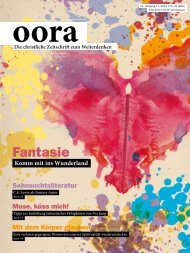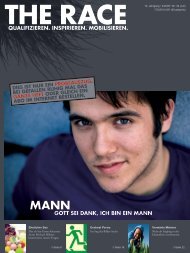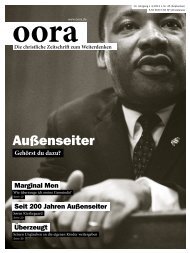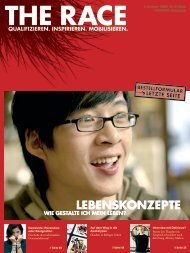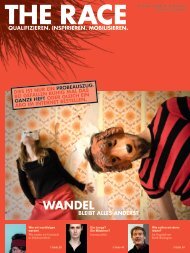oora eBook 42
oora eBook 42
oora eBook 42
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
12. Jahrgang • 4/2011 • Nr. <strong>42</strong> (Dezember)<br />
5,50 EUR/7,50 SFr (Einzelpreis)<br />
www.<strong>oora</strong>.de<br />
THE RACE heißt jetzt <strong>oora</strong><br />
und erscheint viermal pro Jahr<br />
Die christliche Zeitschrift zum Weiterdenken<br />
Anfang<br />
Es geht los<br />
Startup-Power im Doppelpack<br />
Interview mit Claudia Hoppe und Claudia Pelz<br />
Seite 4<br />
Ein magisches Gebet<br />
Ist das Übergabegebet biblisch?<br />
Seite 19<br />
Kann ein Kind denn Sünde sein?<br />
Wenn der Anfang eines Lebens aus Ehebruch entsteht<br />
Seite 12
Urlaub 2012<br />
Rund 250 Freizeiten<br />
<strong>42</strong><br />
NEUE Reiseziel e!<br />
Frühbucher-Vorteile!<br />
Gratiskatalog:<br />
( 0 7052) 933960<br />
ww w. freizeiten-reisen.de<br />
mit tagesaktuellen Infos<br />
... u nd das bie ten wir Ihn en:<br />
Profession elle Organisatio n un<br />
d<br />
40 Jahre Erfahrung<br />
Größter christlicher Reiseveranstalter<br />
Reisen, Übernacht en, E ssen, Besichtig en :<br />
alles aus ein er Hand<br />
Keine versteckt en Kosten<br />
Umfangreicher Reise<br />
service<br />
Täglic h biblisches Programm<br />
Bequeme Buchung: per Telefo n od er Internet<br />
Extra Program m für Kinder un d Teens bei<br />
Familienfreizeiten<br />
Liebenzeller Mission<br />
Freizeiten & Reisen GmbH<br />
Heinrich-Coerper-Weg 2<br />
75378 Bad Liebenzell<br />
info@freizeiten-reisen.de
Inhalt<br />
Editorial<br />
<strong>oora</strong><br />
Artikel, die mit dem Lautsprecher gekennzeichnet sind, gibt es<br />
als Audioversion in iTunes und auf www.<strong>oora</strong>.de/audio.<br />
Schwerpunkt: Anfang<br />
Flitterwochen<br />
4 Startup-Power im Doppelpack<br />
Interview mit Claudia Hoppe und Claudia Pelz<br />
Interview: Johanna WeiSS<br />
8 Im Rhythmus<br />
Das Kirchenjahr – ein verborgener Schatz<br />
Sandra Bils<br />
12 Kann ein Kind denn Sünde sein?<br />
Wenn der Anfang eines Lebens aus Ehebruch<br />
entsteht<br />
Anneke Reinecker<br />
15 Anfang<br />
Lyrik: Daniel Sailer<br />
16 Ohne Anfang und Ende<br />
Zeit als geschaffenes Element begreifen<br />
Robert Pelzer<br />
19 Ein magisches Gebet<br />
Ist das Übergabegebet biblisch?<br />
Jim Gettmann<br />
24 Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne<br />
Unter der Oberfläche<br />
Kolumne: Linda Zimmermann<br />
Details<br />
21 Impressum<br />
22 <strong>oora</strong> braucht dich<br />
Geschenkabo + Fehlerkorrektur<br />
23 Buchrezensionen<br />
Covermotiv: Das künstlerische Motiv auf den Covern dieses<br />
Flipover-Heftes stammt aus den Händen unseres Grafikers<br />
Johannes Schermuly. Es stellt die Lebenswege dar, die wir<br />
Menschen gehen. Umwege, Sackgassen und Wachstumsphasen.<br />
Unsere Wege kreuzen sich dabei unaufhörlich<br />
mit denen anderer Menschen.<br />
// Zieht jemand für einen längeren Zeitraum in ein anderes Land,<br />
so erlebt er dort oft eine emotionale Achterbahnfahrt. Zunächst<br />
ist man von allem fasziniert: Das Essen schmeckt exotisch anders,<br />
der Verkehr ist möglicherweise chaotisch und funktioniert<br />
trotzdem irgendwie und die Menschen haben einen ganz anderen<br />
Lebensrhythmus. Spannend! Doch schon bald – meist nach<br />
etwa drei Monaten – geht einem dieses »andere« zunehmend auf<br />
die Nerven und man fällt in ein Loch. Jetzt bemerkt man, was<br />
einem alles nicht gefällt und es treten alle möglichen Probleme<br />
auf, die damit zu tun haben, dass alles so unglaublich anders<br />
ist. Dieses Phänomen bezeichnet man als »Kulturschock«. Doch<br />
nach einigen Monaten erholt man sich von dieser Krise und beginnt,<br />
die von der Heimatkultur abweichenden Handlungsweisen<br />
zu verstehen und zu akzeptieren. Schließlich folgt die Phase<br />
der Anpassung, in der man sich in die Kultur integriert und anfängt<br />
sich in ihr Zuhause zu fühlen.<br />
Das Wissen um diese Dynamik kann dabei helfen, die zauberhafte<br />
mit »Honeymoonphase« bezeichnete Anfangszeit so richtig<br />
auszukosten. Denn Neues zu entdecken macht lebendig und so<br />
lohnt es sich, Augen, Ohren und Herz zu öffnen und das Neue,<br />
Andere zu umarmen. Ist man dann nach einem langen Tag in<br />
der neuen Kultur einmal reizüberflutet und genervt, so hilft es,<br />
sich erstmal zurückzuziehen und das Erlebte zu verarbeiten. So<br />
kann die Euphorie der Anfangsphase möglichst lange anhalten.<br />
Über diesen Zauber des Anfangs schreibt auch unsere Kolumnistin<br />
Linda auf Seite 24. Sie liebt Neuanfänge und inspiriert<br />
dazu, unbeschriebene Seiten im eigenen Lebensbuch munter zu<br />
gestalten. Auch die Lyrik auf Seite 15 trägt diese Gedanken in<br />
sich. Man lese und staune.<br />
Viele wertvolle Inspirationen beim Lesen wünscht dir<br />
Dein <strong>oora</strong> Redaktionsteam<br />
<strong>oora</strong>.de 3
iszeit<br />
Anfang | Im Rythmus<br />
ewigkeitssonntag<br />
bu - und bettag<br />
reformationsfest<br />
itat<br />
trin<br />
michaelistag<br />
erntedank<br />
sonntage nach<br />
trinitatis<br />
adventszeit<br />
weihnachtskreis<br />
weihnachten<br />
epiphanias<br />
epiphaniaszeit<br />
letzter sonntag nach epiphanias<br />
sonntage vor der<br />
passionszeit<br />
passionszeit<br />
johannis<br />
trinitatis<br />
pf ingsten<br />
himmelfahrt<br />
sterliche<br />
freudenzeit<br />
gr ndonnerstag<br />
karfreitag<br />
ostern<br />
osterkreis<br />
Der evangelische Jahreskreis beginnt mit dem 1. Advent.<br />
8 <strong>oora</strong> 04/11
Im Rythmus | Anfang<br />
Im Rhythmus<br />
Das Kirchenjahr – ein verborgener Schatz<br />
Text: Sandra Bils<br />
Für freikirchliche Christen ist das Kirchenjahr meistens<br />
entweder unbekannt oder unwichtig. Dabei steckt dieser<br />
gottesdienstliche Jahresrhythmus voller Kostbarkeiten.<br />
// Ein beruflich viel beschäftigter Mann erzählte mir diese Woche<br />
von einer Rehamaßnahme, der er sich nach einer Operation<br />
unterziehen musste. Als ich ihn nach der Gestaltung dieser<br />
Auszeit fragte, antwortete er, dass das Schönste nicht die arbeitsfreie<br />
Zeit an sich war, die ihm auf einmal im Überfluss zur<br />
Verfügung stand, sondern die Strukturierung dieser Zeit. Die<br />
festgelegten Tagesabläufe, die für ihn durch die geregelte Abfolge<br />
der Behandlungen und Massagen entstand. »Zu wissen,<br />
wann man was am sinnvollsten machen kann, war enorm entlastend.<br />
Darin lag die größte Stärkung«, sagte er noch immer<br />
sichtlich begeistert.<br />
Rhythmen des Lebens<br />
Vorgeschrieben zu bekommen, was wann zu tun ist, gehört in<br />
unserer individualisierten Zeit nicht zu unseren vordergründigen<br />
Wunschvorstellungen. Andererseits sind wir von Rhythmen<br />
des Lebens umgeben und mitunter auch sehr dankbar dafür.<br />
Rhythmen geben unserem Alltag Struktur und verhindern, dass<br />
wir in ewiger Gleichförmigkeit verloren gehen. Unserem Zeitempfinden<br />
ab und an ein paar Ankerpunkte zu liefern, hilft, das<br />
Gleichgewicht zwischen creatio und recreatio herzustellen. Und<br />
vor allem: im Hamsterrad des Alltags die wirklich wichtigen<br />
Dinge nicht aus dem Blick zu verlieren.<br />
Räume sind wahrzunehmen zwischen den Schlägen unseres<br />
Herzens, zwischen zwei Atemzügen, Rhythmen von Wachen<br />
und Schlafen, von Hungergefühl und Sättigung. Neben diesen<br />
biologischen Rhythmen sind wir auch von kosmischen Rhythmen<br />
umgeben: Helligkeit und Dunkelheit, Tag und Nacht, Ebbe<br />
und Flut und natürlich dem Wechsel der Jahreszeiten.<br />
Die Zeiterfahrung in der Wahrnehmung kosmischer sowie biologischen<br />
Rhythmen führte schon früh zur Entwicklung von<br />
Traditionen und Brauchtum. Eng an das Naturjahr gekoppelt<br />
entstanden Feste, um die hervorgehobenen Ankerpunkte im<br />
Alltag zu begehen und zu feiern.<br />
Jüdische Wurzeln<br />
Im frühen Israel wurden diese Feste im Naturjahr mit der Heilsgeschichte<br />
Israels verbunden. So wurde sichergestellt, dass eben<br />
diese Heilsgeschichte dem Volk Israel alljährlich vor Augen<br />
stand. Diese »Vergeschichtlichung« bildete die Basis für das, was<br />
wir heute Kirchenjahr nennen.<br />
An zwei Stellen berührt das christliche Festjahr eng den jüdischen<br />
Festkalender, auf dem es gründet: Das jüdische Passafest,<br />
durch neutestamentliche Deutungen ohnehin eng mit Tod und<br />
Auferstehung Jesu verbunden, wurde zum Ansatzpunkt des<br />
christlichen Osterfestes. Das sieben Wochen später stattfindende<br />
jüdische Wochenfest wurde, verknüpft mit der Sendung des<br />
Heiligen Geistes und der Gründung der ersten Gemeinde, zum<br />
Hintergrund für das christliche Pfingstfest.<br />
Unserem Zeitempfinden ab und an<br />
ein paar Ankerpunkte zu liefern,<br />
hilft, das Gleichgewicht zwischen<br />
creatio und recreatio herzustellen.<br />
In Anlehnung an den jüdischen Sabbat hat sich im Christentum<br />
der Sonntag als Versammlungstag herausgebildet, der den Akzent<br />
auf die Gemeinschaft legt. Über die Jahrhunderte wurden<br />
die einzelnen Sonntage und herausragenden Feiertage im Jahr<br />
dann in eine feste Abfolge gebracht – das Kirchenjahr, wie wir<br />
es heute kennen. Ähnlich den Jahreszeiten Frühling, Sommer,<br />
Herbst und Winter bietet das Kirchenjahr einen Rahmen, der<br />
sicherstellt, dass alle wichtigen heilsgeschichtlichen Elemente<br />
jedes Jahr ihren Platz finden.<br />
Kirchenjahreskreis<br />
Da wohlmöglich nicht jeder in gleicher Weise mit dem Kirchenjahr<br />
vertraut ist, stelle ich nun einmal die wichtigsten Elemente<br />
<strong>oora</strong>.de 9
Anfang | Im Rythmus<br />
trinitatis<br />
passionszeit<br />
Ähnlich den Jahreszeiten<br />
Frühling, Sommer, Herbst und Winter<br />
bietet das Kirchenjahr einen Rahmen,<br />
johannis<br />
trinitatis<br />
pf ingsten<br />
der sicherstellt, dass alle wichtigen heilsgeschichtlichen Elemente<br />
jedes Jahr ihren Platz finden.<br />
himmelfahrt<br />
sterliche<br />
freudenzeit<br />
gr ndonnerstag<br />
karfreitag<br />
ostern<br />
reis<br />
Innerevangelisch-ökumenische Perspektiven<br />
Im Hinblick auf das Kirchenjahr aus freikirchlicher Perspektive<br />
könnte nun gefragt werden, ob jene kirchenjahreszeitlich geprägten<br />
Ordnungen ein zu enges und beschränkendes Korsett<br />
darstellen. Ob sie die Verkündigung einengen und zu wenig<br />
Raum für das Wirken des Geistes und das Eingehen auf aktuvor.<br />
Seinen Anfang nimmt das Kirchenjahr mit der Adventszeit<br />
und dem ersten Adventssonntag, als Vorbereitung auf das Zur-<br />
Welt-Kommen Gottes an Weihnachten in der Ankunft Jesu. Die<br />
Adventszeit geht am Heiligen Abend, dem Vorabend zum eigentlichen<br />
Festtag am 25. Dezember, in die Weihnachtszeit über.<br />
Die Menschwerdung Gottes steht im Mittelpunkt. In der darauf<br />
folgenden Epiphaniaszeit (epiphaínein, griech. erscheinen) steht<br />
die Erscheinung und Göttlichkeit Jesu im Vordergrund.<br />
Der daran anschließende Osterfestkreis bildet das Herzstück<br />
des Kirchenjahres. Er beginnt am Aschermittwoch mit der<br />
40-tägigen Fasten- bzw. Passionszeit, in der dem Leiden und<br />
Sterben Jesu gedacht wird, und findet den Höhepunkt in der<br />
Osterwoche mit Gründonnerstag als Erinnerungstag an die<br />
Einsetzung des Abendmahls, Karfreitag in Gedenken an den<br />
Tod Jesu am Kreuz sowie Ostersonntag als Jubeltag der Auferstehung<br />
Jesu. Die Osterzeit erstreckt sich bis in die Feier von<br />
Himmelfahrt als Abschiedsfest der Jünger von Jesus vierzig<br />
Tage nach seiner Auferstehung sowie Pfingsten, dem die Ausgießung<br />
des Heiligen Geistes und die Gründung der ersten Gemeinde<br />
zugrunde liegt.<br />
Nun beginnt die Trinitatiszeit, in der die Dreieinigkeit Gottes<br />
gefeiert wird (trinitas, lat. Dreifaltigkeit). Die Trinitatiszeit erstreckt<br />
sich über die gesamten Sommermonate und mündet im<br />
Herbst in das Ende des Kirchenjahres mit der Feier des Erntedankfestes,<br />
des Reformationsfestes (Erinnerung an den Thesenanschlag<br />
Luthers und die damit begründete Reformation), des<br />
Buß- und Bettages, des Volkstrauertages (Gedenken an die in<br />
Kriegen Verstorbenen) sowie des Ewigkeitssonntages (Gedenktag<br />
der Verstorbenen) als Abschluss des Kirchenjahres.<br />
Die liturgische Ausgestaltung des Gottesdienstes<br />
Dieser Kirchenjahreskreis wird sowohl in der katholischen Kirche<br />
als auch in den evangelischen Landeskirchen in den Gottesdiensten<br />
liturgisch gestaltet. Im 19. Jahrhundert fanden in<br />
den amtlichen Agenden, den »Drehbüchern« der Gottesdienste<br />
dieser Landeskirchen, erstmals kirchenjahreszeitlich geprägte<br />
Vorschläge Einzug. So wurde den stets gleichbleibenden Teilen<br />
des Gottesdienstes, dem sogenannten Ordinarium (lat. das Wiederkehrende),<br />
ein spezifisches Proprium (lat. das Wesentliche)<br />
zugeordnet und dadurch jedem einzelnen Gottesdienst ein individuelles<br />
Gepräge gegeben.<br />
Die Profilierung eines Sonn- und Festtages geschieht konkret<br />
durch die Ausgestaltung der Proprien und darin zuallererst<br />
durch die Auswahl der Schriftlesungen. Von der bisherigen Praxis<br />
der Bahnlesungen (fortlaufende Lesungen) wurde damals<br />
abgewichen, hin zu einer Auswahl eines biblischen Textes mit<br />
Festtagsbezug. Seit 1978 schließlich haben die gottesdienstlichen<br />
Bibelleseausgaben stärkere inhaltliche Zusammenhänge.<br />
Ausgehend vom Evangeliumstext wurden eine inhaltlich dazu<br />
passende Lesung aus den neutestamentlichen Briefen (Epistel)<br />
und dem Alten Testament gewählt. Der Predigttext ergibt sich<br />
aus einer Ordnung, die sechs Jahresreihen umfasst. Die Basistexte<br />
sind somit alle sechs Jahre wiederkehrend.<br />
Weiter nennt das Proprium des Sonntags einen Wochenspruch<br />
sowie ein Wochenlied, das sogenannte Graduallied, weil es oftmals<br />
zwischen den Lesungen gesungen wird. Außerdem wird<br />
ein Wochenpsalm und eine bestimmte kirchenjahreszeitlich bestimmte<br />
liturgische Farbe vorgeschlagen, die zum Beispiel für die<br />
Wahl der Paramente (Altar- und Kanzelbekleidung) und der farblichen<br />
Gestaltung des Gottesdienstraumes Hilfestellungen gibt,<br />
weil sie den farblichen Charakter des Sonntags sichtbar macht. So<br />
ist beispielsweise Weiß als »Christusfarbe« für die Weihnachtsund<br />
Epiphaniaszeit, Rot als Farbe des Feuers an Pfingsten, Violett<br />
als »Bußfarbe« für die Advents- und Passionszeit, Schwarz für<br />
den Karfreitag und Grün als Farbe der Hoffnung für die übrigen<br />
Sonntage in der allgemeinen Kirchenjahreszeit gedacht.<br />
Neben diesem spezifischen Profil als Branding des Sonntags<br />
in Text, Musik und Farbe, wird zum Teil auch die reguläre Liturgie<br />
(Ordinarium) dem Kirchenjahr angepasst. An Karfreitag<br />
als traurigem Tiefpunkt des Kirchenjahres etwa werden die<br />
sonst klassischen liturgischen Lobgesänge Gloria Patri (Ehre sei<br />
dem Vater und dem Sohn), Gloria in excelsis (Ehre sei Gott in<br />
der Höhe) und das Halleluja nach der Epistellesung weggelassen.<br />
Vielerorts schweigen auch Glocken und Orgel, der Altar ist<br />
schmucklos ohne Blumen, Kerzen und Paramente.<br />
10<br />
<strong>oora</strong> 04/11
osterk<br />
Womit möchtest<br />
du nächstes Jahr<br />
anfangen?<br />
elle Themen und Bedürfnisse lassen. Man könnte fragen, ob innerhalb<br />
der Vorgaben durch das kirchenjahreszeitliche Gepräge<br />
Themen, wie zum Beispiel das Kreuz, Vergebung, Mission oder<br />
andere wichtige Fragestellungen zu kurz kommen, weil sie nur<br />
nebenbei in den Ablauf des Jahres eingewoben sind? Ob man<br />
sich daher doch eher die Vorteile einer relativ ungebundenen<br />
und kreativeren Art, Gottesdienste zu planen, lobt?<br />
Der wiederkehrende Rahmen des Kirchenjahres ist die Grundlage<br />
meines liturgischen Berufsalltags als lutherische Gemeindepastorin.<br />
Ich traue dem Heiligen Geist durchaus zu, durch die<br />
Jahrhunderte alte Kultur von Liturgie und Kirchenjahr wirken zu<br />
können. Ich schätze, dass Wiederkehrendes den Gottesdienstbesuchern<br />
vertraut wird und so geistliche Heimat und Verwurzelung<br />
darstellen kann. Für mich ist diese traditionell gewachsene<br />
und biblisch basierte Leseordnung ein großer Schatz des christlichen<br />
Glaubens, die dem Evangelium innerhalb unserer menschlichen<br />
Zeiterfahrung eine kulturelle Gestalt zu geben vermag.<br />
Das Kirchenjahr – für viele, die nicht stark kirchenjahresspezifisch<br />
gebunden sind, ist und bleibt es das große Unbekannte<br />
oder gar Einengung der Freiheit des Geistes. Und für andere<br />
die Gewähr, dass genau dieser Geist auch wirklich zur Sprache<br />
kommt – und nicht nur die aktuellen Lieblingsthemen seiner<br />
Verkündigerinnen und Verkündiger. ///<br />
Zum Weiterforschen:<br />
› Impulse für das Leben nach dem Kirchenjahr findet man hinten in jedem<br />
Evangelischen Gesangbuch und im Internet unter de.wikipedia.org/wiki/Kirchenjahr<br />
› Das Buch »Das Kirchenjahr« von Karl-Heinrich Bieritz, dem dieser Artikel viele<br />
Informationen verdankt, entfaltet das Themenfeld noch tiefgehender und eignet sich<br />
gut für eine umfangreichere Einarbeitung.<br />
Dany, 30<br />
Ansbach<br />
»Ich möchte mich nächstes Jahr konkret damit beschäftigen<br />
in welcher Form ich mich beruflich weiter qualifizieren<br />
werde und das dann auch umsetzen. Das war schwer<br />
– ich bin nämlich eigentlich niemand, der sich Vorsätze<br />
für ein neues Jahr macht, dass passiert eher kontinuierlich,<br />
dass ich Ideen habe, mit was ich anfangen könnte.«<br />
Martin, 33<br />
Pfedelbach<br />
»Nach über sechs Jahren berufs- und familienbegleitendem<br />
Fernstudium, möchte ich gerne mit meiner Bachelorarbeit<br />
beginnen und somit das Ende meines Studiums<br />
einläuten.«<br />
Sandra Bils (34) ist evangelische Theologin und arbeitet als Pastorin in der<br />
Kirchengemeinde St. Nicolai in Gifhorn. Sie schätzt das liturgische Erbe ihrer<br />
Kirche und mag ihre Gottesdienste kreativ und vielseitig gestalten. Sandra engagiert<br />
sich im Koordinationskreis von Emergent Deutschland und bloggt unter<br />
www.pastorsandy.de<br />
Svenja, 35<br />
Berlin<br />
»Ich werde im nächsten Jahr nach dann sieben Jahren<br />
Elternzeit einen Neuanfang ins Berufsleben wagen. Freude<br />
und Furcht halten sich bei dem Gedanken daran momentan<br />
noch die Waage …«<br />
<strong>oora</strong>.de 11
Anfang | Ohne Anfang und Ende<br />
Ohne Anfang und Ende<br />
Zeit als geschaffenes Element begreifen<br />
Text: Robert Pelzer<br />
Der Gedanke an die Ewigkeit kann uns verrückt machen,<br />
weil wir so sehr auf Anfang und Ende gepolt sind, dass<br />
wir uns ein Leben ohne Ende kaum vorstellen können.<br />
Beobachtungen aus der Quantenphysik bieten dabei<br />
einen alternativen Blickwinkel.<br />
// Das Leben ist kurz. Diese Aussage haben wir mit Sicherheit<br />
schon oft gehört. Sie will uns wohl dazu auffordern, möglichst<br />
viele tolle Erfahrungen in der uns zur Verfügung stehenden Zeit<br />
mitzunehmen und das scheinbar so kurze Leben bis zum Maximum<br />
auszukosten. Und auch zu bedenken, dass es irgendwann<br />
zu spät dafür sein kann. Zu spät, weil dann etwas vorbei ist – die<br />
Lebensuhr ist dann abgelaufen. Finito.<br />
Ohne Zweifel ist unser irdisches Dasein zeitlich stark begrenzt<br />
– wir leben einen winzigen Abschnitt auf einem sehr langen<br />
Zeitstrahl. In einem Schulbuch für Geschichte hätten wir wahrscheinlich<br />
selbst mit einer Lupe Mühe, die kurze Weile, die unserem<br />
Leben entspricht, auf diesem Zeitstrahl zu finden. Ob dieser<br />
Abschnitt tatsächlich so winzig ist oder nicht, sei einmal dahingestellt.<br />
Das ist ja irgendwie auch Wahrnehmungssache. Empfindet<br />
eine Alltagsfliege ihr Leben als kurz? U2-Sänger Bono sagt in<br />
einem Lied treffend: »Das Leben ist kurz, aber es ist das längste,<br />
was du jemals tun wirst« 1 . Fakt ist, dass wir gerade jetzt am Leben<br />
sind. Die Uhr tickt, und alles bewegt sich nach vorn. Die Mühle<br />
dreht sich beständig, und niemand kann sie anhalten.<br />
Doch im krassen Gegensatz zu der Beerdigungsformel »Asche zu<br />
Asche und Staub zu Staub«, welche die Endlichkeit unseres irdischen<br />
Seins ausdrückt, steht das göttliche »von Ewigkeit zu Ewigkeit«.<br />
Ein Ausdruck, mit dem die Bibel wenig geizt. Der gläubige<br />
Mensch, der das ewige Leben empfängt, welches Jesus anbietet,<br />
bekommt eine neue Sichtweise: Er wird sein irdisches Leben immer<br />
noch als zeitlich begrenzt wahrnehmen, aber er glaubt hoffnungsvoll<br />
an eine Fortsetzung. Nicht jedoch in Form einer Zugabe,<br />
die nur gegeben wird, weil alle Engel rufen »One more song«,<br />
sondern vielmehr als ein nicht endendes Dasein, eine ewige Existenz.<br />
Bei dieser Vorstellung wird uns, wenn wir wirklich einmal<br />
versuchen uns das vorzustellen, schwindelig, weil wir nichts dergleichen<br />
kennen. Bei uns hat alles einen Anfang und ein Ende.<br />
Mit dem Urknall fing alles an, irgendwann explodiert die Sonne<br />
und dann macht auch der Letzte das Licht aus. Ewigkeit hingegen<br />
bringt eine neue Perspektive mit sich. Diese Perspektive lässt uns<br />
rauszoomen, lässt unsere Sorgen und die vermeintliche Wichtigkeit<br />
unserer Probleme kleiner erscheinen. Vor allem jedoch erhebt<br />
uns das Bewusstsein der eigenen, uns von Gott geschenkten<br />
Ewigkeit, über den Staub und die Asche hinweg.<br />
Gott drückt diese Ewigkeit sogar in seinem Namen aus: Ich bin.<br />
Punkt. Als Jesus eben diese Worte benutzt, um sich den römischen<br />
Soldaten vorzustellen, fallen diese schier zu Boden. 2 Eine<br />
eindrückliche Demonstration der Kraft hinter diesem einfachen<br />
»Ich bin«. Mose, der am Berg Sinai live dabei ist als Gott sagt »Ich<br />
16<br />
<strong>oora</strong> 04/11
Ohne Anfang und Ende | Anfang<br />
Was, wenn Zeit ein geschaffenes<br />
Element ist, das in der Ewigkeit<br />
irrelevant ist, nicht deshalb, weil<br />
enorm viel Zeit zur Verfügung steht,<br />
sondern weil das Konzept Zeit<br />
nicht mehr greift?<br />
bin«, schreibt später in einem Psalm an Gott: »Du bist von Ewigkeit<br />
zu Ewigkeit.« 3 Eine andere Übersetzung lautet hier sehr treffend:<br />
»Du bist ohne Anfang und ohne Ende.«<br />
Nun stellen wir uns also die Ewigkeit als einen Zeitstrahl ohne<br />
Anfang und ohne Ende vor. Doch anscheinend kann sich Gott<br />
auf diesem Strahl beliebig bewegen, zumindest weiß er, was in<br />
drei Tagen sein wird und sowieso, was gestern war. Tausend<br />
Jahre sind für ihn wie ein Tag und doch bekommt er jeden der<br />
50 Flügelschläge pro Sekunde beim Flug des Kolibris mit.<br />
Was ist jedoch, wenn wir Ewigkeit nicht als endlosen Zeitstrahl<br />
definieren, sondern vielmehr als die Abwesenheit von Zeit, als<br />
einen Zustand, in dem Zeit keine Rolle spielt? Was, wenn Zeit<br />
ein geschaffenes Element ist, das in der Ewigkeit irrelevant ist,<br />
nicht deshalb, weil enorm viel Zeit zur Verfügung steht, sondern<br />
weil das Konzept Zeit nicht mehr greift?<br />
Quantenphysik<br />
Dass dieser Gedanke nicht völlig irrwitzig ist, begreifen wir,<br />
wenn wir uns einmal der Physik zuwenden. Mag diese uns im<br />
Alltag eher selten tangieren, so katapultiert uns die bewusste<br />
Beschäftigung vor allem mit der Quantenphysik gedanklich gewaltig<br />
über den Tellerrand des Erfahrbaren hinaus.<br />
Vielleicht haben wir schon einmal vom Zwillingsparadoxon<br />
gehört, einem Gedankenexperiment, das veranschaulichen<br />
soll, was passieren würde, wenn man das Experiment genauso<br />
durchführen könnte. Es geht bei diesem Experiment um ein<br />
Zwillingspaar, von denen einer der beiden in eine Raumkapsel<br />
steigt und mit nahezu Lichtgeschwindigkeit in Richtung eines<br />
weit entfernten Sterns davonfliegt. Nach einem Monat kehrt er<br />
zurück und stellt fest, dass sein Zwillingsbruder bereits ein alter<br />
Mann ist – auf der Erde sind viele Jahre vergangen.<br />
In der »speziellen Relativitätstheorie« beschreibt Albert Einstein,<br />
dass Raum und Zeit relativ sind – sie hängen von der Bewegung<br />
des Betrachters ab. Für jemanden, der sich nicht bewegt, herrscht<br />
eine andere Realität bezüglich Raum und Zeit als für jemanden,<br />
der sich bewegt. Anhand von hochpräzisen Atomuhren kann der<br />
Effekt des Zwillingsparadoxons sogar auf Atlantikflügen nachgewiesen<br />
werden. Die anschließend festgestellte Zeitdifferenz<br />
der Uhren ist jedoch verschwindend gering, da die Flugzeuggeschwindigkeit<br />
gegenüber der Lichtgeschwindigkeit von über einer<br />
Milliarde Kilometer pro Stunde kaum ins Gewicht fällt.<br />
Mit der Relativität des Raumes und der Zeit ist also nicht die<br />
bloße Wahrnehmung gemeint, wie wenn beispielsweise ein<br />
Rennfahrer durch eine Allee heizt, die Bäume nur so an ihm<br />
vorbeifliegen und ihm die Strecke kürzer vorkommt als sie eigentlich<br />
ist. Sehr schnell bewegte Objekte erleben eine tatsächliche<br />
Stauchung des Raumes, die sogenannte Lorentzkontraktion.<br />
Und sie erleben eine Dehnung der Zeit, die Zeitdilatation. Im<br />
Grunde genommen sind Lorentzkontraktion und Zeitdilatation<br />
verwandt, weswegen man in der Quantenphysik Zeit und Raum<br />
zur Raumzeit zusammenfasst.<br />
Einsteins Theorie wurde mittlerweile mehrfach bewiesen. Mit ihr<br />
lassen sich auch Phänomene verstehen, die mit »gesundem Menschenverstand«<br />
und der klassischen Physik nicht erklärbar sind.<br />
Ein Beispiel dafür sind die sogenannten Myonen, kosmische Teilchen,<br />
die mit annähernder Lichtgeschwindigkeit in die Erdatmosphäre<br />
eintreten. Nach Eintritt in die Atmosphäre haben diese<br />
Teilchen bis zu ihrem Verfall nur eine sehr geringe Lebensdauer.<br />
Da man ihre Geschwindigkeit und die Lebensdauer innerhalb<br />
unserer Atmosphäre kennt, kann man mit einfacher, klassischer<br />
Physik die Strecke bestimmen, die die Myonen bis zum Zerfall<br />
zurücklegen können. Man kommt auf nur wenige hundert Meter.<br />
Tatsächlich jedoch herrscht für diese rasend schnellen Teilchen<br />
eine andere Realität. Sie befinden sich in einem anderen sogenannten<br />
Inertialsystem – die Zeit in ihrer Realität ist gedehnt,<br />
vergeht also langsamer, so dass sie tatsächlich bis zur Erdober-<br />
<strong>oora</strong>.de 17
Anfang | Ohne Anfang und Ende<br />
Wenn selbst Geschwindigkeit und<br />
übrigens auch Gravitation verschiedene<br />
Realitäten für das Vergehen von Zeit<br />
bewirken, erkennen wir Zeit als<br />
geschaffenes Element in der Hand<br />
des Schöpfers.<br />
fläche kommen. Und das, obwohl auf unserer Stoppuhr der Zeitpunkt<br />
ihres Zerfalls schon längst verstrichen ist.<br />
Alles relativ<br />
Phänomene wie diese stellen den Absolutheitsanspruch unserer<br />
Wahrnehmung in Frage. Wir sind uns hundertprozentig sicher,<br />
dass das Licht der Sonne die Erde nach etwa 8 ½ Minuten erreicht<br />
und dass Photonen von diesem bis zu jenem Stern soundso viele<br />
Jahre brauchen. Damit haben wir absolut relativ Recht. Aus der<br />
Perspektive von Licht vergeht nämlich keine einzige Sekunde, um<br />
von hier nach dort zu kommen. Im Inertialsystem des Lichts ist<br />
Licht überall gleichzeitig, es vergeht gar keine Zeit. Für Licht existiert<br />
Zeit nicht – die Uhren, die mit Lichtgeschwindigkeit durchs<br />
All flögen, blieben stehen. Doch Uhren sind auch nur periodische<br />
Systeme, wie auch die Zerfallsstrukturen unseres Körpers.<br />
Elektronen kreisen um Atomkerne, Atome gehen verschiedene<br />
Verbünde ein, wobei es wiederum zu chemischen Reaktionen<br />
kommt. Wir altern. Aber wer hat denn nun Recht? Derjenige, der<br />
sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt und keine Zeit kennt, oder<br />
der ruhende Beobachter, für den Zeit sehr wohl real ist?<br />
Selbst der Quantenphysiker und Nobelpreisträger Feynman<br />
sagte einmal von sich, dass er die Quantenphysik nicht mit Sicherheit<br />
verstünde. 4 Wir müssen uns also nicht wundern, wenn<br />
wir in Anbetracht dieser Dinge Gehirnfasching bekommen.<br />
Wir können uns lediglich herantasten und zulassen, dass die<br />
Absolutheit unseres Modells für Zeit zu bröckeln beginnt. Obwohl<br />
sich dieses »So-verläuft-die-Zeit-nun-mal-Modell« durch<br />
Erfahrungen immer wieder bestätigt und für unser Leben hier<br />
nicht fortzudenken ist, können die quantenphysikalischen Aspekte<br />
uns helfen, das Konzept »Zeit« als das wahrzunehmen,<br />
was es ist: als relativ. Wenn selbst Geschwindigkeit und übrigens<br />
auch Gravitation verschiedene Realitäten für das Vergehen von<br />
Zeit bewirken, erkennen wir Zeit als geschaffenes Element in der<br />
Hand des Schöpfers. Dieser Schöpfer wird ja nicht einmal durch<br />
dieses, sein eigenes, Universum begrenzt und ist erst Recht nicht<br />
an die Gesetzmäßigkeiten und Naturgesetze darin gebunden.<br />
Gott hält die Unendlichkeit des Raums in seiner Hand. Und er<br />
hält Zeit in seiner Hand. Diese Erkenntnis vermag es vielleicht<br />
nicht, unser irdisches Leben auch nur um einen einzigen Tag zu<br />
verlängern, aber sie lässt uns ein wenig über den stumpfen Tellerrand<br />
des Alltags hinwegschauen und erkennen, dass da mehr ist,<br />
als nur der straff gespannte Bogen zwischen Staub und Staub, auf<br />
dem wir uns gerade bewegen. Immerhin ist ein essentieller Teil<br />
von uns zeitlos. Der weise König Salomo schreibt bereits, dass uns<br />
Ewigkeit ins Herz gelegt worden ist. 5 Von Ewigkeit zu Ewigkeit.<br />
Ohne Anfang und ohne Ende, einfach nur: Ich bin. ///<br />
Fußnoten:<br />
1 U2 – »Moment of Surrender«, Live at the Rose Bowl<br />
2 Johannes 18,6<br />
3 Psalm 90,2<br />
4 Original engl.: »[…] I think I can safely say nobody understands Quantummechanics« –<br />
The Character of Physical Law. MIT Press, 1967, Kapitel 6, zitiert nach Anthony J. G. Hey et. al.:<br />
The new Quantum Universe. Cambridge University Press, 2003, Seite 335<br />
5 Prediger 3,11<br />
Robert Pelzer (29) lebt mit seiner Frau Tirza und dem Töchterchen Timea in<br />
Berlin. Er arbeitet als Ingenieur in einem Medizintechnikunternehmen, am<br />
liebsten jedoch spielt er Gitarre und philosophiert über das Leben mit Gott<br />
und dessen Reich.<br />
18<br />
<strong>oora</strong> 04/11
Ein magisches Gebet | Anfang<br />
Ein magisches Gebet<br />
Ist das Übergabegebet biblisch?<br />
Text: Jim Gettmann<br />
Allgemein gilt es als der offizielle Anfang eines Lebens als<br />
Christ – das Lebensübergabegebet. Doch ist es wirklich<br />
biblisch begründet? Eine kritische Betrachtung.<br />
// Wie wird man Christ? Die Antwort auf diese Frage ist für die<br />
meisten von uns kein Geheimnis. »Gott hat keine Enkelkinder«<br />
wurde uns von klein auf beigebracht – und deshalb muss jeder<br />
Mensch selbst Gott kennenlernen und sich für ihn entscheiden.<br />
Dies geschieht typischerweise folgendermaßen: Irgendwann ist<br />
man soweit, dass man sagen kann »Ich glaube an Jesus Christus<br />
als Gottes Sohn und Heiland.« Jetzt betet man ein Übergabegebet.<br />
Und schon ist man Christ geworden.<br />
Das Übergabegebet kann unterschiedlich formuliert werden,<br />
meist klingt es aber in etwa so: »Vater im Himmel, ich bekenne,<br />
dass ich ein Sünder bin und dass ich einen Heiland brauche. Ich<br />
glaube, dass Jesus Christus für mich gekreuzigt wurde und von<br />
den Toten auferstanden ist, damit ich ewig leben darf. Ich nehme<br />
ihn heute als meinen Heiland und Herrn an. Danke, dass ich<br />
dein Kind sein darf. Amen.«<br />
Eine sichere Fahrkarte in den Himmel?<br />
Ist man nach dem Sprechen dieses Gebetes wirklich gerettet<br />
und automatisch ein Himmelsbürger? Aufgrund meiner Erfahrungen<br />
halte ich das für fragwürdig.<br />
Im Laufe der Jahre war ich bei vielen evangelistischen Veranstaltungen<br />
dabei. Ich habe dabei oft beobachtet, dass die Mehrheit<br />
derer, die auf einen Aufruf reagieren, so gut wie keine Ahnung<br />
davon hat, was sie gerade machen. Sie wissen meist wenig<br />
von der Kreuzigung und Auferstehung Jesu und sind selten<br />
wirklich bereit, ihr Leben vor ihm hinzulegen. Von Buße und<br />
Umkehr gibt es kaum Zeichen. Man könnte höchstens behaupten,<br />
dass diese Menschen von den Aussagen des Predigers angetan<br />
sind und nun Gott ein Signal schicken wollen, dass sie ihn<br />
kennenlernen möchten. Und das ist toll! Für viele Menschen<br />
ist so ein Signal-Abgeben ein echtes Schlüsselerlebnis auf ihren<br />
Weg zu Gott.<br />
Wenn ich Gelegenheit hatte, solche Menschen in den darauf folgenden<br />
Monaten zu begleiten, stellte ich oft fest, dass ihre wahre<br />
Bekehrung viel später stattfand. »Na gut«, könnte man sagen,<br />
<strong>oora</strong>.de 19
Anfang | Ein magisches Gebet<br />
Die Mehrheit derer,<br />
die auf einem Aufruf reagieren,<br />
hat so gut wie keine Ahnung davon,<br />
was sie gerade machen.<br />
»zumindest haben sie sich am Ende doch bekehrt.« Aber was<br />
ist mit den vielen, die niemanden haben, der sie weiterführen<br />
kann? Viele von ihnen sind wahrscheinlich trotzdem der Meinung,<br />
einen Platz im Himmel sicher zu haben, nur weil sie ein<br />
Gebet gesprochen haben und ihnen danach ein Mitarbeiter oder<br />
Pastor bestätigt hat, dass sie nun Christ geworden sind.<br />
Wenn jedoch keine tatsächliche Lebensumkehr stattfindet und<br />
keine Beziehung zum lebendigen Gott erkennbar ist, kann man<br />
dann noch behaupten, dass eine Person sich bekehrt hat? Was<br />
ist mit den Worten Johannes des Täufers: »So bringt nun Früchte,<br />
die der Buße würdig sind«?<br />
Die Bibel kennt kein übergabegebet<br />
Erstaunlicherweise findet man in der Bibel weder eine Anweisung<br />
noch ein Beispiel für ein Lebensübergabegebet. Am nächsten<br />
kommt dem Jesu Geschichte von den zwei Betern: Der eine<br />
ist sehr religiös und stolz auf seine Frömmigkeit. Dem anderen<br />
ist klar, dass er Gott nichts zu bieten hat und betet einfach: »Gott,<br />
sei mir Sünder gnädig!« Jesus will uns mit dieser Geschichte jedoch<br />
nicht zeigen, wie wir gerettet werden, sondern verdeutlichen,<br />
dass Demut besser ist als eine heuchlerische Frömmigkeit.<br />
Statt uns eine Vorlage für ein Übergabegebet zu liefern, verpasst<br />
Jesus sogar eine superevangelistische Gelegenheit, als ein Mann<br />
zu ihm kommt und ihn fragt, wie er gerettet werden könne. Was<br />
macht Jesus? Er stellt ihm dermaßen unmögliche Forderungen,<br />
dass der Mann traurig weggeht. Jesus hat die Frechheit, von dem<br />
Mann zu verlangen, dass er zuerst sein Geld verschenken und<br />
ihm erst dann nachfolgen soll.<br />
Da stellt sich die Frage, ob wir es den Menschen zu leicht machen,<br />
sei es, weil wir hoffen, dass möglichst viele errettet werden<br />
oder weil wir unter einem missionarischen Erfolgsdruck stehen?!<br />
Wir tun den Leuten keinen Gefallen, wenn wir sie überreden,<br />
uns ein Gebet nachzusprechen, in der Hoffnung, dadurch ihr<br />
Leben vor der Hölle zu retten. Stattdessen sollten wir ihnen Unterstützung<br />
und Freiraum geben, um in den Glauben hinein zu<br />
wachsen. Jeder muss die Kosten überschlagen, weil das Leben<br />
sich völlig ändert, wenn man anfängt Jesus nachzufolgen.<br />
Ursprünge des Übergabegebets<br />
Trotz fehlender biblischer Belege gilt Vielen das Übergabegebet<br />
wie selbstverständlich als »der offizielle Weg«, um ein Leben mit<br />
Gott zu beginnen. Deshalb ist es mir wichtig, die historischen<br />
Hintergründe dafür zu erforschen. Wann hat dieser Brauch begonnen?<br />
Und was war der Grund für seine Entstehung?<br />
Das Übergabegebet war eine Erfindung der Erweckungsprediger<br />
des 18. und 19. Jahrhunderts, wie zum Beispiel John Wesley,<br />
George Whitefield, Charles Finney und Dwight Moody.<br />
Diese Prediger standen vor folgenden Fragen: Wie bringen wir<br />
Suchende dazu, zu erkennen, dass eine Entscheidung für Gott<br />
notwendig ist, obwohl sie bereits einer christlichen Kultur angehören?<br />
Wie soll dieser neue Anfang gestaltet werden, so dass<br />
für sie deutlich wird, »vorher war ich von Gott getrennt, ab jetzt<br />
gehöre ich ihm«?<br />
Eine Methode, die Mitte des 18. Jahrhunderts aufkam, nannte<br />
Charles Finney den »Sitz der Bestrebten«. Er reservierte die erste<br />
Reihe der Kirchenbänke für Suchende, so dass diejenigen, die<br />
auf den Altarruf reagierten, nach vorne kommen und sich dort<br />
hinsetzen konnten, während der Prediger sie weiter ermahnte<br />
»in die Errettung durchzubrechen«. Diese Methode wurde<br />
bald als emotional manipulativ erkannt. Moody veränderte<br />
sie deshalb etwas, so dass die Suchenden nach dem Altarruf<br />
einen separaten Raum aufsuchen konnten. Dort wurde ihnen<br />
von geschulten Beratern noch einmal das Evangelium erklärt.<br />
Hauptsache war, dass die Suchenden danach zum Sprechen eines<br />
Gebets gebracht wurden. Seitdem ist es weit verbreitet, den<br />
Prozess der Errettung mit einem Gebet zu vollenden, und bereits<br />
vor dem Ende des 19. Jahrhunderts galt dieses Gebet in<br />
Amerika und Großbritannien allgemein als die Standardtechnik,<br />
um »Jesus im Herzen zu empfangen«.<br />
Billy Graham und Bill Bright trugen diese Ideen im 20. Jahrhundert<br />
weiter. Sie versuchten, die Not der Suchenden und Gottes<br />
Antwort darauf, kurz und prägnant darzustellen. Ihre Erklärung<br />
von Gottes Heilsplan fand in einer Broschüre namens »Die<br />
vier geistlichen Gesetze« weite Verbreitung und endete mit dem<br />
Gebet, das uns heute als Übergabegebet bekannt ist.<br />
20<br />
<strong>oora</strong> 04/11
Impressum<br />
Das Übergabegebet als Ersatz<br />
Könnte es sein, dass dieses Gebet ein Ersatz für die Glaubenstaufe<br />
geworden ist? Finney gab das selbst zu. Er meinte, die Apostel hätten<br />
im ersten Jahrhundert die Taufe als Zeichen der Lebensübergabe<br />
angeboten, er hingegen nutze dafür den Sitz der Bestrebten.<br />
Nirgendwo in der Bibel findet man ein Gebet, das man bei der<br />
Bekehrung sprechen kann, und in der Apostelgeschichte gibt es<br />
keine Beispiele von Menschen, die sich allein durch ein Gebet<br />
bekehrt hätten. Stattdessen berichtet uns die Bibel immer wieder<br />
davon, wie Menschen sofort getauft wurden, sobald sie die<br />
Wahrheit der Botschaft von Christus erkannt hatten:<br />
»Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz, und sie sprachen<br />
zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr<br />
Männer und Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und<br />
ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi<br />
zur Vergebung eurer Sünden; so werdet ihr die Gabe des heiligen<br />
Geistes empfangen.« (Apostelgeschichte 2,37-38)<br />
»Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine<br />
Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst!« (Apostelgeschichte<br />
22,16)<br />
Daran kann man erkennen, dass die Taufe mit einer bewussten<br />
Lebensumkehr in direktem Zusammenhang steht. Das biblische<br />
Modell der Errettung besteht demzufolge aus Glauben, Umkehr<br />
von Sünden und der Taufe als Zeichen der Entscheidung. Es ist<br />
nicht die Taufe, die rettet, aber sie setzt ein klares Zeichen, dass<br />
das alte Leben nun endgültig vorbei ist.<br />
Ist das Übergabegebet nicht auch ein Symptom unserer oft theoretischen<br />
Glaubensgewohnheiten? Wir bringen die Leute dazu,<br />
eine Lehre über Jesus und das Kreuz als wahr anzunehmen.<br />
Dann sollen sie diese neue Überzeugung durch ein Gebet über<br />
die Lippen bringen. Was bleibt, ist oft nur Kopfsalat und wird<br />
nicht Teil des eigenen Lebens. Jesus, die Apostel und die ganze<br />
hebräische Prägung der Bibel sprechen von der Rettung als einer<br />
kompletten Neustrukturierung des Lebens. Sie bleibt nicht<br />
nur theoretisch im Kopf, sondern wird jeden Tag gelebt, mit<br />
einer völligen Umkehr und im Gehorsam Christus gegenüber.<br />
Ich finde es folglich passend, dass das Zeichen des neuen Lebens<br />
den ganzen Körper in Anspruch nimmt. Der Körper wird untergetaucht<br />
im Sinne eines Theaterstückes: Ich gehe mit Christus<br />
ins Grab, stehe mit ihm wieder zum neuen Leben auf und<br />
lasse mein altes Leben mit allen Sünden hinter mir. Es ist nicht<br />
theoretisch, sondern umfasst mein ganzes Leben.<br />
Wie wird man Christ? Durch eine das ganze Leben umfassende<br />
Umkehr und einen Glauben, der alles auf Jesus setzt. Nicht<br />
durch ein magisches Gebet. ///<br />
<strong>oora</strong><br />
Die christliche Zeitschrift zum Weiterdenken<br />
Nummer <strong>42</strong> • 4/2011<br />
ISSN 2191-7892<br />
Herausgeber: <strong>oora</strong> verlag GbR, Jörg Schellenberger und<br />
Michael Zimmermann, Dollmannstr. 104, 91522 Ansbach<br />
Redaktionsleitung: Jörg Schellenberger,<br />
Michael Zimmermann (info@<strong>oora</strong>.de)<br />
Redaktionsteam: Anne Coronel, Matthias Lehmann,<br />
Anneke Reinecker, Jörg Schellenberger, Johanna Weiß,<br />
Michael Zimmermann<br />
Anzeigen: Johanna Weiß (johanna@<strong>oora</strong>.de)<br />
Redaktionsbeirat: Klaus-Peter Foßhag, Gernot Rettig<br />
Gestaltung: Johannes Schermuly, www.ideenundmedien.de<br />
Druck: Müller Fotosatz & Druck GmbH, Selbitz,<br />
www.druckerei-gmbh.de<br />
Abonnement: <strong>oora</strong> erscheint viermal im Jahr (März,<br />
Juni, September, Dezember) und kostet 18,50 EUR in<br />
Deutschland bzw. 24,50 EUR in anderen europäischen<br />
Ländern. Darin sind Mehrwertsteuer und Versandkosten<br />
bereits enthalten! Das Abo kann immer bis sechs Wochen<br />
vor Bezugsjahresende gekündigt werden. Eine E-Mail an<br />
service@<strong>oora</strong>.de genügt. Das gilt nicht für Geschenk-Abos,<br />
die automatisch nach einem Bezugsjahr enden.<br />
Einzelpreis: 5,50 EUR/7,50 SFr. Preisänderungen und<br />
Irrtümer vorbehalten.<br />
Mengenrabatt: Ab 10 Hefte: 5,00 EUR pro Heft, ab 20<br />
Hefte: 4,50 EUR pro Heft (inkl. Versand)<br />
Bankverbindung: <strong>oora</strong> verlag GbR, Konto-Nr. 836 89 38,<br />
BLZ 765 500 00, Sparkasse Ansbach • IBAN: DE18<br />
76550000 0008 3689 38, BIC: BYL ADEM1ANS<br />
Leserservice: <strong>oora</strong> Leserservice, Postfach 1363,<br />
82034 Deisenhofen, Telefon: 089/858 53 - 552,<br />
Fax: 089/858 53 - 62 552, service@<strong>oora</strong>.de<br />
© 2011 <strong>oora</strong> verlag GbR • www.<strong>oora</strong>.de<br />
Teil Anfang<br />
Bilder: Wenn nicht anders vermerkt: photocase.com<br />
Titelbild: Johannes Schermuly; S.12: vandalay; S.24: jöni;<br />
S.26: Flickr-SFB579, istock<br />
Teil Ende<br />
Bilder: Wenn nicht anders vermerkt: photocase.com<br />
Titelbild: Johannes Schermuly; S.4: view7; S.7-8: Flickrmikebaird;<br />
S.14: daniel.schoenen; S.16-18: complize;<br />
S.20: willma...; S.22: Bratscher; S.26: Flickr-catmachine<br />
Alle weiteren von <strong>oora</strong> oder von privat.<br />
Jim Gettmann (49) lebt mit seiner Familie in der Nähe von Rostock. Er ist seit<br />
über 20 Jahren in verschiedenen Ländern im Gemeindebau tätig. Dabei ist es<br />
sein Anliegen, organische statt organisatorische Gemeinden aufzubauen.<br />
Zertifikat: Hiermit bestätigt natureOffice, dass <strong>oora</strong><br />
verlag GbR einen nachhaltigen Beitrag zum freiwilligen<br />
Klimaschutz geleistet hat, indem dieses Druckerzeugnis<br />
durch die Kompensation der entstandenen Emissionen<br />
durch anerkannte Klimaschutzprojekte klimaneutral<br />
gestellt wurde.<br />
Menge CO2e: 712 kg<br />
ID-Nummer: DE-245-736715 (Über die ID-Nummer<br />
können Sie unter www.natureOffice.com die Echtheit<br />
des Zertifikates überprüfen.)<br />
Klimaschutzprojekt: Abwasseraufbereitung und<br />
Biogasnutzung Thailand<br />
<strong>oora</strong>.de 21
<strong>oora</strong> braucht dich<br />
Noch kein Weihnachtsgeschenk<br />
für Freunde oder Geschwister?<br />
Wir empfehlen dir das <strong>oora</strong>-Geschenkabo,<br />
das automatisch nach vier Ausgaben endet.<br />
Nur 18,50 Euro inkl. Versandkosten<br />
Das erste Heft bekommst du als Schenker direkt von uns<br />
zugeschickt und kannst es so unter den Weihnachtsbaum<br />
legen. Ab der zweiten Ausgabe schicken wir <strong>oora</strong> dann<br />
direkt an den Beschenkten.<br />
Vier Postkarten legen<br />
wir als Bonus mit dazu.<br />
Und hier kannst du bestellen: www.<strong>oora</strong>.de/shop oder (089) 85853-552<br />
Fehlerkorrektur »Zahlen der Macht«<br />
Ausgabe 41 (3/2011), Seite 17<br />
Bei der Recherche der Militärausgaben sind uns ein paar Kommas verrutscht, weshalb die Infografik leider falsche Angaben enthält.<br />
Richtig sind folgende Zahlen:<br />
Militärausgaben 2010<br />
• weltweit: 1.611 Mrd. $<br />
• der fünf Länder mit höchsten Ausgaben (USA, China, Großbritannien, Frankreich, Russland): 995 Mrd. $<br />
• der USA: 698 Mrd. $<br />
Die restlichen drei Angaben waren korrekt. Wir bitten euch, diesen Fehler zu entschuldigen.<br />
22<br />
<strong>oora</strong> 04/11
ücher, die wir gelesen haben<br />
Buchrezensionen | Anfang<br />
Eric Metaxas<br />
Bonhoeffer<br />
Der Heldenstatus von Bonhoeffer steht außer<br />
Frage. Gerne unterstreicht man eine Aussage<br />
mit einem Bonhoeffer-Zitat oder verweist auf<br />
seinen Mut gegenüber dem Naziregime. Er ist<br />
der Gute und die Nazis die Bösen. Die Biographie<br />
von Eric Metaxas über Bonhoeffer geht<br />
über dieses Duell hinaus. Sie führt hinein in<br />
das Leben von Dietrich Bonhoeffer. Ein deutscher<br />
Intellektueller, der mit seinem scharfen<br />
Denken und seinem tief verwurzelten Gehorsam<br />
gegenüber Jesus ein Fels in einer unruhigen<br />
Zeit der Geschichte war. Er wuchs in<br />
einer Professorenfamilie auf und entwickelte<br />
dort sein freies Denken. Er ließ sich weder<br />
von Menschen noch der Kirche vereinnahmen,<br />
sondern behielt sich selbst in der von<br />
ihm mit aufgebauten Widerstandskirche eine<br />
kritische Stimme.<br />
Seine bedeutenden Bücher »Ethik«, »Nachfolge«<br />
oder »Gemeinsames Leben« liest man<br />
nach der Biographie anders als zuvor. Man<br />
begreift, wie Bonhoeffer Begriffe füllt, oder<br />
warum er bestimmte Aussagen tätigte. Eine<br />
absolute Empfehlung für jeden, der sich mit<br />
Bonhoeffers Büchern oder Leben auseinandersetzen<br />
möchte. /// Jörg Schellenberger<br />
Gebundene Ausgabe, 752 Seiten, SCM Hänssler 2011<br />
ISBN 978-3775152716, € 29,95<br />
Michael Ende<br />
Momo<br />
Wenn sich ein Kinderbuch auch für Erwachsene<br />
eignet, ist es meist postmodern. Es hat<br />
nämlich ziemlich sicher mehrere Bedeutungsebenen:<br />
eine für Kinder und mindestens eine<br />
weitere, meist tiefere Ebene für den erwachsenen<br />
Leser. So auch der 1973 erschienene Jugendbuchklassiker<br />
Momo von Michael Ende,<br />
der in 27 Sprachen übersetzt ist. Der Märchen-Roman<br />
spielt in einer Phantasie-Welt, in<br />
der die Erwachsenen zunehmend auf all das<br />
verzichten, was Menschsein ausmacht – Zeit<br />
füreinander haben, Zuhören, Spielen – nur,<br />
um Zeit einzusparen. Schuld daran ist die gespenstische<br />
Gesellschaft der grauen Herren,<br />
die den Menschen die scheinbar eingesparte<br />
Zeit stiehlt. Das hilfsbereite Mädchen Momo<br />
und ihre Freunde leiden darunter bis der geheimnisvolle<br />
Zeit-Verwalter »Meister Hora«<br />
eingreift und mit Hilfe der Romanheldin den<br />
Kampf mit den Zeit-Dieben aufnimmt.<br />
Der Autor zeichnet ein eindrucksvolles Bild der<br />
Verödung des hektischen Erwachsenenlebens<br />
und was dagegen hilft: kindliche Offenheit und<br />
hin und wieder auch einmal Zeit zu verschwenden.<br />
Da das die Lebendigkeit fördert, finde ich<br />
das Buch hilfreich. /// Michael Zimmermann<br />
Gebundene Ausgabe, 304 Seiten, Thienemann 2005<br />
ISBN 978-3522177504, € 14,90<br />
Jens Soentgen<br />
Selbstdenken!:<br />
20 Praktiken<br />
der Philosophie<br />
Philosophie – das klingt zunächst abstrakt<br />
und trocken. Es klingt nach alten Männern,<br />
die verschrobene Theorien über alles und<br />
nichts entwickeln. Doch diesem Buch geht es<br />
ums Denken und darum, den Dingen auf den<br />
Grund zu gehen. Der Autor stellt auf unterhaltsame<br />
Weise verschiedene Techniken vor,<br />
die bei dieser Art von Gedankenspielen eingesetzt<br />
werden können. Von der Provokation<br />
über die Logik bis zum Gedankenexperiment<br />
erklärt er in verständlicher Sprache und mit<br />
vielen Anekdoten und Beispielen, wie Gedanken<br />
entwickelt, Argumente überprüft und<br />
Ideen vermittelt werden können. Viele dieser<br />
Praktiken kann man selbst anwenden – sei es<br />
beim Sinnieren über die großen Fragen des Lebens<br />
oder beim Meinungsaustausch über die<br />
Gestaltung des Abendprogramms.<br />
Nicht jede vorgestellte Technik ist gleichermaßen<br />
nützlich und nicht jede skizzierte Idee<br />
klingt vernünftig, aber insgesamt war das<br />
Buch für mich eine interessante Lektüre. Wer<br />
das eigenständige Denken schätzt und ein Interesse<br />
an philosophischen Fragestellungen<br />
besitzt, dem kann dieses Buch als lesenswert<br />
empfohlen werden. /// Matthias Lehmann<br />
Taschenbuch, 240 Seiten, Verlagsgruppe Beltz 2010<br />
ISBN 978-3407755261, € 8,95<br />
Anzeige<br />
www.christkindclothing.de
Dieser Ausgabe ist ein Wendeheft.<br />
Auf beiden Außenseiten findest du ein<br />
Cover: eins mit dem Thema Anfang,<br />
eins mit dem Thema Ende.<br />
Der Ende-Auszug beginnt hier.
12. Jahrgang • 4/2011 • Nr. <strong>42</strong> (Dezember)<br />
5,50 EUR/7,50 SFr (Einzelpreis)<br />
www.<strong>oora</strong>.de<br />
THE RACE heißt jetzt <strong>oora</strong><br />
und erscheint viermal pro Jahr<br />
Die christliche Zeitschrift zum Weiterdenken<br />
Ende<br />
Es ist vollbracht<br />
Rauch oder Schall<br />
Über die Unmöglichkeit, Nichtraucher zu werden<br />
Seite 4<br />
Vier Geschichten vom Glück<br />
Rückblicke auf mein Leben<br />
Seite 10<br />
Wenn der Staat zur Strafe tötet<br />
Interview zur Todesstrafe mit Professor Dieter Hermann<br />
Seite 16
Foto: Mikael Damkier - Fotolia.com<br />
Bewerbung<br />
Sommersemester bis:<br />
15. Januar 2012<br />
BRINGT DICH WEITER !<br />
Eine Initiative unterstützt durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung<br />
Wir bieten finanzielle Unterstützung, Seminare, Beratung und Netzwerke.<br />
Die Förderung richtet sich an alle leistungsstarken, engagierten Studierenden –<br />
unabhängig vom Studienfach. Bewerber mit ausländischen Wurzeln<br />
und Studierende, deren Eltern selbst nicht<br />
studiert haben, sind herzlich willkommen.<br />
Bewerbungsunterlagen unter:<br />
www.kas.de/stipendium
Inhalt<br />
Editorial<br />
<strong>oora</strong><br />
Artikel, die mit dem Lautsprecher gekennzeichnet sind, gibt es<br />
als Audioversion in iTunes und auf www.<strong>oora</strong>.de/audio.<br />
Schwerpunkt: Ende<br />
Finale, oh-oh<br />
4 Rauch oder Schall<br />
Über die Unmöglichkeit, Nichtraucher<br />
zu werden<br />
Axel Brandhorst<br />
7 Ich dachte, du bist tot<br />
Was die Taufe alles kann<br />
Rüdiger Halder<br />
10 Vier Geschichten vom Glück<br />
Rückblicke auf mein Leben<br />
Anne Coronel<br />
13 Ende<br />
Lyrik: Franziska Arnold<br />
14 Die Bilanz meines Scheiterns<br />
Sind Niederlagen eine Idee Gottes?<br />
Damaris Bittner<br />
16 Wenn der Staat zur Strafe tötet<br />
Interview zur Todesstrafe mit Professor<br />
Dieter Hermann<br />
Konzept: Michael Zimmermann<br />
Interview: Cosima Strawenow<br />
20 Du sollst Vater und Mutter pflegen<br />
Im Konflikt der Fürsorge<br />
Dr. Torsten Lange<br />
22 Die Kunst des Trauerns<br />
Nach jedem Ende kommt ein neuer Anfang<br />
Kerstin Hack<br />
24 Vom Mut, Dinge sterben zu lassen<br />
Mein Freund Gott und ich<br />
Kolumne: Mickey Wiese<br />
// Das Ende ist überall: Ein Land nach dem anderen erreicht das<br />
Ende seiner Zahlungsfähigkeit. Occupy-Aktivisten weltweit fordern<br />
ein Ende des hemmungslosen Finanzsystems. Regime, die<br />
Jahrzehnte überdauert haben, werden von wütenden Demonstranten<br />
zum Ende gebracht. Und auch unsere Regierung ist in<br />
den Augen der Opposition schon längst am Ende – trotz Atomkraftausstieg<br />
und Ende der Wehrpflicht. Glaubt man den Maya,<br />
ist das alles sowieso egal, denn Ende des nächsten Jahres ist ihrer<br />
alten Vorhersage zufolge auch das endgültige Ende der Welt.<br />
Das alles klingt irgendwie bedrohlich und unberechenbar. Denn<br />
das Wort Ende bedeutet, dass wir die Sicherheit des uns Bekannten<br />
aufgeben müssen, dass die Dinge, die wir kennen und<br />
lieben, nicht für immer bestehen. Und es erinnert uns daran,<br />
dass auch unser eigenes Leben irgendwann einen Schlusspunkt<br />
finden wird. Diese Vorstellung finden wir meist nicht sonderlich<br />
attraktiv. Aber es könnte dennoch ein bedeutender Gedanke sein.<br />
Der kürzlich verstorbene Steve Jobs hat 2005 vor Studenten der<br />
Stanford Universität gesagt: »Remembering that you are going<br />
to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you<br />
have something to lose. You are already naked. There is no reason<br />
not to follow your heart.« Das Ende wirkt demnach wie eine relativierende<br />
Größe, das Bewusstsein der Endlichkeit unseres Lebens<br />
kann uns aktivieren und freisetzen. Das sind natürlich keine<br />
neuen Erkenntnisse der iPad-Zeit, denn schon Mose betete ganz<br />
ähnlich: »Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass<br />
wir klug werden.« (Psalm 90,12) Es könnte sich also lohnen, die<br />
Furcht vor dem Ende einmal abzuschütteln und sich etwas mehr<br />
mit seinen Bedeutungen für unser Leben zu beschäftigen. Dafür<br />
wollen wir euch mit diesem Heft ein paar Anstöße geben:<br />
Früher als wir selber gehen unsere Eltern ihrem Lebensende entgegen<br />
und sind dann vielleicht auf Hilfe angewiesen. Was das für<br />
uns bedeutet, damit beschäftigt sich der Artikel »Du sollst Vater<br />
und Mutter pflegen« auf Seite 20. Im krassen Gegensatz zum<br />
Pflegen steht es, wenn das Lebensende vorzeitig herbeigeführt<br />
wird. In »Wenn der Staat zur Strafe tötet« auf Seite 16 befragen<br />
wir einen Experten zu Sinn und Wirksamkeit der Todesstrafe.<br />
Viele wertvolle Inspirationen beim Lesen wünscht dir<br />
Dein <strong>oora</strong> Redaktionsteam<br />
<strong>oora</strong>.de 3
Ende | Wenn der Staat zur Strafe tötet<br />
Wenn der Staat zur Strafe tötet<br />
Interview zur Todesstrafe mit Professor Dieter Hermann<br />
Konzept: Michael Zimmermann<br />
Interview: Cosima Strawenow<br />
Amnesty International registrierte 2008<br />
mindestens 2.390 Hinrichtungen in<br />
25 Staaten sowie 8.864 Todes urteile<br />
in 52 Staaten. Wir befragen den<br />
Kriminal soziologen Dieter Hermann zum<br />
Thema Todesstrafe. Er hat 52 Studien zur<br />
Abschreckungswirkung der Todesstrafe<br />
einer Analyse unterzogen. Die einzelnen<br />
Studien kommen zu völlig unterschiedlichen<br />
Ergebnissen.<br />
// Ich entdecke die Arbeit von Professor<br />
Hermann in der Sommer-Ausgabe der Zeitschrift<br />
Chrismon. Aufmerksam lese ich die kurzen,<br />
prägnanten Aussagen, die der Sozialforscher<br />
zur Wirksamkeit der Todesstrafe macht.<br />
Schon bin ich dabei, seine Kontaktdaten im<br />
Netz zu recherchieren und ihn für ein Interview<br />
anzufragen. Kurze Zeit später trifft ihn unsere<br />
Mitarbeiterin Cosima in seinem Büro am Institut<br />
für Kriminologie an der Uni Heidelberg.<br />
16 <strong>oora</strong> 04/11
Wenn der Staat zur Strafe tötet | Ende<br />
Herr Hermann, haben Sie Angst vor dem Tod?<br />
(überlegt) Ja. Tod bedeutet Trennung. Der Tod ist ein Feind<br />
Gottes. Das ist alles nichts Positives.<br />
Was, glauben Sie, passiert nach dem Tod?<br />
Ich werde bei Christus sein. Das betrifft nicht jede Person, aber<br />
gläubige Personen schon.<br />
Trotzdem haben Sie Angst davor, die Erde zu verlassen?<br />
Ja, denn diese negativen Begleiteffekte, wie die Trennung vom<br />
Partner, sind schließlich trotzdem da.<br />
Sie haben 52 verschiedene Studien zur Wirksamkeit der<br />
Todesstrafe miteinander verglichen. Was hat Sie dazu<br />
bewogen?<br />
Die Studie ist eingebunden in eine größere Untersuchung, eine<br />
sogenannte Metaanalyse, in der wir insgesamt 700 Abschreckungsstudien<br />
untersucht haben. Metaanalyse heißt, dass wir<br />
nicht Personen, Länder oder Regionen untersucht haben, sondern<br />
bereits vorhandene Studien. Wir haben uns gefragt, wie<br />
es zu den Ergebnissen einzelner Studien gekommen ist und wie<br />
man diese Ergebnisse so zusammenfassen kann, dass die Resultate<br />
insgesamt sicherer werden.<br />
Es ging also um Ergebnissicherung?<br />
Nicht nur. Die Studien kommen zu sehr unterschiedlichen Resultaten.<br />
Einige kommen zu dem Ergebnis, dass Abschreckung<br />
funktioniere, andere kommen zu dem gegenteiligen Ergebnis,<br />
nämlich, dass Abschreckung Kriminalität produzieren würde.<br />
Unsere Frage war deshalb: Wie kommen diese Unterschiede zustande?<br />
Im Rahmen unserer Untersuchung haben wir natürlich<br />
auch solche Studien berücksichtigt, die sich speziell mit der Todesstrafe<br />
befassen. Eine Studie von Ehrlich beispielsweise, die in<br />
der Frühzeit der Forschungen zur Todesstrafe entstanden ist,<br />
kommt zu dem Ergebnis, dass jede Exekution sieben bis acht<br />
Morde verhindere. Es gab später dann Replikationen dieser Studie,<br />
die zu dem Ergebnis kamen, dass die Todesstrafe keine einzige<br />
Tötung verhindert.<br />
In Ländern, in denen die Todesstrafe abgeschafft wird, ist<br />
oft sogar ein Rückgang von Tötungsdelikten zu beobachten.<br />
Woher kommt das?<br />
Es gibt Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass die Abschaffung<br />
der Todesstrafe zu einem Rückgang der Tötungsdelikte<br />
führt, und es gibt Studien, die in der Einführung der Todesstrafe<br />
diesen Effekt sehen. Der Grund für diese Diskrepanzen, so jedenfalls<br />
das Ergebnis der Metaanalyse, ist das Menschenbild des<br />
Forschers und die Theorie, die seiner Studie zugrunde liegt. Nehmen<br />
wir zum Beispiel einen Forscher mit einem utilitaristischen<br />
Ansatz, der postuliert, dass der Mensch Vor- und Nachteile verschiedener<br />
Handlungsalternativen abwägt und dann immer die<br />
wählt, die ihm den größten Nutzen bringt. Ein Forscher, der so<br />
vorgeht, nimmt an, dass die Todesstrafe zwangsläufig verhaltensrelevant<br />
ist. Der eigene Tod wäre in einer solchen Kosten-Nutzen-<br />
Rechnung immer der größte Kostenfaktor.<br />
Wenn man die Todesstrafe<br />
rechtfertigen will, findet man<br />
immer eine Studie, die das belegt.<br />
Wenn man der Todesstrafe gegenüber<br />
jedoch eher kritisch eingestellt ist,<br />
findet man genauso eine Studie,<br />
die das unterstützt.<br />
In diesem Menschenbild wäre kein Platz für eine Affekthandlung.<br />
Eine einseitige, rein ökonomische Sicht, die man auch<br />
anzweifeln kann.<br />
Richtig. Wenn man den Alltag beobachtet, gibt es ausgesprochen<br />
viele irrationale Handlungen.<br />
Ihr Ansatz ist offenbar kein rein ökonomischer. Welchen Ansatz<br />
verfolgen Sie?<br />
Ich verfolge eher eine Handlungstheorie, die auf den Arbeiten von<br />
Weber und Parsons basiert. Ich gehe davon aus, dass der Mensch<br />
einen freien Willen hat, in dem Sinne, dass er sich zwar zwischen<br />
mehreren Handlungsalternativen entscheiden, aber seine Entscheidung<br />
nicht unbedingt auch praktisch umsetzen kann. Bei der<br />
Wahl der Handlungsalternative spielen seine Werte eine größere<br />
Rolle. Welche Präferenzen hat er? Welche Ziele hat er für sein Leben?<br />
Dabei spielen sein Normverständnis und auch seine strukturelle<br />
Einbindung und seine Sozialisation eine Rolle.<br />
Prof. Dr. Dieter Hermann (60) ist Soziologe und Diplommathematiker. Er<br />
lehrt und forscht am Institut für Kriminologie der Universität Heidelberg. Seine<br />
Schwerpunkte liegen in den Bereichen Kriminalsoziologie (Kriminalitätstheorien,<br />
Präventions- und Evaluationsforschung), Kultursoziologie (Werte-, Lebensstil-<br />
und Sozialkapitalforschung), Methoden empirischer Sozialforschung und<br />
Statistik sowie Ethik.<br />
<strong>oora</strong>.de<br />
17
Ende | Wenn der Staat zur Strafe tötet<br />
Unter anderem auch die religiöse Prägung?<br />
Ja. Es scheint so zu sein, dass gewisse Werte eine Art Plattform<br />
bilden, auf deren Grundlage der Mensch weitere Werte ausbildet.<br />
Diese Basiswerte sind religiöser Natur. Die daraus abgeleiteten<br />
Werte sind beispielsweise Materialismus, Egoismus, Altruismus<br />
und eine subkulturelle Orientierung.<br />
Nehmen Sie dabei Unterschiede zwischen den verschiedenen<br />
Religionen wahr?<br />
Das habe ich nicht untersucht. Aber es ist schon wahrscheinlich,<br />
dass es Unterschiede gibt, denn Religionen postulieren nun<br />
einmal ein bestimmtes Wertefundament. Und die Werte unterscheiden<br />
sich durchaus religionsspezifisch. Vergleichen Sie<br />
einmal Christentum und Islam. Die Forderung nach Nächstenliebe,<br />
der im Christentum eine große Bedeutung zukommt, ist<br />
auch im Islam vorhanden; im Sinne des Gebots, Almosen zu geben,<br />
hat sie aber nicht denselben hohen Stellenwert. Ein anderes<br />
Beispiel ist die Leistungsorientierung. Das, was man unter dem<br />
Begriff der »protestantischen Ethik« subsumiert, ist im Islam<br />
meines Wissens in der Form nicht von Bedeutung.<br />
Der Leistungsgedanke spielt in unserer Gesellschaft eine<br />
große Rolle. Dazu zählt, dass man Haltung bewahrt und sich<br />
selbst und sein Leben immer unter dem Gesichtspunkt des<br />
Fortschritts betrachtet. Hat sich da nicht etwas vom Christentum<br />
abgekoppelt?<br />
Leistung ist kein Alleinstellungsmerkmal der christlichen Religion,<br />
das ist richtig. Aber gerade die Reformatoren, insbesondere<br />
Calvin, haben den Gedanken betont, dass Leistung für Christen<br />
außerordentlich wichtig ist. Er hat dies etwas kompliziert mit der<br />
Prädestinationslehre begründet, aber der Gedanke, dass Christen<br />
zu Leistung verpflichtet sind, dass sie der Stadt Bestes suchen und<br />
sich gesellschaftlich engagieren sollen, ist schon ein Gedanke, der<br />
dem Christentum entspringt.<br />
Die Annahme, dass religiöse Prägung Mord verhindert, ist<br />
momentan höchst unpopulär. Dem Islam wird ja seit geraumer<br />
Zeit gerade das Gegenteil vorgeworfen.<br />
Nein, das kann man so nicht sagen. Der Islam ist eine Religion,<br />
der ein anderes Werteprofil hervorbringt als das Christentum.<br />
Aber deshalb ist der Islam noch lange keine Religion, die notwendigerweise<br />
Gewalt hervorbringt. In manchen Fällen hängt<br />
das sicher von der Interpretation des Korans ab, aber in der Regel<br />
dürfte das nicht der Fall sein.<br />
Die Todesstrafe besteht unter anderem noch in den USA, die<br />
uns als westliches Land näher steht als viele andere Länder.<br />
Diesen Monat wurde in Texas die Hinrichtung des 234.<br />
Todeskandidaten unter dem amtierenden Gouverneur Rick<br />
Perry vollzogen. Weshalb findet die Todesstrafe in einem<br />
Staat wie Texas so viele Anhänger?<br />
Der Abschreckungsgedanke spielt in den USA eine viel größere<br />
Rolle als in Europa – übrigens im gesamten Strafrecht. Nahezu<br />
alle staatlichen Sanktionen in den USA sind im Vergleich zu<br />
Deutschland relativ hoch.<br />
18 <strong>oora</strong> 04/11
Wenn der Staat zur Strafe tötet | Ende<br />
Wichtig ist, dass gestraft wird.<br />
Dass deutlich gemacht wird,<br />
eine Norm hat Gültigkeit und keiner<br />
kann sie so ohne Weiteres übertreten.<br />
Die Höhe der Strafe ist dann gar<br />
nicht mehr so entscheidend.<br />
Warum ist das so?<br />
Das kann ich mir auch nicht so richtig erklären. Vielleicht spielt<br />
hier die Kultur eine Rolle. Womöglich kommt dem Mensch an<br />
sich in Europa kulturbedingt ein höherer Stellenwert zu. Vielleicht<br />
liegt es auch an der niedrigeren Kriminalitätsrate in Europa.<br />
Nach Ihren Forschungen würde aber ein milderes Strafmaß<br />
auch zu weniger Kriminalität führen.<br />
Wichtig ist, dass gestraft wird. Dass deutlich gemacht wird, dass<br />
eine Norm Gültigkeit hat und keiner sie so ohne Weiteres übertreten<br />
kann. Die Höhe der Strafe ist dann gar nicht mehr so entscheidend.<br />
Wichtig ist auch, dass schnell gestraft wird.<br />
Wäre das auch ein Kostenfaktor? Je länger der Mensch in<br />
Untersuchungshaft sitzt, umso mehr kostet er den Staat.<br />
Bei neueren Forschungen zu diesem Thema, die ökonomisch<br />
orientiert sind, spielt das tatsächlich eine Rolle. Sie kommen zu<br />
dem Ergebnis, dass der Zeitraum zwischen Tat und Sanktion<br />
möglichst kurz sein sollte, um Effizienz im rational-utilitaristischen<br />
Sinne zu erreichen.<br />
Ist es dann nicht billiger, eine Exekution durchzuführen, als<br />
einen Mörder lebenslang hinter Gittern zu beherbergen?<br />
Nein, das ist sogar noch teurer. Die Freiheitsstrafe, die vor der<br />
Exekution abgesessen wird, ist in der Regel ausgesprochen lang,<br />
bis zu 20 Jahren, und dann kommt am Ende doch noch die Exekution.<br />
Das heißt, der Unterschied der Haftdauer einer Person,<br />
die zum Tode verurteilt wurde und einer Person, die »lebenslänglich«<br />
bekommen hat, ist gar nicht so gravierend.<br />
Weshalb sitzen Todeskandidaten so lange ein?<br />
Weil man Fehlurteile vermeiden will. Bei der Todesstrafe gibt es<br />
viel mehr Einspruchsmöglichkeiten als bei anderen Strafmaßnahmen.<br />
Der juristische Aufwand ist für das Gericht wesentlich<br />
höher, wenn eine Todesstrafe zur Diskussion steht.<br />
Was empfehlen Sie den 60 Staaten, die nach wie vor die<br />
Todesstrafe anwenden?<br />
Sie sollen meine Studie lesen. Wir haben herausgefunden, dass<br />
es in allererster Linie an der Institutionenzugehörigkeit eines<br />
Forschers liegt, zu welchem Ergebnis er bezüglich der Abschreckungswirksamkeit<br />
der Todesstrafe kommt. Es kommt auf das<br />
Menschenbild an, das der Forscher hat, und auf seine handlungstheoretischen<br />
Vorstellungen. Somit fehlt der Todesstrafe<br />
die generalpräventive Legitimation.<br />
Sie sagen, Forscher sind gar nicht objektiv?<br />
Alle Forscher forschen subjektiv, vermutlich ist Objektivität gar<br />
nicht möglich. Allerdings wirkt sich diese subjektive Sichtweise<br />
bei anderen Forschungen nicht so gravierend aus wie bei den<br />
Studien zur Todesstrafe. Nur bei diesem Thema findet man einen<br />
engen Zusammenhang zwischen der Zugehörigkeit zu einer<br />
Institution und dem Forschungsergebnis.<br />
Die Todesstrafe wird also politischer bewertet als andere<br />
Strafmaßnahmen?<br />
Ja. Wahrscheinlich liegt das auch an der emotionalen Position<br />
des Forschenden zu dem Thema. Wenn er Anhänger einer Rational-Choice-Theorie<br />
ist, wenn er also davon ausgeht, dass Menschen<br />
nach Kosten-Nutzen-Aspekten handeln, wenn er an einer<br />
ökonomischen Institution angestellt ist, wenn er in einer ökonomischen<br />
Zeitschrift veröffentlicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit,<br />
dass seine Studie die Todesstrafe befürwortet, viel größer,<br />
als wenn er eine andere Handlungstheorie präferiert, beispielsweise<br />
als Soziologe oder Kriminologe. Das sind die Weichenstellungen,<br />
die zu unterschiedlichen Studienergebnissen führen.<br />
Der Unterschied der Haftdauer<br />
einer Person, die zum Tode<br />
verurteilt wurde und einer Person,<br />
die »lebenslänglich« bekommen hat,<br />
ist gar nicht so gravierend.<br />
Würden Sie also den Politikern dieser 60 Länder, wenn sie<br />
denn darüber nachdächten, die Todesstrafe abzuschaffen,<br />
dazu raten, mehrere Studien zu Rate zu ziehen?<br />
So ist es. Wenn man die Todesstrafe rechtfertigen will, findet<br />
man immer eine Studie, die das belegt. Wenn man der Todesstrafe<br />
gegenüber jedoch eher kritisch eingestellt ist, findet man<br />
genauso eine Studie, die das unterstützt. In einer solchen Situation<br />
braucht man einen größeren Überblick, um halbwegs sicher<br />
zu sein, wie die verschiedenen Ergebnisse einzuordnen sind.<br />
Das heißt, dass Ihre Forschungsergebnisse im besten Fall<br />
dazu beitragen können, dass die Todesstrafe geächtet wird?<br />
… und dass man eine kritische Distanz zur Todesstrafe bekommt<br />
und einer einzelnen Studie nicht einfach so glaubt.<br />
Herr Hermann, vielen Dank für das Gespräch. ///<br />
<strong>oora</strong>.de 19
Ende | Die Kunst des Trauerns<br />
Die Kunst des Trauerns<br />
Nach jedem Ende kommt ein neuer Anfang<br />
Text: Kerstin Hack<br />
Der Verlust eines geliebten Menschen oder der lieb<br />
gewonnenen Arbeitsstelle trifft einen plötzlich und<br />
unerwartet. Eine Ära geht zu Ende. Tiefe Trauer breitet<br />
sich aus. Was dann? Wie kann man diese Phase für<br />
sich sortieren und nutzen? Wie kann man andere darin<br />
unterstützen? Hilfestellung dazu gibt es hier.<br />
// Passt dieser Artikel überhaupt zu mir? Das hatte ich mich<br />
schon bald nach meiner Zusage gefragt. Ich mag praktische<br />
Ideen, die man gleich umsetzen kann. Gebe leidenschaftlich gerne<br />
Besser-Leben-Tipps und freue mich, wenn ich höre, dass sie<br />
das Leben anderer Menschen erleichtern und bereichern. Erlebt<br />
jemand jedoch einen Verlust und betrauert diesen, sind konkrete,<br />
praktische Tipps meist fehl am Platz und greifen zu kurz.<br />
Trauer kommt wie ein ungebetener Gast – und bleibt auf unbestimmte<br />
Zeit. Und weil sie irgendwie zur Familie gehört, kann<br />
man sie nicht einfach rauswerfen. Billige Ratschläge im Sinne<br />
von »Kopf hoch« helfen nun gar nicht. Sie führen eher dazu,<br />
dass man sich noch mehr zurückzieht, weil man sich unverstanden<br />
und allein gelassen fühlt.<br />
Was hilft bei Trauer?<br />
Wenn man selbst trauert, hilft es zu verstehen, woher die Trauer<br />
kommt. Trauer entsteht immer aufgrund eines Verlustes. Das<br />
kann ein geliebter Mensch sein, der plötzlich nicht mehr da ist.<br />
Oder auch der Verlust von körperlicher Kraft. So wie bei einer<br />
Frau, die nach einer – gut verlaufenen – Krebserkrankung nicht<br />
mehr zu ihrer früheren Kraft zurückfand und nun über diesen<br />
Verlust trauerte. Es kann auch der Verlust von Beziehungen<br />
sein. Oder auch der Verlust einer Arbeitsstelle.<br />
Manches verliert man im Leben und kann es relativ gelassen<br />
hinnehmen – doch in der Regel verliert man mit dem Verlust<br />
auch die Sicherheit. Bisher dachte man, die Ehe wäre stabil, der<br />
geliebte Mensch würde bis ans Ende seiner Tage bei einem blei-<br />
22<br />
<strong>oora</strong> 04/11
Die Kunst des Trauerns | Ende<br />
ben, der Körper würde weitgehend leistungsfähig bleiben, man<br />
würde immer einen Job haben. Und plötzlich erlebt man: Das,<br />
was vermeintlich sicher war, stürzt ein. Nichts ist mehr sicher.<br />
Das verunsichert. Man muss jetzt neue Sicherheit finden.<br />
Erstmal sortieren<br />
Hier hilft es, das Trauern bewusst als Sortieren zu begreifen.<br />
Wer trauert, kann und muss neu sortieren: Was hat in meinem<br />
Leben Bestand? Was nicht? Oder auch: Was bleibt von diesem<br />
Lebensabschnitt? Was muss ich für immer loslassen?<br />
Mir hat es in einer Trauerphase geholfen, mich ganz bewusst<br />
von Hunderten kleinen Dingen einzeln zu verabschieden, die<br />
nun nicht mehr möglich waren. Ich habe Gott für jedes Einzelne<br />
gedankt. Und dann gesagt, dass ich akzeptiere, dass es nun<br />
nicht mehr ist. Akzeptieren heißt nicht »gut finden«. Es heißt<br />
lediglich »annehmen«. Ich nehme an, dass es ist, wie es ist. Ich<br />
kämpfe nicht mehr dagegen an. Das kann insbesondere dann<br />
hilfreich sein, wenn Selbstanklage im Spiel ist und man sich ausmalt,<br />
dass der Verlust vielleicht hätte vermieden werden können,<br />
hätte man nur dieses oder jenes getan. Damit kann man Tage,<br />
Wochen, Monate und Jahre verbringen. Oder zum Annehmen<br />
finden. Und sagen: Es war, wie es war. Und ich gehe jetzt weiter.<br />
Im Trauern entdeckt man, was Bestand hat. Was trotz allem<br />
bleibt. Manche Menschen, Beziehungen, eigene Stärken, Erfahrungen,<br />
Schätze, Erinnerungen an schöne Zeiten und gelebtes<br />
Leben. Das kann – nach einer Phase, in der man den Blick nach<br />
hinten richtet – wieder Kraft für das geben, was vor einem liegt.<br />
Mit dem Verlust ist nicht alles vorbei.<br />
Ins Leben zurückkehren<br />
Ich habe einem Freund nach dem Krebstod seiner Frau geschrieben,<br />
dass ich ihm wünsche, dass er gut trauern kann, aber dann<br />
auch wieder ins Leben zurückkehrt. »Es ist schlimm genug, dass<br />
der Krebs ihr Leben zerstört hat. Es wäre noch schlimmer, wenn<br />
er jetzt auch deines zerstören würde.« Ich wagte es, ihm folgenden<br />
Satz zu schreiben: »Ein gutes Leben ist die beste Rache.« Einige<br />
Zeit später schrieb er mir, dass er eine neue Partnerin gefunden<br />
hat und wieder heiraten wird – und dass ihn dieser Satz<br />
ermutigt hat, nicht in der Vergangenheit und dem Verlust stecken<br />
zu bleiben, sondern die neuen Möglichkeiten zu sehen. Er<br />
hat sich für den Verlust »gerächt«, indem er neu begann und das<br />
Beste aus der Situation machte.<br />
Anderen helfen<br />
Wer Menschen unterstützen will, die gerade einen Verlust betrauern,<br />
tut gut daran, zu wissen, dass Trauer in verschiedenen<br />
Phasen kommt. 1 In der Anfangsphase ist man oft nur geschockt.<br />
Man leugnet, was geschehen ist. »Das kann doch nicht wahr<br />
sein.« Man ist geschockt, erstarrt, hält alles für einen bösen<br />
Traum. In dieser Phase braucht man vor allem praktische Unterstützung.<br />
Man ist wie gelähmt, und es tut gut, wenn Menschen<br />
da sind und helfen, indem sie Essen kochen, Einkäufe erledigen,<br />
praktische Aufgaben übernehmen.<br />
Löst sich die Starre, kommen in einer zweiten Phase die Emotionen<br />
hoch: Angst, Wut, Zorn, Unruhe. Auch Anklage gegen die<br />
vermeintlich Schuldigen: den früheren Partner, die Ärzte, Gott,<br />
das Leben selbst. Hier ist Beschwichtigen fehl am Platz. Auch<br />
Erklärungen sind wenig hilfreich, selbst wenn sie inhaltlich<br />
stimmen, wie beispielsweise »Gott meint es trotz allem gut mit<br />
dir.« Was wirklich hilft, ist, dem Trauernden Raum zu geben,<br />
seine Gefühle ungeschminkt zu äußern. Man kann ihn unterstützen,<br />
indem man Resonanz gibt: »Du fühlst dich gerade so<br />
und so.« oder »Es klingt, als ob du gerade …«<br />
In der dritten Trauerphase versucht man, das Verlorengegangene<br />
irgendwie wiederzufinden. Man hält innerlich Zwiesprache,<br />
träumt, phantasiert. In dieser Phase kommt häufig auch nicht<br />
Gelöstes an die Oberfläche »Ich wünschte, ich hätte ihm das<br />
noch gesagt.« In dieser Phase kann es hilfreich sein, nachzufragen:<br />
»Welche Erinnerungen sind denn besonders schön? Was<br />
kannst oder möchtest du aus dieser Phase behalten?«<br />
In der vierten Phase hat man den Verlust schließlich akzeptiert<br />
und entdeckt neue Lebensmöglichkeiten. Wenn man<br />
ahnt, dass der andere sich wieder dem Leben zuwenden möchte,<br />
kann man ihn einladen – zu Aktivitäten und gemeinsamen<br />
Unternehmungen.<br />
Das, was hier so ordentlich klingt, ist im echten Leben ein weitaus<br />
größeres Chaos. Menschen, die trauern, durchlaufen diese<br />
Phasen in der einen oder anderen Form. Doch nicht immer geradlinig<br />
und chronologisch, sondern häufig mit Sprüngen hin<br />
und her. Wer Trauernde begleitet, darf sich auf Überraschungen<br />
gefasst machen. Mal ist Akzeptanz und Gelassenheit spürbar,<br />
dann wieder wütendes Aufbegehren. Manchmal im Minutentakt<br />
wechselnd.<br />
Wer sich darauf einlässt, einem Menschen hierbei zur Seite zu<br />
stehen und sensibel auf die jeweilige Phase zu reagieren, kann<br />
dabei Schätze entdecken. Denn jedes geteilte Leben ist wunderbar<br />
und hat seine eigene Schönheit. Das macht ja auch den Verlust<br />
oft so hart. Doch in der Trauer mit dem anderen zu entdecken,<br />
was von dieser Phase behalten werden kann – und was<br />
jetzt immer noch möglich ist, eröffnet wunderbare Möglichkeiten<br />
des Mitleidens, Mitliebens und Mitlebens. ///<br />
Fußnote:<br />
1 Nach der Trauerforscherin Verena Kast – sehr verkürzt – dargestellt. Ausführlicher zu finden unter<br />
de.wikipedia.org/wiki/Trauer#Trauerprozess_in_vier_Phasen_nach_Kast<br />
Kerstin Hack (44) ist Berlinerin, liebt das Leben, Schoko- und echte Küsse,<br />
Liegeräder, Fotografie und Go-Kart-Fahren. Die ist Verlegerin des »Down to Earth<br />
Verlages«, der auf kompakte Lebenshilfe spezialisiert ist. Sie bloggt unter<br />
www.kerstinpur.de<br />
<strong>oora</strong>.de 23
Ende | Vom Mut, Dinge sterben zu lassen<br />
Vom Mut,<br />
Dinge sterben zu lassen<br />
Mein Freund Gott und ich<br />
Text: Mickey Wiese // Kolumne<br />
Audioversion unter www.<strong>oora</strong>.de/audio<br />
Mickey denkt über das Sterben und<br />
Sterben-lassen nach und gesteht<br />
seinem Freund Gott, dass er damit<br />
gar nicht gut klar kommt. Der jedoch<br />
eröffnet ihm ganz neue Perspektiven.<br />
// Als mein Freund Gott und ich über<br />
das Thema dieses Artikels nachdachten,<br />
saßen wir im Kellerfoyer des Langener<br />
Glaskunstmuseums zwischen Toiletten<br />
und verschlossenen Türen. »Das stimmt<br />
schon mal so richtig auf das Thema ein«,<br />
schmunzelten wir beide unwillkürlich.<br />
Eigentlich hatten wir uns die abstrakten<br />
Glasfenster unseres Freundes Johannes<br />
Schreiter anschauen wollen, dem wohl<br />
international bedeutendsten abstrakten<br />
Glasmaler unserer Zeit. 1 Schließlich mussten<br />
wir diesen Gedanken aufgrund neuer<br />
Öffnungszeiten jedoch sterben lassen.<br />
Das fiel uns in diesem Fall nicht ganz so<br />
schwer, weil es im Kellerfoyer ein Glasfenster<br />
von Schreiter als Appetizer zur<br />
Ausstellung gibt, dem wir nun gegenüber<br />
saßen. 2 Auf weißem Grund durchzieht<br />
unter anderem ein Bündel energischer<br />
freier schwarzer Handzeichnungen das<br />
Bild. »Da siehst du mein Problem in Bezug<br />
auf das Sterben«, sagte ich zu meinem<br />
Freund Gott. »Ich lebe viel zu oft<br />
nach dem Motto: Lieber ein bekanntes<br />
Leid, als ein unbekanntes Glück. Und<br />
dann verharre ich gefühlte Ewigkeiten in<br />
Situationen, die mir vielleicht gar nicht<br />
gut tun oder die sogar schon längst ihr<br />
Leben eingebüßt haben. Aber ich habe<br />
einfach Angst, mich in den verwirrenden<br />
Lebenslinien, die sich in neuen Lebenssituationen,<br />
wie auf dem Glasfenster hier,<br />
ergeben können, nicht zurecht zu finden.<br />
Zum Tot-sein brauche ich keinen Mut,<br />
weil ich ja bei dir sein will, aber zum<br />
Sterben schon, denn das kann hässlich<br />
und gemein werden.«<br />
Mein Freund Gott schaute mich mit<br />
ernstem Blick an: »Wie hättest du eigentlich<br />
damals anstelle der Jünger reagiert,<br />
als ich ihnen sagte, dass ich unsere gemeinsame<br />
Zeit auf der Erde zunächst<br />
einmal sterben lassen würde?« »Ich<br />
wäre auch traurig gewesen«, antwortete<br />
ich. »Auch deine Ankündigung, dass<br />
der Heilige Geist nun bei uns bleiben<br />
werde, hätte mich nicht froh gestimmt.<br />
Ich will nicht verlieren. Ich habe Angst,<br />
dass dann doch nichts kommt oder wenn<br />
doch, dass ich mich darin nicht orientieren<br />
kann.«<br />
»Sterben heißt, die Schmerzen des Verlusts<br />
zu ertragen mit der Perspektive,<br />
etwas loszulassen, aber doch nur in der<br />
Hoffnung, Neues zu empfangen«, schlaumeierte<br />
mein Freund Gott. Aber auch<br />
solche klugen Sätze konnten mich nicht<br />
restlos überzeugen. Man kennt das Neue<br />
ja noch nicht, es ist einem nicht vertraut,<br />
und sicher ist es auch nicht.<br />
Mein Freund Gott nahm mich bei der<br />
Hand: »Spürst du mich?« »Ja.« »Hättest<br />
du Angst, an meiner Hand in unbekanntes<br />
Land zu gehen?«<br />
»So lange ich deinen Stecken und<br />
deinen Stab spüren kann, fürchte<br />
ich kein Unheil, auch wenn’s<br />
mal durch eine Schattenwelt<br />
geht«, kam ich meinem Freund<br />
Gott jetzt mal ganz biblisch.<br />
Das nahm er natürlich gleich<br />
zum Anlass auf derselben Ebene<br />
zu kontern: »Es ist ein Problem<br />
des Vertrauens in das Leben.<br />
Hast du dir einmal überlegt,<br />
warum ich meine Freunde<br />
ihr Manna jeden Tag neu<br />
einsammeln ließ? Weil<br />
das Leben hier in dieser<br />
Dimension der linearen<br />
24<br />
<strong>oora</strong> 04/11
Vom Mut, Dinge sterben zu lassen | Ende<br />
Sterben heißt, die Schmerzen des Verlusts<br />
zu ertragen mit der Perspektive, etwas loszulassen,<br />
aber doch nur in der Hoffnung,<br />
Neues zu empfangen.<br />
Zeitausbreitung ständig voranschreitet<br />
und sich beständig verändert. Kein Herzschlag<br />
gleicht dem Vorigen. Solange ihr<br />
noch auf der Wanderung seid und nicht<br />
am Ziel, wandelt sich alles beständig,<br />
und du musst Abschied nehmen in jeder<br />
Sekunde. Das Manna, das dich heute<br />
noch am Leben erhält, ist morgen schon<br />
dein totes Gestern. Und selbst die Toten<br />
werden noch einmal eine Änderung<br />
erfahren, sie werden Abschied nehmen<br />
müssen vom Hades, dem Totenreich, in<br />
dem alle Seelen bis zum jüngsten Gericht<br />
zwischengelagert sind, und sie werden<br />
auferstehen müssen, um dann endgültig<br />
an ihr anvisiertes Ziel zu kommen, entweder<br />
zu mir in die ewige Heimat oder<br />
eben in den zweiten, den endgültigen<br />
Tod, das ewige Verwehen im Nichts. Beides<br />
ist dann endgültig. Meine Ewigkeit<br />
beendet das Sterben-lassen-müssen, die<br />
ständigen Abschiede und Neubeginne.<br />
Nur wenn meine Freunde das Ziel nicht<br />
sehen können und ihre Leben nicht als<br />
Wanderung begreifen, dann machen ihnen<br />
die Abschiede Angst, weil sie sie aus<br />
der Wärme des Vertrauten herausreißen<br />
und so schockieren. Verstehst du das,<br />
Mickey? Folge mir nach …«<br />
Nach diesem langen Vortrag war ich<br />
jetzt etwas platt. Das muss man ja auch<br />
erst einmal verdauen. Zum Glück kam<br />
in diesem Moment gerade unser Freund<br />
Johannes Schreiter durch die Tür und<br />
lud uns zum Essen ein. Dankbar beendete<br />
ich vorerst das herausfordernde Gespräch<br />
mit meinem Freund Gott. Aber<br />
ich konnte ihn die ganze Zeit auf dem<br />
Weg zum Restaurant hinter uns spüren,<br />
und ich wusste genau, dass er fröhlich<br />
schmunzelte, weil er wieder einmal einen<br />
Samen des Lebens in meine Erde versenkt<br />
hatte, damit er dort stirbt …<br />
Seitdem bitte ich meinen Freund Gott<br />
nicht nur um den Mut, Dinge sterben<br />
zu lassen, sondern um die Weisheit, Anfang<br />
und Ende in einen Zusammenhang<br />
bringen zu können und die Gnade, mein<br />
Leben immer mehr aus einer Hubschrauber-<br />
oder besser Gipfelperspektive betrachten<br />
zu können. Und dann schnalle<br />
ich mir den Rucksack wieder auf den Rücken<br />
und mache mich daran, das nächste<br />
Tal zu durchwandern und zu genießen<br />
bis hin zum nächsten Gipfelkreuz. ///<br />
Fußnoten:<br />
1 www.neue-stadthalle-langen.de/lang-de/GlasWerke/c151<br />
2 Kurzvideo von und mit Mickey im Kellerfoyer des<br />
Glasmuseums: youtu.be/6Y76GKsSzrc<br />
Mickey Wiese (51), länger als er lebt mit Jesus<br />
befreundet, ist als Event-Pastor, systemischer<br />
Berater für störende Schüler und in einigen anderen<br />
Rollen unterwegs. Er hat Sehnsüchte nach<br />
Glauben im Alltag, wird gerne gegooglet und findet<br />
Beerdigungen fast besser als Hochzeiten, feiert<br />
letztere aber ausgiebiger.<br />
<strong>oora</strong>.de 25