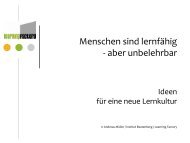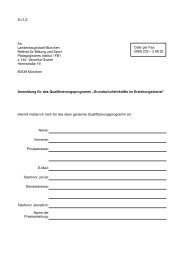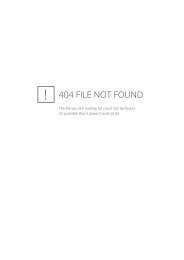Symposium - Pädagogisches Institut
Symposium - Pädagogisches Institut
Symposium - Pädagogisches Institut
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Pädagogisches</strong> <strong>Institut</strong> • Dokumentation <strong>Symposium</strong> 2013 • Vortrag Prof. Dr. Mechtild Gomolla<br />
Blatt 2 von 11<br />
Ausgangspunkt für meinen Vortrag ist die Feststellung, dass sich Konzepte zur interkulturellen Öffnung<br />
oder zur Inklusion zwar meistens ausdrücklich zum Ziel der Nicht-Diskriminierung bekennen, aber, dass<br />
Diskriminierung im institutionellen Leben von Kindergärten oder Schulen nicht nur aus individuellen Vorurteilen<br />
resultiert und nicht nur in informellen Kontakten zustande kommt, sondern auch in den formalen<br />
Rahmungen des pädagogischen und administrativen Handelns eingebettet ist, bleibt zumeist unterbelichtet.<br />
Und mangels eines klaren Verständnisses über die Ursachen von Diskriminierung bleiben auch die<br />
Handlungskonzepte an diesem Punkt vielfach diffus. Auf diese Weise wiederholen auch Strategien der<br />
interkulturellen Öffnung oder der Schul- und Unterrichtsentwicklung oft die alten Probleme kompensatorischer<br />
Fördermaßnahmen für bestimmte als benachteiligt etikettierte Gruppen (Ausländerpädagogik),<br />
sowie die Probleme der frühen, naiven Konzepte Interkultureller oder Antirassistischer Pädagogik: Defizitkonstruktionen<br />
und Essentialisierung kultureller Unterschiede, während diskriminierende Strukturen intakt<br />
bleiben. Konzepte des ›Diversity Mainstreaming/-Management‹ oder der ›Interkulturellen Öffnung‹ entpuppen<br />
sich dann sozusagen als ›alter Wein im neuen Schlauch‹ des populären Organisationsentwicklungsjargons.<br />
In meinem weiteren Vortrag gehe ich zunächst auf den Begriff der institutionellen Diskriminierung ein (2.).<br />
Dabei werde ich zeigen, warum es so schwierig ist, diese Form der Diskriminierung zum Gegenstand<br />
pädagogischer Entwicklungsarbeit zu machen (2.1). Auf der Grundlage von Studien über die Mechanismen<br />
institutioneller Diskriminierung, wie aus der Forschung über innovative Strategien, um Ungerechtigkeit<br />
und Ungleichheit in Schulen wirksam zu unterbinden, werde ich in einem ersten Schritt auf einer<br />
pragmatischen Ebene einige Interventionspunkte und Gelingensbedingungen für eine nicht-diskriminierende<br />
pädagogische Entwicklungsarbeit zusammenfassen, über die in der Literatur weitgehend Einigkeit<br />
besteht (2.2). Mit solchen eher technologischen Gesichtspunkten, die für die Gestaltung und Umsetzung<br />
schulischer Innovationen unerlässlich sind, ist aber noch nichts über die inhaltliche Ausrichtung schulischer<br />
Prozesse im Umgang mit den Spannungen von Differenz und Gleichheitszielen gesagt. Von daher<br />
möchte ich hier noch einen Schritt weiter gehen und auf einer programmatischen Ebene mit der Gerechtigkeitstheorie<br />
Nancy Frasers einen theoretischen Rahmen anbieten, vor dem man genauer diskutieren<br />
kann, welche Strategien geeignet sind, um eine differenzsensible und diskriminierungskritische Bildungspraxis<br />
in einem spezifischen lokalen Kontext zu verankern (3.). Vor diesem Hintergrund möchte ich etablierte<br />
und neue Strategien zum Umgang mit migrationsbedingter Heterogenität in Kindergärten und<br />
Schulen diskutieren und abschließend einige Fragen zusammenfassen, die Sie vielleicht in Ihren Workshops<br />
an die Praxiskonzepte richten können, mit denen Sie sich beschäftigen (4.).<br />
2. <strong>Institut</strong>ionelle Diskriminierung<br />
2.1 Was ist institutionelle Diskriminierung?<br />
Im deutschen Sprachraum werden Rassismus, Sexismus oder Diskriminierungen ›behinderter‹ Menschen<br />
zumeist in einem ›minimalistischen‹ Verständnis als Resultat von Vorurteilen einzelner Personen oder<br />
relativ klar einzugrenzender sozialer Gruppen (z.B. rassistische oder rechtsextremistische Orientierungen<br />
sozio-ökonomisch marginalisierter Jugendlicher) definiert. Dabei wird vielfach unterstellt, diskriminierende<br />
Praktiken stellten eine Art ›Unfall‹ dar – eine Ausnahmeerscheinung in einer gesellschaftlichen Praxis, in<br />
der demokratische Prinzipien der Fairness und Meritokratie die Regel sind.<br />
Der Begriff institutionelle Diskriminierung (iD) sucht demgegenüber die Einbettung von Diskriminierung in<br />
den Organisationsstrukturen und Arbeitskulturen in zentralen gesellschaftlichen <strong>Institut</strong>ionen, wie v.a. Bildung,<br />
Arbeit, Wohnen, Versorgung mit sozialen Dienstleistungen, zu erfassen. Ungleichheitseffekte werden<br />
– ohne von unmittelbar diskriminierenden Absichten und Einstellungen der Akteure auszugehen – mit<br />
institutionellen Handlungskontexten in Beziehung gesetzt. In den Blick genommen werden v.a. rechtliche<br />
und politische Vorgaben, sowie organisatorische Strukturen, Programme, Routinen und institutionelle<br />
Wissenshaushalte, die das Handeln der Akteure in den <strong>Institut</strong>ionen auf komplexe und oft schwer durchschaubare<br />
Weise strukturieren.<br />
Herausgegeben von:<br />
Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und Sport,<br />
<strong>Pädagogisches</strong> <strong>Institut</strong>, Herrnstraße 19, 80539 München,<br />
www.pi-muenchen.de<br />
<strong>Symposium</strong><br />
2013