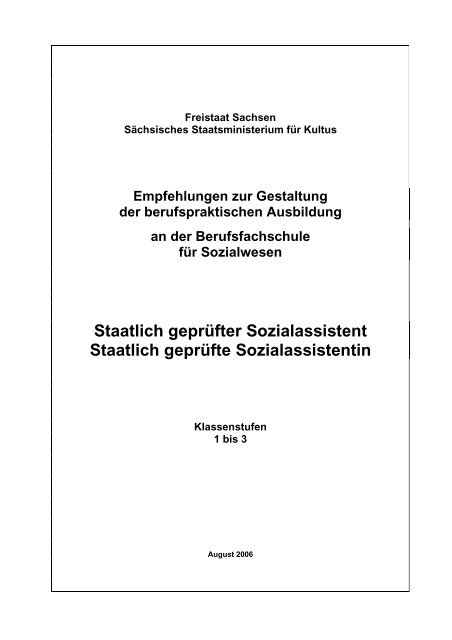Empfehlungen zur Gestaltung der berufspraktischen Ausbildung an ...
Empfehlungen zur Gestaltung der berufspraktischen Ausbildung an ...
Empfehlungen zur Gestaltung der berufspraktischen Ausbildung an ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Freistaat Sachsen<br />
Sächsisches Staatsministerium für Kultus<br />
<strong>Empfehlungen</strong> <strong>zur</strong> <strong>Gestaltung</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>berufspraktischen</strong> <strong>Ausbildung</strong><br />
<strong>an</strong> <strong>der</strong> Berufsfachschule<br />
für Sozialwesen<br />
Staatlich geprüfter Sozialassistent<br />
Staatlich geprüfte Sozialassistentin<br />
Klassenstufen<br />
1 bis 3<br />
August 2006
Die <strong>Empfehlungen</strong> <strong>zur</strong> <strong>Gestaltung</strong> <strong>der</strong> <strong>berufspraktischen</strong> <strong>Ausbildung</strong> sind ab dem<br />
1. August 2006 freigegeben.<br />
I m p r e s s u m<br />
Die <strong>Empfehlungen</strong> <strong>zur</strong> <strong>Gestaltung</strong> <strong>der</strong> <strong>berufspraktischen</strong> <strong>Ausbildung</strong> basieren auf dem<br />
Lehrpl<strong>an</strong> Staatlich geprüfter Sozialassistent/staatlich geprüfte Sozialassistentin vom<br />
August 2005, <strong>der</strong> Verordnung des SMK Berufsfachschule im Freistaat Sachsen, mit<br />
St<strong>an</strong>d 9. Februar 2005, dem Erlass zu Neuregelungen für die Berufsfachschule Sozialwesen<br />
vom 20. September 2005 und <strong>der</strong> Rahmenvereinbarung <strong>der</strong> Kultusministerkonferenz<br />
über die Berufsfachschulen vom 28.02.1997 i. d. F. vom 22.10.2004.<br />
Die <strong>Empfehlungen</strong> <strong>zur</strong> <strong>Gestaltung</strong> <strong>der</strong> <strong>berufspraktischen</strong> <strong>Ausbildung</strong> wurden unter Leitung<br />
des<br />
Sächsischen Staatsinstituts für Bildung und Schulentwicklung<br />
Comenius-Institut<br />
Dresdner Straße 78 c<br />
01445 Radebeul<br />
www.comenius-institut.de<br />
unter Mitwirkung von<br />
Kathrin H<strong>an</strong>ak<br />
Gabriele Markus<br />
Carmen Wollenberg-Menssen<br />
Gundula Schubert<br />
Leipzig<br />
Bad Lausick<br />
Dresden<br />
Großenhain<br />
erarbeitet.<br />
HERAUSGEBER<br />
Sächsisches Staatsministerium für Kultus<br />
Carolaplatz 1<br />
01097 Dresden<br />
www.sachsen-macht-schule.de<br />
VERTRIEB<br />
www.comenius-institut.de
Staatlich geprüfter Sozialassistent<br />
Berufsfachschule Staatlich geprüfte Sozialassistentin Klassenstufen 1 bis 3<br />
___________________________________________________________________________________<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Seite<br />
Kurzcharakteristik 4<br />
Org<strong>an</strong>isatorische Aspekte 5<br />
Inhaltliche <strong>Gestaltung</strong> 7<br />
Dokumentation und Bewertung 14<br />
___________________________________________________________________________________<br />
3
Staatlich geprüfter Sozialassistent<br />
Klassenstufen 1 bis 3 Staatlich geprüfte Sozialassistentin Berufsfachschule<br />
___________________________________________________________________________________<br />
Kurzcharakteristik<br />
Die "<strong>Empfehlungen</strong> <strong>zur</strong> <strong>Gestaltung</strong> <strong>der</strong> <strong>berufspraktischen</strong> <strong>Ausbildung</strong>" sollen sowohl<br />
den Lehrkräften <strong>der</strong> Berufsfachschule als auch den Fachkräften <strong>der</strong> Einrichtungen, in<br />
denen die Schülerinnen und Schüler ihre berufspraktische <strong>Ausbildung</strong> absolvieren,<br />
einen Orientierungsrahmen geben. Sie bilden die Grundlage für die org<strong>an</strong>isatorische<br />
und inhaltliche Abstimmung zwischen Schülerin/Schüler, Berufsfachschule und Praxiseinrichtung.<br />
Grundlage <strong>der</strong> <strong>berufspraktischen</strong> <strong>Ausbildung</strong> sind die Verordnung des Sächsischen<br />
Staatsministeriums für Kultus über die Berufsschule im Freistaat Sachsen (Schulordnung<br />
Berufsfachschule - BFSO) in ihrer jeweils geltenden Fassung und die Rahmenvereinbarung<br />
<strong>der</strong> Kultusministerkonferenz über die Berufsfachschulen vom 28.02.1997<br />
i. d. F. vom 22.10.2004.<br />
Das Ziel <strong>der</strong> <strong>Ausbildung</strong> <strong>an</strong> <strong>der</strong> Berufsfachschule besteht im Erwerb <strong>der</strong> für die Tätigkeit<br />
einer Sozialassistentin/eines Sozialassistenten erfor<strong>der</strong>lichen Kenntnisse, Fähigkeiten<br />
und Fertigkeiten, um den vielfältigen Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> pflegerischen und sozialpädagogischen<br />
H<strong>an</strong>dlungsfel<strong>der</strong> gerecht zu werden. Dabei steht die weitere Entwicklung<br />
<strong>der</strong> Persönlichkeit, vor allem im Hinblick auf Ver<strong>an</strong>twortungsbewusstsein und<br />
Leistungsbereitschaft im Mittelpunkt <strong>der</strong> <strong>berufspraktischen</strong> <strong>Ausbildung</strong>.<br />
Die Verzahnung von Theorie und Praxis und <strong>der</strong> unterschiedlichen Lernorte ist durchgängiges<br />
Prinzip <strong>der</strong> gesamten <strong>Ausbildung</strong>. In <strong>der</strong> <strong>berufspraktischen</strong> <strong>Ausbildung</strong> erleben<br />
und erfahren die Schülerinnen und Schüler die Notwendigkeit, berufliches H<strong>an</strong>deln<br />
zu reflektieren und zu begründen.<br />
Im Verlauf <strong>der</strong> zwei- bzw. dreijährigen schulischen <strong>Ausbildung</strong> finden Pflicht- und Wahlpflichtpraktika<br />
statt. Die Praktika werden in geeigneten Einrichtungen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>- und<br />
Jugendhilfe, <strong>der</strong> Behin<strong>der</strong>tenhilfe und <strong>der</strong> Pflege absolviert.<br />
Mit Abschluss <strong>der</strong> <strong>Ausbildung</strong> verfügen die Schülerinnen und Schüler über Basiskompetenzen,<br />
die sie befähigen, in pflegerischen und sozialpädagogischen Arbeitsfel<strong>der</strong>n<br />
tätig zu sein. Sie unterstützen die jeweilige Fachkraft <strong>der</strong> Einrichtung und führen übertragene<br />
Aufgaben selbstständig aus. Sie übernehmen pflegerische, sozialpädagogische<br />
und hauswirtschaftliche Dienstleistungen.<br />
Die berufspraktische <strong>Ausbildung</strong> trägt dazu bei, dass folgende Kompetenzen entwickelt<br />
werden:<br />
- Fähigkeit <strong>zur</strong> Orientierung in den unterschiedlichen Arbeitsfel<strong>der</strong>n<br />
- Beobachtungsfähigkeit<br />
- Urteilskraft und Entscheidungsfähigkeit<br />
- Fähigkeit <strong>zur</strong> <strong>Gestaltung</strong> und Unterstützung von Beziehungen, Kooperations- und<br />
Kommunikationsfähigkeit<br />
- Fähigkeit, sich in das jeweilige Team einzuordnen und aktiv einzubringen<br />
- Fähigkeit <strong>zur</strong> Pl<strong>an</strong>ung und selbstkritischen Reflektion des eigenen H<strong>an</strong>delns<br />
Die berufspraktische <strong>Ausbildung</strong> schließt mit einer praktischen Prüfung am Ende des<br />
letzten Wahlpflichtpraktikums ab, die Entscheidung für das Arbeitsfeld liegt bei den<br />
Schülerinnen und Schülern.<br />
___________________________________________________________________________________<br />
4
Staatlich geprüfter Sozialassistent<br />
Berufsfachschule Staatlich geprüfte Sozialassistentin Klassenstufen 1 bis 3<br />
___________________________________________________________________________________<br />
Org<strong>an</strong>isatorische Aspekte<br />
Die berufspraktische <strong>Ausbildung</strong> umfasst laut Stundentafel 800 Stunden im zweijährigen<br />
und 960 Stunden im dreijährigen Bildungsg<strong>an</strong>g.<br />
Im zweijährigen Bildungsg<strong>an</strong>g finden folgende vier Praxiseinsätze statt:<br />
- fünfwöchiges Praktikum in einer Einrichtung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>- und Jugendhilfe<br />
- fünfwöchiges Praktikum in einer Einrichtung <strong>der</strong> Behin<strong>der</strong>tenhilfe<br />
- fünfwöchiges Praktikum in einer Pflegeinrichtung<br />
- fünfwöchiges Praktikum in einem von <strong>der</strong> Schülerin/dem Schüler selbst gewählten<br />
Arbeitsfeld (Wahlpflichtpraktikum)<br />
Im dreijährigen Bildungsg<strong>an</strong>g finden folgende fünf Praxiseinsätze statt:<br />
- fünfwöchiges Praktikum in einer Einrichtung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>- und Jugendhilfe<br />
- fünfwöchiges Praktikum in einer Einrichtung <strong>der</strong> Behin<strong>der</strong>tenhilfe<br />
- fünfwöchiges Praktikum in einer Pflegeinrichtung<br />
- vierwöchiges Praktikum in einem von <strong>der</strong> Schülerin/dem Schüler selbst gewählten<br />
Arbeitsfeld (Wahlpflichtpraktikum)<br />
- fünfwöchiges Praktikum in einem von <strong>der</strong> Schülerin/dem Schüler selbst gewählten<br />
Arbeitsfeld (Wahlpflichtpraktikum)<br />
Die Zuordnung <strong>der</strong> Bereiche zu den <strong>Ausbildung</strong>sjahren ist im Rahmen <strong>der</strong><br />
Pflichtpraktika den Schulen überlassen. Die Org<strong>an</strong>isation und Pl<strong>an</strong>ung <strong>der</strong> Einsätze<br />
liegt in <strong>der</strong> Ver<strong>an</strong>twortung <strong>der</strong> Schule.<br />
Die Auswahl <strong>der</strong> Einrichtungen richtet sich nach den festgelegten <strong>Ausbildung</strong>szielen<br />
und erfolgt in Absprache zwischen Schülerin/Schüler, Schule und Praxiseinrichtung.<br />
Während <strong>der</strong> <strong>Ausbildung</strong> sind Praxiseinsätze in den drei gefor<strong>der</strong>ten Bereichen zu absolvieren.<br />
Die Wahl des Arbeitsfeldes in den Wahlpflichtpraktika obliegt <strong>der</strong> Schülerin/<br />
dem Schüler.<br />
Die Entscheidung über die Eignung einer Praxiseinrichtung trifft entsprechend § 11<br />
BFSO die Schule.<br />
Es wird empfohlen, solche Praxiseinrichtungen auszuwählen, die für die fachliche Begleitung<br />
<strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler eine qualifizierte Fachkraft als Praxis<strong>an</strong>leiterin/<br />
Praxis<strong>an</strong>leiter benennen.<br />
Im Prozess <strong>der</strong> <strong>berufspraktischen</strong> <strong>Ausbildung</strong> soll sich die Praxis<strong>an</strong>leiterin/<strong>der</strong> Praxis<strong>an</strong>leiter<br />
als Berater, Mo<strong>der</strong>ator und Identifikationsfigur verstehen und folgende Aufgaben<br />
übernehmen:<br />
- Hineinversetzen in die Perspektive <strong>der</strong> Schülerin/des Schülers<br />
- Her<strong>an</strong>führen <strong>an</strong> die Abläufe <strong>der</strong> Einrichtung und Ermöglichen <strong>der</strong> Partizipation<br />
- Motivation <strong>der</strong> Schülerin/des Schülers<br />
- Übertragen von Aufgaben entsprechend <strong>der</strong> Zielstellung des jeweiligen Praktikums<br />
- Anleitung und Hilfestellung bei <strong>der</strong> Erfüllung von Assistenzaufgaben<br />
- Reflexion, Bewertung und Dokumentation von Leistungen nach zwischen Schülerin/<br />
Schüler, Schule und Praxiseinrichtung abgestimmten und tr<strong>an</strong>sparenten Kriterien<br />
___________________________________________________________________________________<br />
5
Staatlich geprüfter Sozialassistent<br />
Klassenstufen 1 bis 3 Staatlich geprüfte Sozialassistentin Berufsfachschule<br />
___________________________________________________________________________________<br />
Die Schülerin/<strong>der</strong> Schüler erhält von <strong>der</strong> Schule für jedes Praktikum einen Praktikumsauftrag<br />
und stimmt die konkrete Umsetzung dieses Auftrages mit <strong>der</strong> Praxis<strong>an</strong>leiterin/<br />
dem Praxis<strong>an</strong>leiter ab.<br />
Die Schülerinnen und Schüler sollen pro Praktikum mindestens einmal in <strong>der</strong> Praxiseinrichtung<br />
von <strong>der</strong> Lehrkraft beraten und begleitet werden. Der zeitliche Umf<strong>an</strong>g ist in<br />
§ 11 (2) BFSO geregelt.<br />
Die Praxisbesuche beinhalten:<br />
- die Beobachtung <strong>der</strong> Tätigkeit <strong>der</strong> Schülerin/des Schülers<br />
- reflektierende und beratende Gespräche<br />
- Rückmeldung <strong>zur</strong> Entwicklung <strong>der</strong> beruflichen H<strong>an</strong>dlungskompetenz<br />
Für jeden Praxiseinsatz wird zwischen <strong>der</strong> Schülerin/dem Schüler, <strong>der</strong> Schule und <strong>der</strong><br />
Praxiseinrichtung sowie ggf. dem Träger <strong>der</strong> Einrichtung eine schriftliche Praxisvereinbarung<br />
abgeschlossen.<br />
Die Praxisvereinbarung regelt:<br />
- Zeitraum und Dauer des Praktikums<br />
- Pflichten <strong>der</strong> Praxiseinrichtung<br />
- Pflichten <strong>der</strong> Schülerin/des Schülers<br />
- Versicherungsschutz<br />
- Praktikumsauftrag<br />
Die Arbeitszeit für die Schülerinnen und Schüler entspricht <strong>der</strong> tariflichen Wochenarbeitszeit.<br />
Der Einsatz richtet sich nach den Möglichkeiten und Erfor<strong>der</strong>nissen <strong>der</strong><br />
Einrichtung. K<strong>an</strong>n die tarifliche Arbeitszeit nicht vollständig in <strong>der</strong> Einrichtung abgeleistet<br />
werden, so sollten den Schülerinnen und Schülern Aufgaben übertragen werden,<br />
die eine Anwesenheit in <strong>der</strong> Einrichtung nicht voraussetzen. Dazu gehören insbeson<strong>der</strong>e<br />
Vor- und Nachbereitungen.<br />
___________________________________________________________________________________<br />
6
Staatlich geprüfter Sozialassistent<br />
Berufsfachschule Staatlich geprüfte Sozialassistentin Klassenstufen 1 bis 3<br />
___________________________________________________________________________________<br />
Inhaltliche <strong>Gestaltung</strong><br />
Erstes Pflichtpraktikum<br />
Das erste Praktikum wird in fünf zusammenhängenden Wochen durchgeführt und sollte<br />
in <strong>der</strong> ersten Hälfte des ersten <strong>Ausbildung</strong>sjahres stattfinden. Es k<strong>an</strong>n in allen sozialpädagogischen<br />
und pflegerischen Arbeitsfel<strong>der</strong>n stattfinden. Das Praktikum dient einer<br />
ersten Überprüfung persönlicher Berufswahlmotive und unterstützt einen praxisorientierten<br />
<strong>Ausbildung</strong>seinstieg.<br />
Die Schülerinnen und Schüler erwerben einen Einblick in die Arbeitsprozesse <strong>der</strong> ausgewählten<br />
Einrichtung. Sie erleben und beobachten das H<strong>an</strong>deln <strong>der</strong> Fachkräfte und<br />
erfassen <strong>der</strong>en ver<strong>an</strong>twortungsvolle Rolle. Sie beteiligen sich <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>Gestaltung</strong> des<br />
Tagesablaufes in <strong>der</strong> Einrichtung, indem sie die Fachkräfte bei ihrer Arbeit unterstützen.<br />
Die Schülerinnen und Schüler kennen die Struktur <strong>der</strong> Praxiseinrichtung. Sie erleben<br />
die Notwendigkeit <strong>der</strong> Beziehungsgestaltung für ihre Arbeit und setzen sich mit<br />
ihrer Rolle in den Beziehungen zu Klienten und Kollegen ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>. Sie ziehen<br />
eigene Schlussfolgerungen für ihr H<strong>an</strong>deln. Sie gehen auf ihre Klienten zu und nehmen<br />
Kontakte auf. Sie sind sicher im Umg<strong>an</strong>g mit den räumlichen Gegebenheiten und zeitlichen<br />
Abläufen <strong>der</strong> Einrichtung.<br />
Daraus ergeben sich für das erste Praktikum folgende Rahmenaufgaben:<br />
- Einsichtnahme in die Konzeption bzw. vergleichbare Unterlagen <strong>der</strong> jeweiligen Einrichtung<br />
- Erfassen <strong>der</strong> räumlichen Gegebenheiten <strong>der</strong> Einrichtung<br />
- Erfassen <strong>der</strong> Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>an</strong> das H<strong>an</strong>deln <strong>der</strong> Fachkräfte<br />
- Beschreiben <strong>der</strong> Einrichtung und des Tagesablaufes<br />
- Notieren <strong>der</strong> bestehenden Regeln in <strong>der</strong> Einrichtung<br />
- Übernahme von ausgewählten Assistenzaufgaben in verschiedenen Tagesabschnitten<br />
- Sammeln von Materialien und Ideen <strong>zur</strong> <strong>Gestaltung</strong> von Assistenzaufgaben<br />
- sich gegenüber Klienten, Mitarbeitern und Angehörigen in geeigneter Form vorstellen<br />
- Üben von Kontaktaufnahme zu Klienten<br />
- <strong>an</strong>geleitete Reflexion <strong>der</strong> Beziehungen zu den Klienten<br />
- Teilnahme <strong>an</strong> Gesprächen im Team<br />
Zweites Pflichtpraktikum<br />
Dieses Praktikum sollte im zweiten Halbjahr des ersten <strong>Ausbildung</strong>sjahres durchgeführt<br />
werden und umfasst fünf Wochen. Zur Auswahl stehen alle sozialpädagogischen und<br />
pflegerischen Einrichtungen. Die Schülerinnen und Schüler absolvieren ihr zweites<br />
Praktikum in einem Bereich, <strong>der</strong> nicht im ersten Praktikum gewählt wurde.<br />
Das zweite Pflichtpraktikum dient <strong>der</strong> Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung mit den H<strong>an</strong>dlungsabläufen<br />
und Aufgaben von Sozialassistenten in einem weiteren Arbeitsfeld. Zentraler Gegenst<strong>an</strong>d<br />
des Praktikums ist die Erweiterung kommunikativer Kompetenzen und <strong>der</strong> Beobachtungsfähigkeit.<br />
___________________________________________________________________________________<br />
7
Staatlich geprüfter Sozialassistent<br />
Klassenstufen 1 bis 3 Staatlich geprüfte Sozialassistentin Berufsfachschule<br />
___________________________________________________________________________________<br />
Die Schülerinnen und Schüler erkennen ihre Ver<strong>an</strong>twortung in <strong>der</strong> <strong>Gestaltung</strong> von Beziehungen.<br />
Unter Anleitung <strong>der</strong> Fachkraft gestalten sie diese zu ihren Klienten, wählen<br />
geeignete Mittel <strong>der</strong> Kommunikation aus und nutzen sie bewusst.<br />
Die Schülerinnen und Schüler beobachten Situationen aus dem Alltag <strong>der</strong> Klienten und<br />
dokumentieren ihre eigenen Beobachtungen. Sie erkennen Abweichungen vom alltäglichen<br />
Geschehen und informieren die Fachkraft. Sie beteiligen sich <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>Gestaltung</strong><br />
von Räumen und Tagesabläufen. Sie erproben und nutzen die verschiedenen Ausdrucksformen<br />
und Medien <strong>zur</strong> <strong>Gestaltung</strong> einer <strong>an</strong>regenden Umgebung.<br />
Die Schülerinnen und Schüler führen die ihnen von <strong>der</strong> Fachkraft übertragenen Assistenzaufgaben<br />
selbstständig aus. Sie kennen ihre Rolle in Abgrenzung zu <strong>an</strong><strong>der</strong>en Professionen<br />
und beschreiben die Abläufe <strong>der</strong> Zusammenarbeit im Team.<br />
Daraus ergeben sich für das zweite Praktikum folgende Rahmenaufgaben:<br />
- Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung mit <strong>der</strong> Konzeption <strong>der</strong> Einrichtung und Erfassen <strong>der</strong> Paradigmen<br />
für das H<strong>an</strong>deln <strong>der</strong> Professionellen<br />
- Beschreibung <strong>der</strong> zeitlichen, räumlichen, materiellen und personellen Strukturelemente<br />
(z. B. Tagesablauf, Raumaufteilung, Qualifizierungen)<br />
- Üben und Erproben verschiedener Ausdrucksformen und Anwenden von Medien<br />
- Sammeln von Materialien und Ideen <strong>zur</strong> <strong>Gestaltung</strong> von Assistenzaufgaben<br />
- Assistenz bei <strong>der</strong> <strong>Gestaltung</strong> von Räumen und Tagesabläufen<br />
- Einblick nehmen in die Dokumentation<br />
- schriftliche Dokumentation eigener Beobachtungen<br />
- Beteiligung <strong>an</strong> Gesprächen und Diskussionen im Team<br />
- Üben von Interaktion und Kommunikation mit den Klienten sowie <strong>an</strong>geleitete Reflexion<br />
- selbstständiges Ausführen von Assistenzaufgaben und Beschreiben <strong>der</strong> Durchführung<br />
und des Gelingens<br />
Drittes Pflichtpraktikum<br />
Dieses Praktikum sollte im ersten Halbjahr des zweiten <strong>Ausbildung</strong>sjahres durchgeführt<br />
werden und umfasst fünf Wochen. Zur Auswahl stehen alle sozialpädagogischen und<br />
pflegerischen Einrichtungen. Die Schülerinnen und Schüler absolvieren ihr drittes<br />
Praktikum in einem Bereich, <strong>der</strong> nicht im ersten und zweiten Pflichtpraktikum gewählt<br />
wurde.<br />
Das dritte Praktikum führt die Schülerinnen und Schüler des zweijährigen Bildungsg<strong>an</strong>ges<br />
<strong>zur</strong> vertieften Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung mit dem breiten Spektrum beruflicher Aufgaben<br />
von Sozialassistenten und zu Sicherheit im beruflichen H<strong>an</strong>deln, insbeson<strong>der</strong>e in <strong>der</strong><br />
<strong>Gestaltung</strong> von Beziehungen. Die Schülerinnen und Schüler <strong>der</strong> dreijährigen <strong>Ausbildung</strong><br />
erweitern das Spektrum beruflicher H<strong>an</strong>dlungen durch Erfahrungen in einem dritten<br />
Arbeitsfeld, ohne abschließend Sicherheit zu gewinnen. Für die Schülerinnen und<br />
Schüler des dreijährigen Bildungsg<strong>an</strong>ges steht die Entwicklung persönlicher Kompetenzen<br />
weiterhin im Mittelpunkt. Aus diesem Grund werden im Folgenden Differenzierungen<br />
bei den Zielen und Aufgaben für den zweijährigen und dreijährigen Bildungsg<strong>an</strong>g<br />
vorgenommen.<br />
___________________________________________________________________________________<br />
8
Staatlich geprüfter Sozialassistent<br />
Berufsfachschule Staatlich geprüfte Sozialassistentin Klassenstufen 1 bis 3<br />
___________________________________________________________________________________<br />
Zweijähriger Bildungsg<strong>an</strong>g<br />
Die Schülerinnen und Schüler verstehen die Struktur <strong>der</strong> Einrichtung und unterscheiden<br />
die H<strong>an</strong>dlungsabläufe in unterschiedlichen sozialpädagogischen und pflegerischen<br />
Einrichtungen. Sie nehmen jeden Klienten in seiner Individualität wahr und berücksichtigen<br />
dessen Interessen, Bedürfnisse und Ressourcen. Sie beobachten sich selbst und<br />
die zu betreuenden Klienten strukturiert und zielgerichtet. Entsprechend den Erfor<strong>der</strong>nissen<br />
<strong>der</strong> Einrichtung dokumentieren sie eigene Beobachtungen und leiten pl<strong>an</strong>volles<br />
H<strong>an</strong>deln ab. Sie führen die übertragenen Aufgaben auch unter Zeitdruck und verän<strong>der</strong>ten<br />
Umständen gewissenhaft aus. Gemeinsam mit Klienten und Fachkräften pl<strong>an</strong>en sie<br />
verschiedene Aktivitäten und Angebote im Alltag und führen diese durch.<br />
Die Schülerinnen und Schüler verstehen sich als Teil des Teams und tragen die getroffenen<br />
Entscheidungen mit.<br />
Dreijähriger Bildungsg<strong>an</strong>g<br />
Die Schülerinnen und Schüler verstehen die Struktur <strong>der</strong> Einrichtung und unterscheiden<br />
die H<strong>an</strong>dlungsabläufe in unterschiedlichen sozialpädagogischen und pflegerischen<br />
Einrichtungen. Sie erkennen die Interessen und Bedürfnisse ihrer Klienten. Auf <strong>der</strong><br />
Grundlage von Informationen durch die Fachkraft und in <strong>der</strong>en Auftrag richten sie ihr<br />
H<strong>an</strong>deln <strong>an</strong> den Ressourcen <strong>der</strong> Klienten aus. Sie beobachten sich selbst und die zu<br />
betreuenden Klienten. Sie dokumentieren eigene Beobachtungen und leiten in Absprache<br />
mit <strong>der</strong> Fachkraft pl<strong>an</strong>volles H<strong>an</strong>deln ab. Sie erkennen verän<strong>der</strong>te Umstände.<br />
Die Schülerinnen und Schüler wenden geeignete Mittel <strong>der</strong> Kommunikation zielgerichtet<br />
<strong>an</strong> und reflektieren ihr Kommunikationsverhalten kritisch. Gemeinsam mit Klienten<br />
und Fachkräften pl<strong>an</strong>en sie verschiedene Aktivitäten und Angebote im Alltag und führen<br />
diese durch.<br />
Die Schülerinnen und Schüler verstehen sich als Teil des Teams und verhalten sich<br />
kooperativ. Sie begegnen ihren Klienten, <strong>der</strong>en Angehörigen und den Kollegen mit<br />
Respekt, Verständnis und Höflichkeit.<br />
___________________________________________________________________________________<br />
9
Staatlich geprüfter Sozialassistent<br />
Klassenstufen 1 bis 3 Staatlich geprüfte Sozialassistentin Berufsfachschule<br />
___________________________________________________________________________________<br />
Daraus ergeben sich für das dritte Praktikum folgende Rahmenaufgaben:<br />
zweijähriger Bildungsg<strong>an</strong>g<br />
dreijähriger Bildungsg<strong>an</strong>g<br />
Darstellen <strong>der</strong> Struktur und <strong>der</strong> H<strong>an</strong>dlungsabläufe<br />
<strong>der</strong> Einrichtung<br />
Beschreiben eines Klienten, Zuordnung<br />
von Merkmalen und Verhalten, Ressourcen,<br />
Kr<strong>an</strong>kheiten, Interessen und Bedürfnissen<br />
Vergleichen alltäglicher und beson<strong>der</strong>er<br />
Situationen<br />
Üben und Erproben von Ausdrucksformen<br />
und Anwenden von Medien<br />
Reflexion und Dokumentation eigenen<br />
H<strong>an</strong>delns<br />
Pl<strong>an</strong>en, Ausführen und Reflektieren verschiedener<br />
Aktivitäten und Angebote für<br />
den Alltag in <strong>der</strong> Einrichtung<br />
Üben von Interaktion und Kommunikation<br />
in verschiedenen Situationen<br />
Sammeln von Materialien und Ideen <strong>zur</strong><br />
<strong>Gestaltung</strong> von Assistenzaufgaben<br />
aktive Beteiligung <strong>an</strong> Gesprächen im<br />
Team<br />
Darstellen <strong>der</strong> Struktur und <strong>der</strong> H<strong>an</strong>dlungsabläufe<br />
<strong>der</strong> Einrichtung<br />
Beschreiben verschiedener Situationen<br />
des Alltags einschließlich <strong>der</strong> Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
<strong>an</strong> das berufliche H<strong>an</strong>deln<br />
Vergleichen alltäglicher und beson<strong>der</strong>er<br />
Situationen<br />
Üben und Erproben von Ausdrucksformen<br />
und Anwenden von Medien<br />
Reflexion und Dokumentation eigenen<br />
H<strong>an</strong>delns<br />
Beteiligung <strong>an</strong> <strong>der</strong> Pl<strong>an</strong>ung und Ausführung<br />
verschiedener Aktivitäten und Angebote<br />
für den Alltag in <strong>der</strong> Einrichtung<br />
Üben von Interaktion und Kommunikation<br />
in verschiedenen Situationen<br />
Sammeln von Materialien und Ideen <strong>zur</strong><br />
<strong>Gestaltung</strong> von Assistenzaufgaben<br />
aktive Beteiligung <strong>an</strong> Gesprächen im<br />
Team<br />
schriftliche Darstellung <strong>der</strong> Zusammenarbeit<br />
mit Angehörigen<br />
___________________________________________________________________________________<br />
10
Staatlich geprüfter Sozialassistent<br />
Berufsfachschule Staatlich geprüfte Sozialassistentin Klassenstufen 1 bis 3<br />
___________________________________________________________________________________<br />
Erstes Wahlpflichtpraktikum<br />
Dieses Wahlpflichtpraktikum umfasst im zweijährigen Bildungsg<strong>an</strong>g fünf, im dreijährigen<br />
Bildungsg<strong>an</strong>g vier Wochen.<br />
Zur Auswahl stehen alle für die Sozialassistentin/den Sozialassistenten relev<strong>an</strong>ten<br />
sozialpädagogischen und pflegerischen Einrichtungen. Die Wahl des Arbeitsfeldes liegt<br />
bei den Schülerinnen und Schülern.<br />
Das erste Wahlpflichtpraktikum bildet im zweijährigen Bildungsg<strong>an</strong>g den Abschluss <strong>der</strong><br />
<strong>berufspraktischen</strong> <strong>Ausbildung</strong>. Gegen Ende dieses Praktikums erfolgt die praktische<br />
Prüfung. Damit dient dieses Praktikum im zweijährigen Bildungsg<strong>an</strong>g <strong>der</strong> abschließenden<br />
Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung mit den H<strong>an</strong>dlungsabläufen und Aufgaben von Sozialassistentinnen<br />
und Sozialassistenten. Das Praktikum unterstützt im Beson<strong>der</strong>en die Erweiterung<br />
personaler Kompetenzen, die Festigung des eigenen H<strong>an</strong>delns in <strong>der</strong> Berufsrolle<br />
und damit das Ankommen im Beruf.<br />
Im dreijährigen Bildungsg<strong>an</strong>g zielt das erste Wahlpflichtpraktikum auf die Erweiterung<br />
<strong>der</strong> Erfahrungen in den verschiedenen Arbeitsfel<strong>der</strong>n und die vertiefende Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung<br />
mit den H<strong>an</strong>dlungsabläufen und Aufgaben.<br />
Das Praktikum dient <strong>der</strong> Verzahnung <strong>der</strong> Lernorte und bildet einen Rahmen für die<br />
eigene Reflexion erworbener Kompetenzen.<br />
Zweijähriger Bildungsg<strong>an</strong>g<br />
Die Schülerinnen und Schüler integrieren sich zuverlässig in die unterschiedlichen<br />
Rahmenbedingungen und Arbeitsabläufe <strong>der</strong> sozialpädagogischen und pflegerischen<br />
Institutionen. Sie pl<strong>an</strong>en ihr H<strong>an</strong>deln über verschiedene Zeiträume entsprechend <strong>der</strong><br />
Arbeitsorg<strong>an</strong>isation in <strong>der</strong> Einrichtung und unter Beachtung <strong>der</strong> Interessen, Bedürfnisse<br />
und Ressourcen <strong>der</strong> Klienten. Sie führen die ihnen übertragenen Aufgaben effektiv,<br />
ver<strong>an</strong>twortungsvoll und selbstständig aus.<br />
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren eigene Bedürfnisse und sind sich ihrer Rolle<br />
im Prozess <strong>der</strong> Beziehungsgestaltung bewusst.<br />
Die Schülerinnen und Schüler schätzen Situationen ein, treffen im Rahmen ihrer Assistenzfunktion<br />
Entscheidungen und reagieren sicher und <strong>an</strong>gemessen.<br />
Die Schülerinnen und Schüler unterstützen die Zusammenarbeit <strong>der</strong> Fachkräfte mit den<br />
Angehörigen <strong>der</strong> Klienten.<br />
Die Schülerinnen und Schüler haben eine reflektierte Berufsmotivation.<br />
Dreijähriger Bildungsg<strong>an</strong>g<br />
Die Schülerinnen und Schüler integrieren sich in die unterschiedlichen Rahmenbedingungen<br />
und Arbeitsabläufe <strong>der</strong> sozialpädagogischen und pflegerischen Institutionen.<br />
Die Schülerinnen und Schüler nehmen jeden Klienten in seiner Individualität wahr und<br />
berücksichtigen dessen Interessen, Bedürfnisse und Ressourcen.<br />
Die Schülerinnen und Schüler beobachten sich selbst und die zu betreuenden Klienten<br />
strukturiert und zielgerichtet.<br />
Entsprechend den Erfor<strong>der</strong>nissen <strong>der</strong> Einrichtung dokumentieren sie eigene Beobachtungen<br />
und leiten pl<strong>an</strong>volles H<strong>an</strong>deln ab.<br />
Sie führen die übertragenen Aufgaben auch unter Zeitdruck und verän<strong>der</strong>ten Umständen<br />
gewissenhaft aus.<br />
Die Schülerinnen und Schüler gestalten eine von Empathie und Dialog geprägte<br />
Kommunikation mit Klienten, Angehörigen und Kollegen.<br />
___________________________________________________________________________________<br />
11
Staatlich geprüfter Sozialassistent<br />
Klassenstufen 1 bis 3 Staatlich geprüfte Sozialassistentin Berufsfachschule<br />
___________________________________________________________________________________<br />
Daraus ergeben sich für das erste Wahlpflichtpraktikum folgende Rahmenaufgaben:<br />
zweijähriger Bildungsg<strong>an</strong>g<br />
Üben von Org<strong>an</strong>isationspl<strong>an</strong>ung<br />
Beschreiben von Situationen und Ableiten<br />
von notwendigen H<strong>an</strong>dlungen<br />
Reflexion und Dokumentation eigenen<br />
H<strong>an</strong>delns<br />
Üben und Erproben von Ausdrucksformen<br />
und Anwenden von Medien<br />
Pl<strong>an</strong>en, Ausführen und Reflektieren verschiedener<br />
Aktivitäten und Angebote für<br />
den Alltag in <strong>der</strong> Einrichtung<br />
Üben von Interaktion und Kommunikation<br />
in verschiedenen Situationen<br />
Reflexion eigener Bedürfnisse<br />
Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung mit Möglichkeiten<br />
und Grenzen <strong>der</strong> <strong>Gestaltung</strong> von Beziehungen<br />
<strong>an</strong>h<strong>an</strong>d konkreter Situationen<br />
dreijähriger Bildungsg<strong>an</strong>g<br />
Vergleich <strong>der</strong> H<strong>an</strong>dlungsabläufe von Einrichtungen<br />
verschiedener Arbeitsfel<strong>der</strong><br />
Beschreiben eines Klienten, Zuordnung<br />
von Merkmalen und Verhalten, Ressourcen,<br />
Kr<strong>an</strong>kheiten, Interessen und Bedürfnissen<br />
Reflexion und Dokumentation eigenen<br />
H<strong>an</strong>delns<br />
Üben und Erproben von Ausdrucksformen<br />
und Anwenden von Medien<br />
Pl<strong>an</strong>en, Ausführen und Reflektieren verschiedener<br />
Aktivitäten und Angebote für<br />
den Alltag in <strong>der</strong> Einrichtung<br />
Üben von Interaktion und Kommunikation<br />
in verschiedenen Situationen<br />
Sammeln von Materialien und Ideen <strong>zur</strong><br />
<strong>Gestaltung</strong> von Assistenzaufgaben<br />
Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung mit Möglichkeiten<br />
und Grenzen <strong>der</strong> <strong>Gestaltung</strong> von Beziehungen<br />
<strong>an</strong>h<strong>an</strong>d konkreter Situationen<br />
schriftliche Darstellung <strong>der</strong> Zusammenarbeit<br />
mit Angehörigen<br />
___________________________________________________________________________________<br />
12
Staatlich geprüfter Sozialassistent<br />
Berufsfachschule Staatlich geprüfte Sozialassistentin Klassenstufen 1 bis 3<br />
___________________________________________________________________________________<br />
Zweites Wahlpflichtpraktikum<br />
Dieses Wahlpflichtpraktikum findet nur im dreijährigen Bildungsg<strong>an</strong>g statt und umfasst<br />
fünf Wochen.<br />
Zur Auswahl stehen alle für die Sozialassistentin/den Sozialassistenten relev<strong>an</strong>ten<br />
sozialpädagogischen und pflegerischen Einrichtungen. Die Wahl des Arbeitsfeldes liegt<br />
bei den Schülerinnen und Schülern. Das zweite Wahlpflichtpraktikum bildet im dreijährigen<br />
Bildungsg<strong>an</strong>g den Abschluss <strong>der</strong> <strong>berufspraktischen</strong> <strong>Ausbildung</strong>. Gegen Ende<br />
dieses Praktikums erfolgt die praktische Prüfung. Damit dient dieses Praktikum im<br />
dreijährigen Bildungsg<strong>an</strong>g <strong>der</strong> abschließenden Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung mit den H<strong>an</strong>dlungsabläufen<br />
und Aufgaben von Sozialassistentinnen und Sozialassistenten und im Beson<strong>der</strong>en<br />
<strong>der</strong> Erweiterung personaler Kompetenzen, <strong>der</strong> Festigung des eigenen H<strong>an</strong>delns<br />
in <strong>der</strong> Berufsrolle und damit dem Ankommen im Beruf.<br />
Die Schülerinnen und Schüler integrieren sich zuverlässig in die unterschiedlichen<br />
Rahmenbedingungen und Arbeitsabläufe <strong>der</strong> sozialpädagogischen und pflegerischen<br />
Institutionen. Sie pl<strong>an</strong>en ihr H<strong>an</strong>deln über verschiedene Zeiträume entsprechend <strong>der</strong><br />
Arbeitsorg<strong>an</strong>isation in <strong>der</strong> Einrichtung und unter Beachtung <strong>der</strong> Interessen, Bedürfnisse<br />
und Ressourcen <strong>der</strong> Klienten. Sie führen die ihnen übertragenen Aufgaben effektiv,<br />
ver<strong>an</strong>twortungsvoll und selbstständig aus.<br />
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren eigene Bedürfnisse und sind sich ihrer Rolle<br />
im Prozess <strong>der</strong> Beziehungsgestaltung bewusst.<br />
Die Schülerinnen und Schüler schätzen Situationen ein, treffen im Rahmen ihrer Assistenzfunktion<br />
Entscheidungen und reagieren sicher und <strong>an</strong>gemessen.<br />
Die Schülerinnen und Schüler unterstützen die Zusammenarbeit <strong>der</strong> Fachkräfte mit den<br />
Angehörigen <strong>der</strong> Klienten.<br />
Die Schülerinnen und Schüler haben eine reflektierte Berufsmotivation.<br />
Daraus ergeben sich für das zweite Wahlpflichtpraktikum folgende Rahmenaufgaben:<br />
- Üben von Org<strong>an</strong>isationspl<strong>an</strong>ung<br />
- Beschreiben von Situationen und Ableiten von notwendigen H<strong>an</strong>dlungen<br />
- Reflexion und Dokumentation des eigenen H<strong>an</strong>delns<br />
- Üben und Erproben von Ausdrucksformen und Anwenden von Medien<br />
- Pl<strong>an</strong>en, Ausführen und Reflektieren verschiedener Aktivitäten und Angebote für den<br />
Alltag in <strong>der</strong> Einrichtung<br />
- Üben von Interaktion und Kommunikation in verschiedenen Situationen<br />
- Reflexion eigener Bedürfnisse<br />
- Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung mit Möglichkeiten und Grenzen <strong>der</strong> <strong>Gestaltung</strong> von Beziehungen<br />
<strong>an</strong>h<strong>an</strong>d konkreter Situationen<br />
___________________________________________________________________________________<br />
13
Staatlich geprüfter Sozialassistent<br />
Klassenstufen 1 bis 3 Staatlich geprüfte Sozialassistentin Berufsfachschule<br />
___________________________________________________________________________________<br />
Dokumentation und Bewertung<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> <strong>berufspraktischen</strong> <strong>Ausbildung</strong> fertigt jede Schülerin/je<strong>der</strong> Schüler einen<br />
Situationsbericht und einen Reflexionsbericht <strong>an</strong>. Diese schriftlichen Arbeiten werden<br />
jeweils benotet. Die Note des Situationsberichtes und die Note des Reflexionsberichtes<br />
gehen in die Vornotenbildung für die berufspraktische <strong>Ausbildung</strong> direkt ein.<br />
D<strong>an</strong>eben erhält jede Schülerin/je<strong>der</strong> Schüler eine Note pro Praktikum. Die Benotung<br />
<strong>der</strong> Praxiseinsätze erfolgt durch die begleitende Lehrkraft unter Berücksichtigung <strong>der</strong><br />
Einschätzung <strong>der</strong> Praxiseinrichtung. Die Bewertung innerhalb <strong>der</strong> <strong>berufspraktischen</strong><br />
<strong>Ausbildung</strong> erfolgt auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> BFSO § 13 in Verbindung mit dem Erlass zu<br />
Neuregelungen für die Berufsfachschule für Sozialwesen vom 20.09.2005.<br />
Situationsbericht<br />
Der Situationsbericht sollte im zweijährigen Bildungsg<strong>an</strong>g im zweiten Praktikum, im<br />
dreijährigen Bildungsg<strong>an</strong>g im dritten Praktikum <strong>an</strong>gefertigt werden. Er umfasst mindestens<br />
vier Seiten und sollte fünf Seiten nicht überschreiten.<br />
Gegenst<strong>an</strong>d des Situationsberichtes ist die kurze Beschreibung <strong>der</strong> Einrichtung und die<br />
Darstellung <strong>der</strong> eigenen Arbeitssituation einschließlich <strong>der</strong> übertragenen Aufgaben.<br />
Daraus leiten sich drei inhaltliche Schwerpunkte für den Situationsbericht ab, die folgen<strong>der</strong>maßen<br />
geglie<strong>der</strong>t sein können:<br />
(1) Darlegung <strong>der</strong> Struktur <strong>der</strong> Einrichtung<br />
- Benennen des Trägers <strong>der</strong> Einrichtung<br />
- wesentliche Punkte <strong>der</strong> Konzeption sollen mit eigenen Worten ben<strong>an</strong>nt werden<br />
- Org<strong>an</strong>isationsstruktur <strong>der</strong> Einrichtung<br />
- Einordnung <strong>der</strong> Qualifikation <strong>der</strong> Mitarbeiter<br />
- Darstellung <strong>der</strong> Kooperation im Team<br />
(2) Beschreibung <strong>der</strong> Alltagsstruktur<br />
- Darlegung <strong>der</strong> räumlichen, zeitlichen, personellen und materiellen Strukturierungselemente<br />
des Alltages in <strong>der</strong> Einrichtung<br />
- Beschreibung des Tagesablaufes<br />
(3) Darstellung <strong>der</strong> eigenen Arbeit<br />
- Schil<strong>der</strong>n eines typischen Arbeitstages<br />
- Benennen <strong>der</strong> eigenen Aufgaben<br />
- Formulierung <strong>der</strong> eigenen Ziele für die Arbeit in <strong>der</strong> Einrichtung<br />
Reflexionsbericht<br />
Der Reflexionsbericht sollte im zweijährigen Bildungsg<strong>an</strong>g im Rahmen des dritten Praktikums<br />
und im dreijährigen Bildungsg<strong>an</strong>g im ersten Wahlpflichtpraktikum <strong>an</strong>gefertigt<br />
werden. Er umfasst mindestens drei Seiten und sollte vier Seiten nicht überschreiten.<br />
Gegenst<strong>an</strong>d des Reflexionsberichtes ist die Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung mit den im Praktikum<br />
ausgeführten beruflichen H<strong>an</strong>dlungen. Der Schwerpunkt soll dabei auf <strong>der</strong> Reflexion<br />
<strong>der</strong> <strong>Gestaltung</strong> von Beziehungen zu Klienten und im Team sowie auf <strong>der</strong> Reflexion <strong>der</strong><br />
ausgeführten einrichtungsspezifischen Tätigkeiten liegen.<br />
___________________________________________________________________________________<br />
14
Staatlich geprüfter Sozialassistent<br />
Berufsfachschule Staatlich geprüfte Sozialassistentin Klassenstufen 1 bis 3<br />
___________________________________________________________________________________<br />
Im Reflexionsbericht bewerten die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Einstellungen,<br />
ihr eigenes Erleben, ihre Erfahrungen und ihr eigenes H<strong>an</strong>deln. Sie beziehen Stellung<br />
und leiten Konsequenzen für ihre weitere Entwicklung ab.<br />
Bewertung <strong>der</strong> Praktika<br />
Für jedes Praktikum <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler erfolgt eine schriftliche Beurteilung<br />
durch die Praxis<strong>an</strong>leiterin/den Praxis<strong>an</strong>leiter (vgl. BFSO § 13). Die begleitende Lehrkraft<br />
<strong>der</strong> Schule erteilt auf <strong>der</strong> Grundlage dieser Beurteilung eine Note für jedes Praktikum.<br />
Die Beurteilung und Bewertung sollte entl<strong>an</strong>g einvernehmlich festgelegter Kriterien erfolgen.<br />
Die Kriterien <strong>zur</strong> Bewertung leiten sich aus den Zielen für die berufspraktische <strong>Ausbildung</strong><br />
ab. Es wird empfohlen, dass die Schule in Abstimmung mit <strong>der</strong> Praxiseinrichtung<br />
ein Bewertungsraster erarbeitet.<br />
___________________________________________________________________________________<br />
15
Staatlich geprüfter Sozialassistent<br />
Klassenstufen 1 bis 3 Staatlich geprüfte Sozialassistentin Berufsfachschule<br />
___________________________________________________________________________________<br />
Die nachfolgende Tabelle k<strong>an</strong>n hierfür <strong>zur</strong> Orientierung dienen:<br />
Ziel <strong>der</strong> <strong>Ausbildung</strong> Kriterien Indikatoren (Ausprägung)<br />
Beobachten<br />
<strong>Gestaltung</strong> und Unterstützung<br />
von Beziehungen<br />
Orientierung in unterschiedlichen<br />
Arbeitsfel<strong>der</strong>n<br />
Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit<br />
Pl<strong>an</strong>ung und selbstkritische<br />
Reflexion des eigenen<br />
H<strong>an</strong>delns<br />
- Wahrnehmen von Bedürfnissen<br />
und aktuellen Befindlichkeiten<br />
- Erfassen von alltäglichen<br />
und beson<strong>der</strong>en Situationen<br />
- Grundhaltungen<br />
- Kontaktfähigkeit<br />
- Flexibilität und Konsequenz<br />
- Einordnen in die Arbeitsabläufe<br />
<strong>der</strong> Einrichtung<br />
- selbstständiges Ausführen<br />
einrichtungsspezifischer<br />
Assistenzaufgaben<br />
- Ver<strong>an</strong>twortungsbewusstsein<br />
- Aufgeschlossenheit<br />
- Kritikfähigkeit<br />
- Annehmen und Ausführen<br />
<strong>der</strong> Assistenzrolle im Team<br />
- adressatenbezogene Sprache<br />
- bewusster Einsatz von Kommunikationsmitteln<br />
- Ziele für eigenes H<strong>an</strong>deln<br />
formulieren<br />
- pl<strong>an</strong>volles Ausführen von<br />
Arbeitsaufgaben<br />
- situationsorientiertes H<strong>an</strong>deln<br />
- eigene Stärken und Schwächen<br />
erkennen<br />
- Lernbereitschaft<br />
- Belastbarkeit<br />
- ...<br />
- ...<br />
- ...<br />
- ...<br />
- ...<br />
- ...<br />
- ...<br />
- ...<br />
- ...<br />
- ...<br />
Durch die Berufsfachschule sollte eine Präzisierung zu oben gen<strong>an</strong>nten Zielen und Kriterien<br />
in Form von Indikatoren erfolgen.<br />
___________________________________________________________________________________<br />
16