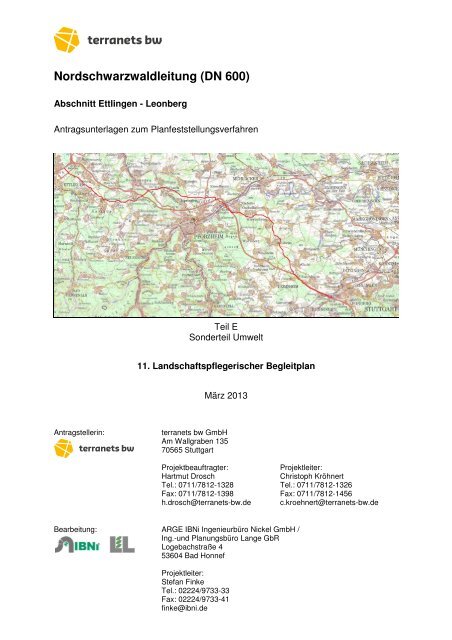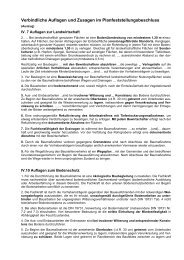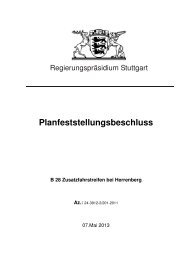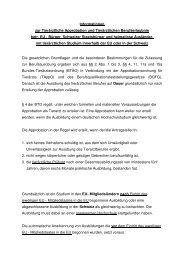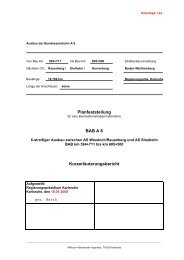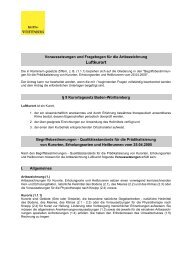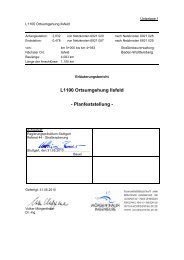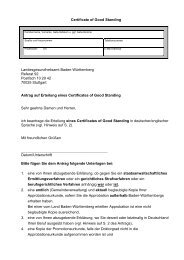Landschaftspflegerischer Begleitplan (PDF, 4.2 MB)
Landschaftspflegerischer Begleitplan (PDF, 4.2 MB)
Landschaftspflegerischer Begleitplan (PDF, 4.2 MB)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Nordschwarzwaldleitung (DN 600)<br />
Abschnitt Ettlingen - Leonberg<br />
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren<br />
Teil E<br />
Sonderteil Umwelt<br />
11. <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
März 2013<br />
Antragstellerin:<br />
terranets bw GmbH<br />
Am Wallgraben 135<br />
70565 Stuttgart<br />
Projektbeauftragter:<br />
Projektleiter:<br />
Hartmut Drosch<br />
Christoph Kröhnert<br />
Tel.: 0711/7812-1328 Tel.: 0711/7812-1326<br />
Fax: 0711/7812-1398 Fax: 0711/7812-1456<br />
h.drosch@terranets-bw.de c.kroehnert@terranets-bw.de<br />
Bearbeitung: ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH /<br />
Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />
Logebachstraße 4<br />
53604 Bad Honnef<br />
Projektleiter:<br />
Stefan Finke<br />
Tel.: 02224/9733-33<br />
Fax: 02224/9733-41<br />
finke@ibni.de
Nordschwarzwaldleitung 1 / 48<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Tabellenverzeichnis ................................................................................................................. 2<br />
Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................ 3<br />
1 Einleitung .................................................................................................................. 4<br />
1.1 Veranlassung der Planung ......................................................................................... 4<br />
1.2 Leitungsverlegung ...................................................................................................... 4<br />
1.2.1 Allgemeine Angaben .................................................................................................. 4<br />
1.2.2 Bauablauf ................................................................................................................... 6<br />
1.2.3 Bauzeit ....................................................................................................................... 9<br />
1.3 Technische Angaben ................................................................................................ 10<br />
1.4 Rechtliche Grundlagen ............................................................................................. 10<br />
1.5 Erläuterungen zur methodischen Vorgehensweise der Untersuchung ...................... 11<br />
2 Trassenbeschreibung ............................................................................................ 13<br />
2.1 Schutzgebiete ........................................................................................................... 13<br />
2.2 Beschreibung des Trassenverlaufs ........................................................................... 13<br />
2.3 Biotoptypen im Bereich der geplanten Erdgasleitung ................................................ 17<br />
3 Konfliktanalyse ....................................................................................................... 19<br />
3.1 Allgemeine Charakterisierung der Eingriffswirkung ................................................... 19<br />
3.2 Erweiterung und Neubau von Stationen ................................................................... 19<br />
3.3 Auswirkung der geplanten Leitungsverlegung auf die Schutzgüter ........................... 20<br />
3.3.1 Mensch ..................................................................................................................... 20<br />
3.3.2 Tiere und Pflanzen ................................................................................................... 20<br />
3.3.3 Boden ....................................................................................................................... 22<br />
3.3.4 Wasser ..................................................................................................................... 22<br />
3.3.5 Klima / Luft ............................................................................................................... 23<br />
3.3.6 Landschaft ................................................................................................................ 23<br />
3.3.7 Kultur- und sonstige Sachgüter ................................................................................ 24<br />
4 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Eingriffsfolgen ............... 24<br />
4.1 Vermeidungsmaßnahmen ........................................................................................ 25<br />
4.1.1 Schutzgut Mensch .................................................................................................... 25<br />
4.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen ................................................................................... 25<br />
4.1.3 Schutzgut Boden ...................................................................................................... 28<br />
4.1.4 Schutzgut Wasser .................................................................................................... 29<br />
4.1.5 Schutzgut Landschaft ............................................................................................... 29<br />
4.1.6 Schutzgut Kultur- und Sachgüter .............................................................................. 29<br />
<strong>4.2</strong> Verminderungsmaßnahmen ..................................................................................... 30<br />
ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />
Unterlage_11_LBP.docx 10/174
2 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
<strong>4.2</strong>.1 Schutzgut Mensch .................................................................................................... 30<br />
<strong>4.2</strong>.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen ................................................................................... 30<br />
<strong>4.2</strong>.3 Schutzgut Boden ...................................................................................................... 30<br />
<strong>4.2</strong>.4 Schutzgut Wasser .................................................................................................... 31<br />
<strong>4.2</strong>.5 Schutzgut Klima / Luft ............................................................................................... 32<br />
<strong>4.2</strong>.6 Schutzgut Landschaft ............................................................................................... 32<br />
<strong>4.2</strong>.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter .............................................................................. 32<br />
5 Eingriffskompensation ........................................................................................... 32<br />
5.1 Ausgleichbarkeit ....................................................................................................... 32<br />
5.2 Ausgleichsmaßnahmen ............................................................................................ 32<br />
5.2.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen ................................................................................... 32<br />
5.2.2 Schutzgut Boden ...................................................................................................... 33<br />
5.2.3 Schutzgut Wasser .................................................................................................... 33<br />
5.2.4 Schutzgut Klima / Luft ............................................................................................... 33<br />
5.2.5 Schutzgut Landschaft ............................................................................................... 33<br />
5.3 Beschreibung der nicht vermeidbaren und nicht ausgleichbaren Eingriffe ................ 34<br />
5.4 Quantitative Eingriffsbewertung und Ermittlung des Ersatzflächenbedarfs ............... 34<br />
5.4.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen ................................................................................... 34<br />
5.<strong>4.2</strong> Schutzgut Boden ...................................................................................................... 42<br />
6 Quellenverzeichnis ................................................................................................. 47<br />
7 Anhang .................................................................................................................... 48<br />
Tabellenverzeichnis<br />
Tab. 1: Gasdruck- Regel- und Messstationen ......................................................................... 5<br />
Tab. 2: Absperrarmaturenstationen ........................................................................................ 5<br />
Tab. 3: Rahmendaten der geplanten Leitung ........................................................................ 10<br />
Tab. 4: Stationen .................................................................................................................. 20<br />
Tab. 5: Tabuflächen der archäologischen Bodendenkmalpflege ........................................... 24<br />
Tab. 6: Übersicht Bauzeitenregelungen ................................................................................ 26<br />
Tab. 7: Übersicht Kompensationsmaßnahmen ..................................................................... 35<br />
Tab. 8:<br />
Verlust an Hektarwerteinheiten Schutzgut Boden im Bereich des<br />
Arbeitsstreifens ......................................................................................................... 44<br />
Tab. 9: Verlust Hektarwerteinheiten Stationen ...................................................................... 46<br />
Tab. 10: Kompensationsbedarf für das Schutzgut Boden (Hektarwerteinheiten) .................... 47<br />
2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />
10/174
Nordschwarzwaldleitung 3 / 48<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Abb. 1: Übersicht Maßnahme Nr. 1 ....................................................................................... 37<br />
Abb. 2: Detail Maßnahme Nr. 1 ............................................................................................ 37<br />
Abb. 3: Übersicht Maßnahme Nr. 2 ....................................................................................... 38<br />
Abb. 4: Detail Maßnahme Nr. 2 ............................................................................................ 39<br />
Abb. 5: Übersicht Maßnahme Nr.3 ........................................................................................ 40<br />
Abb. 6: Detail Maßnahme Nr. 3 ............................................................................................ 40<br />
Abb. 8: Übersicht Maßnahme 4 ............................................................................................ 41<br />
Abb. 8: Detail Maßnahme 4 .................................................................................................. 42<br />
ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />
Unterlage_11_LBP.docx 10/174
4 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
1 Einleitung<br />
1.1 Veranlassung der Planung<br />
Die terranets bw GmbH plant seit 2008 den Bau der „Nordschwarzwaldleitung“, einer<br />
neuen, leistungsfähigen Anbindung Baden-Württembergs an die Trans-Europa-<br />
Naturgas-Pipeline (TENP). Die geplante Leitung weist einen Nenndurchmesser von<br />
600 mm auf und ist für einen maximalen Betriebsdruck von 80 bar ausgelegt. Gegenstand<br />
des vorliegenden Antrags auf Planfeststellung ist der zweite Bauabschnitt von<br />
Ettlingen bis Leonberg.<br />
1.2 Leitungsverlegung<br />
1.2.1 Allgemeine Angaben<br />
Für den Bau der Erdgasleitung wird ein Regelarbeitsstreifen von 25 m Breite benötigt<br />
(s. Regelquerschnitte im Erläuterungsbericht Kap. 4). Der Arbeitsstreifen wird zur<br />
Querung von Waldflächen, Hecken und Gewässern auf kurzen Strecken auf bis zu<br />
12 m eingeengt (siehe Bestands- und Maßnahmenkarten im Maßstab 1:1.000 im<br />
Anhang). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bei Einengungen des Arbeitsstreifens der<br />
Platz für die sorgfältige Trennung der Bodenhorizonte nicht zur Verfügung steht, so<br />
dass zusätzliche Maschinenbewegungen zum Bodentransport und zusätzliche Bodenlagerflächen<br />
außerhalb des eingeengten Bereichs erforderlich werden.<br />
Im Bereich von Sonderbaustellen (geschlossene Querungen) wird bedingt durch die<br />
Baugruben am Anfang und Ende der geschlossenen Querung ein erhöhter Flächenbedarf<br />
für die Lagerung von zusätzlichem Erdaushub und für Maschinen und Geräte<br />
erforderlich.<br />
Für die schweren Baufahrzeuge dienen weitestgehend nur der Arbeitsstreifen und die<br />
ausgewiesenen Zufahrten als Fahrbereich. Kleinere Fahrzeuge (PKW, Kleinbusse etc.)<br />
werden auch vorhandene Straßen und Feldwege als Zufahrten zur Baustelle nutzen.<br />
Die Nutzung von öffentlichen Wegen (Feldwegen) wird im Luftbildplan M. 1: 5.000 im<br />
Teil C der vorliegenden Planfeststellungsunterlagen dargelegt.<br />
Für die Zwischenlagerung der Leitungsrohre werden 13 Rohrlagerplätze benötigt, die<br />
ebenfalls in den genannten Luftbildplänen M. 1: 5.000 dargestellt werden. Zu jedem<br />
Lagerplatz wird auch eine Alternative dargestellt. Verwirklicht wird allerdings nur jeweils<br />
ein Platz pro Standort. Die Rohrlagerplätze werden auf Ackerflächen, im Ausnahmefall<br />
auch auf intensiv genutzten Fettwiesen angelegt, die nur eingeschränkt Funktionen für<br />
den Arten- und Biotopschutz übernehmen können. Da keine dauerhafte Veränderung<br />
dieser Flächen erfolgt, werden sie im Rahmen dieser Untersuchung nicht näher betrachtet.<br />
Das Gleiche gilt für die Anlagen für den kathodischen Korrosionsschutz, deren<br />
Bau ebenfalls nicht mit Eingriffen im Sinne des Naturschutzrechts verbunden ist. Die<br />
2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />
10/174
Nordschwarzwaldleitung 5 / 48<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Einrichtung der Baubüros und ggf. von Materiallagern obliegt den Baufirmen. Baubüros<br />
benötigen Strom- und Wasseranschlüsse und werden daher üblicherweise in Siedlungs-<br />
bzw. Gewerbebereichen eingerichtet.<br />
Die Leitung wird in einem Schutzstreifen von 10 m Breite (5 m beiderseits der Rohrachse)<br />
verlegt, der durch beschränkt persönliche Dienstbarkeiten oder Gestattungsverträge<br />
gesichert wird. Innerhalb dieses Schutzstreifens dürfen keine Gebäude errichtet und<br />
keine leitungsgefährdenden Maßnahmen durchgeführt werden. In einem lichten<br />
Abstand von 2,5 m beidseitig der Leitung dürfen keine Bäume bzw. tiefwurzelnden<br />
Gehölze wachsen.<br />
Die Erdgasleitung selbst (Stahlrohr von 60 cm Innendurchmesser) und die Kabelschutzrohre<br />
für die Lichtwellenleiterkabel werden mit einer Erdüberdeckung von in der Regel<br />
mindestens 1,2 m, gemessen ab Rohroberkante, unter der Erdoberfläche verlegt.<br />
In Ettlingen und in Leonberg werden Gasdruck- Regel- und Messstationen (GDRM)<br />
errichtet, die die folgenden Flächengrößen in Anspruch nehmen:<br />
Tab. 1:<br />
Gasdruck- Regel- und Messstationen<br />
GDRM-Station<br />
Fläche umzäuntes<br />
Grundstück [m²]<br />
Pflasterfläche ca.<br />
[m²]<br />
Rasengittersteine<br />
[m²]<br />
Gebäudefläche<br />
[m²]<br />
Ettlingen 750 105 220 160<br />
Leonberg 890 105 110 240<br />
Darüber hinaus ist die Errichtung von vier Absperrarmaturenstationen geplant. Es<br />
handelt sich um eine unterirdische Absperrarmatur, die über einen oberirdisch angeordneten<br />
elekrohydraulischen Antrieb verfügt und mit einem 2,10 m hohen Stabgitterzaun<br />
umzäunt wird. Gebäude werden nicht errichtet. Die gesamte umzäunte Fläche wird<br />
gepflastert. Die folgende Tabelle zeigt die vier Armaturenstandorte:<br />
Tab. 2:<br />
Absperrarmaturenstationen<br />
Station<br />
Lageplan Nr.<br />
Umzäunte und gepflasterte<br />
Fläche [m²]<br />
Nöttingen 88 / 89 61<br />
Eutingen 142 72<br />
Mönsheim 187 63<br />
Leonberg 224 71<br />
ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />
Unterlage_11_LBP.docx 10/174
6 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Beim Bau der Leitung sowie der verfahrenstechnischen Anlagen werden die anerkannten<br />
Regeln der Technik berücksichtigt und eingehalten. Die Leitung wird mit einem<br />
passiven und aktiven Korrosionsschutz ausgestattet. Der passive Korrosionsschutz<br />
besteht aus einer Rohrumhüllung aus Polyethylen oder vergleichbaren Materialien. Die<br />
Umhüllung wird im Herstellwerk und auf der Baustelle mit einem Prüfgerät auf Umhüllungsfehlstellen<br />
überprüft. Der aktive Korrosionsschutz ist ein Verfahren, bei dem das<br />
Metall der Rohre durch den Betrieb der kathodischen Korrosionsschutzanlage dauerhaft<br />
geschützt wird (s. Erläuterungsbericht zum vorliegenden Planfeststellungsantrag).<br />
Von den verwendeten Materialien der Rohrumhüllungen, der PE-Kabelschutzrohre<br />
sowie der Korrosionsschutzanlagen gehen keine Umweltgefährdungen aus.<br />
1.2.2 Bauablauf<br />
Vermessung und Beweissicherung<br />
Zunächst wird die geplante Achse der Erdgasleitung eingemessen und der erforderliche<br />
Arbeitsstreifen ausgepflockt. Der Trassenräumung geht eine Beweissicherung durch die<br />
Bauleitung voraus.<br />
Räumen der Trasse<br />
Innerhalb der ausgepflockten Arbeitsfläche werden zunächst Bäume und Sträucher<br />
eingeschlagen. Ausgenommen sind dabei im Arbeitsstreifen zu erhaltende Gehölze.<br />
Vorhandene Zäune, Anlagen und sonstiger Aufwuchs werden beseitigt bzw. aufgenommen.<br />
Ausschlagfähige Wurzelstöcke von Hecken und kleineren Feldgehölzen<br />
sollen randlich gelagert und im Anschluss an die Bauarbeiten wieder eingebaut werden.<br />
Nicht erntereife landwirtschaftliche Kulturen werden üblicherweise durch Mulchen<br />
zerkleinert.<br />
Abheben des Oberbodens<br />
Es folgt das Abheben des Oberbodens in der anstehenden Mächtigkeit auf die Breite<br />
des festgelegten Arbeitsstreifens. Diesen Arbeitstakt bewerkstelligen Bagger, die mit<br />
Grabenräumlöffel ausgestattet sind. Der Oberboden wird während der Bauarbeiten am<br />
Arbeitsstreifenrand in einer Miete separat gelagert und bei längerer Lagerung durch<br />
eine Einsaat geschützt.<br />
Ausfahren der Rohre<br />
Dem Abheben und der seitlichen Lagerung des Oberbodens schließt sich das Ausfahren<br />
der Rohre an. Von den Rohrlagerplätzen werden die Rohre nacheinander mit<br />
Spezialfahrzeugen auf die Trasse gebracht.<br />
Biegen und Vorstrecken<br />
Die zuvor ausgelegten, einzelnen Rohre werden durch die Biegevermessung liniert und<br />
aufgenommen. Rohre, die als Feldbögen verwendet werden sollen, werden vor Ort<br />
2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />
10/174
Nordschwarzwaldleitung 7 / 48<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
gebogen und in die Linierung der Rohre eingefügt. Anschließend werden die Rohre zu<br />
unterschiedlich langen Rohrsträngen verschweißt.<br />
Die Längenbegrenzungen der Rohrstränge werden dabei durch Richtungsänderungen,<br />
Straßenquerungen und dergleichen gebildet. Diese Rohrstränge werden auf Vierkanthölzern<br />
neben dem künftigen Rohrgraben abgelegt.<br />
Ausheben des Grabens<br />
Nachdem der Rohrstrang verschweißt ist, wird der Graben mit Löffelbaggern ausgehoben.<br />
Die Tiefe des Grabens muss so gewählt werden, dass nach Auftrag des Oberbodens<br />
in der Regel eine Mindestüberdeckung über dem Rohrscheitel von 1,2 m gewährleistet<br />
ist. Die Rohrgrabentiefe wird dementsprechend mindestens 1,8 m betragen. Der<br />
Grabenaushub wird neben der Oberbodenmiete gelagert, Vermischungen der beiden<br />
Mieten werden ausgeschlossen. Wenn im Rohrgraben deutlich unterschiedliche<br />
Bodenhorizonte anstehen, ist vorgesehen, entsprechend zwei getrennte Bodenmieten<br />
mit Rohrgrabenaushub zu bilden.<br />
Vorhandene Drainagen und Fremdleitungen werden beim Grabenaushub berücksichtigt.<br />
Wasserhaltungsmaßnahmen<br />
Aus Gründen der sicheren und fachgerechten Leitungsverlegung sowie um Verschlämmungen<br />
des Bodens beim Wiederverfüllen des Rohrgrabens zu vermeiden, ist<br />
es erforderlich, das Rohr in den trockenen Rohrgraben abzusenken. Hierzu werden bei<br />
hoch anstehendem Grund- oder Stauwasser Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich.<br />
Bei der Wasserhaltung wird das Grund- bzw. Stauwasser bis auf ca. 0,5 m unter die<br />
Grabensohle abgesenkt. Die Wasserhaltung erfolgt durch Einfräsen von Horizontaldräns<br />
entlang des vorgesehenen Rohrgrabens, durch Filterlanzen oder durch Setzen<br />
von Brunnen bei Pressgruben. Das Wasser aus den Wasserhaltungsmaßnahmen wird<br />
üblicherweise in nahegelegene Vorfluter eingeleitet, örtlich besteht auch die Möglichkeit,<br />
es auf angrenzenden Flächen zu versickern. Gegebenenfalls wird das abgepumpte<br />
Wasser vor dem Einleiten in Vorfluter in Absenk- oder Filterbecken von Schwebstoffen<br />
gereinigt. Wasserhaltungsmaßnahmen werden schon aus Kostengründen auf eine<br />
möglichst kurze Zeitdauer begrenzt. Bei Sonderbaumaßnahmen (Pressungen etc.)<br />
können längere Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich werden. Die Bereiche mit<br />
Wasserhaltungsmaßnahmen sowie die Absenktrichter sind der Umweltverträglichkeitsuntersuchung<br />
sowie Unterlage 8.1.2 zu entnehmen.<br />
Absenken des Rohrstranges<br />
Die Rohrstränge werden durch mehrere spezielle Rohrverlegegeräte (mobile Hubkräne<br />
mit Raupenlaufwerk) in den Rohrgraben abgesenkt. Anschließend werden die in den<br />
Rohrgraben abgesenkten längeren Rohrabschnitte miteinander verschweißt, und der<br />
Rohrgraben wird bis etwa zum Rohrscheitel verfüllt.<br />
ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />
Unterlage_11_LBP.docx 10/174
8 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Kabelverlegung<br />
Es folgt das Einlegen der Leerrohre für die Kabel. Diese werden grundsätzlich seitlich in<br />
Höhe des Rohrscheitels verlegt. Später wird das Glasfaserkabel mittels Druckluft-<br />
Einblastechnik in das Leerrohr eingebracht.<br />
Restverfüllung des Grabens<br />
Die restliche Verfüllung des Grabens erfolgt mittels Bagger mit Grabenlöffel, der den<br />
Aushub lagenweise in den Rohrgraben einbaut. Um Bodensetzungen zu vermeiden,<br />
erfolgt eine maßvolle Rückverdichtung des Bodens, bei der die gleiche Lagerungsdichte<br />
wie im Ausgangszustand angestrebt wird (s. DIN 19731). Anschließend wird ein<br />
Rohbodenplanum entsprechend der ursprünglichen Geländeform hergestellt.<br />
Rekultivierung<br />
Die Arbeitsflächen einschließlich des verfüllten Grabens werden mit geeigneten Lockerungsgeräten<br />
gelockert. Die Lockerung wird zunächst längs der Trasse und, soweit<br />
erforderlich, anschließend noch einmal diagonal durchgeführt. Nach der Lockerung wird<br />
ein gleichmäßiges Planum mittels Raupen hergestellt. Steine und Baurückstände<br />
werden abgesammelt und abgefahren. Ein vermehrter Steinbesatz auf dem Rohbodenplanum<br />
wird vor Aufziehen des Oberbodens mit Steinsammel- oder Steinzertrümmermaschinen<br />
bearbeitet, so dass die Erhöhung des Steinanteils im Oberboden ausgeschlossen<br />
werden kann.<br />
Der Oberboden wird durch Bagger mit Grabenräumlöffel auf der Arbeitsfläche wieder<br />
verteilt. Bei zu nasser Witterung werden die Rekultivierungsarbeiten eingestellt. Die<br />
Flächen werden wieder der (z. B. landwirtschaftlichen) Grundnutzung zugeführt. Hiermit<br />
ist dann die Oberflächenherstellung beendet. Erfahrungsgemäß sind nach einer<br />
derartigen Rekultivierung keine nennenswerten Ertragseinbußen zu erwarten. Sollte<br />
dieses Ergebnis im Einzelfall nicht erzielt worden sein, werden die Schäden in den<br />
ersten Jahren nach Bauende genau beobachtet, diagnostiziert und zur Ursachenbeseitigung<br />
individuelle Meliorationsmaßnahmen durchgeführt.<br />
Die Abfolge der einzelnen für die Verlegung einer Gasleitung erforderlichen Arbeitsschritte<br />
wird aus dem folgenden Flussdiagramm ersichtlich:<br />
2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />
10/174
Nordschwarzwaldleitung 9 / 48<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Abstecken und Räumen der Trasse<br />
↓<br />
Feststellen und Sichern vorhandener, zu kreuzender oder parallelführender<br />
Leitungen<br />
↓<br />
Abheben des Oberbodens<br />
↓<br />
Ausfuhr der Rohre<br />
↓<br />
Biegen der Feldbögen und Vorstrecken (Verschweißen der Rohre)<br />
↓<br />
Ausheben des Rohrgrabens<br />
↓<br />
Absenken des Rohrstrangs<br />
↓<br />
Kabelleerrohrverlegung<br />
↓<br />
Verfüllung des Rohrgrabens<br />
↓<br />
Behandlung des Rohbodenplanums (Lockern, Steine absammeln)<br />
↓<br />
Auftrag des Oberbodens, Rekultivierung<br />
1.2.3 Bauzeit<br />
Es ist geplant, je nach Witterungsverlauf ab März des Verlegejahres (nach derzeitiger<br />
Planung 2015) mit den Bauarbeiten zu beginnen. Die Gehölzrodungen erfolgen vorab<br />
im Winter und sind bis zum 01.03. abgeschlossen. Auch Kampfmittelräumung und<br />
archäologische Vorerkundungen finden im Vorfeld des eigentlichen Leitungsbaus statt.<br />
Ebenfalls ist geplant, mit dem Bau der Stationen früher zu beginnen.<br />
Für den Bau der Erdgasleitung ist in den einzelnen Bereichen eine Zeitdauer von ca. 8-<br />
12 Wochen vom Abheben des Oberbodens bis zur Rekultivierung der Flächen vorgesehen,<br />
im Bereich grabenloser Verlegung und bei Sonderbaustrecken auch länger. Die<br />
Rohrleitung wird voraussichtlich im Herbst betriebsbereit fertig gestellt sein (Inbetriebnahme).<br />
Die Rekultivierungsmaßnahmen können sich in Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen<br />
bis zum Frühjahr des Folgejahres erstrecken.<br />
Der Bau der Erdgasleitung erfolgt kontinuierlich, d. h. während im "vorderen" Bereich<br />
der Leitung noch gebaut wird, kann im "hinteren" Bereich bereits mit der Rekultivierung<br />
der Flächen begonnen werden. Die Bautätigkeiten erfolgen i. d. R. nur tagsüber an<br />
Werktagen. Lediglich im Bereich von Sonderbaustellen (z. B. längere Pressungen oder<br />
offene Straßenquerungen) ist eventuell Nachtarbeit erforderlich.<br />
ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />
Unterlage_11_LBP.docx 10/174
10 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Aus Gründen des Artenschutzes sind verschiedene Bauzeitenregelungen zu beachten.<br />
Diese gehen aus den anliegenden Plänen M. 1: 1.000 hervor. Eine Übersicht findet<br />
sich in Kap. 4.1.2.<br />
1.3 Technische Angaben<br />
Im Folgenden werden die wichtigsten technischen Parameter der geplanten Erdgasleitung<br />
nochmals zusammenfassend dargestellt:<br />
Tab. 3:<br />
Rahmendaten der geplanten Leitung<br />
Rahmendaten<br />
Gasart:<br />
Maximaler Betriebsüberdruck:<br />
Regelüberdeckung:<br />
Durchmesser der Leitung:<br />
Leitungslänge<br />
Schutzstreifen:<br />
durch beschränkte persönliche Dienstbarkeit<br />
dinglich gesichert:<br />
Gehölzfrei zu haltender Streifen:<br />
Regelarbeitsstreifenbreite:<br />
Leitungsrohre:<br />
Rohrverbindung:<br />
Bauzeit (geplant):<br />
Erdgas<br />
PN 80 (80 bar)<br />
1,2 m<br />
DN 600 mm<br />
ca. 55,95 km<br />
10 m (5 m beidseitig der Leitungsachse)<br />
5,6 m (2,5 m lichter Abstand beidseitig der Leitung)<br />
25 m, Einengung möglich in sensiblen Bereichen<br />
(z.B. Wald)<br />
Hochfeste Stahlrohre mit Kunststoff-Beschichtung,<br />
abschnittsweise Ummantelung mit Faserzement<br />
(FZM)<br />
Stumpfnaht-geschweißt<br />
März bis Ende 2015, (Gehölzeinschlag und Anlage<br />
von Rohrlagerplätzen voraussichtlich bereits<br />
Winter 2014-2015)<br />
Rekultivierung evtl. bis Frühjahr 2016<br />
1.4 Rechtliche Grundlagen<br />
Bei der geplanten Erdgasleitung handelt es sich um eine Energieanlage im Sinne des<br />
§ 49 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Sie dient im Sinne von § 1 EnWG einer sicheren,<br />
preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen<br />
Versorgung der Allgemeinheit mit Gas und damit dem öffentlichen Interesse, was<br />
bereits im Raumordnungsverfahren bestätigt wurde.<br />
Die Verlegung von unterirdischen Leitungen im Außenbereich stellt einen Eingriff in<br />
Natur und Landschaft dar, der die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts<br />
oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen kann (§ 14 BNatSchG).<br />
Nach § 43 Energiewirtschaftsgesetz bedürfen die Errichtung und der Betrieb von<br />
Gasversorgungsleitungen über 300 mm Durchmesser der Planfeststellung. Im Verfah-<br />
2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />
10/174
Nordschwarzwaldleitung 11 / 48<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
ren werden die unterschiedlichen Belange, die durch das Vorhaben berührt werden<br />
(z. B. Umwelt- und Naturschutz, Landwirtschaft, Rechte Privater) abgewogen.<br />
Der Verursacher des Eingriffes ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von<br />
Natur und Landschaft zu unterlassen (§ 15 (1) BNatSchG).<br />
Nach § 15 (2) BNatSchG ist der Verursacher verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen<br />
durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen<br />
(Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist<br />
eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts<br />
in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht<br />
wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung,<br />
wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem<br />
betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild<br />
landschaftsgerecht neu gestaltet ist.<br />
Ein Eingriff darf gemäß § 15 (5) BNatSchG nicht zugelassen oder durchgeführt werden,<br />
wenn die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist<br />
auszugleichen oder zu ersetzen sind und die Belange des Naturschutzes und der<br />
Landschaftspflege bei der Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft<br />
anderen Belangen im Range vorgehen. Sind diese Belange in der Abwägung höherrangig<br />
(z. B. bei öffentlichem Interesse), kann der Eingriff zulässig sein.<br />
Nach § 17 (4) BNatSchG kann die zuständige Behörde die Vorlage von Gutachten<br />
verlangen, soweit dies zur Beurteilung der Auswirkungen des Eingriffs und der Ausgleichs-<br />
und Ersatzmaßnahmen erforderlich ist.<br />
Der vorliegende Landschaftspflegerische <strong>Begleitplan</strong> dient dazu, Art, Umfang und<br />
zeitlichen Ablauf des Eingriffs sowie der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung,<br />
Verminderung, zum Ausgleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen darzulegen.<br />
1.5 Erläuterungen zur methodischen Vorgehensweise der Untersuchung<br />
Ein Hauptziel des hier vorgelegten Landschaftspflegerischen <strong>Begleitplan</strong>s besteht darin,<br />
die negativen Auswirkungen des Vorhabens auf Natur und Landschaft so weit wie<br />
möglich zu reduzieren (KÖPPEL ET AL. 1998).<br />
Im vorliegenden Landschaftspflegerischen <strong>Begleitplan</strong> wird für die Schutzgüter<br />
• Mensch,<br />
• Boden,<br />
• Wasser,<br />
ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />
Unterlage_11_LBP.docx 10/174
12 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
• Pflanzen- und Tierwelt,<br />
• Landschaftsbild,<br />
• Klima/Luft und<br />
• Kultur- und sonstige Sachgüter<br />
dargestellt,<br />
• welche Beeinträchtigungen durch die geplante Verlegung der Erdgasleitung erwartet<br />
werden können;<br />
• welche konkreten Vorkehrungen für die Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen<br />
getroffen werden;<br />
• welche Maßnahmen für den Ausgleich nicht vermeidbarer Beeinträchtigungen<br />
(Wiederherstellung betroffener Werte und Funktionen) und<br />
• welche Ersatzmaßnahmen für nicht vermeidbare und nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen<br />
durchzuführen sind.<br />
Berücksichtigt werden hierbei sowohl bau- als auch betriebs- und anlagebedingte<br />
Beeinträchtigungen, die für die einzelnen Schutzgüter dargestellt werden.<br />
In den Vegetationsperioden 2010 bis 2012 erfolgte eine detaillierte Biotoptypenkartierung<br />
auf Basis des Biotoptypenschlüssels Baden-Württemberg („LfU: Arten, Biotope,<br />
Landschaft. Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben, Bewerten“, dritte Auflage). Die<br />
Bewertung der Empfindlichkeit richtet sich nach der Biotopwertliste der Ökokontoverordnung<br />
(Stand Dezember 2010).<br />
In einem 100 m breiten Streifen über der geplanten Trasse wurden die Biotoptypen<br />
erhoben. Sie werden in der Bestands- und Maßnahmenkarte M. 1:1.000 (vgl. Anhang)<br />
dargestellt. Unter der Schlüsselnummer für den Biotoptyp wird in Klammern die Biotopbewertung<br />
angegeben (s. hierzu Kap. 5).<br />
Darüber hinaus wurden Konfliktstrecken festgelegt. In diesen Bereichen ist mit Beeinträchtigungen<br />
von Natur und Landschaft durch das Vorhaben zu rechnen. Jeder<br />
Konfliktstrecke ist ein Textfeld zugeordnet, aus dem die erforderlichen Angaben zum<br />
Biotoptyp, zu vorgesehenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, zu möglichen<br />
verbleibenden Beeinträchtigungen, zur Wiederherstellung und zum evtl. erforderlichen<br />
Kompensationsbedarf hervorgehen. Die Stammdurchmesser betroffener Bäume<br />
bzw. Waldbestände werden mit „BHD“ (Brusthöhendurchmesser in 1,3 m Höhe)<br />
angegeben.<br />
2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />
10/174
Nordschwarzwaldleitung 13 / 48<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Der Blattschnitt der Bestands- und Maßnahmenkarte entspricht dem der Baupläne, was<br />
die Orientierung zwischen technischen- und Umwelt-Plänen erleichtert. Der Blattschnitt<br />
des ersten Bauabschnitts (Au am Rhein – Ettlingen) wird in den vorliegenden<br />
Unterlagen fortgeführt, so dass die Pläne mit Blatt 49 und Konflikt 70<br />
beginnen. Ein Blattschnitt im Maßstab 1: 25.000 befindet sich in der Umweltverträglichkeitsuntersuchung<br />
(Unterlage 10).<br />
Die textliche Darstellung enthält eine Beschreibung der Biotoptypen im Trassenverlauf<br />
(Kapitel 2). Die sich ergebenden Konflikte mit Natur und Landschaft (Kapitel 3), Vermeidungs-<br />
und Minimierungsmaßnahmen (Kapitel 4) sowie der erforderliche Kompensationsbedarf<br />
(Kapitel 5) werden diskutiert.<br />
2 Trassenbeschreibung<br />
2.1 Schutzgebiete<br />
Die Schutzgebiete sowie die schutzwürdigen Biotopflächen der amtlichen Biotopkartierung<br />
werden in der Umweltverträglichkeitsuntersuchung dargestellt. Flächen, die<br />
aufgrund der eigenen Kartierung als nach § 32 NatSchG geschützte Flächen erfasst<br />
wurden, sind mit einem „§“-Zeichen markiert.<br />
2.2 Beschreibung des Trassenverlaufs<br />
Landkreis Karlsruhe<br />
Südlich der A 5 ist die Errichtung der Gasdruck- Regel- und Messanlage Ettlingen im<br />
Gewann „Hägenich“ im Bereich von Weihnachtsbaumkulturen geplant (Konflikt 70, Blatt<br />
49). Bevor die Trasse den Ettlinger Hang erreicht, werden verschiedene Hecken und<br />
Gebüsche im Umfeld des Hedwigshofes gequert (Konflikte 72 bis 75, Blätter 50-52).<br />
Anschließend erreicht die Trasse den steilen Aufstieg nach Wettersbach. Hier steigt die<br />
Trasse um knapp 200 Höhenmeter an. Genutzt wird eine vorhandene Schneise, die die<br />
Waldbestände im Bereich des Edelbergs durchschneidet. Die Trasse verläuft zwischen<br />
der Freileitung und dem südlichen Waldrand. Hierbei wird auch der nördliche Rand des<br />
FFH-Gebietes „Wiesen und Wälder bei Ettlingen“ tangiert. Örtlich muss der südliche<br />
Waldrand um bis zu 6 m zurückgenommen werden, um die Erdgasleitung mit dem<br />
vorgeschriebenen Abstand zur Freileitung platzieren zu können. Von dem Eingriff sind<br />
vor allem Ruderalfluren, Gebüsche und Sukzessionswälder im Umfeld der Freileitung<br />
betroffen. Am südlichen Waldrand werden örtlich mittelalte Buchenwälder tangiert<br />
(Konflikte 76 bis 80, Blätter 52 bis 55).<br />
Stadt Karlsruhe<br />
Am Oberhang verspringt die Trasse auf die Nordseite der Freileitung. Hier kann der<br />
Waldrand des alten Buchenwaldes erhalten werden (Konflikt 80, Blatt 55). Die Trasse<br />
erreicht das FFH-Gebiet „Wiesen und Wälder bei Ettlingen“. In diesem verläuft sie bis<br />
ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />
Unterlage_11_LBP.docx 10/174
14 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
ca. 600 m südöstlich der L 609 (Konflikte 83 bis 99, Blätter 56 bis 68). Gequert werden<br />
zunächst vor allem Obstwiesen, die überwiegend als Fettwiesen einzustufen sind. Die<br />
Kernbereiche des Vorkommens des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings werden<br />
mit der Trasse umgangen. Nördlich der L 609 erreicht die Trasse wieder das Gebiet des<br />
Landkreises Karlsruhe.<br />
Landkreis Karlsruhe<br />
Südöstlich der L 609 werden gut ausgeprägte Magerwiesen mit der Trasse gequert.<br />
Zwischen den Ortslagen Reichenbach und Langensteinbach werden Obstwiesen,<br />
Obstgärten und verschiedene Hecken gequert (Konflikte 100 bis 105, Blätter 70 bis 74).<br />
Anschließend quert die Trasse das Waldgebiet „Rappenbusch“. Hier sind alte Buchenwaldbestände<br />
betroffen, die auf einer Länge von etwa 440 m gequert werden (Konflikt<br />
106, Blätter 75 und 76).<br />
Zwischen Langensteinbach und Auerbach werden vor allem Obstbaumreihen gequert<br />
(Konflikte 107 bis 112, Blätter 77 bis 82). Westlich der K 3564 verläuft die Trasse über<br />
Magerwiesen (Konflikt 113, Blatt 83).<br />
Der Auerbach wird geschlossen unterquert, so dass keine Beeinträchtigungen am<br />
Gewässerbett auftreten. Östlich der K 3564 erreicht die Trasse den Enzkreis.<br />
Enzkreis<br />
Zwischen der K 3564 und der L 399 werden vor allem Obstwiesen gequert (Konflikte<br />
115 bis 120, Blätter 83 bis 87). Westlich der L 399 wird eine Armaturenstation im<br />
Bereich einer Fettwiese errichtet (Konflikt 122, Blatt 88).<br />
Anschließend werden die Pfinz sowie der Mühlgraben in offener Bauweise gequert. Die<br />
Gewässer werden temporär mit Behelfsbrücken versehen. Nach Abschluss der Verlegearbeiten<br />
werden die Ufer naturnah wieder hergerichtet, es erfolgt keine Versiegelung<br />
der Ufer (Konflikte 123 und 124, Blätter 89 und 90).<br />
Die Trassenführung südöstlich von Nöttingen ist durch die Querung zahlreicher Obstwiesen<br />
gekennzeichnet. Die Gestaltung des Arbeitsstreifens nimmt hierauf Rücksicht,<br />
Gehölzeinschläge sind aber nicht zu vermeiden (Konflikte 125 bis 130, Blätter 90 bis<br />
95).<br />
Anschließend erreicht die Trasse den Klosterweg. Hier wird der Arbeitsstreifen weitgehend<br />
auf den Wegebereich beschränkt. Beidseitig des Weges wird örtlich der Einschlag<br />
einzelner Bäume erforderlich, ein flächiger Waldverlust kann aber vermieden werden.<br />
Ausnahme ist ein temporärer Lagerplatz an einer Hütte, der mit einer Größe von ca. 25<br />
x 25 m im Bereich einer Laubholz-Dickung angelegt werden soll (Konflikte 132 bis 135,<br />
Blätter 96 bis 99).<br />
2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />
10/174
Nordschwarzwaldleitung 15 / 48<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Nach der Waldquerung wird der Sperlingshof an der B 10 erreicht. Die Trasse verläuft<br />
dann in einem Tal in Richtung Bilfingen. Hier werden zunächst nur einzelne Obstwiesen<br />
gequert. Ab dem Gewann „Anwänder“ müssen dann gut ausgeprägte Obstwiesen, zum<br />
Teil auch mit Magergrünland, gequert werden (Konflikte 136 bis 145, Blätter 100 bis<br />
106).<br />
Der Kämpfelbach wird in offener Bauweise gequert (Konflikt 146, Blatt 107). Anschließend<br />
überwindet die Trasse einen steilen bewaldeten Hang, der bereits von einer<br />
Leitungsschneise durchschnitten wird. Allerdings ist diese Schneise nicht breit genug,<br />
um die neue Erdgasleitung auf der Südseite einer vorhandenen Trinkwasserleitung<br />
einzubringen. Daher werden Eingriffe in Wälder erforderlich (Konflikt 147, Blätter 107<br />
und 108).<br />
Bis zur nächsten Waldpassage quert die Trasse auf einer Länge von etwa 1,8 km<br />
mehrere Obst- und Magerwiesen (Konflikte 148 bis 156, Blätter 108 bis 114). Teilweise<br />
fallen diese in das FFH-Gebiet „Pfinzgau Ost“. Nördlich von Ispringen durchschneidet<br />
die Trasse ein Waldgebiet, das ebenfalls zum FFH-Gebiet gehört. Es kann eine vorhandene<br />
Schneise entlang einer Freileitung genutzt werden, so dass nur im Bereich<br />
von niedrigen Sukzessionswäldern Rodungen erforderlich werden. Der Rand der alten<br />
Buchenwälder wird erhalten (Konflikte 157 und 158, Blätter 114 und 115).<br />
Anschließend verläuft die Trasse bis zur Querung der L 621 häufig im Bereich von<br />
Obstwiesen, so dass Gehölzverluste nicht zu vermeiden sind (Konflikte 159 bis 162,<br />
Blätter 115 bis 120).<br />
Ab der L 621 wird offeneres Gelände erreicht. Örtlich wird die Querung von Hecken und<br />
Obstbaumreihen erforderlich (Konflikte 163 bis 169, Blätter 121 bis 130). Hier erreicht<br />
die Trasse das Gebiet der Stadt Pforzheim.<br />
Stadt Pforzheim<br />
Von der Stadtgrenze bis zum Beginn des FFH-Gebietes „Enztal bei Mühlacker“ werden<br />
lediglich einzelne Gehölzstrukturen wie z. B. Obstbaumreihen gequert. Im Bereich des<br />
FFH-Gebietes ist die Landschaft kleinteiliger gegliedert. Es herrschen gut entwickelte<br />
Obstwiesen vor, die häufig Magergrünland aufweisen (Konflikt 176 bis 183, Blätter 138<br />
bis 140). Anschließend erreicht die Trasse die Enz, die in offener Bauweise gequert<br />
wird (Konflikt 187, Blatt 141). Südlich der Enz wird eine Armaturenstation im Bereich<br />
einer Fettwiese errichtet (Konflikt 188, Blatt 142). Anschließend verlässt die Trasse das<br />
Stadtgebiet Pforzheim und tritt erneut in den Enzkreis ein.<br />
Enzkreis<br />
Auf der Westseite der A 8 werden Feldgehölze, Gebüsche und Obstwiesen von der<br />
Trasse gequert. Dies setzt sich auch hinter der A 8-Querung südlich der Ortslage<br />
Niefern fort (Konflikte 190 bis 201, Blätter 143 bis 150). Hinter der L 1125 wird der<br />
ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />
Unterlage_11_LBP.docx 10/174
16 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Kirnbach in offener Bauweise gequert. Es folgt ein bewaldeter kurzer Steilhang oberhalb<br />
der Bräuningsmühle. Hier werden auf einer Länge von ca. 100 m Waldrodungen<br />
erforderlich (Konflikte 202 und 203). Westlich der Ortslage Niefern werden Äcker und<br />
Wiesen gequert. Anschließend verläuft die Trasse im Bereich eines Fichtenwaldes im<br />
Südwesten des Öschelbronner Gewerbegebietes (Konflikt 210, Blatt 155). Anschließend<br />
wird erneut eine Teilfläche des FFH-Gebietes „Enztal bei Mühlacker“ gequert. Hier<br />
verläuft die Trasse durch mehrere magere Obstwiesen (Konflikte 212 und 213, Blätter<br />
156 und 157).<br />
Die Trasse passiert die Öschelbronner Sportplätze und verläuft erneut über teils<br />
magere Obstwiesen (Konflikte 215 bis 218, Blätter 158 und 159). Südlich der Klinik<br />
Öschelbronn kann die Leitung so trassiert werden, dass der dortige Waldrand erhalten<br />
wird. Allerdings kommt es zu Gehölzrodungen im Bereich mehrerer Obstwiesen<br />
(Konflikte 219 bis 220, Blatt 160).<br />
Zwischen Öschelbronn und Wiernsheim ist aufgrund der vorherrschenden Ackerlandschaft<br />
eine weitgehend konfliktarme Leitungsverlegung möglich. Nördlich und nordöstlich<br />
von Wiernsheim werden mehrere Obstgärten passiert, hier kommt es zu Obstbaumverlusten<br />
(Konflikte 222 und 223, Blätter 166 bis 168). Das Wiernsheimer<br />
Neubaugebiet wird östlich von der Trasse umfahren. Es folgt bis oberhalb von Mönsheim<br />
eine überwiegend von Äckern geprägt Landschaft. Einige Gehölzstrukturen<br />
werden allerdings gequert (Konflikte 224 bis 230, Blätter 172 bis 178).<br />
Es folgt vor dem Grenzbach eine kurze Waldpassage, die Trasse fällt steil bis auf die<br />
Talsohle ab, und der Grenzbach wird in offener Bauweise gequert (Konflikte 231 bis<br />
233, Blätter 178 bis 180). Auf der Südseite des Grenzbachtals verläuft die Trasse an<br />
einem bewaldeten Steilhang, der auch in den Bereich des FFH-Gebiets „Strohgäu und<br />
unteres Enztal“ fällt. Hier wird es auf einer Trassenlänge von knapp 250 m Rodungen<br />
im Bereich eines alten Buchenwaldes geben (Konflikt 236, Blatt 181).<br />
Oberhalb des Waldes befinden sich Obstwiesen sowie ein Gartenhausgebiet. Hier<br />
kommt es zu Querungen von verschiedenen Gehölzstrukturen (Konflikte 237 bis 242,<br />
Blätter 181 bis 183). Südlich der L 1177 erreicht die Trasse den Bereich des Gewanns<br />
„Kalkofen“, das als FFH-Gebiet und seit einiger Zeit auch als Naturschutzgebiet festgesetzt<br />
ist. Hier verlässt die Trasse den Parallelverlauf mit einer vorhandenen Erdgasleitung,<br />
um verschiedene wertvolle Magerrasen zu erhalten. Nahe der bereits vorhandenen<br />
Erdgasstation wird eine neue Armaturenstation im Bereich eines Ackers errichtet<br />
(Konflikt 244, Blatt 187). Weiter südlich werden verschiedene Hecken gequert, und die<br />
Trasse erreicht das Gebiet des Landkreises Böblingen.<br />
Landkreis Böblingen<br />
Westlich von Flacht verläuft die Trasse im Randbereich eines Fichtenwaldes (Konflikt<br />
249, Blatt 193). Hierdurch kann eine gegenüberliegende Obstwiese erhalten werden.<br />
2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />
10/174
Nordschwarzwaldleitung 17 / 48<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Bis zur A 8 werden eine Magerwiese sowie mehrere Gehölzstrukturen gequert. Im<br />
Perouser Wald wird die Leitung parallel zur A 8 sowie zur L 1180 geführt. Da diese<br />
Bestände örtlich stark von Windwürfen geschädigt sind, kommt es häufig zu Eingriffen<br />
in Sukzessionswälder. Häufiger sind auch Ausgleichspflanzungen betroffen, die nach<br />
dem Ausbau der A 8 angelegt worden sind (Konflikte 255 bis 260, Blätter 201 bis 205).<br />
Östlich der Waldpassage wird eine Doline weiträumig umgangen, und die Trasse<br />
erreicht eine von Ackerbau geprägte Landschaft südlich der A 8. Hier werden verschiedene<br />
Gehölzstrukturen wie Hecken, Gebüsche und jüngere Baumreihen gequert<br />
(Konflikte 261 bis 271, Blätter 206 bis 217). Im Bereich der Rutesheimer Obstsortenanlage<br />
müssen vier Obstbäume eingeschlagen werden. Östlich der Siedlung Heuweg wird<br />
die A 8 erneut gequert. Im weiteren Verlauf wird der Wasserbach in offener Bauweise<br />
gequert (Konflikt 275, Blatt 220).<br />
Die Leitung endet nahe der Glems, wo eine neue Armaturenstation sowie eine neue<br />
GDRM-Station im Bereich von Ruderalflächen errichtet werden (Konflikte 278 bis 280,<br />
Blatt 224).<br />
2.3 Biotoptypen im Bereich der geplanten Erdgasleitung<br />
Im Folgenden wird auf die unmittelbar vom Arbeitsstreifen betroffenen Biotoptypen<br />
eingegangen. Eine detaillierte Darstellung der Biotoptypen erfolgt in der Bestands- und<br />
Maßnahmenkarte im Maßstab 1:1.000 im Anhang. In der Karte werden auch solche<br />
Biotoptypen, die voraussichtlich nicht von der Leitung beeinträchtigt werden, in einem<br />
50 m breiten Streifen beidseitig der Leitung dargestellt.<br />
Wälder: Mehrfach sind Sukzessionswälder im Randbereich von Freileitungen vom<br />
Arbeitsstreifen betroffen. Hier handelt es sich vor allem um Verjüngung von Birke und<br />
Salweide sowie anderen Laubbaumarten. Diese werden regelmäßig von den Freileitungsbetreibern<br />
auf den Stock gesetzt (km 16,5 - 17,5; km 33,9 - 34,1; km 36,0 - 36,5).<br />
Örtlich sind auch Eingriffe in geschlossene ältere Waldbestände nicht zu umgehen:<br />
Dies ist nördlich von Langensteinbach der Fall (km 23,5 -24,0), wo die Trasse das<br />
Waldgebiet „Rappenbusch“ quert. Betroffen sind mittelalte Buchen- und Eichenbestände<br />
mit Kiefernbeimischung. Ein Buchen-Altbestand an einem Steilhang ist bei Mönsheim<br />
betroffen (km 57,1 - 57,4). Bei Öschelbronn (km 48,9 - 49,2) liegt ein mittelalter<br />
Fichtenwald im Arbeitsstreifen. Bei Perouse (km 63,6 - 65,4) sind häufiger Birken-<br />
Sukzessionswälder betroffen, die sich auf Sturmwurfflächen etabliert haben. Darüber<br />
hinaus werden dort Wiederaufforstungsflächen tangiert, die nach dem Ausbau der A 8<br />
angelegt wurden.<br />
Feldgehölze, Feldhecken und Gebüsche befinden sich verstreut nahezu im gesamten<br />
Trassenbereich. Schwerpunkte liegen beim Hedwigshof (km 16,0 - 16,5), im Bereich<br />
der Bauschlotter Platte (km 38,5 - 41,0) sowie auf Mönsheimer Gemarkung (km 57,5 -<br />
60,5). Ein besonders gut ausgeprägtes Gebiet mit verschiedenen Schlehenhecken<br />
ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />
Unterlage_11_LBP.docx 10/174
18 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
befindet sich zwischen km 34,4 und 36,0. Die Hecken setzen sich zumeist aus bodenständigen<br />
Arten wie Schlehe, Hasel, Hartriegel und Salweide zusammen. Gebüsche<br />
werden zumeist aus Schlehen gebildet.<br />
Obstwiesen sind für den Nordschwarzwald besonders kennzeichnend. Es handelt sich<br />
häufig um ältere Hochstämme. In Teilbereichen zeichnet sich die Verbrachung der<br />
Wiesen durch fehlende Pflege ab, zum größten Teil werden die Flächen aber noch<br />
extensiv bewirtschaftet. Hier entwickelt sich, vor allem auf flachgründigen Standorten,<br />
örtlich mageres Grünland unter den Bäumen. Schwerpunkte der Obstwiesen befinden<br />
sich bei Wettersbach (km 17,5 -23,0), bei Nöttingen (km 28,5 – 29,8), bei Kämpfelbach<br />
(km 33,0 – 33,6), bei Ispringen (km 36,5 – 38,0), bei Pforzheim-Eutingen (km 43,5 –<br />
44,5), bei Niefern (km 45,4 – 47,7), bei Öschelbronn (km 48,8 – 51,0), bei Wiernsheim<br />
(km 52,2 – 53,5) sowie bei Mönsheim (km 57,3 – 57,8).<br />
Grünland ist im Trassenbereich häufig. Es handelt sich zumeist um extensiv genutzte<br />
Fettwiesen, die mäßig gedüngt werden. Kennzeichnend ist vor allem die Strukturvielfalt<br />
zwischen den verschiedenen Parzellen, die sich durch die Kleinflächigkeit der Grundstücke<br />
ergibt. Magerwiesen entwickeln sich vor allem auf flachgründigen Standorten,<br />
die extensiv genutzt werden. Schwerpunkte liegen hier bei Waldbronn (km 20,9 – 21,4),<br />
Ispringen (km 34,4 – 36,0), Pforzheim-Eutingen (km 43,5 – 44,5) und Öschelbronn (km<br />
49,5 – 50,5). Die Magerwiesen sind durch typische Arten wie Wiesensalbei (Salvia<br />
pratensis), Klappertopf (Rhinantus angustifolius) und Wiesenknopf (Sanguisorba<br />
officinalis) gekennzeichnet. Im Bereich von Pforzheim-Eutingen sind Grünlandeinsaaten<br />
häufig.<br />
Staudenfluren und Ruderalvegetation kommen häufiger im Trassenbereich vor. Auf<br />
vielen Brachen haben sich Brombeer-, und Brennesselbestände entwickelt. Ruderalflächen<br />
finden sich zumeist im Randbereich von Verkehrswegen.<br />
Die Fließgewässer sind im Verlauf der geplanten Leitung recht unterschiedlich ausgeprägt.<br />
Pfinz, Auerbach, Kämpfelbach, Kirnbach, Grenzbach und Wasserbach sind<br />
weitgehend naturnah entwickelt. Sie weisen weitgehend naturnahe Ufergehölze auf und<br />
haben meist steile, unverbaute oder nur fragmentarisch verbaute Ufer. Die Enz weist<br />
örtlich eine alte Steinschüttung auf, die teilweise aber bereits erodiert ist. Stark ausgebaut<br />
und wenig naturnah sind der Rannbach bei Nöttingen sowie der Ortsbach bei<br />
Öschelbronn. Eine gut ausgeprägte Ufervegetation mit Pestwurzfluren (Petasites<br />
hybridus) befindet sich am südlichen Ufer der Enz. Bei den übrigen Fließgewässern<br />
kann sich zumeist nur eine schmale Ufervegetation ausbilden, die dann häufig aus<br />
Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea), Zottigem Weidenröschen (Epilobium hirsutum)<br />
und Wasserdost (Eupatoria cannabina) besteht.<br />
Äcker sind der dominierende Biotoptyp im Trassenbereich. Es handelt sich überwiegend<br />
um Getreide- und Maisäcker. Im Gegensatz zum ersten Trassenabschnitt sind die<br />
2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />
10/174
Nordschwarzwaldleitung 19 / 48<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Ackerschläge meist großflächig (insbesondere bei km 38,0 - 43,0; km 50,8 – 53,0; 61,5<br />
– 63,0 sowie von km 66,5 bis zum Ende der Trasse). Als Sonderkulturen sind lediglich<br />
einige Weihnachtsbaumkulturen zu nennen. Erdbeer-, Beerstrauch- oder Weinbauflächen<br />
sind vom Vorhaben nicht betroffen.<br />
Biotoptypen der Siedlungsflächen werden vom Leitungsverlauf gemieden. An den<br />
folgenden Flächen nähert sich die Trasse der Bebauung an: Nördlicher Ortsrand von<br />
Langensteinbach (km 23,5), Pforzheim-Eutingen (km 44,2 – 44,6), Öschelbronn<br />
(km 49,3), Wiernsheim (km 53,4 – 54,4) sowie Rutesheim km 68,4 – 68,7).<br />
Biotoptypen der Infrastrukturflächen sind im Trassenverlauf sehr häufig, da die<br />
Leitung sich in vielen Bereichen an diesen orientiert.<br />
3 Konfliktanalyse<br />
3.1 Allgemeine Charakterisierung der Eingriffswirkung<br />
Die Verlegung von unterirdischen Rohrleitungen stellt eine Maßnahme dar, die sich im<br />
Vergleich zu anderen Bauprojekten hauptsächlich durch die folgenden Eigenschaften<br />
unterscheidet:<br />
• geringe zeitliche Inanspruchnahme der betroffenen Biotoptypen,<br />
• fast keine Änderung der bisherigen Nutzung,<br />
• weitgehende Beschränkung der Beeinträchtigungen auf die Bauphase,<br />
• keine dauerhaften Veränderungen des Landschaftsbildes,<br />
• keine Auswirkungen durch den Betrieb der Anlage.<br />
Es ergibt sich eine Reihe von Möglichkeiten, schützenswerte Objekte oder Biotope im<br />
Trassenverlauf zu schonen. Aufgrund des linearen Verlaufs der Rohrleitung werden<br />
andere lineare Strukturen, die nicht parallel verlaufen, jedoch zwangsläufig gekreuzt.<br />
Im Gegensatz zu anderen linienhaften Eingriffen in die Landschaft (wie etwa dem<br />
Straßenbau) treten bei der Verlegung von Rohrleitungen überwiegend baubedingte<br />
Beeinträchtigungen auf, die im Wesentlichen auf den Bereich des Arbeitsstreifens<br />
begrenzt sind (FROELICH & SPORBECK UND SMEETS & DAMASCHEK 2002).<br />
3.2 Erweiterung und Neubau von Stationen<br />
Die einzigen dauerhaften und flächigen Beeinträchtigungen treten durch den Bau der<br />
Gasdruck- Regel- und Messstationen Ettlingen (mit integrierter Absperrarmatur) sowie<br />
Leonberg sowie durch vier Armaturengruppen auf. Die folgende Übersicht zeigt die<br />
geplanten Maßnahmen:<br />
ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />
Unterlage_11_LBP.docx 10/174
20 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Tab. 4:<br />
Stationen<br />
km Name Geplante Maßnahmen Anmerkungen<br />
15,2<br />
GDRM-Station<br />
Ettlingen<br />
Errichtung eines Gebäudes mit 160 m², Versiegelung<br />
von 105 m² für Stellplätze<br />
Dachbegrünung<br />
des Gebäudes<br />
28,0<br />
Absperrarmatur<br />
Nöttingen<br />
Versiegelung von 65 m² Wiesenfläche, Nivellierung<br />
des Geländes im Bereich der Station, Einzäunung der<br />
Anlage mit einem 2,10 m hohen Stabgitterzaun<br />
45,0<br />
Absperrarmatur<br />
Eutingen<br />
Versiegelung von 75 m² Wiesenfläche, Einzäunung<br />
der Anlage mit einem 2,10 m hohen Stabgitterzaun,<br />
Rodung des Baumes BHD 15 cm<br />
59,5<br />
Absperrarmatur<br />
Mönsheim<br />
Versiegelung von 65 m² Ackerfläche, Einzäunung der<br />
Anlage mit einem 2,10 m hohen Stabgitterzaun<br />
71,0<br />
Absperrarmatur<br />
Leonberg<br />
Versiegelung von 65 m² Ruderalfläche, Einzäunung<br />
der Anlage mit einem 2,1 m hohen Stabgitterzaun<br />
71,1<br />
GDRM-Station<br />
Leonberg<br />
Errichtung eines Gebäudes mit 240 m², Versiegelung<br />
von 105 m² für Zufahrten und Stellplätze<br />
Dachbegrünung<br />
des Gebäudes<br />
3.3 Auswirkung der geplanten Leitungsverlegung auf die Schutzgüter<br />
Im Folgenden werden die Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Tiere und<br />
Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter<br />
dargelegt. Die dargestellten Auswirkungen können durch die in Kapitel 4 des LBP<br />
erläuterten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen i. d. R. erheblich abgemildert<br />
werden.<br />
3.3.1 Mensch<br />
Die Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Mensch sind begrenzt und<br />
beschränken sich auf die Bauphase. Zu rechnen ist lokal mit Beeinträchtigungen durch<br />
Lärm und Staub durch die Baufahrzeuge. Dies beschränkt sich auf die wenigen Trassenabschnitte,<br />
wo Wohnbau- und Gewerbeflächen sich im Bereich von unter 100 m<br />
Abstand zur Baustelle befinden (s. hierzu Umweltverträglichkeitsuntersuchung). Hinzu<br />
kommen häufiger genutzte Erholungseinrichtungen, hier vor allem Rad- und Wanderwege,<br />
wo lokal mit eingeschränkten Erholungsmöglichkeiten zu rechnen ist.<br />
3.3.2 Tiere und Pflanzen<br />
Eine direkte Beeinträchtigung der Pflanzen erfolgt während der Bauphase durch die<br />
Beseitigung der Vegetation im Arbeitsstreifen. Da sich die vom Leitungsbau betroffenen<br />
Biotope nach dem Bau der Leitung wieder entwickeln können, sind die Auswirkungen<br />
des Leitungsbaus vorwiegend von der Regenerationsdauer der betroffenen Biotope<br />
abhängig. Hierbei spielt die Nachhaltigkeit der Standortveränderungen eine besondere<br />
Rolle. Es kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund von Bodenverdichtungen,<br />
soweit diese nicht vollständig beseitigt werden können, vor allem im Grünland zunächst<br />
2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />
10/174
Nordschwarzwaldleitung 21 / 48<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
eine Verschiebung des Artenspektrums hin zu den wechselfeuchte-toleranten Arten<br />
stattfindet (SCHUCHARDT ET AL., 1999).<br />
Die Beeinträchtigung von Tierarten wird in der artenschutzrechtlichen Prüfung (ASP)<br />
untersucht, die ebenfalls Bestandteil der vorliegenden Planfeststellungsunterlagen ist.<br />
Hierbei wird das Eintreten von Verbotstatbeständen im Sinne des § 44 BNatSchG<br />
untersucht. Die Ergebnisse der ASP wurden in die Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen<br />
dieses Landschaftspflegerischen <strong>Begleitplan</strong>s übernommen.<br />
Neben den Darstellungen der ASP sind die „nur“ national besonders geschützten Arten<br />
im Landschaftspflegerischen <strong>Begleitplan</strong> zu berücksichtigen. Im Rahmen der Untersuchungen<br />
zur Artenschutzrechtlichen Prüfung wurden auch diese Arten erfasst. Sie<br />
werden in der Bestands- und Maßnahmenkarte im Anhang dieses Landschaftspflegerischen<br />
<strong>Begleitplan</strong>s im Untersuchungsbereich 50 m beidseitig der Trasse dargestellt.<br />
Pflanzen: Die ermittelten besonders geschützten Pflanzen werden im Untersuchungsbereich<br />
dargestellt. Bei den ermittelten Arten handelt es sich um solche, die entweder<br />
keinen Rote-Liste-Status haben oder den Status „Vorwarnliste“ aufweisen. Gefährdete<br />
Pflanzenarten wurden nicht ermittelt. Einige Arten, die im Arbeitsstreifen häufiger<br />
vorkommen, sind der Knöllchen-Steinbrech (Saxifraga granulata), die Schlüsselblume<br />
(Primula veris) oder die Stechpalme (Ilex aquifolium). Hier sind Verluste der Arten im<br />
Arbeitsstreifen nicht zu vermeiden. Da es sich nicht um gefährdete Arten handelt, kann<br />
davon ausgegangen werden, dass sich die Arten nach Abschluss der Arbeiten mittelfristig<br />
wieder im Arbeitsstreifen ausbreiten werden. Maßnahmen zum Bergen einzelner<br />
Pflanzenbestände werden nicht erforderlich.<br />
Amphibien: Ermittelt wurden der Bergmolch, die Erdkröte, der Grasfrosch sowie der<br />
Teichfrosch. Die in der Bestands- und Maßnahmenkarte dargestellten Maßnahmen „T1“<br />
dienen dazu, Auswirkungen auf die Amphibien zu vermeiden. Es handelt sich um die<br />
Installation von Amphibienschutzzäunen. Bei km 36,4 (Waldpassage nördlich von<br />
Ispringen) muss ein temporär wasserführender Tümpel außerhalb des Arbeitsstreifens<br />
angelegt werden, so dass die dort vorkommenden Amphibien eine alternative Laichmöglichkeit<br />
haben. Es bietet sich an, den neuen Tümpel direkt an den vorhandenen<br />
Tümpel angrenzen zu lassen.<br />
Falter: Bei den nur besonders geschützten Falterarten handelt es sich nur beim<br />
Kreuzdorn-Zipfelfalter um eine gefährdete Art (RL III). Alle anderen besonders geschützten<br />
Arten sind nicht gefährdet bzw. auf der Vorwarnliste. Die Gefährdung von<br />
Falter-Individuen kann weitgehend ausgeschlossen werden, da der Bau der Leitung in<br />
den Sommermonaten stattfindet. Die Tiere können sich bei der Mahd der Flächen<br />
rechtzeitig aus dem Arbeitsstreifen entfernen. Nach dem Bau der Leitung stehen<br />
Grünlandflächen und Säume wieder als Lebensraum für die Tiere zur Verfügung.<br />
ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />
Unterlage_11_LBP.docx 10/174
22 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Fische: Die streng geschützten Arten Groppe, Strömer und Bachneunauge werden in<br />
der ASP behandelt. Eine Liste der Fischerei-Daten des RP Karlsruhe befindet sich in<br />
der UVU. Maßnahmen zum Schutz der Fischarten finden sich in den Bestands- und<br />
Maßnahmenplänen. Hier handelt es sich um den Bau von Sedimentsperren sowie um<br />
eine Bauzeitenregelung zum Schutz des Laichs: Baubeginn frühestens am 01. Juni.<br />
Libellen: Es wurden neun verschiedene Libellenarten ermittelt, die in den Bestands-<br />
und Maßnahmenplänen dargestellt werden. Alle ermittelten Arten sind nicht gefährdet.<br />
Die Nachweise liegen an den von der Erdgasleitung gequerten Fließgewässern oder an<br />
trassennahen Stillgewässern, die von dem Vorhaben nicht betroffen sind. Im Querungsbereich<br />
der Fließgewässer wird der Arbeitsstreifen maximal eingeschränkt, so<br />
dass die Lebensräume der Libellen nur im unbedingt erforderlichen Umfang von dem<br />
Vorhaben betroffen sind. Im Anschluss an das Vorhaben können sich diese Lebensräume<br />
wieder entwickeln.<br />
Reptilien: Als einzige nur besonders geschützte Reptilienart wurde die Waldeidechse<br />
ermittelt. An den folgenden Stellen wird zum Schutz der Waldeidechse die Errichtung<br />
eines Schutzzauns erforderlich: Km 36,0 – 36,5; km 64,1 – 64,2 sowie km 64,6 – 64,7.<br />
Durch diese Vermeidungsmaßnahme kann eine Gefährdung der Waldeidechse ausgeschlossen<br />
werden.<br />
3.3.3 Boden<br />
Dauerhafte Bodenversiegelungen erfolgen im Bereich der Stationen. Es handelt sich<br />
um insgesamt 840 m². Hier wird der Boden seine ursprünglichen natürlichen Funktionen<br />
verlieren.<br />
Auswirkungen auf den Boden ergeben sich darüber hinaus vor allem durch die Erdarbeiten<br />
im Zuge des Leitungsbaus. Hier wird es zu bedingten Bodenvermischungen im<br />
Unterbodenbereich des Rohrgrabens kommen. Bodenverdichtungen im Arbeitsstreifen<br />
sind nicht auszuschließen.<br />
Nachhaltige Beeinträchtigungen durch das Vorhaben werden durch die sorgfältige<br />
Trennung von Ober- und Mineralboden verhindert. Es ist darüber hinaus geplant, bei<br />
deutlich unterschiedlichen Bodenhorizonten zwei getrennte Bodenmieten mit Rohrgrabenaushub<br />
zu bilden. Bodenverdichtungen werden im Zuge der Rekultivierung durch<br />
Bodenlockerungen behoben.<br />
3.3.4 Wasser<br />
Alle Fließgewässer mit Ausnahme des Auerbaches werden offen gequert. Hierbei wird<br />
durch die Erdarbeiten im Uferbereich und an der Gewässersohle in die Gewässerstruktur<br />
eingegriffen. Es kommt zu einer temporären Beeinträchtigung des Bodengefüges,<br />
des Benthos und der Vegetation an der Gewässersohle und an den Böschungen. Dabei<br />
werden zeitweise eine verstärkte Trübung des Gewässers und eine höhere Sediment-<br />
2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />
10/174
Nordschwarzwaldleitung 23 / 48<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
fracht verbunden mit verstärkten Ablagerungen in Fließrichtung ausgelöst. Bei der<br />
geschlossenen Gewässerquerung am Auerbach sind keine Auswirkungen des Leitungsbaus<br />
auf das Fließgewässer zu erwarten.<br />
Temporäre Absenkungen des Grundwassers können in Bereichen mit hoch anstehendem<br />
Grundwasser durch Wasserhaltungsmaßnahmen während der Bauphase auftreten.<br />
Nachhaltige Absenkungen des Grundwasserstandes erfolgen nicht.<br />
Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität sind nicht zu erwarten (s. hierzu Sondergutachten<br />
zum Grundwasserschutz: Deckschichtenkartierung und Pumpversuche,<br />
Unterlage 8.4).<br />
3.3.5 Klima / Luft<br />
Durch den Bau der Leitung kommt es nicht zu nachhaltigen Nutzungs- oder Reliefveränderungen,<br />
die klimatische Auswirkungen haben könnten.<br />
Waldflächen mit ihrer Funktion als klimatische Ausgleichsräume sind von dem Vorhaben<br />
häufiger betroffen. Allerdings handelt es sich zumeist um die Aufweitung bereits<br />
bestehender Leitungsschneisen im Wald, so dass sich die klimatischen Auswirkungen<br />
in Grenzen halten.<br />
Da betroffene Grünlandflächen wieder hergestellt werden, wird auch deren Funktion als<br />
Kaltluftentstehungsgebiet nicht nachhaltig beeinträchtigt.<br />
Lücken in Hecken oder Gehölzstreifen, die durch die Leitungstrasse entstehen, können<br />
im Einzelfall Auswirkungen auf das Mikroklima haben. Durch Pflanzmaßnahmen im<br />
Rahmen der Wiederherstellung können diese Beeinträchtigungen mittelfristig behoben<br />
werden. Während der Bauphase kommt es zu Belastungen der Luft durch Emissionen<br />
der Baustellenfahrzeuge und Geräte. Während der Betriebsphase treten durch das<br />
geschlossene Leitungssystem keine Emissionen auf. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung<br />
der Emissionen sind die auftretenden Konflikte gering.<br />
3.3.6 Landschaft<br />
Beeinträchtigungen der Landschaft treten während der Bauphase durch Geräte,<br />
Maschinen, Erdlager u. ä. im Nahbereich der Baustelle auf. Während der Betriebsphase<br />
wird das Landschaftsbild durch das Aufstellen von gelben Schilderpfählen, z. T. mit<br />
roten Markierungstafeln, zur Kennzeichnung der Leitung geringfügig beeinträchtigt.<br />
Gewisse Auswirkungen auf das Landschaftsbild entstehen durch die Gehölzrodungen<br />
im Wald sowie bei Hecken und Baumreihen. Hier kommt es örtlich zur Unterbrechung<br />
von ästhetisch wirksamen Leitlinien in der Landschaft. Auch hier können entstandene<br />
Beeinträchtigungen durch Wiederaufforstungsmaßnahmen in der Regel abgemildert<br />
werden.<br />
ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />
Unterlage_11_LBP.docx 10/174
24 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Die Gasdruck- Regel- und Messanlagen in Ettlingen und Leonberg stellen einen<br />
bleibenden Eingriff in das Landschaftsbild dar. Die Gebäude und die oberirdischen<br />
Armaturen stellen einen Fremdkörper in der Landschaft dar. Allerdings liegt bei beiden<br />
Standorten eine erhebliche Vorbelastung durch vorhandene Verkehrswege vor.<br />
Bei den Armaturengruppen ist die Beeinträchtigung des Landschaftsbilds zu vernachlässigen.<br />
Im Fall der Stationen Eutingen, Mönsheim und Leonberg wurden Standorte<br />
mit Vorbelastungen durch bereits vorhandene Stationen ausgewählt. Lediglich bei der<br />
Station Nöttingen war dies nicht möglich. Die Station wird mit einer Hecke eingegrünt.<br />
3.3.7 Kultur- und sonstige Sachgüter<br />
Baudenkmäler sind von dem Vorhaben nicht betroffen. Bodendenkmäler im Bereich des<br />
Vorhabens werden in der Umweltverträglichkeitsuntersuchung dargestellt.<br />
Mit dem Landesamt für Denkmalpflege wurden Vorab-Untersuchungen bei den folgenden<br />
sog. archäologischen Tabuflächen vereinbart:<br />
Tab. 5:<br />
Tabuflächen der archäologischen Bodendenkmalpflege<br />
Km Benennung Anmerkung<br />
16,0 Ettl. 043, Villa Rustica<br />
Für diese Fläche ist im Rahmen der Planungen eine geoelektrische<br />
Untersuchung durchgeführt worden. Mögliche Konflikte mit<br />
dem geplanten Leitungsbau sind nicht zu erwarten.<br />
Die Fläche wird randlich tangiert<br />
26,0 Auer 003, Mauerreste Die Fläche wird randlich tangiert<br />
31,2<br />
Mittelalterliche Wüstung<br />
„Im Kloster“<br />
Die Fläche wird randlich tangiert<br />
Art und Umfang der archäologischen Begleitung des Projektes wird zwischen dem<br />
Landesamt für Denkmalpflege und der Vorhabensträgerin vertraglich geregelt.<br />
4 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von<br />
Eingriffsfolgen<br />
Im vorliegenden Landschaftspflegerischen <strong>Begleitplan</strong> werden die in der UVU in Kapitel<br />
3 allgemein dargestellten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen lokal und auf<br />
den einzelnen Eingriffstatbestand bezogen präzisiert.<br />
• Die nachfolgend entworfenen Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes<br />
folgen dem naturschutzrechtlichen Gebot, bei Eingriffen in Natur und Landschaft<br />
• vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen (Vermeidungsgebot),<br />
2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />
10/174
Nordschwarzwaldleitung 25 / 48<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
• unvermeidbare Beeinträchtigungen zu minimieren (Minimierungsgebot) und<br />
• in ihren Wirkungen zu kompensieren (Ausgleichs- und Ersatzpflicht).<br />
Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung und zur Reduktion der<br />
Folgen des Eingriffs wurden in Zusammenarbeit und in Absprache mit dem Träger des<br />
Vorhabens erstellt. Sie sind für die ausführenden Baufirmen nicht fakultativ, sondern<br />
verbindlich.<br />
Eine Spezifizierung der im Einzelnen durchzuführenden Maßnahmen ist für den<br />
gesamten Leitungsverlauf auf der Bestands- und Maßnahmenkarte im Anhang dargestellt.<br />
Um die Umsetzung der Maßnahmen zu gewährleisten, müssen diese Vorgaben<br />
Bestandteil der Verträge mit den Baufirmen werden. Sie werden darüber hinaus durch<br />
eine ökologische Baubegleitung während der Baudurchführung gewährleistet.<br />
4.1 Vermeidungsmaßnahmen<br />
Vermeidungsmaßnahmen umfassen sämtliche Maßnahmen, die geeignet sind, um<br />
vermeidbare Auswirkungen auf die Umwelt abzuwenden. Teilweise werden in den<br />
Textfeldern zu den Konfliktstrecken in der Bestands- und Maßnahmenkarte keine<br />
Vermeidungsmaßnahmen vorgeschlagen. In diesen Fällen ist eine Vermeidung entweder<br />
nicht möglich oder sie wäre angesichts der schnellen Wiederherstellbarkeit oder der<br />
nur geringen Bedeutung des betroffenen Biotops (z. B. einzelner Strauch im Arbeitsstreifen)<br />
nicht angemessen.<br />
4.1.1 Schutzgut Mensch<br />
Bei der Trassenführung der Erdgasleitung wurde auf einen möglichst großen Abstand<br />
zu vorhandenen oder geplanten Wohn- und Gewerbegebieten sowie Einzelhäusern und<br />
-höfen Wert gelegt. Beispiele sind die nördlichen Ortsränder von Langensteinbach und<br />
Auerbach, der Hörnleweg in Pforzheim-Eutingen sowie die östliche Umfahrung von<br />
Wiernsheim.<br />
Östlich von Mönsheim quert die Trasse ein Gartenhausgebiet. Hier wurde der Arbeitsstreifen<br />
so geplant, dass möglichst geringe Beeinträchtigungen entstehen.<br />
4.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen<br />
Schonende Trassierung und Dimensionierung des Arbeitsstreifens<br />
Im Rahmen der Trassenplanung wurden verschiedene besonders sensible Lebensräume<br />
mit der Trassenführung umgangen. Beispiele sind die Lebensräume des Dunklen<br />
Wiesenknopf-Ameisenbläulings im FFH-Gebiet bei Wettersbach, die Umgehung des<br />
FFH-Gebiets „Bocksbach und Obere Pfinz“ und die Schonung von Magergrünland im<br />
Bereich des Gewanns „Brömach“ in Pforzheim-Eutingen.<br />
ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />
Unterlage_11_LBP.docx 10/174
26 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Der in den Planfeststellungsunterlagen dargestellte Arbeitsstreifen ist das Ergebnis<br />
einer intensiven Diskussion zwischen technischen Planern und Ökologen. Viele Teilbereiche<br />
wurden darüber hinaus mit Behördenvertretern bei verschiedenen Ortsterminen<br />
in Augenschein genommen. Als Ergebnis wurde der Arbeitsstreifen so dimensioniert,<br />
dass eine größtmögliche Schonung sensibler Lebensräume erreicht werden konnte. In<br />
vielen Bereichen wird der Arbeitsstreifen eingeengt, um Einzelbäume und Hecken zu<br />
erhalten, so z. B. im in den Obstwiesengebieten bei Kämpfelbach und Ispringen.<br />
Zu berücksichtigen ist, dass auch eine ausreichende Arbeitsstreifenbreite erforderlich<br />
ist, um eine angemessene Bodenschonung umsetzen zu können.<br />
Durch die Parallelführung zu bestehenden Strukturen wurden vorbelastete Bereiche für<br />
die Erdgasleitung in Anspruch genommen. Beispiele hierfür sind die Nutzung von<br />
Freileitungstrassen bei Ettlingen und Ispringen sowie die Parallelführung zur Bodensee-<br />
Trinkwasserleitung im Bereich Kämpfelbach.<br />
Schonung von angrenzenden Flächen<br />
Um alle Beeinträchtigungen und Störungen außerhalb der Baustelle zu vermeiden, sind<br />
die Flächen außerhalb des Arbeitsstreifens und der Zufahrten zum Arbeitsstreifen von<br />
jeglichem Baustellenverkehr freizuhalten (keine Abkürzungen über das freie Feld).<br />
Hierfür ist der Arbeitsstreifen eindeutig zu kennzeichnen. Bei Bedarf ist Flatterband<br />
einzusetzen. Baustellenzubehör darf nur innerhalb des geräumten Arbeitsstreifens und<br />
speziell vorgesehenen Stell- und Lagerflächen gelagert werden. Diese Maßnahmen<br />
vermeiden auch Eingriffe in andere Schutzgüter, wie z. B. den Boden.<br />
Errichtung von Amphibienschutzzäunen<br />
In gefährdeten Bereichen weist die Bestands- und Maßnahmenkarte Abschnitte aus, in<br />
denen Amphibienschutzzäune zu errichten sind.<br />
Bauzeitenbeschränkungen<br />
In gefährdeten Bereichen weist die Bestands- und Maßnahmenkarte Abschnitte aus, in<br />
denen Bauzeitenbeschränkungen erforderlich werden. Näheres hierzu geht auch aus<br />
der artenschutzrechtlichen Prüfung (Teil E, Unterlage 13) hervor. Die folgende Tabelle<br />
zeigt eine Übersicht der erforderlichen Bauzeitenregelungen:<br />
Tab. 6:<br />
Übersicht Bauzeitenregelungen<br />
Nr. 1 Arten Maßnahme Häufigkeit Lfm<br />
Kein Bau<br />
von - bis<br />
T 5 2<br />
Tagfalter<br />
Mahd der Wiesen im Juni –<br />
August des Vorjahres<br />
6 1.300<br />
01.07. –<br />
31.08.<br />
T 6<br />
Fische<br />
Elektrobefischung /<br />
Sedimentsperren / Kein Bau<br />
innerhalb der Laichperioden<br />
5 100<br />
01.02. –<br />
31.05.<br />
2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />
10/174
Nordschwarzwaldleitung 27 / 48<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Nr. 1 Arten Maßnahme Häufigkeit Lfm<br />
T 7a<br />
T 7a<br />
T 7b<br />
Feldlerche und<br />
Schwarzmilan<br />
Feldlerche<br />
Baumpieper, Dorngrasmücke,<br />
Wendehals, Grauspecht,<br />
Grünspecht,<br />
Mäusebussard<br />
Einrichten der Rohrlagerplätze<br />
4, 7 und 12 vor<br />
Brutbeginn<br />
Abtrag Oberboden<br />
außerhalb der Brutsaison<br />
Abtrag Oberboden<br />
außerhalb der Brutsaison<br />
3<br />
Nur<br />
Rohrlagerplätze<br />
5 4.500<br />
5 1.600<br />
T 7c Wendehals Bauverbot 1 200<br />
T 8<br />
Haselmaus<br />
kein Bau im Winter, kein<br />
Befahren der zu rodenden<br />
Flächen mit Schlepper<br />
1 Maßnahmenbezeichnung der artenschutzrechtlichen Prüfung<br />
2 Bei Umsetzung des Mahdregimes im Jahr vor dem Bau entfällt das Bauverbot<br />
5 1.000<br />
Kein Bau<br />
von - bis<br />
01.04. –<br />
31.07.<br />
01.04. –<br />
31.07.<br />
01.04. –<br />
31.07.<br />
01.04. –<br />
31.07.<br />
01.10. –<br />
30.04.<br />
Bau von Sedimentsperren<br />
Zum Schutz von Fischen, Muscheln und Flusskrebsen werden Sedimentsperren in<br />
Form von gesicherten Strohballen in verschiedenen Fließgewässern errichtet. Vor<br />
Starkregenereignissen sind diese rechtzeitig zu entfernen.<br />
Gehölzrodung im Winter<br />
Zur Vermeidung der Tötung oder Verletzung von Vogelarten gemäß § 44 (1) Nr. 1<br />
BNatSchG ist die Rodung von Gebüschen und Bäumen in den Monaten Oktober bis<br />
Februar durchzuführen.<br />
Schutz von Einzelbäumen und Gehölzen in Hecken<br />
Grundsätzlich ist der Wurzelbereich von Gehölzen (Kronendurchmesser zuzüglich<br />
1,5 m allseitig) nicht als Arbeitsstreifen zu nutzen. Hier sollen weder Erdaushub gelagert<br />
noch Maschinen und Geräte abgestellt werden.<br />
Zu erhaltende Heckenabschnitte und Einzelbäume sind mit Holzlatten außerhalb des<br />
Kronenraumes standfest einzuzäunen. Baumgruppen sind mit Flatterband einzuzäunen.<br />
Um das Beeinträchtigungsrisiko der unmittelbar an den Arbeitsstreifen grenzenden<br />
Gehölze zu verringern, sollen in Anlehnung an die DIN 18920 und die Richtlinien für die<br />
Anlage von Straßen (RAS-LP 4) eine Reihe von prophylaktischen Gehölzschutzmaßnahmen<br />
durchgeführt werden:<br />
Schutz der oberirdischen Teile gegen mechanische Beschädigungen<br />
Um die oberirdischen Teile der Gehölze gegen mechanische Beschädigungen zu<br />
schützen, sollen die Stämme der Bäume mit einer gegen den Stamm abgepolsterten<br />
mindestens 2 m hohen Bohlenummantelung versehen werden. Die Schutzvorrichtung<br />
ist ohne Beschädigung der Bäume anzubringen, insbesondere dürfen keine Bauklam-<br />
ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />
Unterlage_11_LBP.docx 10/174
28 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
mern, Nägel o. ä. in die Bäume geschlagen werden. Die Schutzvorrichtung darf nicht<br />
unmittelbar auf die Wurzelhälse aufgesetzt werden.<br />
Die Wurzelhälse sind auch gegen Beschädigung durch Überfahrten z. B. mit Raupenketten<br />
zu schützen. Hier können z. B. Altreifen zum Einsatz kommen. Bei der Anlagerung<br />
von Bodenmaterial darf bei der Entfernung des Bodens keine Beschädigung der<br />
Wurzelhälse durch die Baggerschaufel erfolgen, ggf. wird Handarbeit erforderlich.<br />
Untere, tief hängende Äste sind hochzubinden oder vor Beginn der Bauarbeiten<br />
fachgerecht aufzuasten, die Wunden sind mit einem scharfen Messer glattzuschneiden.<br />
Schutz der Wurzelbereiche bei kurzfristigen Aufgrabungen<br />
Gemäß der DIN 18920 sind Ausschachtungen im Wurzelbereich der Bäume mit<br />
Handschachtung durchzuführen. Grundsätzlich sollen Aufgrabungen wegen der Gefahr<br />
des Wurzelbruches nicht dichter als 2,5 m vom Stamm ausgeführt werden; im Einzelfall<br />
kann bei tiefwurzelnden Bäumen der Abstand auf 1,5 m, bei flachwurzelnden auf 2 m<br />
verringert werden.<br />
4.1.3 Schutzgut Boden<br />
Abtragen des Mutterbodens<br />
Der Mutterboden wird zu Beginn der Baumaßnahme zum Schutz vor Strukturschäden<br />
und Vermischungen auf der gesamten Arbeitsstreifenbreite abgetragen und gesondert<br />
vom mineralischen Unterboden gelagert. Beim Wiederverfüllen des Rohrgrabens ist<br />
eine Vermischung von humosem Oberboden und mineralischem Unterboden zu<br />
vermeiden.<br />
Keine zusätzliche Befestigung oder Versiegelung von Wegen<br />
Zuvor unbefestigte Wege dürfen im Zuge der Baumaßnahme nicht befestigt werden.<br />
Vermeidung von Bodenverdichtungen<br />
Bodenmieten werden nicht befahren. In empfindlichen Bereichen (insbesondere bei<br />
grundwasserbeeinflussten Böden) werden im Zuge des Oberbodenabtrages ggf.<br />
Baustraßen errichtet. Sofern dies erfolgt, sind die Baustraßen nach Beendigung der<br />
Baumaßnahme vollständig zu entfernen und der ursprüngliche Zustand des betroffenen<br />
Bereiches ist wiederherzustellen.<br />
Die Wiederherstellung von Dränungen sollte vor dem Mutterbodenauftrag erfolgen, um<br />
Bodenschäden zu vermeiden. Dies gilt insbesondere im Spätherbst oder Winter, wenn<br />
aufgrund hoher Niederschläge und geringer Verdunstung die Gefahr von Verdichtungen<br />
und Verschlämmungen des Bodens besonders hoch ist. Bei nicht tragfähigen Bodenverhältnissen<br />
aufgrund starken und lang andauernden Niederschlägen sind die Arbeiten<br />
einzustellen. Das Aufstauen von Niederschlagswasser ist sowohl im Bereich des<br />
Arbeitsstreifens als auch außerhalb zu vermeiden. Wasser, das sich in Tiefpunkten<br />
2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />
10/174
Nordschwarzwaldleitung 29 / 48<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
anstaut, ist abzuleiten. Rekultivierungsmaßnahmen werden nur bei ausreichend<br />
trockenem Boden durchgeführt.<br />
Umgang mit nicht einbaufähigem Bodenmaterial<br />
Oberboden und Rohrgrabenaushub sind gemäß LAGA Boden auf Wiedereinbaufähigkeit<br />
zu kontrollieren. Nicht einbaufähiger Boden wird abgefahren und ordnungsgemäß<br />
entsorgt.<br />
4.1.4 Schutzgut Wasser<br />
In den Sondergutachten zum Grundwasserschutz (Deckschichtenkartierung und<br />
Pumpversuche, Unterlage 8.4) werden ebenfalls Vermeidungsmaßnahmen dargestellt.<br />
Während der Bauphase ist beim Betanken der Baufahrzeuge und beim Betreiben von<br />
Pumpen für etwaige Wasserhaltungsmaßnahmen ein Eintrag von Kraft- und Schmierstoffen<br />
in das Erdreich zu vermeiden. Die Geräte und Maschinen sollen mit biologisch<br />
abbaubaren Ölen betrieben werden.<br />
Das Tanken ist ausschließlich von geschultem Personal vorzunehmen. Es ist nach<br />
Möglichkeit auf festen Tankplätzen durchzuführen. Eingesetzt werden dürfen nur<br />
biologisch abbaubare Hydrauliköle. Das Betanken von selbst fahrenden Geräten und<br />
Maschinen darf nicht innerhalb der Wasserschutzzone II erfolgen. Die Betankung von<br />
Kettenfahrzeugen lässt sich im Bereich von Wasserschutzzonen II nicht immer vermeiden,<br />
da diese teilweise große Ausdehnungen aufweisen. Dann erfolgt die Betankung<br />
auf temporär errichteten Betankungsplätzen, die mit festen Folien abgedichtet werden.<br />
Ortsfeste Aggregate und Pumpen werden in Auffangwannen aufgestellt und die Betankung<br />
mit äußerster Sorgfalt durchgeführt. In den Tank- und Montagewagen sowie den<br />
mobilen Werkstätten sind Bindemittel für Unfallsituationen mitzuführen. Die Etablierung<br />
von Notfallplänen mit den zugehörigen Meldeketten ist sicherzustellen. Material- und<br />
Gerätelager sowie Abstellplätze von Baumaschinen und Fahrzeugen sollen nicht in der<br />
Nähe von Oberflächengewässern angelegt werden.<br />
4.1.5 Schutzgut Landschaft<br />
Durch Einengungen des Arbeitsstreifens können in vielen Trassenabschnitten Eingriffe<br />
in prägende Gehölzstrukturen, wie z. B. Einzelbäume, vermieden werden.<br />
4.1.6 Schutzgut Kultur- und Sachgüter<br />
Bei der Trassenführung wurde auf archäologische Fundstellen Rücksicht genommen:<br />
Die drei betroffenen Fundstellen werden nur an ihren Randbereichen tangiert.<br />
ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />
Unterlage_11_LBP.docx 10/174
30 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
<strong>4.2</strong> Verminderungsmaßnahmen<br />
Unter diesem Begriff werden alle Maßnahmen zusammengefasst, die zur Verminderung<br />
von unvermeidbaren Auswirkungen auf die Umwelt dienen können.<br />
<strong>4.2</strong>.1 Schutzgut Mensch<br />
In der Bauphase werden Beeinträchtigungen von Anwohnern und Spaziergängern<br />
durch Staubentwicklung vermindert, indem die Trasse in Trockenperioden regelmäßig<br />
befeuchtet wird. Straßen werden mit Kehrmaschinen von Verschmutzungen gereinigt.<br />
Bei der offenen Querung von Straßen, Rad- und Fußwegen werden von der örtlichen<br />
Bauleitung Passiermöglichkeiten sichergestellt.<br />
Von der Bauleitung werden individuelle Lösungen zur Berücksichtigung der landwirtschaftlichen<br />
Belange angestrebt. Hierzu gehört z. B. der Bau provisorischer Zäune zur<br />
Absicherung von Weideflächen.<br />
<strong>4.2</strong>.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen<br />
Vor allem bei den Baggerarbeiten im Bereich der zu querenden Gewässer sind die<br />
Bauarbeiten zügig voranzutreiben, um die Beeinträchtigungen auf einen möglichst<br />
kurzen Zeitraum zu begrenzen.<br />
Die Umsetzung der Verminderungsmaßnahmen zum Schutzgut Boden kommt auch<br />
dem Schutzgut Tiere und Pflanzen zugute, da durch sie Standortveränderungen<br />
minimiert werden.<br />
<strong>4.2</strong>.3 Schutzgut Boden<br />
Maßnahmen zur Verminderung von Bodenverdichtungen<br />
Zur Verminderung von Bodenverdichtungen sind, abhängig von der Verdichtungsempfindlichkeit<br />
der Böden und der Witterung, möglichst Kettenfahrzeuge einzusetzen. Beim<br />
Einsatz von Radfahrzeugen sind Niederdruckreifen zu benutzen.<br />
Es ist darauf zu achten, dass sich bei längeren Regenperioden keine Aufstauungen<br />
entlang der Bodenmieten (sowohl innerhalb als auch außerhalb des Arbeitsstreifens)<br />
bilden, um Verschlämmungen des Bodens zu vermeiden. Bei länger anhaltenden<br />
Schlechtwetterperioden sind die Baumaßnahmen einzustellen. Dies gilt insbesondere<br />
bei der Bildung länger anhaltender Pfützen auf der Trasse. Der Aufbau eines stabilen<br />
Bodengefüges wird gegebenenfalls durch Kalkung und entsprechende Bewirtschaftungsmaßnahmen<br />
gefördert. Die Einebnung des Bodens muss umgehend nach Auftrag<br />
des Oberbodens erfolgen, so dass sich keine Aufstauungen im Bereich von Bodenunebenheiten<br />
bilden, die zu Verschlämmungen führen.<br />
2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />
10/174
Nordschwarzwaldleitung 31 / 48<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Verfüllung des Rohrgrabens mit Aushubmaterial<br />
Zum Verfüllen des Rohrgrabens ist das Aushubmaterial wieder einzubringen und<br />
möglichst entsprechend der ursprünglich anstehenden Lagerungsdichte wieder zu<br />
verdichten. Durch die Bildung von zwei verschiedenen Aushubmieten können Vermischungen<br />
deutlich unterschiedlicher Bodenhorizonte vermieden werden. Die DIN 19731<br />
ist zu beachten.<br />
Durch die Umhüllung des Rohres mit Faserzement kann die sonst oft übliche Einsandung<br />
des Rohres zumeist unterbleiben. Hierdurch werden die erforderlichen Transporte<br />
minimiert. Auf Trassenabschnitten ohne FZM-Ummantelung der Rohre wird der Schutz<br />
der Umhüllung durch eine Sandeinbettung bzw. eine besondere Aufbereitung des<br />
Aushubmaterials sichergestellt.<br />
<strong>4.2</strong>.4 Schutzgut Wasser<br />
Schutz von Oberflächengewässern<br />
Die Fahrzeugführung erfolgt bei den offen gequerten Bächen über Behelfsbrücken.<br />
Trübstoffhaltiges Wasser aus Wasserhaltungsmaßnahmen ist vor der Einleitung in<br />
Fließgewässer in Absetzbecken zu klären. Zur Verminderung der Sedimentfracht sind<br />
örtlich Strohballen in die gequerten Fließgewässer einzubringen, um Sediment auszufiltern.<br />
Bei Leitungsverlegung in der Nähe von Stillgewässern ist sicherzustellen, dass weder<br />
durch die Wasserhaltungsmaßnahmen in der Bauzeit noch durch die Einflüsse des<br />
Rohrgrabens während der Betriebsphase eine Entwässerung erfolgt.<br />
Während der Bauphase ist der Wasserspiegel in den nahegelegenen Stillgewässern zu<br />
kontrollieren. Bei sinkendem Wasserspiegel ist Wasser aus den Wasserhaltungsmaßnahmen<br />
einzuleiten, um ein Trockenfallen der Gewässer zu verhindern. Bei der Einleitung<br />
ist darauf zu achten, dass die Uferbereiche nicht beschädigt werden. Trübstoffhaltiges<br />
Wasser ist vor der Einleitung in Absetzbecken zu klären. Eine Anreicherung des<br />
Wassers mit Sauerstoff durch indirektes Einleiten über Prallteller oder ähnliches ist zu<br />
empfehlen.<br />
Schutz des Grundwassers<br />
Um die Wasserhaltungsmaßnahmen zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß zu<br />
begrenzen, sollen die Baumaßnahmen zügig durchgeführt werden. Baubedingte<br />
Wasserhaltungen werden in Unterlage 8 beantragt. Nach dem Verlegen des Rohrstranges<br />
wird das Aushubmaterial möglichst lagengerecht wieder eingebaut und erforderlichenfalls<br />
auf die Lagerungsdichte der angrenzenden, unbeeinträchtigten Flächen<br />
verdichtet, um eine unbeabsichtigte Entwässerung oder auch Stauwirkung durch den<br />
Rohrgraben zu vermeiden.<br />
Einbau von Dränungen<br />
ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />
Unterlage_11_LBP.docx 10/174
32 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Grundsätzlich sollen im Zuge des Leitungsbaus ausschließlich vorhandene Dränungen,<br />
die durch den Leitungsbau beeinträchtigt werden, funktionsgerecht wiederhergestellt<br />
werden. Ein Einbau von zusätzlichen Dränungen erfolgt nur zu diesem Zweck und in<br />
Ausnahmefällen. Im Bereich feuchter Grünlandflächen erfolgen keine zusätzlichen<br />
flächenhaften Dränungen.<br />
<strong>4.2</strong>.5 Schutzgut Klima / Luft<br />
Wälder fungieren als klimatische Ausgleichsflächen. Durch Minimierung des Gehölzeinschlags<br />
in Waldpassagen erfolgt auch eine Verminderung von Eingriffen in das Schutzgut<br />
Klima / Luft.<br />
<strong>4.2</strong>.6 Schutzgut Landschaft<br />
Eingriffe in Landschaftsbild-prägende Hecken werden durch Einengungen des Arbeitsstreifens<br />
vermindert.<br />
<strong>4.2</strong>.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter<br />
Die Tiefbauarbeiten werden durch eine archäologische Baubegleitung überwacht.<br />
Hierdurch können etwaige Auswirkungen auf Bodendenkmale in enger Abstimmung mit<br />
der zuständigen Behörde vermindert werden.<br />
5 Eingriffskompensation<br />
5.1 Ausgleichbarkeit<br />
Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen<br />
des Naturhaushalts wieder hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht<br />
wiederhergestellt oder neu gestaltet ist.<br />
Die Ausgleichbarkeit unvermeidbarer Eingriffe hängt von der zeitlichen Wiederherstellbarkeit<br />
der betroffenen Funktionen bzw. Biotope (als Konvention werden 25-30 Jahre<br />
Entwicklungszeit angesetzt) sowie von der räumlichen bzw. standörtlichen Wiederherstellbarkeit<br />
ab.<br />
5.2 Ausgleichsmaßnahmen<br />
5.2.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen<br />
Im Anschluss an den Bau der Leitung werden die Flächen wiederhergestellt. Brachflächen<br />
werden der Sukzession überlassen. Durch die Maßnahmen zur Flächenwiederherstellung<br />
kann die Beeinträchtigung der Vegetation zum Teil ausgeglichen werden.<br />
Im Bereich der eingeschlagenen Gehölze ist besonders sorgfältig auf eine Wiederanpflanzung<br />
zu achten. In der Regel wird eine Wiederanpflanzung im Verhältnis 1:1<br />
angestrebt, da sich bei ähnlichen Projekten gezeigt hat, dass zusätzliche Bäume auf<br />
2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />
10/174
Nordschwarzwaldleitung 33 / 48<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
den Flächen nicht unterzubringen sind, da zusätzliche Pflanzungen von den Eigentümern<br />
nicht akzeptiert werden.<br />
Dort wo Laubgehölze der freien Landschaft von dem Vorhaben betroffen sind, ist häufig<br />
eine Bergung der Wurzelstöcke, seitliche Lagerung und ein Wiedereinsetzen bei der<br />
Trassenwiederherstellung möglich. Die Wurzelstöcke haben i. d. R. eine ausreichende<br />
Ausschlagfähigkeit und wachsen besser wieder an als bei Verwendung von Jungpflanzen.<br />
Im Gegensatz zu anderen Vorhaben wie Bebauungen oder Straßenbau treten Beeinträchtigungen<br />
der Tierwelt fast ausschließlich während der Bauphase auf. Es handelt<br />
sich dabei um Störungen, die während der Bauphase durch die Baufahrzeuge, Maschinen<br />
und Geräte, die Anwesenheit von Menschen etc. erfolgen. Dies sind zeitlich<br />
begrenzte Beeinträchtigungen.<br />
5.2.2 Schutzgut Boden<br />
Der Bereich des Arbeitsstreifens sowie die Rohrlagerplätze werden vor dem Wiederauftrag<br />
des Mutterbodens im Rahmen der Trassenwiderherstellung in erforderlicher Tiefe<br />
gelockert. Eine weitere Lockerung erfolgt nach Auftrag des Mutterbodens. Falls partiell<br />
nach der Wiederherstellung noch Schäden festgestellt werden, können diese durch<br />
Meliorationsmaßnahmen beseitigt bzw. vermindert werden. Vom Leitungsrohr im Boden<br />
gehen keine erheblichen Beeinträchtigungen aus. Daher ist hier kein weiterer Ausgleich<br />
erforderlich.<br />
5.2.3 Schutzgut Wasser<br />
Beeinträchtigungen des Grundwassers treten durch Wasserhaltungsmaßnahmen<br />
während der Bauphase auf. Da sich der ursprüngliche Wasserstand erfahrungsgemäß<br />
nach Abschalten der Pumpen sehr schnell wieder einstellt, bleiben keine erheblichen<br />
Beeinträchtigungen zurück. Ausgleich ist somit nicht erforderlich.<br />
5.2.4 Schutzgut Klima / Luft<br />
Die Beeinträchtigung der Luft ist nur auf die Bauphase beschränkt. Erhebliche Beeinträchtigungen<br />
bleiben nicht über die Bauphase hinaus bestehen.<br />
5.2.5 Schutzgut Landschaft<br />
Durch die Wiederherstellung der Trasse erfolgt auch eine Wiederherstellung des<br />
Landschaftsbildes. Mit Ausnahme der Beeinträchtigungen durch die Schilderpfähle zur<br />
Kennzeichnung der Leitung ist die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes hierdurch<br />
ausgeglichen.<br />
ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />
Unterlage_11_LBP.docx 10/174
34 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Für Bereiche, in denen diese Ausgleichsmaßnahmen nicht ausreichend sind, werden<br />
weitere Maßnahmen außerhalb der eigentlichen Eingriffsfläche notwendig (s. folgendes<br />
Kapitel).<br />
5.3 Beschreibung der nicht vermeidbaren und nicht ausgleichbaren<br />
Eingriffe<br />
Die für den Leitungsbau in Anspruch genommenen Flächen können sich zwar nach<br />
Beendigung der Baumaßnahme wieder entwickeln, die Regenerationszeit reicht aber<br />
über die Bauphase hinaus, so dass eine zusätzliche Kompensation für das Schutzgut<br />
„Tiere und Pflanzen“ erforderlich wird.<br />
Trotz der beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Bodenverdichtungen<br />
ist örtlich mit verbleibenden Verdichtungen im Arbeitsstreifen zu rechnen.<br />
Darüber hinaus treten Vermischungen von Bodenschichten im Rohrgraben auf.<br />
5.4 Quantitative Eingriffsbewertung und Ermittlung des Ersatzflächenbedarfs<br />
Gemäß § 15 (2) BNatSchG ist eine Beeinträchtigung ersetzt, wenn und sobald die<br />
beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in<br />
gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu<br />
gestaltet ist.<br />
5.4.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen<br />
Im Folgenden wird der Ersatzflächenbedarf anhand der Darlegungen von Ökokonto-<br />
Verordnung (2010) hergeleitet. Es wurde folgendermaßen vorgegangen:<br />
• Es erfolgte eine Bewertung jedes einzelnen Biotoptyps mit Hilfe des Feinmoduls.<br />
Dabei wurden Zu- und Abschläge, je nach Ausprägung des Biotops berücksichtigt.<br />
Diese Bewertung wird in Klammern unter jedem Biotoptyp in der Bestands- und<br />
Maßnahmenkarte dargestellt.<br />
• Der Bereich des Arbeitsstreifens wurde mit Hilfe eines Geographischen Informationssystems<br />
mit den ermittelten Biotoptypen verschnitten, so dass die beeinträchtigte<br />
Fläche für jeden Biotoptyp ermittelt wird.<br />
• Die Ausprägung des Biotoptyps nach Abschluss des Vorhabens wird anhand des<br />
„Planungsmoduls“ abgeschätzt. Es handelt sich hierbei um einen Prognosewert für<br />
die Biotopqualität, die sich nach 25 Jahren einstellt. Oft stellt sich nach kurzer Zeit<br />
wieder der Ausgangswert ein (z. B. bei Äckern und Fettwiesen). Auch der Planungswert<br />
wird in der Bestands- und Maßnahmenkarte unter dem Biotoptyp dargestellt. Im<br />
Bereich von Feldgehölzen und Wäldern muss ein Streifen von 2,5 m beiderseits der<br />
2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />
10/174
Nordschwarzwaldleitung 35 / 48<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Leitung dauerhaft freigehalten werden. Hier wird die Entwicklung einer Ruderalflur<br />
(11 Wertpunkte) angenommen.<br />
• Es werden die Biotopwerte mit den Flächenwerten multipliziert, und anschließend<br />
wird die Differenz zwischen dem Zustand vor und dem Zustand nach der Baumaßnahme<br />
ermittelt.<br />
• Es werden alle Wertdifferenzen aufsummiert.<br />
Beispiel: Der Arbeitsstreifen quert auf 1.000 m² eine Magerwiese mit einer überdurchschnittlich<br />
hohen Artenvielfalt. Die Wiese wird im Feinmodul mit 25 Wertpunkten<br />
bewertet. Im Planungsmodul werden 21 Wertpunkte angesetzt, die die Wiese nach dem<br />
gemäß Ökokontoverordnung vorgegebenen Zeitraum von 25 Jahren wieder erreichen<br />
kann. Es kommt zu einer Wertdifferenz von 4 Wertpunkten, so dass sich bei der<br />
1.000 m² großen Fläche 4.000 Wertpunkte aufsummieren. In der Bestands- und<br />
Maßnahmenkarte wird die Bewertung wie folgt dargestellt:<br />
3343 Biotopschlüssel für „Magerwiese<br />
25-> 21 Aktuelle Biotopbewertung mit 25 Wertpunkten. Der Wert<br />
verringert sich im Bereich des Arbeitsstreifens auf 21<br />
Wertpunkte nach der Baumaßnahme<br />
Es ergibt sich ein Defizit von 931.543 Wertpunkten.<br />
Kompensationskonzept<br />
Das Kompensationskonzept berücksichtigt in besonderem Maße die mit dem Vorhaben<br />
verbundenen Eingriffe in Wälder und Gehölze, Magergrünland und Gewässer. Als<br />
Kompensation für die erforderlichen Versiegelungen wird durch den Rückbau der<br />
Feuerlöschteiche eine Entsiegelungsmaßnahme umgesetzt. Darüber hinaus wird auch<br />
das im Rahmen des Scopingverfahrens formulierte Ziel berücksichtigt, mit den Maßnahmen<br />
nur in geringem Umfang landwirtschaftlich genutzte Flächen für den Naturschutz<br />
umzuwidmen. Die folgende Übersicht zeigt die vier geplanten Maßnahmen:<br />
Tab. 7:<br />
Übersicht Kompensationsmaßnahmen<br />
Nr.<br />
Maßnahme<br />
Gemarkung<br />
Flurstück<br />
Flächengröße<br />
Kompensierte<br />
Wertpunkte<br />
Bewertungsansatz<br />
1<br />
Rückbau von vier<br />
Feuerlöschbecken<br />
am Hedwigshof<br />
Ettlingen<br />
Ettlingen<br />
10520<br />
Ca. 450 m² 280.000<br />
Bewertung über Herstellungskostenansatz<br />
(Ökokonto-VO Kap.<br />
1.3.5)<br />
ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />
Unterlage_11_LBP.docx 10/174
36 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Nr.<br />
Maßnahme<br />
Gemarkung<br />
Flurstück<br />
Flächengröße<br />
Kompensierte<br />
Wertpunkte<br />
Bewertungsansatz<br />
2<br />
Sanierung von zwei<br />
Trockenmauern in<br />
Weissach an der<br />
Strudelbachhalle<br />
Weissach<br />
8265, 8266<br />
Ca. 70 lfm 260.000<br />
Bewertung über Herstellungskostenansatz<br />
(Ökokonto-VO Kap.<br />
1.3.5)<br />
3<br />
4<br />
Aufforstung einer<br />
Ackerfläche mit<br />
einem Eichenwald<br />
Umwandlung einer<br />
von Brombeeren<br />
dominierten<br />
Gartenbrache in eine<br />
Magerwiese<br />
Menzingen<br />
10553<br />
Eutingen<br />
1719<br />
26.500 m² 397.500<br />
1.424 m² 17.088<br />
Summe 954.588<br />
Acker: 4 WP<br />
Planungswert Eichen-<br />
Sekundärwald: 19 WP<br />
Differenz: 15 WP x 26.500 m² =<br />
397.500 WP<br />
Brombeergestrüpp: 9 WP<br />
Planungswert Magerwiese: 21 WP<br />
Differenz: 12 WP x 1.424 m² =<br />
17.088 WP<br />
Wie die Übersicht zeigt, sind die geplanten Maßnahmen 1 - 4 geeignet, das mit dem<br />
Vorhaben verbundene Defizit von 931.543 Wertpunkten zu kompensieren. Es kommt zu<br />
einer geringfügigen Überkompensation von 23.045 Wertpunkten.<br />
Im Folgenden werden die vier Ersatzmaßnahmen näher erläutert:<br />
Maßnahme Nr. 1:<br />
Der Rückbau von vier Feuerlöschbecken südöstlich der B 3 am Hedwigshof wurde von<br />
der Stadt Ettlingen angeregt. Es handelt sich um vier alte Betonbecken, die den Verlauf<br />
des Baches unterhalb der Hedwigsquelle naturfern überprägen. Die vier massiven<br />
Querbauwerke weisen Abstürze von ca. 1,0 m Höhe auf. Die Becken sind mit Bodenplatten<br />
versiegelt. Es ist geplant, die Becken rückzubauen, den Beton zu entsorgen und<br />
an Stelle der ursprünglichen Becken ein naturnahes Bachprofil anzulegen. Eine Ersatzlösung<br />
für die Feuerlöschbecken zur Erhaltung der Brandschutz-Vorgaben wird durch<br />
die Stadt Ettlingen geplant und umgesetzt. Da es sich bei diesem Vorhaben um eine<br />
kleinflächige Maßnahme mit großer Flächenwirkung handelt, wird der Herstellungskostenansatz<br />
(Ökokonto-VO Kap. 1.3.5) für die Herleitung der Wertpunkte herangezogen.<br />
Hierfür wurde bei einem regional ansässigen Tiefbauunternehmen, das auf wasserbauliche<br />
Maßnahmen spezialisiert ist, ein Kostenvoranschlag eingeholt. Dieser geht von<br />
Kosten in Höhe von 70.000,-- € für die Maßnahme aus. Die Maßnahme ist geeignet, die<br />
mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe in Gewässer sowie die erforderlichen Versiegelungsmaßnahmen<br />
zu ersetzen.<br />
2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />
10/174
Nordschwarzwaldleitung 37 / 48<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Abb. 1: Übersicht Maßnahme Nr. 1<br />
Abb. 2: Detail Maßnahme Nr. 1<br />
ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />
Unterlage_11_LBP.docx 10/174
38 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Maßnahme Nr. 2:<br />
Auf der Gemarkung Weissach befinden sich westlich der Strudelbachhalle auf den<br />
beiden Flurstücken 8265 und 8266 verschiedene brachgefallene Obstgärten. Hier hat<br />
die Gemeinde Weissach bereits zwei Trockenmauern saniert. Zwei weitere degradierte<br />
Mauern bieten sich zur Sanierung an. Sie haben Längen von jeweils ca. 35 m. Auch<br />
hier handelt es sich um eine kleinflächige Maßnahme, die nach dem Herstellungskostenansatz<br />
bewertet wird. Hierfür liegen Erfahrungswerte der Gemeinde vor, die von<br />
30.000,-- € pro Mauer ausgeht. Die Maßnahme ist geeignet, Eingriffe in Kleinstrukturen<br />
und Trockenlebensräume wie z. B. Säume und Böschungen zu kompensieren und<br />
Lebensräume vor allem für Reptilien herzustellen.<br />
Abb. 3: Übersicht Maßnahme Nr. 2<br />
2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />
10/174
Nordschwarzwaldleitung 39 / 48<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Abb. 4: Detail Maßnahme Nr. 2<br />
Maßnahme Nr. 3:<br />
Südöstlich der Ortslage Menzingen (Landkreis Karlsruhe) befindet sich ein ca. 220 ha<br />
großer Laubwaldkomplex. An seinem westlichen Rand ragt das 2,65 ha große Flurstück<br />
10553 als intensiv genutzter Maisacker in diesen Waldkomplex hinei. Aufgrund der<br />
Beschattung sind die landwirtschaftlichen Erträge mäßig. Die Aufforstung der Fläche<br />
wurde durch das Landwirtschaftsamt des Landkreises Karlsruhe bereits genehmigt. Die<br />
Fläche befindet sich etwa 22 km von der geplanten Nordschwarzwaldleitung entfernt.<br />
Sie fällt aber in den von der Erdgasleitung betroffenen Naturraum „Neckar- und Tauber-<br />
Gäuplatten / Kraichgau“. Es ist geplant, eine Eichenkultur mit Beimischung von ca. 10<br />
% Hainbuche anzulegen. Am südwestlichen Ende der Fläche wird ein Waldrand mit<br />
bodenständigen Straucharten angelegt. Die Fläche wird mit einem ca. 1,5 m hohen<br />
Wildzaun umzäunt. Die Zäunung wird bereits im Rahmen dieser Planfeststellung mit<br />
beantragt. Die Maßnahme ist in besonderem Maße geeignet, die mit dem Vorhaben<br />
verbundenen Wald- und Gehölzverluste zu ersetzen. Darüber hinaus wird durch die<br />
Überführung in forstliche Nutzung ein positiver Beitrag zum Bodenschutz erreicht.<br />
ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />
Unterlage_11_LBP.docx 10/174
40 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Abb. 5:<br />
Übersicht Maßnahme Nr.3<br />
Abb. 6: Detail Maßnahme Nr. 3<br />
2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />
10/174
Nordschwarzwaldleitung 41 / 48<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Maßnahme Nr. 4:<br />
In der Gemarkung Eutingen befindet sich westlich der sog. Igelsbachsiedlung eine<br />
Teilfläche des FFH-Gebiets „Enztal bei Mühlacker“, die auch von der Nordschwarzwaldleitung<br />
gequert wird. Hier befinden sich in größerem Umfang gut ausgeprägte magere<br />
Obstwiesen. Zwischen den Gewannen „Brömach“ und „Eichenlaub“ befindet sich ein<br />
asphaltierter Weg, an dem auf dem Flurstück 1719 eine Obstgartenbrache liegt. Die<br />
Fläche ist nahezu vollständig von Brombeeren überwachsen. Es ist geplant, die Fläche<br />
in eine Magerwiese umzuwandeln und dauerhaft als solche zu erhalten. Voraussichtlich<br />
werden die Maßnahmen von der Stadt Pforzheim durchgeführt und von der Vorhabensträgerin<br />
monetär abgelöst. Die Stadt Pforzheim (Umweltamt) hat auch die Durchführung<br />
einer entsprechenden Maßnahme angeregt. Die Maßnahme ist geeignet, die mit dem<br />
Vorhaben verbundenen Eingriffe in mageres Grünland zu ersetzen.<br />
Abb. 7: Übersicht Maßnahme 4<br />
ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />
Unterlage_11_LBP.docx 10/174
42 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Abb. 8: Detail Maßnahme 4<br />
5.<strong>4.2</strong> Schutzgut Boden<br />
Die Eingriffe in den Boden stellen sich wie folgt dar: Im Bereich des Arbeitsstreifens<br />
wird der humose Oberboden abgezogen und seitlich gelagert. Die Bodenfunktionen<br />
werden demnach hauptsächlich durch das Befahren und damit verbundene Verdichten<br />
des Unterbodens beeinträchtigt. Von einem Einfluss der temporären Wasserabsenkung<br />
auf die Bodenfunktionen wird nicht ausgegangen.<br />
Gemäß der Arbeitshilfe „Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“<br />
lässt sich der Eingriff im Bereich des Arbeitsstreifens in die Kategorie „bauzeitliche<br />
Beeinträchtigungen“ einordnen. Demnach kann für verdichtungsempfindliche<br />
Böden ein pauschaler Verlust von 10 % der ursprünglichen Leistungsfähigkeit angesetzt<br />
werden. Dabei wurden gemäß der Arbeitshilfe die Bodenfunktionen natürliche Bodenfruchtbarkeit<br />
(nat.Bodenfr.), Ausgleichskörper für den Wasserkreislauf (AKIWAS), Filter<br />
und Puffer für Schadstoffe (FIPU) und Standort für natürliche Vegetation (St.nat.Veg.)<br />
bewertet.<br />
In einem ersten Arbeitsschritt wurden die verdichtungsempfindlichen Böden im Bereich<br />
des Arbeitsstreifens ermittelt (vgl. UVU Kap. 2.3.4.). Datengrundlage bilden die BK 50<br />
ergänzt durch die Bodenschätzungsdaten auf Basis von ALK und ALB. Die Bodenschätzungsdaten<br />
enthalten für die verdichtungsempfindlichen Böden keine Angabe zur<br />
Bodenfunktion. Im Folgenden wurden deshalb die Angaben zur Bodenfunktion aus der<br />
BK 50 entnommen.<br />
2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />
10/174
Nordschwarzwaldleitung 43 / 48<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Im Anschluss wurden die gemäß der Arbeitshilfe „Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen<br />
Eingriffsregelung“ relevanten Bewertungsklassen der betroffenen<br />
Böden ermittelt. Die Bewertungsklasse Filter- und Pufferfunktion musste, da sie sich<br />
aus mehreren Einzelwerten zusammensetzt, gemittelt werden. Da alle Flächen landwirtschaftlich<br />
genutzt werden, konnten bei den Funktionen „Ausgleichskörper für den<br />
Wasserkreislauf“ und „Filter- und Pufferfunktion“ die Angaben für landwirtschaftlich<br />
genutzte Flächen herangezogen werden.<br />
Der Verlust der ursprünglichen Leistungsfähigkeit ergibt sich durch die Multiplikation der<br />
Bewertungsklasse mit dem Faktor 0,1. Mit Hilfe eines Geoinformationssystems wurden<br />
die verdichtungsempfindlichen Böden mit der Flächeninanspruchnahme der Fahrspur<br />
im Arbeitsstreifen verschnitten. Es wird davon ausgegangen, dass die temporäre<br />
Lagerung der Bodenmieten keine Bodenverdichtungen verursacht und diese nur im<br />
Bereich der mit Baufahrzeugen befahrenen Fahrspur auftreten.<br />
Gemäß der Arbeitshilfe „Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“<br />
ist es möglich, durch fachgerechte Rekultivierung eine weitgehende Wiederherstellung<br />
der beeinträchtigten Leistung von Böden im Naturhaushalt zu erreichen. Diese<br />
direkte Kompensation auf der Eingriffsfläche ist vorrangig zu betrachten.<br />
Aus Erfahrungswerten im Pipelinebau ergibt sich, dass durch obligatorische Vermeidungsmaßnahmen<br />
wie z.B. die Einrichtung von Baustraßen, Beeinträchtigungen auf<br />
80 % vermieden werden. Es bleibt als rechnerischer Ansatz auf 20 % der Fläche ein<br />
Wertverlust durch den Eingriff. Durch Maßnahmen der Wiederherstellung (Tiefenlockerung)<br />
können davon zu 50 % Funktionen wiederhergestellt werden. Auf der restlichen<br />
Fläche ist mit Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen zu rechnen. Diese Werte stellen<br />
sich bei den ungünstigsten äußeren Verhältnissen ein (hohe Niederschläge, bautechnische<br />
Schwierigkeiten usw.).<br />
Es ergibt sich somit eine Fläche, auf der Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen in<br />
dem in der Arbeitshilfe „Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“<br />
beschriebenen Rahmen verbleiben. Die Tabelle unten zeigt die Rechenschritte<br />
für die verschiedenen Bewertungsklassen, wie viele Hektarwerteinheiten durch Kompensation<br />
beim Schutzgut Boden ausgeglichen werden müssen:<br />
ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />
Unterlage_11_LBP.docx 10/174
44 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Tab. 8:<br />
Verlust an Hektarwerteinheiten Schutzgut Boden im Bereich des Arbeitsstreifens<br />
BE e111 e76 g85<br />
Bodeneinheit<br />
Auengley und Brauner<br />
Auenboden-Auengley<br />
aus Auenlehm<br />
Pseudogley-<br />
Parabraunerde aus Löss<br />
Kalkhaltiger Auengley<br />
aus Auenlehm<br />
Bewertungsklasse vor dem Eingriff<br />
St.nat.Veg. 3 0 3<br />
nat.Bodenfr. 2,5 2,5 2,5<br />
AKIWAS 3 2,5 3<br />
FIPU 3,5 3 3<br />
Werteinheitenverlust durch den Eingriff (gem. Arbeitshilfe für verdichtungsempfindliche Böden x<br />
0,1)<br />
St.nat.Veg. 0,3 0 0,3<br />
Bodenfruchtbarkeit 0,25 0,25 0,25<br />
AKIWAS 0,3 0,25 0,3<br />
FIPU 0,35 0,3 0,3<br />
Berechnung der betroffenen Fläche<br />
Fläche im Fahrstreifen 0,333 0,444 0,783<br />
Maßnahmen zur Vermeidung obligatorisch (Baustraßen)<br />
Wertverlust 0,200 0,200 0,200<br />
Maßnahmen zur Vermeidung fakultativ (Baustraßen bei zu hoher Bodenfeuchte)<br />
Wertverlust 0,300 0,300 0,300<br />
Maßnahmen zur Kompensation auf der Eingriffsfläche (Tiefenlockerung, Wiederbegrünung)<br />
Wertverlust 0,500 0,500 0,500<br />
Flächenanteil mit bleibenden Beeinträchtigungen<br />
Fläche [ha] 0,009993 0,013311 0,023484<br />
Verlust von Hektarwerteinheiten<br />
St.nat.Veg. 0,0029979 0 0,0070452<br />
Bodenfruchtbarkeit 0,00249825 0,00332775 0,005871<br />
AKIWAS 0,0029979 0,00332775 0,0070452<br />
FIPU 0,00349755 0,0039933 0,0070452<br />
Summe 0,0119916 0,0106488 0,0270066<br />
Im Bereich des Rohrgrabens kommt es zu Bodenvermischungen, auch wenn diese<br />
durch sorgfältigen Einbau weitgehend vermieden werden können, und zur Einbringung<br />
eines Fremdkörpers. Die Arbeitshilfe „Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen<br />
Eingriffsregelung“ betrachtet diesen Fall nicht. Die Herleitung des Kompensationsbedarfs<br />
erfolgt deshalb nach einem angepassten Bewertungsverfahren.<br />
Während der Bauphase ist für einen möglichst kurzen Zeitraum der Rohrgraben<br />
geöffnet. Der ausgehobene Boden wird in Mieten seitlich gelagert. Treten im Rohrgra-<br />
2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />
10/174
Nordschwarzwaldleitung 45 / 48<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
ben unterschiedliche Horizonte auf, werden diese in einer dritten Miete gelagert (A -<br />
Oberboden; B- und ggf. C-Horizont , Rohrgraben).<br />
Die Situation nach der Wiederherstellung stellt sich so dar, dass in einer Tiefe von<br />
1,2 m die geplante Gasleitung mit einem Durchmesser von 600 mm liegt. Über der<br />
Leitung (1,2 m) wird der Boden weitgehend lagegerecht wieder eingebaut. Das von dem<br />
Rohr verdrängte Volumen wird im Arbeitsstreifen verteilt und führt hier zu einer nicht<br />
wahrnehmbaren Erhöhung. Steinhaltiges oder stark bindiges Material wird abgefahren.<br />
Der gesamte Arbeitsstreifen wird tiefengelockert.<br />
Die Berechnung der Kompensation erfolgt in Anlehnung an die Arbeitshilfe „Das<br />
Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“. Hierbei erfolgt die<br />
Bewertung der Bodenfunktionen „natürliche Bodenfruchtbarkeit“, „Ausgleichskörper für<br />
den Wasserkreislauf“ und „Filter- und Pufferfunktion für Schadstoffe“ vor und nach dem<br />
Eingriff.<br />
Die Beeinträchtigung der Bodenfunktionen im Bereich des Rohrgrabens ist während der<br />
Bauphase und vor allem bei geöffnetem Rohrgraben hoch. Beim lagegerechten Wiedereinbau<br />
des autochthonen Bodens kann es zu Durchmischungen des Unterbodens<br />
kommen, vor allem ist aber damit zu rechnen, dass das Bodengefüge beeinträchtigt<br />
wird.<br />
Mit dem Wiederherstellen und der Wiederbegrünung stellen sich das Bodengefüge und<br />
die Bodenfunktionen wieder ein. Die Dauer, bis die Böden ihre ursprüngliche Leistungsfähigkeit<br />
erreichen, hängt u. a. von äußeren Einflüssen wie dem Klima und der landwirtschaftlichen<br />
Nutzung ab. Sie stellt sich i. d. R. nach einigen Jahren wieder nahezu<br />
vollständig ein.<br />
Der Einfluss des Fremdkörpers im Boden kann vernachlässigt werden, da gemäß Heft<br />
31 dieser außerhalb der Kontrollsektion liegt und somit nicht in die Bewertung der<br />
Bodenfunktionen einfließt.<br />
Die Vermeidungsmaßnahmen wie der lagegerechte Aus- und Einbau des Bodens sowie<br />
die Wiederherstellungsmaßnahmen (Tiefenlockerung und Wiederbegrünung) werden<br />
als so effektiv bewertet, dass weitere Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, wie sie<br />
für den gesamten Arbeitsstreifen beschrieben wurden, nicht zu erwarten sind.<br />
Der Kompensationsbedarf für Eingriffe in den Boden errechnet sich gemäß der Tabelle<br />
im Anhang für die Böden, die im Rahmen der Berechnung für den Arbeitsstreifen nicht<br />
berücksichtigt wurden (weniger verdichtungsempfindliche Böden).<br />
Die Kompensationsermittlung für Versiegelung von Boden im Bereich der Stationen<br />
erfolgt gemäß der Arbeitshilfe „ Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen<br />
ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />
Unterlage_11_LBP.docx 10/174
46 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Eingriffsregelung“ über die Funktionen „natürliche Bodenfruchtbarkeit“, „Ausgleichskörper<br />
im Wasserkreislauf“ sowie „Filter und Puffer für Schadstoffe“.<br />
Grundlage ist die Auswertung in der BK 50 gemäß dem Leitfaden „Bewertung von<br />
Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit“ (Heft 31 aus der Reihe "Luft, Boden, Abfall" des<br />
Umweltministeriums Baden - Württemberg, 1995).<br />
Die Tabelle unten fasst die Berechnung des Kompensationsbedarfs für die Stationen<br />
zusammen:<br />
Tab. 9:<br />
Verlust Hektarwerteinheiten Stationen<br />
Betroffene<br />
Fläche [ha]<br />
BE g62 e107 e46 l59 l45 1 w39<br />
Mäßig<br />
tiefes und<br />
tiefes<br />
Kolluvium<br />
(Heckengäu,<br />
mo)<br />
Kalkhaltiger<br />
Auenpseupseudogley-<br />
Brauner<br />
Auenboden<br />
aus<br />
Auenlehm<br />
Parabraunerde<br />
aus<br />
würmzeitlichem<br />
Löss<br />
Auengley<br />
und<br />
Brauner<br />
Auenbo-<br />
den-<br />
Auengley<br />
aus<br />
Auenlehm<br />
Kolluvium<br />
und<br />
Pseu-<br />
dogley-<br />
Kolluvium<br />
aus<br />
Abschwemm<br />
massen<br />
über<br />
Fließerde<br />
Auftrag<br />
(Deponie,<br />
Halde)<br />
0,006 0,0072 0,011 0,0063 0,002 0,0145 0,0115<br />
Werteinheiten der Bodeneinheiten<br />
NATVEG 1 1 1 1 1 1<br />
NATBOD 3,5 3 3 2,5 2,5 2,5<br />
AKIWAS_LN 3 3 3 2 2,5 4<br />
FIPU_LN 2,5 3,5 3 3 4 2<br />
Wertverlust durch den Bau der Stationen<br />
NATVEG 0 0 0 0 0 0<br />
NATBOD 2,5 2 2 1,5 1,5 1,5<br />
AKIWAS_LN 2 2 2 1 1,5 3<br />
FIPU_LN 1,5 2,5 2 2 3 1<br />
Verlust an ha Werteinheiten<br />
NATVEG 0 0 0 0 0 0 0<br />
NATBOD 0,015 0,0144 0,022 0,00945 0,003 0 0,01725<br />
AKIWAS_LN 0,012 0,0144 0,022 0,0063 0,003 0 0,0345<br />
FIPU_LN 0,009 0,018 0,022 0,0126 0,006 0 0,0115<br />
Parabraunerde<br />
aus<br />
Hochflutlehm<br />
auf<br />
Niederterrassenschottern<br />
Kompensationsbedarf<br />
[haWE]<br />
0,036 0,0468 0,066 0,02835 0,012 0 0,06325<br />
2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />
10/174
Nordschwarzwaldleitung 47 / 48<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
Für Eingriffe im Arbeitsstreifen, im Rohrgraben und im Bereich der Stationen ergibt sich<br />
der in der Tabelle unten dargestellte Kompensationsbedarf:<br />
Tab. 10:<br />
Kompensationsbedarf für das Schutzgut Boden (Hektarwerteinheiten)<br />
Arbeitstreifen Rohrgraben Stationen Summe<br />
St.nat.Veg. 0,0100431 0,128004 0 0,1380471<br />
Bodenfruchtbarkeit 0,011697 0,036999 0,0811 0,129796<br />
AKIWAS 0,01337085 0,0321045 0,0922 0,13767535<br />
FIPU 0,01453605 0,0477945 0,0791 0,14143055<br />
Summe 0,049647 0,244902 0,2524 0,546949<br />
Die im Kapitel 5.4.1 dargestellten Kompensationsmaßnahmen sind so geplant, dass<br />
durch sie auch die Bodenfunktionen verbessert werden. Sie sind schutzgutübergreifend<br />
angelegt, so dass durch sie auch der erforderliche Kompensationsbedarf für den Boden<br />
abgedeckt wird.<br />
6 Quellenverzeichnis<br />
ARGE EINGRIFF-AUSGLEICH NRW (1994): Entwicklung eines einheitlichen Bewertungsrahmens<br />
für straßenbedingte Eingriffe in Natur und Landschaft und deren Kompensation<br />
(Endbericht). Erarbeitet durch FROELICH & SPORBECK,<br />
LANDSCHAFTSWERKSTATT NOHL, SMEETS + DAMASCHEK, INGENIEURBÜRO W.<br />
VALENTIN. Hg.: Ministerium für Stadtentwicklung und Verkehr NRW und Ministerium<br />
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW, Düsseldorf.<br />
DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, HG. (1990): DIN 18915: Vegetationstechnik im<br />
Landschaftsbau: Bodenarbeiten, Berlin.<br />
DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, HG. (1990): DIN 18920: Schutz von Bäumen,<br />
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen, Berlin.<br />
DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, HG. (2000): DIN 18300: VOB Teil C: Allgemeine<br />
Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) - Erdarbeiten, Berlin.<br />
FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR STRASSEN- UND VERKEHRSWESEN (1999): Richtlinie für<br />
die Anlage von Straßen (RAS) Teil: Landschaftspflege (RAS-LP); Abschnitt 4:<br />
Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen<br />
RAS-LP 4, Köln.<br />
INSTITUT FÜR BOTANIK UND LANDESKUNDE (2005) : Bewertung der Biotoptypen Baden-<br />
Württembergs zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs in der Eingriffsregelung.<br />
ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />
Unterlage_11_LBP.docx 10/174
48 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />
Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />
KÖPPEL, J. ET AL. (1998): Praxis der Eingriffsregelung: Schadenersatz an Natur und<br />
Landschaft? Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.<br />
KÜPFER, C. (2005): Empfehlungen für die Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft<br />
in der Bauleitplanung, Ermittlung von Art und Umfang von Kompensationsmaßnahmen<br />
sowie deren Umsetzung.<br />
LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTE<strong>MB</strong>ERG (2001): Arten, Biotope,<br />
Landschaft. Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben, Bewerten- 3.Auflage 2001.<br />
Karlsruhe<br />
SCHUCHARDT, B.; W. SCHOLLE, M. BECKMANN UND H. KULP (1999): Auswirkungen der<br />
Verlegung einer Gasfernleitung auf die Bodenfunktion. Naturschutz und Landschaftsplanung<br />
6/99.<br />
UMWELTMINISTERIUM BADEN-WÜRTTE<strong>MB</strong>ERG: Das Schutzgut Boden in der Eingriffsregelung<br />
(2006)<br />
UMWELTMINISTERIUM BADEN-WÜRTTE<strong>MB</strong>ERG: Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit<br />
(2010)<br />
UMWELTMINISTERIUM BADEN-WÜRTTE<strong>MB</strong>ERG: Verordnung des Ministeriums für Umwelt,<br />
Naturschutz und Verkehr über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durchgeführter<br />
Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Ökokonto-VO,<br />
2010)<br />
7 Anhang<br />
Tabelle<br />
Karte<br />
Eingriffsbewertung Boden (Rohrgraben)<br />
Übersichtskarte M 1: 25.000 mit Blattschnitten<br />
Karte Bestands- und Maßnahmenkarte M. 1: 1.000<br />
2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />
10/174