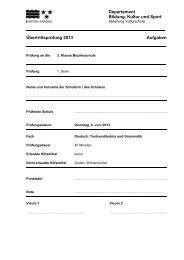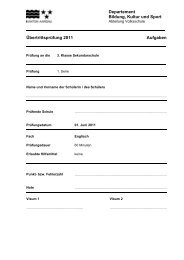Merkblatt Individuelle Lernvereinbarung
Merkblatt Individuelle Lernvereinbarung
Merkblatt Individuelle Lernvereinbarung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Departement<br />
Bildung, Kultur und Sport<br />
Abteilung Volksschule<br />
<strong>Merkblatt</strong> <strong>Individuelle</strong> <strong>Lernvereinbarung</strong> (ILV)<br />
<strong>Individuelle</strong> <strong>Lernvereinbarung</strong>en sind erforderlich, wenn zusätzliche individuelle Ressourcen<br />
(Förderlektionen) beansprucht werden oder wenn Dispensationen von Pflicht- oder Wahlpflichtfächern<br />
verfügt werden, insbesondere bei Lernbehinderungen (Verstärkte Massnahmen<br />
für Behinderte) und befristetem Schulausschluss, aber auch im Bereich der Begabungsförderung<br />
und bei Verlängerungen von DaZ-Unterricht. Mit der <strong>Individuelle</strong>n <strong>Lernvereinbarung</strong> werden<br />
die Rahmenbedingungen der individuellen Förderung festgelegt, d.h:<br />
- wie die zusätzlichen Mittel zweckgebunden und zielgerichtet eingesetzt werden<br />
- welche Verbindlichkeiten zwischen den Beteiligten, insbesondere Eltern, Kind und<br />
Schule bestehen<br />
- wie die Kommunikation zwischen den Beteiligten erfolgt<br />
- wie bei Schulausschluss der Anschluss an die Stammklasse gewährleistet wird.<br />
Im Folgenden wird das Vorgehen bei Verstärkten Massnahmen für Behinderte erläutert, wobei<br />
die Hinweise nicht generalisiert werden können. Je nach Behinderung bzw. Beeinträchtigung<br />
sind unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen. Wir verweisen auf die entsprechenden<br />
Merkblätter, insbesondere auf das <strong>Merkblatt</strong> soziale Beeinträchtigung, zu finden unter<br />
www.ag.ch/ume .<br />
Das Vorgehen lässt sich sinngemäss auch im Bereich der Begabungsförderung und bei Verlängerung<br />
von DaZ-Unterricht anwenden.<br />
Ablauf<br />
Schritte Beteiligte Vorgehen, Hilfsmittel Zeitpunkt<br />
1. Grundlagen<br />
beschaffen<br />
Lernbehinderungen<br />
- LP / SHP<br />
- SPD<br />
i.d.R. im 3. Quartal<br />
befristeter Schulausschluss<br />
- SL, SPF<br />
<strong>Merkblatt</strong> Schulausschluss<br />
sofort bei Bedarf<br />
2. Lernziele bzw.<br />
<strong>Lernvereinbarung</strong>en<br />
formulieren<br />
3. Stellungnahme<br />
Inspektorat<br />
- Beteiligte LP bzw SHP<br />
- Einbezug der Eltern<br />
- SPD<br />
- Inspektorat<br />
- Formular ILV<br />
- Runder Tisch<br />
4. Antrag stellen - SL Anfang Juni bei Anträgen<br />
für das neue<br />
schuljahr<br />
Hinweise zum Formular <strong>Individuelle</strong> <strong>Lernvereinbarung</strong> (ILV)<br />
Das Formular wird am besten digital benutzt. Es steht auf der Website www.ag.ch/ume als<br />
Download bereit.<br />
August 2011 1/3
Ausgangslage<br />
Verstärke Massnahmen für Behinderte werden bewilligt, wenn sie den gesetzlichen Bestimmungen<br />
der Verordnung Sonderschulung (SAR 421.213), bzw. der Verordnung über die Förderung<br />
von Kindern und Jugendlichen mit besonderen schulischen Bedürfnissen (SAR<br />
421.331) entsprechen. Die im Formular aufgeführten Gründe sind deshalb abschliessend. Die<br />
Ausgangslage - der Ist-Zustand - ist oftmals bereits im Fachbericht des abklärenden kantonalen<br />
Dienstes festgelegt. Auf diesen kann verwiesen werden, allenfalls sind Ergänzungen aus<br />
dem Schulalltag anzuführen.<br />
Lern- und Entwicklungsziele<br />
Die individuelle Förderung erfolgt zielgerichtet. Das setzt eine Diagnose voraus, die Auskunft<br />
gibt über die Bereiche der Förderung, welche für die günstige Entwicklung des Kindes oder<br />
Jugendlichen notwendig sind. In der Zusammenarbeit von Lehrpersonen, Schulischen Heilpädagoginnen<br />
und Schulpsychologischem Dienst können die nächsten Entwicklungsschritte<br />
bestimmt und die entsprechenden konkreten Lernziele formuliert werden.<br />
Beispiele:<br />
- Kennt seine Rolle innerhalb der Klasse, akzeptiert sie und kann erste kleine Veränderungen vornehmen.<br />
- Kennt neue Arbeitsstrategien, Abläufe und Regeln und kann sie anwenden.<br />
- Kann mit Sinneswahrnehmungen adäquat umgehen und sie verknüpfen.<br />
Wenn die Förderziele bestimmt sind, stellt sich die Frage nach der Umsetzbarkeit. In der<br />
<strong>Individuelle</strong>n <strong>Lernvereinbarung</strong> werden die Fragen "wer macht was, wann, wie, mit wem?"<br />
beantwortet. Die ganzheitliche Förderung berücksichtigt neben schulischen Massnahmen<br />
auch die Fördermöglichkeiten des Umfeldes und die Eigenverantwortung.<br />
Schulische Massnahmen (LP, SHP)<br />
Hier werden die Methoden und Inhalte aufgeführt, die zur Zielerreichung vorgesehen sind. Es<br />
wird vereinbart, wer dafür mit welchem zeitlichen Aufwand verantwortlich ist. Involviert sind die<br />
Lehrpersonen (allenfalls Fach-LP, Daz-LP), Schulische Heilpädagogik, Lega oder Logo.<br />
Beispiele (abgestimmt auf obige Lernziele):<br />
Mit welchen Massnahmen sollen die Ziele erreicht werden? Wer ist verantwortlich dafür?<br />
- Gemeinsame Arbeit mit der ganzen Klasse im Bereich Andersartigkeit,<br />
Toleranz, Klassengemeinschaft.<br />
LP: wöchentlich im Klassenrat und<br />
im Fachbereich "Mensch und Mitmensch"<br />
- Erprobt neue Arbeitsabläufe, überprüft sie und übt sie ein. SHP: Einführung integrativ im Unterricht,<br />
Erprobung und Überprüfung<br />
auf Eignung<br />
LP: Einübung wenn geeignet<br />
- Wahrnehmungsübungen<br />
- Selbstbeobachtung im Umgang mit anderen, Beobachtungsaufträge<br />
im voraus gemeinsam vereinbaren und im<br />
Nachhinein auswerten.<br />
SHP: Einzelförderung<br />
SHP: wöchentlich kurze Feedbackgespräche<br />
August 2011 3/3
Vereinbarungen mit dem Kind bzw. Jugendlichen und den Eltern<br />
Förderung darf nicht als blosse "Hege und Pflege" verstanden werden. Die eigene aktive Mitarbeit<br />
des Kindes bzw. Jugendlichen ist ein entscheidender Bestandteil der Förderung, ebenso<br />
die Mitwirkung der Eltern. Verbindliche Vereinbarungen sind besonders im Bereich der<br />
erheblichen sozialen Beeinträchtigungen unerlässlich.<br />
Flankierende Massnahmen<br />
Je nach Förderung können zusätzliche Vereinbarungen nötig sein. Beispielsweise kann die<br />
Förderung von der gesundheitlichen Belastbarkeit abhängen oder es müssen nach einem<br />
befristeten Schulausschluss Massnahmen zur Reintegration in die Klasse getroffen werden.<br />
Allenfalls übersteigt der Förderbedarf die Möglichkeiten der Schule und des Elternhauses,<br />
sodass Therapien (Ergotherapie, Psychotherapie usw.) nötig werden. Die flankierenden<br />
Massnahmen ergänzen die schulische Förderung und sollen auf sie abgestimmt sein. Besondere<br />
Beachtung soll die Gesamtbelastung des Kindes bzw. Jugendlichen finden. Unter Umständen<br />
müssen an sich notwendige Lern- und Entwicklungsschritte zu Gunsten dringlicher<br />
Bedürfnisse zurückgestellt werden.<br />
Kommunikationswege<br />
Je mehr Parteien an der Förderung beteiligt sind, desto höher sind die Ansprüche an die<br />
Kommunikation. Informationswege werden deshalb im Voraus vereinbart, wobei die Mittel vom<br />
Kontaktheft bis hin zum Runden Tisch reichen können. Verbindlich ist die Terminierung der<br />
nächsten Standortbestimmung. Sie soll zeitlich so angesetzt werden, dass die Ergebnisse für<br />
ein allfälliges Verlängerungsgesuch zur Verfügung stehen.<br />
Unterschriften<br />
Die Vereinbarung soll Transparenz schaffen und verbindlich sein. Die Parteien können sich<br />
bei Unstimmigkeiten auf sie berufen. Für die Schule dient sie als Sicherheit, wenn Eltern ihre<br />
Haltung ändern oder ihre Verantwortung unzureichend wahrnehmen.<br />
August 2011 3/3