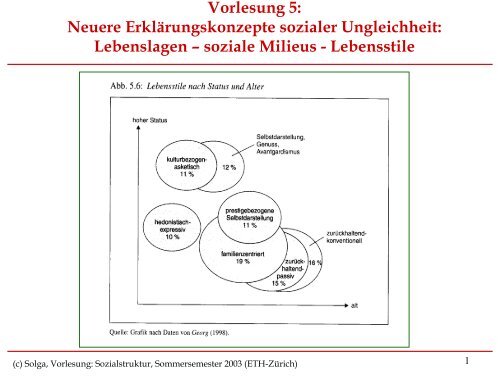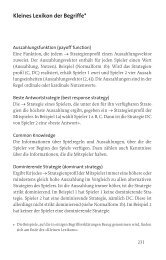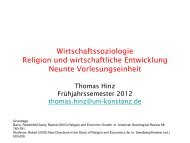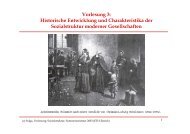Lebenslagen â soziale Milieus - ETH Zürich
Lebenslagen â soziale Milieus - ETH Zürich
Lebenslagen â soziale Milieus - ETH Zürich
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Vorlesung 5:<br />
Neuere Erklärungskonzepte <strong>soziale</strong>r Ungleichheit:<br />
<strong>Lebenslagen</strong> – <strong>soziale</strong> <strong>Milieus</strong> - Lebensstile<br />
(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />
1
Kritik an Klassen- und Schichtkonzepten<br />
1) zu starke ökonomische Ausrichtung<br />
2) subjektive Einschätzung der Individuen hat kaum eine Bedeutung<br />
3) können ihren umfassenden Anspruch – alle Gesellschaftsmitglieder & alle<br />
Lebensbedingungen – nicht einlösen<br />
4) zu statisch (starke Reproduktion): sie sehen keine Veränderung in der<br />
Ungleichheitsstruktur vor<br />
5) nur vertikale Definition von Ungleichheit<br />
6) zu einseitige Kausalität: äußeren Lebensbedingungen (z.B.<br />
Klassenposition) = Ursache für Handeln<br />
Klassen/Schichten seien heute keine erfahrbaren Einheiten mehr<br />
drei neue Konzepte seit den 1980er Jahren: Soziallagen, Lebensstile und <strong>Milieus</strong><br />
(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />
2
Soziallagen – <strong>Lebenslagen</strong><br />
(Stefan Hradil, 1983, sowie Wolfgang Zapf, 1989)<br />
= Konzepte, die „ganzheitliche“ Lebensbedingungen und –formen beschreiben<br />
bieten Möglichkeit der Verortung aller Gesellschaftsmitglieder (s. Einwand 3)<br />
= typische Konstellationen von Handlungsbedingungen (beinhalten materielle<br />
Ressourcen als Indikatoren der ‚objektiven Wohlfahrt’)<br />
Ziel: Verbindung von vertikalen und ‚horizontalen’ Ungleichheiten um<br />
Mehrdimensionalität moderner Ungleichheitsstrukturen erfassen zu können<br />
Zusammenwirken verschiedener Merkmale bei der „Zuweisung“ von<br />
Privilegien und Nachteilen (Berufspositionen, Alter, Geschlecht, Region)<br />
Merkmalskonstellationen definieren Handlungsbedingungen in diesen<br />
Zuweisungsprozessen<br />
werden dann kontrastiert mit: subjektiven Befindlichkeiten/Lebenszufriedenheit<br />
als Indikator der ‚subjektiven Wohlfahrt’<br />
(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />
3
Soziale Lagen nach Zapf (1989):<br />
= Kombination des vertikalen Schichtkriteriums der beruflichen Position und<br />
der ‚horizontalen’ (quer dazu liegenden) Kriterien: Geschlecht, Alter & Region<br />
Quelle: Datenreport<br />
2000, S. 571<br />
(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />
4
Probleme & Vorteile von Lagenkonzepten<br />
Probleme:<br />
wenn weitere Ungleichheitsdimensionen: Stadt/Land, Nationalität, Familienstand,<br />
dann noch mehr Soziallagen<br />
oft werden Cluster (Ähnlichkeitsmessungen) gebildet: um ca. 10 aggregierte <strong>soziale</strong><br />
Lagen zu erhalten dann aber Schwierigkeiten bei der Bezeichnung<br />
Definition der einzubeziehenden Kriterien = beliebig, keine Erklärung von Ursachen<br />
Was ist mit Statusinkonsistenzen?<br />
Lebenszyklus unberücksichtigt (Alter)<br />
Worauf bezieht sich die Lagenzuordnung: Haushalt oder Individuum<br />
Gleichfalls relativ statisch (Widerspruch zu Einwand 4 gegen Klassen/Schichten)<br />
Vorteile:<br />
Mehrdimensionalität<br />
Gute Deskriptionsmöglichkeiten: Lagentypologien = deskriptive Ordnungskonzepte:<br />
Definition gleicher – ungleicher <strong>Lebenslagen</strong><br />
Flexible: für verschiedene Problemstellungen anwendbar<br />
ermöglichen Untersuchung des Zusammenhangs von objektiver und subjektiver<br />
Wohlfahrt<br />
(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />
5
Lebensstile<br />
nicht ‚objektive“ Lebensbedingungen sondern Typologien kultureller Vielfalt<br />
(Wertorientierungen, Einstellungen, Verhaltensweisen, Interaktionen etc.)<br />
verschiedene Varianten, da keine eindeutiges Definitionskriterium<br />
Lebensstile<br />
= personen- und gruppenspezifisch verwendete Handlungsmuster zur Erreichung<br />
von Lebenszielen<br />
= ein relativ stabiles, regelmäßig wiederkehrendes Muster der alltäglichen<br />
Lebensführung<br />
= Ensemble von Wertorientierungen, Einstellungen, Deutungen,<br />
Geschmacksdifferenzen, Handlungen und Interaktionen<br />
= Mittel der (sub-)kulturellen Einbindung und eine Form der Selbstpräsentation<br />
des Individuums, die Zugehörigkeit zu einen bestimmten <strong>soziale</strong>n Milieu zu<br />
gehören<br />
Lebensstile sind damit identitätsstiftend und distinktiv (abgrenzend,<br />
ausgrenzend). Sie schaffen individuelle oder auch kollektive Identitäten, weil sich<br />
Menschen oder Gruppen mit einem bestimmten Muster der Lebensführung<br />
identifizieren<br />
(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />
6
Lebensstile nach Werner Georg (1998)<br />
(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />
7
Lebensstile nach Werner Georg (1998)<br />
Einbezogene Lebensbereiche: Freizeit, Musik- und Leseinteressen, Wohnstil, Kleidungsstil,<br />
Körperinszenierung (Selbstdarstellung, Schlankheit, Körperpflege), Vorlieben für Essen und<br />
trinken und Konsumgewohnheiten<br />
befragt: ca. 2000 Westdeutsche (ab 14 Jahre)<br />
Clusteranalyse gemacht Ergebnis: 7 Lebensstiltypen, die eine hohe Korrelation<br />
(Zusammenhang) mit Alter und <strong>soziale</strong>m Status (Schicht) aufweisen<br />
Lebensstiltypen:<br />
Typ 1: kulturbezogen-asketischer Lebensstil (11 % seiner Befragten)<br />
Interesse an gehobener Kultur, an Wissenschaft und Politik, Vorliebe für Aktivurlaub &<br />
bewegungsbezogenen Sport, starke Arbeitsorientierung mit Verzicht auf „Überflüssiges“<br />
(geringe Bedeutung für Kleidung), dezente Körperinszenierung<br />
relative jung (Durchschnitt 34 Jahre), gut qualifizierte Männer und Frauen<br />
Typ 2: Lebensstil „Selbstdarstellung, Genuß und Avantgardismus“ (12 % seiner Befragten)<br />
Hang zum Genuss, eine auf Vergnügen und Sozialkontakte bezogene Freizeitgestaltung,<br />
ausgeprägtes prestigeträchtiges Repräsentationsbedürfnis, Hang zur Selbstinszenierung und<br />
Selbstdarstellung (avantgardistischer Wohnstil und extravagante Freizeitkleidung)<br />
vorwiegend Frauen (75 %) mit gutem Einkommen und überdurchschnittlicher Bildung<br />
Typ 3: prestigebezogene Selbstdarstellung (11 % seiner Befragten)<br />
Prestigebezogene Außenwirkung (antikonventioneller Wohnstil und Outfit nach neuestem Trend),<br />
Stilunsicherheiten<br />
nur durchschnittliches Einkommen und Qualifikation, häufig beengtes wohnen<br />
(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />
8
Lebensstile nach Werner Georg (1998)<br />
Typ 4: hedonistisch-expressiver Lebensstil (10 % seiner Befragten)<br />
In der Freizeit dominieren expressive, auf Selbstdarstellung und Geselligkeit abzielende Aktivitäten,<br />
Vorliebe für Rock- und Popmusik, modern Jazz, Kino und Computer, Geld gilt als Voraussetzung<br />
für Lebensqualität, man trägt auffällige oder sportlich-legere Kleidung<br />
insbesondere junge Personen (Durchschnittsalter: 25), mittlere Bildung, häufig Ledige & Singles<br />
Typ 5: familienzentrierter Lebensstil (19 % seiner Befragten)<br />
Zurückhaltung bei Selbstdarstellung, Freizeitinteressen sind auf praktische und nützliche<br />
Tätigkeiten und kleinen Vergnügen in und mit Familie hin ausgerichtet, triviale Unterhaltung<br />
(Volksmusik, Schlager, Operette)<br />
v.a. Frauen (73 %), mittleren Alters und einfacher Bildung, meist verheiratet und Mütter<br />
Typ 6: zurückhaltend-passiver Lebensstil (15 % seiner Befragten)<br />
Zurückhaltung im zwischenmenschlichen Umgang, unauffällige Kleidung, traditionelles Essen,<br />
konventionelle Gemütlichkeit (plüschige Sitzgarnitur, Schrankwand etc.), Freizeitinteressen v.a.<br />
Autos, Sport, Basteln<br />
v.a. Männer (69 %) fortgeschrittenen Alters, verheiratet, manuelle Berufe &<br />
unterdurchschnittliches Einkommen<br />
Typ 7: zurückhaltend-konventioneller Lebensstil (16 % seiner Befragten)<br />
Zurückhaltung und Distanz, sparsamer Konsumstil, klassisch-konservative Kleidung, einfaches<br />
Essen, Freizeit mit häuslichen Tätigkeiten und außerhäuslicher Entspannung (Einkaufbummel,<br />
Spazieren u.ä.), häufiger Kirchenbesuch, Mitgliedschaften in Vereinen<br />
Weibliches Pendant zur Typ 6 und unter Älteren (durchschnittlich über 60), einfache Bildung<br />
(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />
9
Soziale <strong>Milieus</strong><br />
Milieu = Mitte, Umgebung (franz.)<br />
Auguste Comte (1798 – 1857):<br />
Milieu = Umwelt bzw. Lebensverhältnisse von Personen, Gruppen und<br />
Bevölkerungsteilen<br />
Soziale <strong>Milieus</strong><br />
= Gruppen gleichgesinnter PERSONEN, die ähnliche Lebensziele und ähnliche<br />
Lebensstile aufweisen sowie sich durch gruppenspezifische Existenzformen und<br />
erhöhte Binnenkommunikation voneinander abheben<br />
= Gruppen von Menschen, die sich in ihrer Lebensauffassung und Lebensweise (=<br />
Lebensstil) ähneln und damit subkulturelle Einheiten innerhalb der Gesellschaft<br />
bilden<br />
nicht mehr POSITIONEN<br />
in den 1980er Jahren erneut bekannt geworden: u.a. mit den Sinus-<strong>Milieus</strong><br />
(SINUS-Institut = Marktforschungsunternehmen) Einzelheiten der Messung<br />
werden aus kommerziellen Gründen geheimgehalten<br />
(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />
10
Soziale <strong>Milieus</strong>:<br />
„Sinus-<strong>Milieus</strong>“<br />
Westdeutschland 2000<br />
= 10 Milieutypen für Westdeutschland<br />
waagerechte Achse = Grundorientierungen<br />
(Werteforschung)<br />
senkrechte Achse = Schichtstruktur (<strong>soziale</strong><br />
Lagen)<br />
Zwei „Auffälligkeiten“<br />
(1) im oberen Bereich gibt es andere<br />
<strong>Milieus</strong> als im unteren Bereich<br />
(2) auf den gleichen Ebenen des<br />
Schichtgefüges (horizontal) z.T.<br />
unterschiedliche <strong>Milieus</strong> aber:<br />
Pluralisierung in der Mitte deutlich<br />
stärker als oben und unten<br />
(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />
11
Soziale <strong>Milieus</strong><br />
Probleme<br />
es bleibt offen: Wie kommt es zu den feststellbaren Ähnlichkeiten und<br />
Gemeinsamkeiten bzw. zu den entsprechenden Differenzierungen in den<br />
kennzeichnenden Lebenszielen und –stilen?<br />
unklar ist: Sind <strong>Lebenslagen</strong>/Lebensstile/<strong>Milieus</strong> Ursache <strong>soziale</strong>r<br />
Ungleichheit oder Dimension/Auswirkung <strong>soziale</strong>r Ungleichheit?<br />
Messung meist beim „Individuum“ – man achtet nicht auf „Konsistenz“ in der<br />
Familie oder Umgebung (obgleich dies wesentliches Definitionsmerkmal ist)<br />
Messung beim Individuum unabhängig vom „regionalen Kontext“ – obgleich<br />
„Umwelt“ ein zentraler Bestandteil der Begriffsbestimmung<br />
(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />
12
Ende der Klassen & Schichten – Leben in der pluralisierten<br />
Wohlstandsgesellschaft?<br />
Differenzierung, Pluralisierung und Individualisierung der Soziallagen, Lebensstile und<br />
<strong>Milieus</strong> werden als Symptome der Entstrukturierung entlang von Klasse und Schicht gewertet<br />
Argumente die dafür gemacht werden:<br />
o Vereinheitlichung der Lebensbedingungen (steigender Wohlstand und Massenkonsum,<br />
Arbeitslosigkeit kennt keine Klassengrenzen)<br />
o Differenzierung der Soziallagen durch horizontale (quer zu traditionellen Dimensionen)<br />
liegenden Ungleichheiten (Region, Geschlecht) sind das jedoch „neue“ Erscheinungen der<br />
Sozialstruktur oder nur neuerdings durch Wissenschaft beobachtet? (Vorkommen oder Aufmerksamkeit?)<br />
o Auflösung schichttypischer Subkulturen: steigender Wohlstand lockert die materiellen<br />
Bedingungen, der moderne Sozialstaat lockert traditionelle Solidaritäten, allgemein höheres<br />
Bildungsniveau – Zunahme <strong>soziale</strong>r Mobilität (ist das wirklich die Realität?)<br />
o Pluralisierung und Individualisierung von <strong>Milieus</strong> und Lebensstilen (verbunden mit<br />
Entkopplung von objektiven Lebensbedingungen) hiergegen widersprechen die eigenen Befunde<br />
der Lebensstil- und Milieuforschung (siehe Georg)<br />
o Entschichtung der Lebenswelt: Klassen und Schichten verschwinden aus der Lebenswelt der<br />
Menschen, werden immer weniger wahrgenommen widerspricht den Befunden der subjektiven<br />
Schichteinstufung<br />
o Pluralisierung von Konfliktlinien: <strong>soziale</strong> Konflikte sind immer weniger Klassen- und<br />
Schichtkonflikte, sondern themen- und situationsspezifische Interessenkoalitionen (z.B. neue<br />
<strong>soziale</strong> Bewegungen)<br />
(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />
13
Ausblick<br />
Meine Antwort zur „Debatte“:<br />
Berechtigte Punkte: zunehmende Differenzierung durch Zunahme an Wohlstand,<br />
Bildung und Freizeit<br />
Empirisches Argument:<br />
Aber auch in unserer differenzierter gewordenen Welt hängen wichtige<br />
Lebenschancen und Risiken in erheblichem Maße mit traditionellen vertikalen<br />
Ungleichheitskriterien zusammen zudem sind diese vertikalen<br />
Ungleichheitsstrukturen im Bewusstsein der Bevölkerung präsent<br />
Theoretisches Argument:<br />
<br />
<br />
Debatte im deutschsprachigen Raum: Klasse und Schicht sind anderswo<br />
selbstverständliche analytische Konzepte der Sozialstrukturanalyse<br />
sie stellen „objektive Positionen“ in der Sozialstruktur dar, die man definieren<br />
kann – und die es unabhängig vom Bewusstsein der Individuen gibt<br />
Die Frage ist: wie bestimmen Klassen-/Schichtzugehörigkeit unser heutiges Leben<br />
= empirisch zu beantwortende Frage und nicht argumentativ!!!<br />
Damit fangen wir nächste Woche an: Bildungs- und Ausbildungsungleichheiten<br />
(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />
14