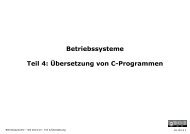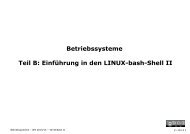Notebook-Universität - Wirtschaftsinformatik HTW Berlin
Notebook-Universität - Wirtschaftsinformatik HTW Berlin
Notebook-Universität - Wirtschaftsinformatik HTW Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Diplomarbeit<br />
zur Erlangung des akademischen Grades eines<br />
Diplom-<strong>Wirtschaftsinformatik</strong>ers (FH)<br />
über das Thema<br />
<strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> —<br />
Kooperationsmodelle zwischen Hochschule und Industrie<br />
Eingereicht am Fachbereich 4, Studiengang <strong>Wirtschaftsinformatik</strong>,<br />
an der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft <strong>Berlin</strong><br />
von<br />
Michael Jeschke<br />
Matrikel-Nr.: 7690 0336000<br />
Erstgutachter: Prof. Dr. Horst Theel<br />
Zweitgutachter: Prof. Dr. Burkhard Messer<br />
Betrieblicher Betreuer: Dipl.-Ing. Stephan Sandig, IBM Deutschland GmbH<br />
<strong>Berlin</strong>, den 19.8.2003
Inhaltsverzeichnis<br />
Abbildungsverzeichnis iii<br />
Tabellenverzeichnis iv<br />
1 Einleitung 1<br />
2 Auswirkungen des Technologiewandels auf die Hochschulen 4<br />
2.1 Medienkompetenz und lebenslanges Lernen . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />
2.2 Virtuelle <strong>Universität</strong>en und <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en . . . . . . . . . . . 8<br />
2.3 Unterrichtsergänzung und Mehrwert durch <strong>Notebook</strong>s . . . . . . . . . . 10<br />
3 <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> — Das Umfeld der deutschen Hochschulen 13<br />
3.1 Ziele der Hochschulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />
3.2 Wireless LAN und mobile Endgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />
3.2.1 Anforderungen der Hochschulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />
3.2.2 Anforderungen der Studierenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />
3.3 Umsetzung von <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en . . . . . . . . . . . . . . . . . 23<br />
3.3.1 Aufgabenbereiche innerhalb der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> . . . . . . 24<br />
3.3.2 Modell einer Organisationsform . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />
4 <strong>Notebook</strong>s-<strong>Universität</strong> — Ziele und Erwartungen der Wirtschaft 29<br />
4.1 Ziele der Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br />
4.2 Angebote und Leistungen der Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . 37<br />
i
INHALTSVERZEICHNIS ii<br />
5 Integrationsszenarien: Die Industrie als Partner 40<br />
5.1 Fachliche Kooperationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41<br />
5.1.1 Spezifikation und Entwicklung von E-Learning-Plattformen . . . 42<br />
5.1.2 Entwicklung fachspezifischer Software . . . . . . . . . . . . . . . 45<br />
5.1.3 Erstellung von E-Learning-Content . . . . . . . . . . . . . . . . 48<br />
5.2 Technische und organisatorische Kooperationen . . . . . . . . . . . . . 51<br />
5.2.1 <strong>Notebook</strong>-Versorgungskonzepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51<br />
5.2.2 Supportkonzept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56<br />
5.2.3 Kooperative Projektdurchführung . . . . . . . . . . . . . . . . . 57<br />
5.2.4 Kooperative Organisationsform . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60<br />
6 Fazit 62<br />
Literaturverzeichnis 65<br />
A Inhalt der CD-ROM 69<br />
Erklärung 70
Abbildungsverzeichnis<br />
3.1 Aufgabengebiete innerhalb der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> . . . . . . . . . . 25<br />
3.2 Organisationsstruktur für das Projekt „<strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>” . . . . . 28<br />
4.1 Gesamtumsatz am E-Learning-Markt in Europa . . . . . . . . . . . . . 30<br />
4.2 Pro-Kopf-Ausgaben für E-Learning in Europa . . . . . . . . . . . . . . 30<br />
4.3 Die Märkte im Umfeld der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en . . . . . . . . . . . 32<br />
5.1 Beispiel für nichtlineare Lernprozesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43<br />
5.2 Kooperative Entwicklung einer E-Learning-Plattform . . . . . . . . . . 45<br />
5.3 Schnittstelle zwischen E-Learning-Plattform und Software-Tool . . . . . 47<br />
5.4 Innerfachliche Anordnung von Wissenselementen . . . . . . . . . . . . . 49<br />
5.5 Thematische Anordnung von Wissenselementen . . . . . . . . . . . . . 50<br />
5.6 <strong>Notebook</strong>-Vertriebskonzepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52<br />
5.7 Projektphasen mit externen Beratungsfeldern . . . . . . . . . . . . . . 59<br />
5.8 Modifizierte Organisationsstruktur für Kooperationsmodelle . . . . . . 61<br />
iii
Tabellenverzeichnis<br />
2.1 Fähigkeiten der Medienkompetenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />
3.1 Hard- und softwareseitige Anforderungen an <strong>Notebook</strong>s . . . . . . . . . 19<br />
3.2 Aufgaben innerhalb der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> . . . . . . . . . . . . . . 26<br />
4.1 Betriebswirtschaftliche Zielsetzungen: monetäre Ziele . . . . . . . . . . 33<br />
4.2 Betriebswirtschaftliche Zielsetzungen: nicht-monetäre Ziele . . . . . . . 36<br />
5.1 Beispiel einer Aufgabenstellung mit nicht-linearen Lösungswegen . . . 42<br />
5.2 Beispielhafte Umsetzung hochschulseitiger Anforderungen an <strong>Notebook</strong>s 54<br />
iv
Kapitel 1<br />
Einleitung<br />
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hat der gesellschaftliche Wandel der klassischen In-<br />
dustriegesellschaft bereits stattgefunden: Prägte in den letzten Jahrzehnten des 20.<br />
Jahrhunderts v.a. die Produktion von Gütern die Gesellschaft, so zeichnet sich die ge-<br />
genwärtige Informationsgesellschaft durch die zentrale Bedeutung der Gewinnung,<br />
Speicherung, Verarbeitung, Vermittlung, Verbreitung und Nutzung von Information<br />
und Wissen aus. 1 Dieser Definition folgt auch der US-amerikanische Soziologe Daniel<br />
Bell, 2 während andere Wissenschaftler von einer Wissensgesellschaft, wieder andere von<br />
einer Kommunikationsgesellschaft sprechen. 3 Eine klare Abgrenzung zwischen den drei<br />
Begrifflichkeiten wird von den Sozialwissenschaftlern derzeit heftig diskutiert. 4 Über-<br />
einstimmend wird jedoch in sämtlichen Definitionen den Elementen Information und<br />
Bildung eine zentrale Bedeutung beigemessen. 5<br />
Die Grundlage für den gesellschaftlichen Wandel bilden die innovativen Entwicklun-<br />
gen in den Informations- und Kommunikationstechnologien, durch welche andere große<br />
Umbrüche im sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Bereich, wie etwa das Ver-<br />
schmelzen der Finanzmärkte oder die Globalisierung der Gesellschaft insgesamt, erst<br />
möglich wurden. Eine zentrale Voraussetzung hierfür – und gleichzeitig aber auch Fol-<br />
ge des technischen Fortschritts – stellt das Internet als globales Kommunikations- und<br />
1 vgl. Brockhaus 2002<br />
2 vgl. Bell 1985, S. 353<br />
3 vgl. Steinbicker 2001, S. 21<br />
4 vgl. Steinbicker 2001, S. 8<br />
5 Der Einfachheit halber wird im Rahmen dieser Arbeit keine Unterscheidung vorgenommen und<br />
vorrangig vom Informationszeitalter bzw. der Informationsgesellschaft gesprochen.<br />
1
Informationsnetz dar: Information wird zum ubiquitären Gut der modernen Gesell-<br />
schaft. 6<br />
Eine zentrale Folge, welche sich aus dieser Entwicklung ableitet, ist eine ständig zu-<br />
nehmende Menge an Daten, Informationen und Wissen. Die breite Verteilung dieser<br />
Ressourcen auf viele Köpfe macht ein neuartiges Wissensmanagement erforderlich: 7<br />
Wissensmanagement bezeichnet hier die Fähigkeit und Fertigkeit des Einzelnen, sich<br />
das über Internet oder andere informationstechnische Medien verfügbares Wissen zu-<br />
gänglich und schließlich auch nutzbar zu machen. Diese Fähigkeiten werden häufig auch<br />
unter dem Begriff Medienkompetenz zusammengefasst.<br />
Medienkompetenz zählt daher zu den Schlüsselqualifikationen bzw. Kernkompetenzen,<br />
auf die Wirtschaftsunternehmen bei der Rekrutierung ihres Personals in verstärktem<br />
Maße Wert legen. 8 Um sich die Grundlagen für das Erfüllen dieser Erwartungen an-<br />
zueignen, steht dem Einzelnen v.a. der Zeitraum der (Aus-)Bildung zur Verfügung.<br />
Letztlich wird somit dem Bildungssektor die Verantwortung für die Vermittlung der<br />
Medienkompetenz übertragen. Von dieser Umorientierung sind alle Bereiche des Bil-<br />
dungssektors betroffen; neben Schul- und Hochschulausbildung werden auch die Berei-<br />
che Berufs- und Weiterbildung aufgefordert, sich den gesellschaftlichen Veränderungen<br />
anzupassen. Die Notwendigkeit des Erwerbs von Medienkompetenz ist also unabhängig<br />
von Bildungsweg und Berufsziel. 9<br />
Eine direkte Folge aus der geforderten Modernisierung der Lehre stellt die Inte-<br />
gration mobiler und flexibler Lehr- und Lernszenarien in die Präsenzlehre dar. Dabei<br />
bezeichnen „mobil” und „flexibel” einerseits die Förderung der Orts- und Zeitunab-<br />
hängigkeit für den Lernenden, der durch konsequente Förderung des Einsatzes eigener<br />
mobiler Computersysteme in Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk entsprochen<br />
werden kann. Andererseits erhöht die Integration multimedialer Lernmodule und das<br />
Angebot personalisierbarer Lernumgebungen die Flexibilität auch im inhaltlichen Lern-<br />
prozess.<br />
Für die Realisierung der anstehenden Aufgaben steht den Hochschulen beispielsweise<br />
das Konzept der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> zur Verfügung. Bei der Umsetzung dieses<br />
Konzeptes ist eine Zusammenarbeit mit erfahrenen IT-Wirtschaftsunternehmen nicht<br />
6 vgl. Holznagel 2001, S. 10<br />
7 vgl. Tavangarian et al. 2001(a), S. 15<br />
8 vgl. Tavangarian et al. 2001(a), S. 15 und S. 39<br />
9 vgl. Tavangarian et al. 2001(a), S. 15<br />
2
nur von Vorteil, sie ist aus verschiedenen Gründen nahezu unerlässlich. Die Gründe<br />
sowie das Erarbeiten und Aufzeigen konkreter Ansatzpunkte für solche Kooperationen<br />
unter besonderer Beachtung der beiderseitigen Auswirkungen stehen im Mittelpunkt<br />
dieser Arbeit.<br />
Dazu werden in Kapitel 2 zunächst die gesellschaftlichen Veränderungen und ihre<br />
Folgen für den Bildungssektor im Detail aufgezeigt und das Konzept der <strong>Notebook</strong>-<br />
<strong>Universität</strong>en im Ganzen vorgestellt.<br />
In Kapitel 3 werden das Umfeld der deutschen Hochschulen sowie dessen Anforderun-<br />
gen und Ziele an eine <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> untersucht, wobei hier die Interessen der<br />
Studierenden gesonderte Beachtung finden.<br />
Kapitel 4 beleuchtet anschließend im Gegenzug das Interesse der Wirtschaft an solchen<br />
Umsetzungen. Im Mittelpunkt steht hierbei die Aufdeckung möglicher Erwartungen<br />
und Zielgrößen beteiligter Unternehmen.<br />
Sich aus diesen Betrachtungen ergebende Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Hoch-<br />
schulen und Unternehmen verschiedener Wirtschaftszweige werden dann in Kapitel 5<br />
vorgestellt. Ziel ist dabei die Ausnutzung vorhandener Potentiale zum gemeinsamen<br />
bzw. beiderseitigen Vorteil, also die Nutzung von Synergieeffekten. In diesem Zusam-<br />
menhang werden auch die mittel- und langfristigen Entwicklungen des Bildungsmarktes<br />
berücksichtigt, um auch zukünftige Kooperationsmodelle zu beachten.<br />
Die Arbeit mündet schließlich in einer zusammenfassenden Betrachtung der Thematik<br />
sowie einem Ausblick für die Zukunft.<br />
3
Kapitel 2<br />
Auswirkungen des Technologiewandels<br />
auf die Hochschulen<br />
Die Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts stellt infolge der gesellschaftlichen<br />
Umbrüche, die die schnell fortschreitende Entwicklung im Bereich der Informations-<br />
und Kommunikationstechnologien mit sich gebracht hat, andere, z.T. neuartige An-<br />
forderungen an das Können und die Fähigkeiten von sich selbst und folglich jedem<br />
Einzelnen. Zu diesen neuen „Skills” gehören u.a. die Medienkompetenz und die Be-<br />
reitschaft des lebenslangen Lernens, worauf in Abschnitt 2.1 näher eingegangen<br />
wird.<br />
Aufgabe des Bildungssystems ist es, durch eine Modernisierung der Lehre dafür<br />
Sorge zu tragen, dass die Voraussetzungen für den Erwerb dieser Fähigkeiten geschaf-<br />
fen werden. Das Konzept der sog. <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en bietet einen Ansatz für<br />
die Integration und die praktische Umsetzung moderner Lehr- und Lernkonzepte in der<br />
Präsenzlehre der Hochschulen. Die <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> wird im Abschnitt 2.2 vor-<br />
gestellt und begrifflich von der sog. virtuellen <strong>Universität</strong> abgegrenzt. In Abschnitt<br />
2.3 wird schließlich der Gedanke des Mehrwertes für die Lehre durch die Integration<br />
mobiler Endgeräte untersucht.<br />
Im Rahmen dieser Arbeit werden <strong>Universität</strong>en, technische Hochschulen und Fach-<br />
hochschulen gleichermaßen betrachtet und unter der Bezeichnung „Hochschulen” zu-<br />
sammengefasst. Insbesondere ist das Konzept der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> nicht auf die<br />
Bildungseinrichtung „<strong>Universität</strong>” beschränkt, sondern vielmehr eine geläufige Organi-<br />
sationsbezeichnung für spezielle Einrichtungen und Dienste an allen Formen von Hoch-<br />
schulen.<br />
4
2.1 Medienkompetenz und lebenslanges Lernen 5<br />
2.1 Medienkompetenz und lebenslanges Lernen<br />
Der Arbeitsmarkt von heute zeigt die Veränderungen der letzten Jahre deutlich: Galt<br />
von 10 Jahren die Kenntnis des Umgangs mit Textverarbeitungssoftware oder aber die<br />
aktive Nutzung des World Wide Web (WWW) 1 noch als besondere Fähigkeit im Sinne<br />
einer Höherqualifizierung des Einzelnen, wird heute der alltägliche und selbstverständ-<br />
liche Umgang mit gängigen Betriebssystemen oder Anwendungsprogrammpaketen in<br />
den verschiedensten Versionen in nahezu allen Arbeitsbereichen vorausgesetzt.<br />
Staatlich finanzierte Schulungsmaßnahmen sollen diese „Kompetenzlücken” bei Arbeits-<br />
losen schließen. 2 Diese Schulungsmaßnahmen können jedoch nur von temporärer Natur<br />
sein, da sie lediglich eine verspätete Reaktion auf die veränderte Anforderungssituati-<br />
on darstellen und somit langfristig keine befriedigende Lösung bieten; vielmehr wird<br />
dem Bildungssektor die Aufgabe übertragen, durch eine Modernisierung der Lehre den<br />
gewachsenen Ansprüchen der Gesellschaft und insbesondere der Wirtschaft gerecht zu<br />
werden und so eine zukunftsorientierte Bildung bzw. Ausbildung sicherzustellen.<br />
Innerhalb des Bildungssektors fällt daher besonders den Schulen und Hochschulen die<br />
Aufgabe einer permanenten und flexiblen Anpassung der Lehre an die gesellschaftlichen<br />
Erfordernisse zu. 3 Es genügt immer weniger, Lernenden einen gewissen „Wissensvor-<br />
rat” zu vermitteln – vielmehr müssen dem Lernenden Werkzeuge an die Hand gegeben<br />
und bei ihm spezielle Kompetenzen aufgebaut werden, die ihm auch zukünftig den Er-<br />
werb von neu benötigtem Wissen vereinfachten, also den Prozess des lebenslangen<br />
Lernens unterstützen.<br />
Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften definiert das lebenslange Lernen<br />
wie folgt:<br />
„ ... alles Lernen während des gesamten Lebens, das der Verbesserung von<br />
Wissen, Qualifikationen und Kompetenzen dient und im Rahmen einer persönlichen,<br />
bürgergesellschaftlichen, sozialen, bzw. beschäftigungsbezogenen<br />
Perspektive erfolgt.” 4<br />
1 Die Bezeichnung „Internet” wird etwa seit 1986 verwendet. Mit der Umstellung auf das HTTP-<br />
Protokoll 1992 hat sich unter dem Begriff „World Wide Web” eine zentrale Anwendung des Internet<br />
etabliert.<br />
2 vgl. Thomas 2001, S. 6<br />
3 vgl. Haefner 1999, S. 3<br />
4 Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2001, S. 9
2.1 Medienkompetenz und lebenslanges Lernen 6<br />
Die Fähigkeit, „sich selbst Fertigkeiten und Wissensbestände zu erschließen” 5 , wird als<br />
Medienkompetenz bezeichnet. Per Definition wird sie zu einem wichtigen Element<br />
der neuen Lehr- und Lernkultur und zum fundamentalen Werkzeug des lebenslangen<br />
Lernens. 6<br />
Medienkompetenz bezeichnet hierbei nicht nur die technische Handhabung moderner<br />
Systeme: Vielmehr besteht sie nach Hesse/Mandel aus den drei Teilbereichen der allge-<br />
meinen Kompetenzen, der Technikkompetenzen sowie der sozialen Kompetenzen, die<br />
in Tabelle 2.1 anhand einzelner Fähigkeiten genauer beschrieben sind. 7<br />
Allgemeine Kompetenzen • Eigenverantwortliches Handeln<br />
• Selbstgesteuertes und selbstkontrolliertes Vorgehen<br />
• Interaktives und kooperatives Arbeiten<br />
• Selbstkonstruierendes Lernen anhand relevanter Frageund<br />
Problemstellungen<br />
Technikkompetenzen • Umgang mit den neuen Medien<br />
• Orientierungs- und Navigationsvermögen<br />
• Entwicklung von Qualitätskriterien für die Auswahl medialer<br />
Angebote<br />
• Effiziente Suche von Informationen<br />
• Entwicklung einer Motivation zum (medien- und<br />
problembasierten) Lernen<br />
Soziale Kompetenzen • Effiziente netzbasierte Kommunikation<br />
• Kooperation und Kollaboration in virtuellen Lerngruppen<br />
Tabelle 2.1: Fähigkeiten der Medienkompetenz. Quelle: Hesse/Mandl 2000, S. 48f<br />
Eine zentrale Rolle spielt dabei die Verfügbarkeit moderner Computersysteme sowie<br />
aktueller Softwareprodukte. Die aktive Nutzung moderner und zukunftsorientierter<br />
Technologien z.B. durch direkten Einsatz in der Lehre fördert diesen Prozess nachhal-<br />
tig. 8<br />
5 Hugger 1999, S. 50<br />
6 vgl. Bundesarbeitskreis „Lernen mit <strong>Notebook</strong>s” 2002, S. 8<br />
7 vgl. Hesse/Mandl 2000, S. 48f<br />
8 vgl. Hesse/Mandl 2000, S. 35
2.1 Medienkompetenz und lebenslanges Lernen 7<br />
In Deutschland gibt es daher mittlerweile zahlreiche Projekte an Schulen und Hoch-<br />
schulen, in deren Mittelpunkt die (relativ) neue und oft als E-Learning (Electronic<br />
Learning) bezeichnete Form des computergestützten Lernens steht. Hierbei stand noch<br />
vor wenigen Jahren der Computer als Instrument zur Nutzung von lokaler Lernsoft-<br />
ware im Vordergrund. Heute dagegen muss das Internet mit den dort vorhandenen<br />
Wissensressourcen als Lernplattform und der Computer als Werkzeug für Lehrende<br />
und Lernende im E-Learning-Prozess angesehen werden.<br />
E-Learning kann nur relativ allgemein als „ein durch die Informations- und Kommunika-<br />
tionstechnologien (IKT) gestütztes Lernen” 9 definiert werden, da Ansätze, Methoden<br />
und Mittel der Umsetzung einem ständigen Wandel unterzogen sind.<br />
Während der Begriff E-Learning die Sicht des Lernenden vertritt, spiegelt die Bezeich-<br />
nung E-Teaching die Thematik aus dem Blickwinkel der Lehrenden wider.<br />
Für das E-Learning steht ein Teil der benötigten technischen Infrastruktur längst be-<br />
reit, und in vielen Bildungsbereichen ist die Lehre ohne den Einsatz von Computern<br />
heute kaum mehr denkbar. Zumeist handelt es sich hier jedoch um die Nutzung statio-<br />
närer Ressourcen in Computerpools oder Übungsräumen der Hochschulen; nur teilweise<br />
ist eine Integration eigener häuslicher Computersysteme in existierende Lernumgebun-<br />
gen der Hochschule gegeben. 10 Eine Integration mobiler Computersysteme innerhalb<br />
der Hochschulumgebung war bisher selten vorhanden; in den letzten zwei Jahren jedoch<br />
ist hier ein deutlicher Trend hin zur Nutzung von <strong>Notebook</strong>s in Verbindung mit dem<br />
Wireless Local Area Network (WLAN) zu beobachten. Dies resultiert u.a. auch aus der<br />
Umsetzung drittmittelfinanzierter Projekte zum Aufbau drahtloser Netzwerke. 11<br />
Die zunehmende Leistungsfähigkeit von Computersystemen und die immer weiter an-<br />
steigende Anzahl von Netzwerken bzw. über das Internet vernetzter Rechner ermög-<br />
lichen neue und innovative Formen von Lehre und ihrer Organisation: Rein technisch<br />
ist heute der Besuch von Vorlesungen möglich, ohne tatsächlich vor Ort im Unter-<br />
richtsraum anwesend zu sein (Online-Vorlesung), und fachliche Diskussion mit welt-<br />
weit verteilten Experten können mit Hilfe geeigneter Kommunikationsplattformen (z.B.<br />
Online-Chat, Internet-Forum) ortsunabhängig und zeitnah durchgeführt werden.<br />
9 Cedefop 2002, S. 3<br />
10 So ist beispielsweise die Nutzung des an der F<strong>HTW</strong> <strong>Berlin</strong> vorhandenen SAP R/3-Systems mittels<br />
Webbrowser auch vom heimischen PC möglich.<br />
11 Beispiel hierfür ist die Förderung von Demonstrationsprojekten für die Funkvernetzung (WLAN)<br />
von Hochschulen durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Jahr 2000.
2.2 Virtuelle <strong>Universität</strong>en und <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en 8<br />
2.2 Virtuelle <strong>Universität</strong>en<br />
und <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en<br />
Durch den allgemeinen Trend zu netzgestützten Lernumgebungen, der Forderung nach<br />
flexiblen und mobilen Lehr- und Lernszenarien und dem gesellschaftlichen Wandel mit<br />
seinen Auswirkungen auf das Bildungssystem ergeben sich neue Forderungen an die<br />
Hochschulen und ihre Strukturen: Sie müssen diese Veränderungen als Chance für die<br />
Bildung begreifen 12 und die Lehr- und Lernmethoden zukunftsorientiert überarbeiten.<br />
Zur Umsetzung wurden die Konzepte der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> und der virtuellen<br />
<strong>Universität</strong> entwickelt. Dabei gilt es hier zunächst die sog. „virtuelle <strong>Universität</strong>” von<br />
der „<strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>” begrifflich abzugrenzen.<br />
Die virtuelle <strong>Universität</strong><br />
Die der virtuellen <strong>Universität</strong> (auch: virtuelle Hochschule) zugrundeliegende Philoso-<br />
phie ist die eines auf die Informations- und Kommunikationstechnologien aufbauendes<br />
„elektronisches Abbild einer konventionellen Hochschule”. 13 Ortsunabhängigkeit und<br />
zeitlich flexibles Studium stehen dabei im Vordergrund. In virtuellen (Klassen-) Räu-<br />
men und (Arbeits-) Gruppen werden herkömmliche Lehrformen zum großen Teil durch<br />
multimediale und netzgestützte Lehreinheiten ersetzt.<br />
Virtuelle <strong>Universität</strong>en haben im Gegensatz zu konventionellen <strong>Universität</strong>en i.d.R. kei-<br />
nen stark ausgeprägten Forschungscharakter, sondern konzentrieren sich auf die reine<br />
Ausbildung der Studierenden. Beispiele für virtuelle <strong>Universität</strong>en bzw. Hochschulen<br />
sind u.a. die Virtuelle <strong>Universität</strong> <strong>Berlin</strong> (URL http://www.vu-bb.de), die Virtuelle<br />
Hochschule Bayern (URL http://www.vhb.org) und die Virtuelle Hochschule Ober-<br />
rhein (URL http://www.viror.de).<br />
Die <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong><br />
Bei einer <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> handelt es sich um eine herkömmliche Hochschule, de-<br />
ren Präsenzlehre um flexible und mobile Lehr- und Lernszenarien erweitert wird. Die<br />
12 vgl. Thomas 2001, S. 4<br />
13 Tavangarian et al. 2001(a), S. 18
2.2 Virtuelle <strong>Universität</strong>en und <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en 9<br />
Bezeichnung „<strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>” (oder auch <strong>Notebook</strong>-Hochschule, engl.: <strong>Notebook</strong>-<br />
University) referiert deutlich den verstärkten Einsatz von mobilen Computersystemen,<br />
insgesamt wird generell eine starke Integration moderner Computertechnologien in den<br />
Lehrbetrieb von Hochschulen angestrebt. 14<br />
Die Hauptzielsetzungen sind dabei zum einen die Erweiterung der herkömmlichen Lehr-<br />
und Lernmethoden durch den Einsatz neuer Technologien (Multimedia, drahtlose Netz-<br />
werke, elektronische Kreide 15 etc.) mit dem Ziel der Verbesserung des Lehrerfolges und<br />
zum anderen die Förderung der Medienkompetenz der Studierenden allgemein.<br />
Eine weiteres wichtiges Ziel für die Hochschulen ist die Entwicklung neuer Lernsysteme,<br />
die mittel- und langfristig eine deutlich höhere Flexibilität in der Lehre gewährleisten<br />
und somit den Aus- und Umbau der Bildungsangbote unterstützen.<br />
Auch bei den <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en kann in einem begrenzten Rahmen eine Orts-<br />
und Zeitunabhängigkeit für Studierende erreicht und eine praxisnahe Ausbildung um-<br />
gesetzt werden.<br />
Der Anteil und die Art und Weise der Integration mobiler Endgeräte in die Lehre<br />
der Hochschulen ist sehr unterschiedlich ausgeprägt, was v.a. durch die uneinheitlichen<br />
und individuellen Eingangsvoraussetzungen der einzelnen Hochschulen zu begründen<br />
ist. Auch das Fehlen einer eindeutigen Definition des Begriffes „<strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>”<br />
sowie eines Anforderungskataloges 16 bedingt die Heterogenität der bisherigen Umset-<br />
zungen.<br />
In der aktuellen Literatur werden jedoch bis zu vier wichtige Charakteristika aufge-<br />
führt, welche <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en von anderen Umsetzungen mobiler Lehrkonzepte<br />
abgrenzen: 17<br />
• Integration mobiler Hardware in Präsenzhochschulen<br />
• Einsatz von elektronischen Lehrmaterialien<br />
• Nutzung moderner Netzstrukturen (LAN, WLAN, WWW)<br />
• Kommunikationsmöglichkeiten auf Basis moderner Technologien<br />
14 vgl. Tavangarian et al. 2001(a), S. 16<br />
15 Es gibt mehrere Umsetzungsversuche für einen digitalen höherwertigen Ersatz der klassischen Kreidetafel.<br />
An der Technischen <strong>Universität</strong> <strong>Berlin</strong> wird seit dem Wintersemester 2002/2003 im Fachbereich<br />
Mathematik die an der Freien <strong>Universität</strong> <strong>Berlin</strong> unter Leitung von Prof. Dr. Rojas entwickelte<br />
„E-Kreide” in der Mathematikausbildung der Ingenieure erfolgreich eingesetzt. E-Kreide<br />
im Internet: http://www.e-kreide.de<br />
16 vgl. Timm/Haefner 2002, S. 12<br />
17 vgl. Tavangarian et al. 2001(a), S. 16f
2.3 Unterrichtsergänzung und Mehrwert durch <strong>Notebook</strong>s 10<br />
Von der zeitlich begrenzten Bereitstellung mobiler Hardware für Vorlesungen und<br />
Übungen durch sog. <strong>Notebook</strong>-Wagen bis hin zur Bereitstellung frei nutzbarer Netz-<br />
werkstrukturen (Ethernet oder WLAN) für <strong>Notebook</strong>s reichen die derzeit in Deutsch-<br />
land vorhandenen Umsetzungsversuche.<br />
Pilotprojekte und erste Erfahrungswerte sind an zahlreichen <strong>Universität</strong>en und Fach-<br />
hochschulen vorhanden, in <strong>Berlin</strong> u.a. an der Fachhochschule für Technik und Wirt-<br />
schaft <strong>Berlin</strong> (Projekt „Musical”, URL http://musical.fhtw-berlin.de) und an der Tech-<br />
nischen <strong>Universität</strong> <strong>Berlin</strong> (Projekt „Moses”, URL http://www.moses.tu-berlin.de).<br />
Als mobile Endgeräte steht derzeit v.a. das <strong>Notebook</strong> als Werkzeug für Studierende<br />
zur Verfügung. Es ist jedoch an der schnellen Entwicklung im Bereich der portablen<br />
Computersysteme absehbar, dass eine Beschränkung allein auf <strong>Notebook</strong>-Systeme lang-<br />
fristig nicht ausreichen wird. Vielmehr muss auch die Nutzung anderer mobiler End-<br />
geräte wie z.B. des Personal Digital Assistant in verschiedenen Ausführungen (PDA 18 ,<br />
WebPDA 19 , Handheld 20 oder Tablet-PC 21 ) in der Zukunft Bedeutung geschenkt wer-<br />
den.<br />
2.3 Unterrichtsergänzung und Mehrwert durch <strong>Notebook</strong>s<br />
Mit der Nutzung von <strong>Notebook</strong>s durch die Studierenden werden neue Formen des<br />
Lehrens und des Lernen innerhalb der Hochschulen möglich. Beispielhaft sei hier die<br />
gemeinsame Nutzung von Softwareprodukten oder auf Java basierende interaktive Bild-<br />
schirmexperimente (IBE) in WWW-Umgebungen zur aktiven Teilnahme und fachlichen<br />
Unterstützung von Vorlesungen genannt. Vergleichbare Lehrkonzepte sind an den Hoch-<br />
schulen i.d.R. nur in wenigen speziell ausgerüsteten Laboren (Rechenzentrum, PC-Pool<br />
etc.) möglich. Gerade an den großen <strong>Universität</strong>en und in Studiengängen mit hohen<br />
Teilnehmerzahlen stellen die vorhandenen Hardware-Ressourcen oft einen Engpass für<br />
solche praktischen und interaktiven Lehreinheiten dar. Durch die seit Jahren gespann-<br />
te finanzielle Situation vieler Hochschulen in Deutschland stehen für den Ausbau der<br />
18 Personal Digital Assistant<br />
19 Spezieller PDA, optimiert für die Nutzung des World Wide Web<br />
20 Mobiles Kleinstcomputersystem mit geringen Abmessungen<br />
21 ähnlich einem Touch-Screen, wird aber i.d.R. mit einem Stift bedient. Wie ein <strong>Notebook</strong> besteht<br />
ein Tablet-PC nur aus einer Baueinheit.
2.3 Unterrichtsergänzung und Mehrwert durch <strong>Notebook</strong>s 11<br />
Labore i.d.R. nur wenige Mittel zur Verfügung, so dass einer Änderung dieser Situati-<br />
on allein seitens der Hochschulen in absehbarer Zeit kaum möglich erscheint. Obwohl<br />
es nicht Aufgabe oder Zielsetzung der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> ist, diese infrastruktu-<br />
rellen Defizite der Hochschulen durch die Integration mobiler Computer der Studie-<br />
renden auszugleichen, wird dennoch der Grad an Verfügbarkeit für die vorhandene<br />
IT-Infrastruktur erhöht, wenn der Nutzungsanteil studenteneigener Computersysteme<br />
steigt.<br />
Innerhalb einer <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> kann die Orts- und Zeitabhängigkeit bei steigen-<br />
der Mobilität und Flexibilität deutlich verringert werden. Dem o.g. Ziel nach Förderung<br />
der Medienkompetenz sowie Integration moderner Informations- und Kommunikations-<br />
technologien kann entsprochen werden. Für den Lernenden stellt diese Kombination<br />
aus E-Learning in Verbindung mit einem mobilen und flexiblen Lernwerkzeug daher<br />
einen deutlichen Mehrwert im Rahmen der Ausbildung dar. Die Doppelfunktion von<br />
Lernwerkzeug und persönlichem mobilen Arbeitsplatz zur Nutzung auch außerhalb des<br />
Lehrbetriebes verstärkt diesen Zugewinn zusätzlich. Durch den integrierten Ansatz der<br />
Modernisierung der Lehre an der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> wird ein fachlich höherwertiges<br />
Bildungsangebot geschaffen.<br />
In der Summe ergeben sich also fachliche und organisatorische Vorteile für Studierende<br />
und Hochschulen, wobei eine deutliche Orientierung der Lehre an die Erfordernisse der<br />
Gesellschaft, speziell auch der Wirtschaft, erfolgt.<br />
Nötig ist aber, dass die mobilen Endgeräte den Studierenden permanent und damit<br />
auch außerhalb der Hochschule zur Verfügung stehen. In letzter Konsequenz bedeutet<br />
dies, dass Studierende eigene, also auch selbstfinanzierte <strong>Notebook</strong>s in ihren Lernpro-<br />
zess integrieren, da von den Hochschulen i.d.R. keine finanziellen Mittel zur flächen-<br />
deckenden Versorgung bereitgestellen werden können. Obwohl die hochschulseitige Ver-<br />
sorgung eine Reihe von Vorteilen bieten würde, wie beispielsweise optimale E-Learning-<br />
Voraussetzungen durch homogene Hard- und Software-Strukturen sowie der einfache<br />
Aufbau eines umfassenden und effektiven Supportkonzeptes, kann ein Finanzierungs-<br />
modell nur durch dauerhafte staatliche Unterstützung oder durch die Erhebung einer<br />
speziellen Abgabe von den Studierenden getragen werden. Da auch für die Zukunft mit<br />
sinkenden Preisen im Bereich der Hardware gerechnet werden kann, scheint ein solches<br />
Modell theoretische durchführbar: Wenn ein mobiler Computer mit angemessener Aus-<br />
stattung bei einer angenommen Nutzungszeit von drei Jahren mit einem Endpreis von<br />
beispielsweise 1200,- kalkuliert wird, wären je Semester 200,- von jedem Studieren-
2.3 Unterrichtsergänzung und Mehrwert durch <strong>Notebook</strong>s 12<br />
den aufzubringen, was immerhin in der Größenordnung des Semestertickets an einigen<br />
<strong>Berlin</strong>er Hochschulen entspricht. Diese Praxis wird an vielen amerikanischen und ka-<br />
nadischen Bildungseinrichtungen längst erfolgreich angewendet.<br />
Dennoch ist der Versuch einer solche Umsetzung an deutschen Hochschulen noch nicht<br />
in Sicht. Dafür kann mit einem natürlichen Anwachsen in der <strong>Notebook</strong>-Ausstattung<br />
privater Haushalte gerechnet werden. Zudem sorgen zahlreiche <strong>Notebook</strong>-Projekte an<br />
Schulen für eine frühe Integration mobiler Computersysteme in die Lehre. Der Anteil<br />
der mit mobilen Computersystemen ausgestatteten Studierenden wird daher weiter<br />
steigen und begründet somit zusätzlich die Existenz von <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en.<br />
Im Rahmen dieser Arbeit werden aus o.g. Gründen besonders der Eigenerwerb mobiler<br />
Endgeräte durch die Lernenden betrachtet, da dies den derzeitig realen Bedingungen<br />
im Umfeld der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en am ehesten entspricht. Für mittel- bis langfri-<br />
stige Betrachtungen wird davon teilweise abgewichen und damit Platz für zukünftige<br />
Entwicklungen gelassen.
Kapitel 3<br />
<strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> — Das Umfeld<br />
der deutschen Hochschulen<br />
Der Einfluss des gesellschaftlichen Wandels auf die Hochschullehre ist weitreichend.<br />
War die Studentenschaft in den letzten Jahrzehnten v.a. durch junge Abiturienten/-<br />
innen geprägt, kann als Konsequenz der veränderten Ausbildungsanforderungen in der<br />
Zukunft eine Personengruppe mit deutlich höherem Altersdurchschnitt an den deut-<br />
schen Bildungseinrichtungen erwartet werden, die sich durch größere Berufserfahrung<br />
sowie gezielteren Wissensbedarf auszeichnet. Der Anteil berufstätiger bzw. teilzeit-<br />
arbeitender Studierender wird sich zudem weiter vergrößern.<br />
Als Folge der Entwicklung hin zum lebenslangen Lernen kann der Studierende der Zu-<br />
kunft als „Bildungs- oder Wissenskonsument” bezeichnet werden und die Bildung wird<br />
zu einem standortentscheidenden Produktionsfaktor. 1 Hochschulen und andere<br />
Bildungseinrichtungen kommt dann die Rolle von Dienstleistern im Bildungsbereich<br />
zu.<br />
Der Bildungsmarkt nimmt damit auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten einen<br />
erheblich größeren Stellenwert ein: So wird von Fachleuten in den USA ein weltweiter<br />
Bildungsmarkt erwartet, dessen Volumen auf etwa 15% der Bruttosozialprodukte ge-<br />
schätzt wird. 2 Dies führt zu einem zunehmenden Interesse der Wirtschaft am Bildungs-<br />
markt: In einer Doppelrolle werden Unternehmen zu Dienstleistern am Bildungsmarkt<br />
und gleichzeitig zu dessen Konsumenten. 3<br />
1 vgl. Encarnação/Leidhold/Reuter 2000, S. 17<br />
2 vgl. Thomas 2001, S. 4<br />
3 vgl. Hendricks 2001, S. 12<br />
13
3.1 Ziele der Hochschulen 14<br />
In diesem Kapitel werden zunächst im Abschnitt 3.1 die Zielsetzung der Hochschulen<br />
an das Konzept der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en untersucht und im Anschluss in Abschnitt<br />
3.2 die technische Umsetzung erörtert, wobei sowohl die Anforderungen der Studie-<br />
renden als auch die hochschulseitigen Bedürfnisse wegen möglicher Interessenskonflikte<br />
einzeln untersucht werden müssen.<br />
Im Abschnitt 3.3 wird schließlich die Integration der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> in die beste-<br />
hende Hochschulstruktur untersucht und ein Organsiationsmodell für die Umsetzung<br />
entwickelt.<br />
3.1 Ziele der Hochschulen<br />
Die potentiellen Zielsetzungen von Hochschulen an die zu realisierende <strong>Notebook</strong>-<br />
<strong>Universität</strong> sind umfangreich. Die im Bildungsbereich allgemein immer vorhandene<br />
Grundzielsetzung ist die Gewährleistung einer zeitgemäßen und zukunftsorientierten<br />
Ausbildung bei qualitativ immer hochwertigerer Wissenvermittlung. Folgerichtig gilt<br />
diese Anforderung auch für eine <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>.<br />
Durch den in den letzten Jahren vollzogenen Auf- und Ausbau des Internet als globales<br />
Kommunikations- und Informationsnetz kommt den Bildungseinrichtungen neuerdings<br />
eine weitere wichtige Funktion zu: Die sich im World Wide Web ansammelnden Wis-<br />
sensbestände müssen beobachtet, kritisch untersucht und mitgestaltet werden. Schließ-<br />
lich ist „für den Erhalt unterschiedlicher Arten von Wissen Sorge zu tragen”. 4 Dieser<br />
Aufgabenkomplex könnte mit Wissen managen zusammengefasst werden.<br />
Einige umzusetzende Ziele können also sein:<br />
• Angebot einer zeitgemäßen und zukunftsorientierten Lehre<br />
• Aufbau zusätzlicher Bildungsangebote für weitere Zielgruppen<br />
• Qualitative Verbesserung der Lehre<br />
• Effizienzsteigerung im Lehrbetrieb<br />
• Motivationssteigerung bei den Studierenden<br />
4 Schelhowe 2001, S. 18
3.1 Ziele der Hochschulen 15<br />
• Verkürzung der durchschnittlichen Studienzeiten 5<br />
• Wissensaufbau durch Forschung und Entwicklung (F&E)<br />
• Bereitstellung von Wissensressourcen (Institute = Kompetenzzentren)<br />
• Managen von global vorhandenem Wissen<br />
Betrachtet man die Folgen der Verschmelzung von Lern- und Arbeitswelt, ist eine<br />
deutliche Erweiterung des Wirkungs- und Einflussbereiches für die Hochschulen eine<br />
logische Folge. 6 Die strikte Trennung von Bildung und Weiterbildung bzw. berufsbe-<br />
gleitender Ausbildung wird dann aufgehoben und aus der Sichtweise der Hochschulen<br />
heraus entstehen neue Aufgabenfelder mit neuen Zielgruppen: Der Studierende wird<br />
zum „Kunden”, die Bildung zur „Ware” 7 und die Bildunsinstitute zu „Dienstleistern”,<br />
ähnlich wie es im Bereich der beruflichen Weiterbildung längst ausgeprägt ist. Ein sog.<br />
„Wissens-Broker” kann dabei die Rolle des Vermittlers und Beraters für beide Seiten<br />
einnehmen.<br />
Eine Teilnahme am nationalen und schließlich auch am internationalen Bildungmarkt<br />
wird für die Hochschulen möglich und bietet grundsätzlich die Möglichkeiten der Eigen-<br />
erwirtschaftung finanzieller Mittel.<br />
Aus diesen Betrachtungen heraus lassen sich u.a. folgende mögliche Ziele ableiten:<br />
• Änderung des Selbstverständnisses: Hochschulen als Dienstleister<br />
• Erweiterung des Wirkungskreises in den Bereich Weiterbildung<br />
• Teilnahme am nationalen und internationalen Aus- und Weiterbildungsmarkt<br />
• Entwicklung und Einsatz „kommerzieller” Bildungsprodukte<br />
5 Eine Verkürzung der Regelstudienzeiten ist dagegen i.d.R. kein Ziel der Hochschulen und scheint<br />
ohne die Reduzierung des Lernstoffs auch kaum möglich. Weiterhin muss die Doppelbelastung<br />
vieler Studierender durch paralleles Studieren und Arbeiten berücksichtigt werden, worauf Hochschulen<br />
fast keine Möglichkeit der Einflussnahme haben. Wie später noch aufgezeigt wird, bieten<br />
<strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en v.a. durch die modernen Lehr- und Lernszenarien jedoch die Möglichkeit<br />
zur Erhöhung der Mobilität und der Flexibilität der Studierenden und damit auch zur Verbesserung<br />
der Lernmöglichkeiten für teilzeitarbeitende, örtlich gebundene, Kinder erziehende und körperbehinderte<br />
Studierende.<br />
6 vgl. Scheer 2001, S. 6 sowie Encarnaçsão/Leidhold/Reuter 2000, S. 17<br />
7 vgl. Thomas 2001, S. 5
3.2 Wireless LAN und mobile Endgeräte 16<br />
Zusätzlich müssen noch die neuen gesellschaftlichen Anforderungen an die Lernenden<br />
erfüllt werden (vgl. Abschnitt 2.1). Sie lassen sich als Zielvorgaben mit den Studieren-<br />
den als Zielgruppe definieren zu:<br />
• Förderung der Medienkompetenz<br />
• Entwickeln der Kompetenz zum lebenslangen Lernen<br />
Als Hilfe für eine Verbesserung der Lehre lassen sich schließlich aufführen:<br />
• Erhöhung der Flexibilität<br />
• Erhöhung der Mobilität<br />
• Vermeidung von Medienbrüchen in der Lehre<br />
Das <strong>Notebook</strong> erfüllen hier im Rahmen der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> eine Doppelfunk-<br />
tion: Zum einen ist er das moderne Werkzeug für die neuen Lehr- und Lernformen,<br />
zum anderen stellt er einen mobilen und flexiblen persönlichen Arbeitsplatz dar. Inner-<br />
halb der Räumlichkeiten der Hochschule kann u.U. auch auf ein drahtloses Netzwerk<br />
(WLAN) zugegriffen werden, wodurch insbesondere die Flexibilität und die Mobilität<br />
der Studierenden zusätzlich deutlich wird.<br />
3.2 Wireless LAN und mobile Endgeräte<br />
Die Kombination aus mobilen Computersystemen und drahtlosem Netzwerk ermögli-<br />
chen den Studierenden neue Möglichkeiten der Information und der Kommunikation<br />
und stellt die Grundlage für die Teilnahme am E-Learning dar. Gerade deshalb kommt<br />
auch dieser technischen Realisierung – neben den didaktischen Aufgaben – eine zentrale<br />
Bedeutung zu.<br />
Teilweise wurden an deutschen Hochschulen durch Förderungen des Bundesministeri-<br />
ums für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Projektträger „Neue Medien in der<br />
Bildung + Fachinformation” erste informationstechnische Strukturen für den draht-<br />
losen Netzwerkbetrieb WLAN umgesetzt und in der Praxis erprobt. Hierbei handelt
3.2 Wireless LAN und mobile Endgeräte 17<br />
es sich i.d.R. um WLAN-Strukturen nach dem IEEE 802.11b-Standard, der Übertra-<br />
gungsraten von bis zu 11 Mbit/s bei Reichweiten von bis zu 500 m ermöglicht. 8 Am<br />
Markt finden sich inzwischen auch erste Produkte nach dem IEEE 802.11g-Standard,<br />
die mit Übertragungsraten von bis zu 54 Mbit/s bei gleichzeitiger Abwärtskompati-<br />
bilität noch höheren Ansprüchen genügen. Ein Ende der Entwicklung im Bereich der<br />
WLAN-Technologie ist noch nicht abzusehen.<br />
In der Praxis wird auf der Seite der mobilen Endgeräte eine Empfängerkarte (WLAN-<br />
Karte) benötigt: Sie kann fest im Gerät integriert sein oder als PCMCIA-Karte in einem<br />
entsprechenden Erweiterungssteckplatz betrieben werden. Bei fest eingebauten WLAN-<br />
Komponenten ist die Antenne i.d.R. innerhalb des Gehäuses angebracht, wohingegen<br />
PCMCIA-Karten über eigene Antennen verfügen, deren Empfangsleistung jedoch oft<br />
geringer ist. Durch Marktbeobachtungen ist deutlich zu erkennen, dass der Anteil der<br />
mit WLAN ausgerüsteten <strong>Notebook</strong>s ständig zunimmt. In naher Zukunft wird eine in-<br />
tegrierte WLAN-Karte ebenso wie Netzwerkkarte und Modem zur Mindestausstattung<br />
gängiger mobiler Endgeräte gehören. Für den Betrieb sind die verschiedenen Standards<br />
zu beachten, um eine Funktion im vorhandenen WLAN zu gewährleisten.<br />
Der drahtlose Datenverkehr findet zwischen dem WLAN-fähigen <strong>Notebook</strong> und einem<br />
sog. Access-Point statt. Dieser ist i.d.R. über ein Twisted-Pair-Kabel physikalisch mit<br />
dem Hochschulnetzwerk verbunden und mit einer Antenne zur drahtlosen Kommuni-<br />
kation mit mobilen Computersystemen ausgestattet. Sich überlappende Empfangsbe-<br />
reiche verschiedener Access-Points können durch geschickte räumliche Anordnung der<br />
Empfänger und die Nutzung verschiedener Kanäle einen flächendeckenden Empfangs-<br />
bereich ausbilden. 9<br />
3.2.1 Anforderungen der Hochschulen<br />
Die Erfordernisse der Hochschulen an die Versorgung der Studierenden mit <strong>Notebook</strong>s<br />
und deren Betrieb im WLAN lassen sich in vier Bereiche untergliedern: allgemeine,<br />
technischen, organisatorischen und sozialen Anforderungen. Da Sicherheitsfragen bei<br />
einer drahtlosen Datenübertragung eine ausgesprochen wichtige Rolle einnehmen, wird<br />
8 Die Reichweite ist sehr stark von der Umgebung abhängig. So wurden an der Technischen <strong>Universität</strong><br />
<strong>Berlin</strong> teilweise reale Empfangsradien von weniger als 20 m ermittelt, wobei insbesondere<br />
Wände aus Stahlbeton und ähnliche Hindernisse für den deutlichen Leistungsverlust verantwortlich<br />
sind.<br />
9 vgl. Tavangarian et al. 2001(b), S. 44f
3.2 Wireless LAN und mobile Endgeräte 18<br />
dieser Aspekt am Ende dieses Abschnitts gesondert betrachtet.<br />
Eine allgemein zukunftsorientierte hard- und softwaretechnische Ausstattung der Note-<br />
books sowie die Möglichkeit einer nahtlosen Integration in die bereits vorhandene und<br />
die geplante IT-Infrastruktur können zu den allgemeinen Anforderungen gezählt<br />
werden: So muss beispielsweise die Nutzung vorhandener Netzstrukturen (v.a. LAN,<br />
WLAN) ebenso wie die nachträgliche Aufrüstbarkeit wichtiger Hardkomponenten (z.B.<br />
Arbeitsspeicher, Festplatte, Zusatzakku) gewährleistet sein. 10 Weiterhin ist die Einhal-<br />
tung gehobener Qualitätsstandards (z.B. robuste Ausführung der Geräte 11 ) sowie ein<br />
hinreichend leistungsfähiges Supportkonzept von Seiten der Hersteller oder auch der<br />
Hochschule nötig, um die allgemeine Akzeptanz des <strong>Notebook</strong>-Versorgungskonzeptes<br />
und der einzelnen <strong>Notebook</strong>-Modelle bei den Studierenden sicherzustellen. Speziell das<br />
Image des Hardwareherstellers hat hierauf besonders starken Einfluss und ist daher<br />
bei der Auswahl geeigneter industrieller Kooperationspartner nicht zu vernachlässigen.<br />
Auch eine ausreichend lange Verfügbarkeit der Modelle ist im Hinblick auf die Vorteile<br />
einer homogenen Hard- und Softwareausstattung ein wichtiges Argument (siehe S. 19).<br />
Bei den technischen Anforderungen spielen die individuellen Angebote moderner<br />
Lehr- und Lernszenarien der Hochschule eine entscheidende Rolle. Für die Nutzung von<br />
E-Learning-Komponenten, multimedialen Elementen oder für die Bearbeitung von Pro-<br />
jekten mit spezieller Software müssen sowohl hardware- als auch softwareseitig geeigne-<br />
te Voraussetzungen geschaffen werden. In Tabelle 3.2.1 sind wichtige Anforderungskri-<br />
terien aufgeführt. Diese Auflistung kann wegen der uneinheitlichen Ausgangsbedingun-<br />
gen an Hochschulen nicht erschöpfend oder allgemeingültig sein, aber als Anhaltspunkt<br />
bei der Ermittlung von Mindestanforderungen dienen.<br />
10 Im Handel finden sich u.a. besonders kleine und leichte <strong>Notebook</strong>s ohne integrierte WLAN-Karte<br />
und ohne PCMCIA-Erweiterungschächte. Obwohl eine Nutzung eines vorhandenen WLAN mittels<br />
externem WLAN-Adapter über die USB-Schnittstelle grundsätzlich möglich ist, erscheinen solche<br />
Modelle für den alltäglichen mobilen Betrieb innerhalb von Hochschulen mit häufiger WLAN-<br />
Nutzung wenig geeignet.<br />
11 Im Falle des Eigenerwerbs der Geräte durch die Studierenden kann ein besonders sorgsamer Umgang<br />
mit den <strong>Notebook</strong>s und somit eine lange Lebensdauer der Geräte erwartet werden. Werden<br />
Geräte dagegen durch die Hochschule bereitgestellt, müssen auch Schäden durch unsachgerechte<br />
Handhabung oder Vandalismus zu Lasten der Bildungseinrichtung hingenommen werden. Im<br />
Zusammenhang mit dieser Problematik stellt sich dann die Frage nach speziellen Versicherungen<br />
oder besonderen Garantieleistungen, die in der Konsequenz jedoch zu einer weiteren finanzielle<br />
Belastung der Hochschule führen würden.
3.2 Wireless LAN und mobile Endgeräte 19<br />
Hardwareseitige Kriterien Softwareseitige Kriterien<br />
• Systemleistung, Rechenleistung<br />
• Größe des Arbeitsspeichers<br />
• Speicherkapazität der Festplatte<br />
• Austauschbare Datenträger<br />
• Größe und Auflösung des Displays<br />
• Hohe Akkuleistung, geringe Ladedauer<br />
• Hardwareseitige Sicherheitssysteme<br />
• Allgemeine Hardwarekompatibilität<br />
• Geräuscharmer Betrieb<br />
• Hardwareseitiges Sicherheitskonzept<br />
...<br />
• Betriebssystem(e)<br />
• Anwendungsprogramme<br />
• Entwicklungsumgebungen<br />
• Tools<br />
• Internet-Applikationen<br />
• Softwareseitiges Sicherheitskonzept<br />
...<br />
Tabelle 3.1: Hard- und softwareseitige Anforderungen an <strong>Notebook</strong>s<br />
Die organisatorischen Anforderungen ergeben sich v.a. aus dem direkten Beschaf-<br />
fungsprozess der Geräte sowie der Frage nach dem an der Hochschule verfügbaren<br />
Support: Logistik, Modellauswahl und Preisgestaltung sind beispielsweise wichtige Pa-<br />
rameter der organisatorischen Anforderungen.<br />
<strong>Notebook</strong>-Beschaffung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Studierende bei<br />
der Auswahl und beim Erwerb eines <strong>Notebook</strong>s von Seiten der Hochschule bzw. des Pro-<br />
jektes unterstützt wird. Hierfür ist die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle sinnvoll,<br />
deren Mitarbeiter stets über die aktuellen Entwicklungen der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> in-<br />
formiert sind und auch technischen Support leisten können.<br />
Soll – wie etwa von Tavangarian empfohlen 12 – innerhalb der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> ein<br />
lokales Supportcenter für Studierende durch Hochschulmitarbeiter eingerichtet werden,<br />
setzt dies voraus, dass auch eine möglichst homogene Hard- und Softwarestruktur ein<br />
Ziel des Beschaffungskonzeptes ist, um den Umfang an technischen Problemstellungen<br />
zu begrenzen. Dann ist beispielsweise auch die Erstellung einer Image-CD bzw. Image-<br />
DVD für wenige verschiedene Modelle zu bewerkstelligen, die bereits alle benötigten<br />
Softwareprodukte, Tools und Einstellungen für einen Betrieb innerhalb der vorhande-<br />
nen IT-Infrastruktur enthält und den Studierenden die Möglichkeit der Konzentration<br />
12 vgl. Tavangarian et al. 2001(a), S. 104
3.2 Wireless LAN und mobile Endgeräte 20<br />
auf fachspezifisches E-Learning bietet. 13<br />
In die organisatorischen Anforderungen können ebenfalls langfristige Planungsvorga-<br />
ben miteingehen. So muss im Rahmen eines Nachhaltigkeitskonzeptes für eine<br />
dauerhafte effiziente Funktion des <strong>Notebook</strong>-Versorgungsprogramms in der <strong>Notebook</strong>-<br />
<strong>Universität</strong> Sorge getragen werden, v.a. wenn etwaige Förderprogramme zur Anschub-<br />
finanzierung auslaufen.<br />
Die sozialen Anforderungen sind insbesondere dann von entscheidender Bedeutung<br />
für das Projekt „<strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>”, wenn die Hauptlast der Finanzierung der Ge-<br />
räte durch die Studierenden selber zu tragen ist. Dann muss ein Gleichgewicht zwischen<br />
Preis und Leistung unter der besonderen Berücksichtigung der Sozialstruktur der Stu-<br />
dierenden hergestellt werden. Die offensichtliche Diskrepanz dieser beiden Forderungen<br />
kann beispielsweise durch ein ausgewogenes Sozialkonzept in Kombination mit spe-<br />
ziell ausgehandelten Vergünstigungen für Studierende und der Auswahl auch preisgün-<br />
stiger Modelle deutlich reduziert werden. Auch allgemeine regionale Unterschiede der<br />
Einkommensstruktur müssen berücksichtigt werden: Die an der ETH Zürich erreichten<br />
hohen Absatzzahlen für <strong>Notebook</strong>s wurden im vergleichbar angelegten Beschaffungs-<br />
konzept der TU <strong>Berlin</strong> nicht annähernd erreicht.<br />
Auch Aspekte zu den Themen Datensicherheit und Datenschutz müssen hier ins-<br />
besondere bei Einsatz der WLAN-Technologie berücksichtigt werden. Die Hochschulen<br />
müssen dafür Sorge tragen, dass ihre Netzstruktur nicht durch zugelassene oder sich il-<br />
legal Zugang verschaffende Benutzer missbraucht werden kann. Für die Praxis bedeutet<br />
dies beispielsweise, dass Hard- und Softwarekomponenten nötige Sicherheitsanwendun-<br />
gen unterstützen müssen.<br />
Im WLAN-Standard IEEE 802.11b sind diverse Sicherheitsmechanismen definiert, die<br />
aber keinen ausreichenden Schutz bieten: 14<br />
• Service Set Identity (SSID): Nur durch die Angabe des Netzwerknamens wird<br />
der Zugang zum Netzwerk möglich. Dabei wird dieser Name jedoch im Klartext<br />
13 Im Rahmen des Moses-Projektes der Technischen <strong>Universität</strong> <strong>Berlin</strong> wurden für einige <strong>Notebook</strong>-<br />
Modelle Image-DVD’s angefertigt und den interessierten Studierenden zugänglich gemacht. Neben<br />
einer Neuaufteilung der Festplatte und einer parallelen Installation von Microsoft Windows und Linux<br />
konnten auch wichtige Softwareprodukte für die Nutzung der angebotenen E-Learning-Inhalte<br />
vorinstalliert werden, beispielsweise spezielle Java-Versionen und die benötigte vorkonfigurierte<br />
WLAN-Software.<br />
14 vgl. Bundesamt für Sicherheit in der Informationswirtschaft 2002, S. 4 ff
3.2 Wireless LAN und mobile Endgeräte 21<br />
übertragen und ist somit leicht abhörbar. Außerdem werden SSID’s teilweise im<br />
Internet bekannt gemacht.<br />
• Media Access Control-Adresse (MAC-Adresse): Die MAC-Adresse identi-<br />
fiziert jede Netzwerkkarte weltweit eindeutig. Der organisatorische Aufwand für<br />
die Registrierung von MAC-Adressen ist bei hohen Nutzerzahlen jedoch sehr<br />
aufwendig. Außerdem können MAC-Adressen gefälscht werden und daher nicht<br />
als einzige Authentifizierung genutzt werden. Auch die Kombination von MAC-<br />
Adressen und SSID kann daher nicht als sicher bezeichnet werden.<br />
• Wired Equivalent Privacy-Protokoll (WEP-Protokoll): Dieses Protokoll<br />
arbeitet mit dem Verschlüsselungs-Algorithmus RC4, der nicht mehr als sicher<br />
gilt. Eine sichere Übertragung sensibler Daten kann daher nicht gewährleistet<br />
werden. 15<br />
Abhilfe kann durch Verwendung eines Virtual Private Network (VPN) in Verbindung<br />
mit dem IPSec-Protokoll (Internet Protocol Security) geschaffen werden. Die Verschlüs-<br />
selung von Datenpaketen mit IPSec gilt derzeit als sicher. In Kombination mit einem<br />
VPN-Konzept entsteht ein sog. kryptographischer Tunnel, der mögliche Abhörversuche<br />
durch Dritte deutlich erschwert.<br />
Um den Sicherheitsanforderungen der Hochschulen zu genügen, sollte der WLAN-<br />
Betrieb aus o.g. Gründen nicht mit dem WEP-Protokoll realisiert sein. Derzeit ist<br />
die Nutzung des IPSec-Protokolls u.a. vom Bundesministerium für Sicherheit in der<br />
Informationswirtschaft (BSI) dringend empfohlen. 16<br />
3.2.2 Anforderungen der Studierenden<br />
Die Studierenden stellen v.a. zusätzliche Ansprüche an die Endgeräte, deren Bedeutung<br />
für die Hochschulen teilweise gering sind, aber deshalb nicht weniger beachtenswert!<br />
15 Auf die genaue Beschreibung der Schwachstellen soll hier verzichtet werden. Eine detaillierte<br />
Beschreibung ist beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) unter<br />
http://www.bsi.de/fachthem/funk_lan/index.htm zu finden. Dort werden auch Maßnahmen zur<br />
Behebung einiger WEP-Sicherheitsprobleme genannt, die bei der Nutzung dieses Protokolls unbedingt<br />
beachtet werden sollten, beispielsweise die Erhöhung der Schlüssellänge von 40 auf 104 Bit<br />
und die Nutzung statischer IP-Adressen.<br />
16 vgl. Bundesamt für Sicherheit in der Informationswirtschaft 2002, S. 11
3.2 Wireless LAN und mobile Endgeräte 22<br />
Die Frage nach Garantiezeiten sowie nach der Garantieabwicklung sind in Kombination<br />
mit dem angebotenen Preis-Leistungs-Verhältnis ein wichtiges Entscheidungskriterium.<br />
Qualität, Kompatibilität, Mobilität sowie Modularität für spätere Aufrüstungen sind<br />
weitere generelle Zielgrößen. Größe und Gewicht sollen möglichst gering sein, ein CD-<br />
Brenner sowie ein DVD-Laufwerk gehört derzeit in Form von Combo-Laufwerken schon<br />
fast zu den Mindestanforderungen – schließlich müssen die Geräte auch alle Anforderun-<br />
gen für eine vollständige Abdeckung der Aufgabenbereiche außerhalb der Hochschule<br />
erfüllen: Integrierte Soundkarte, große Festplattenkapazität sowie leistungsfähige Chip-<br />
sätze (Mainboard, Grafikkarte) sind dafür unerlässlich. Eine integrierte Netzwerkkarte<br />
sowie ein Modem gehören mittlerweile ebenfalls zu der Standardausstattung moderner<br />
<strong>Notebook</strong>s.<br />
Wenn eine Hochschule dem Studierenden im Zuge eines <strong>Notebook</strong>-Beschaffungskon-<br />
zeptes direkt Geräte zum Kauf empfiehlt, erwartet der Lernende dann auch ein ganz<br />
besonderes Angebot, das ihm im Vergleich zum konventionellen Kauf im Geschäft oder<br />
per Internet deutlich sichtbare Vorteile bietet. Ein besonders umfangreiches Softwarepa-<br />
ket, eine höherwertige technische Ausstattung, verlängerte Garantiezeiten und schließ-<br />
lich hohe Rabatte können für hohe Akzeptanz sorgen.<br />
Zusätzlich spielt mindestens bei einem Teil der Studierenden auch das Markenbewusst-<br />
sein eine Rolle, wie es bei der Verbreitung von Handys beobachtet werden kann. Eine<br />
breite Palette von verschiedenen Modellen unterschiedlicher Hersteller bietet dem Kauf-<br />
willigen die Möglichkeit der Auswahl nach individuellen Anforderungen und fördert das<br />
Bewusstsein für die eigene Kaufentscheidung. Wird dagegen nur ein Modell angeboten,<br />
kann dies als persönlichen Einschränkung empfunden werden und somit der allgemei-<br />
nen Akzeptanz der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> hinderlich sein.<br />
Dieser Konflikt zwischen hochschul- und nutzerseitigen Anforderungen muss bei der<br />
Gestaltung von <strong>Notebook</strong>-Beschaffungskonzepten berücksichtigt werden.<br />
Die wichtigsten Kriterien im Überblick:<br />
• Preis, Preis-Leistungsverhältnis-Verhältnis und Rabatte<br />
• Qualität, Support und Garantie<br />
• Fortschrittliche Technologie („up-to-date”)<br />
• Multimediatauglichkeit
3.3 Umsetzung von <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en 23<br />
• Softwareausstattung<br />
• Größe und Gewicht<br />
• Markenbewusstsein<br />
• Auswahl<br />
Für die Majorität der Studierenden ist letztendlich v.a. ein geringer Preis die ent-<br />
scheidende Anforderung, wobei es sich hier um eine subjektiv empfundenen Zielgröße<br />
handelt, die auch wesentlich von der Höhe eingeräumter Rabatte beeinflusst wird –<br />
der Mehrwert gegenüber einem anderweitigen Erwerb ergibt sich also v.a. aus diesen<br />
finanziellen Größen in Verbindung mit dem Angebot zusätzlichen Serviceleistungen der<br />
Hochschule, die noch genauer betrachtet werden.<br />
3.3 Umsetzung von <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en<br />
Bei der Einführung einer <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> handelt es sich zumeist um ein fach- und<br />
organisationsstruktur-übergreifendes Projekt, welches schließlich in einem gegebenen<br />
Zeitfenster in die bestehende Hochschulstruktur eingebunden werden muss. Tavangari-<br />
an bezeichnet die <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> sogar als „Form der Hochschulorganisation”. 17<br />
Dies würde dann aber in der Konsequenz einen gesamteinheitlichen Umstrukturierungs-<br />
und Anpassungsprozess erfordern, also nicht eine Integration mobiler und flexibler<br />
Lehr- und Lernszenarien in die bestehende Hochschulstruktur, sondern vielmehr eine<br />
Integration alter Strukturen in die neue <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>. Ein solcher grundle-<br />
gender Umwälzungsprozess kann nur unter höchstem Einsatz und Unterstützung des<br />
leitenden Hochschulpersonals umgesetzt werden.<br />
Zu den direkt an der Umsetzung beteiligten Personengruppen gehören Dozenten und<br />
wissenschaftliche Mitarbeiter, Techniker sowie verschiedene weitere Personengruppen.<br />
Zielgruppe sind natürlich v.a. die Studierenden, aber auch Dozenten und Mitarbeiter<br />
profitieren direkt und indirekt von der Umsetzung. Das Formulieren konkreter Zielset-<br />
zungen, die Festlegung von Meilensteinen sowie die klare Abtrennung der einzelnen Auf-<br />
gabenbereiche sind grundlegende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Projektdurch-<br />
17 Tavangarian et al. 2001(a), S.16
3.3 Umsetzung von <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en 24<br />
führung. Wichtige Aufgabe der Projektleitung ist es, die breite Unterstützung aller<br />
direkt und indirekt Beteiligten sicherzustellen: Der für das Gelingen überaus wichtige<br />
Konsens insbesondere in den wichtigen grundlegenden Fragen der Umsetzung kann bei-<br />
spielsweise durch das Aufzeigen des Mehrwerts für alle beteiligten Personengruppen po-<br />
sitiv beeinflusst werden. Die aktive Unterstützung des Projektes durch alle Beteiligten<br />
ist wichtigste Grundlage für die erfolgreiche Einführung der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>. 18<br />
Der erfolgreichen Realisierung einer <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> kann die breite Palette an<br />
aktuellen, verschiedenartigen Ansätzen sowie die bisher gesammelten Erfahrungswerte<br />
nur förderlich sein. Es ist zu beachten, dass auf Grund der Aktualität dieser Thematik<br />
bisher nur wenige Quellen in gedruckter Form vorliegen. 19 Zahlreiche Quellen finden<br />
sich jedoch im World Wide Web.<br />
3.3.1 Aufgabenbereiche innerhalb der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong><br />
Die einzelnen Aufgaben innerhalb einer <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> können in drei große Be-<br />
reiche unterteilt werden: der organisatorische, der technisch-infrastrukturelle und<br />
der fachlich-inhaltliche Bereich. Die Abgrenzung der Aufgabenbereiche sowie eine<br />
Auswahl an Schnittstellen zu hochschuleigenen und von außen einwirkenden Faktoren<br />
und Einrichtungen ist in Abbildung 3.1 auf Seite 25 dargestellt.<br />
Zu den Aufgaben im organisatorischen Bereich gehören beispielsweise das Ver-<br />
einbaren von Zielsetzungen sowie deren Kontrolle. Ein tragfähiges Finanzkonzept muss<br />
erarbeitet und die allgemeine Unterstützung für das Projekt sichergestellt werden. Pro-<br />
jektleitung und Projektmanagement sind für die zentralen Aufgaben dieses Bereiches<br />
verantwortlich.<br />
Hauptaufgabengebiet im technisch-infrastrukturellen Bereich ist die Bereitstel-<br />
18 vgl. Bundesarbeitskreis „Lernen mit <strong>Notebook</strong>s” 2002, S. 52<br />
19 Sehr empfehlenswert ist das Buch „Studium online – Hochschulentwicklung durch neue Medien”,<br />
Verlag Bertelsmann Stiftung. Weiterhin finden sich etliche aktuelle Artikel, Aufsätze, Erfahrungsberichte<br />
und Leitfäden im Internet, die aus verschiedenen Sichtweisen heraus diesen Themenkomplex<br />
erörtern. Als Beispiele seien hier Döbeli, Stähli: „Empfehlung zur Planung eines Ein-<strong>Notebook</strong>s-pro-<br />
StudentIn-Programms (ENpS)” sowie vom Bundesarbeitskreis „Lernen mit <strong>Notebook</strong>s”: „Lernen<br />
mit <strong>Notebook</strong>s – Wege zum selbstständigen Lernen” genannt. Auch die vom Bundesministerium<br />
für Bildung und Forschung (BMBF) in Auftrag gegebene Studie „Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten<br />
von <strong>Notebook</strong>s in Lehre und Ausbildung an Hochschulen” muss mit einbezogen werden,<br />
da hier z.T. sehr konkrete Handlungsweisen für eine Umsetzung der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> aufgezeigt<br />
werden. Informationen zu Projekten des Einsatzes von <strong>Notebook</strong>s an Schulen sind ebenfalls<br />
beachtenswert und finden sich im Internet.
3.3 Umsetzung von <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en 25<br />
Standardisierungsgremien<br />
Partner aus der Industrie<br />
Datenbanken<br />
Bibliotheken<br />
technisch−<br />
infrastruktureller<br />
Bereich<br />
"<strong>Notebook</strong>−<strong>Universität</strong>"<br />
organisatorischer Bereich<br />
(Projekt−) Management<br />
Gebäude−<br />
Rechenzentrum<br />
management<br />
Didaktik<br />
fachlich−<br />
inhaltlicher<br />
Bereich<br />
Fachgebiete<br />
Institute<br />
Präsidium<br />
Hochschulverwaltung<br />
Anforderungen<br />
Erwartungen<br />
Abbildung 3.1: Aufgabengebiete und mögliche Schnittstellen innerhalb der <strong>Notebook</strong>-<br />
<strong>Universität</strong><br />
lung einer auf die individuellen Anforderungen ausgelegten informationstechnischen<br />
Infrastruktur, die langfristig im Rahmen der Nachhaltigkeit in die bestehende Hoch-<br />
schulstruktur integriert werden kann. Weiterhin kann ein technischer Support für Leh-<br />
rende und Studierende in dieses Aufgabengebiet fallen, wobei es zu Überschneidungen<br />
mit organisatorischen Aufgaben kommen kann. V.a. Hochschulmitarbeiter aus den Be-<br />
reichen Verwaltung und Service agieren innerhalb dieses Aufgabenbereiches.<br />
Im fachlich-inhaltlichen Bereich stehen die Entwicklung und Nutzung moderner<br />
Lernumgebungen und deren fachliche Inhalte im Vordergrund. E-Learning-Inhalte und<br />
multimediale Elemente als Ergänzung für die Präsenzlehre müssen von den Fachgebie-<br />
ten bzw. Instituten für die <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> vorbereitet, in der Praxis erprobt und<br />
schließlich in den regulären Lehrbetrieb übernommen werden. Eine bewertbare Lerner-<br />
folgskontrolle evtl. mit Hilfe didaktischer Unterstützung sollte zur Sicherstellung eines<br />
erfolgreichen Projektverlaufes ebenfalls durchgeführt werden.<br />
Tabelle 3.2 zeigt beispielhaft die Zuordnung einzelner Aufgaben zu den drei Bereichen.
3.3 Umsetzung von <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en 26<br />
Bereich Aufgabe<br />
Organisatorischer<br />
Bereich<br />
Technischinfrastruktureller<br />
Bereich<br />
Fachlich-inhaltlicher<br />
Bereich<br />
• Festlegung der Rahmenbedingungen für die <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong><br />
• Erarbeiten der Zielvorgaben und Zielkontrollen für das Projekt<br />
• Erstellung einer Finanzplanung sowie deren Kontrolle<br />
• Erarbeitung eines tragfähigen <strong>Notebook</strong>beschaffungskonzeptes<br />
• Sicherung der Unterstützung und allgemeiner Akzeptanz des Projektes<br />
• Öffentlichkeitsarbeit, Werbung<br />
• Aufbau von Netzwerkstrukturen (v.a. Ethernet, WLAN...)<br />
• Integration vorhandener Netzwerkstrukturen<br />
• Einrichtung und Pflege von Zugangsberechtigungen (Accounts)<br />
• Bereitstellung von Diensten (WWW, Mail, Druckservice...)<br />
• Bereitstellung und Pflege der E-Learning-Plattform<br />
• Bereitstellung einer Kommunikationsplattform (Forum, Chat...)<br />
• Festsetzung technischer Mindestanforderungen für <strong>Notebook</strong>s<br />
• Technischer Support<br />
• Anpassung der didaktischen Konzepte an mobile Lernumgebungen<br />
• Aufbereitung des fachlichen Lehrmaterials für IT-gestützte Lernumgebungen<br />
(z.B. Präsentationen, Visualisierungen, Skripte...)<br />
• Bereitstellung des aufbereiteten Lehrmaterials zum Download<br />
• Einsatz von <strong>Notebook</strong>s in Übungen<br />
• Lernerfolgskontrolle<br />
• Förderung der Selbstorganisation der Studenten<br />
Tabelle 3.2: Aufgaben innerhalb der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong><br />
3.3.2 Modell einer Organisationsform<br />
Auf Grund der vielschichtigen Verflechtungen der Aufgabengebiete untereinander sind<br />
eindeutige Zuordnungen von Aufgaben zu Aufgabengebieten oft nur schwer abzugren-<br />
zen. So kann beispielsweise die Vergabe von Benutzerzugängen (Accounts) je nach<br />
Hochschule eine Aufgabe organisatorischer oder auch technisch-infrastruktureller Art<br />
sein. Dies belegt die Wichtigkeit einer möglichst flachen und flexiblen Organisations-<br />
struktur mit zentraler Projektleitung.
3.3 Umsetzung von <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en 27<br />
Eine klare Zuweisung von Verantwortlichkeiten ist bereits in den frühen Projektphasen<br />
unabdingbar. Hierfür erscheint insbesondere eine Kombination aus Matrix- und Stabli-<br />
nienorganisation sinnvoll. Innerhalb der Matrix ist eine klare Trennung von fachlich-<br />
inhaltlichen sowie technisch-infrastrukturellen Bereichen und dazugehörigen Kompe-<br />
tenzzentren möglich, sich überschneidende Bereiche für bereichsübergreifende Aufga-<br />
ben sind jedoch vorgesehen. Dadurch kann eine flexible Zuordnung von Aufgaben in-<br />
nerhalb des Gesamtprojektes erfolgen, was insbesondere für die Integration neuer Auf-<br />
gabenfelder in der Zukunft von besonderer Bedeutung ist. Durch verstärkt bereichs-<br />
übergreifendes Arbeiten wird die Kommunikation und die Transparenz innerhalb des<br />
Projektes gefördert sowie die Effektivität und Qualität erhöht.<br />
Weiterhin wird die Einrichtung einer lokalen Koordinationsstelle 20 dringend empfoh-<br />
len, wobei eine enge Bindung an das Projektmanagement vorteilhaft ist. Als zentrale<br />
Anlaufstelle für Lehrende und Lernende sollte ein Supportzentrum (Helpdesk) einge-<br />
richtet werden. Wegen der besonderen Schnittstellenfunktion zwischen Organisatoren,<br />
Entwicklern und Anwendern muss diesem Service-Center besondere Bedeutung beige-<br />
messen werden.<br />
Eine mögliche Form der Organisationsstruktur ist in Abbildung 3.2 aus Seite 28 dar-<br />
gestellt. Es ist zu beachten, dass die Ausprägung der einzelnen Aufgabengebiete sich<br />
aus den individuellen Anforderungen und Bedürfnissen der Hochschule ergeben. Daher<br />
muss auch die Organisationsstruktur diesen Bedingungen angepasst werden.<br />
Die technische Grundlage für eine erfolgreiche Modernisierung im Sinne der <strong>Notebook</strong>-<br />
<strong>Universität</strong> bildet die technische Infrastruktur. Insbesondere an Hochschulen mit hohen<br />
Studierendenzahlen stehen oft heterogene, gewachsene, technische und organisatorische<br />
Strukturen einer schnellen Umsetzung hemmend im Wege. Dennoch muss die Überwin-<br />
dung verwaltungstechnischer Hürden sowie die Errichtung einer möglichst hochkapazi-<br />
tiven, weit ausgebauten Netzwerkinfrastruktur angestrebt werden, was auf Grund der<br />
angespannten Haushaltslage der Hochschulen oft ein finanzielles Problem darstellt. So<br />
ist beispielsweise der Aufbau eines flächendeckenden drahtlosen Netzwerkes (WLAN)<br />
bei größeren Bildungseinrichtungen wegen der zunächst hohen Investitionskosten oft<br />
nur schwer umzusetzen. Permanente Fixkosten wie z.B. Personalkosten für Wartung<br />
und Betreuung müssen in ein tragfähiges Finanzierungskonzept einkalkuliert werden.<br />
Weiterhin müssen Rechenzentren und evtl. Teile der Verwaltungsstrukturen reorgani-<br />
siert werden, um für die Bewältigung der neuen Aufgaben vorbereitet zu sein.<br />
20 vgl. Tavangarian et al. 2001(a), S. 104
3.3 Umsetzung von <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en 28<br />
Management<br />
Projektleitung<br />
Koordinations−<br />
stelle<br />
Fachliche Leitung<br />
Fachgebiet 1<br />
Fachgebiet 2<br />
Fachgebiet 3<br />
Helpdesk<br />
Hardware<br />
Software<br />
Institutseigener<br />
Webserver<br />
−−−<br />
Auswahl<br />
eines CMS<br />
. . .<br />
Technische Leitung<br />
LAN/WLAN Internet Support<br />
. . . . . .<br />
Versorgung<br />
des Institutes<br />
mit LAN / WLAN<br />
. . . . . .<br />
Lehrende<br />
Lernende<br />
. . .<br />
fachliche Inhalte<br />
auf zentralem<br />
Webserver<br />
Losung<br />
technischer<br />
Umsetzungs−<br />
probleme<br />
Abbildung 3.2: Vorschlag einer Organisationsstruktur mit Beispielen für bereichsübergreifende<br />
Aufgabenkomplexe<br />
Auch wenn der Name „<strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>” direkt v.a. die technische Komponen-<br />
te betont, steht und fällt die moderne Hochschulbildung mit der didaktischen Quali-<br />
tät der fachlichen Inhalte und dem zugrundeliegenden Lernkonzept. 21 Die <strong>Notebook</strong>-<br />
<strong>Universität</strong> kann sich auch nur dann langfristig etablieren, wenn kontinuierlich an der<br />
fachspezifischen Umsetzung und Content-Erstellung gearbeitet wird, was im Rahmen<br />
der Nachhaltigkeit durch alle Projektbeteiligten sichergestellt werden muss. Eine lang-<br />
fristige Planung auch über Projektlaufzeiten hinaus muss daher gemeinsam mit der<br />
Hochschulleitung erarbeitet werden, um die Zukunft der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> durch<br />
Förderung der Contenterstellung und dessen erfolgreichen Einsatz in der Lehre abzu-<br />
sichern.<br />
21 vgl. Hendricks 2001, S. 34<br />
. . .<br />
. . .
Kapitel 4<br />
<strong>Notebook</strong>s-<strong>Universität</strong> — Ziele und<br />
Erwartungen der Wirtschaft<br />
Unter rein makroökonomischer Betrachtungsweise stellt die <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> in<br />
Deutschland eine öffentliche Institution dar, die v.a. nicht-monetäre Zielsetzungen ver-<br />
folgt (siehe Abschnitt 3.1). Sie ist Teil des Bildungsmarktes, i.w.S. Teil des E-Learning-<br />
Marktes, an dem Unternehmen der Wirtschaft dagegen monetäre Ziele verfolgen. Der<br />
Gesamtumsatz diese Marktes wird von dem internationalen Marktforschungsinstitut<br />
International Data Corporation (IDC) für 2004 auf 23 Mrd. USD geschätzt, wobei der<br />
Umsatz 1999 gerade bei 2 Mrd. USD weltweit lag, was das hohe Potential in Verbin-<br />
dung mit enormen Zuwachsraten dieses Marktes aufzeigt. 1 International Business Ma-<br />
chines (IBM) prognostiziert für den gleichen Zeitraum sogar ein Marktumsatzvolumen<br />
von weltweit 43 Mrd. USD, wobei neben den Kosten zur Erstellung von E-Learning-<br />
Inhalten auch Investitionen in Hardware, Software und infrastrukturelle Ausstattung<br />
berücksichtigt wurden. 2<br />
Besonders in den USA wird der E-Learning-Sektor als besonders lukrativ und profi-<br />
tabel eingeschätzt. 3 2003 wird ein Umsatz von 11,4 Mrd. USD nach IDC 4 und 15,0<br />
Mrd. USD nach Brandon Hall und Outsell erwartet, 5 was in Anbetracht der Zahlen für<br />
weltweite Umsatzerwartungen als sehr optimistisch bezeichnet werden muss (wenn eine<br />
nahezu gleiche Abgrenzung und Definition des E-Learning-Marktes unterstellt wird).<br />
1 vgl. Monitoring Informationswirtschaft 2002, S. 467<br />
2 vgl. Monitoring Informationswirtschaft 2002, S. 464<br />
3 vgl. Hendricks 2001, S. 12<br />
4 vgl. Schestak 2000, S. 326<br />
5 vgl. Monitoring Informationswirtschaft 2002, S. 464<br />
29
Der europäischen Markt entwickelte sich bisher deutlich langsamer als der Markt in den<br />
USA. Eine Ursache liegt vermutlich in der Tradition der weitgehenden Kostenfreiheit<br />
in den europäischen Bildungssystemen. In den USA ist dagegen der Dienstleistungs-<br />
charakter des Bildungsbereiches deutlich stärker ausgeprägt. So lag im Jahr 2000 der<br />
Umsatz in Deutschland bei gerade 106 Mio. USD und führt damit den europaweiten<br />
Umsatzvergleich an. Es folgen Großbritannien mit 84 Mio. USD und Frankreich mit<br />
74 Mio. USD (siehe Abbildung 4.1).<br />
Abbildung 4.1: Gesamtumsatz am E-Learning-Markt in Europa 2001. Quelle: IDC<br />
Betrachtet man jedoch die Pro-Kopf-Ausgaben, so liegen gerade diese traditionell<br />
bildungs-starken Länder im Vergleich abgeschlagen auf den hinteren Plätzen (siehe<br />
Abbildung 4.2). Insbesondere in den skandinavischen Ländern liegen die Ausgaben<br />
z.T. deutlich über den übrigen europäischen Vergleichswerten.<br />
Abbildung 4.2: Pro-Kopf-Ausgaben für E-Learning in Europa 2001. Quelle: IDC/NFO<br />
30
4.1 Ziele der Unternehmen 31<br />
Die sich aus diesen Betrachtungen ergebenden Potentiale bei angenommener weiterhin<br />
steigender Marktentwicklung sind Ursache für das aktive Engagement vieler global<br />
agierender Unternehmen an den nationalen und internationalen Bildungsmärkten.<br />
Zu den aktiv am Markt agierenden Wirtschaftszweigen gehören v.a. Unternehmen aus<br />
den Bereichen Hard- und Software, spezielle Anbieter für E-Learning-Content sowie<br />
weitere Dienstleister. Die Zielsetzungen dieser Unternehmen am E-Learning-Markt<br />
und insbesondere den <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en werden in Abschnitt 4.1 untersucht.<br />
Anschließend werden in Abschnitt 4.2 die Angebote und Leistungen in Hinblick auf<br />
mögliche Kooperationen mit <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en analysiert.<br />
4.1 Ziele der Unternehmen<br />
Bei mikroökonomischer Betrachtung und unter Berücksichtigung der Konzeption von<br />
<strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en zeigt sich, dass für die Untersuchung der Zielsetzungen von<br />
Wirtschaftsunternehmen zwei (Teil-)Märkte von besonderer Bedeutung sind: Zum einen<br />
können Unternehmen Anbieter auf dem Bildungsmarkt sein, dessen direkter Hauptab-<br />
nehmer im Rahmen der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en die Hochschulen sind (siehe Abbildung<br />
4.3 oben). Infrastrukturelle Ausrüstungen, spezielle Hard- und Softwarelösungen sowie<br />
Dienstleistungen im Rahmen der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> werden an diesem Markt ge-<br />
handelt. Dieser wird der Einfachheit halber im folgenden als Markt „Hochschule”<br />
bezeichnet. Es handelt sich hierbei um einen bereits etablierten Markt, der im Zuge<br />
von ständig modifizierten Rahmenbedingungen einem permanenten Änderungsprozess<br />
unterworfen ist.<br />
Zum anderen erhält der Markt für mobile Computersysteme aus Sicht der Unternehmen<br />
durch die zunehmende Integration von <strong>Notebook</strong>s in die Lehre neues Kundenpotential:<br />
Der Kreis der Nachfrager wird um die Studierenden erweitert. Aus Sicht der Hochschu-<br />
len entsteht somit ein neuer Markt: Für das E-Learning ausgelegte mobile Endgeräte<br />
werden durch den Wissenskonsumenten nachgefragt.<br />
Letztlich ist es eine Frage der Betrachtungsweise, ob ein neuer Markt entstanden ist<br />
oder der Bestehende sich nur verändert bzw. sein Abnehmerkreis sich erweitert hat.<br />
Wegen der besseren Abgrenzbarkeit wird im Rahmen dieser Arbeit der Studierende als<br />
Markt betrachtet, worin es selber die Rolle des Abnehmers einnimmt. Im folgenden wird<br />
hierfür die Bezeichnung Markt „Studierende” verwendet. Hier werden v.a. Hard- und
4.1 Ziele der Unternehmen 32<br />
Softwareprodukte sowie Dienstleistungen aus den Bereichen Service und Support nach-<br />
gefragt. Besonders Unternehmen aus dem Bereich mobiler Hardware agieren hier als<br />
Anbieter.<br />
Abbildung 4.3 veranschaulicht die beiden Märkte im Umfeld der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>,<br />
wobei hier eine Abgrenzung in personeller Hinsicht, also nach Anbietern und Nachfra-<br />
gern, stattfindet: 6<br />
Anbieter:<br />
Hardwarehersteller<br />
Softwarehersteller<br />
Dienstleister<br />
Anbieter:<br />
Hardwarehersteller<br />
Softwarehersteller<br />
Dienstleister<br />
Markt<br />
"Hochschule"<br />
Markt<br />
"Studierende"<br />
direktes Agieren indirektes Agieren<br />
Nachfrager:<br />
Hochschulen<br />
Studierende<br />
Nachfrager:<br />
Hochschulen<br />
Studierende<br />
Abbildung 4.3: Märkte im Umfeld von <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en<br />
Eine besondere Rolle auf den Märkten nehmen die Hersteller von mobiler Hardware<br />
(v.a. <strong>Notebook</strong>s) ein, da sie über direkten Zugang zu den beiden Kundengruppen verfü-<br />
gen. Über sie werden auch Softwareprodukte (z.B. Betriebssystem, Standardanwendun-<br />
gen, Tools...) sowie Serviceleistungen (Produktsupport, Schulungsangebote, Updates...)<br />
anderer Unternehmen vertrieben, die insbesondere am „Markt Studierende” nur indi-<br />
rekt agieren. Der Abnehmer erhält dort ein Leistungsbündel aus Komplementärgütern<br />
aus einer Hand. 7<br />
6 Eine sachliche oder räumliche Abgrenzung erscheint dagegen hier für die Untersuchung der Zielsetzungen<br />
weniger sinnvoll: Eine sachliche Abgrenzung würde zu einer Vielzahl von zu unterscheidenden<br />
Märkten führen. Die sich schließlich ergebenden Zielsetzungen sind jedoch gleich, da diese ja<br />
nicht von der Betrachtungsweise abhängen. Eine räumliche Abgrenzung ist kaum möglich, da die<br />
Märkte über keine realen räumlichen Grenzen verfügen; der Markt kann beispielsweise vollständig<br />
über das Internet abgewickelt werden.<br />
7 vgl. Wöhe 1996, S. 632
4.1 Ziele der Unternehmen 33<br />
Da die Hochschulen vorwiegend eigene Lehr- und Fachinhalte für mobile und flexi-<br />
ble Unterrichtsszenarien gestalten, ist die direkte Nachfrage nach E-Learning-Inhalten<br />
durch Studierende eher gering und die Zielgruppe somit für Content-Anbieter von wenig<br />
Interesse. Hochschulen stellen dagegen potentielle Kunden dar, wenn die Vorstellung<br />
von fachlichem Inhalt und didaktischem Konzept auf beiden Seiten deckungsgleich sind<br />
oder entsprechend angepasst werden können.<br />
Bisher hat sich jedoch gezeigt, dass ein Großteil der E-Learning-Produzenten sich v.a.<br />
auf die Entwicklung und Bereitstellung von Standard-Inhalten konzentrieren und somit<br />
hochspezialisierte Angebote für die Ausbildung an Hochschulen fehlen.<br />
Bei der ökonomischen Untersuchung der Zielsetzungen müssen monetäre und nicht-<br />
monetäre Zielsetzungen unterschieden werden: 8<br />
Zu den allgemeinen monetären Zielen gehören v.a. das Gewinnstreben, das Umsatz-<br />
streben sowie die langfristige Gewinnmaximierung. Diese drei grundlegenden ökono-<br />
mische Ziele können durch absatzorientiertes Marketing verfolgt werden. Die mone-<br />
tären Zielsetzungen und Beispiele für deren Umsetzung im Rahmen von <strong>Notebook</strong>-<br />
<strong>Universität</strong>en zeigt Tabelle 4.1.<br />
monetäre Zielsetzung Beispiele<br />
Umsatzstreben • Umsatzsteigerungen können durch die Erschließung des Marktes<br />
„Studierende” realisiert werden<br />
Gewinnstreben • Gewinnsteigerungen können durch die Erschließung des Marktes<br />
„Studierende” sowie durch Vergrößerung der Marktanteile realisiert<br />
werden, wobei jedoch die finanzielle Situation der Zielgruppe<br />
beachtet werden muss. Durch hohe Rabatte werden Gewinne reduziert.<br />
langfristige<br />
Gewinnmaximierung<br />
8 vgl. Wöhe 1996, S. 125<br />
• Ergibt sich aus einer Summe anderer Zielsetzungen, z.B. dem Gewinnstreben,<br />
der langfristigen Kundenbindung und dem Streben<br />
nach Prestige<br />
Tabelle 4.1: Monetäre Zielsetzungen mit Beispielen für deren Umsetzung
4.1 Ziele der Unternehmen 34<br />
Im folgenden wird eine grobe Abschätzung des Marktpotentials für <strong>Notebook</strong>s durch-<br />
geführt, deren genaue Werte weniger wichtig sind als die ungefähre Absatzdimension:<br />
Abschätzung:<br />
In Deutschland studieren derzeit knapp 1,9 Mio. Menschen, 9 wovon sich ca.<br />
360.000 Studierende pro Jahr in ihrem ersten Hochschulsemester befinden. 10 Ein<br />
Teil (ca. 16%) der Lernenden ist bereits mit mobilen Computersystemen ausgestattet<br />
und tritt zunächst nicht am Markt als Kunde auf. 11<br />
Wenn durch die aktive Förderung von Seiten der Hochschulen das Interesse der<br />
Studierenden verstärkt und ein durchschnittlicher Durchdringungsgrad von 15%<br />
bei den übrigen Studierenden erreicht werden könnte, beträgt die Anzahl der potentiellen<br />
nachgefragten Geräte ca. 45.000 Stück. 12<br />
Auch die Lebens- bzw- Nutzungsdauer der Geräte muss im Verhältnis zur durchschnittlichen<br />
Studiendauer an deutschen Hochschulen beachtet werden: Bei einer<br />
durchschnittlichen Gesamtstudiendauer von 12 Semestern 13 und einer angenommenen<br />
Lebens- bzw. Nutzungsdauer von 3 Jahren (eigene Schätzung) würden<br />
statistisch gesehen zwei Geräte pro Student und Studium am Markt nachgefragt<br />
werden. In der Summe ergibt sich dadurch eine jährliche Gesamtnachfrage von<br />
90.000 Geräten allein als Folge der Modernisierungen in der Lehre.<br />
Diese Zahlen belegen das Interesse der Hardwarehersteller am Markt „Studierende”<br />
und somit auch am Konzept der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>, welches die o.g. Entwicklung<br />
fördert: Umsatzzuwächse sind durch das Erschließen neuer Käufergruppen zu erzielen.<br />
Gewinnzuwächse sind dagegen v.a. von der Höhe eingeräumter Rabatte und den Mark-<br />
terschließungskosten abhängig.<br />
Das Ziel der langfristigen Gewinnmaximierung ergibt sich aus einer Summe anderer,<br />
u.a. auch nicht-monetärer Zielsetzungen wie beispielsweise der langfristigen Kunden-<br />
bindung.<br />
Zu den möglichen nicht-monetären Zielen der Unternehmen gehören u.a. die Er-<br />
schließung neuer Märkte, die Marktanteilsvergrößerungen, das Erreichen von Wachs-<br />
9 vgl. Statistische Bundesamt, http://www.destatis.de/basic/d/biwiku/hochtab2.htm (2002/03),<br />
letzter Zugriff am 21.5.2003<br />
10 vgl. Statistische Bundesamt Deutschland, http://www.destatis.de/basic/d/biwiku/hochtab3.htm<br />
(2002/03), letzter Zugriff am 21.5.2003<br />
11 Tavangarian ermittelte hier bei einer Umfrage an der <strong>Universität</strong> Rostock 2001 einen Anteil von<br />
16% unter den Studierenden<br />
12 Der Durchdringungsgrad von Studierenden mit <strong>Notebook</strong>s wird natürlich auch durch „äußere”<br />
Faktoren beeinflusst, beispielsweise durch weitere Leistungssteigerungen, Preisentwicklungen, Substitutionseffekte<br />
sowie eigene Bedürfnissen unabhängig vom Studium. Es ist anzunehmen, dass der<br />
Anteil an vorhandenen <strong>Notebook</strong>s in der Bevölkerung insgesamt mittelfristig weiter zunimmt.<br />
13 vgl. Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 5.9.2001, http://www.destatis.de/presse/<br />
deutsch/pm2001/p3060071.htm, letzter Zugriff am 21.5.2003
4.1 Ziele der Unternehmen 35<br />
tumszielen, das Streben nach Prestige, die langfristige Kundenbindung und die Einhal-<br />
tung traditioneller Handlungsweisen.<br />
Die zunehmende Verbreitung von <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en in Deutschland kommt der<br />
Verfolgung dieser Ziele entgegen: Durch die allgemeine Modernisierung der Lehr- und<br />
Lernmethoden wird eine erhöhte Nachfrage auf dem E-Learning-Markt im Allgemeinen<br />
und dem oben definierten Markt „Studierende” im Speziellen geschaffen. Es ist daher<br />
nun das Ziel vieler Unternehmen, mit möglichst großen Anteilen an den neuen, stark<br />
wachsenden Märkten vertreten zu sein.<br />
Weiterhin bewirkt ein aktives und öffentliches Engagement im Bildungbereich oft-<br />
mals positive Auswirkungen aus das Ansehen des Unternehmens, was wiederum einen<br />
Prestige- und Imagegewinn darstellt. Auch aus diesen Gründen unterstützen bereits<br />
viele kapitalträchtige Konzerne die Bildungseinrichtungen durch Sponsoring in unter-<br />
schiedlichster Ausprägung.<br />
Auch die Aussichten, innerhalb der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en ein akquisitorisches Po-<br />
tenzial von v.a. jungen Menschen mit hohem Ausbildungsniveau vorzufinden, die in<br />
ihrer Zukunft einerseits zu den Besserverdienenden gehören und andererseits beispiels-<br />
weise auch an Investitionsentscheidungen teilhaben werden, fördert das Interesse der<br />
Unternehmen nachhaltig, da es sich auch um langfristig gewinnbringende Investitionen<br />
handelt.<br />
In Tabelle 4.1 werden allgemeine betriebswirtschaftliche Zielsetzungen aufgeführt und<br />
ihre mögliche Umsetzung innerhalb von <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en beispielhaft darge-<br />
stellt.<br />
Neben diesen rein wirtschaftlichen Zielsetzungen gibt es abstrakte Ziele wie beispiels-<br />
weise das Interesse an einem hohen Ausbildungsniveau der Absolventen oder der hohen<br />
Medienkompetenz innerhalb der Gesellschaft (siehe Abschnitt 2.1). Solche Ziele können<br />
auch als ideelle Ziele bezeichnet werden.<br />
Obwohl es sich hierbei i.w.S. um nicht-monetäre Zielsetzungen handelt, werden diese<br />
hier auf Grund des besonders hohen Abstraktionsgrades gesondert genannt. Das Errei-<br />
chen solcher Ziele ist oft weniger vom einzelnen Unternehmen als vielmehr vom Agieren<br />
ganzer Branchen oder Wirtschaftsverbände abhängig.
4.1 Ziele der Unternehmen 36<br />
nicht-monetäre<br />
Zielsetzung<br />
Erschließung<br />
neuer Märkte<br />
Vergrößerung<br />
von Marktanteilen<br />
Erreichen<br />
von Wachstumszielen<br />
Beispiele<br />
• Erschließung des Marktes „Hochschule”<br />
• Erschließung des neu entstandenen Marktes „Studierende”<br />
• Vergrößerung der Anteile auf den Märkten „Hochschule” und<br />
„Studierende”<br />
• Verdrängung von Wettbewerbern durch Marktübernahme<br />
• Langfristige Etablierung auf den o.g. Märkten<br />
• Wachstum durch Expansion: Aufbau neuer Vertriebsstrukturen<br />
für den Markt „Studierende”<br />
• Wachstum durch Übernahme von Unternehmen, die auf diesen<br />
Märkten als Anbieter agieren, z.B. die Übernahme von E-<br />
Learning-Produzenten durch Hardwarehersteller<br />
Streben nach Prestige • Ergibt sich aus der Tatsache, dass öffentliches Engagement im<br />
Bildungsbereich das äußere Ansehen von Unternehmen positiv<br />
beeinflusst und auch werbewirksam umgesetzt werden kann.<br />
langfristige<br />
Kundenbindung<br />
Fortsetzen traditioneller<br />
Handlungsweisen<br />
Einführung neuer<br />
Produkte und Technologien<br />
• Durch guten Service und Produktsupport wird eine langfristige<br />
Kundenbindung initiiert. Positive Erfahrungswerte auf Seiten<br />
der Nachfrager werden durch diese auch unternehmensweit auf<br />
andere Produkte bezogen. Dies ist insbesondere deshalb sehr<br />
wichtig, weil die Nachfrager auf dem Markt „Studierende” zukünftig<br />
auch als Nachfrager auf anderen Märkten agieren können.<br />
• Bereits in der Firmenhistorie entstandene Verflechtungen zwischen<br />
Forschungs- und Entwicklungsbereich und den Hochschulen<br />
können weiter intensiviert werden.<br />
• Neue Technologien und Produkte können in großen hochschulweiten<br />
Feldversuchen erprobt und weiterentwickelt werden. Zusätzlich<br />
steigt der Bekanntheitsgrad für die neuen Technologien<br />
und Produkte durch fachlich weit gefächerte Anwenderkreise.<br />
Tabelle 4.2: Nicht-monetäre Zielsetzungen mit Beispielen der Umsetzung im Rahmen von<br />
<strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en
4.2 Angebote und Leistungen der Unternehmen 37<br />
4.2 Angebote und Leistungen der Unternehmen<br />
Nachdem die Ziele seitens der Industrie untersucht wurden, stellt sich die Frage nach<br />
konkreten Möglichkeiten der Zielerreichung. Werden gänzliche Umorientierung bzw.<br />
Neuausrichtung von Unternehmen von der ersten Betrachtung ausgeschlossen, wird das<br />
Agieren an den Märkten zunächst durch die vorhandene unternehmenseigene Produkt-<br />
und Dienstleistungspalette begrenzt: Angebote und Leistungen, die an anderen Märk-<br />
ten angeboten werden, können teilweise auch an den Märkten im Umfeld der <strong>Notebook</strong>-<br />
<strong>Universität</strong>en angeboten werden und dort zur Sicherung von Marktanteilen beitragen.<br />
Diese Angebote umfassen u.a.:<br />
• Verkauf von Hard- und Software (auch: Vermietung, Leasing...)<br />
• Bereitstellung von Service- und Supportleistungen<br />
• Bereitstellung spezieller Dienste und Infrastrukturen<br />
• Weitere Angebot im Bereich allgemeiner Dienstleistungen<br />
Für die Hersteller mobiler Computersysteme liegt es nahe, v.a. mit besonders lu-<br />
krativen <strong>Notebook</strong>-Angeboten an die relativ kapitalschwache Käuferschaft von<br />
Studierenden heranzutreten und so das Interesse für die eigenen Produkte zu wecken.<br />
Besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist die Abstimmung der hard- und soft-<br />
waretechnischen Ausstattung der Geräte auf die zu erwartenden Anforderungen in-<br />
nerhalb der Ausbildungsstätten bzw. Ausbildungszeit. Dies setzt jedoch weitergehen-<br />
de Kenntnisse über den Bildungsbereich und speziell das Konzept von „<strong>Notebook</strong>-<br />
<strong>Universität</strong>en” voraus. Dieses Wissen kann durch Dialoge mit Bildungseinrichtungen<br />
erworben bzw. aktualisiert werden (siehe Kapitel 5).<br />
Für den speziellen Kundenkreis der Studierenden können individuelle Software- oder<br />
Zubehörpakete bereitgestellt und besondere Serviceleistungen angeboten wer-<br />
den. Die räumliche Konzentration der Kunden und Nutzer an zentralen Hochschul-<br />
standorten kann hierbei zu besonderer Effektivität für beide Seiten führen, wie im<br />
nächsten Kapitel noch aufgezeigt wird.<br />
Da die meisten Hardwarehersteller sich nicht nur auf die Produktion und den Vertrieb<br />
von mobilen Computern beschränken, sondern über eine horizontale Produktdiversifi-<br />
zierung verfügen, können der Käuferschaft auch marktfremde Produkte wie beispiels-<br />
weise stationäre Heim-PC’s, einzelne Computer-Komponenten oder Schulungsangebote
4.2 Angebote und Leistungen der Unternehmen 38<br />
präsentiert werden, was zu weiteren Umsatzsteigerungen und Marktanteilsvergrößerun-<br />
gen führen kann. Hiervon profitieren besonders diejenigen Unternehmen, welche auf<br />
Grund verhältnismäßig hochwertiger und preisgehobener Produkte eher weniger im<br />
Interesse dieser Käuferschaft stehen.<br />
Durch die Bedienung des Marktes „Studierende” rücken die Hardwarehersteller au-<br />
ßerdem auch weiter in den Blickpunkt des Interesses der Hochschulen: Auch ih-<br />
re Nachfrage nach Computersystemen verschiedenster Art wie Arbeitsplatzrechnern,<br />
Forschungs- und Entwicklungsumgebungen sowie spezieller Servertechniken für den<br />
Betrieb innerhalb der Bildungseinrichtung kann großteils von diesen Unternehmen be-<br />
dient werden. Natürlich spielen hier auch vorhandene Geschäftsbeziehungen, gesammel-<br />
te Erfahrungswerte sowie die Preispolitik eine große Rolle; Ausschreibungsvorschriften<br />
grenzen die Entscheidungsfreiheit der Verantwortlichen auf Seiten der Hochschulen für<br />
große Investitionen zusätzlich ein. Dennoch verbessern sich die Chancen der am Markt<br />
„Studierende” engagierten Unternehmen, auch Hochschulen als Kunden zu gewinnen<br />
und somit weitere Umsatzzuwächse zu realisieren.<br />
Die Hochschulen können auch als Abnehmer von Dienstleistungen in Frage kom-<br />
men: technischer Support für die hochschuleigene IT-Ausstattung, Wartungsverträge<br />
für hochverfügbare Netzwerk-Komponenten sowie die allgemeine Unterstützung bei der<br />
Einführung neuer Technologien oder informationstechnischer Umstrukturierungsmaß-<br />
nahmen sind einigen Beispiele.<br />
Auch stabile und leistungsstarke Plattformen für internetbasiertes E-Learning kön-<br />
nen hard- und softwareseitig vermarktet werden, wenn Hochschulen als reine Content-<br />
Produzenten fungieren. In diesem Zusammenhang ist auch die Vermarktung bereits<br />
vorhandener E-Learning-Produkte und -Inhalte aus firmeninternen oder externen Schu-<br />
lungsmaßnahmen grundsätzlich möglich, wenn fachliche und didaktische Übereinstim-<br />
mung besteht. Dies führt insbesondere dann zu Synergieeffekten, wenn die Hochschulen<br />
im Zuge ihrer Modernisierung als Anbieter auch auf dem Weiterbildungsmarkt auftre-<br />
ten und daher neue fachliche und didaktische Anforderungen im Hinblick auf eine<br />
neue Zielgruppe von Lernenden umzusetzen haben. Hier können auch Dienstleistun-<br />
gen zur Unterstützung dieser Entwicklung nachgefragt werden, etwa die Bereitstellung<br />
von Erfahrungen in der Content- und Softwareentwicklung für das E-Learning aus den<br />
Unternehmen.
4.2 Angebote und Leistungen der Unternehmen 39<br />
Dienstleistungen im Bereich des Projektmanagement können von besonderem In-<br />
teresse für Hochschulen sein, da an diese verstärkt die Forderung nach wirtschaft-<br />
lich effizienteren Projektrealisierungen gestellt wird. So wäre es beispielsweise denk-<br />
bar, Wirtschaftsunternehmen in ein Projekt-Controlling mit einzubeziehen, um finan-<br />
zielle Risiken für die Hochschule zu verringern und eine langfristige Kostenkontrolle<br />
zu etablieren. In den USA werden in diesem Zusammenhang bereits „Total Cost of<br />
Ownership”-Ansätze gewählte, um die laufenden Kosten der IT-Bereiche von Schulen<br />
zu analysieren. 14 Solche Untersuchungen fallen zwar v.a. in den Kernkompetenzbe-<br />
reich der Wirtschaftsberatungen, werden aber im Rahmen der Kundenberatung auch<br />
von vielen anderen großen Unternehmen als zusätzlicher Service angeboten, um das<br />
Vertrauen und die Zufriedenheit der Kundschaft zu erhöhen.<br />
Durch das breiten Leistungsspektrum großer Unternehmen ergeben sich eine Vielzahl<br />
möglicher verschiedenartiger Kooperationsformen, die im nächsten Kapitel vorgestellt<br />
werden.<br />
14 vgl. Klaus 2001, S. 10
Kapitel 5<br />
Integrationsszenarien: Die Industrie<br />
als Partner<br />
Die Umsetzung mobiler und multimedialer Lehr- und Lernszenarien stellt für die Uni-<br />
versitäten einen enormen zusätzlichen Aufwand dar, für den i.a. aber keine zusätzlichen<br />
Mittel zur Verfügung stehen. Viele Hochschulen bemühen sich daher um geeignete Ko-<br />
operationen zur Bewältigung der gewachsenen Aufgaben.<br />
Eine naheliegende Kooperationsform ist dabei zunächst die Zusammenarbeit zwischen<br />
verschiedenen Hochschulen. So nutzt beispielsweise die TU Cottbus u.a. das Modell<br />
zur <strong>Notebook</strong>-Versorgung der TU <strong>Berlin</strong> (Projekt „Moses”), welches wiederum auf ein<br />
bereits länger bestehendes Umsetzungkonzept der ETH Zürich aufbaut (Projekt „Nep-<br />
tun”), und die entwickelte Plattform des Open-Source-Projektes Miless 1 der Universi-<br />
tät Essen wird als digitale Bibliothek auch an vielen anderen Hochschulen eingesetzt.<br />
In der Zukunft ist zudem eine verstärkte Zusammenarbeit im fachspezifisch-inhaltlichen<br />
Bereich zu erwarten, weil die notwendigen technischen und infrastrukturellen Grund-<br />
lagen einer „<strong>Universität</strong> der Zukunft”, die den Einsatz solcher neuen Materialien über-<br />
haupt erst zulassen, zunehmend mehr zur Verfügung stehen.<br />
Diese Bemühungen erfassen jedoch nur einen Teil des komplexen Problems der Neuord-<br />
nung des Bildungsmarktes, nämlich die Modernisierung der Lehr- und Lernszenarien.<br />
Um auch den gesellschaftlichen Veränderungen wie der Verschmelzung von Arbeits-<br />
und Lernwelt und dem lebenslangen Lernen gerecht zu werden, müssen auch Koope-<br />
1 Multimedialer Lehr- und Lernserver Essen, http://miless.uni-essen.de<br />
40
5.1 Fachliche Kooperationen 41<br />
rationen mit am Bildungsmarkt agierenden Wirtschaftsunternehmen eingegangen wer-<br />
den. Erfahrungen am Markt und Kenntnisse über Kunden und Kundenpotentiale sind<br />
für eine Neuausrichtung von Hochschulen zukünftig von hoher Bedeutung. Kenntnisse<br />
professioneller Projektplanung und -durchführung sowie marktwirtschaftlicher Praxis<br />
zum Agieren an offenen Märkten fehlen jedoch oft an Hochschulen und können dem<br />
Erreichen angestrebter Ziele entgegenstehen (siehe Abschnitt 3.1). 2<br />
Auch Partnerschaften für Aufgaben im technischen und organisatorischen Bereich wie<br />
etwa der Versorgung der Studierenden mit <strong>Notebook</strong>s oder der WLAN-Ausstattung<br />
der Hochschule können sich positiv auswirken, da hier stark ausgeprägte Kompetenzen<br />
im Bereich der Wirtschaft vorliegen, die an Hochschulen oft erst mühsam erarbeitet<br />
werden müssen.<br />
Im letzten Kapitel wurden dagegen die Ziele der Unternehmen untersucht, welche Ko-<br />
operationen mit Hochschulen und ein Engagement an den <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en er-<br />
folgversprechend erscheinen lassen (siehe Abschnitt 4).<br />
Im Folgenden werden daher konkrete Kooperationsmaßnahmen von Hochschulen und<br />
Industrie in den Bereichen Technik, Content und Organisation vorgestellt und genauer<br />
untersucht. Dabei werden auch bereits vorhandene Lösungen einzelner Hochschulen<br />
berücksichtigt und ggf. Vorschläge für Verbesserungen gemacht.<br />
5.1 Fachliche Kooperationen<br />
In diesem Abschnitt sollen Kooperationsmöglichkeiten erörtert werden, die im direkten<br />
Zusammenhang mit den E-Learning-Inhalten stehen. Der Begriff „Fachliche Kooperati-<br />
on” prägt hier die Sichtweise der Hochschulen und ist äquivalent zu einer „inhaltlichen<br />
Kooperation” zu verstehen.<br />
Hierfür werden in Abschnitt 5.1.1 Formen der Zusammenarbeit im Bereich der Spe-<br />
zifikation und Entwicklung von E-Learning-Plattformen betrachtet. Abschnitt 5.1.2<br />
befasst sich mit der kooperativen Entwicklung fachspezifischer Softwareprodukte, und<br />
schließlich wird im Abschnitt 5.1.3 der Vorgang der Wissenserstellung für E-Learning-<br />
Umgebungen auf mögliches Kooperationspotential untersucht.<br />
2 vgl. Wagner 2000, S. 397
5.1 Fachliche Kooperationen 42<br />
Die Kooperationsmöglichkeiten ergeben sich hier im fachlich-inhaltlichen Bereich nur<br />
teilweise innerhalb der Realisierung der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>, da in diesen Projekten<br />
i.d.R. ein deutlicher Schwerpunkt im Bereich der infrastrukturellen Aufgabenstellun-<br />
gen vorliegt. Allerdings sind die Inhalte eine wichtige Voraussetzung für eine sinnvolle<br />
Umsetzung von <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en und werden deshalb an dieser Stelle betrach-<br />
tet. Die innerhalb des Projektes entwickelten Lösungen sowie der individuelle Erfah-<br />
rungsschatz für den Bereich des E-Learning stellen die Grundlage sich anschließender<br />
Kooperationen auf fachlicher Ebene dar.<br />
5.1.1 Spezifikation und Entwicklung von E-Learning-Plattformen<br />
Für das Erstellen und Verwalten von Wissensbausteinen werden v.a. Web-gestützte<br />
E-Learning-Plattformen eingesetzt. Dass diese auf dem Markt verfügbaren Systeme<br />
für den Aufbau von E-Learning-Umgebungen an Hochschulen nur begrenzt geeignet<br />
sind, ergibt sich aus der Tatsache, dass die dem Systemdesign zugrundeliegenden Spe-<br />
zifikationen sich je nach fachlichem Anwendungsbereich und gefordertem Anspruch<br />
stark unterscheiden: Sollen in einem Unternehmen Kenntnisse zur Durchführung eines<br />
Geschäftsprozesses mit Hilfe einer neuen Softwarelösung durch E-Learning vermittelt<br />
werden, reicht i.A. eine lineare Wissensvermittlung aus, die am Ablauf des Prozes-<br />
ses orientiert ist (Beispiel: Online-Tutorium für einen Bestellvorgang mit SAP R/3).<br />
Hochschulen benötigen dagegen Werkzeuge, die innerfachlich, d.h. nach fachlichen Ver-<br />
knüpfungen strukturiertes Wissen bereitstellen.<br />
Ein Beispiel aus dem Bereich der Mathematik soll dieses Problem veranschaulichen:<br />
Aufgabe: • Erarbeiten von Kenntnissen zur Lösung eines linearen Gleichungssystems<br />
Lösung A:<br />
(Auszug)<br />
Lösung B:<br />
(Auszug)<br />
• ...<br />
• Herleitung über die Definition elementarer Zeilen- und Spaltenumformungen<br />
• ...<br />
• ...<br />
• Herleitung über die Einführung der Elementarmatrizen<br />
• ...<br />
Tabelle 5.1: Beispiel einer Aufgabenstellung mit nicht-linearen Lösungswegen
5.1 Fachliche Kooperationen 43<br />
Hier gibt es für die Herleitung und Begründung der Lösung durch den allgemein be-<br />
kannten Gauss-Algorithmus verschiedene Möglichkeiten: Die Definition der elementa-<br />
ren Zeilen- und Spaltenumformungen oder die Einführung der Elementarmatrizen. Es<br />
gibt daher mindestens zwei mögliche Lernpfade, oftmal deutlich mehr. Für die Umset-<br />
zung von Lerneinheiten sind dann nicht-lineare Navigationsstrukturen vorzusehen, wie<br />
sie in Abbildung 5.1 dargestellt sind.<br />
D<br />
+<br />
T L<br />
+<br />
A<br />
M<br />
Al<br />
D<br />
T T<br />
A<br />
T<br />
T<br />
A<br />
D<br />
+<br />
T L<br />
+<br />
A<br />
M<br />
Al<br />
D<br />
T<br />
T<br />
T T<br />
A<br />
A<br />
Links: Lernpfad 1<br />
Lösung des LGS durch Definition<br />
elementarer Zeilen− und Spalten−<br />
umformungen<br />
Rechts: Lernpfad 2<br />
Lösung des LGS durch Definition<br />
von Elementarmatrizen<br />
Legende:<br />
M<br />
D<br />
T<br />
L<br />
Al<br />
A<br />
Motivation<br />
Definition<br />
Theorem<br />
Lemma<br />
Algorithmus<br />
Anwendung<br />
gewählter (aktiver) Lernpfad<br />
Abbildung 5.1: Ein nichtlinearer Lernprozess am Beispiel der Herleitung des Gauss-<br />
Algorithmus: Durch die Existenz zweier verschiedener, im Lernprozess paralleler Definitionen<br />
entstehen unterschiedliche Lernpfade, die hier visualisiert sind. 3<br />
Dies zeigt, dass an die Entwicklung hochschulgeeigneter E-Learning-Umgebungen an-<br />
dere und teilweise neuartige Anforderungen gestellt werden, denen bisher oft nur wenig<br />
oder keine Beachtung geschenkt wurde. Weitere Beispiele hierfür sind das Ausbilden<br />
von Schnittstellen zu fachbezogenen Softwareprodukten wie Mathematica, Maple und<br />
Cinderella im Bereich der Mathematik und Physik sowie AutoCAD und Solid Edge im<br />
Bereich der Ingenieurswissenschaften. Hierbei handelt es sich teilweise um fachspezifi-<br />
sche Produkte, die nur punktuell eingesetzt werden können und deren Anwendung da-<br />
her oft nur an Hochschulen oder in hochspezialisierten Betrieben sinnvoll ist. Dennoch<br />
sind gerade diese Werkzeuge insbesondere durch den Anspruch der Modernisierung der<br />
3 Quelle: Jeschke, S. / Zorn 2002, S. 4 und S. 7
5.1 Fachliche Kooperationen 44<br />
Lehre und der Anpassung der Lerninhalte für E-Learning-Umgebungen im Hochschul-<br />
bereich von besonderer Wichtigkeit.<br />
Auch das Darstellen komplexer Formeln in HTML-Dokumenten stellt im naturwissen-<br />
schaftlichen Bereich ein großes Problem dar, und so wird an den Hochschulen verstärkt<br />
an einer Integration von L ATEX mit Hilfe von XML/MathML gearbeitet. 4 Eigenstän-<br />
dige Aktivitäten zum Schließen dieser „Produktlücke” von Seiten der Softwareindustrie<br />
bleiben dagegen bisher wohl v.a. wegen des Nachfragemangels ihrer Kunden nach ent-<br />
sprechenden Lösungen aus.<br />
Kommerzielle E-Learning-Plattformen sollen nach Vorstellung der Hersteller ein mög-<br />
lichst breites Marktsegment bedienen, um die hohen Entwicklungskosten auf eine große<br />
Absatzmenge umzulegen zu können. Es zeigt sich aber, dass diese Produkte individu-<br />
ellen Anforderungen oft nicht genügen, wie am Beispiel der Hochschulen ausgeführt<br />
wurde.<br />
Es muss in diesem Zusammenhang auch festgestellt werden, dass der Umgang mit Wis-<br />
sen und Wissenbausteinen allgemein sowie deren fachliche Ordnung und Verwaltung<br />
ebenso wie die Entwicklung zugehöriger didaktischer Lernkonzepte im Kernkompetenz-<br />
bereich der Hochschulen und nicht in dem von Unternehmen liegt.<br />
Für die Entwicklung individuell angepasster Lernumgebungen ergibt sich daher<br />
ein besonders großes Kooperationspotential: Die Hochschulen könnten hier insbesonde-<br />
re bei der Spezifikation Kenntnisse, Konzepte und Lösungsmodelle einbringen, welche<br />
die Entwicklung von wissensspezifischen Lernplattformen ermöglicht, die auch beson-<br />
deren Anforderungen genügen. Die Implementation kann sowohl an der Hochschule als<br />
auch im beteiligten Unternehmen stattfinden. Das so entstandene Produkt kann an<br />
verschiedenen Bildungseinrichtungen gleichermaßen zum Einsatz kommen: Insbeson-<br />
dere alle Arten von Schulen und Hochschulen zählen zu den potentiellen Abnehmern.<br />
Die Vermarktung, Einführung und Weiterentwicklung kann von unternehmerischer Sei-<br />
te erfolgen.<br />
Abbildung 5.2 zeigt am vereinfachten Phasenmodell die Aufgabenteilung bei der ko-<br />
operativen Entwicklung einer E-Learning-Plattform.<br />
4 Bisher ist eine Umsetzung nur durch Medienbrüche möglich: Die mit L ATEX erzeugte dvi-Datei muss<br />
in ein internetfähiges Bildformat transformiert und schließlich in den HTML-Quellcode eingefügt<br />
werden.
5.1 Fachliche Kooperationen 45<br />
Phasen<br />
Projektverlauf<br />
Aufgaben−<br />
verteilung<br />
Projekt: Entwicklung einer speziellen E−Learning−Plattform<br />
Spezifikation<br />
Kompetenzbereich<br />
der Hochschule<br />
Implementierung<br />
Weiterentwicklung<br />
Verwertung<br />
Kompetenzbereich<br />
des Unternehmens<br />
Abbildung 5.2: Beispiel für eine kooperative Entwicklung einer E-Learning-Plattform.<br />
Hier sind die fach- und wissensabhängigen Aufgabenstellungen ausgewählt.<br />
Es gibt aber auch ein starkes Interesse großer Konzerne, das eigene Wissen in elek-<br />
tronischer Form zu sammeln, zu verwalten und abzurufen, um durch einen gezielten<br />
schnellen Zugriff auf den vorliegenden Wissenbestand Probleme zu erkennen, Risiken zu<br />
minimieren oder erfolgreiche Handlungsweisen zu analysieren. Hier zeigt sich, wie eng<br />
das sog. Wissenmanagement und die hier erörterte Thematik des E-Learning zusam-<br />
menliegen. Gerade für die Durchführung derartiger Projekte kann eine Kooperation von<br />
Hochschule und Industrie von besonders großem Nutzen sein. Dabei werden hochschul-<br />
seitig Modelle zur Wissensorganisation entwickelt und durch den Kooperationspartner<br />
implementiert, umgesetzt und vermarktet.<br />
Insgesamt ist also durch eine Trennung von Entwicklung und Modellierung von Wis-<br />
senstrukturen und der anschließenden Realisierung eine Kooperation möglich, deren<br />
Produkte individuell angepasste, fachspezifische E-Learning-Plattformen sind, die an<br />
den expandierenden Bildungsmärkten angeboten werden können.<br />
5.1.2 Entwicklung fachspezifischer Software<br />
E-Learning-Plattformen können nie alle geforderten Funktionalitäten und Merkmale<br />
erfüllen, da durch die schnelle Entwicklung der Hard- und Software immer neue Wün-<br />
sche und Anforderungen an die Produkte gestellt werden.<br />
Dies stellt i.d.R nur dann ein wirkliches Problem dar, wenn das System in sich geschlos-<br />
sen ist und somit nicht auf die Funktionalitäten und Merkmale andere Systeme oder<br />
Programme zurückgreifen kann. Lernumgebungen müssen daher über Schnittstellen<br />
verfügen, über die alle Arten von (i.w.S.) Helfer-Applikationen angesprochen werden<br />
können.
5.1 Fachliche Kooperationen 46<br />
Die Rolle fachspezifischer Softwareprodukte und Tools in der Realisierung von E-<br />
Learning-Umgebungen wurde im vorangegangenen Kapitel bereits angedeutet. Hier<br />
gilt es zwei Arten von Softwareprogrammen bzw. -tools zu unterscheiden:<br />
1. Anwendungsprogramme zur Lernunterstützung<br />
Diese Programme sind für den modernen Lehr- und Lernprozess notwendig. In-<br />
nerhalb der E-Learning-Plattformen stehen Inhalte bereit, die nur durch Integra-<br />
tion dieser Software durch den Endanwender oder die Plattform selbst abgerufen<br />
werden können.<br />
Beispiele: Mathematica und Maple (Scripte), AutoCAD und Solid Edge (2D-<br />
Zeichnungen, 3D-Animationen)<br />
2. Autorenwerkzeuge zur Content-Erstellung<br />
Diese Programme sind v.a. für die Erstellung von E-Learning-Inhalte notwendig.<br />
Dabei handelt es sich um plattformeigene Helfer-Applikationen oder unabhän-<br />
gige Tools, die eine neuartige, oft multimediale Präsentation von Lerninhalten<br />
ermöglichen.<br />
Beispiele: Course-Creator 5 , Cinderella 6 , tex2html-Tools<br />
Die Entwicklung solcher Programme geht hier oft aus den speziellen Anforderungen im<br />
Hochschulbereich hervor: Sie werden für die Modernisierung der Lehre benötigt und<br />
müssen, wenn noch nicht vorhanden, entwickelt werden. Die fachlichen Spezifikationen<br />
können hier im Falle einer Kooperation mit einem Software-Hersteller an der Hoch-<br />
schule erarbeitet und Modelle für eine Realisierung entwickelt werden. Insbesondere<br />
die Integration in vorhandene E-Learning-Szenarien und die Anpassung der Schnitt-<br />
stellen im Hinblick auf die Weiterverbreitung des Produktes stehen hier im Mittelpunkt<br />
der Zusammenarbeit.<br />
Aber auch die Anpassung und Modifikation von bereits auf den Märkten etablier-<br />
ten Produkten für die Wissensabforderung können gemeinschaftlich umgesetzt wer-<br />
den. Denkbar ist hier beispielsweise das gemeinsame Entwickeln bzw. Modifizieren<br />
5 Der Course-Creator ist ein Tool zur Erstellung von Lehreinheiten für die an der TU <strong>Berlin</strong> in<br />
Entwicklung stehende E-Learning-Plattform der Projektes „Mumie” (Multimediale Mathematikausbildung<br />
für Ingenieure).<br />
6 Die Software Cinderella ist ein Tools zur Visualisierung geometrischer Zusammenhänge<br />
und liefert als Ergebnis ein interaktives Java-Applet, welches innerhalb von Web-gestützten<br />
E-Learning-Umgebungen den Lernprozess interaktiv unterstützt. Cinderella im Internet:<br />
http://www.cinderella.de
5.1 Fachliche Kooperationen 47<br />
von Schnittstellen zur Funktionserweiterung bei dem Zusammenwirken verschiede-<br />
ner Produkte. So könnte das wissenschaftliche Softwareprodukt „Mathematica” über<br />
entsprechende Schnittstellen direkt von der E-Learning-Plattform gesteuert werden.<br />
Die Ergebnisse werden im Gegenzug innerhalb der Software für die speziellen Anforde-<br />
rungen der Lernumgebung aufbereitet und an diese zurückgeliefert , wie es in Abbildung<br />
5.3 dargestellt ist.<br />
Lernplattform<br />
Aufgaben:<br />
− Datenerfassung<br />
− Tool−Auswahl<br />
− Präsentation<br />
− Darstellung<br />
Schnittstelle<br />
Daten (Inhalte und Metadaten)<br />
Anweisungen<br />
Daten (Inhalte und Metadaten)<br />
Anweisungen<br />
Schnittstelle<br />
Software / Tool<br />
Aufgaben:<br />
− Datenanalyse<br />
− Auswertung<br />
− Optimierung<br />
− Visualisierung<br />
− Anpassung<br />
Abbildung 5.3: Beispiel einer Schnittstelle für die Erweiterung der Funktionalitäten<br />
zwischen E-Learning-Plattform und Software-Tool (Helfer-Applikation).<br />
Die Verteilung der Aufgaben zwischen den beiden Applikationen ist individuell von<br />
den Bedürfnissen, Anforderungen und möglichen Funktionen abhängig. Im Fall der<br />
Software „Mathematica” kann beispielsweise die Auswahl eines geeigneten Lösungswe-<br />
ges durch einen Vergleich verschiedener numerisch berechneter Lösungen innerhalb des<br />
Mathematik-Programms erfolgen, alternativ kann der Lösungsweg bereits durch das<br />
Lernsystem (Plattform) vorgegeben werden.<br />
Auch im Bereich der visuellen Aufbereitung der Ergebnisse können die Aufgaben ver-<br />
teilt werden: Die Lernplattform fordert Ergebnisse gezielt nach (evtl. zur weiteren Be-<br />
arbeitung nötigen) vorgegebenen Spezifikationen wie z.B. Umfang, Grafikauflösung,<br />
spezielle Syntax und Layout von der Applikation an.<br />
Diese Kooperationen können von den Herstellern fachspezifischer Softwareprodukte von<br />
besonders großem Interesse sein, weil die Hochschulen und Lernenden zu den größten<br />
Abnehmern der entstehenden Produkte gehören. Es bietet sich auch an, solche Aufga-<br />
ben in Verbindung mit den Praktika, Studien- oder Diplomarbeiten der Studierenden<br />
durchzuführen, um neben einer kostengünstigen auch eine anwenderorientierte Pro-<br />
duktweiterentwicklung zu ermöglichen. Zudem finden sich die Softwareprodukte häufig<br />
auch im späteren Arbeitsalltag der Studierenden wieder, was aus Sicht der Unterneh-<br />
men eine langfristige Kundenbindung darstellt.
5.1 Fachliche Kooperationen 48<br />
5.1.3 Erstellung von E-Learning-Content<br />
Für die Erstellung von E-Learning-Inhalten können die hochschulseitig vorhandenen<br />
Kompetenzen im Bereich der Wissensverwaltung, -verknüpfung und -modellierung ähn-<br />
lich wie bei der Zusammenarbeit in der Entwicklung von Lernplattformen die Grund-<br />
lage gemeinsamer Vorhaben bilden.<br />
Eine einfache Art der Kooperation stellt hier die Beteiligung der Hochschule im Bereich<br />
der didaktischen und pädagogischen Konzeptentwicklung sowie der fachlichen<br />
Überwachung der Content-Erstellung dar: Unternehmen, die von dritter Seite mit<br />
der Bereitstellung fachlicher E-Learning-Inhalte beauftragt sind, können mit für diesen<br />
Bereich qualifizierten Hochschulmitarbeitern gemeinsam nach didaktischen und päd-<br />
agogischen Gesichtspunkten optimierte Inhalte kontrollieren und validieren. Schließlich<br />
ist die Art und Weise der Präsentation von Wissen für den Lernerfolg von hoher Be-<br />
deutung und sollte daher im Zusammenspiel mit Mediendesignern umgesetzt werden.<br />
Es muss aber berücksichtigt werden, dass für die Hochschule stets auch ein wissenschaft-<br />
licher Anspruch gegeben sein muss, der ein solches Engagement rechtfertigt: Hochschu-<br />
len können bisher kaum im Rahmen allgemeiner Dienstleistungen in der Wirtschaft<br />
agieren.<br />
Eine weitere, sehr anspruchsvolle Form der Zusammenarbeit ist die kooperative Con-<br />
tent-Erstellung. Hier können nach vorgegebenen Themen- oder Arbeitsgebieten neue<br />
Möglichkeiten der Wissensdarbietung entwickelt und eingesetzt werden, wobei speziell<br />
an den Hochschulen entwickelte fachliche Softwareprodukte eine große Rolle spielen<br />
können (siehe Abschnitt 5.1.2).<br />
Durch das Hinzuziehen von Fachleuten aus Wirtschaft und Industrie zu den Aufzeich-<br />
nungen bleibt der fachliche Inhalt nicht auf das Hochschulwissen beschränkt, sondern<br />
kann stärker an der Praxis ausgerichtet sein. Entscheidend ist hier die Integration von<br />
an der Hochschule entwickelten Tools in die Lernumgebungen zur Verbesserung des<br />
Lernerfolges. Denkbar ist, dass für ein sehr spezielles Wissensgebiet an der Hochschule<br />
gehaltene Vorlesungen mit der bereits im Abschnitt 2.2 vorgestellten elektronischen<br />
Kreide aufgezeichnet und als Element in den Lernpfad einer hochschulunabhängigen<br />
E-Learning-Lektion aufgenommen werden. 7<br />
7 Dann wäre auch die Entwicklung einer besonders ausgeprägten Schnittstelle für das Zusammenspiel<br />
von Lernplattform und elektronischer Kreide sinnvoll, wie es im vorangegangenen Abschnitt<br />
erläutert wurde.
5.1 Fachliche Kooperationen 49<br />
Eine dritte Stufe beinhaltet schließlich auch die thematische Strukturierung und<br />
das fachliche Verknüpfen von Wissens- und Informationsbausteinen für die<br />
Entwicklung plattformgeeigneter Datenbank-Strukturen, die innerfachlich organisiert<br />
und strukturiert sind. Im Bereich der Softwareentwicklung wird in diesem Zusammen-<br />
hang der Begriff „Ontologieentwicklung” verwendet.<br />
Abbildung 5.4 zeigt beispielhaft ein solches Modell, das für den Entwurf einer geeigne-<br />
ten Datenbankstruktur zugrunde gelegt werden kann. Der Wissensbaustein Markttheo-<br />
rie ist hier im Bereich der betriebswirtschaftlichen Theorien unterhalb der allgemeinen<br />
Betriebswirtschaftslehre platziert. 8<br />
Mathematik<br />
betriebswirtschaftliche<br />
Theorien<br />
allg. BWL spez. BWL<br />
Markttheorie<br />
Wirtschaft<br />
BWL VWL<br />
<strong>Wirtschaftsinformatik</strong><br />
Informatik<br />
Abbildung 5.4: Innerfachliche Anordnung von Wissenbausteinen am Beispiel von Wissensbausteinen<br />
des Studiengangs <strong>Wirtschaftsinformatik</strong> (Auszug).<br />
Abbildung 5.5 zeigt eine alternative Wissensorganisation: Hier werden die Wissens-<br />
bausteine beispielsweise nach Lehrveranstaltungsinhalten einer <strong>Universität</strong> bzw. Fach-<br />
hochschule strukturiert. Der Baustein Markttheorie findet sich hier in der Betriebs-<br />
wirtschaftslehre und in der Volkswirtschaftslehre wieder. Neben i.d.R. unerwünschter<br />
doppelter Datenhaltung stellt das Wiederauffinden der einzelnen Bausteine innerhalb<br />
großer und komplexer E-Learning-Umgebungen oft ein ernsthaftes Problem dar.<br />
8 vgl. Wöhe 1996, S. 19
5.1 Fachliche Kooperationen 50<br />
Markttheorie<br />
VWL<br />
BWL<br />
BWL 1 BWL 2 BWL 3<br />
Markttheorie<br />
<strong>Wirtschaftsinformatik</strong><br />
Datenbanken<br />
Informatik<br />
DB 1 DB 2 DB 3<br />
Abbildung 5.5: Anordnung von Wissenbausteinen nach der Wissensabforderung am<br />
Beispiel des Studiengangs <strong>Wirtschaftsinformatik</strong> (Auszug).<br />
Die innerfachliche Struktur ist so objektiv wie möglich und für nahezu alle Fachleute<br />
Konsens. Sie ist zeitlos, nicht von speziellen Gegebenheiten (Hochschule, Region, Ziel-<br />
gruppe ...) oder aktuellen didaktischen oder bildungspolitischen Strömungen abhängig. 9<br />
Für eine Wiederverwendbarkeit von Wissenbausteinen im Rahmen der Nachhaltigkeit<br />
zeigt die innerfachliche Struktur klare Vorteile: Für das Zusammenstellen neuer Lehr-<br />
gänge oder Lernpfade können alle Elemente einfach aufgefunden und eingesetzt werden.<br />
Andere Strukturen (siehe Abbildung 5.5) sind demgegenüber im Nachteil: Da die Vor-<br />
lesungen selbst sowie deren Inhalte sich nahezu zwischen allen Hochschulen unter-<br />
scheiden, ist die schließlich realisierte Datenbankstruktur auch nicht an einer anderen<br />
Hochschule ohne umfangreiche Modifikationen nutzbar.<br />
Ein Transfer dieser Problematik auf den Bereich Plattform-Entwicklung zeigt, dass die<br />
hohen Entwicklungskosten im Bereich der Lehr- und Lernplattformen beispielsweise<br />
durch den Einsatz geeigneter Datenmodelle wegen der Wiederverwertbarkeit enorm<br />
gesenkt werden können.<br />
Diese Kooperationsform ist daher eng mit der gemeinsamen Entwicklung oder Modifi-<br />
zierung von E-Learning-Plattformen verknüpft, da Grundlagen für die Nutzung solcher<br />
Datenbankstrukturen im System geschaffen und entsprechende Tools zur Zusammen-<br />
stellung von Lerneinheiten (sog. Course-Creator) bereitgestellt werden müssen.<br />
9 vgl. Jeschke, Sabina 2003, Kapitel 5
5.2 Technische und organisatorische Kooperationen 51<br />
5.2 Technische und organisatorische Kooperationen<br />
Im technischen und organisatorischen Bereich des Projektes <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> liegt<br />
die Hauptaufgabe in der Schaffung eines infrastrukturell optimal gestalteten Umfeldes.<br />
Die Versorgung der Studierenden mit <strong>Notebook</strong>s stellt in vielen Realisierungskonzep-<br />
ten eine zentrale Projektaufgabe dar (siehe Abschnitt 3.2). Hier finden sich große und<br />
teilweise sehr einfach zu nutzende Kooperationspotentiale.<br />
Verschiedene Umsetzungsmodelle werden daher in Abschnitt 5.2.1 vorgestellt und mit-<br />
einander verglichen. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach effizi-<br />
enten Supportkonzepten, die direkt von Seiten der Hochschule als Unterstützung der<br />
Studierenden fungieren und deren Leistungen teilweise deutlich über den allgemeinen<br />
Herstellersupport hinausgehen (Abschnitt 5.2.2).<br />
In Abschnitt 5.2.3 wird dann die Möglichkeit einer kooperativen Projektbearbeitung<br />
untersucht, wobei die in den Unternehmen vorhandenen Erfahrungen in den Bereichen<br />
der Projektdurchführung, Projektleitung und Projektsteuerung die Kooperationsbasis<br />
bilden und dem Hochschulprojekt <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> förderlich zugute kommen.<br />
Als Synthese wird in Abschnitt 5.2.4 das Modell einer Organisationsform entwickelt,<br />
die im Rahmen einer kooperativen Projektbearbeitung Anwendung finden kann. Dabei<br />
werden die im Laufe des Kapitels vorgestellten Ansätze der Zusammenarbeit beachtet<br />
und in den Konzeptansatz integriert.<br />
5.2.1 <strong>Notebook</strong>-Versorgungskonzepte<br />
Eine Form der Kooperation ist das gemeinsame Erarbeiten des Gesamtkonzeptes<br />
für die <strong>Notebook</strong>-Versorgung. Das Erreichen gemeinsam formulierter Zielsetzungen<br />
kann hier als Kooperationsbasis verstanden werden.<br />
Für die <strong>Notebook</strong>-Versorgung sind verschiedene Modelle einer praktischen Umsetzung<br />
bzw. einer Vertriebslösung denkbar: Verschiedenartige Shop-Lösungen (online oder lo-<br />
kal) oder zeitlich begrenzte Verkaufsaktionen sind Beispiele für einfache Konzepte (siehe<br />
Abbildung 5.6). Je nach gewählter Umsetzung können sich weitere Kooperationsfelder<br />
und schließlich zusätzliche Synergieeffekte ergeben, wie noch aufgezeigt wird.<br />
Die verschiedenartigen Realisierungsformen werden im Folgenden in Reihenfolge zu-<br />
nehmender Kooperationspotentiale genauer vorgestellt.
5.2 Technische und organisatorische Kooperationen 52<br />
weitere<br />
weitere<br />
weitere weitere<br />
Kooperationspotentiale Kooperationspotentiale Kooperationspotentiale Kooperationspotentiale<br />
Aktion<br />
zeitlich befristet Bestellung über Internet<br />
Online−Shop Shop<br />
Kooperation:<br />
Kooperationsbasis:<br />
Geschäft im<br />
Hochschulstandort<br />
Erreichen gemeinsamer Ziele<br />
Campus−Shop<br />
Geschäft auf bzw. nahe<br />
dem Hochschulgelände<br />
gemeinsames Erarbeiten von Spezifikationen und Auswahl des Vertriebskonzeptes<br />
Abbildung 5.6: Beispiele für einfache <strong>Notebook</strong>-Vertriebskonzepte. Je nach gewählter<br />
Umsetzung können sich weiterführende Kooperationsformen ergeben.<br />
weitere<br />
Kooperationspotentiale<br />
Aktion<br />
zeitlich befristet<br />
Aktionen bezeichnen hier zeitlich befristete Sonderverkäufe: Es<br />
wird beispielsweise zu Semesterbeginn ein Zeitfenster für Bestellun-<br />
gen bestimmter Modelle zu vergünstigten Konditionen vorgegeben. 10<br />
I.d.R. werden solche Verkaufsaktionen durch gezielte Werbemaßnah-<br />
men durch den Distributor oder den Hersteller an der Hochschule<br />
unterstützt. Aktionen ohne Absprache mit der Hochschule bzw. mit<br />
den Projektverantwortlichen der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> stellen keine Kooperation dar:<br />
Sie können vielmehr einen wirklichen Schaden für die Studierenden bedeuten, wenn<br />
sich die erworbenen Geräte für die hochschuleigenen E-Learning-Szenarien und das<br />
technische Umfeld als ungeeignet herausstellen.<br />
Die gemeinsame Konzeption eines Versorgungskonzeptes muss also auch das gemein-<br />
same Erarbeiten der genauen Spezifikationen nach den Anforderungen der Bil-<br />
dungseinrichtung einschließen. Ist dies der Fall, können die Hochschulen die Studie-<br />
renden auf diese Angebote gesondert hinweisen und auch Empfehlungen aussprechen.<br />
Außerdem können in gemeinsamer Absprache Zeiten für besonders effektive Werbeak-<br />
tionen ermittelt und günstige Bestellzeiträume festgelegt werden, ohne die geforderte<br />
10 Im Rahmen dieser Arbeit werden v.a. die besonderen Konditionen für die Studierenden betrachtet.<br />
Es muss aber auch erwähnt werden, dass bei den meisten bisher realisierten Lösungen diese<br />
Vergünstigungen auch für das Hochschulpersonal gelten.
5.2 Technische und organisatorische Kooperationen 53<br />
Neutralität der Bildungseinrichtung zu verletzen. Weiterhin können Hochschulen or-<br />
ganisatorisch eingebunden werden, indem beispielsweise vor Ort die Bestellungen ge-<br />
sammelt und an den Kooperationspartner weiterleiten werden. Schließlich ist auch die<br />
Annahme und Ausgabe der Geräte durch Hochschulen möglich. 11<br />
Aus der gewählten Umsetzung ergeben sich also weitere Kooperationspotentiale, die<br />
bei Realisierung einer <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> auf Nutzbarkeit und Nutzwert geprüft<br />
und ggf. realisiert werden sollten.<br />
weitere Bei den Online-Shops handelt es sich um internetgestützte Distri-<br />
Kooperationspotentiale<br />
butionsmodelle im Rahmen des E-Commerce. Es müssen zwei aus<br />
Online−Shop<br />
Bestellung über Internet<br />
Betreibersicht grundlegend unterschiedliche Modelle berücksichtigt<br />
werden:<br />
1. Online-Shop des Herstellers bzw. seines Distributors<br />
Es werden nur Produkte des Herstellers angeboten. Es können Studierende einzelner<br />
Hochschulen oder alternativ alle Studierenden versorgt werden.<br />
Beispiel: Die pro-com Datensysteme GmbH bietet unter http://www.nofost.de <strong>Notebook</strong>s<br />
und Zubehör des Produzenten IBM für Studierende zu Sonderkonditionen an.<br />
2. Online-Shop unabhängig vom Hersteller<br />
Der Shop wird durch Dritte betrieben. Die Produktpalette ist nicht auf auf die Modelle<br />
eines Produzenten beschränkt. Die Hersteller stehen hier in Konkurrenz zueinander.<br />
Beispiel: Der Campuspoint unter http://www.campuspoint.de bietet eine Vielzahl von<br />
Produkten der Hersteller IBM, HP, Fujitsu Siemens, ASUS, Acer und Sony für Studierende<br />
zu Sonderkonditionen an.<br />
Die Anforderung nach einer homogenen Hard- und Softwarestruktur spielt hier eine<br />
besondere Rolle: Herstellerunabhängige Distributoren mit breiter Produktpalette ste-<br />
hen diesem Ziel oft entgegen.<br />
Beispiel für eine erfolgreiche Realisierung einer Online-Shop-Lösung ist die Kooperati-<br />
on der Technischen <strong>Universität</strong> <strong>Berlin</strong> mit der IBM Deutschland GmbH und der pro-<br />
com Datensysteme GmbH: Hier ist es gelungen, nach den speziellen Anforderungen<br />
der Hochschule zwei geeignete Produkte auszuwählen und gleichzeitig Rabatte aus-<br />
zuhandeln, die prozentual betrachtet noch unter bereits vorhandenen Studierenden-<br />
Vergünstigungen der <strong>Notebook</strong>s-for-Students-Initiative lagen.<br />
11 Natürlich wäre die Übernahme solcher Aufgaben durch die Hochschule mit dem zusätzlichen Einsatz<br />
von Personal und dem Auftreten organisatorischer Probleme verbunden: So stellt sich beispielsweise<br />
die Frage nach einer sicheren Verwahrung der angelieferten Geräte innerhalb der Hochschulgebäude<br />
sowie nach deren Versicherung für den Zeitraum der Aufbewahrung.
5.2 Technische und organisatorische Kooperationen 54<br />
Tabelle 5.2 zeigt, wie die hochschulseitigen Anforderungen an ein geeignetes <strong>Notebook</strong><br />
innerhalb der bereits vorhandenen Shop-Lösung der pro-com Datentechnik GmbH, die<br />
unter http://www.nofost.de bundesweit rabattierte IBM-<strong>Notebook</strong>s für Studierende<br />
anbietet, umgesetzt werden konnte. 12<br />
hochschulseitige<br />
Anforderung<br />
Umsetzung durch die Initiative der IBM Deutschland GmbH<br />
und der pro-com Datensysteme GmbH<br />
WLAN-Unterstützung • Es wurden nur Geräte mit integrierter WLAN-Technologie in den<br />
Auswahlprozess einbezogen, was zu diesem Zeitpunkt (September<br />
2002) nur auf wenige Modelle zutraf<br />
Linux-Unterstützung • Alle relevanten Elemente wie beispielsweise der Grafikchipsatz und<br />
das Power-Management mussten durch Linux-Treiber unterstützt<br />
werden. Die übliche Festplattenkapazität wurde von 30 GB auf 40<br />
GB erweitert. 13<br />
CD-Brenner • Um auch einen netzwerkunabhängigen und komfortablen Austausch<br />
großer Datenmenge zu ermöglichen, musste ein CD-Brenner integriert<br />
sein. Diese Anforderung wird auch durch die Tatsache unterstützt,<br />
dass aktuelle <strong>Notebook</strong>-Modelle teilweise standardmäßig ohne<br />
Diskettenlaufwerk ausgeliefert werden und ein Datenaustausch ohne<br />
Netzwerk und CD-Brenner kaum noch möglich ist.<br />
Lange Laufzeiten • Um möglichst lange netzunabhängige Laufzeiten zu garantieren, wurden<br />
nur Modelle mit speziellen Mobile-Prozessoren in die engere Auswahl<br />
aufgenommen. 14<br />
3 Jahre Garantie • In der IBM-Produktpalette finden sich Geräte mit Garantiezeiten von<br />
1 bis 3 Jahren. Für die <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> wurde hier ein Modell<br />
mit 3 Jahren Garantie ausgewählt.<br />
Tabelle 5.2: Umsetzung der hochschulseitigen Anforderungen am Beispiel des IBM Thinkpad<br />
R32 2658-BQG im September 2002 (Auszug aus dem Anforderungskatalog)<br />
12 Nofost steht für „<strong>Notebook</strong>s for Students”. Rabattierte IBM-<strong>Notebook</strong>s für Schüler und Schülerinnen<br />
werden im <strong>Notebook</strong>s-for-Education-Programm unter http://www.no4ed.de vertrieben.<br />
13 Dadurch war es den Mitarbeitern des Hochschulprojektes möglich, die Windows-Partition zu verkleinern<br />
und eine Daten-Partition sowie eine zusätzliche Linux-Partition anzulegen. Diese Neuinstallation<br />
konnte mit Hilfe einer Image-DVD auf den <strong>Notebook</strong>s der Studierenden jederzeit wiederholt<br />
werden. Für das Erstellen dieser Image-DVD wurde auf Erfahrungswerte der ETH Zürich<br />
zurückgegriffen.<br />
14 Durch die neue Centrino-Technologie der Firma Intel können Laufzeiten von bis zu 6 Stunden<br />
erreicht werden, was für eine Anwendung innerhalb von Hochschulgebäuden optimal ist, da dort
5.2 Technische und organisatorische Kooperationen 55<br />
Innerhalb des Online-Shops wurden so zeitweise zwei auf die besonderen Anforderun-<br />
gen des Projektes Mobiles Service for Students (MOSES) der Technischen <strong>Universität</strong><br />
<strong>Berlin</strong> ausgelegte <strong>Notebook</strong>s angeboten, die im Vergleich zum Listenpreis um bis zu<br />
40% reduziert waren. Der Endpreis lag bei dem Modell Thinkpad R32 2658-BQG bei<br />
1895,- (Oktober 2002) bzw. bei<br />
um etwa<br />
1595,- (März 2003). Das zweite Gerät lag preislich<br />
250,- darüber und verfügte über eine höherwertige Ausstattung.<br />
Durch diese Kooperation ist es gelungen, den Studierenden nahezu optimale Lernwerk-<br />
zeuge zum Erwerb bereitzustellen. Dass die erwarteten Absatzzahlen dennoch unter<br />
den beiderseitigen Erwartungen lagen, ist auf den immer noch verhältnismäßig hohen<br />
Endpreis zurückzuführen. 15 Durch weiteres Ansteigen der Leistungsfähigkeit der Geräte<br />
sowie dem allgemeinen Trend sinkender Preise für Hardware wird sich der Stellenwert<br />
dieser Problematik in absehbarer Zeit deutlich verringern.<br />
weitere<br />
Kooperationspotentiale<br />
Shop<br />
Geschäft im<br />
Hochschulstandort<br />
weitere<br />
Kooperationspotentiale<br />
Campus−Shop<br />
Geschäft auf bzw. nahe<br />
dem Hochschulgelände<br />
Das Einrichten eines <strong>Notebook</strong>-Verkaufshauses am<br />
Hochschulstandort oder auch auf dem Hochschulge-<br />
lände stellt ein weiteres Modell für die <strong>Notebook</strong>-<br />
Versorgung dar. Durch die regionale Beschränkung<br />
kann zielgenau auf die Spezifikationen der <strong>Notebook</strong>-<br />
<strong>Universität</strong> eingegangen werden. Weiterhin kann unter<br />
den Verantwortlichen auch ein gemeinsames Support-Konzept erarbeitet werden: Mög-<br />
lich ist, dass dem Betreiber dieses Geschäftes hochschuleigene Örtlichkeiten zur Ver-<br />
fügung gestellt werden, und dieser sich im Gegenzug im begrenzten Umfang auch an<br />
den hochschulabhängigen Service- und Support-Leistungen beteiligt. So könnte u.a. ei-<br />
ne Hilfestellung zum Einrichten von WLAN-Verbindungen durch das Verkaufspersonal<br />
angeboten werden.<br />
Für eine solche Shop-Lösung kann die Hochschule über eine Ausschreibung einen ge-<br />
eigneten Betreiber finden. Beispiel für eine solche Umsetzung ist mit Einschränkungen<br />
auch hier der Campus-Point der <strong>Universität</strong> Bremen (http://www.campus-point.de):<br />
Ein Online-Shop wurde mit der Einrichtung einer lokalen Verkaufsstelle an der Hoch-<br />
schule kombiniert.<br />
oft nur wenige öffentlich zugängliche Steckdosen bereit stehen. Da Intel bisher jedoch genauere<br />
Informationen zu dieser Technologie zurückhält, gibt es noch keine aktive Unterstützung durch<br />
das Open-Source-Betriebssystem Linux. Herkömmliche Laufzeiten liegen im Bereich von bis zu 2,5<br />
Stunden.<br />
15 Vorlage für diese Kooperation war die erfolgreiche Zusammenarbeit der ETH Zürich mit der IBM<br />
Schweiz. Dort werden zu Anfang jedes Semesters mehrere hundert <strong>Notebook</strong>s an Studierende verkauft.<br />
Diese hohe Absatzmenge steht in Verbindung mit dem dort vorhandenen finanziellen Umfeld.
5.2 Technische und organisatorische Kooperationen 56<br />
Dass ein Hardwarehersteller selbst vor Ort ein Geschäft einrichtet, ist wegen des stark<br />
lokal begrenzten Wirkungskreises eher unwahrscheinlich. Schließlich stellt die Konzep-<br />
tion solcher individueller Lösungen für jede einzelne Bildungseinrichtung für ein Unter-<br />
nehmen einen deutlichen Mehraufwand hinsichtlich der Organisation und der Abwick-<br />
lung dar, welcher unter rein finanziellen Gesichtspunkten etwaigen Umsatzzielen und<br />
Gewinnabsichten kontraproduktiv entgegen steht: Die direkte Erwirtschaftung von Ge-<br />
winnen ist für die Unternehmen bei stark rabattierten Angeboten kaum noch möglich<br />
und so werden v.a. nicht-monetäre Ziele verfolgt (vgl. Abschnitt 4.1).<br />
Dennoch ist eine solche Lösung von Seiten der Hersteller zumindest für große Hoch-<br />
schulstandorte überlegenswert: Eine stark eingeschränkte Produktpalette in Kombina-<br />
tion mit stark eingeschränkten Verkaufszeiten würde den finanziellen und personellen<br />
Aufwand deutlich begrenzen und den Studierenden dennoch für ihre Zwecke genügen.<br />
5.2.2 Supportkonzept<br />
Ein Kooperationsmöglichkeit für den Service- und Support-Bereich wurde bereits im<br />
Abschnitt 5.2.1 angesprochen: Auf dem Campus kann ein spezieller <strong>Notebook</strong>-Shop<br />
eingerichtet werden, dessen Mitarbeiter auch im begrenzten Rahmen (v.a. technischen)<br />
Support leisten.<br />
Wird das <strong>Notebook</strong>-Beschaffungskonzept direkt mit einem Hardware-Hersteller um-<br />
gesetzt, finden sich ebenfalls Szenarien eines gemeinsamen Support-Angebotes. Hier<br />
ist eine Aufteilung in First-Level- und Second-Level-Support sinnvoll. Der First-Level-<br />
Support für einfache Probleme und Fragestellungen kann durch das vorhandene Hoch-<br />
schulpersonal übernommen werden, beispielsweise durch Mitarbeiter der Rechenzen-<br />
tren bzw. Computerpools. Diese Mitarbeiter können durch Spezialisten des Herstellers<br />
zunächst geschult werden, um häufig auftretende Fehler erkennen und lösen zu können.<br />
Werden die Probleme der Anwender so nicht behoben, ist der Einsatz von Firmenper-<br />
sonal im Rahmen des Second-Level-Support denkbar.<br />
Praktisch kann dies z.B. durch regelmäßige „Sprechstunden” der Spezialisten vor Ort<br />
an der Hochschule oder an firmeneigenen Standorten durchgeführt werden. Natürlich<br />
kann eine solche Lösung für den industriellen Kooperationspartner nur dann vorteilhaft<br />
und rentabel sein, wenn dieser Aufwand in einem vertretbaren Verhältnis zum Errei-<br />
chen der selbstgesteckten Ziele wie beispielsweise den Umsatzerwartungen steht. Ist
5.2 Technische und organisatorische Kooperationen 57<br />
dies nicht der Fall, können nur die allen Käufern zur Verfügung stehenden allgemeinen<br />
Service-Leistungen wie etwa der telefonische Produkt-Support in Anspruch genommen<br />
werden. Für den Studierenden ergibt sich so jedoch kein Vorteil im Support-Bereich<br />
und ein kaufentscheidendes Argument entfällt.<br />
Durch den direkten Kontakt mit dem Endkunden können dagegen aus unternehme-<br />
rischer Sicht besonders die nicht-monetären Ziele verfolgt werden, hier besonders der<br />
Prestigezugewinn und die langfristige Kundenbindung. Die Wichtigkeit gerade dieser<br />
Zielstellungen darf nicht unterschätzt werden: I.a. sind gerade sie es, die das Engage-<br />
ment der Unternehmen an den Hochschulen begründen.<br />
5.2.3 Kooperative Projektdurchführung<br />
Am Anfang einer <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> steht i.d.R. ein Projekt der Hochschule, häufig<br />
durch Drittmittelgeber wie dem BMBF gefördert. Langfristiges Ziel ist neben der Mo-<br />
dernisierung der Lehre oft auch die Neuausrichtung der Hochschule hin zur Abdeckung<br />
des Weiterbildungsmarktes.<br />
Damit tritt die Hochschule als Anbieter in Konkurrenz zu bereits etablierten Weiterbil-<br />
dungseinrichtungen auf und muss sich mit ihnen messen. Dies erfordert eine langfristig<br />
wirtschaftlich tragfähige Konzeption der „<strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>” mit all den betriebs-<br />
wirtschaftlichen Anforderungen, die Unternehmen natürlicherweise als Grundlage für<br />
wirtschaftlichen Erfolg dienen.<br />
Hochschulen agierten bisher aber fast nur an einem geschlossenen Bildungsmarkt und<br />
waren daher einer marktwirtschaftlichen Konkurrenzsituation kaum ausgesetzt. Dies<br />
ändert sich zunehmend: der Wissenskonsument der Zukunft muss umworben und zu-<br />
friedenstellend bedient werden. Dabei müssen die Aufwendungen für die Bildungsange-<br />
bote in jeder Hinsicht konkurrenzfähig gestaltet werden, was eine hohe Effizienz seitens<br />
der Hochschule schon in und v.a. nach der Projektphase voraussetzt. Gerade dazu nö-<br />
tige Erfahrungswerte fehlen jedoch oft, wogegen viele Unternehmen über ein großes<br />
Erfahrungspotential in der Projektplanung und -umsetzung verfügen.<br />
Es liegt daher nahe, auch auf dieses Potential zurückzugreifen und Fachleute aus den<br />
Unternehmen in vielen Projektphasen der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> zu konsultieren oder<br />
weiterführende Kooperationen mit ihnen einzugehen.
5.2 Technische und organisatorische Kooperationen 58<br />
Eine gemeinsame Gestaltung des Projektes „<strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>” von Hochschulen<br />
und Unternehmen kann in unterschiedlichster Weise umgesetzt werden. Grundsätzlich<br />
sind folgenden Möglichkeiten denkbar:<br />
(a) Unternehmen führen das Projekt eigenständig nach Vorgaben der Hochschule<br />
durch.<br />
(b) Unternehmen beraten die Hochschule bzw. die Projektverantwortlichen, die Hoch-<br />
schule führt das Projekt durch.<br />
(c) Unternehmen nehmen aktiv am Projekt und an Entscheidungsprozessen teil,<br />
Hochschule und Industrie führen das Projekt gemeinschaftlich durch.<br />
Eine eigenständige Projektdurchführung durch industrielle Partner (a) kommt hier<br />
einem totalen Outsourcing-Prozess gleich. Da für Hochschulen Unabhängigkeit und<br />
Neutralität zentrale Bestandteile ihres Selbstbildes und Selbstverständnisses sind, gibt<br />
es an solchen Lösungen ein vergleichsweise geringes Interesse.<br />
Fungieren Fachleute aus Kreisen der Wirtschaft als externe Berater (b), kann auf deren<br />
Wissen und Erfahrungen zugegriffen werden. Hier sind v.a. Marktkenntnisse, Projek-<br />
terfahrung sowie Marketingstrategien speziell für den Bildungsbereich von besonderer<br />
Bedeutung für die Hochschulen, denen diese Kenntnisse v.a. der betriebswirtschaftli-<br />
chen Aspekte oft fehlen.<br />
Allgemeine betriebswirtschaftliche Erfahrungswerte können ebenso wie vorhandene Pro-<br />
jektpraxis alle Phasen der Einführung einer <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> unterstützen. Bereits<br />
in der Initialisierungsphase können externe Berater für die Wahl und Ausbildung der<br />
Organisationsform herangezogen werden. Im weiteren Projektverlauf müssen Prozes-<br />
se modelliert und optimiert werden. Dies sind die klassischen Aufgabengebiete der<br />
Consulting-Unternehmen, die auch zur Unterstützung des Projektcontrolling herange-<br />
zogen werden können.<br />
Abbildung 5.7 zeigt am schematischen Projektablauf mit vier Phasen mögliche Auf-<br />
gaben, die mit Unterstützung externer Berater durchgeführt werden könnten, sind als<br />
rote Balken über den entsprechenden Projektphasen aufgetragen.
5.2 Technische und organisatorische Kooperationen 59<br />
Beratungstätikeit<br />
Hochschulprojekt <strong>Notebook</strong>−<strong>Universität</strong><br />
Projekterfahrung, betriebswirtschaftliche Erfahrung<br />
Organisationsmodellierung<br />
Projektcontrolling<br />
Projektverlauf<br />
Phase 1:<br />
Initialisierung<br />
Zieldefinition<br />
Marktforschung<br />
Aufgabenstellung<br />
Projektorganisation<br />
Projektplanung (1)<br />
Prozessmodellierung<br />
Ist−Analyse<br />
Machbarkeit<br />
Phase 2:<br />
Analyse<br />
Anforderungsanalyse<br />
Nutzungspotential<br />
Projektplanung (2)<br />
Schwachstellen−<br />
analyse<br />
Nachhaltigkeit<br />
Phase 3:<br />
Phase 4:<br />
Konzeption Realisierung<br />
Aufgaben: Aufgaben: Aufgaben: Aufgaben:<br />
Soll−Konzept Umsetzung<br />
Spezifikation<br />
Projektplanung (3)<br />
Prozessoptimierung<br />
Verwertung und Vermarktung<br />
Dokumentation<br />
Tests<br />
Schulung<br />
Projektplanung (4)<br />
Integration<br />
Abbildung 5.7: Projektphasen mit möglichen externen Beratungsfeldern<br />
Für derartige Unterstützungleistungen verfügen viele große Unternehmen über eigene<br />
Geschäftsbereiche. So steht z.B. bei IBM der Business Consulting Service bereit, um<br />
die Arbeit an Aufgaben und Projekten in nahezu allen Geschäftbereichen hilfreich zu<br />
unterstützen.<br />
Ein Problem bei diesem Ansatz stellt jedoch die Vergütung dieser Beratertätigkeit<br />
dar: Das Hinzuziehen von Spezialisten aus professionellen Consulting-Unternehmen<br />
kann den finanziellen Rahmen des Projektes sprengen bzw. eine zu große Belastung<br />
darstellen; letztlich werden hier hochwertige Dienstleistungen eingekauft, die von den<br />
Unternehmen in Rechnung gestellt werden. 16<br />
Auch das Anliegen zur Sicherung von Arbeitplätzen an der Hochschule kann eine solche<br />
Lösung verhindern: Hochschulen sind i.A. bestrebt, die vorliegenden Aufgaben durch<br />
Einsatz des eigenen Personalstamms zu bearbeiten. Hier muss deutlich darauf hinge-<br />
wiesen werden, dass dieses Anliegen im ungünstigsten Fall den gesamten Projekterfolg<br />
verhindert.<br />
16 Obwohl diese Praxis für deutsche Hochschulen recht ungewöhnlich erscheint, gibt es Beispiele solcher<br />
Vorgehensweisen: Die Technische <strong>Universität</strong> <strong>Berlin</strong> beauftragte 1998 die Unternehmensberatergruppe<br />
A.T. Karney zur Unterstützung ihrer Reformvorhaben in der Hochschulverwaltung. Im<br />
Bereich der Wirtschaft dagegen ist die professionelle Unterstützung durch Consulting-Unternehmen<br />
in vielen Bereichen längst etabliert.
5.2 Technische und organisatorische Kooperationen 60<br />
Werden Vertreter der industriellen Partner hingegen direkt an der Projektdurchfüh-<br />
rung und evtl. auch am Projektmanagement beteiligt, entsteht eine noch engere und<br />
weiterführende Form der Kooperation (c). Beide Projektpartner haben dann die Mög-<br />
lichkeit, ihre eigenen Interessen in die Projektgestaltung mit einfließen zu lassen und<br />
profitieren gleichzeitig vom Wissen und Erfahrungsschatz der anderen Beteiligten.<br />
Werden die in den Abschnitten 3.1 und 4.1 erarbeiteten Ziele der Beteiligten gegenüber-<br />
gestellt, stellen gemeinsam formulierte Zielsetzungen die Kooperationsgrundlage dar.<br />
Ein Beispiel ist hier die langfristige Neuausrichtung der Hochschulen als Anbieter am<br />
Weiterbildungsmarkt in Verbindung mit dem Ausbau von Umsatz- oder Marktanteilen<br />
durch den oder die Kooperationspartner.<br />
5.2.4 Kooperative Organisationsform<br />
Von der gemeinsamen Projektdurchführung hin zu einer kooperativen Projekt-Orga-<br />
nisationsstruktur ist es nur ein kleiner Schritt: Besteht von Seiten des Bildungsinsti-<br />
tutes die Bereitschaft, auch innerhalb der Organisationsstruktur den direkten Einfluss<br />
durch den Kooperationspartner zuzulassen, können die vorhandenen Synergieeffekte<br />
auf beiden Seiten optimal genutzt werden. 17<br />
Es ist für den Projektverlauf und schließlich auch für den Projekterfolg unabdingbar,<br />
dass diese Gewichtung in einem ausgewogenen Verhältnis auch innerhalb der Organi-<br />
sationsstruktur umgesetzt wird. Dies bedeutet insbesondere, dass die Projektleitungs-<br />
und Steuerungsbereiche auf hoher Ebene dem Kooperationspartner aus der Wirtschaft<br />
nicht verschlossen bleiben dürfen; vielmehr ist das Beteiligen der Partner auch an wich-<br />
tigen Entscheidungsprozessen Merkmal einer stabilen und zukunftsorientierten Zusam-<br />
menarbeit.<br />
Aus dieser Betrachtung ergibt sich für den Bereich der Projektleitung bzw. des Pro-<br />
jektmanagements eine Beteiligung des Kooperationspartners durch Entsendung ent-<br />
sprechender Mitarbeiter in die projektbezogenen Leitungs- und Entscheidungsgremien.<br />
Hier ist der Anteil und evtl. damit verbundene Stimmrechte für Entscheidungen zu-<br />
nächst unerheblich: Wichtig ist das Einbringen neuer Wissensschätze, Erfahrungswerte<br />
17 Natürlicherweise werden Hochschulen versuchen, diesen Einfluss auf ein notwendiges Minimum zu<br />
beschränken, um ihre Autonomie zu erhalten; der Kooperationspartner versucht hingegen, seinen<br />
Einflussbereich möglichst groß auszuprägen.
5.2 Technische und organisatorische Kooperationen 61<br />
und Handlungswege insbesondere aus den betriebswirtschaftlichen und projektrelevan-<br />
ten Bereichen durch den Kooperationspartner auch auf hoher Hierarchiebene, damit<br />
eine unmittelbare Anwendung neuer Erkenntnisse im Projektverlauf schnell möglich<br />
wird.<br />
Abbildung 5.8 stellt in Anlehnung an die im Abschnitt 3.3.2 vorgestellte Organisati-<br />
onsstruktur für die Einführung einer <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> eine Modifikation für ein<br />
kooperativ ausgerichtetes Projekt dar. In dieser Skizze sind Organisationseinheiten, in<br />
welchen im Laufe dieses Kapitels erfolgversprechende Kooperationspotentiale aufge-<br />
zeigt und diskutiert wurden, rot hervorgehoben.<br />
Management<br />
Projektleitung<br />
Didaktische und<br />
pädagogische<br />
Unterstützung<br />
Koordinations−<br />
stelle<br />
Fachliche Leitung<br />
Controlling<br />
Plattform−Entw. Software−Entw.<br />
Content−Erstell.<br />
Content−Erstell.<br />
Hochschule<br />
Unternehmen<br />
ev. externe Berater<br />
Hardware<br />
Software<br />
Beschaffung Anpassung<br />
Technische Leitung<br />
LAN/WLAN<br />
Legende: Mitarbeiter der Kooperationspartner Kooperationsbereiche<br />
Internet<br />
Lehrende und Lernende<br />
Helpdesk<br />
Service und Support<br />
Support<br />
First Level Second Level<br />
Abbildung 5.8: Beispiel einer Organisationsstruktur für eine kooperative Einführung<br />
einer <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>. Kooperationsbereiche sind rot hervorgehoben.
Kapitel 6<br />
Fazit<br />
Im Rahmen dieser Arbeit hat sich gezeigt, dass bei der Umsetzung von <strong>Notebook</strong>-<br />
<strong>Universität</strong>en viele Möglichkeiten gegeben sind, die Einführung und langfristige Eta-<br />
blierung der neuen Lernformen durch geeignete Kooperationen unterschiedlicher Aus-<br />
prägung mit Unternehmen aus Industrie und Wirtschaft sinnvoll zu unterstützen. Es<br />
bleibt auch festzustellen, dass Hochschulen sich diesem enormen Kooperationspotential<br />
oft kaum bewußt sind und dass derart gestaltete Szenarien in der Vergangenheit daher<br />
kaum realisiert wurden. Dabei gehen die Kooperationsmöglichkeiten von Hochschulen<br />
und Industrie weit über das Modell der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> hinaus und können eben<br />
auch in vielen anderen Bereichen erfolgversprechende Verbesserungsansätze sein.<br />
Eine gelungene Zusammenarbeit mündet im Erreichen der von den Kooperationspart-<br />
ner vorgegebenen Ziele. Dabei profitieren die Partner gegenseitig v.a. von Synergieef-<br />
fekten, die durch Kombination der unterschiedlichen Wissensbereiche und Erfahrungs-<br />
werte entstehen. Weiterhin stellt eine nach vorhandenen (Kern-) Kompetenzen ausge-<br />
richtete Projekt- und Organisationsstruktur die Möglichkeit der effektiven Nutzung der<br />
gemeinsam vorhandenen Potentiale dar.<br />
V.a. große Unternehmen aus dem Bereich der Computerindustrie bieten sich als ge-<br />
eignete Kooperationspartner an und sind bereit, ihre betriebswirtschaftlichen Zielstel-<br />
lungen für den Rahmen dieser Zusammenarbeit neu zu formulieren: Das Erreichen<br />
nicht-monetäre Zielvorgaben rechtfertigt schon seit langem ein Engagement v.a. im so-<br />
zialen Bereich, obgleich gerade hier das Überwachen des Zielerreichungsgrades oft nur<br />
schwer möglich ist.<br />
62
In ein solches Engagement war in der Historie oft auch der Bildungsbereich eingeschlos-<br />
sen, den es in verschiedensten Formen zu unterstützen galt: Sachspenden, teilweise auch<br />
finanzielle Zuwendungen oder das Angebot unentgeltlicher Dienstleistungen für Studie-<br />
rende und Lehrpersonal stellen zukunftsorientierte Investitionen in das Humankapital<br />
der Gesellschaft dar.<br />
Doch die Rahmenbedingungen ändern sich: Die einzelnen Bereiche und Aufgabengebie-<br />
te des nationalen Bildungsmarktes verschmelzen zunehmend, es entsteht ein komplexer<br />
Bildungsmarkt, dessen Wirkungbereich infolge der Globalisierung nicht mehr auf die<br />
nationale Ebene beschränkt ist. Alle Anbieter und Nachfrager der bisher abgegrenzten<br />
Teilmärkte müssen nun an diesem einen Markt agieren, das Gründen von Bildungsal-<br />
lianzen wird für die Anbieter langfristig zur Existenzfrage.<br />
In weiten Teilen der Wirtschaft wurde dieser Gedanke der Umorientierung längst zum<br />
Anlass für neue Aktivitäten im Bildungbereich genommen, und es sind v.a. die Hoch-<br />
schulen, die infolge dieses Prozesses als potentielle Kooperationspartner besonders in-<br />
teressant werden.<br />
Die Situation auf Seiten der Hochschulen stellt sich deutlich komplexer dar: Obwohl<br />
der Umbruch im Bildungsbereich erkannt ist und auch durch entsprechende Projekte<br />
wie der Einführung der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong>en reagiert wird, schränken eine Fülle von<br />
äußeren Randbedingungen und Vorgaben (gesetzliche, bildungspolitische und psycho-<br />
logische) sowie eigene traditionelle Handlungsweisen die Hochschulen in diesem Prozess<br />
stark ein: V.a. der fast als verkrampft zu bezeichnende Anspruch, alle sich ihr stellenden<br />
Aufgaben vollständig autark zu bewältigen, muss hochschulseitig dringend überdacht<br />
werden.<br />
Hier gilt es, auch durch hochschulpolitische Maßnahmen günstigere Voraussetzungen<br />
für die Um- und Neuorientierung zu schaffen, um schließlich auch das durch Koopera-<br />
tionen mit der Industrie entstehende Potential voll ausnutzen zu können.<br />
Der einzelnen Hochschule bleibt bis dahin nur die Möglichkeit, innerhalb des gegebenen<br />
Umfeldes die günstigsten Lösungen zur Modernisierung des Lehr- und Lernprozesses<br />
umzusetzen, was eben gerade nicht bedeutet, dass die für die Hochschule günstigste<br />
Methode gewählt werden darf: Das angestrebte Ergebnis muss den Einführungs- und<br />
Umsetzungsprozess letztlich bestimmen, nicht etwa die interne Personalpolitik oder die<br />
Existenz anderer Ressourcen.<br />
63
Allgemein muss das ressourcenorientierte Handeln an Hochschulen durch verstärkte<br />
Zielorientierung ersetzt werden, auch wenn dieser Prozess unter der derzeit gegebenen<br />
finanziellen Situation im Bildungsbereich äußerst schwierig umzusetzen ist.<br />
Für die Einführung einer <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> bedeutet dies, das bereits im organisa-<br />
torischen Vorfeld die Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung zu schaffen ist. Dazu<br />
gehört zunächst das Untersuchen der Frage, ob die anfängliche Projektform überhaupt<br />
eine geeignete Methode für die Einführung darstellt oder alternativ die dauerhafte Auf-<br />
gabe einer dafür geeigneten Institution (z.B. Rechenzentrum) zugeordnet wird. Sicher<br />
stellte die Möglichkeit der Projektförderung durch Drittmittel in den vergangenen Jah-<br />
ren eine für die Hochschulen nahezu „risikolose” Variante zur Einführung dar; welche<br />
Komponenten der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> jedoch tatsächlich nachhaltig und dauerhaft<br />
an den Hochschulen verbleiben, wird sich erst nach Projektende zeigen: Schwächen und<br />
Fehler in Projektorganisation und -durchführung wirken sich erst mittelfristig auf den<br />
Erfolg der <strong>Notebook</strong>-<strong>Universität</strong> aus und sind nachträglich schwer zu korrigieren.<br />
Dieses Problem resultiert v.a. aus der Tatsache, dass elementare Kenntnisse für die Bil-<br />
dung eines effektiv und ergebnisorientiert arbeitenden Projektmanagements an Hoch-<br />
schulen kaum vorhanden sind. Besonders gravierende Auswirkungen zeigen sich dann,<br />
wenn der betriebswirtschaftliche und organisatorische Projektanteil im Vergleich zu rei-<br />
nen Forschungsprojekten verhältnismäßig groß wird, wie es bei den <strong>Notebook</strong>-Universi-<br />
täten der Fall ist.<br />
Zukünftige Projekte zu deren Einführung sollten daher unter kooperativer Einbezie-<br />
hung von Spezialisten des Projektmanagements aus Kreisen der Wirtschaft konzipiert<br />
und umgesetzt werden. Dazu wurden in dieser Arbeit verschiedene Möglichkeiten her-<br />
ausgearbeitet und eine mögliche Organisationsform an Ansatz entwickelt. Entscheidend<br />
ist die nötige hochschulseitige und hochschulpolitische Erkenntnis, dass mittel- und<br />
langfristig v.a. Kooperationen auf relativ hoher Organisationsebene für gemeinsame<br />
Aktivitäten am Bildungmarkt erfolgversprechend sind.<br />
Die Aufgabengebiete der <strong>Notebook</strong>-Beschaffung und der WLAN-Versorgung der Hoch-<br />
schulen werden mittelfristig im Rahmen der technischen Weiterentwicklung und des<br />
allgemeinen Preisverfalls von untergeordneter Bedeutung sein.<br />
Es gilt aber, besonders in den fachlich-inhaltlichen Aufgabenbereichen langfristig trag-<br />
bare Modelle rechtzeitig und mit Hilfe von Kooperationspartnern im Rahmen von Bil-<br />
dungsallianzen zu entwickeln, die auch den Bildungmarkt von morgen bedienen.<br />
64
Literaturverzeichnis<br />
[1] Bell, Daniel: Die nachindustrielle Gesellschaft, New York 1973, in: Reihe Campus, Band 1001,<br />
Frankfurt a.M. 1985<br />
[2] Bertelsmann Stiftung / Heinz Nixdorf Stiftung (Hrsg.): Studium online - Hochschul-<br />
entwicklung durch neue Medien, Gütersloh 2000<br />
[3] Biedebach, A. et al.: Funktionsbeschreibung der Virtuellen <strong>Universität</strong>, Bericht, Hagen 1999<br />
URL http://voss.fernuni-hagen.de/forschung/informatikberichte/1999.html (letzter Zugriff<br />
22.7.2003), Kopie auf CD-ROM (virt_uni.pdf)<br />
[4] Brockhaus: Brockhaus in einem Band, Online-Version, Mannheim 2003<br />
URL http://www.brockhaus.de (letzter Zugriff 11.8.2003), Menüpunkt „Nachschlagen”<br />
[5] Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung: Verglei-<br />
chende internationale Bildungsstatistik – Sachstand und Vorschläge zur Verbesserung, BLK Heft<br />
103, Bonn 2002<br />
[6] Bundesamt für Sicherheit in der Informationswirtschaft: Sicherheit im Funk-LAN<br />
(WLAN, IEEE 802.11), Projektgruppe „Local Wireless Communication”, Bonn 2002<br />
URL http://www.bsi.de/fachthem/funk_lan/wlaninfo.pdf (letzter Zugriff 22.7.2003), Kopie auf<br />
CD-ROM (wlaninfo.pdf)<br />
[7] Bundesarbeitskreis „Lernen mit <strong>Notebook</strong>s”: Lernen mit <strong>Notebook</strong>s – Wege zum selbst-<br />
ständigen Lernen, o.O. o.J.<br />
URL http://www.e-nitiative.nrw.de/projekte_notebookleitfaden.php, Verweis auf Download<br />
(letzter Zugriff 22.7.2003), Kopie auf CD-ROM (leitfaden.pdf)<br />
[8] Cedefop: Cedefop Online-Umfragen: Einschätzung des eLearning durch die Nutzer, Cedefop<br />
(Hrsg.), Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften Luxemburg 2002<br />
[9] Detecon & Diebold Consultants: E-Learning – Die zweite Welle, Eschborn 2002<br />
URL http://www.detecon.com/de/publikationen/studienbuecher.php, Verweis auf Download<br />
(letzter Zugriff 22.7.2003), Kopie auf CD-ROM (e_Learning.pdf)<br />
[10] Döbeli, Beat / Stähli, Rolf: Empfehlung zur Planung eines Ein-<strong>Notebook</strong>-pro-StudentIn-<br />
Programms (ENpS), o. O. 2001<br />
URL http://www.educeth.ch/informatik/berichte/enps/ (letzte Zugriff 22.7.2003), Kopie auf<br />
CD-ROM (enps.pdf)<br />
65
LITERATURVERZEICHNIS 66<br />
[11] Encarnação, Jóse L. / Leidhold, Wolfgang / Reuter, Andreas: Die <strong>Universität</strong> im Jahre<br />
2005, in: Bertelsmann Stiftung, Heinz Nixdorf Stiftung (Hrsg.): Studium online – Hochschul-<br />
entwicklung durch neue Medien, Gütersloh 2000<br />
[12] Encarnação, Jóse L. et al.: Technologie und Infrastruktur: Standardisieren schafft Vorteile, in:<br />
Bertelsmann Stiftung, Heinz Nixdorf Stiftung (Hrsg.): Studium online – Hochschulentwicklung<br />
durch neue Medien, Gütersloh 2000<br />
[13] Enquete-Kommission „Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft –<br />
Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft / Deutscher Bundestag (Hrsg.):<br />
Medienkompetenz im Informationszeitalter, Bonn 1997<br />
[14] Glotz, Peter: Einführung, in: Bertelsmann Stiftung, Heinz Nixdorf Stiftung (Hrsg.): Studium<br />
online – Hochschulentwicklung durch neue Medien, Gütersloh 2000<br />
[15] Graumann, Sabine / Köhne, Bärbel: E-Learning, in: NFO Intratest GmbH & Co: Moni-<br />
toring Informationswirtschaft, 5. Faktenbericht 2002 (Sekundärstudie), München 2002<br />
URL http://193.202.26.202/bmwi/Faktenbericht_5/index.htm (lezter Zugriff 11.8.2003), Kopie<br />
auf CD-ROM (MI_5.pdf)<br />
[16] Hampel, Thorsten: Virtuelle Wissensräume – Ein Ansatz für kooperative Wissensorganisa-<br />
tion, Dissertation, Paderborn 2001<br />
[17] Haefner, Klaus: ”MultiMedia” in der Hochschulausbildung / Eine nationale Infrastruktur muß<br />
entwickelt werden, Bremen 1999<br />
URL http://itgl.informatik.uni-bremen.de/seite9.htm (letzter Zugriff 11.8.2003), Kopie auf CD-<br />
ROM (MultiMedia.pdf)<br />
[18] Hendricks, Wilfried: Allgemeinbildendes Schulwesen – ein komplexer Markt, in: Thomas, Uwe<br />
et al. (Hrsg.): Anytime, Anywhere – IT-gestütztes Lernen in den USA, o. O. 2001<br />
[19] Hendricks, Wilfried: Chancen Deutschlands, in: Thomas, Uwe et al. (Hrsg.): Anytime, Any-<br />
where – IT-gestütztes Lernen in den USA, o. O. 2001<br />
[20] Hesse, Friedrich W. / Mandl, Heinz: Neue Technik verlangt neue pädagogische Konzepte,<br />
in: Bertelsmann Stiftung, Heinz Nixdorf Stiftung (Hrsg.): Studium online – Hochschulentwick-<br />
lung durch neue Medien, Gütersloh 2000<br />
[21] Holznagel, Bernd: Stellungnahme für die öffentliche Anhörung „Von der Industrie- zur Wis-<br />
sensgesellschaft: Wirtschaft, Arbeitswelt und Recht, Privatisierung und Patentierung von Wis-<br />
sen”, Münster 2001<br />
URL http://www.bundestag.de/gremien/welt/weltto/weltto126_stell004.pdf (letzter Zugriff<br />
11.8.2003), Kopie auf CD-ROM (stellungnahme.pdf)<br />
[22] Hubig, Christoph (Hrsg.): Unterwegs zur Wissensgesellschaft – Grundlagen - Trends - Pro-<br />
bleme, <strong>Berlin</strong> 2000<br />
[23] Hugger, Kai Uwe: Under Construction!, in: Schimpf, Silke (Hrsg.): Medienkompetenz – Neue<br />
Medien in Beruf, Hochschule und Gesellschaft, Köln 1999<br />
[24] Jeschke, Sabina: Mathematik in Virtuellen Wissensräumen, Dissertation, <strong>Berlin</strong> 2003
LITERATURVERZEICHNIS 67<br />
[25] Jeschke, Sabina / Zorn, Erhard: Multimedia in der Mathematikausbildung für Ingenieure<br />
Teil-Spezifikation: Navigationsframe, <strong>Berlin</strong> 2002, Kopie auf CD-ROM (navigation.pdf)<br />
[26] Klaus, Hans Gerhard: Staatliche Initiativen, in: Thomas, Uwe et al. (Hrsg.): Anytime, Any-<br />
where – IT-gestütztes Lernen in den USA, o. O. 2001<br />
[27] Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Einen europäischen Raum des lebenslan-<br />
gen Lernens schaffen, Mitteilung der Kommission, Brüssel 2001, in: Bund-Länder-Kommission<br />
für Bildungsplanung und Forschungsförderung: Vergleichende internationale Bildungsstatistik,<br />
Heft 103, Bonn 2002<br />
[28] Krause, Peter: <strong>Notebook</strong>s als Lernwerkzeuge für die Wissenschaft, in: Initiative D21 (Hrsg.):<br />
Lernen mit <strong>Notebook</strong>s in Deutschland: Präsentation und Perspektiven, Frankfurt a.M. 2002<br />
[29] NFO Worldgroup:Monitoring Informationswirtschaft, 5. Faktenbericht 2002 - E-Learning,<br />
Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit, München 2002<br />
[30] Plur, Christoph: Sichere Netzwerkeinbindung mobiler Lernwerkzeuge, in: Initiative D21<br />
(Hrsg.): Lernen mit <strong>Notebook</strong>s in Deutschland: Präsentation und Perspektiven, Frankfurt a.M.<br />
2002<br />
[31] Poser, Hans: Zwischen Information und Erkenntnis, in: Hubig, Christoph (Hrsg.): Unterwegs<br />
zur Wissensgesellschaft, <strong>Berlin</strong> 2000<br />
[32] Scheer, August-Wilhelm / Salzer, Rainer: Chancen Deutschlands auf dem E-Learning-<br />
Markt im Vergleich, in: Thomas, Uwe et al. (Hrsg.): Anytime, Anywhere – IT-gestütztes OB<br />
Lernen in den USA, Bericht, o. O. 2001<br />
[33] Scheer, August-Wilhelm: Einführung, in: Broschüre (Internet), Ministerium für Bildung,<br />
Kultur und Wissenschaft und Ministerium für Wirtschaft (Hrsg.), Saarbrücken 2001<br />
URL http://www.bildungsserver.saarland.de/referate/g1/broschuere_k.PDF (letzter Zugriff<br />
11.8.2003), Kopie auf CD-ROM (saarland21.pdf)<br />
[34] Schelhowe, Heidi: Lerngemeinschaften fördern — Wissen strukturieren / Digitale Medien und<br />
die Rolle der <strong>Universität</strong>en, in: <strong>Universität</strong> Erfurt und Heinrich Böll Stiftung (Hrsg.), S. 41-60:<br />
<strong>Universität</strong>en in der Wissensgesellschaft, München 2001<br />
[35] Schestak, Susanne: Bildungsportale - neue Zugänge zu Wissen, in: Scheuermann, Friedrich<br />
(Hrsg.): Campus 2000 - Lernen in neuen Organisationsformen, Münster 2000<br />
[36] Schereumann, Friedrich (Hrsg.): Campus 2000 – Lernen in neuen Organisationsformen,<br />
Münster 2000<br />
[37] Schimpf, Silke (Hrsg.): Medienkompetenz – Neue Medien in Beruf, Hochschule und Gesell-<br />
schaft, Köln 1999<br />
[38] Schulmeister, Rolf: Grundlagen hypermedialer Lernsysteme, 2. aktualisierte Auflage, Mün-<br />
chen 1997<br />
[39] Schulmeister, Rolf: Virtuelle <strong>Universität</strong> – Virtuelles Lernen, München 2001<br />
[40] Siebenkrüb, Horst: Technik für Lehre und Lerner, in: Initiative D21 (Hrsg.): Lernen mit<br />
<strong>Notebook</strong>s in Deutschland: Präsentation und Perspektiven, Frankfurt a.M. 2002
LITERATURVERZEICHNIS 68<br />
[41] Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Informationsgesellschaft, Wiesbaden 2002<br />
[42] Steinbicker, Jochen: Zur Theorie der Informationsgesellschaft – Ein Vergleich der Ansätze<br />
von Peter Drucker, Daniel Bell und Manuel Castells, Lehrtexte Soziologie, Opladen 2001<br />
[43] Thomas, Uwe et al. : Anytime, Anywhere – IT-gestütztes Lernen in den USA, Bundesmini-<br />
sterium für Bildung und Forschung (Hrsg.), o.O. 2001<br />
[44] Timm, Michael / Haefner, Klaus: Bericht über die Fallstudie „<strong>Notebook</strong>s als wesentlicher<br />
Bestandteil der Lehrerausbildung an der <strong>Universität</strong> Bremen”, Bremen 2000<br />
[45] Tavangarian, Djamshid et al.: Organisation und Betrieb einer Beratungsstelle zum Einsatz<br />
drahtloser Kommunikationsinfrastruktur an deutschen Hochschulen, Abschlussbericht 2000 der<br />
BMBF-Initiative zur Förderung von Demonstrationsprojekten für die Funkvernetzung (WLAN)<br />
von Hochschulen, Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.), Abschlussbericht, Ber-<br />
lin 2001(a)<br />
[46] Tavangarian, Djamshid et al.: Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten von <strong>Notebook</strong>s in<br />
Lehre und Ausbildung an Hochschulen, Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.),<br />
Studie, <strong>Berlin</strong> 2001(b)<br />
[47] Wagner, Erwin: Innovationsinstrumente – oder: Wie kommen Hochschulen mit dem Einsatz<br />
der Neuen Medien in der Lehre wirklich voran?, in: Scheuermann, Friedrich (Hrsg.): Campus<br />
2000 – Lernen in neuen Organisationsformen, Münster 2000<br />
[48] Wöhe, Günter: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 19. Auflage, München<br />
1996
Anhang A<br />
Inhalt der CD-ROM<br />
Auf dem Datenträger finden sich die im Literaturverzeichnis aufgeführten Dokumente<br />
aus dem Internet als Kopien. Diese Arbeit ist im Portable Document Format (pdf)<br />
ebenfalls auf der CD-ROM gespeichert (dipl.pdf).<br />
69
Erklärung<br />
Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und<br />
ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht<br />
benutzt und die aus anderen Quellen entnommenen Stellen als solche gekennzeichnet<br />
habe.<br />
<strong>Berlin</strong>, am 19.8.2003<br />
Michael Jeschke<br />
70