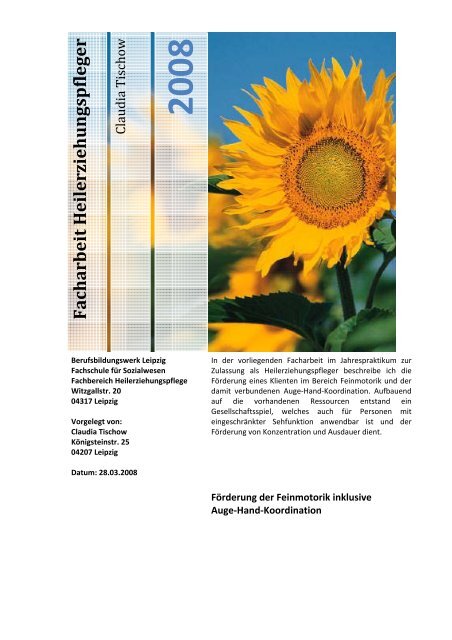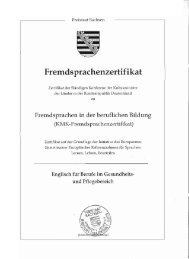2008 Facharbeit Heilerziehungspfleger - ICE-BREAKERZ.DE
2008 Facharbeit Heilerziehungspfleger - ICE-BREAKERZ.DE
2008 Facharbeit Heilerziehungspfleger - ICE-BREAKERZ.DE
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Facharbeit</strong> <strong>Heilerziehungspfleger</strong><br />
Claudia Tischow<br />
<strong>2008</strong><br />
Berufsbildungswerk Leipzig<br />
Fachschule für Sozialwesen<br />
Fachbereich Heilerziehungspflege<br />
Witzgallstr. 20<br />
04317 Leipzig<br />
Vorgelegt von:<br />
Claudia Tischow<br />
Königsteinstr. 25<br />
04207 Leipzig<br />
Datum: 28.03.<strong>2008</strong><br />
In der vorliegenden <strong>Facharbeit</strong> im Jahrespraktikum zur<br />
Zulassung als <strong>Heilerziehungspfleger</strong> beschreibe ich die<br />
Förderung eines Klienten im Bereich Feinmotorik und der<br />
damit verbundenen Auge‐Hand‐Koordination. Aufbauend<br />
auf die vorhandenen Ressourcen entstand ein<br />
Gesellschaftsspiel, welches auch für Personen mit<br />
eingeschränkter Sehfunktion anwendbar ist und der<br />
Förderung von Konzentration und Ausdauer dient.<br />
Förderung der Feinmotorik inklusive<br />
Auge‐Hand‐Koordination
[1]<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
0 Vorwort................................................................................................................. 2<br />
Theorie............................................................................................................................ 3<br />
1 Theoretische Grundlagen..................................................................................... 4<br />
1.1 Das Klientel der Förderschule ......................................................................... 4<br />
1.2 Was bedeutet Behinderung?........................................................................... 5<br />
1.3 Geistige Behinderung in Literatur und Gesellschaft ....................................... 6<br />
1.4 Das Noonan-Syndrom................................................................................... 12<br />
1.5 Auge-Hand-Koordination............................................................................... 13<br />
Praxis............................................................................................................................ 15<br />
2 Den Klienten im Fokus....................................................................................... 16<br />
2.1 Biographische Daten ..................................................................................... 16<br />
2.2 Die Einschulung in die Förderschule Rosenweg ........................................... 16<br />
3 Ziele der Förderung............................................................................................ 17<br />
3.1 Grobziel ......................................................................................................... 17<br />
3.2 Feinziel .......................................................................................................... 18<br />
4 Material und Methoden ..................................................................................... 18<br />
5 Durchführung der Förderung.............................................................................. 19<br />
5.1 Die erste Fördereinheit – Vorstellung des Projektes ..................................... 20<br />
5.2 Die zweite Einheit – Schulung der Auge-Hand-Koordination ........................ 20<br />
5.3 Einheit 3 – Linien schneiden.......................................................................... 20<br />
5.4 Die vierte Einheit – ein Clown zum Fasching ................................................ 21<br />
5.5 Einheit Fünf – Fensterdekoration mit Fingerfarben ....................................... 21<br />
5.6 Die sechste Fördereinheit - Osterkörbchen................................................... 22<br />
Reflexion – erste Zwischenauswertung ........................................................................ 23<br />
6 Ein erster Soll-Ist-Vergleich................................................................................ 24<br />
7 Ausblick auf die weitere Förderung.................................................................... 24<br />
Quellenverzeichnis ....................................................................................................... 26<br />
Anlagen......................................................................................................................... 28<br />
Anlage 1 – Beobachtungsnotizen von 2005..............................................................A1<br />
Anlage 2 – Einschätzung im Schuljahr 2006/2007....................................................A2<br />
Anlage 3 - Erklärung zur Verwendung persönlicher Daten und Fotos in der<br />
<strong>Facharbeit</strong> .................................................................................................................A3<br />
Eidesstattliche Versicherung.....................................................................................A4
0 Vorwort<br />
[2]<br />
Als ich 1997 meine Vorausbildung zum Sozialassistenten begann, wusste ich<br />
noch nicht, auf welchen Schwerpunktbereich ich mich festlegen werde. Meine<br />
Interessen für die Pflegemaßnahmen ließen mich in Richtung Altenpflege<br />
tendieren. Einige Jahre später wurde ich Mutter einer kleinen Tochter. Die<br />
pränatalen Untersuchungen blieben stets ohne Befund. Je näher der Geburtstermin<br />
rückte, quälten mich Fragen. Was ist, wenn mein Kind nicht gesund ist?<br />
Würde mein Kind ohne größere Probleme in der Gesellschaft klarkommen? Wie<br />
könnten wir mit einer möglichen Behinderung umgehen?<br />
Die Entwicklung meiner Tochter verlief nach einer anfänglichen Verzögerung<br />
normal. Die Sprache und Feinmotorik entsprach jedoch nicht dem Stand eines<br />
Gleichaltrigen. Eine kurzzeitige Ergotherapie und mehrjährige Logopädie bewirkten<br />
jedoch ein Nachholen der geforderten Fähigkeiten.<br />
Die Erlebnisse seit der Geburt meines Kindes veränderten meine Prioritäten im<br />
Beruf. Schon das zweite Praktikum in einer Förderschulklasse stärkte mich in<br />
der Entscheidung, künftig vermehrt mit Kindern zu arbeiten. Ihre Offenheit und<br />
Freiheit von Vorurteilen eröffnen mir die Realisierung kreativer Fördermöglichkeiten.
[3]<br />
Theorie
1 Theoretische Grundlagen<br />
[4]<br />
Die 1993 eröffnete Förderschule am Rosenweg in Leipzig Grünau bietet viele<br />
Möglichkeiten zur individuellen Förderung. Bis 1991 wurde das 1978 erbaute<br />
Gebäude als Kindergrippe und Kindergarten genutzt. In der näheren Umgebung<br />
befinden sich weitere Bildungseinrichtungen wie Grund- und Mittelschulen, ein<br />
Gymnasium, eine Förderschule für Blinde und Sehschwache, der Jugendclub<br />
„Völkerfreundschaft“ mit einem reichhaltigen Kulturangebot, das Allee-Center<br />
sowie zwei kleinere Parks, von denen sich einer direkt an das Schulgelände anschließt<br />
und zu Spaziergängen zur Entspannung einlädt.<br />
Mit anfangs nur 64 Schülern, ist die Schule in diesem Schuljahr mit 96 Schülern<br />
im Alter von 6-18 Jahren gut besucht. Aufgeteilt in 12 Klassen, arbeiten und lernen<br />
die Schüler in kleinen Gruppen. Jede Klassenstufe umfasst drei der festgelegten<br />
zwölf Schuljahre. Die Schule verfügt nach den umfangreichen Umbaumaßnahmen<br />
vor der Eröffnung und während des Schuljahres 2002/2003 über<br />
ein großzügiges Raumangebot, einen Personenaufzug, ein Bewegungsbecken,<br />
Snoozelraum, Töpferwerkstatt sowie für die älteren Schüler eine Lehrküche,<br />
Wäscheraum und einen Medienraum.<br />
Neben den 19 Lehrern sichert in jeder Klasse eine Pädagogische Unterrichtshilfe<br />
(PU) die individuelle Förderung der Schüler ab.<br />
1.1 Das Klientel der Förderschule<br />
Die Vielzahl der unterschiedlichen Diagnosen bei den Schülern an der Förderschule<br />
für geistig Behinderte erfordert eine individuelle Einstellung auf jedes<br />
Kind der Klasse, vor allem auf dessen Ressourcen.<br />
Entsprechend dem Profil der Schule sind die Schüler geistig behindert. Neben<br />
den Defiziten bei der geistigen Entwicklung sind häufig auch körperliche Einschränkungen<br />
zu beobachten. Ich absolviere mein Jahrespraktikum in einer<br />
Unterstufenklasse mit acht Schülern, die sich aus fünf Jungen und drei Mädchen<br />
zusammensetzt. Neben mittelgradigen bis schweren Intelligenzminderungen,<br />
Verdacht auf Hirnorgan – Psychosyndrom und hyperaktiver Verhaltensstörung<br />
sind häufig weitere Diagnosen mit unterschiedlicher Ausprägung in den
[5]<br />
Akten dokumentiert. Die weiteren Diagnosen umfassen u.a. cerebrale Bewegungsstörungen,<br />
epileptisches Anfallsleiden, Sehbehinderungen, Hyperaktivität,<br />
Autismus und Muskelhypotonie. Zwei Schüler der Klasse zeigen<br />
verschiedene Syndromerkrankungen. Im ersten Fall handelt es sich um ein<br />
Fehlbildungs-Retardierungs-Syndrom und bei dem zweiten Schüler um das<br />
Morbus L. Down-Syndrom.<br />
Allen Schülern soll neben einem Schulabschluss eine Integration in ein weitgehend<br />
„normales“ gesellschaftliches Leben ermöglicht werden. Neben dem<br />
Training der Konzentration und Ausdauer erfolgen häufig ein Ausbau der<br />
körperlichen Fähigkeiten und die Gewinnung größtmöglicher Selbständigkeit in<br />
allen Lebensbereichen. Weiterhin werden die Kommunikationsfähigkeit, lebenspraktische<br />
Bildung, Verhaltenserziehung und die Grob- und Feinmotorik geschult.<br />
Die Bildungs- und Erziehungsziele orientieren sich am Lehrplan und<br />
dem sonderpädagogischen Förderbedarf der einzelnen Schüler.<br />
Neben der täglichen Förderung in der Gruppe habe ich mich auf eine Intensivförderung<br />
eines Schülers spezialisiert, welcher mir durch eine verminderte<br />
Feinmotorik und gestörte Auge-Hand-Koordination auffiel. Bisher erhielt er nur<br />
eine Förderung von 45 Minuten pro Woche und eine ergänzende Physio- und<br />
Ergotherapie. Von den Übungen mit meiner Tochter inspiriert, überlegte ich mir<br />
eine Fördermethode für ihn. Bis zur Umsetzung der Förderung waren jedoch<br />
zahlreiche Überlegungen zu den Materialien, vorhandenen Ressourcen und<br />
deren Nutzung nötig.<br />
1.2 Was bedeutet Behinderung?<br />
Das Profil der Förderschule am Rosenweg ist auf geistig Behinderte ausgelegt.<br />
Bei den Spaziergängen im nahegelegenen Park trifft man häufig auf verunsicherte,<br />
mitleidige aber ebenso vorurteilsvolle Blicke und Bemerkungen von<br />
Passanten, die das Selbstwertgefühl der Kinder teilweise stark verletzen<br />
können. Man kann sich jedoch heute leichter als vor einigen Jahren oder<br />
Jahrzehnten über Behinderungen informieren. Viele Menschen verdrängen das<br />
Thema aus Angst vor dem „anders sein“. Dabei gibt es neben zweifelhaften<br />
Onlineinhalten auch wissenschaftliche Informationen im Internet. Für die ein-
[6]<br />
zelnen Behinderungsarten und Stufen gibt es unterschiedliche Definitionen.<br />
Zum einen gilt die allgemeine Definition nach der WHO, zum anderen zahlreiche<br />
Definitionen von Spezialisten aus den unterschiedlichsten Fachbereichen.<br />
Die Quelle der Definition bestimmt dabei die Eingrenzung auf einzelne<br />
Bereiche oder eine Allgemeingültigkeit. Die Bezeichnung „Behinderung“<br />
erweckt einen etwas abwertenden Eindruck. Einschränkungen oder Beeinträchtigungen<br />
beschreiben die Situation treffender.<br />
Definition von „Behinderung“ nach<br />
WHO SGB IX<br />
Aufgrund einer Erkrankung, angeboren-<br />
en Schädigung oder eines Unfalls als<br />
Ursache entsteht ein dauerhafter ge-<br />
sundheitlicher Schaden.<br />
Der Schaden führt zu einer funktionalen<br />
Beeinträchtigung der Fähigkeiten und<br />
Aktivitäten des Betroffenen.<br />
Die soziale Beeinträchtigung (handicap)<br />
ist Folge des Schadens und äußert sich<br />
in persönlichen, familiären und gesell-<br />
schaftlichen Konsequenzen.<br />
Menschen sind behindert, wenn ihre<br />
körperliche Funktion, geistige Fähig-<br />
keit oder seelische Gesundheit mit<br />
hoher Wahrscheinlichkeit länger als<br />
sechs Monate von dem für das<br />
Lebensalter typischen Zustand ab-<br />
weichen und daher ihre Teilhabe am<br />
Leben in der Gesellschaft beein-<br />
trächtigt ist. Sie sind von Behinder-<br />
ung bedroht, wenn eine Beein-<br />
trächtigung zu erwarten ist.<br />
(Neuntes Buch Sozialgesetzbuch, 2001)<br />
(WHO: ICIDH-2, 1998)<br />
Gegenüberstellung der Definitionen nach WHO und SGB IX<br />
1.3 Geistige Behinderung in Literatur und Gesellschaft<br />
Analog des allgemeinen Begriffs Behinderung bedient man sich in den verschiedenen<br />
Behinderungsarten auch abweichender Definitionen aufgrund<br />
unterschiedlichster Betrachtungswinkel. Geschichtlich gesehen dienten die Einstufungen<br />
und diskriminierenden Bezeichnungen nicht nur der Einstufung bei<br />
Behörden, die über einen Pflegezuschuss entschieden, sondern vor allem im<br />
Dritten Reich der Rechtfertigung für Aktivitäten der Euthanasie. Behinderte<br />
wurden für die Erforschung effizienter Vernichtungstechniken missbraucht bzw.
[7]<br />
„zur Sicherung der Evolution der deutschen Rasse“ eliminiert. Erst in den<br />
folgenden Jahren gelang der Durchbruch für eine würdige Behandlung von behinderten<br />
Menschen. Gesetzliche Vorschriften regeln heute die Behandlung von<br />
Menschen, gleich welcher Art von Einschränkung sie unterliegen.<br />
1.3.1 Definition der WHO<br />
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 2001 die Definition für geistige<br />
Behinderung von 1980 (ICIDH) aktualisiert. Bisher bediente man sich der<br />
Begriffe Schädigung (impairment), dem körperlichen oder mentalen „Defekt“,<br />
Funktionsbeeinträchtigung (disability), die individuellen Auswirkungen der<br />
Schädigung und der sozialen Beeinträchtigung (handicap), der gesellschaftlichen<br />
Benachteiligung durch Barrieren. Alle 3 Bereiche beschrieben die<br />
Behinderung. Im Jahr 2001 wurde die neue Einteilung verabschiedet und liegt<br />
seit 2004 auch in deutscher Sprache vor. Die sogenannte „Internationale<br />
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (ICF) soll<br />
eine verbesserte Rehabilitation ermöglichen. Die WHO hält an der Dreiteilung<br />
fest, hat jedoch die Begrifflichkeiten und die damit einhergehenden Definitionen<br />
geändert.<br />
1. körperliche Schädigung<br />
2. individuelle Aktivitätsbeeinträchtigung<br />
3. gesellschaftliche Partizipationseinschränkung (z.B. gesellschaftliche Normen)<br />
Die Neuerung in der WHO-Definition liegt auch in der Einbeziehung von<br />
Umweltfaktoren wie Assistenz- oder Heilmittelbedarf, Alter und Geschlecht. In<br />
jeder Kategorie wird jeweils eingeteilt, ob die körperliche, individuelle und<br />
gesellschaftliche Behinderung kein, ein geringes, ein gemäßigtes, ein schweres<br />
oder vollständiges Problem darstellt. Gemessen wird jedoch an der Norm von<br />
Menschen ohne Behinderung, was von Behindertenbewegungen kritisiert wird.<br />
Die Ergebnisse ergeben ein umfassendes Bild über die Gesundheitscharakteristik.<br />
Nach dieser Definition wird die Bezeichnung „behinderter<br />
Mensch“ durch „Mensch mit Aktivitätsbeeinträchtigung“ abgelöst. Der Grundsatz<br />
der WHO besagt jedoch: “Menschen haben ein Recht darauf, so genannt<br />
zu werden, wie sie es wünschen!“. In der ICF wurde auf den Begriff „geistig
[8]<br />
behinderte Person“ bewusst verzichtet und durch „Person mit einem Problem<br />
im Lernen“ ersetzt. Die ICF stellt einen Kompromiss zwischen dem medizinischen<br />
und dem sozialen Modell von Behinderung dar. Während das medizinische<br />
Modell die Behinderung als ein persönliches Problem begrenzt und die<br />
Einschränkung an der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eine Folge der<br />
Schädigung darstellt. Beim sozialen Modell von Behinderung wird jedoch das<br />
Problem in der Umwelt, durch die der Mensch behindert wird, gesehen. Die<br />
WHO vereint beide Ansichten, indem eine Behinderung aus Barrieren in der<br />
Umwelt oder aus einer Schädigung resultieren kann. Die Umsetzung der ICF in<br />
die soziale Gesetzgebung ist jedoch bisher nicht ausreichend realisiert wurden.<br />
1.3.2 Definition des BSHG<br />
Häufig wird die körperliche Einschränkung priorisiert. Im Bundessozialhilfegesetz<br />
(BSHG) heißt es noch immer: „Geistig wesentlich behindert …<br />
sind Personen, bei denen in Folge einer Schwäche ihrer geistigen Kräfte die<br />
Fähigkeit zur Eingliederung in die Gesellschaft in erheblichem Umfang beein-<br />
trächtigt ist.“. (Neuntes Buch Sozialgesetzbuch, 2001) In der Medizin bedient man<br />
sich der Beschreibung vererbter oder frühzeitig erworbener psychischer<br />
Zustände, die hauptsächlich die Intelligenz betreffen und durch den Fachbegriff<br />
Oligophrenie bezeichnet werden.<br />
1.3.3 geistige Behinderung aus medizinischer Sicht<br />
In der Psychologie spricht man von einer Retardierung der Intelligenz (IQ unter<br />
65) und geht häufig von einer allgemeinen Retardierung aus, obwohl manchmal<br />
nur bestimmte geistige Fähigkeiten betroffen sind. In der Internationalen statistischen<br />
Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme,<br />
10. Revision (ICD-10) unterteilt man sechs Formen der Intelligenzminderung<br />
(F70-79) mit jeweils vier Unterteilungen des Ausmaßes der Verhaltensstörungen.<br />
F70 Leichte Intelligenzminderung (IQ 50-69):<br />
Bei einem Erwachsenen entspricht dies einem Intelligenzalter von neun bis<br />
unter zwölf Jahren. Es kommt zu Lernschwierigkeiten in der Schule. Viele<br />
Erwachsene können arbeiten und gute soziale Beziehungen unterhalten.
[9]<br />
F71 Mittelgradige Intelligenzminderung (IQ 35-49):<br />
Diese Stufe entspricht bei einem Erwachsenen einem Intelligenzalter von sechs<br />
bis unter neun Jahren. Nach einer deutlichen Entwicklungsverzögerung in der<br />
Kindheit können die meisten ein gewisses Maß an Unabhängigkeit erreichen<br />
und eine ausreichende Kommunikationsfähigkeit und Ausbildung erwerben.<br />
F72 Schwere Intelligenzminderung (IQ 20-34):<br />
Es ist eine andauernde Unterstützung nötig, da das Intelligenzalter eines Erwachsenen<br />
bei 3 bis unter 6 Jahren liegt.<br />
F73 Schwerste Intelligenzminderung (IQ unter 20):<br />
Dies entspricht einem Intelligenzalter von unter drei Jahren. Die eigene Versorgung,<br />
Kontinenz, Kommunikation und Beweglichkeit sind hochgradig beeinträchtigt.<br />
Zu den Diagnosen F70 bis F79 kann das Ausmaß der Verhaltensstörung durch<br />
eine 4. Stelle angegeben werden.<br />
.0 keine oder geringfügige Verhaltensstörung<br />
.1 deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert<br />
.8 sonstige Verhaltensstörung<br />
Die einzelnen Entwicklungsstörungen können entsprechend den betroffenen<br />
Bereichen durch die Diagnosenschlüssel F80-F89 beschrieben werden.<br />
1.3.4 geistige Behinderung aus der Sicht der Pädagogik<br />
Etwas neutraler fällt die Definition in der Pädagogik durch die Bildungskommission<br />
des Deutschen Bildungsrates 1973 aus: „geistig behindert ist, wer<br />
infolge einer organisch-genetischen oder anderweitigen Schädigung in seiner<br />
psychischen Gesamtentwicklung und seiner Lernfähigkeit so beeinträchtigt ist,<br />
daß er voraussichtlich lebenslanger sozialer und pädagogischer Hilfen bedarf.<br />
Mit den kognitiven Beeinträchtigungen gehen solche der sprachlichen, sozialen,<br />
emotionalen und der motorischen einher. Eine „untere Grenze“ sollte weder<br />
durch Angabe von IQ-Werten noch durch Aussprechen einer Bildungsunfähigkeit<br />
festgelegt werden, da grundsätzlich bei allen Menschen die Bil-
[10]<br />
dungsfähigkeit angenommen werden muß.“. (<strong>DE</strong>UTSCHER BILDUNGSRAT zitiert<br />
nach HENSLE, 1988, 16 f.)<br />
1.3.5 Einteilung nach Gustav-Peter Hahn<br />
Einen wichtigen Stellenwert bei der Arbeit mit Behinderten nimmt der Pädagoge<br />
und Theologe Gustav-Peter Hahn mit seiner Einstufung der Klienten nach<br />
Ressourcen ein. Dabei werden neben den Beeinträchtigungen die vorhandenen<br />
Ressourcen zur Beurteilung in den Vordergrund gesetzt. In seiner Publikation<br />
„Hilfen für das Zusammenleben mit geistig Behinderten“ definiert er in der<br />
Edition Marhold: „Geistig Behinderte sind Menschen, die in der unmittelbaren<br />
Lebensbewältigung auf Hilfe bzw. spezielle Begleitung angewiesen sind.<br />
Entsprechend dem Grad der Behinderung wird diese Hilfe recht unterschiedlich<br />
aussehen. Sie reicht von der Pflege mit pädagogischen Akzenten bis zur<br />
Pädagogik mit pflegerischen Akzenten.“ Damit betont er, dass Hilfe nur dort<br />
erfolgen soll, wo sie unbedingt notwendig ist. Der behinderte Mensch soll<br />
jedoch Tätigkeiten, die er autonom durchführen kann, selbst bewältigen. Ein<br />
Eingriff in die Möglichkeiten des Behinderten würde ihn in seiner eigenen<br />
Persönlichkeit einschränken. In seinen Überlegungen, die bisher noch nicht<br />
vollständig in der Praxis umgesetzt werden, geht er von einer Entwicklung mit<br />
Zunahme an Fähigkeiten aus. Seine eigenen Erfahrungen mit geistig Behinderten<br />
zeigten eine Entwicklung der Motorik, Motivation und kognitiven Fähigkeiten.<br />
Er teilt die Menschen nach dem Entwicklungsstand ein und entwickelte<br />
entsprechende Förderprogramme. Hahn betrachtet die Entwicklung in Richtung<br />
Normalität und beschreibt nicht den aktuellen Stand der Fähigkeiten. Seine<br />
Einteilung beruht auf vier Ebenen. Die Steigerungen der vorhandenen<br />
Ressourcen, die ich mit „*“ kennzeichne, werden in den detaillierten Beschreibungen<br />
der einzelnen Gruppen durch Gustav-Peter Hahn erkenntlich.<br />
* ein- und ausdrucksfähige geistig Behinderte<br />
** gewöhnungsfähige geistig Behinderte<br />
*** erfahrungsfähige geistig Behinderte<br />
**** sozial handlungsfähige geistig Behinderte<br />
Die Einstufung nach Hahn weicht von der ursprünglichen Einteilung in der
Psychiatrie deutlich ab.<br />
Psychiatrie Pädagogik<br />
Idiotie<br />
Imbezillität<br />
Debilität<br />
[11]<br />
ein- und ausdrucksfähige geistig Behinderte<br />
Der Ausdruck erfolgt nicht über Sprache, sondern durch Mimik und<br />
Gestik. Bei wiederkehrenden Situationen ist ein Wortverständnis<br />
feststellbar.<br />
gewöhnungsfähige geistig Behinderte<br />
Sie sind zu Kontakt und Aktivität fähig, wenn diese vom Erzieher<br />
entgegengebracht werden. Sie können jedoch nicht von sich aus<br />
auf andere Personen in sinnvoller Weise zugehen oder aktiv<br />
werden. Durch ständige Wiederholungen kann man Dinge von den<br />
Behinderten verlangen, die über die Erfüllung primärer Bedürfnisse<br />
hinausgehen. Diese Aktivitäten können nur bei Anwesenheit des<br />
Erziehers und nach ständiger Aufforderung erwartet werden.<br />
erfahrungsfähige geistig Behinderte<br />
Die Behinderten fallen durch selbständige Kontaktaufnahme und<br />
Aktivitäten in der vertrauten Umgebung auf. Dabei greifen sie auf<br />
eigene Erfahrungen zurück und nutzen ihre Fähigkeit, Vergleiche<br />
anzustellen und Unterschiede zu erkennen.<br />
sozial handlungsfähige geistig Behinderte<br />
Mit zunehmendem Alter passen sich diese Personen an normale<br />
Verhaltensweisen an und erfragen die Umgebung über die<br />
Wohnung, Gruppe und vertraute Umgebung hinaus. Mit Hilfe der<br />
Sprache drückt er sich nicht nur über alltägliche Dinge aus,<br />
sondern beschäftigt sich auch mit der Gestaltung seiner Zukunft.<br />
Gegenüberstellung derEinteilung in Psychiatrie und Pädagogik nachGustav-Peter Hahn<br />
Die einzelnen Stufen überschneiden sich aufgrund der Betrachtung vorhandener<br />
Ressourcen. Anhand der vorliegenden Einteilungen nach Hahn ist es
[12]<br />
möglich, die Grundlagen für die Förderung einer Person zu legen. Die Betrachtung<br />
der Diagnosen und gegebenen Ressourcen meines Klienten für eine<br />
Förderung erforderten jedoch auch das Auseinandersetzen mit seiner Syndromerkrankung<br />
und dem möglichen Zusammenhang mit seiner gestörten Auge-<br />
Hand-Koordination.<br />
1.4 Das Noonan-Syndrom<br />
Genetisch bedingte, komplexe Entwicklungsstörungen, die dem Ullrich-Turner-<br />
Syndrom ähnlich sind, werden als Noonan-Syndrom bezeichnet. Es wird durch<br />
eine Vielzahl von Fehlbildungen an den inneren Organen und äußeren Erscheinungen<br />
gekennzeichnet. Die Bezeichnung des Syndroms geht auf die USamerikanische<br />
Kinderkardiologin Jaqueline Noonan zurück, die 1963 der Erkrankung<br />
den Namen verlieh. Im Gegensatz zum U.-Turner-Syndrom sind keine<br />
Chromosomenanomalien in Form von veränderter Anzahl oder Struktur<br />
nachweisbar. Bei ca. 40-50% der Betroffenen wurde ein Defekt am PTPN 11-<br />
Gen auf dem langen Arm des Chromosoms 12 festgestellt. Das PTPN 11-Gen<br />
codiert das SHP-2 Protein, das eine wichtige Regulationsfunktion bei der<br />
Signalübertragung von Wachstumsfaktoren hat. Dieser Gendefekt wird<br />
autosomal-dominant vererbt und ist mit einer Häufigkeit von 1 Erkrankung pro<br />
1000-1500 Geburten, unabhängig vom Geschlecht, recht weit verbreitet. Ein<br />
Einfluss von äußeren Fakturen wie verschiedene Medikationen oder Infektionen<br />
während der Schwangerschaft können nicht sicher ausgeschlossen werden.<br />
Die Diagnose erfolgt meist aufgrund der Symptome. Ein genetischer Test und<br />
die vorgeburtliche Untersuchung sind inzwischen möglich. Eine Behandlungsmöglichkeit<br />
der Krankheit existiert derzeit noch nicht. Man beschränkt sich auf<br />
die symptomatische Therapie, z. B. durch operative Korrekturen an Organen.<br />
Die typischen Symptome sind der weniger ausgeprägte Kleinwuchs gegenüber<br />
dem U.-Turner-Syndrom, ein tiefer Haaransatz im Nacken sowie Organfehlbildungen<br />
an Herz, Nieren und Skelett. Bei männlichen Betroffenen ist eine<br />
gestörte Entwicklung der Geschlechtsorgane z. B. ein fehlender Eintritt des<br />
Hodens in den Hodensack, als Kryptorchismus bezeichnet, oder sogar eine<br />
Hodenaplasie, das Fehlen eines Hodens, erkennbar. Die Geschlechtsentwick-
[13]<br />
lung verläuft bei Mädchen, abgesehen von einer zeitlichen Verzögerung, meist<br />
normal.<br />
Erbanlagen der Mutter<br />
1.5 Auge-Hand-Koordination<br />
Vererbungsschema des autosomal dominanten Erbgangs<br />
Das Zusammenspiel der optischen Wahrnehmung und der gezielten und kontrollierten<br />
Bewegung der Arme und vor allem der Hände ist die Grundlage für<br />
die Feinmotorik. Um diese Einheit zu verstehen, muss man sich mit den einzelnen<br />
Begriffen visuelle Wahrnehmung, Reizverarbeitung, Motorik und Koordination<br />
auseinandersetzen.<br />
1.5.1 visuelle Wahrnehmung<br />
Die optischen Reize aus der Umwelt werden über zahlreiche Sinneszellen in<br />
der Netzhaut (Retina) des Auges aufgenommen. Die dabei entstehenden elektrischen<br />
Impulse werden über den Sehnerv (Nervus opticus) vertikal gespiegelt<br />
in die Sehrinde im Hinterhauptlappen des Gehirns (Cerebrum) weitergeleitet.<br />
1.5.2 Reizverarbeitung<br />
Erbanlagen des Vaters<br />
gesundes Gen defektes Gen<br />
gesundes Gen gg gd<br />
defektes Gen dg dd<br />
Ein autosomal dominanter Erbgang bewirkt den Ausbruch<br />
einer Krankheit bei Auftreten eines defekten Chromomes<br />
im diploiden Chromosomensatz.<br />
Die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung liegt bei 3:1, dies<br />
entspricht einer Quote von 75%.<br />
Die im Gehirn ankommenden elektrischen Impulse werden mit eventuell vorhandenen<br />
Informationen abgeglichen und gespeichert. Ist eine motorische
[14]<br />
Reaktion notwendig, wird über die absteigenden (efferenten) Nervenbahnen<br />
des Rückenmarks (Medulla spinalis) ein Impuls entlang der Membranoberfläche<br />
zu den entsprechenden Muskelzonen gesendet. Erregt durch diese Impulse finden<br />
in den Muskeln chemische Reaktionen statt, die zu einer Kontraktion und<br />
anschließender Erschlaffung der Muskelfasern führen.<br />
1.5.3 Motorik<br />
Motorik umfasst alle Bewegungsabläufe eines Organismus durch Muskelarbeit.<br />
Während die Bewegungen des Kopfes, der Arme und Beine, des Rumpfes etc.<br />
unter den Begriff Grobmotorik fallen, zählen die Bewegungen der Finger, Zehen<br />
und des Gesichtes zur Feinmotorik. Unabhängig von den Körperregionen<br />
versteht man Motorik als kontrollierte, willkürliche Bewegung durch ein harmonisches<br />
Zusammenspiel der für eine Bewegung notwendigen Muskeln.<br />
1.5.4 Koordination<br />
Die ersten gesteuerten Bewegungen beginnen beim Menschen bereits im<br />
vierten Lebensmonat. Das anfangs noch etwas unkontrollierte Greifen bildet<br />
sich im Laufe der Zeit zu einem gezielten Griff aus. Man bezeichnet diese Entwicklung<br />
auch als Differenzierung. Dabei kommt es zu einer Verbindung von<br />
sensorischen und motorischen Funktionen. Diese Sensomotorik ist jedoch nur<br />
uneingeschränkt möglich, wenn die Bewegung aufgrund von ungestörten<br />
Sinnesrückmeldungen gesteuert und kontrolliert werden kann.<br />
Aufbauend auf die theoretischen Grundlagen kann man das eigene Klientel<br />
besser beurteilen und eine entsprechende Förderung planen. Neben den<br />
Krankheitsbildern ist eine Betrachtung der Klienten als einzelne Individuen<br />
nötig. Die Individualität jedes Menschen soll gewahrt und gefördert werden.
[15]<br />
Praxis
3.2 Feinziel<br />
[18]<br />
Um der Arbeit in der Mittelstufe gerecht zu werden, muss Malvyn konzentrierter<br />
arbeiten. Daraus ergibt sich als Feinziel, dass er bei den Übungen konzentriert<br />
auf die Arbeitsblätter schaut, ohne sich von seiner Umwelt ablenken zulassen.<br />
Malvyn lernt, vorgegebenen Linien zu folgen und Formen innerhalb ihrer<br />
Grenzen ordentlich auszumalen. Erschwerend wirkt sich dabei seine Erkrankung<br />
aus, bei der sich seine Augen schnell zur Seite bewegen.<br />
4 Material und Methoden<br />
Malvyns Neugier nach neuen, ausgefallenen Dingen in seiner Umgebung lässt<br />
sich gut für eine individuelle Förderung nutzen. Es entstand die Idee, ein<br />
Brettspiel zu gestalten, das auch von den anderen Schülern seiner Klasse<br />
genutzt werden kann. Dabei stand die Überlegung im Raum, dass einzelne<br />
Mitschüler von Malvyn zum Teil eine stark ausgeprägte Sehstörung haben und<br />
das Spielbrett trotzdem gut erkennen sollen, sowie durch unkontrollierte Bewegungen<br />
die Spielfiguren nicht verschoben werden • •<br />
können. Diese Anforderungen an das Spiel ließen • •••<br />
•••<br />
•<br />
mich zu dem Entschluss kommen, das Spielbrett des •••••••<br />
••• •••<br />
von den Spielregeln leicht verständlichen „Mensch •••••••<br />
ärgere dich nicht“ leicht abzuwandeln und durch kleine •••<br />
• ••• •<br />
Hilfsmittel an die Bedürfnisse der Gruppe anzupassen.<br />
• •<br />
Abgewandeltes Spielbrett von „Mensch ärgere dich nicht“<br />
Die Auswahl der Materialien gestaltete sich anfangs schwierig, da eine leichte<br />
Verarbeitung möglich sein sollte und farblich eine gute Erkennbarkeit sowie<br />
eine gute Handhabung gewährleistet werden musste. Für ein festes Haften der<br />
Spielfiguren habe ich mich für farbiges Klettband entschieden. Bei unkontrollierten<br />
Bewegungen über das Spielfeld fallen dadurch die Figuren nicht um.<br />
Die individuelle Förderung von Malvyn musste in einem separaten Raum durchgeführt<br />
werden, da er sich leicht von seinen Mitschülern ablenken lässt und<br />
seine Konzentration darunter erheblich leidet. Die Fördereinheiten habe ich auf<br />
jeweils 30 Minuten begrenzt, um seine Konzentration langsam zu steigern. In<br />
jeder Fördereinheit werden verschiedene Arbeiten durchgeführt, um die Arbeit
[19]<br />
abwechslungsreich zu gestalten und Malvyn ausreichend Zeit für Überlegungen<br />
zur Gestaltung des Spieles zu gewähren. Mit Unterstützung durch den <strong>Heilerziehungspfleger</strong><br />
muss Malvyn zum Beispiel die Ränder der Kreise nachziehen<br />
und farbig ausmalen. Anschließend wird das Spielbrett um die Kreise farbig<br />
gestaltet.<br />
Angepasst an die aktuellen Projekte in der Klasse wurde die Arbeit an dem<br />
Brettspiel zwischenzeitlich unterbrochen und durch jahreszeitlich entsprechende<br />
Aktivitäten ergänzt.<br />
In der zweiten Januarhälfte begannen wir mit der Faschingsdekoration. Dabei<br />
trainierte ich mit ihm das Linienschneiden. Es entstanden Girlanden, die der<br />
Dekoration des Klassenzimmers dienten. Weiterhin wurde von Malvyn mittels<br />
einer Schablone ein Clown auf Papier gebracht und anschließend ausgeschnitten.<br />
In einer weiteren Fördereinheit habe ich gemeinsam mit Malvyn die Zimmerfenster<br />
entsprechend der bevorstehenden Faschingsfeier dekoriert. Dabei hat<br />
er mit Fingermalfarben Kreise an den Fenstern aufgetragen.<br />
5 Durchführung der Förderung<br />
Nach dem Faschingsprojekt und Bastelarbeiten für Ostern widmeten wir uns<br />
wieder der Gestaltung des Brettspieles. Bis zum heutigen Zeitpunkt ist die<br />
Arbeit an dem Spiel noch nicht abgeschlossen wurden. Bis zum Schuljahresende<br />
wird die Förderung weiter fortgesetzt. Die Dauer einer Fördereinheit ist<br />
noch auf 30 Minuten begrenzt, wobei Malvyns Konzentration von anfangs 10-15<br />
Minuten auf die vollständige Fördereinheit ausgebaut werden konnte. Durch<br />
den Einbau der Faschingsvorbereitungen und seiner anfänglich stark eingeschränkten<br />
Konzentration hat sich der Abschluss der Gestaltungsarbeiten an<br />
dem Spiel um einige Einheiten zum Schuljahresende hin verschoben.<br />
In der Zeit von Anfang Januar bis Ende Februar wurden sechs Fördereinheiten<br />
durchgeführt, die weiterhin einmal wöchentlich stattfinden sollen.
[21]<br />
konzentrierte er sich mehr auf die Linien und die Streifen wurden zunehmend<br />
gleichmäßiger. Nachdem er einige Streifen in unterschiedlichen Farben<br />
geschnitten hatte, klebte ich die Streifen mit ihm zu kleinen ineinander<br />
verbundene Kreise zusammen. Es entstand eine bunte Girlandenkette. Von<br />
dem Erfolg begeistert, wollte er anschließend weitere Streifen schneiden. Voller<br />
Begeisterung und Stolz schnitt er konzentriert eine Vielzahl von Streifen. Am<br />
Ende der Fördereinheit, die sogar die geplanten 30 Minuten überschritt, hatte er<br />
drei lange Ketten fertig gestellt, die er im Klassenzimmer aufhängen durfte.<br />
5.4 Die vierte Einheit – ein Clown zum Fasching<br />
Malvins Begeisterung bei der Faschingsvorbereitung in der vergangenen<br />
Woche wollte ich für eine neue Aufgabe nutzen. Mit Hilfe einer Schablone<br />
musste Malvyn einen Clown auf Papier übertragen. Etwas unsicher zog er die<br />
Umrandungen nach. Anschließend durfte er den Clown nach seinen Vorstellungen<br />
farbig gestalten. Das Ausmalen gelang ihm anfangs recht gut. Nach<br />
20 Minuten lies er sich jedoch von Kindern, die vor dem Zimmer umherliefen<br />
ablenken. Er hatte Schwierigkeiten, wieder zur Konzentration zurückzufinden.<br />
Ich konnte ihn jedoch nach einigen Minuten wieder zum konzentrierten<br />
Ausschneiden des Clowns animieren. Die fertige Figur hat er mit meiner<br />
Unterstützung am Fenster angebracht.<br />
5.5 Einheit Fünf – Fensterdekoration mit Fingerfarben<br />
Nachdem das Zimmer mit den Ketten und weiteren Girlanden geschmückt<br />
wurde, fiel die leere Fensterfront auf. Ich fragte Malvyn, ob er eine Vorstellung<br />
hat, wie man die Fenster gestalten könnte. Er wollte sie farbig anmalen. Um<br />
eine sinnvolle Dekoration zu erhalten und gleichzeitig seine Feinmotorik und<br />
Auge-Hand-Koordination zu schulen, entschied ich mich für die Gestaltung von<br />
Kreisen. Allen Kindern seiner Klasse machte es immer Spaß, mit Fingermalfarben<br />
zu arbeiten. Sie sind leicht wieder abwaschbar und bei einem versehentlichen<br />
Kontakt mit Textilien gut entfernbar. Während seine Mitschüler in<br />
einem anderen Raum waren, konnten wir ungestört an den Fenstern arbeiten.<br />
Die ersten Kreise waren anfangs noch unförmig. Mit jeder Wiederholung<br />
gelangen ihm die Rundungen besser. Die Arbeit mit den Fingerfarben bereitete
[22]<br />
ihm viel Freude, dass er nach einiger Zeit die Konzentration verlor und lieber<br />
seine Handabdrücke am Fenster hinterlassen wollte. Wir einigten uns auf den<br />
Kompromiss, das Fenster fertig zu gestalten und er durfte nach den fertigen<br />
Kreisen seine Arbeit mit einem Handabdruck signieren.<br />
5.6 Die sechste Fördereinheit - Osterkörbchen<br />
Im Unterricht bastelte die ganze Klasse kleine Osternester. Die Schüler erhielten<br />
einen aufgemalten Osterhasen, der entlang der durchgezogenen Linien<br />
ausgeschnitten wurde. Ich nutzte die Gelegenheit und griff die Aktivität für<br />
Malvyn auf. Ich gab ihm nur eine geringe Hilfestellung, indem ich ihm zeigte, an<br />
welchen Linien er schneiden muss. Bei den anschließenden Faltarbeiten<br />
musste ich ihm verstärkt helfen, da er nicht gerade entlang der Linien falten<br />
kann. Malvyn arbeitete längere Zeit konzentriert mit. Während ich ihm beim<br />
Kleben der Kanten half, lies er sich aber von seinen<br />
Mitschülern ablenken und beobachtete sie, statt auf<br />
meine Hinweise zu achten. Nachdem ich ihn aber aufforderte,<br />
die Klebestellen zusammenzupressen, fand<br />
er schnell wieder zu seinem Arbeitsplatz zurück.<br />
Osterkörbchen<br />
In den folgenden Wochen werde ich mit Malvyn die Arbeit an dem ursprünglich<br />
geplanten Brettspiel fortsetzen. In den einzelnen bevorstehenden Fördereinheiten<br />
wird er mit unterschiedlichen Tätigkeiten und Materialien konfrontiert, die<br />
ihm eine abwechslungsreiche und interessante Förderung ermöglichen. Dabei<br />
werden das Schneiden von Klettband und das Formen der Spielfiguren aus Ton<br />
im Mittelpunkt stehen. Die ausgehärteten Tonfiguren werden anschließend mit<br />
leuchtender Acrylfarbe entsprechend der farbigen Kreise auf dem Spielbrett<br />
bemalt. Aus dem ebenfalls farbigen Klettband werden Quadrate geschnitten,<br />
die etwa eine Größe von 2x2cm haben. Eine Seite wird mit Leim auf den<br />
Kreisen fixiert, während die zweite Seite an den Spielfiguren befestigt wird.
Quellenverzeichnis<br />
Bücher und Zeitschriftenartikel:<br />
Bundesministerium der Justiz:<br />
[26]<br />
Sozialgesetzbuch : Neuntes Buch / Bundesminist. f. Justiz.- Berlin:2001.- §2(1)<br />
Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, DIMDI:<br />
ICD-10 : Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und<br />
verwandter Gesundheitsprobleme / DIMDI.- 10. Revision.- München: Urban &<br />
Schwarzenberg, Aug. 1994<br />
ISBN 3-541-18701-8<br />
Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, DIMDI:<br />
Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit<br />
: Final Draft / DIMDI : WHO-Kooperationszentrum f. d. Familie Internationaler<br />
Klassifikationen, Okt. 2004<br />
Hahn, Gustav-Peter:<br />
Hilfen für das Zusammenleben mit geistig Behinderten : Erfahrungen aus<br />
jahrzehntelanger Tätigkeit / G.-P. Hahn.- 6., überarb. Aufl.- Berlin: Wiss.-Verl.<br />
Spiess, 1995.- S. 22-37<br />
ISBN 3-89166-062-6<br />
Hobmair, Hermann:<br />
Psychologie für Fachoberschulen / H. Hobmair.- 1. Aufl.- Troisdorf: Bildungsverl.<br />
Eins-Stam, 1996.- S. 263ff<br />
ISBN 3-8237-5010-0<br />
Pschyrembel, Willibald:
[27]<br />
Pschyrembel Klinisches Wörterbuch / W. Pschyrembel.- 61.-84. Aufl.- Berlin: de<br />
Gruyter, 1944.- S. 387<br />
Pschyrembel, Willibald:<br />
Pschyrembel Klinisches Wörterbuch.-257., neu bearb. Aufl.- Berlin; New York:<br />
de Gruyter, 1994.- S. 993, 1083<br />
ISBN 3-11-014183-3<br />
Staatsministerium für Kultus (SMK):<br />
Schulen in Leipzig 2006/2007 / Staatsminist. f. Kultus.- S. 139<br />
Internetmedien:<br />
Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, DIMDI:<br />
ICF-Endfassung / DIMDI: 2005,<br />
http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endfassung/icf_endfa<br />
ssung-2005-10-01.pdf
Eidesstattliche Versicherung<br />
[35] A4<br />
Hiermit erkläre ich, Claudia Tischow - geb. Abramow - an Eides Statt, dass die<br />
vorliegende Arbeit selbständig von mir angefertigt wurde, nur die angegebenen<br />
Hilfsmittel von mir benutzt wurden und Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinn<br />
nach anderen Werken entnommen, von mir durch Quellen als Anlehnung<br />
kenntlich gemacht wurden.<br />
Leipzig, den