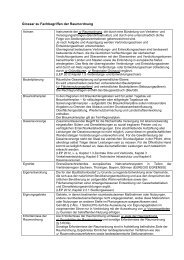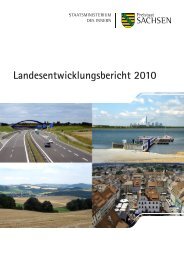Thomas Hecker, Regionaler Planungsverband Chemnitz-Erzgebirge
Thomas Hecker, Regionaler Planungsverband Chemnitz-Erzgebirge
Thomas Hecker, Regionaler Planungsverband Chemnitz-Erzgebirge
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Thomas</strong> <strong>Hecker</strong>, <strong>Regionaler</strong> <strong>Planungsverband</strong> <strong>Chemnitz</strong>-<strong>Erzgebirge</strong><br />
Herausforderungen des demographischen Wandels unter Berücksichtigung der<br />
Besonderheiten der Waldhufenstruktur in der Region <strong>Chemnitz</strong>-<strong>Erzgebirge</strong><br />
Das Siedlungsnetz der Planungsregion C-E wird geprägt durch linear dominierte<br />
Strukturen der Besiedlung, die sich – ohne Seitenäste - in der Siedlungshauptachse auf rd.<br />
1100 km Länge addieren.<br />
Mehr als 50 städtische Siedlungskerne bilden ein dichtes Netz funktionaler<br />
Konzentrationspunkte, die – bei Gleichverteilung – durchschnittlich nur 8 km auseinander<br />
liegen. Weitere 30 randstädtische, regional bedeutsame großflächige Einzelhandelsstandorte<br />
und zusätzlich 16 nennenswerte Siedlungs- und Versorgungskerne in Waldhufendörfern<br />
erweitern die Zugangsmöglichkeiten und die Wahlfreiheit bei der Nutzung überörtlicher<br />
Leistungen. Wir nennen das kurz „Polyzentralität“.<br />
Das Phänomen des Bevölkerungsrückgangs kennen wir seit fast 60 Jahren. Die<br />
Einwohnerzahl der Planungsregion hat sich seit 1950 um 400 TEW oder mehr als 30%<br />
verringert. Da spielt der Verlust der letzten 50 TEW, seit man vom „demographischen<br />
Wandel“ redet und diese Tendenzen hörbar zur Kenntnis nimmt, eher keine besondere Rolle.<br />
Und – kurioserweise -, wenn Sie 100 TEW Bevölkerungsrückgang auf 1100 km Besiedlung<br />
gleichverteilen, sind das nur jeweils 45 Personen, die auf 1 km Besiedlung jeweils rechts bzw<br />
links der Dorfstraße fehlen, also alle 22 Meter eine. Das fällt nicht sonderlich auf.<br />
Nun hat sich aber der Bevölkerungsrückgang bei uns verstärkt in den 50 städtischen<br />
Siedlungskernen und in den Blöcken und Plattenbauten vollzogen, die im Rahmen des<br />
Wohnungsbauprogramms der DDR zur Lösung der Wohnungsfrage seit 1973 errichtet<br />
wurden.<br />
Diese Lösung der Wohnungsfrage („Jedem Haushalt eine – man kann heute sagen – seine<br />
Wohnung“) Anfang der 90er Jahre in der Planungsregion C-E ist der Ausgangspunkt des<br />
siedlungsstrukturellen Wandels, der sich in einer Entdichtung der Städte, also des EW-<br />
Rückganges pro ha bebauter Fläche und in einer punktuellen Verdichtung der<br />
Waldhufenstruktur – sowohl im Innenbereich als auch rechtwinklig zur Siedlungsachse im<br />
Außenbereich – und am Rand der Städte nachvollziehen lässt. Hierbei handelt es sich<br />
eindeutig um ein Schwellenproblem.<br />
Nicht primär der Bevölkerungsrückgang, der lange Zeit durch die Verkleinerung der<br />
Haushalte und einen absoluten Anstieg der Haushaltzahl kompensiert werden konnte, ist die<br />
Ursache des Wohnungsleerstandes, sondern zunächst der Bau Tausender neuer<br />
Wohnungen, der in nahezu der gleichen Größenordnung und zwar seit Anfang der 90er<br />
Jahre leer stehende Wohnungen zur Folge hatte. Dieser Prozess verstärkt sich und wird mit<br />
dem zu erwartenden absoluten Rückgang der Haushaltzahlen in unserer Region auch die<br />
Waldhufendörfer erreichen.<br />
Die regionalplanerische Einflussnahme auf diese Entwicklungen ist begrenzt und kann<br />
überwiegend nur mit Grundsatzqualität formuliert werden. Dazu sind in unserem Planentwurf<br />
u.a. folgende Aussagen nachzulesen:
1. „Beim Rückbau von Gebäuden und Siedlungsflächen städtebaulich zusammenhängende<br />
Siedlungsgebiete erhalten.“ – natürlich mit der Konsequenz der Perforierung kompakter<br />
Stadtviertel.<br />
2. „Siedlungsrückbau bevorzugt in hochwassergefährdeten Gebieten prüfen.“ – soweit die<br />
vernünftige Theorie…<br />
3. „Aufgabe von Wohnstandorten mit starker Verkehrsbelastung, möglichst im Einvernehmen<br />
mit Hauseigentümern und Bewohnern sowie in städtebaulicher und denkmalpflegerischer<br />
Abstimmung.“ - Dieser Sachverhalt wird zunehmend auch die Waldhufendörfer mit ihren<br />
Ortsdurchfahrten beschäftigen.<br />
Weiter für Waldhufendörfer:<br />
4. „ Beim Umbau der Ortslagen ehemaliger Waldhufendörfer sollen Flächen mit<br />
Funktionskonzentration und historische Dorfkerne erhalten werden.“ – Dabei sind aber auch<br />
die neu entstandenen Wohngebiete und Infrastrukturen zu berücksichtigen.<br />
5. „Erhalt des Siedlungscharakters noch nicht verstädterter Abschnitte von<br />
Waldhufendörfern.“ – Das ist vor allem eine Frage der Lenkung des Baus von Einzelhäusern.<br />
Hier wird deutlich, dass ohne Problemverständnis im Rahmen der kommunalen<br />
Bauleitplanung die praktische Umsetzung an Grenzen gerät.<br />
Demographischer Wandel – über den wir hier sprechen – ist überwiegend und auch<br />
langfristig Ergebnis von Geburtenausfall, mindestens in der Größe der Differenz zur<br />
einfachen natürlichen Bevölkerungsreproduktion, und das weiterhin, Jahr für Jahr, mit all<br />
seinen Konsequenzen, z. B. für die Daseinsvorsorge. Hier wird das Unterschreiten von<br />
Schwellen, die wir durch Definition von Effektivitätskriterien auch selbst beeinflussen, am<br />
sichtbarsten.<br />
Obwohl die Städte den größten Anteil abgebauter Kapazitäten der Daseinsvorsorge<br />
abgefangen haben, ist die Zahl der Orte ohne Kindergarten, Schule, Grundversorgung,<br />
Sparkasse usw. deutlich gestiegen. Die langfristig weiter sinkenden Geborenenzahlen<br />
führen zu immer mehr wachsenden Einwohnergrößen für den effektiven Betrieb von<br />
Einrichtungen und den Erhalt Jahrzehnte lang gewohnter Siedlungsfunktionen. Das bedeutet<br />
für unsere Planungsregion, dass die Vorzüge der Polyzentralität auf längere Sicht in gewissem<br />
Umfang schwinden und eine Bedeutungszunahme der Ober- und Mittelzentren sowie<br />
größerer Grundzentren bzw. von Grundzentren mit größerem Einzugsbereich unübersehbar<br />
wird.<br />
Für die Bewertung der Folgen des demographischen Wandels aus siedlungsstruktureller<br />
Sicht ist die Erreichbarkeit des Oberzentrums in Verbindung mit den regionalen Achsen<br />
von den Mittelzentren und die Direktverbindungen von den größeren Grundzentren im 20 km-<br />
Umkreis von <strong>Chemnitz</strong> von Bedeutung. Die Endpunkte der Verkehrsverbindungen und<br />
deren Verkehrsaufkommen sind für den Betrieb entscheidend, die dazwischen liegenden<br />
Dörfer und deren Bevölkerungsentwicklung sind lediglich für die Auslastung von Interesse.<br />
Lineare Besiedlungsstrukturen im Achsenverlauf sind für polyzentrale<br />
Zugangsmöglichkeiten zu Leistungen und Versorgungskernen bevorteilt, quer liegende oder<br />
in Achsenzwischenräumen liegende Siedlungen sowie Dörfer in regionaler Randlage<br />
jenseits der o.g. Zentralorte haben zunächst entsprechende Entwicklungsnachteile, die sich<br />
durch demographische Folgen allenthalben verstärken können.
Zu Letzterem hat unser Regionalplan unter dem Kapitel „Räume mit besonderem<br />
regionalplanerischem Handlungsbedarf“ Gemeinden mit besonderen Belastungen zwar mit<br />
anderer Begründung ausgewiesen. Gleichwohl haben 17 von 24 grenznahen Städten und<br />
Gemeinden Bevölkerungsverluste seit 1990 von -10 bis -20%, in Oberwiesenthal von -40%.<br />
Hier dringen wir schon längere Zeit auch auf anhaltendes landesplanerisches Augenmerk,<br />
wobei nicht verkannt werden soll, dass ILE/LEADER- bzw. FR-Regio- und andere<br />
Fördermittel unterstützend in diesen Raum geflossen sind.<br />
Mit dem Erreichen der Berufstätigkeit für die Anfang der 90er Jahre geborenenen Jahrgänge<br />
beginnt ein dauerhaftes Tief an nachdrängenden Berufseinsteigern, das mit dem<br />
„Fachkräftemangel“ im erweiterten Sinne beschrieben wird. Für die Region C-E gehen wir<br />
davon aus, dass daraus Chancen für Ansiedlungen und Änderungen bisheriger<br />
Migrationstendenzen entstehen, wenn das Primat entsprechender wirtschaftlicher Impulse<br />
begleitend wirksam werden kann.<br />
Herausforderungen des demographischen Wandels stellen auch die Auswirkungen aus dem<br />
zunehmenden Durchschnittsalter der Bevölkerung in den Siedlungen, verbunden mit dem<br />
steigenden Anteil von Rentnern an der Gesamtbevölkerung dar. Inwieweit die bisher<br />
funktionierende Versorgung und Betreuung der Senioren im hohen Lebensalter, die<br />
unterstützend in der Dorfgemeinschaft oft auch über Familien- und Bekanntenkreis<br />
organisiert abläuft, in der Zukunft erhalten bleibt, ist auch für unsere Dörfer gegenwärtig<br />
schwer zu beantworten. Zweifellos hat die Abwanderung junger Menschen langfristig<br />
Veränderungen zur Folge, die erweiterte Aufgaben der Daseinsvorsorge, vielleicht auch mit<br />
Funktionskonzentration im Bereich der Betreuung und Pflege und Ausbau einer<br />
altengerechten Infrastruktur nach sich ziehen.<br />
Die Veränderungen der Handelslandschaft, insofern diese in einem schwer zu<br />
durchschauenden Geflecht von betrieblichen Erfordernissen, Konkurrenzdruck u.a. eben auch<br />
demographische Ursachen haben, stellen gleichfalls regionalplanerischen Handlungsbedarf<br />
dar. Ein aktuelles Beispiel der Schließung eines Plusmarktes in einer Kleinstadt an der<br />
böhmischen Grenze hat genau solche einschneidenden Wirkungen, wie der Verlust der<br />
Schule, des Kindergartens, der Post, der Sparkasse oder der Arztpraxis. Andererseits hat die<br />
Unterschreitung von Schwellen auch eine objektive Seite, die planerisch häufig nur im<br />
Nachlauf zur Kenntnis genommen werden kann und erst dann durch geeignete<br />
Einzelfallkonzepte unterstützt werden kann.<br />
Zusammenfassung:<br />
Der zu erwartende Bevölkerungsrückgang, insbesondere in seiner altersstrukturellen<br />
Differenzierung, wird in der Planungsregion C-E in verstärktem Maße Schwellen<br />
unterschreiten, die zum Verlust und zur Neuorganisation bestehender Siedlungsfunktionen<br />
führen. Die Definition dieser Schwellen und die Lösungsansätze für Folgewirkungen werden<br />
regional- sowie bevölkerungsstruktur- bzw. siedlungsstrukturabhängig unterschiedlich<br />
ausfallen. Sie können durch die Landesplanung nicht vorgegeben werden, ohne zu<br />
reglementieren. Im Gegenteil, hier eröffnet sich für die planerische Begleitung und<br />
Moderation in Teilräumen ein wichtiges Arbeitsfeld für die Regionalplanung, wenn ihr<br />
genügend Zeit für diese Arbeit gelassen wird, die ich als Umsetzung der Pläne unter<br />
konkreten Fragestellungen, wie den demographischen Wandel, verstehe. Das ist<br />
Überzeugungsarbeit in den Gemeindeparlamenten und Beratung der Kreistage im Rahmen<br />
ihrer Gestaltungsmöglichkeiten.
Es bleibt aber auch festzuhalten, dass – solange eine nennenswerte Differenz zur einfachen<br />
Bevölkerungsreproduktion auf Grund fehlenden Kinderwunsches besteht – keine einzige<br />
Problemlösung die Chance auf Dauerhaftigkeit bekommt.






![Projekt-Flyer (deutsch) [Download,*.pdf, 2,14 MB] - Landesentwicklung](https://img.yumpu.com/24779820/1/190x96/projekt-flyer-deutsch-downloadpdf-214-mb-landesentwicklung.jpg?quality=85)