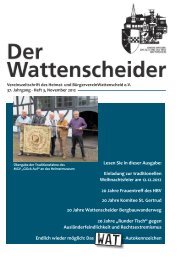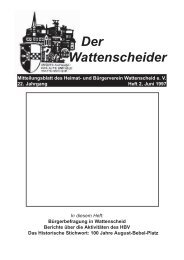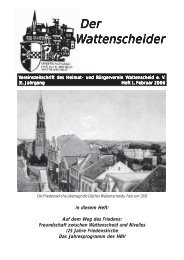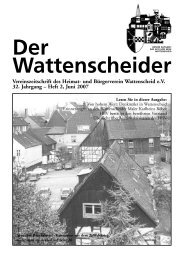3 / 2011 - Heimat- und Bürgerverein Wattenscheid
3 / 2011 - Heimat- und Bürgerverein Wattenscheid
3 / 2011 - Heimat- und Bürgerverein Wattenscheid
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Der<br />
<strong>Wattenscheid</strong>er<br />
Vereinszeitschrift des <strong>Heimat</strong>- <strong>und</strong> <strong>Bürgerverein</strong> <strong>Wattenscheid</strong> e.V.<br />
36. Jahrgang - Heft 3, November <strong>2011</strong><br />
HBV-Vorsitzender Heinz-Werner Kessler<br />
<strong>und</strong> Gilda Büttner<br />
bei der Sankt-Gertrudispreis-Verleihung<br />
an Oskar Pieneck<br />
Lesen Sie in dieser Ausgabe:<br />
Oskar Pieneck erhielt Sankt-Gertrudis-Preis <strong>2011</strong><br />
Bericht über den Tag des offenen Denkmals<br />
Das Sommerfest des HBV<br />
Bald wieder WAT-Kennzeichen?<br />
Einladung zur Weihnachtsfeier
In diesem Heft:<br />
Impressum 2<br />
Mitgliedernachrichten Juli – Dezember <strong>2011</strong> 3<br />
HBV trauert um Walter Härtel 4<br />
Rudolf Wantoch: "Die Nackte aus der Lorheide" 5<br />
Delia Albers: "Führung von polnischen Schülern durch die Innenstadt" 6<br />
Gerhard Lutter: "Aufstieg <strong>und</strong> Niedergang des<br />
Steinkohlenbergbaus im mittleren Ruhrgebiet" 7<br />
Wirrwarr um Zuständigkeiten für die Barbara-Grotte geklärt 8– 9<br />
H.-W. Kessler: "Zur Geschichte der Eppendorfer Eiche" 10–11<br />
Großartige Stimmung beim Sommerfest des HBV 12<br />
Neues von der Bartholomäus-Kapelle: Präsentation des Pilgerstempels<br />
für den <strong>Wattenscheid</strong>er Jakobsweg 13<br />
Bericht über den Tag des offenen Denkmals <strong>2011</strong> in <strong>Wattenscheid</strong> 14<br />
Offene Mitgliederversammlung "Rückblick auf das Still-Leben 2010<br />
auf der A 40" 15<br />
Wiedereinführung ehemaliger WAT-Kennzeichen möglich? 16<br />
HBV besuchte die mittelalterliche Zollstadt Zons<br />
<strong>und</strong> das Kloster Knechtsteden 17<br />
Führung über den Bergbauwanderweg 18<br />
Oskar Pieneck erhielt Sankt-Gertrudis-Preis <strong>2011</strong> 19<br />
Angela Feller <strong>und</strong> Hermann Hülder berichten: Mit dem VW-Bulli<br />
auf großer Fahrt - Eine Einladung 20<br />
Einladung zur Weihnachtsfeier <strong>und</strong> Grüße zum Jahreswechsel 20<br />
Das Buch von Wantoch/Mandzel "Unser altet Ruhrgebiet" 21<br />
Das Wort hat der Leser: Die Glocken am <strong>Heimat</strong>museum Helfs Hof 21<br />
Alfred Winter: Fotoausstellung im Stadtarchiv 22<br />
Beitrittserklärung/Einzugsermächtigung 23<br />
HBV-Markt 24<br />
Impressum:<br />
Herausgeber: <strong>Heimat</strong>- <strong>und</strong> <strong>Bürgerverein</strong> <strong>Wattenscheid</strong> e.V.,<br />
An der Papenburg 30 a<br />
44866 <strong>Wattenscheid</strong><br />
Telefon/Fax 02327/321720<br />
Postadresse: Postfach 600452, 44844 <strong>Wattenscheid</strong><br />
Internet/eMail: www.hbv-wat.de · info@hbv-wat.de<br />
Redaktion: Klaus-Peter Hülder (kphü)<br />
Heinz-Werner Kessler (hwk)<br />
Layout: Pia Annas<br />
Fotos: Rudolf Wantoch, Klaus-Peter Hülder, Pia Annas,<br />
Heinz-Werner Kessler, Philina Hülder<br />
Druck: Ritter-Druck, – 2 – Bochum-<strong>Wattenscheid</strong>
Juli - Dezember <strong>2011</strong><br />
Geburtstage<br />
93 Jahre<br />
Irmgard Paas<br />
91 Jahre<br />
Maria Rieks - Egon Schulte-Holtey - Johanna Niederlohmann<br />
90 Jahre<br />
Marta Hasslacher<br />
89 Jahre<br />
Esther Hombergs<br />
88 Jahre<br />
Karl-Heinz Weitz - Ursula Rotthauwe-Riedel - Franz-Werner Bröker<br />
87 Jahre<br />
Irmgard Scholten - Heinz Jäger - Karl-Heinz Braß<br />
86 Jahre<br />
Elisabeth Grünewald - Dr. Paul Schönefeld - Bruno Herden -<br />
Helmut Rohsiepe - Else Schönrowski<br />
85 Jahre<br />
Edith Görick - Elisabeth Kummer - Renate Plewka - Hans Henneke<br />
80 Jahre<br />
Waltraud Wilner - Gerda Stephan<br />
75 Jahre<br />
Friedhelm Nunier - Helmut Schneider - Horst Hahne - Wolfgang Haase<br />
Gestorbene Mitglieder<br />
Walter Härtel - Helmtrud Götz - Wilfried Marmulla<br />
Neue Mitglieder<br />
Dr. Bernd Stange-Grüneberg - Ulrike Siesenop-Jablonski - Ulrike Jochheim<br />
Matthias Speeth - Peter Reinhardt - Ulrich Zurwehn - Berthold Jablonski<br />
Inge Marie Kessler - Willibald Berner - Brigitte Hoga<br />
– 3 –
HBV trauert um Walter Härtel<br />
Der <strong>Heimat</strong>- <strong>und</strong> <strong>Bürgerverein</strong> <strong>Wattenscheid</strong> (HBV) trauert um Walter Härtel,<br />
der am 16. September <strong>2011</strong> im Alter von 73 Jahren plötzlich verstorben ist.<br />
Walter Härtel hat sich in verschiedenen Funktionen des HBV große Verdienste erworben.<br />
So war Walter Härtel einige Jahre Mitglied des HBV-Beirates <strong>und</strong> bis zuletzt Mitglied<br />
(stellv. Sprecher) des Arbeitskreises Stadtgeschichtliche Fragen. Die Fre<strong>und</strong>schaft<br />
zwischen dem belgischen Nivelles <strong>und</strong> <strong>Wattenscheid</strong> war ihm ein besonderes<br />
Anliegen. Härtel half wo er konnte, z.B. bei den renommierten Sommerfesten des HBV<br />
am Kutscherhaus im Südpark oder im <strong>Heimat</strong>museum im Helfs Hof, bei den Sprechst<strong>und</strong>en<br />
oder als Wanderführer bei den "Samstagsbesuchen" (Tageswanderungen)<br />
des HBV.<br />
Der <strong>Heimat</strong>- <strong>und</strong> <strong>Bürgerverein</strong> wird diesem beliebten menschenfre<strong>und</strong>lichen <strong>und</strong><br />
zupackenden <strong>Heimat</strong>fre<strong>und</strong> ein ehrendes <strong>und</strong> dankbares Andenken bewahren.<br />
Foto vom Verkauf des Buches über KLV<br />
Foto: Friedhelm Nunier<br />
– 4 –
Die Nackte aus der Lohrheide<br />
Lippische Ziegelarbeiter in <strong>Wattenscheid</strong><br />
Diese Feierabendarbeit eines lippischen Ziegeleiarbeiters, der auf der Ziegelei der<br />
<strong>Wattenscheid</strong>er Zeche Holland beschäftigt war, wurde bei Ausschachtungsarbeiten<br />
(Langenbach) im August <strong>2011</strong> gef<strong>und</strong>en. Diese Plastik entstand vermutlich zwischen<br />
den Jahren 1920 bis 1930. Der Ziegler hat die Plastik, die aus Ton gebrannt ist, mit<br />
den Anfangsbuchstaben seines Namens „AS“ signiert. „Die Nackte“ ist nur mit einer<br />
langen Perlenkette, die vom Hals über die Hüfte reicht, bekleidet. Weiter trägt sie zwei<br />
riesige Ohrringe als Schmuck.<br />
Viele lippische Ziegler waren während der Monate April bis September auf den zahlreichen<br />
<strong>Wattenscheid</strong>er Ziegeleien beschäftigt. Diese Zeit nannten die Ziegler „Kampagne“.<br />
Leider sind im Stadtarchiv von der Ziegelei Holland sehr wenige Bilder <strong>und</strong><br />
keine Aufzeichnungen vorhanden.<br />
Anfang Oktober reisten die Ziegler wieder in ihre <strong>Heimat</strong> ins Lipperland zurück <strong>und</strong><br />
hatten viel Gepäck mitzuführen. Für die „Nackte aus der Lohrheide“, die immerhin<br />
8 kg. schwer ist, war wohl kein Platz mehr in der Reisekiste <strong>und</strong> so wurde sie einfach<br />
auf dem Ziegeleigelände vergraben, in der Hoffnung sie im nächsten Jahre wieder<br />
auszugraben. Dazu ist es aber nicht mehr gekommen <strong>und</strong> so schlummerte die<br />
„Nackte“ viele Jahre unerkannt im Erdreich. Bei den Bergungsarbeiten hat die<br />
„Nackte“ doch einen kleinen Schaden erlitten, ihren linken Arm <strong>und</strong> die Finger hat sie<br />
dabei verloren, der Arm konnte wieder angeklebt werden, die Finger sind nicht mehr<br />
aufgef<strong>und</strong>en worden.<br />
Im LWL Industriemuseum Ziegelei Lage sind einige dieser Feierabendarbeiten ausgestellt.<br />
Zahlreiche Ziegler mit künstlerischer Neigung haben solche oder zweckmäßigere<br />
Gegenstände in ihrer knappen Freizeit hergestellt. Zweckmäßige Gegenstände<br />
waren Mausefallen, Nistkästen, Schreibzeughalter oder Spielzeug für die Kinder, z. B.<br />
Murmeln oder Obst, wie Äpfel oder Birnen aus Ziegelton. Solche Feierabendarbeiten<br />
die sich noch erhalten haben, sind heute der Stolz eines jeden lippischen <strong>Heimat</strong>museums.<br />
Um so erfreulicher, dass wir nun in unserem <strong>Heimat</strong>museum im Helfs Hof<br />
an das bisher sehr wenig erforschte <strong>und</strong> dokumentierte Thema der heimischen Ziegeleien<br />
<strong>und</strong> ihrer lippischen Wanderarbeiter erinnern können.<br />
Nicht nur praktische <strong>und</strong> künstlerische Gegenstände wurden von den Zieglern hergestellt,<br />
auch der bekannteste Zieglerdichter Fritz Wienke aus Brakelsiek hatte eine Verbindung<br />
nach <strong>Wattenscheid</strong>- Leithe. Seine Lieder sind mit Sicherheit von den Zieglern<br />
auch auf <strong>Wattenscheid</strong>er Ziegeleien gesungen worden.<br />
Rudolf Wantoch<br />
Feierabendarbeit eines lippischen Zieglers, ca. 1920 - 1930<br />
Literatur <strong>und</strong> Quellen:<br />
Museumsführer: Ziegelei Lage<br />
<strong>Wattenscheid</strong>er Geschichte(n): <strong>Heimat</strong>- <strong>Bürgerverein</strong> 1999 Seiten 51 – 53<br />
<strong>Wattenscheid</strong>er Zeitung vom 1. März 1930: Erinnerung an den Ziegeldichter Fritz Wienke<br />
von Elsa Prein Gerlach, Watt. Leithe.<br />
<strong>Wattenscheid</strong>er Zeitung WAZ: vom 25.5.1975 Ziegler auf Rhein-Elbe von Franz- Werner Bröker.<br />
– 5 –
“Stolpersteine”<br />
Führung durch die <strong>Wattenscheid</strong>er Innenstadt<br />
am 19. September <strong>2011</strong>, 14.00-16.00 Uhr<br />
für polnische Austauschschüler <strong>und</strong> zwei polnische Lehrerinnen aus Poznan<br />
sowie Schüler des Hellweg-Gymnasiums, Bochum-<strong>Wattenscheid</strong>, Lohackerstr.<br />
durch Frau Delia Albers MA, Kunsthistorikerin<br />
Auf Anfrage des Lehrers Herrn Gockel vom Hellweg-Gymnasium fand am 19. September<br />
für polnische Austauschülerinnen <strong>und</strong> -schüler aus Poznan (Posen) sowie für zwei<br />
ihrer Lehrerinnen eine Führung durch die <strong>Wattenscheid</strong>er Innenstadt statt. Im Rahmen<br />
eines EU-Schüleraustauschs ist vor zwei Jahren die Schulpartnerschaft zwischen<br />
dem Hellweg-Gymnasium <strong>und</strong> der polnischen Schule in Posen entstanden. Kunsthistorikerin<br />
Delia Albers eröffnete die Führung an der evangelischen Friedenskirche<br />
mit Daten der <strong>Wattenscheid</strong>er Stadthistorie. Anschließend ging es in die von 1879-80<br />
errichtete Friedenskirche, die ihren Namen in Erinnerung an den Friedensschluss<br />
nach dem Deutsch-Französischen Krieg erhielt. Neben kunsthistorischen <strong>und</strong> historischen<br />
Informationen gab es anschließend die Möglichkeit, im Eine-Weltladen im<br />
Foyer der Kirche herumzustöbern <strong>und</strong> Proben der angebotenen Süßigkeiten zu verkosten.<br />
Die Oststraße entlang ging es zum Standort der ehemaligen Synagoge am Nivelles-<br />
Platz. Am Mahnmal <strong>und</strong> der Gedenktafel, die an die Progromnacht des 9./10. November<br />
1938, in der die Synagoge niederbrannte, <strong>und</strong> die an die Opfer der Shoa erinnern<br />
soll, wurde auch die Aktion „Stolpersteine“ des Künstlers Gunter Demnig erklärt.<br />
Weiter ging es zur katholischen Propsteikirche Sankt Gertrud von Brabant, die<br />
zunächst von außen, dann von innen besichtigt-, kunsthistorisch beschrieben <strong>und</strong><br />
die Historie erläutert wurde. Begeisterung fanden u.a. der Taufstein <strong>und</strong> der mächtige<br />
Westturm.<br />
Die alte evangelische Kirche am Alten Markt war nächster Führungspunkt. Dort wurde<br />
mittels Bildmaterial auf die Orgel <strong>und</strong> den Kanzelaltar hingewiesen.<br />
Ein Abstecher auf das Parkdeck des Gertrudiscenters bescherte den Gästen einen<br />
w<strong>und</strong>erbaren Blick auf das Fördergerüst der Zeche Holland. Eine Erläuterung über die<br />
Historie der Zeche <strong>und</strong> über den Bergbau im Ruhrgebiet r<strong>und</strong>ete diese Impression ab.<br />
Durch das Rosenviertel, vorbei an dem 1975 translozierten Fachwerkhaus „Old Wattsche<br />
9“ endete die Führung am Rathaus. Nach der Baugeschichte <strong>und</strong> Beschreibung<br />
des 1876-84 errichteten Baus ging es ins Innere zum 1897 erschaffenen Gertrudisfenster.<br />
Von da aus lief die Gruppe durch die Gänge in den 1955-57 bündig angeschlossenen<br />
Erweiterungsbau. Hier wurden u. a. anhand des Treppenhauses mit<br />
Spindeltreppe <strong>und</strong> der rückseitig konkav angelegten Fassade Merkmale der Architektur<br />
der 1950er Jahre aufgezeigt.<br />
Eine Zusammenfassung über die Entwicklung <strong>Wattenscheid</strong>s seit Anbeginn bis Heute<br />
schloss die Führung ab.<br />
Delia Albers M. A.<br />
– 6 –
Aufstieg <strong>und</strong> Niedergang des Steinkohlenbergbaus im mittleren<br />
Ruhrgebiet - Besonders in der Emscherzone (etwa 1902 - 2002)<br />
Mit der Erfindung bzw. Einführung des Abbauhammers (Patente der Firma Flottmann!)<br />
stiegen besonders in der Emscherzone ab 1906 die Abbauzahlen des Steinkohlebergbaus.<br />
Da die Industrie mit Koks <strong>und</strong> die Haushalte mit Kohlen versorgt<br />
werden mußten, bestand trotz fortlaufender Mechanisierung in der Eisenindustrie<br />
<strong>und</strong> bei den Bergbauzulieferern ein großer Bedarf an Bergleuten <strong>und</strong> an Fachleuten.<br />
Erst durch immer stärker anschwellende Öl- <strong>und</strong> Gasimporte kam es ab ca. 1950 zu<br />
Zechenstilliegungen <strong>und</strong> zu Kohlenhalden.<br />
Zur Produktion von Stahl <strong>und</strong> Kriegsmaterial waren (leider!) auch die Kohlen dringend<br />
erforderlich. Besonders die Zechen der Emscherzone hatten von etwa 1910 bis<br />
zum Jahre 2000 mit großen Kohlen- Abbauzahlen für die Versorgung der Bevölkerung,<br />
der Fabriken, der Bahnen <strong>und</strong> von Schiffen gesorgt. In den Kriegsjahren des ersten<br />
<strong>und</strong> zweiten Weltkrieges ist übrigens kaum ein Bürger des Ruhrgebiets erfroren oder<br />
verhungert, weil auch mit Kohlen <strong>und</strong> Deputatkohlen "schwarz" gehandelt wurde.<br />
Trotz der gegen Deutschland verhängten Sperren für Öleinfuhren wurde Benzin aus<br />
Kohlen in den Hydrierwerken hergestellt.<br />
Die etwa 9 Milliarden Tonnen Steinkohle, die bis etwa 1980 gefördert wurden, sind<br />
von etwa 300.000 Bergleuten mit hohem Maschineneinsatz zutage gebracht worden.<br />
Einen erheblichen Anteil an den hohen Förderzahlen <strong>und</strong> an der Verteilung der Kohlemengen<br />
hatte bzw. hat die "Abteilung Bergbau <strong>und</strong> Industriefirmen" der Fa. Heitkamp.<br />
Der Autor hat bei einem Kontakt mit der Firma erfahren, daß auf der Zahlenbasis<br />
der "Huske-Bergbaubibel", in der Blüte des Steinkohlebergbaus für den Transport<br />
der 9 Milliarden Kohle-Tonnen etwa 360.000 LKW-Transporte oder Waggontransporte<br />
erforderlich waren. Diese Zahlen machen deutlich, daß durch den Bergbau<br />
auch die Eisenbahn, die Schiffahrt <strong>und</strong> die LKW-Speditionen vielen tausend Beschäftigten<br />
Arbeit <strong>und</strong> Brot gaben.<br />
Das Ruhrgebiet hatte von seinem Anfang bis zum Jahre 1987 ca. 3.500 gemeldete<br />
Zechen. Die Grob-Verteilung: Bochum 610, Dortm<strong>und</strong> 360, Dusiburg 20, Wetter 130,<br />
Essen 860, Hattingen 290, Herbede 280, Sprockhövel 220, Witten 250.<br />
Interessant die Liste der <strong>Wattenscheid</strong>er Großzechen:<br />
Storksbank (1735 - 1835), Steinbank (1735 - 1835), Horster Erbstollen 1835 - 1878),<br />
Marianne (1843 - 1905), Hector (1845 - 1875), Holland 1-7 (1856 - 1983), Centrum<br />
1-4 (1861 - 1956), Engelsburg 1-4 (1829 - 1961), Fröhliche Morgensonne (1840 -<br />
1956), Hannover (1856 - 1967).<br />
Gerhard Lutter<br />
Anmerkung: Ohne Kohle <strong>und</strong> Stahl wäre das Ruhrgebiet nicht das, was es heute ist. Das haben<br />
auch die Aktivitäten zur Kulturhauptstadt 2010 eindrucksvoll belegt. Zu empfehlen ist ein<br />
Besuch im Deutschen Bergbaumuseum in Bochum, in dem die besondere Bedeutung des<br />
Bergbaus genauestens nachvollzogen werden kann.<br />
– 7 –
Wirrwarr um Zuständigkeiten für die Barbara-Grotte geklärt<br />
Die Wirren um die Barbara-Grotte (s. Schreiben des HBV-Vorsiteznden Heinz-Werner<br />
Kessler an die Fa. Lidl vom 9. September) haben ein glückliches Ende gef<strong>und</strong>en.<br />
Lidl Vertriebs-GmbH & Co KG, schrieb am 26.9.<strong>2011</strong> dem HBV den folgenden<br />
Antwort-Brief:<br />
Sehr geehrte Damen <strong>und</strong> Herren,<br />
vielen Dank für die Zusendung der Information gemäß ihrem<br />
Schreiben vom 9.9.<strong>2011</strong>....<br />
Wir sind bereits seit einiger Zeit mit der Polizei in Kontakt<br />
<strong>und</strong> haben entsprechend den Diebstahl <strong>und</strong> die Sachbeschädigung<br />
angezeigt. Die Täter wurden gestellt <strong>und</strong> nach Polizeiangaben<br />
das entwendete Material sichergestellt. Die Polizei gibt das<br />
Material diesen Freitag frei.<br />
Wir würden von unserer Seite das Material wieder anbringen<br />
lassen <strong>und</strong> gehen davon aus, daß die Grotte in der nächsten<br />
Woche wieder hergestellt ist.<br />
Laut Gr<strong>und</strong>stücksverkäufer hatten sich in der Vergangenheit<br />
Personen/Vereine um die Grotte gekümmert. Im Laufe der letzten<br />
Jahre hat offenbar die Resonanz deutlich abgenommen. Daher<br />
wäre es von unserer Seite wünschenswert, etwas Licht in die<br />
Sache herein zu bringen, da uns keine weiteren Informationen<br />
vorliegen.<br />
Sobald wir das Material gesichtet haben, können wir gerne<br />
einen Ortstermin vereinbaren <strong>und</strong> uns über die genannten Punkte<br />
austauschen.<br />
Mit fre<strong>und</strong>lichen Grüßen<br />
Anmerkung der Redaktion: Der HBV ist froh, daß die Sache gr<strong>und</strong>sätzlich geklärt<br />
werden konnte <strong>und</strong> die für <strong>Wattenscheid</strong> so bedeutsame Grotte erhalten werden kann.<br />
Der HBV-Vorstand wird das Gespräch mit Lidl suchen. Nachrichtlich sei noch<br />
erwähnt, daß es zuvor eine Reihe von Kontakten des HBV mit dem Pfarrgemeinderat<br />
der kath. Kirche, der Ruhrkohle, der Polizei <strong>und</strong> der Stadt gegeben hat.<br />
Barbara-Grotte, 1928<br />
– 8–
Lidl-Dienstleistungen GmbH&Co KG<br />
z. H. v. Frau Trabat<br />
Rötelstr. 30<br />
74172 Neckarsulm<br />
Betr.: Barbara-Grotte in <strong>Wattenscheid</strong><br />
Sehr geehrte Frau Trabat, 9. September <strong>2011</strong><br />
im August diesen Jahres wurde auf dem Gr<strong>und</strong>stück in der<br />
Lyrenstraße in <strong>Wattenscheid</strong>, das der Lidl GmbH gehört, die<br />
„Barbara-Grotte“ durch Metalldiebe erheblich beschädigt.<br />
Die Kupferplatten, die die Grotte vor Feuchtigkeit schützen<br />
sollen, sind zum größten Teil entfernt worden <strong>und</strong> es bietet<br />
sich dem Bürger ein hässliches Bild von der der zerstörten<br />
Grotte. Bei der Grotte handelt es sich um einen kleinen<br />
Schutzbau für ein Mosaik, das die heilige Barabara zeigt.<br />
Für die Menschen im Ruhrgebiet ist die hl. Barbara als Schutzheilige<br />
der Bergleute von ganz besonderer Bedeutung. Das Werk<br />
wurde 1955 gestiftet <strong>und</strong> ist ein ganz wichtiger Bestandteil<br />
des städtischen Erscheinungsbildes der Stadt <strong>Wattenscheid</strong>.<br />
Die Reaktionen in der <strong>Wattenscheid</strong>er Bevölkerung, die die Zerstörung<br />
der Grotte nach sich zog, machen ganz deutlich, dass<br />
den Bürgern unserer Stadt die Grotte nach wie vor am Herzen<br />
liegt. In mehreren Presseartikeln wurde ausführlich von der<br />
Ergreifung der Täter <strong>und</strong> der nachfolgenden Suche nach den<br />
Eigentümern der Grotte berichtet. Es stellte sich am Ende heraus,<br />
dass die Lidl GmbH als Eigentümerin des Gr<strong>und</strong>stücks an<br />
der Lyrenstraße auch die Eigentümerin der Grotte ist.<br />
Ich wende mich an Sie als Vorsitzender des <strong>Heimat</strong>- <strong>und</strong> <strong>Bürgerverein</strong>s<br />
<strong>und</strong> bitte Sie darum, mit uns gemeinsam zu überlegen,<br />
wie die Grotte als Teil unseres Stadtbildes instand gesetzt<br />
werden kann. Wir vertrauen darauf, dass die Lidl GmbH sich<br />
ihrer Verantwortung als Eigentümerin der Grotte bewusst ist<br />
<strong>und</strong> es nicht zulässt, dass dieses Indentifikationsobjekt der<br />
<strong>Wattenscheid</strong>er Bürger nach <strong>und</strong> nach verfällt. Eine zügige<br />
Renovierung des Objekts trägt mit Sicherheit zu einem positiven<br />
Bild der Lidl GmbH in der <strong>Wattenscheid</strong>er <strong>und</strong> Bochumer<br />
Öffentlichkeit bei, zumal das weitere Schicksal der Grotte<br />
aufmerksam von der örtlichen Presse beobachtet wird.<br />
Ich würde mich freuen, wenn Sie sich für die Instandsetzung<br />
der Grotte einsetzen <strong>und</strong> Kontakt mit dem <strong>Heimat</strong>- <strong>und</strong> <strong>Bürgerverein</strong><br />
<strong>Wattenscheid</strong> aufnehmen würden.<br />
Mit fre<strong>und</strong>lichem Gruß<br />
Heinz-Werner Kessler<br />
– 9 –
Das Eppendorfer Denkmal<br />
mit der Eiche<br />
Zur Geschichte der Eppendorfer Eiche<br />
In der Diskussion um die Eppendorfer Eiche, die wegen zahlreicher Verkehrsunfälle<br />
gefällt werden soll, scheinen historische Aspekte weitgehend ausgeblendet. Es wäre<br />
allzu zynisch, wollte man sich über die an der Grüninsel in Eppendorf durch Sichtbehinderung<br />
verursachten Unfälle <strong>und</strong> die Zahl der Schwerverletzten hinwegsetzen.<br />
Eine Lösung durch Kahlschlag wäre allerdings die billigste <strong>und</strong> allzu einfache<br />
Lösung, die der historischen Bedeutung der Eppendorfer Eiche in keiner Weise<br />
gerecht wird.<br />
Die Eppendorfer Eiche ist nicht irgendein Baum, der – wie es in den bislang veröffentlichten<br />
Stellungnahmen <strong>und</strong> Berichten heißt – die Sicht der Verkehrsteilnehmer<br />
behindert <strong>und</strong> daher abgeholzt werden muss. Er ist ein Erinnerungsort <strong>und</strong> historischer<br />
Bezugspunkt des Stadtteils Eppendorf.<br />
Die Geschichte der Eppendorfer Eiche reicht bis ins 19. Jahrh<strong>und</strong>ert zurück. Ihr<br />
Ursprung liegt in der Reichsgründungszeit, in der Zeit, als Otto von Bismarck mit den<br />
Kriegen gegen Dänemark (1864), Österreich (1866) <strong>und</strong> Frankreich (1870/71) den<br />
deutschen Einheitsstaat unter preußischer Führung begründete. Nach dem Krieg<br />
gegen Frankreich wurde am 18. Januar 1871 im Schloss von Versailles das Deutsche<br />
Kaiserreich proklamiert <strong>und</strong> Wilhelm I. zum deutschen Kaiser gekrönt.<br />
In den Kriegen der Reichseinigung hatte es Tausende von Toten <strong>und</strong> Verw<strong>und</strong>ete aus<br />
vielen deutschen Städten <strong>und</strong> Gemeinden gegeben. Auch im Landkreis Bochum, zu dem<br />
die damals kleine Gemeinde Eppendorf gehörte, waren Kriegsopfer zu verzeichnen.<br />
An dem Krieg gegen Österreich hatten auch Männer aus Eppendorf teilgenommen.<br />
Zwei von ihnen – Wilhelm Lomberg <strong>und</strong> Heinrich Kollöchter - waren in der Schlacht<br />
von Königgrätz am 3. Juli 1866 – vielleicht auch schon vorher - gefallen. Als am<br />
10. November 1866 die übrigen 36 Kriegsteilnehmer nach Eppendorf zurückkehrten,<br />
feierten die Gemeinden Eppendorf-Munscheid – wie die Zeitung Märkischer Sprecher<br />
berichtete – „ihren Kriegern zur Ehre ein Sieges- <strong>und</strong> Friedensfest.“ Eine offizielle<br />
Gefallenenehrung sollte am 17. November 1866 stattfinden. Der Märkische Sprecher<br />
schreibt hierzu:<br />
�Bei dem Bewillkommnungs-Feste, den braven Kriegern<br />
unserer Gemeinde am Samstag den 17. dieses Monats<br />
bereitet, wird nach der Bekr�nzung derselben auch der<br />
beiden gefallenen S�hne gedacht, indem zwei Eichen zu<br />
deren Andenken gepflanzt werden.�<br />
Anmerkung: Die historischen Fakten finden sich in der Publikation von Enno Neumann,<br />
Von der Kaiserlinde zum Heldenhain. Denkmäler, Amtmänner, Weihereden <strong>und</strong> Bochum<br />
1867 – 1917, Bd. 1 <strong>und</strong> 2 (Bochum, 2010), hg. v. der Kortum-Gesellschaft Bochum e. V.<br />
– 10–
Die beiden Eichen waren von einem Veteranen geschenkt <strong>und</strong> von drei jungen<br />
Soldaten gepflanzt worden, die im gleichen Regiment gedient hatten.<br />
Mit Eichen verbanden die Zeitgenossen bestimmte mythologische Vorstellungen. Seit<br />
der Antike galt die Eiche als ein Baum der Götter, der beschützt <strong>und</strong> ernährt <strong>und</strong> in<br />
dessen Schatten man sich ausruht. Wer sich im Frieden unter einer Eiche traf, sollte<br />
derer gedenken, die für das Vaterland gestorben waren. Nach den Napoleonischen<br />
Kriegen wurde in deutschen Städten vielfach eine Eiche an die Stelle eines Denkmals<br />
gesetzt, die man „Friedenseiche“ nannte. Dieser Brauch hielt sich das ganze<br />
19. Jahrh<strong>und</strong>ert lang.<br />
Im Jahre 1961 wurden die beiden Eppendorfer Eichen beim Ausbau der Straße gefällt.<br />
Die heutige Eiche stammt aus späterer Zeit. Sie erinnert aber an die Tradition der<br />
Baumstiftungen, wie sie im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert üblich waren. Gedenkeichen wie die in<br />
Eppendorf können als Vorläufer der Kriegerdenkmäler gelten, die im Deutschen Kaiserreich<br />
nach 1871 - auch in <strong>Wattenscheid</strong> - errichtet wurden.<br />
Am 4. Juli 1867 gab der Märkische Sprecher bekannt:<br />
�Ein au�ergew�hnliches Fest hat gestern hier stattgef<strong>und</strong>en,<br />
n�mlich die feierliche Enth�llung <strong>und</strong> Einweihung<br />
eines sch�nen Denkmals, errichtet von der<br />
Gemeinde Eppendorf zum Andenken zweier bei<br />
K�niggr�tz gefallener S�hne.�<br />
Die Bedeutung dieses Ereignisses zeigte sich daran, dass Adolf von Pilgrim – Landrat<br />
des Kreises Bochum – angereist war, um eine Festrede zu halten. Damit wollte er<br />
der Tatsache Rechnung tragen, dass das Eppendorfer Kriegerdenkmal das erste im<br />
gesamten Landkreis Bochum war, zu dem die Städte Bochum, Hattingen <strong>und</strong> Witten<br />
sowie die Ämter Blankenstein, Bochum, Gelsenkirchen, Hattingen, Herne, Langendreer,<br />
Wanne <strong>und</strong> <strong>Wattenscheid</strong> gehörten. Es versteht sich von selbst, dass auch der<br />
Amtmann Coels des Amtes <strong>Wattenscheid</strong> bei der Denkmalfeier anwesend war, dessen<br />
Amtsbezirk zu den größten im Landkreis Bochum zählte.<br />
Mit Fug <strong>und</strong> Recht lässt sich sagen, dass die Denkmalbewegung, wie sie sich im<br />
<strong>Wattenscheid</strong>er Raum zurzeit des Deutschen Kaiserreichs nachweisen lässt, von<br />
Eppendorf ihren Ausgang nahm. Angeregt durch das Eppendorfer Beispiel, ließen in<br />
der Folgezeit die benachbarten Gemeinden ihre eigenen Kriegerdenkmäler errichten.<br />
So entstanden 1895 die Höntroper Kaiserbüste, 1896 das Westenfelder Kaiserstandbild<br />
<strong>und</strong> 1897 der Stürmende Fahnenträger auf dem Kaiserplatz (heute August-<br />
Bebel-Platz) in <strong>Wattenscheid</strong>.<br />
Auf einer Führung des <strong>Heimat</strong>- <strong>und</strong> <strong>Bürgerverein</strong>s <strong>Wattenscheid</strong> am vergangenen Tag<br />
des offenen Denkmals wurde auf diese historischen Zusammenhänge <strong>und</strong> Fakten<br />
hingewiesen.<br />
Heinz-Werner Kessler<br />
(1. Vorsitzender des HBV <strong>Wattenscheid</strong>)<br />
– 11 –
Blick in die<br />
Kunsthandwerkerausstellung<br />
Blick auf die neu<br />
aufgestellten Glocken <strong>und</strong><br />
das Treiben am Festzelt<br />
Großartige Stimmung beim Sommerfest des HBV<br />
Das Sommerfest des <strong>Heimat</strong>- <strong>und</strong> <strong>Bürgerverein</strong> <strong>Wattenscheid</strong> gehört mittlerweile zur<br />
Tradition des 1970 gegründeten Vereins <strong>und</strong> ist seit Jahren ein gesellschaftliches<br />
Ereignis ersten Ranges. In den letzten Jahren wurde das Fest mit großem Erfolg auf<br />
dem Gelände des Kutscherhauses des Sauerländischen Gebirgsvereins (SGV) im<br />
<strong>Wattenscheid</strong>er Südpark durchgeführt. Wegen Einsprüchen von Nachbarn (nach<br />
deren Meinung war der 'Lärmpegel' dieser Veranstaltungen nicht hinnehmbar) mußte<br />
der SGV dem HBV absagen, das Fest weiterhin unter den ur-alten Bäumen des Südparks<br />
durchzuführen. Viele Bürger haben zwischenzeitlich ihren Unmut darüber zum<br />
Ausdruck gebracht, daß es solche ("unbegründeten") Anwohner-Klagen gegeben hat.<br />
Der HBV hat daher aus der Not eine Tugend gemacht <strong>und</strong> nach einem Ersatzgelände<br />
gesucht. Dieses Gelände wurde vor dem <strong>Heimat</strong>museum im Helfs Hof gef<strong>und</strong>en.<br />
Für das Museum hatte der HBV bereits 2003 die Fachaufsicht übernommen. Am Helfs<br />
Hof wurden in den 80er-Jahren, in denen es in <strong>Wattenscheid</strong> die von der Bezirksvertretung<br />
organisierten Bürgerwochen gegeben hatte, auch schon die auch heute noch<br />
gerühmten "Lampionfeste" veranstaltet. Der Festplatz am Museum erwies sich, trotz<br />
gewisser Platznot, als Volltreffer. Für die Besucher gehören, so scheint es, eh das<br />
<strong>Heimat</strong>museum <strong>und</strong> der HBV zusammen. Also war der HBV, wie es der Museumswart<br />
Rudolf Wantoch <strong>und</strong> der neue HBV-Vorsitzende Heinz-Werner Kessler betonten, "wieder<br />
nach Hause gekommen". Die 200 Besucher jedenfalls waren froh, sich die Ausstellung<br />
im Museum anschauen zu können, sich im Festzelt oder im Freien die Stände<br />
dreier Kunsthandwerker anzusehen, den begeisternden musikalischen Vorträgen des<br />
Musikers Werther <strong>und</strong> seiner Partnerin zu folgen, den Bücherstand des HBV zu besuchen<br />
oder Gegrilltes, selbstgebackenen Kuchen nebst dazugehörigem Kaffee <strong>und</strong> am<br />
Bierstand Alkoholisches oder Alkoholfreies zu genießen. Höhepunkt war zweifellos die<br />
offizielle "Einweihung" jener ehemaligen Friedenskirchen-Glocken, die seit dem<br />
Kirchturmbrand vom 24. September 1957 in Hellethal in der Eifel ausgelagert waren<br />
(wir berichteten) <strong>und</strong> jetzt vom HBV nach <strong>Wattenscheid</strong> zurückgeholt, überholt <strong>und</strong><br />
zum Teil der Ausstellung gemacht worden sind. Interessanterweise gibt es Tonaufnahmen<br />
dieser Glocken, über die Rudolf Wantoch Bewegendes mitzuteilen wußte.<br />
Dieses Glockengeläut wurde den Besuchern zu Gehör gebracht. HBV-Vorsitzender<br />
Heinz-Werner Kessler konnte bei seiner Begrüßung, in der er die besondere Verb<strong>und</strong>enheit<br />
der Bevölkerung mit dem HBV herausstellte, auch den Ehrenvorsitzenden des<br />
Vereins, Franz-Werner Bröker, sowie Bezirksbürgermeister Hans Balbach begrüßen,<br />
der seinerseits fre<strong>und</strong>liche Worte an die Versammelten richtete. Kessler dankte dem<br />
Team des HBV, das unter der Leitung von Norbert Herden stand, <strong>und</strong> auch der Familie<br />
Damm, die eng mit dem HBV kooperierte. Alle Beteiligten waren sich einig: Auch in<br />
2012 soll es ein Sommerfest am Helfs Hof geben.<br />
(kphü)<br />
– 12 –
Neues von der St. Bartholomäuskapelle<br />
Pünktlich zum Beginn der Pilgersaison können von der St. Bartholomäuskapelle am<br />
<strong>Wattenscheid</strong>er Hellweg einige wichtige Neuigkeiten berichtet werden.<br />
Das Bistum Essen hat eine neue Beleuchtung im Innenraum installieren lassen, mit<br />
der die Skulpturen des hl. Jakobus <strong>und</strong> hl. Bartholomäus besser fokussiert werden.<br />
Zudem musste an der Südseite der Kapelle eine große Tanne gefällt werden, weil die<br />
Wurzeln das Mauerwerk gefährdeten <strong>und</strong> der geringe Gebäudeabstand des Baumes<br />
verhinderte, dass die Nässe in der südlichen Außenwand austrocknete.<br />
Am Eingang der Kapelle wurde ein Besucherbuch ausgelegt. Unter den mittlerweile<br />
zahlreichen Eintragungen ist u. a. nachzulesen, dass am 2. April <strong>2011</strong> zwei Pilger in<br />
der St. Bartholomäuskapelle ihren Segen erhielten <strong>und</strong> von dort zu ihrer Pilgerschaft<br />
aufgebrochen sind.<br />
An den Sonntagen vor Ostern fanden in der Kapelle regelmäßig am Abend Andachten<br />
statt, die Herr Tietmeyer, Pastoralreferent an der St. Gertrudiskirche, gestaltete.<br />
Am 15. April <strong>2011</strong> wurde vor der Kapelle ein neuer Pilgerstempel für den <strong>Wattenscheid</strong>er<br />
Jakobsweg präsentiert, der die offiziellen Kriterien der katholischen Kirche in<br />
Deutschland erfüllt. Die Gebrauchsgraphikerin Frau Müller-Zantop erläuterte diese<br />
Kiterien:<br />
- die Umschrift im Stempelaufdruck muss in Großbuchstaben gefertigt sein<br />
<strong>und</strong> auf der Position von 12 Uhr beginnen;<br />
- das Stempelmotiv in der Mitte muss auf wenige markante Linien reduziert<br />
sein; hierin unterscheidet es sich z. B. von realistischen Motiven auf<br />
spanischen Stempeln, wie sie vom Jakobsweg bekannt sind.<br />
Bei der Anfertigung der Stempel wird, so erläuterte Frau Müller-Zantop, das gezeichnete<br />
Motiv auf eine Folie übertragen, aus der das Motiv dann herausgeätzt wird.<br />
Was man beim Stempelgebrauch alles falsch machen kann, erfuhren die Anwesenden,<br />
als Frau Müller-Zantop die sachgerechte Säuberung des Stempels <strong>und</strong> den<br />
Umgang mit dem Stempelkissen erläuterte. Wichtig für eine gute Druckqualität sei<br />
vor allen Dingen die gleichmßige Verteilung der Druckerschwärze auf dem Stempelkissen<br />
mit einem kleinen Spachtel.<br />
Den Pilgerstempel nahm Frau Bojarzin in Verwahrung. Sie wohnt in unmittelbarer<br />
Nähe zur St. Bartholomäuskapelle, in der Biterie. Bei ihr können sich vorbeiziehende<br />
Jakobspilger in Zukunft die Pilgerpässe abstempeln lassen.<br />
Für die Strecke des Jakobsweges von Bochum nach <strong>Wattenscheid</strong> sind damit im<br />
Moment drei Pilgerstempel im Gebrauch: der erste Pilgerstempel wird im Besucherzentrum<br />
an der Jahrh<strong>und</strong>erthalle in Bochum aufbewahrt <strong>und</strong> trägt als Symbol den<br />
Engel der Kulturen; der zweite Stempel im weiteren Verlauf der Wegstrecke ist der von<br />
Frau Bojarzin; der dritte Pilgerstempel befindet sich im <strong>Heimat</strong>museum Helfs Hof <strong>und</strong><br />
wurde in privater Initiative für den <strong>Wattenscheid</strong>er Pilgertisch beim Still-Leben A 40<br />
im Kulturhauptstadtjahr 2010 angefertigt.<br />
Heinz-Werner Kessler<br />
– 13 –
Auf dem August-Bebel-Platz<br />
Tag des offenen Denkmals <strong>2011</strong> –<br />
Bericht über die Wanderung zu den <strong>Wattenscheid</strong>er Kriegerdenkmälern<br />
Die Gruppe traf sich bei Sonnenschein am August-Bebel-Platz <strong>und</strong> brachte recht<br />
unterschiedliche Voraussetzungen für die bevorstehende dreistündige Wanderung<br />
mit. Eine Teilnehmerin war noch in den Sommerferien von Pamplona nach Santiago<br />
de Compostela gepilgert; ein älterer Herr hatte erst vor kurzem neue Kniegelenke<br />
bekommen, ließ sich aber von der Streckenlänge von <strong>Wattenscheid</strong> bis Eppendorf<br />
überhaupt nicht abschrecken; seine Frau hingegen meldete sich nach 1 Kilometer<br />
mit Fußbeschwerden <strong>und</strong> fuhr mit dem Auto davon.<br />
Schlecht war es um diejenigen bestellt, die keine Regensachen mitgebracht hatten,<br />
denn um die Mittagszeit setzte Starkregen ein, der dazu führte, dass die Wanderung<br />
in Höntrop abgebrochen werden musste <strong>und</strong> die Teilnehmer mit dem Bus nach Hause<br />
fuhren. Nur die Jakobspilgerin protestierte: „Mir macht der Regen nichts aus!“<br />
Die Wanderung zu den <strong>Wattenscheid</strong>er Kriegerdenkmälern folgte einer umgekehrten<br />
Chronologie. Sie begann am August-Bebel-Platz, wo das jüngste Denkmal der Kaiserzeit<br />
stand. Es war im Jahre 1898 eingeweiht worden. Als Endpunkt der Wanderung<br />
war Eppendorf Denkmal geplant, wo die ersten Denkmäler im <strong>Wattenscheid</strong>er Raum<br />
entstanden <strong>und</strong> von wo sich die Denkmalbewegung nach Norden hin ausbreitete:<br />
1895 die Kaiserbüste in Höntrop, 1896 das Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Westenfeld.<br />
Der Vergleich der einzelnen Denkmäler miteinander <strong>und</strong> der historischen Bedingungen,<br />
die zur Errichtung der <strong>Wattenscheid</strong>er Denkmäler führte, machte deutlich, dass<br />
wichtige Impulse von Bergwerksdirektoren, Landräten <strong>und</strong> Kriegervereinen, also den<br />
bürgerlichen Eliten, ausgingen. Politischer Bezugspunkt <strong>und</strong> auslösendes Moment für<br />
den Denkmalbau war die Gründung des Deutschen Kaiserreichs im Jahre 1871 <strong>und</strong><br />
der vorausgegangenen Kriege gegen Dänemark, Österreich <strong>und</strong> Frankreich. Denkmäler<br />
– wie die in <strong>Wattenscheid</strong> – begründeten den Mythos des deutschen Nationalstaates<br />
<strong>und</strong> waren wichtige Medien der Herrschaftspropaganda. Sie glorifizierten das<br />
Herrscherhaus der Hohenzollern <strong>und</strong> wollten den Stolz <strong>und</strong> die Freude über nationale<br />
Größe <strong>und</strong> soldatische Tapferkeit zur Darstellung bringen.<br />
Am Beispiel des Ehrenmals an der Bahnhofstraße von 1934 ließ sich zeigen, dass die<br />
Nationalsozialisten keine Schwierigkeiten hatten, das <strong>Wattenscheid</strong>er Kriegerdenkmal<br />
mit dem Fahnenträger in ihren eigenen Denkmalkult zu integrieren, indem sie es an<br />
die Bahnhofstraße versetzten.<br />
Obwohl die <strong>Wattenscheid</strong>er Denkmäler - für sich genommen - eine hohe künstlerische<br />
Qualität besaßen, waren sie doch – so konnte in der Führung nachgewiesen werden –<br />
nur Produkte einer landesweit verbreiteten Denkmalindustrie, die auf Nachfrage die<br />
einzelnen Städte <strong>und</strong> Gemeinden mit einem gewünschten <strong>und</strong> prestigeträchtigen<br />
Objekt versorgte. Federführend war in dieser Beziehung die Bildgießerei Gladenbeck<br />
& Sohn in Friedrichshagen bei Berlin.<br />
– 14 –
Keines der <strong>Wattenscheid</strong>er Kriegerdenkmäler – so konnten die Teilnehmer erfahren -<br />
ist in seinem Urzustand noch erhalten. Versetzung, Verschrottung, Umgestaltung<br />
gehören zu ihrer Geschichte. Sie machen deutlich, wie sehr der Denkmalkult – auch<br />
in <strong>Wattenscheid</strong> - von den politischen <strong>und</strong> gesellschaftlichen Gegebenheiten beeinflusst<br />
wurde <strong>und</strong> sie in vielfacher Hinsicht spiegelt.<br />
Heinz-Werner Kessler<br />
Anmerkung: Anders als in der Presse zu lesen war, ist das <strong>Wattenscheid</strong>er Kriegerdenkmal<br />
1898 eingeweiht worden – <strong>und</strong> nicht 1897. Ich bitte, diesen Irrtum zu entschuldigen.<br />
Offene Mitgliederversammlung am 28. September <strong>2011</strong><br />
In der offenen Mitgliederversammlung am 28. September <strong>2011</strong> referierte Herr Georg<br />
Bauernschmidt über das Still-Leben A 40 im Kulturhauptstadtjahr 2010. Die Präsentation<br />
ließ den <strong>Wattenscheid</strong>er Pilgertisch an der Auffahrt zur A 40 an der Bahnhofstraße<br />
in Richtung Essen revue passieren <strong>und</strong> machte noch einmal deutlich, welch<br />
eine phantastische Stimmung an diesem Tag herrschte. Die Frage, ob man das Still-<br />
Leben wiederholen solle, wurde von den Anwesenden, negativ beschieden: es habe<br />
sich um ein einmaliges Gesamtkunstwerk gehandelt, eine Wiederholung würde den<br />
Wert <strong>und</strong> die Erinnerung an dieses Ereignis nur relativieren. Denkbar sei allerdings<br />
eine andere Großveranstaltung auf der A 40.<br />
Im Anschluss an den Vortrag von Herrn Bauernschmidt hatten die Anwesenden<br />
Gelegenheit, sich an einem Informationsstand über den Jakobsweg in unserer Region<br />
k<strong>und</strong>ig zu machen.<br />
(hwk)<br />
– 15 –
Bald wieder "WAT-Kennzeichen"?<br />
Eine Frage, die in den letzten Monaten immer häufiger gestellt wird. Wird es demnächst<br />
wieder das WAT-Autokennzeichen geben können? Diese Gedanken beruhen auf<br />
Untersuchungen des Heilbronner Professors Dr. Ralf Borchert. Bei einer Umfrage von<br />
ihm sprachen sich in 51 kreisangehörigen Städten 73 % der Befragten für einen<br />
Kennzeichenwechsel aus. Durch einen Wechsel des Kennzeichens werde, so die Befürworter,<br />
die Wahrnehmung einer Kommune in den Bereichen Tourismus, Wirtschaftsförderung<br />
<strong>und</strong> Image erhöht <strong>und</strong> verbessert <strong>und</strong> die Identifikation der Bevölkerung<br />
mit ihrer Kommune gestärkt. Zwischenzeitlich haben sich bereits mehr als 125 deutsche<br />
Städte, die ihr altes Kennzeichen verloren haben, durch Stadtratsbeschlüsse,<br />
Unterzeichnung von gemeinsamen Erklärungen oder entsprechende Anträge an die<br />
Landesverkehrsminister für ihr altes Kfz-Kennzeichen ausgesprochen. Initiativen<br />
betreffen zur Zeit allerdings nur ehemals kreisangehörige Gemeinden. Für die früher<br />
selbständige Stadt <strong>Wattenscheid</strong> gilt das bislang nicht. Selbst Prof. Borchert glaubt,<br />
dass es in einem Landkreis möglich sei, mehrere Kennzeichen zu haben, innerhalb<br />
einer Stadt könne er sich das nicht vorstellen. Die Stadt Bochum, nach den Wünschen<br />
vieler <strong>Wattenscheid</strong>er, ein WAT-Kennzeichen zu erhalten, gefragt, machte die<br />
Rechtslage innerhalb einer offiziellen Mitteilung vom 16.12.2010 an den Rat deutlich:<br />
"Die Ausgestaltung von Kennzeichen für Kraftfahrzeuge <strong>und</strong> Kraftfahrzeuganhänger<br />
richtet sich nach der Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung (FZV), obliegt also der<br />
Verordnungsgebung des B<strong>und</strong>es. Nach § 8 FZV teilt die Zulassungsbehörde dem<br />
Fahrzeug bzw. dem Anhänger ein Kennzeichen zu. Es besteht aus einem Unterscheidungszeichen<br />
für den Verwaltungsbezirk mit einer Erkennungsnummer. Die Unterscheidungszeichen<br />
sind nach Maßgabe der Anlage 1 (der FZV) zu vergeben. Für die<br />
Stadt Bochum bestimmt die Anlage 1 allein "BO" als Unterscheidungszeichen.<br />
Falls diese Rechtsvorschriften geändert werden, bestehen gegen die Vergabe unterschiedlicher<br />
Kennzeichen in einem Zulassungsbezirk keine Bedenken wenn<br />
- ein Bezug zur Stadt gewährleistet bleibt - was bei einer Nutzung früher<br />
schon vergebener <strong>und</strong> in geringem Umfang noch vorhandener Kennzeichnungen<br />
gewährleistet wäre.<br />
- der erhöhe Verwaltungsaufwand durch eine kostendeckende Gebührenregelung<br />
aufgefangen wird."<br />
Fest steht: Viele <strong>Wattenscheid</strong>er möchten am liebsten sofort ein neues WAT-Schild<br />
beantragen. Aber, die Entwicklung muß abgewartet werden. Das Interesse an einer<br />
"WAT"-Regelung hat der HBV jedenfalls immer wieder deutlich gemacht.<br />
(kphü)<br />
–16 –<br />
Das alte WAT-.Kennzeichen des Autors
HBV besuchte die mittelalterliche Zollstadt Zons<br />
<strong>und</strong> das Kloster Knechtsteden<br />
Seit langem in der Planung, nun endlich realisiert: Die Fahrt nach Zons <strong>und</strong> zum<br />
Kloster Knechtsteden. Wenige Tage nach der Ausschreibung dieser Fahrt am<br />
10.9.<strong>2011</strong> war sie bereits ausgebucht!<br />
Die Stadt Zons, im 14. Jahrh<strong>und</strong>ert gegründet, wird aufgr<strong>und</strong> ihrer gut erhaltenen<br />
Mauern <strong>und</strong> Türme auch "das rheinische Rothenburg" genannt <strong>und</strong> ist die besterhaltendste<br />
Zollfeste im Rheinland. Sein Mühlenturm, der Zwinger, der Juddeturm, der<br />
mächtige Rhein-/Zollturm, der Krötschenturm, die ehemalige kurkölnische Landesburg<br />
Friedestrom <strong>und</strong> die Stadttore sind berühmt. Zwei kompetente <strong>und</strong> ortsverb<strong>und</strong>ene<br />
Stadtführer des <strong>Heimat</strong>- <strong>und</strong> Verkehrsvereins Zons, Christiane Schneider <strong>und</strong><br />
Helmut Reimann, berichteten über den Stadtgründer Erzbischof Friedrich III von<br />
Saarwerden, die Verlegung des Rheins, Kriegsfeden oder verschiedene Pest-Epedemien,<br />
die oft nur 1/3 der Bevölkerung überlebten. Heute hat Zons 800 Einwohner.<br />
Die <strong>Wattenscheid</strong>er hatten Gelegenheit bei herrlichem Sonnenschein die Stadt zu<br />
erk<strong>und</strong>en, um die Stadt herumzuspazieren, die Straßencafes zu besuchen oder an das<br />
Rheinufer zu gehen oder einen kleinen Ausflug mit der Rheinfähre nach Urdenbach<br />
<strong>und</strong> zurück zu machen. Das Kloster Knechtsteden, 8 km von Zons entfernt, ist die<br />
größte Klosteranlage in der Erzdiözese Köln. Die romanische Basilika wurde im<br />
12. Jahrh<strong>und</strong>ert von Prämonstratensern errichtet. Knechtsteden hat ein Gnadenbild<br />
der schmerzhaften Muttergottes aus dem 13. Jahrh<strong>und</strong>ert <strong>und</strong> ist auch heute noch<br />
Wallfahrtsstätte <strong>und</strong> erhielt 1974 den päpstlichen Titel einer "Basilika minor". Weltberühmt<br />
ist das 1160 fertiggestellte monumentale Fresko in der Westapsis. Die Klosteranlage<br />
wird heute von der Missionsgesellschaft vom Heiligen Geist (Spiritaner)<br />
geführt. Pater Hermann Josef Reetz führte die <strong>Wattenscheid</strong>er 2 St<strong>und</strong>en durch die<br />
imposanten Anlagen (Kräutergarten, museale Handwerksstätten, die Bibliothek, das<br />
berühmte Heuhotel oder die Sakristei mit ihren wertvollen Meßgewändern. Der letzte<br />
Prior der Prämonstratenser, die durch die Säkularisation 1801 die Klosteranlage verlassen<br />
mußten, war übrigens Pater Heinrich Ziliken, der auf dem <strong>Wattenscheid</strong>er<br />
Propsteifriedhof beerdigt ist. Pater Reetz wußte zu berichten, wie die wichtigsten<br />
Bücher <strong>und</strong> Dokumente des Klosters nach dessen Auflösung jeweils auf den Kloster-<br />
Ältesten übergingen <strong>und</strong> schließlich mit Pater Ziliken nach <strong>Wattenscheid</strong> kamen, dort<br />
im Propsteiarchiv verwahrt <strong>und</strong> dem Kloster nach Übernahme 1895 durch die Spiritaner<br />
"zurückgegeben" wurden. Die Reisegruppe konnte sich die wertvollsten Stücke<br />
ansehen <strong>und</strong> waren ob der bibliophilen Kraft <strong>und</strong> Ausstrahlung begeistert.<br />
Die Leitung der Fahrt lag wie immer in den Händen von Klaus-Peter Hülder.<br />
Die Fahrten werden auch in 2012 fortgesetzt.<br />
Der Grabstein von Heinrich Ziliken auf dem<br />
Propsteifriedhof in <strong>Wattenscheid</strong> trägt<br />
folgende Aufschrift:<br />
Heinrich Ziliken<br />
Pfarrer, Landdechant<br />
u. Ehren-Domkapitular<br />
geb. 20. Nov. 1766 in Hasselsweiler<br />
gest. 26. Dez. 1858<br />
R.I.P.<br />
– 17 –<br />
Reiseteilnehmer vor dem Rheintor<br />
Gang zum Juddeturm<br />
Stadtführer Reimann vor dem<br />
Denkmal zu Ehren von<br />
Erzbischof Friedrich III<br />
von Saarwerden<br />
Das weltberühmte Fresco<br />
in der Westapsis der Basilika<br />
"St. Maria-Magdalena - St. Andre<br />
Prior Hermann Josef Reetz<br />
in der Bibliothek
Mariannenplatz<br />
Villa Baare<br />
Führung über den Bergbauwanderweg am 17. September <strong>2011</strong><br />
Die Führung hatte zwei thematische Schwerpunkte, an deren Beispiel die historische<br />
Bedeutung des <strong>Wattenscheid</strong>er Bergbaus dargestellt werden sollte: zum einen sollten<br />
die Impulse aufgezeigt werden, die vom Bergbau auf die Industrialisierung der Stadt<br />
<strong>und</strong> Region insgesamt ausgingen; zum anderen sollte die nationale <strong>und</strong> internationale<br />
Verflechtung <strong>und</strong> Ausstrahlung des <strong>Wattenscheid</strong>er Bergbaus erörtert werden.<br />
Die Geschichte des <strong>Wattenscheid</strong>er Bergbaus ist eng mit der Entwicklung der Stahlindustrie<br />
verknüpft. Zechen wie die Engelsburg (1834 –1848) <strong>und</strong> die Vereinigte<br />
Maria Anna <strong>und</strong> Steinbank (1858 – 1904) waren wichtige Kohlelieferanten des<br />
Bochumer Vereins, der bis zum Ende des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts zum zweitgrößten Stahlwerk<br />
Deutschlands aufstieg. Die steigende Nachfrage der Schwerindustrie nach<br />
Kohle gab den Anreiz dafür, die <strong>Wattenscheid</strong>er Zechen an – z. T. werkseigene –<br />
Eisenbahnlinien anzuschließen <strong>und</strong> diese dann weiter auszubauen. Wichtig für die<br />
Industrialisierung war ferner Dampfmaschinen, die im <strong>Wattenscheid</strong>er Raum zuerst<br />
im Maschinenschacht. der Gewerkschaft Vereinigte Engelsburg (1834 – 1848) zur<br />
Förderung <strong>und</strong> Wasserhaltung eingesetzt wurden.<br />
Für Dampfmaschinen als Motor der Industrialisierung in Deutschland hatte sich der<br />
Freiherr vom <strong>und</strong> zum Stein (1757 – 1831) interessiert, der neben Hardenberg zum<br />
Initiator der preußischen Reformen wurde. Stein war als junger Mann nach England<br />
gereist, um die Konstruktionspläne der Dampfmaschine bei der Firma Boulton & Watt<br />
auszuspionieren. Im Jahre 1784 wurde er Direktor des Märkischen Bergamtes in<br />
Wetter <strong>und</strong> begab sich noch im gleichen Jahr auf eine Inspektionsreise, die ihn im<br />
Juni auch zur Zeche Storksbank führte. Im Zusammenhang mit einigen Verbesserungsvorschlägen<br />
kritisiert Stein, dass der R<strong>und</strong>baum nicht in Ordnung sei, also das<br />
Holzgestell, mit dem sich das Förderseil auf- <strong>und</strong> abdrehen ließ.<br />
Die internationale Bedeutung des <strong>Wattenscheid</strong>er Bergbaus lässt sich mit der Reise<br />
des tschechischen Bergingenieurs Augustin J. Beer (1815 – 1879) belegen, der im<br />
Auftrag des österreichischen Staates Informationen über den deutschen Bergbau<br />
sammeln sollte. Zur Karnevalszeit 1841 hielt er sich auch auf der Zeche Engelsburg<br />
auf. Hier gefielen ihm allerdings – wie er in seinem Tagebuch zu berichten weiß –<br />
weniger die technischen Neuerungen, als vielmehr die Mädchen, die sich im 6-Scheffelförderwagen<br />
herumschieben ließen.<br />
An der Villa Baare, die den Generaldirektoren des Bochumer Vereins Louis (1821 –<br />
1897) <strong>und</strong> Fritz Baare (1855 – 1917) als Sommerresidenz diente, endete die Führung<br />
über den <strong>Wattenscheid</strong>er Bergbauwanderweg. - Louis Baare machte sich als Sozialpolitiker<br />
einen Namen. Er erweiterte beim Bochumer Verein die Hilfskassen für Krankheit<br />
<strong>und</strong> Unfall, führte ein innerbetriebliches Rentenprogramm ein, ließ Werkswohnungen<br />
in Stahlhausen <strong>und</strong> Eppendorf bauen <strong>und</strong> für Ledige ein Arbeiterkosthaus<br />
errichten. 1880 unterbreitete er Bismarck Vorschläge für das Reichsunfallversicherungsgesetz,<br />
das in der damalige Zeit - auch im europäischen Vergleich - Maßstäbe<br />
setzte.<br />
Heinz-Werner Kessler<br />
– 18 –
Oskar Pieneck erhielt Sankt-Gertrudis-Preis <strong>2011</strong><br />
In einer atmosphärisch dichten <strong>und</strong> bewegenden Feierst<strong>und</strong>e erhielt am 23. September<br />
<strong>2011</strong> im vollbesetzten Ratssaal des <strong>Wattenscheid</strong>er Rathauses Oskar Pieneck (89) den<br />
diesjährigen Sankt-Gertrudis-Preis überreicht. Der Preis wird alle drei Jahre von einer<br />
unabhängigen Auswahlkommission vergeben, die in diesem Jahr aus 7 Vorschlägen<br />
auszuwählen hatte <strong>und</strong> sich für Oskar Pieneck entschied. Die Idee zur Preisverleihung<br />
geht zurücauf einen Beschluß des <strong>Wattenscheid</strong>er Rates aus dem Jahre 1949. Von<br />
1951–1964 erhielten per Ratsbeschluß insgesamt 5 herausragende Persönlichkeiten<br />
den Preis (Prälat Bernhard Hellmich, Dr. Eduard Schulte, Rektor Wilhelm Hüls, Dr. Karl-<br />
Otto Schauerte, Studienrat Werner Habig). Die nach 1964 eingestellten Preisverleihungen<br />
wurden erst im Jahre 1990 vom <strong>Heimat</strong>- <strong>und</strong> <strong>Bürgerverein</strong> <strong>Wattenscheid</strong> wiederbelebt,<br />
der seitdem die Organisation <strong>und</strong> Finanzierung der Preisverleihung übernimmt.<br />
Der Vorsitzende der Auswahlkommission, HBV-Vorsitzender Heinz-Werner Kessler, bezeichnete<br />
den Sankt-Gertrudis-Preis als den wertvollsten Preis, den <strong>Wattenscheid</strong> zu<br />
vergeben hat. Der Preis erinnere an die Stadtpatronin St. Gertrud, dessen Bild bis zum<br />
Einschreiten der Nazis bis 1933 Teil des Stadtwappens war. Der Preis sei interkonfessionell,<br />
überparteilich <strong>und</strong> als politischer Preis für heimatverb<strong>und</strong>ene Menschen zu verstehen.<br />
Der Preisträger des Jahres 2008, Klaus-Peter Hülder, lobte in seiner Laudatio<br />
den vorbildlichen <strong>und</strong> ehrenamtlichen Einsatz Pienecks für <strong>Wattenscheid</strong>, den dieser<br />
stets menschennah <strong>und</strong> offen geführt habe. "<strong>Wattenscheid</strong> <strong>und</strong> Pieneck gehören<br />
irgendwie zusammen", so Hülder. Pieneck habe sich sowohl in der Kommunalpolitik, in<br />
der Wirtschaft als auch im kulturellen Bereich erfolgreich engagiert. So bis 1975 als<br />
<strong>Wattenscheid</strong>er Ratsmitglied (dort als Vorsitzender des Kulturausschusses), als Vorsitzender<br />
der CDU <strong>Wattenscheid</strong> <strong>und</strong> als Vorsitzender der CDU-Bezirksfraktion in den Jahren<br />
1975–1989. "Daß die Bezirksvertretung <strong>Wattenscheid</strong> heute eine so hohe Achtung<br />
in der Bevölkerung hat <strong>und</strong> von den <strong>Wattenscheid</strong>ern als 'ihre' Interessenvertretung<br />
verstanden wird, ist auch Pienecks Verdienst", so Hülder. Seine besonderen Interessen<br />
lagen in der Entwicklung der <strong>Wattenscheid</strong>er Innenstadt, in der Arbeit für die <strong>Wattenscheid</strong>er<br />
Werbegemeinschaft <strong>und</strong> im Einsatz für die Kunst im öffentlichen Raum (so<br />
zum Bergbaudenkmal am Centrumplatz, den Kreuzen der Solidarität vor der Friedenskirche<br />
oder dem Förderrad auf dem Alten Markt). "Oskar Pieneck hat sich um <strong>Wattenscheid</strong><br />
verdient gemacht", so Hülder. In der Feierst<strong>und</strong>e überbrachten als Redner Oberbürgermeisterin<br />
Dr. Ottilie Scholz, Bezirksbürgermeister Hans Balbach, Propst Werner<br />
Plantzen (kath. Kirche), Pfarrer Frank Dressler (evgl. Kirche) <strong>und</strong> Hans Henneke (CDU)<br />
ihre Glückwünsche. Oskar Pieneck bedankte sich tief gerührt <strong>und</strong> unter großem Beifall<br />
für die Auszeichnung. Pieneck: "Ich durfte hier im Rathaus mit beraten, damit wir in<br />
<strong>Wattenscheid</strong> eine Stadt des Fortschritts werden konnten. Ich hoffe, daß sich auch in<br />
Zukunft immer wieder Menschen finden, die sich für die Belange ihrer Stadt einsetzen".<br />
Die Feierst<strong>und</strong>e wurde musikalisch begleitet (Pieneck ist auch Jäger) von der Jagdhornbläsergruppe<br />
des Hegerings <strong>Wattenscheid</strong>. Der Preis besteht aus einer kaligraphisch<br />
gestalteten Stadtchronik, die, einmalig in Deutschland, stets neu geschrieben <strong>und</strong> um<br />
Daten der letzten 3 Jahre <strong>und</strong> des Preisträgers ergänzt wird. Der Künstler <strong>und</strong> Kaligraph<br />
Gerd Klemptner war eigens aus Thüringen angereist, um an der Feierst<strong>und</strong>e teilnehmen<br />
zu können. Die Preisträger seit 1990 waren: Prälat Hermann Mikus, Franz-Werner Bröker,<br />
Klaus Steilmann, Leni Lückenbach, Annemarie Brinckmann, Herbert Brandhoff,<br />
Klaus-Peter Hülder <strong>und</strong> jetzt - Oskar Pieneck. Der <strong>Heimat</strong>- <strong>und</strong> <strong>Bürgerverein</strong> <strong>Wattenscheid</strong><br />
hat, so schätzt dies der HBV-Vorstand ein, mit seiner ehrenamtlich geleisteten<br />
Arbeit <strong>und</strong> der Wiederbelebung des Sankt-Gertrudis-Preises zweifelsfrei mit dazu beigetragen,<br />
<strong>Wattenscheid</strong> einen besonderen Ruf <strong>und</strong> Status zu verschaffen.<br />
Oskar Pieneck<br />
bei seiner Dankrede
Angela Feller <strong>und</strong> Hermann Hülder<br />
Einladung zur Weihnachtsfeier<br />
am Mittwoch, 14. Dezember <strong>2011</strong>, 18.00 Uhr,<br />
in das Gertrudishaus, Auf der Kirchenburg<br />
In adventlicher R<strong>und</strong>e mit Weihnachtsliedern, besinnlichen Geschichten, Gedichtvorträgen<br />
<strong>und</strong> Berichten wollen wir zurückblicken auf das Jahr <strong>2011</strong>. Gleichzeitig wollen<br />
wir Ausblick halten auf das Jahr 2012.<br />
Allen Mitgliedern <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>en<br />
wünschen Vorstand <strong>und</strong> Beirat des<br />
<strong>Heimat</strong>- <strong>und</strong> <strong>Bürgerverein</strong> <strong>Wattenscheid</strong> e.V.<br />
ein gesegnetes Weihnachtsfest <strong>und</strong> ein ges<strong>und</strong>es Jahr 2012,<br />
das uns den inneren <strong>und</strong> äußeren Frieden erhalten möge!<br />
Mit dem VW-Bulli auf großer Fahrt -<br />
Angela Feller <strong>und</strong> Hermann Hülder berichten am 23.11.<strong>2011</strong> über ihre Erlebnisse<br />
Einladung zur offenen Mitgliederversammlung<br />
Der Bulli von Angela Feller <strong>und</strong> Hermann Hülder trug seine Besitzer in mehr als<br />
30 europäische Länder. Der Bulli der Marke "Westfalia Berlin", der mittlerweile<br />
250.000 km gefahren ist, half mit, über Sprachgrenzen hinweg Brücken zu bauen.<br />
Das Ehepaar gehört zu den Käferfre<strong>und</strong>en <strong>Wattenscheid</strong>.<br />
Am 23. November werden die beiden nun in einer offenen Mitgliederversammlung<br />
des HBV über ihre Fahrten berichten. Die Versammlung beginnt um 19.30 Uhr im<br />
Gertrudishaus, Auf der Kirchenburg. Eingeladen sind neben den HBV-Mitgliedern<br />
auch die interessierte Bevölkerung. Der Eintritt ist frei.<br />
– 20 –
"Unser altet Ruhrgebiet"<br />
Ein neues Buch von Rudolf Wantoch <strong>und</strong> Waldemar Mandzel<br />
<strong>Wattenscheid</strong> ist um ein Buch reicher, das viel Nachdenkliches bietet, aber auch viel<br />
Anlaß zum Schmunzeln gibt <strong>und</strong> das deutlich macht, das viele der dort geschilderten<br />
kuriosen Geschehnisse von damals in der Regel den heutigen "Ereignissen" nicht<br />
ganz unähnlich sind. <strong>Heimat</strong>forscher <strong>und</strong> Museumswart Rudolf Wantoch, der schon<br />
einige heimatgeschichtliche Bücher geschrieben hat, hat zusammen mit Waldemar<br />
Mandzel, renommierter WAZ-Karikaturist <strong>und</strong> Cartoonist mit Ausstellungen in<br />
Museen, Galerien <strong>und</strong> öffentlichen Einrichtungen sowie Autor mehrerer Satire- <strong>und</strong><br />
Cartoon-Bücher, ein Buch mit dem Titel "Unser altet Ruhrgebiet" herausgebracht. In<br />
diesem Büchlein werden die schönsten Anekdoten aus der "<strong>Wattenscheid</strong>er Zeitung"<br />
aus der Zeit von ca. 1850 - 1930 zusammengetragen. Dabei steht die Authentizität<br />
im Vordergr<strong>und</strong>. Nichts wurde im nachhinein neu gedeutet oder umgeschrieben. So<br />
entstanden w<strong>und</strong>erbare Milieustudien, die beispielhaft für <strong>Wattenscheid</strong> <strong>und</strong> die<br />
ganze Region sind. Die Geschichten handeln von Alkoholsündern, streitenden Eheleuten,<br />
Polizeiberichten, Dieben, ersten Radfahrern, Obdachlose, H<strong>und</strong>ehaltern, dem<br />
Neben- <strong>und</strong> Miteinander verschiedener Bevölkerungsgruppen <strong>und</strong> vielen stadtbekannten<br />
<strong>Wattenscheid</strong>er Originalen. Alle Geschichten wurden von Rudolf Wantoch<br />
ausgesucht <strong>und</strong> unnachahmlich mit großem Einfühlungsvermögen <strong>und</strong> Phantasie<br />
von Waldemar Mandzel illustriert. Beide Autoren stellten zwischenzeitlich das Büchlein<br />
sogar im Rahmen einer Lesung in der Buchhandlung van Kempen vor. Das Buch<br />
ist im Shaker Media Verlag erschienen, ist bei van Kempen zu haben <strong>und</strong> kostet<br />
€ 12,90. Die Lektüre wird nachdrücklich empfohlen.<br />
(kphü)<br />
Das Wort hat der Leser:<br />
"Der <strong>Wattenscheid</strong>er", Heft 2, Juli <strong>2011</strong><br />
Wie zu lesen, in den letzten Monaten, wieder viele Ereignisse<br />
in <strong>Wattenscheid</strong>"! Der Führungswechsel, Herr Hülder, Gruß <strong>und</strong><br />
Dank für seine langjährige Tätigkeit - Herrn Kessler alles<br />
Gute zum Neubeginn! Die Rückkehr der alten Glocken der Friedenskirche,<br />
für mich besonders ansprechend. Begleiteten sie<br />
doch meinen Vater, Heinrich Hildebrand, seit seiner Kindheit,<br />
zum Gottesdienstbesuch, Konfirmation, in der Friedenskirche.<br />
Ihr Platz nun im <strong>Heimat</strong>museum Helfs Hof!<br />
Herr Wantoch, ich möchte sie mir gerne ansehen. Glocken, weit<br />
über 100 Jahre! Ich werde eine Gelegenheit dazu finden."<br />
Mit fre<strong>und</strong>lichen Grüßen<br />
Dagmara Hildebrand<br />
– 21 –<br />
Der Buch-Titel<br />
Die Autoren Mandzel <strong>und</strong> Wantoch bei der Lesun<br />
am 30. September in der Buchhandlung van Kempe
Alfred Winter ("WAZ-Winter"): Fotoausstellung im Stadtarchiv<br />
Der legendäre Alfred Winter, 30 Jahre Fotojournalist für die <strong>Wattenscheid</strong>er Lokalausgabe<br />
der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) hat "nachgegeben" <strong>und</strong> war<br />
bereit, ca. 60 Aufnahmen aus seiner umfangreichen Arbeit für eine Foto-Ausstellung<br />
zur Verfügung zu stellen. Diese Ausstellung ist eine F<strong>und</strong>grube für die Stadtgeschichte.<br />
Viele Aufnahmen sind auch wichtige Dokumente der Zeitgeschichte geworden<br />
<strong>und</strong> fehlen in kaum einer einschlägigen Chronik (so das berühmte Bild mit Rudi<br />
Dutschke <strong>und</strong> Johannes Rau in der <strong>Wattenscheid</strong>er Stadthalle). Alfred Winter ist als<br />
"WAZ-Winter" in <strong>Wattenscheid</strong> ein Begriff. Seine Aufnahmen zeugen von großer Liebe<br />
zum Beruf, von großer Herzlichkeit <strong>und</strong> liebevoller Menschennähe: So wurden Sportfans,<br />
Bergleute in der Waschkaue, spielende Kinder, Turmspringer im Freibad,<br />
Ordensschwestern, Schornsteinfeger oder Schützen aufgenommen <strong>und</strong> ins rechte Bild<br />
gerückt. Der gebürtige Emsdettener, gefragt, was ihn mit <strong>Wattenscheid</strong> so stark verbindet,<br />
gab am 15.9. bei der Ausstellungseröffnung eine zu Herzen gehende Antwort:<br />
"Ich habe in <strong>Wattenscheid</strong> meine 'blaue Blume' gef<strong>und</strong>en".<br />
Die Ausstellung ist bis Ende d.J. im Stadtarchiv Bochum an der Wittener Straße zu<br />
sehen <strong>und</strong> wird auch bald in <strong>Wattenscheid</strong>, dann dort im Foyer der Sparkasse <strong>Wattenscheid</strong>-Mitte,<br />
zu sehen sein.<br />
Ein Besuch ist unbedingt empfehlenswert.<br />
(kphü)<br />
Die Einladung zur Ausstellung<br />
– 22 –
<strong>Heimat</strong>- <strong>und</strong> <strong>Bürgerverein</strong> <strong>Wattenscheid</strong> e.V. – Beitrittserklärung<br />
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt ab ___________________<br />
zum <strong>Heimat</strong> <strong>und</strong> <strong>Bürgerverein</strong> <strong>Wattenscheid</strong> e.V.<br />
Im Rahmen meiner Mitgliedschaft erhalte ich die Vereinszeitschrift<br />
»Der <strong>Wattenscheid</strong>er«.<br />
Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgelegt.<br />
Er beträgt ab dem 1. Januar 2002 jährlich 12,- €<br />
für Familienmitglieder, Schüler, Studenten <strong>und</strong> Rentner 9,- €<br />
für juristische Personen 25,- €<br />
Der Betrag soll von dem untenstehenden Konto abgebucht werden.<br />
Mit der Nutzung meiner Daten zu Vereinszwecken bin ich einverstanden.<br />
Die Kontodaten des HBV lauten: Sparkasse Bochum BLZ 430 500 01, Konto 95 15 82<br />
Name, Vorname: ______________________________________<br />
geboren am: ______________________________________<br />
Straße: ______________________________________<br />
PLZ, Wohnort: ______________________________________<br />
Telefon (priv., dienstl.): ______________________________________<br />
________________________________________<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
Einzugsermächtigung<br />
Hiermit ermächtige ich den <strong>Heimat</strong>- <strong>und</strong> <strong>Bürgerverein</strong> <strong>Wattenscheid</strong> e.V. widerruflich,<br />
den Mitgliedsbeitrag in Höhe von __________ €<br />
<strong>und</strong> eine Zuwendung in Höhe von __________ €<br />
einmal jährlich vom nachstehend genannten Konto abzubuchen.<br />
Kontoinhaber: ________________________________________<br />
Kontonummer: ________________________________________<br />
Bankleitzahl: ________________________________________<br />
Geldinstitut: ________________________________________<br />
________________________________________<br />
Ort, Datum, Unterschrift<br />
<strong>Heimat</strong>- <strong>und</strong> <strong>Bürgerverein</strong> <strong>Wattenscheid</strong> e.V., An der Papenburg 30a, 44866 <strong>Wattenscheid</strong>
Bei Unzustellbarkeit oder Mängeln in der Anschrift<br />
Anschriftenberechtigungskarte senden an<br />
<strong>Heimat</strong>- <strong>und</strong> <strong>Bürgerverein</strong> <strong>Wattenscheid</strong> e.V.<br />
An der Papenburg 30a<br />
44866 Bochum-<strong>Wattenscheid</strong><br />
Der <strong>Heimat</strong>- <strong>und</strong> <strong>Bürgerverein</strong> bietet seinen Mitgliedern <strong>und</strong> Interessierten aus der Reihe der Beiträge zur <strong>Wattenscheid</strong>er<br />
Geschichte folgende Veröffentlichungen sowie Fahnen, Aufkleber <strong>und</strong> Anstecker an:<br />
Heinz-Jürgen Brand: Kirche <strong>und</strong> Krankenhaus –<br />
Zur Geschichte der »leibhaftigen« Liebe<br />
im Christentum zu den Armen <strong>und</strong> Kranken 2,50 €<br />
Peter Zimmermann: <strong>Wattenscheid</strong> in der Notgeldzeit 1,50 €<br />
Rudolf Wantoch: Die <strong>Wattenscheid</strong>er Postgeschichte 1,50 €<br />
Horst Ueberhorst: <strong>Wattenscheid</strong>: Die Freiheit verloren?<br />
Eine Sozialgeschichte 9,00 €<br />
Peter Zimmermann: <strong>Wattenscheid</strong>er Hausinschriften<br />
mit Zeichnungen von Helmut Laaser 1,50 €<br />
Franz-Werner Bröker: 300 Jahre Kanzelaltar in der evangelischen Kirche am Alten Markt –<br />
Ein Beitrag zur evangelischen<br />
Kirchengeschichte <strong>Wattenscheid</strong>s 5,00 €<br />
HBV (Hrsg.): <strong>Wattenscheid</strong>er Geschichte(n) 15,00 €<br />
HBV (Hrsg.): <strong>Wattenscheid</strong>er Geschichte(n)<br />
im Spiegel historischer Zeitungsartikel 15,00 €<br />
HBV (Hrsg.): Anstecker »Siegel der Stadt <strong>Wattenscheid</strong>« 3,00 €<br />
HBV (Hrsg.): WAT-Aufkleber (klein <strong>und</strong> groß) 1,00 €<br />
HBV (Hrsg.): <strong>Wattenscheid</strong>er Wimpel (15 x 25 cm) 8,00 €<br />
HBV (Hrsg.): <strong>Wattenscheid</strong>er Fahne mit Stadtpatronin<br />
»Sankt Gertrud« (60 x 120 cm) 25,00 €<br />
HBV (Hrsg.): <strong>Wattenscheid</strong>er Fahne (80 x 180 cm) 45,00 €<br />
Franz-Werner Bröker: Illustrierte Stadtgeschichte (digitalisierte s/w-Neuauflage) 15,00 €<br />
Kupitz, Wilmes, Gerz, Weinhold: Glocken der <strong>Wattenscheid</strong>er Kirchen <strong>und</strong> Kapellen 9,00 €<br />
Jost Benfer: Der Kampf der <strong>Wattenscheid</strong>er gegen die Eingemeindung 1972–1974 12,00 €<br />
Jost Benfer: Rückgemeindung – Sechs Städte begehren auf 12,00 €