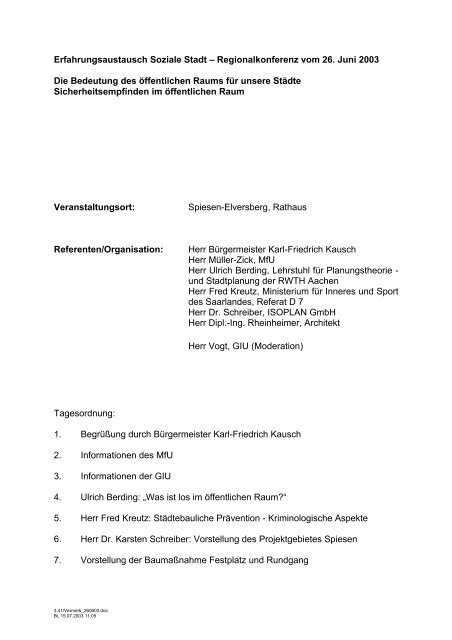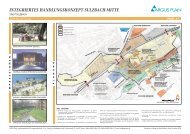Erfahrungsaustausch Soziale Stadt – Regionalkonferenz vom 26 ...
Erfahrungsaustausch Soziale Stadt – Regionalkonferenz vom 26 ...
Erfahrungsaustausch Soziale Stadt – Regionalkonferenz vom 26 ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Erfahrungsaustausch</strong> <strong>Soziale</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>–</strong> <strong>Regionalkonferenz</strong> <strong>vom</strong> <strong>26</strong>. Juni 2003<br />
Die Bedeutung des öffentlichen Raums für unsere Städte<br />
Sicherheitsempfinden im öffentlichen Raum<br />
Veranstaltungsort:<br />
Spiesen-Elversberg, Rathaus<br />
Referenten/Organisation:<br />
Herr Bürgermeister Karl-Friedrich Kausch<br />
Herr Müller-Zick, MfU<br />
Herr Ulrich Berding, Lehrstuhl für Planungstheorie -<br />
und <strong>Stadt</strong>planung der RWTH Aachen<br />
Herr Fred Kreutz, Ministerium für Inneres und Sport<br />
des Saarlandes, Referat D 7<br />
Herr Dr. Schreiber, ISOPLAN GmbH<br />
Herr Dipl.-Ing. Rheinheimer, Architekt<br />
Herr Vogt, GIU (Moderation)<br />
Tagesordnung:<br />
1. Begrüßung durch Bürgermeister Karl-Friedrich Kausch<br />
2. Informationen des MfU<br />
3. Informationen der GIU<br />
4. Ulrich Berding: „Was ist los im öffentlichen Raum“<br />
5. Herr Fred Kreutz: Städtebauliche Prävention - Kriminologische Aspekte<br />
6. Herr Dr. Karsten Schreiber: Vorstellung des Projektgebietes Spiesen<br />
7. Vorstellung der Baumaßnahme Festplatz und Rundgang<br />
3.41/Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
Bi, 15.07.2003 11:05
P:\Projekte_Beratung\Saarl_Erfaustausch_Soz<strong>Stadt</strong>_3255\Praesentation\Veranstaltungen\<strong>Regionalkonferenz</strong>en_Themenworks<br />
hops_Exkursionen_ <strong>Stadt</strong>teilmanagerforen\2002-2003\<strong>26</strong>0603_Regional\Dokumentation\Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
1. Begrüßung durch Bürgermeister Karl-Friedrich Kausch<br />
Der Bürgermeister der Gemeinde Spiesen-Elversberg, Karl-Friedrich Kausch, begrüßt<br />
die anwesenden Teilnehmer und wünscht der Veranstaltung einen guten und<br />
erfolgreichen Verlauf.<br />
2. Informationen des MfU<br />
Das MfU kündigt an, dass die Programm-Mittel der <strong>Soziale</strong>n <strong>Stadt</strong> aller Voraussicht<br />
nach in der zugesagten Größenordnung bewilligt werden können. Die Zuwendungsbescheide<br />
werden den Kommunen voraussichtlich im September diesen Jahres zugehen.<br />
Derzeit läuft die Zwischenbewertung des Bund-Länder-Programms. Eine Fertigstellung<br />
der Bewertung ist für Ende 2003 zu erwarten. Als Folge der Bewertung kann es<br />
sein, dass einzelne Gemeinden aus dem Programm <strong>Soziale</strong> <strong>Stadt</strong> ausscheiden werden,<br />
sofern die Ergebnisse der Bewertung dies nahelegen.<br />
In der Richtlinie der Wohnungsmodernisierungsförderung für 2003 des Saarländischen<br />
Finanzministeriums wird erstmals ausdrücklich den Projektgebieten der <strong>Soziale</strong>n<br />
<strong>Stadt</strong> Vorrang eingeräumt. Für diese Bereiche entfällt gemäß des Leitfadens<br />
<strong>Soziale</strong> <strong>Stadt</strong> als Teil der Verwaltungsvereinbarung zum Bund-Länder-Programm<br />
auch die Belegungsbindung wie bisher an eine Förderung im Rahmen der Wohnungsmodernisierung<br />
geknüpft dar.<br />
3. Informationen der GIU<br />
Das Nauwieser Viertel in Saarbrücken wird aus dem Programm <strong>Soziale</strong> <strong>Stadt</strong> herausgenommen.<br />
In Saarbrücken kommt dafür das <strong>Stadt</strong>teil Burbach in das Programm<br />
hinein. Daraus ergibt sich, dass Herr Ulrich Heimann bisher Mitglied der Lenkungsrunde<br />
zum <strong>Erfahrungsaustausch</strong> <strong>Soziale</strong> <strong>Stadt</strong> dieser zukünftig nicht mehr angehören<br />
wird. Für ihn wird Frau Erika Mühlen zukünftig in der Lenkungsrunde mitarbeiten.<br />
Auf der nächsten <strong>Regionalkonferenz</strong> im September soll über eine mögliche<br />
Neuwahl der gesamten Lenkungsrunde entschieden werden.<br />
Die GIU hat die Förderfibel zum Bund-Länder-Programm <strong>Soziale</strong> <strong>Stadt</strong> fertiggestellt.<br />
Sie wird den Anwesenden als Heft ausgehändigt und kann bei der GIU bei Bedarf<br />
schriftlich bestellt werden. Darüber hinaus steht sie allen Interessierten als Datei im<br />
pdf-Format auf den Internet-Seiten www.soziale-stadt-saar.de zur Verfügung. Die<br />
GIU bittet alle Benutzer der Förderfibel um Rückmeldungen zur Verbesserungsvorschlägen<br />
oder möglichen Korrekturen, da für den Herbst/Winter eine Überarbeitung<br />
und Aktualisierung geplant ist.<br />
Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
Bi, 15.07.2003 11:05<br />
- 2 -
P:\Projekte_Beratung\Saarl_Erfaustausch_Soz<strong>Stadt</strong>_3255\Praesentation\Veranstaltungen\<strong>Regionalkonferenz</strong>en_Themenworks<br />
hops_Exkursionen_ <strong>Stadt</strong>teilmanagerforen\2002-2003\<strong>26</strong>0603_Regional\Dokumentation\Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
4. Ulrich Berding: „Was ist los im öffentlichen Raum“<br />
Der öffentliche Raum ist wieder zum Thema geworden. Das findet seinen Ausdruck<br />
ebenso in Fachpublikationen wie in politischen Diskussionen, Programmen und<br />
kommunalen Handlungsansätzen. Das Interesse richtet sich dabei sowohl auf die<br />
„traditionellen“ öffentlichen Freiräume (Plätze, Parks, Straßenräume etc.) wie auch<br />
auf „neue“ öffentlich nutzbare Räume (Passagen, Malls etc.).<br />
Dass öffentliche Räume wesentlich unser Bild von den Städten prägen und von großer<br />
Bedeutung für die Lebensqualität einer <strong>Stadt</strong> sind, ist eine altbekannte Tatsache.<br />
Denn hier begegnen sich die Bewohnerinnen und Bewohner, hier findet öffentliches<br />
Leben (auch) statt und hier treffen die unterschiedlichsten Nutzungsanforderungen <strong>–</strong><br />
von Verkehr, Konsum und Unterhaltung bis zur Erholung und dem Aufenthalt an der<br />
„frischen Luft“ <strong>–</strong> durchaus nicht konfliktfrei aufeinander. Entsprechend vielfältig waren<br />
und sind auch die Problemwahrnehmungen und die Bemühungen um öffentliche<br />
Räume.<br />
Vor diesem Hintergrund entstand das Vorstudie zum ExWoSt-Forschungsfeld „Öffentlicher<br />
Raum“. Mit ihr sollten<br />
• Situationsanalysen und Problemwahrnehmungen zusammengetragen,<br />
• Handlungsbedarf aus der Sicht der Praxis umrissen,<br />
• bislang vorliegende Handlungsansätze in den Kommunen dargestellt und<br />
• Unterstützungs- und Förderungsmöglichkeiten von Bundesseite aufgezeigt werden.<br />
Zu diesem Zweck wurden im Bearbeitungszeitraum von Ende 2000 bis Mitte 2002<br />
• eine Auswertung von neuerer Literatur und Fachbeiträgen zum Thema,<br />
• Befragungen in Planungs- und Grünflächenämtern von sechzehn Kommunen,<br />
• vertiefende Fallstudien in fünf Gemeinden,<br />
• Interviews mit Fachleuten für bestimmte Aspekte des Themas (Investoren, Polizei,<br />
Pastoren etc.) sowie<br />
• zwei Expertenhearings (mit jeweils etwa 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern<br />
aus Forschung und Praxis) durchgeführt.<br />
Es handelte sich also um eine typische „explorative“ Studie, mit der zunächst ein<br />
Forschungs- und Handlungsfeld soweit strukturiert wird, dass Sinnhaftigkeit und<br />
Machbarkeit weiterer forschender Bemühungen erkennbar sowie nächste Schritte<br />
zielgenau planbar werden.<br />
Zentrale Ergebnisse<br />
Aus der Vielfalt von Befunden und Beobachtungen, die im Schlussbericht ausführlich<br />
dargestellt werden, sollen hier thesenhaft verkürzt einige zentrale Ergebnisse hervorgehoben<br />
werden:<br />
Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
Bi, 15.07.2003 11:05<br />
- 3 -
P:\Projekte_Beratung\Saarl_Erfaustausch_Soz<strong>Stadt</strong>_3255\Praesentation\Veranstaltungen\<strong>Regionalkonferenz</strong>en_Themenworks<br />
hops_Exkursionen_ <strong>Stadt</strong>teilmanagerforen\2002-2003\<strong>26</strong>0603_Regional\Dokumentation\Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
Bedeutung der öffentlichen Räume<br />
Öffentliche Räume sind ein, wenn nicht das zentrale Handlungsfeld des Städtebaus<br />
und diese Bedeutung wird zunehmend (wieder) erkannt.<br />
Literatur, Experten und Fachleute vor Ort bestätigen unisono die Bedeutung öffentlicher<br />
Räume <strong>–</strong> für die Städte und als zentrales Handlungsfeld des Städtebaus.<br />
Hervorgehoben werden im Rahmen unserer Interviews vor allem zwei Funktionen<br />
öffentlicher Räume: Kommunikation und Begegnung stehen unstrittig im Mittelpunkt,<br />
ergänzt durch Hinweise auf den den Lagewert mitbestimmenden Faktor, auf den insbesondere<br />
Wirtschaftsvertreter hinweisen.<br />
Zu berücksichtigen ist, dass außerhalb von Expertenkreisen zwar mit den vielfältigen<br />
Erscheinungsformen des Gegenstandes öffentlicher Raum umgegangen wird <strong>–</strong> allerdings<br />
ohne dass die Bezeichnung „öffentlicher Raum“ Verwendung findet oder<br />
auch nur Klarheit darüber besteht, was genau sich dahinter verbirgt. Für die Vermittlung<br />
des Themas in Öffentlichkeit und Politik muss also mit griffigeren Benennungen<br />
und Hinweisen auf konkrete Aufgaben gearbeitet werden.<br />
Handlungsbedarf vor Ort<br />
Es besteht Handlungsbedarf, denn Nutzung und Funktion öffentlicher Räume verändern<br />
sich auf vielfältige, z. T. krisenhafte Weise.<br />
Praktiker berichten <strong>vom</strong> „guten“ und zugleich „problematischen“ oder „unbefriedigenden“<br />
Zustand öffentlicher Räume innerhalb einer <strong>Stadt</strong>. Das verweist auf ungleichzeitige,<br />
gegenläufige Entwicklungen und eine deutliche Inselbildung (mit positiven<br />
Werten zumeist in den Citys und repräsentativen Parkanlagen). Die überall beklagte<br />
schwierige kommunale Haushaltslage führt also auch im Umgang mit den öffentlichen<br />
Räumen zu Prioritätensetzungen und Vernachlässigungen.<br />
Die These von der nachlassenden Nutzung und damit der fortschreitenden Funktionsentleerung<br />
der öffentlichen Räume wird von den Experten vor Ort nicht geteilt. Im<br />
Gegenteil, es wird allenthalben von einer Zunahme der Nutzung und neuen gesellschaftlichen<br />
Ausdrucksformen in den öffentlichen Räumen gesprochen. In diesem<br />
Zusammenhang wird jedoch der Bedarf gesehen, mehr über neue Ansprüche in Erfahrung<br />
zu bringen, um vor diesem Hintergrund neue Wege des Umgangs mit den<br />
öffentlichen Räumen zu finden bzw. zu entwickeln.<br />
Die befragten Experten berichten von einer Zunahme des Unsicherheitsgefühls in<br />
öffentlichen Räumen, das aber stark nach Räumen zu differenzieren ist und das vor<br />
allem von älteren Menschen so empfunden wird. Die Ursachen für die wachsende<br />
subjektive Unsicherheit sind vielfältig: Medienberichte, abweichendes Verhalten marginalisierter<br />
Bevölkerungsgruppen, Verschmutzungen und Spuren von Vandalismus<br />
schüren bei vielen Menschen Ängste. Dies alles steht aber im deutlichen Kontrast zur<br />
objektiven Sicherheitslage in den öffentlichen Räumen, denn eine Zunahme der die<br />
Zahl der Straftaten ist in den letzten Jahren nicht zu verzeichnen. Hier sehen die Befragten<br />
aber sowohl weiteren Informationsbedarf als auch Handlungserfordernisse<br />
abseits neuer Formen der Überwachung und Kontrolle.<br />
Eine der Ausgangsthesen des Forschungsvorhabens war, dass durch zunehmende<br />
Privatisierung die öffentlichen Räume in ihrer sozialen Funktion gefährdet seien. Versteht<br />
man unter „Privatisierung“ die Übernahme öffentlicher Flächen in private Regie,<br />
so wurde dies im Rahmen unserer Untersuchung von den Gesprächspartnern nicht<br />
als Problem benannt. Hingegen wurde durchweg ein Spannungsverhältnis zwischen<br />
Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
Bi, 15.07.2003 11:05<br />
- 4 -
P:\Projekte_Beratung\Saarl_Erfaustausch_Soz<strong>Stadt</strong>_3255\Praesentation\Veranstaltungen\<strong>Regionalkonferenz</strong>en_Themenworks<br />
hops_Exkursionen_ <strong>Stadt</strong>teilmanagerforen\2002-2003\<strong>26</strong>0603_Regional\Dokumentation\Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
den überall beschriebenen Kommerzialisierungstendenzen und den sozialen Nutzungsanforderungen<br />
beobachtet. In diesem Feld werden Regelungsbedarfe aber<br />
auch -Möglichkeiten gesehen.<br />
Handlungsansätze<br />
In der kommunalen Praxis wurde und wird ein breites Spektrum von Handlungsansätzen<br />
entwickelt, das von Konzepten für einzelne problematische Räume bis hin zu<br />
übergreifenden Strategien reicht.<br />
Ein Schwerpunkt kommunaler Aktivitäten liegt auf den Innenstädten. Aber auch die<br />
Notwendigkeit, etwas für die <strong>Stadt</strong>teile tun zu müssen, wird in Programmen umgesetzt.<br />
Ebenso erfahren die öffentlichen Räume als Teile systemischer und integrierter<br />
gesamtstädtischer Konzepte verstärkte Aufmerksamkeit. Insgesamt zeigt sich, dass<br />
öffentliche Räume nicht auf einzelne Stereotype („Quartiers-Platz“, „Markt“, „Park“<br />
etc.) reduziert werden können, sondern ein komplexes Funktions- und Raumsystem<br />
sind, das sich in dynamischem Wandel befindet <strong>–</strong> und als solches der Gestaltung<br />
bedarf.<br />
Für die Weiterentwicklung der Praxis ist außerdem von großem Interesse, mehr über<br />
Handlungsansätze in Erfahrung zu bringen, die sich diesem Wandel stellen.<br />
Die bestehenden Handlungsansätze bedürfen der Unterstützung, der (wissenschaftlichen)<br />
Förderung und der Verbreitung, zumal die kommunalpolitische Wahrnehmung<br />
des Themas noch nicht ausreichend entwickelt ist. Dazu bedarf es nach Auffassung<br />
der Gesprächspartner eines „Marketings für die öffentlichen Räume“, wobei mit den<br />
öffentlichen Räumen dann auch ein Beitrag für das <strong>Stadt</strong>marketing geleistet werden<br />
kann.<br />
Daneben ist die Koordination innerhalb der Verwaltung zu verbessern. Dies kann auf<br />
unterschiedliche Weise <strong>–</strong> z. B. durch eine Querschnittszuständigkeit für die öffentlichen<br />
Räume <strong>–</strong> erreicht werden. Voraussetzung hierfür ist, ausreichende Ressourcen<br />
zuzuteilen bzw. die Effizienzsteigerung des Mitteleinsatzes für die Handlungsstrategien.<br />
Die in diesem Zusammenhang als sinnvoll und notwendig bezeichneten Partnerschaften<br />
mit Privaten bergen allerdings das Problem der Selektivität: hier werden<br />
durch Aktivitäten Privater knappe öffentliche Mittel gebunden.<br />
Durchweg Einigkeit besteht hinsichtlich der Frage, dass Maßnahmen in öffentlichen<br />
Räumen intensiver öffentlicher Vermittlung bedürfen. Dabei wird darauf hingewiesen,<br />
dass neben lokalen Interessen auch übergeordnete Belange in die Erörterungen einfließen<br />
müssen.<br />
Mehr Wissen<br />
Belastbare empirische Daten über die Entwicklungen in öffentlichen Räumen fehlen<br />
fast vollständig.<br />
Schon die aktuellen Nutzungsanforderungen unterschiedlicher Gruppen <strong>–</strong> z. B. von<br />
Jugendlichen oder Migranten <strong>–</strong> an die öffentlichen Räume sind kaum bekannt. Noch<br />
weniger Kenntnisse bestehen in Bezug auf mittelfristige Nutzungstrends um anstehende<br />
Aufgaben zukunftsfähig anzugehen. Ebenfalls wenig Klarheit herrscht bezüglich<br />
der tatsächlichen Überlagerungen von Nutzungs- und Verfügungsrechten und<br />
deren Regulierung in öffentlich nutzbaren Räumen und welche Auswirkungen aktu-<br />
Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
Bi, 15.07.2003 11:05<br />
- 5 -
P:\Projekte_Beratung\Saarl_Erfaustausch_Soz<strong>Stadt</strong>_3255\Praesentation\Veranstaltungen\<strong>Regionalkonferenz</strong>en_Themenworks<br />
hops_Exkursionen_ <strong>Stadt</strong>teilmanagerforen\2002-2003\<strong>26</strong>0603_Regional\Dokumentation\Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
elle Trends diesbezüglich haben. Zugleich deutet sich an, dass aktuelle Problemwahrnehmungen<br />
(etwa die These von der „Privatisierung öffentlicher Räume“) dringend<br />
der Differenzierung bedürfen.<br />
5. Herr Fred Kreutz: Städtebauliche Prävention - Kriminologische<br />
Aspekte<br />
1. Einführung<br />
Für die Erklärung der überproportional hohen Kriminalitätsbelastung von städtischen<br />
Gebieten wird aus kriminologische Sicht seit langem auch der Wohnumwelt Bedeutung<br />
im Sinne eines Bedingungsfaktors für Kriminalität beigemessen.<br />
Raumstruktur, Städtebau und Architektur können in dreifacher Hinsicht von Belang<br />
sein:<br />
- Sie können Sozialisationsbedingungen zusätzlich dahingehend beeinflussen,<br />
dass diese abweichendes Verhalten begünstigen (also zur „Entstehung von<br />
Straftätern“ beitragen),<br />
- sie können spezifische Gelegenheitsstrukturen schaffen, die die Begehung<br />
von Straftaten ermöglichen oder erleichtern (also zur „Entstehung von Straftaten“<br />
beitragen) und<br />
- sie können Bedingungen schaffen, die <strong>–</strong> unter Umständen völlig unabhängig<br />
von der objektiven Gefahrenlage <strong>–</strong> bei der Bevölkerung oder einzelnen Gruppen<br />
der Bevölkerung Unsicherheit hervorrufen (also zur „Entstehung von Kriminalitätsfurcht“<br />
beitragen).<br />
In polizeilicher Hinsicht können Aspekte der Wohnumwelt damit für die Primäre Prävention<br />
(Bekämpfung der „Kriminalitätsursachen“), für die Sekundäre Prävention<br />
(Beeinflussung der Tatgelegenheitsstrukturen) und für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung<br />
Bedeutung erlangen.<br />
2. Wohnumfeld, Kriminalität und Prävention<br />
2.1 Primäre Prävention<br />
Die empirische Befundlage zu den Auswirkungen der Wohnumwelt als Bedingungsfaktor<br />
für abweichendes Verhalten ist keineswegs gesichert, teilweise sogar widersprüchlich.<br />
Obwohl z. B. Hochhaussiedlungen („Betonsilos“), Trabantenstädte und<br />
Plattenbausiedlungen häufig als kriminalitätsträchtig angesehen werden und dies<br />
auch der polizeilichen Alltagserfahrung entsprechen mag, finden sich bei Untersuchungen<br />
hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen der Anzahl der Stockwerke, der<br />
Belegungsdichte usw. und Kriminalität durchaus widersprüchliche Ergebnisse. Dies<br />
ist freilich in erster Linie auch ein Forschungsproblem, da sich der Wirkfaktor Wohnumwelt<br />
kaum aus dem Bedingungsgeflecht anderer Einflussfaktoren herauslösen<br />
und isoliert messen lässt.<br />
Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
Bi, 15.07.2003 11:05<br />
- 6 -
P:\Projekte_Beratung\Saarl_Erfaustausch_Soz<strong>Stadt</strong>_3255\Praesentation\Veranstaltungen\<strong>Regionalkonferenz</strong>en_Themenworks<br />
hops_Exkursionen_ <strong>Stadt</strong>teilmanagerforen\2002-2003\<strong>26</strong>0603_Regional\Dokumentation\Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
Gleichwohl dürfte in der Kriminologie ein Grundkonsens bestehen, dass der Wohnumwelt<br />
insoweit grundsätzlich Bedeutung zukommt, ungeklärt sind freilich die spezifischen<br />
Aspekte und Zusammenhänge (also was konkret unter welchen Umständen<br />
wir wirkt).<br />
Dabei kommt es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht auf die Bausubstanz bzw. das<br />
Baumaterial („Betonsilo“) an, auch wenn diese sich über das subjektive Wohlbefinden<br />
mittelbar auf andere Aspekte auswirken mögen, von Bedeutung sind vielmehr<br />
die durch bestimmte städtebauliche und architektonische Maßnahmen hervorgerufen<br />
oder begünstigten sozialen Gegebenheiten.<br />
Mögliche Bedingungszusammenhänge zwischen Hochhausarchitektur und Kriminalität<br />
im Sinne einer Begünstigung von abweichendem Verhalten und des Straffälligwerdens<br />
(insbesondere bei Kindern und Jugendlichen) könnten beispielsweise sein:<br />
‣ ungünstige Sozialstruktur, u.a. durch Konzentration sozial benachteiligter, kinderreicher<br />
Familien<br />
‣ hoher Anteil von Kindern und Jugendlichen<br />
‣ hohe Belegungsdichte (keine Rückzugsmöglichkeiten, „Overcrowding“)<br />
‣ unzureichende nichtkommerzielle Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, insbesondere<br />
für ältere Kinder und Jugendliche<br />
‣ Mangel an Orientierungs- und Identifikationsmöglichkeiten durch unpersönliche,<br />
monofunktional gestaltete Wohnumwelt<br />
‣ Anonymität und Kommunikationszerfall<br />
‣ hohe Fluktuation mit sozial destabilisierender Wirkung<br />
‣ mangelhafte soziale Kontrolle<br />
‣ erhöhte Anzeigebereitschaft<br />
‣ usw.<br />
Städtebaulich orientierte Präventionsmaßnahmen im Sinne der Primären Prävention<br />
müssten sich demzufolge zum Beispiel auf folgende Aspekte ausrichten:<br />
‣ Schaffung sozialisationsgeeigneten Wohnraums (einschließlich der Beeinflussung<br />
des Wohnverhaltens)<br />
‣ kinder- und jugendfreundliche Gestaltung des unmittelbaren Wohnumfeldes<br />
(z. B. Wohnstraßen, Spiel-, Bolzplätze, Treffpunkte für Jugendliche)<br />
‣ rechtzeitige Planung und Realisierung jugendbezogener sozialstruktureller<br />
Infrastruktureinrichtungen (z. B. „unkontrollierte“, von Wohngebäuden räumlich<br />
abgesetzte Spielzonen/Treffpunkte)<br />
‣ aktive Beteiligung der Mieter an baulichen und gestalterischen Veränderungen<br />
der Wohnanlage durch den Vermieter/des Wohnumfeldes durch die Gemeinde<br />
‣ (nicht dirigistische) Belegungssteuerung im Sinne der Schaffung kleiner „Communities<br />
of Interest“ innerhalb einer baulich und sozial durchmischten erweiterten<br />
Nachbarschaft<br />
‣ sozial-kulturelle Aufbauarbeit (Animation) in Neubausiedlungen (auch durch<br />
die Bewohner selbst)<br />
‣ Erleichterung des aktiven Kontaktes durch Baugestaltung (z. B. durch verkehrsberuhigte<br />
Zonen)<br />
‣ Planung von Erlebniszonen durch bauliche Nutzungsmischung in Wohnsiedlungen<br />
und von unterschiedlichen Wohnformen in den einzelnen Wohngebieten<br />
Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
Bi, 15.07.2003 11:05<br />
- 7 -
P:\Projekte_Beratung\Saarl_Erfaustausch_Soz<strong>Stadt</strong>_3255\Praesentation\Veranstaltungen\<strong>Regionalkonferenz</strong>en_Themenworks<br />
hops_Exkursionen_ <strong>Stadt</strong>teilmanagerforen\2002-2003\<strong>26</strong>0603_Regional\Dokumentation\Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
‣ Revitalisierung der Innenstädte, u.a. durch Förderung des sogenannten <strong>Stadt</strong>haus-Modells<br />
(Schließen von Baulücken im innerstädtischen Bereich mit kleineren<br />
Wohngebäuden)<br />
‣ Verbesserung der Wohnqualität in sanierungsbedürftigen Gebieten bei gleichzeitiger<br />
Verhinderung großflächiger Luxus-Sanierung von <strong>Stadt</strong>gebieten mit<br />
gewachsener Mischbevölkerung<br />
‣ Sanierung von Problemgebieten mit sozial auffälliger Bevölkerung, gegebenenfalls<br />
auch räumlich gestreute Unterbringung solcher Personen in „normalen“<br />
Wohngebieten<br />
‣ Vermeidung zusammenhängender Wohnareale für Subkulturen (Ghettoisierung);<br />
Förderung von „Alternativmodellen“, wenn durch kaum steuerbaren Zuzug<br />
von Multiproblemgruppen die Gefahr besteht, dass alteingesessene Bevölkerungsteile<br />
abwandern<br />
‣ auch im Hinblick auf die Freizeitgestaltung sinnvolle Verkehrsanbindung<br />
(ÖPNV, Nacht-Taxis usw.) von Neubaugebieten an die üblichen Freizeiteinrichtungen<br />
außerhalb des eigenen Wohngebietes<br />
‣ usw.<br />
Die Auflistung verdeutlicht, dass die Wohnumwelt in Form von baulichen Gegebenheiten<br />
im Grunde den äußeren Rahmen für soziale Zustände und Entwicklungen angibt,<br />
die auch aus sozialpolitischer Sicht als nicht erstrebenswert angesehen werden.<br />
Sie ist insoweit beredter Ausdruck der Aussage Franz von Liszts, wonach eine gute<br />
Sozialpolitik die beste Kriminalpolitik sei.<br />
2.2 Sekundäre Prävention<br />
Im Hinblick auf die Reduzierung von Tatgelegenheitsstrukturen und Tatanreizen im<br />
Rahmen der Sekundären Prävention kamen die <strong>–</strong> vergleichsweise wenigen - empirischen<br />
Untersuchungen ebenfalls zu keinen einhelligen Ergebnissen. Die entsprechenden<br />
Überlegungen gehen überwiegend zurück auf die Studien von Oscar Newman.<br />
Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass sich die bevorzugten Tatorte in Wohnanlagen<br />
vor allem in nicht einsehbaren, unüberschaubaren, anonymen Bereichen<br />
und Ecken befinden, für die sich niemand zuständig fühlt und an denen demzufolge<br />
keine informelle soziale Kontrolle stattfindet. Er plädierte für die Schaffung eines „defensible<br />
space“ (verteidigungsfähiger Raum). Die physische Wohnumwelt soll so beschaffen<br />
sein, dass sie es den Bewohnern erlaubt, Funktionsträger der eigenen Sicherheit<br />
zu sein. Kernpunkt dieses Ansatzes ist die Überlegung, dass der Verteidigungsraum<br />
nicht erst an der Wohnungstür anfangen darf, sondern vorverlagert werden<br />
muss: Er unterscheidet dabei private (z. B. Wohnung), halbprivate (z. B. gemeinsamer,<br />
nach außen abgeschlossener Korridor für einige Wohnungen), halböffentliche<br />
(z. B. Vorplatz, gemeinsamer Parkplatz für die Bewohner und Besucher)<br />
und öffentliche Zonen, denen jeweils unterschiedliche Verantwortlichkeiten und unterschiedliche<br />
Kontrollintensität entspricht. (z. B. die Vorverlagerung der Verantwortlichkeit<br />
und der Kontrollintensität in den öffentlichen Straßenraum im Rahmen einer<br />
Kehrwoche!). Nicht zuletzt durch die physische und symbolische Demonstration von<br />
Territorialitätsansprüchen der Bewohner, von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten<br />
sollen potenzielle Täter von der Tatbegehung abgeschreckt werden (also <strong>vom</strong><br />
Grundgedanken her durchaus vergleichbar mit den Überlegungen der „broken windows“-Theorie).<br />
Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
Bi, 15.07.2003 11:05<br />
- 8 -
P:\Projekte_Beratung\Saarl_Erfaustausch_Soz<strong>Stadt</strong>_3255\Praesentation\Veranstaltungen\<strong>Regionalkonferenz</strong>en_Themenworks<br />
hops_Exkursionen_ <strong>Stadt</strong>teilmanagerforen\2002-2003\<strong>26</strong>0603_Regional\Dokumentation\Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
Auch wenn man berücksichtigt, dass die Wirkung solcher Maßnahmen kaum messbar<br />
sein dürfte, von vornherein nur bestimmte Täter abgeschreckt werden dürften,<br />
nur bestimmte Deliktsarten insoweit präventabel sind und möglicherweise auch mit<br />
einem Verdrängungseffekt gerechnet werden muss, erscheint es sinnvoll, neben herkömmlichen<br />
technischen Präventionsmaßnahmen, wie sie die Kriminalpolizeilichen<br />
Beratungsstellen seit langem empfehlen, auch auf solche Aspekte zu achten.<br />
Im Anschluss an die Überlegungen des „defensible space“ könnten beim Bau von<br />
Wohnanlagen (die Grundgedanken sollten aber durchaus auch bei Ein- oder Zweifamilienhäusern<br />
berücksichtigt werden) zum Beispiel folgende Maßnahmen im Sinne<br />
der Sekundären Prävention von Bedeutung sein.<br />
‣ Funktionsmischung von Gebieten: Wohnen im Geschäftsviertel <strong>–</strong> Läden, Gewerbe-<br />
und Freizeiteinrichtungen in Wohngebieten<br />
‣ Verzicht auf Hochhausbau zugunsten überschaubarer Mehrfamilienhäuser<br />
oder<br />
‣ Schaffung kleinerer, überschaubarer Wohneinheiten (auch in Großwohnanlagen)<br />
mit wenigen Wohnungen pro Hauseingang/Wohnflur/Lift<br />
‣ Maßnahmen zur Belebung von Nachbarschaften und Identifikationsmöglichkeiten<br />
der Bewohner<br />
‣ Belebung wenig genutzter Bereiche durch Maßnahmen zur Gestaltung durch<br />
die Bewohner, Erhöhung der Attraktivität und dem Angebot für vielfältige Nutzungsmöglichkeiten<br />
‣ eindeutige Zuordnung von Flächen und Gebäudeteilen (Verantwortlichkeit,<br />
Zuständigkeit) sowie bauliche Demonstration von Territorialitätsansprüchen<br />
(öffentlicher Raum, halböffentlicher Bereich, halbprivater Bereich, Privatbereich)<br />
durch reale (Mauern, geschlossene Türen) und symbolische (Bepflanzung,<br />
farbliche Gestaltung, unterschiedliche Bepflasterung) Barrieren zur<br />
Kennzeichnung dieser Bereiche<br />
‣ Schaffung von Gemeinschaftseinrichtungen, die die territoriale Haltung der<br />
Bewohner verstärken (Spielplätze, Trockenplätze, Sitzgelegenheiten usw.)<br />
‣ Einsehbarkeit und Überschaubarkeit von Eingängen, Fluren, Parkplätzen und<br />
Tiefgaragen, Spielplätzen, Gemeinschaftseinrichtungen und Wegen; Gruppierung<br />
baulicher Anlagen so zueinander, dass Eingangsbereiche und Umfeld<br />
von den (Küchen-/Wohnzimmer-) Fenstern anderer Gebäude aus bzw. von<br />
der Straße aus einsehbar sind; Vermeidung verdeckter Zugänge, toter Winkel<br />
und Ecken sowie unüberschaubarer Durchgänge; notfalls Kameraüberwachung;<br />
auch im Kellerbereich kleine, überschaubare Einheiten mit wenigen,<br />
nicht einsehbaren (keine Lattenverschläge) Keller- und Abstellräumen; im Außenbereich<br />
keine Sichtbehinderung bzw. Versteckmöglichkeiten durch Büsche<br />
usw.<br />
‣ ausreichende Beleuchtung im Gebäude (ggf. Dauerbeleuchtung) und im Umfeld<br />
(Dämmerschalter)<br />
‣ ansprechende, wohnliche Gestaltung des Eingangsbereichs („Foyer“); <strong>vom</strong><br />
Hausmeisterzimmer aus einsehbarer Postraum mit großen Briefkästen zur Ablage<br />
von Paketen, Einkaufs- und Schultaschen; übersichtliches Klingeltableau<br />
(mit Symbolen für Kinder); Fahrstuhl mit niedrig angebrachten Knöpfen (mit<br />
Symbolen für Kinder)<br />
‣ im öffentlichen, halböffentlichen und halbprivaten Bereich Verwendung widerstandsfähiger,<br />
aber dennoch ansprechender Materialien<br />
Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
Bi, 15.07.2003 11:05<br />
- 9 -
P:\Projekte_Beratung\Saarl_Erfaustausch_Soz<strong>Stadt</strong>_3255\Praesentation\Veranstaltungen\<strong>Regionalkonferenz</strong>en_Themenworks<br />
hops_Exkursionen_ <strong>Stadt</strong>teilmanagerforen\2002-2003\<strong>26</strong>0603_Regional\Dokumentation\Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
‣ Verwendung einbruchshemmender Materialien und sonstige Maßnahmen der<br />
technischen Prävention<br />
‣ laufende Instandhaltung und Pflege von Anlagen und Einrichtungen; sofortige<br />
Reparatur von Beschädigungen, sofortige Beseitigung von Beschmutzungen,<br />
Schmierereien usw.<br />
2.3 Sicherheitsgefühl<br />
Selbst wenn sich die Wirkung solcher Maßnahmen hinsichtlich einer Reduzierung<br />
von Straftaten letztlich kaum messen lässt, dürften sie für das subjektive Sicherheitsgefühl<br />
der Bürgerinnen und Bürger von erheblicher Bedeutung sein. Öffentliche<br />
Sicherheit zählt zu den Grundbedürfnissen und ist für das Wohlbefinden der Bürgerinnen<br />
und Bürger von großer Bedeutung. Ausschlaggebend ist dabei nicht allein die<br />
faktische Kriminalitätsbelastung <strong>–</strong> als objektives Risiko, Opfer eines Verbrechens zu<br />
werden, sondern vor allem auch das subjektive Sicherheitsempfinden.<br />
Die „gefühlte Sicherheit“ unter der Bewohnerschaft spielt daher zunehmend als Kriterium<br />
eine Rolle, an dem sich politische Programme und praktische Maßnahmen auf<br />
der kommunalen Ebene <strong>–</strong> etwa die Gestaltung öffentlicher Erneuerung einer Siedlung<br />
<strong>–</strong> orientieren. In die subjektive Wahrnehmung und Bewertung der öffentlichen<br />
Sicherheit gehen als Faktoren mit ein: die persönliche Betroffenheit, die Berichterstattung<br />
der Medien über Ereignisse in der städtischen Öffentlichkeit, Unterschiede in<br />
den Sicherheitsansprüchen verschiedener Bevölkerungsgruppen und im Toleranzniveau<br />
gegenüber abweichendem Verhalten sowie Unterschiede in der Ängstlichkeit<br />
und im Selbstvertrauen, sich selbst schützen und Risiken vorbeugen zu können.<br />
Umfragen zeigen, wie die öffentliche Sicherheit in der Bevölkerung subjektiv wahrgenommen<br />
und bewertet wird. Sie genießt in den Augen der Bürger eine hohe Priorität.<br />
In Westdeutschland steht der Schutz vor Kriminalität an vierter Stelle in der<br />
Rangfolge der Wichtigkeit von Lebensbereichen, noch vor der Arbeit und dem Einkommen.<br />
58% der Westdeutschen betrachten den Schutz vor Kriminalität als „sehr<br />
wichtig“. Zugleich ist die Zufriedenheit mit der öffentlichen Sicherheit nicht stark ausgeprägt.<br />
In Westdeutschland belegt die öffentliche Sicherheit in der Rangfolge der<br />
Zufriedenheiten mit einzelnen Lebensbereichen den drittletzten Platz. Die geringe<br />
Zufriedenheit mit der öffentlichen Sicherheit bringt zum Ausdruck, wie die aktuelle<br />
Situation vor dem Hintergrund individueller Ansprüche und Wertorientieren beurteilt<br />
wird.<br />
Ein anderer Indikator bildet die Erwartung ab, persönlich Opfer kriminellen Verhaltens<br />
zu werden („Viktimisierungserwartung“). Unter der westdeutschen Bevölkerung hielten<br />
rund 44% für sehr wahrscheinlich oder für wahrscheinlich, dass sie innerhalb der<br />
nächsten Monate angepöbelt oder bedroht, bestohlen, geschlagen oder verletzt, ü-<br />
berfallen, beraubt oder Opfer eines Einbruchs werden.<br />
Subjektiv empfundene Unsicherheit bezieht sich häufig auf das unmittelbare Lebensumfeld.<br />
In einer aktuellen repräsentativen Umfrage erklärten fast ein Viertel der<br />
Befragten, dass sie sich nachts auf den Straßen der eigenen Wohngegend nicht sicher<br />
fühlen. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass den Bürgerinnen und<br />
Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
Bi, 15.07.2003 11:05<br />
- 10 -
P:\Projekte_Beratung\Saarl_Erfaustausch_Soz<strong>Stadt</strong>_3255\Praesentation\Veranstaltungen\<strong>Regionalkonferenz</strong>en_Themenworks<br />
hops_Exkursionen_ <strong>Stadt</strong>teilmanagerforen\2002-2003\<strong>26</strong>0603_Regional\Dokumentation\Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
Bürgern vor allem das tägliche Erleben von Verwahrlosung, Vandalismus und Zerstörung<br />
in ihrem Wohnquartier Angst macht.<br />
Betroffene Gruppen und Orte<br />
Das Sicherheitsempfinden ist bei einzelnen Bevölkerungsgruppen unterschiedlich<br />
ausgeprägt. Frauen ist im Allgemeinen der Schutz vor Kriminalität wichtiger als Männern<br />
und älteren Menschen wichtiger als Jüngeren. Auch die Angst, Opfer kriminellen<br />
Verhaltens zu werden, ist bei Frauen höher als bei Männern. Und oft fühlen sich die<br />
unteren und oberen Altersgruppen stärker bedroht als die mittleren. Ältere Menschen<br />
schätzen sich z. B. als besonders verletzlich und wenig wehrhaft ein und Frauen haben<br />
eine ausgeprägte Angst vor der Traumatisierung durch Sexualdelikte.<br />
Deutliche Unterschiede zeigen sich auch auf der Ebene der Siedlungsstruktur: In den<br />
alten Bundesländern findet sich ein eindeutiger Zusammenhang mit der Gemeindegröße,<br />
weil die Empfindung von Unsicherheit mit zunehmender Größe des<br />
Wohnorts wächst. In der Regel wird die Wahrscheinlichkeit, Opfer zu werden, in kleineren<br />
Gemeinden geringer eingeschätzt als in Städten. Vor allem in Großstädten<br />
leben ein Viertel bis ein Drittel der Einwohnerschaft mit dieser Furcht. Die Verschiedenartigkeit<br />
der Bevölkerungsgruppen in der Nachbarschaft führt in den Städten zu<br />
Konflikten und zu einem geringeren sozialen Zusammenhalt. Besonders betroffen<br />
sind bestimmte Wohnformen: Denn Mieter in größeren Mietwohnanlagen sehen es<br />
als überdurchschnittlich wahrscheinlich an, z. B. Opfer von Körperverletzungsdelikten,<br />
Raubüberfällen und Diebstählen zu werden. Aus nahezu allen Untersuchungen<br />
zur Kriminalitätsfurcht aus den letzten Jahren wissen wir, dass das Sicherheitsgefühl<br />
der Bevölkerung zu einem guten Teil auch an solchen Aspekten anknüpft.<br />
Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Erfahrungsberichten über konkrete Maßnahmen<br />
zur Beseitigung von „Angst-Räumen“ und zur Steigerung des Sicherheitsgefühls<br />
der Bevölkerung, insbesondere aber von Frauen in der Öffentlichkeit. Versucht<br />
man die Indikatoren für die dort angegebenen „Angst-Räume“ zu verallgemeinern,<br />
so konzentrieren sie sich im Wesentlichen auf die Wahrnehmung<br />
‣ von Zuständen sozialer Unordnung („incivilities“ i.S. der „broken windows-<br />
Theorie)<br />
‣ des Fehlens situativer formeller, insbesondere aber informeller sozialer Kontrolle<br />
‣ des Fehlens von Alternativen und Wahlmöglichkeiten zur örtlichen Zielerreichung<br />
(z. B. bei Unterführungen, Wegen in Parkanlagen usw.)<br />
‣ mangelnder Überschaubarkeit und Übersichtlichkeit sowie<br />
‣ mangelhafter Beleuchtung<br />
Sensibilität für solche Gegebenheiten und deren Beseitigung im Rahmen der <strong>Stadt</strong>planung<br />
und der Gestaltung des öffentlichen Raumes können sicher nicht die Ursachen<br />
von Kriminalität beseitigen, sie können aber Gelegenheitsstrukturen reduzieren,<br />
indem sie dazu beitragen, dass Menschen sich aufeinander beziehen, das Empfindungen<br />
von Zugehörigkeit und Geborgenheit vermittelt und so der Kriminalität Hindernisse<br />
entgegengesetzt werden. Ganz unabhängig von der objektiven Gefährdungslage<br />
kann auf diese Weise aber vor allem Kriminalitätsfurcht verringert und das<br />
subjektive Sicherheitsgefühl erhöht werden.<br />
Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
Bi, 15.07.2003 11:05<br />
- 11 -
P:\Projekte_Beratung\Saarl_Erfaustausch_Soz<strong>Stadt</strong>_3255\Praesentation\Veranstaltungen\<strong>Regionalkonferenz</strong>en_Themenworks<br />
hops_Exkursionen_ <strong>Stadt</strong>teilmanagerforen\2002-2003\<strong>26</strong>0603_Regional\Dokumentation\Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
2.4 Was kann der Beitrag der Städte und Gemeinden zur Prävention sein<br />
Zusammenfassung der wesentlichen Gedanken<br />
‣ Es besteht eine vorrangige staatliche Verantwortung für die Kriminalitätsbekämpfung.<br />
In den Städten und Gemeinden ist sie aber auch eine kommunale<br />
Aufgabe, da die Sicherheit für die Lebensqualität der Einwohnerschaft und die<br />
Standortfrage der Wirtschaft wichtig ist.<br />
‣ Im repressiven Bereich können die Städte und Gemeinden lediglich in dem<br />
eng gesteckten Rahmen ihrer Aufgabe als Ordnungsbehörde tätig werden.<br />
‣ Im Bereich der Kriminalprävention kann auf der örtlichen Ebene ein nicht unerhebliches<br />
Potenzial aktiviert werden. Dazu ist es notwendig, die Einwohner,<br />
die gesellschaftlichen Gruppen und die staatlichen Organe in ihren Bemühungen<br />
zu bündeln. Dabei sollten die Städte und Gemeinden eine Moderatorenfunktion<br />
einnehmen. Eine gute Möglichkeit sind kommunale Präventionsräte.<br />
In Deutschland haben sich verschiedene Formen der Zusammenarbeit entwickelt,<br />
um mehr Sicherheit und Ordnung in den Städten und Gemeinden und damit mehr<br />
Lebensqualität für die Menschen zu schaffen. Begriffe wie Runde Tische, Kriminalpräventive<br />
Räte, Sicherheitspartnerschaften, Sicherheitsnetzwerke oder Ordnungspartnerschaften<br />
umschreiben die Vielfalt der möglichen Kooperationsformen. Im<br />
Saarland sind es 17 kriminalpräventive Gremien, die verschiedene Ansätze und Projekte<br />
zur Vorbeugung von Kriminalität auf kommunaler Ebene koordinieren, neue<br />
Projekte anregen und für einen kontinuierlichen Informationsaustausch sorgen. Die<br />
Polizei unterstützt die Gründung von örtlichen und regionalen Präventionsräten.<br />
Der Schlüssel liegt im netzwerkartigen Zusammenwirken von lokalen Akteuren. Auf<br />
freiwilliger Basis werden alle relevanten staatlichen und gesellschaftlichen Kräfte einbezogen;<br />
angesprochen sind: Bürgerinnen und Bürger, Kommunalpolitikerinnen und<br />
Kommunalpolitiker, städtische Ämter, die Oberstaatsanwaltschaft, die Polizei, die<br />
Gleichstellungsbeauftragte, der Ausländerbeirat, das Ausländerreferat, der <strong>Stadt</strong>jugendring,<br />
die Wohnungswirtschaft, Gemeinschaften des Handels, Handwerksunternehmen,<br />
Gewerbetreibende, Verkehrsunternehmen, Kirchengemeinden,<br />
Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Schülervertretungen und Arbeitsgemeinschaften<br />
der örtlichen Vereine. Ein wichtiger Kooperationspartner sind die Wohnungsunternehmen,<br />
damit vermehrt auch Projekte zur Erhöhung der Sicherheit in<br />
Wohnquartieren durchgeführt werden können.<br />
Sicherheit ist eine kommunalpolitische Querschnittsaufgabe. Unterschiedliche Politikfelder<br />
und Aufgaben der Verwaltung müssen verknüpft werden. Dies macht die<br />
kommunale Kriminalprävention zur „Chefsache“.<br />
Kriminalprävention kostet Geld. Die Kostenfrage darf aber nicht dazu führen, dass<br />
die Städte und Gemeinden trotz des bestehenden Bedarfs untätig bleiben.<br />
3. Schlussbetrachtung<br />
Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
Bi, 15.07.2003 11:05<br />
- 12 -
P:\Projekte_Beratung\Saarl_Erfaustausch_Soz<strong>Stadt</strong>_3255\Praesentation\Veranstaltungen\<strong>Regionalkonferenz</strong>en_Themenworks<br />
hops_Exkursionen_ <strong>Stadt</strong>teilmanagerforen\2002-2003\<strong>26</strong>0603_Regional\Dokumentation\Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
Die hier beispielhaft aufgeführten kriminalpräventiven Gesichtspunkte werden oftmals<br />
im Widerstreit untereinander und mit anderen Aspekten stehen: Vielen Überlegungen<br />
werden wirtschaftliche Erwägungen entgegenstehen, Abenteuerzonen ohne informelle<br />
Kontrolle können mit dem Sicherheitsgefühl der Anwohner kollidieren, die Überschaubarkeit<br />
der Außenanlagen kann dem Bedürfnis nach Geborgenheit und Intimität<br />
bei der Freizeitgestaltung im häuslichen Garten widersprechen, aus Gründen der<br />
Verkehrssicherheit notwendige Unterführungen können gleichzeitig Angsträume darstellen,<br />
usw..<br />
Hinzu kommt, dass <strong>–</strong> wie so häufig in der Kriminologie und in den Sozialwissenschaften<br />
(und nicht nur dort!) <strong>–</strong> vielfach der empirische Nachweis für die Bedeutsamkeit<br />
der verschiedenen Faktoren letztlich fehlt. Dennoch spricht eine hohe Plausibilität<br />
für ihre Relevanz. Dies muss zunächst genügen, da wir es uns hier wie in anderen<br />
Bereichen nicht leisten können, mit Maßnahmen erst dann zu beginnen, wenn der<br />
letzte wissenschaftliche Nachweis geführt worden ist. Hier gilt es, auch aus polizeilicher<br />
Sicht, Erfahrungen zu sammeln und diese auszutauschen, um so letztlich<br />
einen Erkenntnisgewinn zu erzielen.<br />
Die hier dargelegten Faktoren mögen insoweit Anhaltspunkte für eigene Überlegungen<br />
und konkrete Vorschläge geben, die stets in Kenntnis der örtlichen Kriminalitätslage<br />
(über die nur die Polizei verfügt!) an den Gegebenheiten vor Ort zu entwickeln<br />
sind und keinesfalls allgemeingültig etwa in Form eines „Merkblattes für <strong>Stadt</strong>planer<br />
und Architekten“ festgeschrieben werden können.<br />
Es muss ein zentrales Anliegen der Polizei sein, nicht erst dann gerufen zu werden<br />
und in Aktion zu treten, wenn örtliche Kriminalitätsherde entstanden sind (also „das<br />
Kind schon in den Brunnen gefallen ist“), sondern bereits im Rahmen von <strong>Stadt</strong>- und<br />
Bauplanung entsprechende Sachkunde einzubringen und auf kriminalpräventive und<br />
sicherheitsrelevante Gesichtspunkte aufmerksam zu machen. Dies muss ebenso<br />
Standard werden wie die Einbeziehung der Polizei im Rahmen der Verkehrsplanung<br />
oder die Berücksichtigung feuerpolizeilicher Vorgaben. Gerade in Zeiten „Kommunaler<br />
Kriminalprävention“ muss die Polizei auch in dieser Richtung Anstöße geben,<br />
und wenn sie dabei nicht als „Oberstadtplaner“ auftritt, sondern sich mit ihren Vorschlägen<br />
und Anregungen auf ihr Fachgebiet konzentriert, hat sie auch gute Chancen,<br />
Gehör und Akzeptanz zu finden.<br />
(Quelle: Fachhochschule Villingen-Schwenningen <strong>–</strong> Hochschule für Polizei)<br />
6. Herr Dr. Karsten Schreiber: Vorstellung des Projektgebietes<br />
Spiesen<br />
Herr Dr. Schreiber stellt das Projekgebiet in Spiesen vor. Die <strong>Soziale</strong> <strong>Stadt</strong> Maßnahmen<br />
sind in der Dokumentation Nr. 4 "Zwischenbilanzkonferenz am 20.11.02 in<br />
St. Ingbert - Berichte aus den Gemeinden" nachzulesen.<br />
7. Vorstellung der Baumaßnahme Festplatz und Rundgang<br />
Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
Bi, 15.07.2003 11:05<br />
- 13 -
P:\Projekte_Beratung\Saarl_Erfaustausch_Soz<strong>Stadt</strong>_3255\Praesentation\Veranstaltungen\<strong>Regionalkonferenz</strong>en_Themenworks<br />
hops_Exkursionen_ <strong>Stadt</strong>teilmanagerforen\2002-2003\<strong>26</strong>0603_Regional\Dokumentation\Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
Herr Dipl.-Ing. Reinheimer stellt die Baumaßnahme Festplatz vor. Alle Anwesenden<br />
begeben sich auf einen Rundgang über das Gelände der Maßnahme. (siehe o. g.<br />
Dokumentation).<br />
Saarbrücken, den 14. Juli 2003<br />
gez. Christoph Vogt<br />
Vermerk_<strong>26</strong>0603.doc<br />
Bi, 15.07.2003 11:05<br />
- 14 -