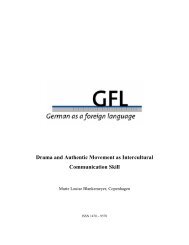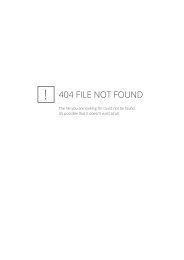Wandel deutsch-türkischer Konstellationen im ... - GFL-Journal
Wandel deutsch-türkischer Konstellationen im ... - GFL-Journal
Wandel deutsch-türkischer Konstellationen im ... - GFL-Journal
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Wandel</strong> <strong>deutsch</strong>-<strong>türkischer</strong> <strong>Konstellationen</strong> <strong>im</strong> filmischen Migrationsdiskurs<br />
Augenschein nehmen und zurückweisen. Anstatt Kommunikationsversuche zu<br />
unternehmen, weist man Turna mit der Begründung zurück, man sei zu alt, könne sie<br />
nicht verstehen und wohne auch erst seit kurzem <strong>im</strong> Haus. Die Ausreden machen klar,<br />
dass die türkische Frau als störend, vielleicht auch als bedrohlich wahrgenommen wird.<br />
Zwar fehlt es hier offensichtlich an Interaktionsvoraussetzungen auf beiden Seiten<br />
(Sprache, kulturelle Kenntnisse etc.), allerdings werden insbesondere die Deutschen in<br />
einer verweigernden Haltung präsentiert. Eine Ausnahme bildet ein <strong>deutsch</strong>es Mädchen,<br />
das regelmäßig in Turnas Wohnung herüberschaut. Es führt seine Puppe vor und<br />
verständigt sich mit Turna durch M<strong>im</strong>ik und Gesten über die anderen Nachbarn. Im<br />
Zuge der Kommunikation mit Händen und Füßen lernt Turna z.B. die Bedeutung des<br />
an-den-Kopf-Tippens, was einem interkulturellen Lernprozess gleichkommt<br />
(00:44:00). 10 Schließlich unterbindet die Mutter des Mädchens die Kommunikation.<br />
Das/Die Fremde wird <strong>im</strong> Film so nicht nur räumlich, sondern auch durch das ihm/ihr<br />
aufgezwungene Fremdbild metaphorisch eingehegt. Dieses dient vor allem dazu, die<br />
Vorzüge einer Integration in das <strong>deutsch</strong>e Wert- und Normensystem zu unterstreichen.<br />
Diese betreffen insbesondere die Befreiung der ausländischen Frau aus ihrer kulturell<br />
gedeuteten Gefangenschaft (vgl. Halft 2010).<br />
Der emanzipatorische Anspruch wird jedoch durch eine darunterliegende ideologische<br />
Prägung relativiert, die vor allem in Abschied vom falschen Paradies (Başer, BRD<br />
1988/1989) offenbar wird: Der Film erzwingt eine interkulturelle Begegnungssituation<br />
dadurch, dass die Hauptfigur Elif sich an die Umstände <strong>im</strong> <strong>deutsch</strong>en Frauengefängnis<br />
anpassen muss. Der Film konzentriert sich dabei vor allem auf ihren sprachlichen<br />
Lernprozess, dem ihre Akkulturation folgt (00:31:10): Am Ende ist sie von der<br />
zerrütteten türkischen Frau zu einer <strong>deutsch</strong>en Dame geworden und hat sich von ihrer<br />
türkischen Familie emanzipiert (00:49:00). Das Frauengefängnis wird hier zum Idyll<br />
(Paradies) stilisiert, in dem weibliche Solidarität, Verständnis und Hilfsbereitschaft<br />
unter den Insassinnen bestehen. Voraussetzung hierfür und für die weitere Interaktion<br />
ist allerdings der Wille, sich (hier sprachlich und habituell) ins Kollektiv zu integrieren.<br />
Der Film hält sich nicht damit auf, zwei divergierende Kulturen aufeinandertreffen zu<br />
lassen und Aushandlungsprozesse zu inszenieren. Das ‚Paradies„ ist eben gerade keine<br />
Kontaktzone, sondern der Ort, an dem Elif ihre kulturelle Identität weitestgehend<br />
10 Einerseits birgt die vorurteilsfreie Wahrnehmung des Mädchens großes Potenzial für die<br />
interkulturelle Verständigung. Andererseits jedoch ist die metaphorische Infantilisierung<br />
Turnas ein Klischee interkultureller Kommunikation.<br />
� gfl-journal, No. 3/2010<br />
11