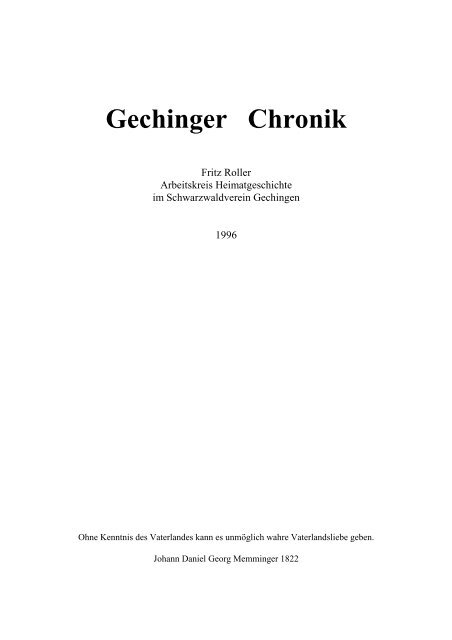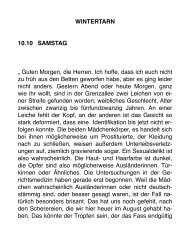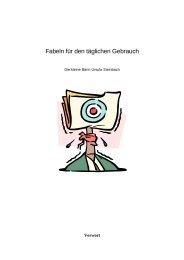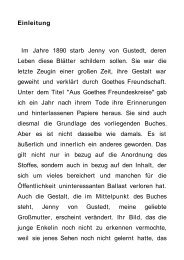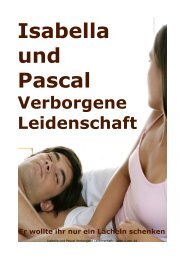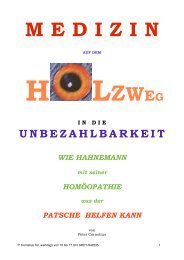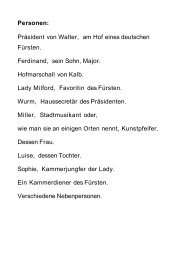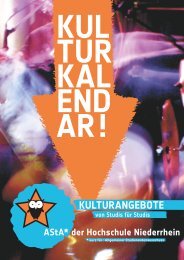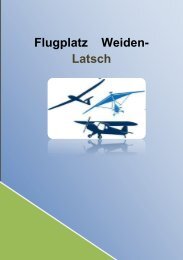Gechinger Chronik - BookRix
Gechinger Chronik - BookRix
Gechinger Chronik - BookRix
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Gechinger</strong> <strong>Chronik</strong><br />
Fritz Roller<br />
Arbeitskreis Heimatgeschichte<br />
im Schwarzwaldverein Gechingen<br />
1996<br />
Ohne Kenntnis des Vaterlandes kann es unmöglich wahre Vaterlandsliebe geben.<br />
Johann Daniel Georg Memminger 1822
2<br />
Liebe <strong>Gechinger</strong>innen und <strong>Gechinger</strong>,<br />
oft haben wir den Eindruck, daß unsere Zeit<br />
schnelllebiger ist. Begriffe wie Gentechnik,<br />
Hochgeschwindigkeitszug,Multimedia,<br />
elektronische Post und Internet sprechen für<br />
sich.<br />
Paßt da eine Heimatchronik überhaupt in die<br />
Landschaft?<br />
Sie paßt nicht nur, sondern wir brauchen sie<br />
notwendig. Wir dürfen zwar an der<br />
Vergangenheit nicht hängen bleiben, können<br />
jedoch aus ihr für Gegenwart und Zukunft<br />
lernen und wichtige Schlüsse daraus ziehen.<br />
Die Entwicklung von früher hilft manches<br />
von der Gegenwart besser zu verstehen. In<br />
der Zeit des allgemeinen Wohlstandes soll<br />
dieses Buch der Heimatgemeinde in ihrer<br />
langen Geschichte zeigen, daß es nicht nur<br />
gute Zeiten gegeben hat, sondern schon<br />
manches Schwere über unseren Ort<br />
hereingebrochen ist. Vielleicht ist gerade der<br />
Hinweis auf die wechsel eitigen Zeit-<br />
geschehnisse ein wirksames Mittel zur<br />
Besonnenheit und Dankbarkeit in dem seit<br />
Jahren schon bestehenden, gut fundierten<br />
Wirtschaftsleben unseres Landes.<br />
Das Werk von Fritz Roller, die neue „Heimatchronik“, ist ein bleibender „Segen“ für unsere Gemeinde.<br />
In jahrelanger Arbeit hat er das bekannte Heimatbuch des früheren Lehrers und geschätzten<br />
Heimatforschers Karl Friedrich Eßig ergänzt und darüber hinaus alle bedeutenden Ereignisse von<br />
1936 bis heute dargestellt. Das vorliegende Buch, verfaßt von einem <strong>Gechinger</strong> Bürger, dem die<br />
Geschichte unserer Gemeinde außerordentlich Wstark am Herzen liegt, hat in meinen Augen einen<br />
viel höheren Stellenwert als eine <strong>Chronik</strong>, die von einem auswärtigen „Wissenschaftler“ formuliert<br />
wurde.<br />
Nach der Eröffnung unseres Heimatmuseums im Juli 1995 ist die Herausgabe der <strong>Gechinger</strong> <strong>Chronik</strong><br />
wieder ein bedeutendes Ereignis für unsere Gemeinde.<br />
Im Namen der gesamten Bevölkerung, den zukünftigen Generationen und auch ganz persönlich danke<br />
ich Fritz Roller sehr herzlich für dieses mit viel Sorgfalt, Fleiß und Liebe zu seinem Heimatort<br />
vorgelegte Werk. Mein Dank gilt auch der Lektorin Erika Albert-Essig, die das gesamte Werk kritisch<br />
durchgesehen hat, Altbürgermeister Rainer Dannemann, Altbürgermeister Otto Weiß und allen, die die<br />
Herausgabe dieses Buches in irgendeiner Art und Weise unterstützt haben.<br />
Ich denke, daß diese <strong>Gechinger</strong> <strong>Chronik</strong> bei der Bevölkerung gut ankommt und sowohl gegenwärtig<br />
als auch zukünftig dazu beiträgt, die Identität mit unserer attraktiven Gemeinde zu stärken.<br />
Jens Häußler<br />
Bürgermeister
Zum Buch<br />
Geboren wurde ich am 7.10.1922 in Stuttgart<br />
und besuchte dort die Schule. Die Stuttgar-<br />
ter Museen waren meine beliebten<br />
Aufenthaltsorte. Nach meiner Lehrzeit wurde<br />
ich zur Wehrmacht eingezogen und kam<br />
1945 in russische Gefangenschaft.<br />
Dort arbeitete ich im Wald, im Steinbruch<br />
und als Flösser auf der Wolga. Nach meiner<br />
Entlassung 1949 heiratete ich Hedwig Weiß<br />
von Gechingen. 1958 zogen wir dann in die<br />
Metzgergasse. Von da an war ich an der<br />
<strong>Gechinger</strong> Geschichte interessiert und<br />
begann, alte Gegenstände und Bilder zu<br />
sammeln. Seit meiner Pensionierung<br />
widmete ich mich ganz der Heimat-<br />
geschichte und zeigte das Ergebnis in<br />
verschiedenenAusstellungen. 1983<br />
begannen die Arbeiten an diesem Buch.<br />
Die vorliegende "Heimatchronik" soll keine Wiederholung des l963 erschienenen Heimatbuches von<br />
Karl Friedrich Essig sein. Diese fleißige und mühevolle Arbeit ist während vielen Jahren entstanden<br />
und eine einmalige Leistung. Sie bricht aber mit dem Wegzug von Herrn Essig l937 ab.<br />
Altbürgermeister Otto Weiß hat das alte Heimatbuch mit einem Nachtrag über die Zeit von l939 bis<br />
l962 ergänzt.<br />
Mit dieser "Heimatchronik" sollen neue Wissensgebiete der <strong>Gechinger</strong> Geschichte erschlossen und<br />
öffentlich gemacht werden. Sie enthält Streiflichter aus vergangenen Jahrhunderten, eine Darstellung<br />
der neuesten vor- und frühgeschichtlichen Forschungsergebnisse und Wissenswertes aus<br />
Vergangenheit und Gegenwart des kulturellen, kirchlichen und wirtschaftlichen Lebens.<br />
Die Jahre zwischen l930 und l990 werden besonders ausführlich dargestellt. Sie sollen der jüngeren<br />
Generation und den Neubürgern nahegebracht werden. Ich habe meine Ausführungen mit Auszügen<br />
aus Arbeiten von Karl Friedrich Essig und stimmungsvollen Berichten von Tillie Jäger aufgelockert.<br />
Tillie Jäger soll damit eine, wenn auch späte, Ehrung erfahren.<br />
Mein Dank gilt all denen, die direkt oder indirekt an diesem Buch mitgearbeitet haben, sei es durch<br />
Materialsammlung oder Artikel in Vereinsveröffentlichungen oder sonstigen Publikationen.<br />
Vielen Dank an Herrn Bürgermeister Häußler, die ehemaligen Bürgermeister Dannemann und Weiß,<br />
meine Frau Hedwig, meine Tochter Waltraud Lachenmaier und allen Mitgliedern des Arbeitskreises,<br />
die mich in vielfältiger Weise tatkräftig unterstützt haben. Ein besonderer Dank an Frau Erika Albert-<br />
Essig, die als Lektorin ihr Wissen eingebracht und das gesamte Werk überarbeitet hat! Herzlichen<br />
Dank vor allem der Spenderin, die die Herausgabe des Buches erst ermöglichte!<br />
Fritz Roller<br />
3
Inhalt<br />
Einführung Seite 7<br />
Das Wappen Seite 7<br />
Aus der ältesten Zeit Gechingens Seite 8<br />
Geologische Verhältnisse Seite 8<br />
Die Eiszeit und die Steinzeitmenschen Seite 9<br />
Die Jungsteinzeit 8000 bis 2000 v.Chr. Seite 9<br />
Die Bronzezeit Seite 10<br />
Die Kelten und die vorrömische Eisenzeit Seite 11<br />
Gechingen in geschichtlicher Zeit Seite 14<br />
Die Römer Seite 14<br />
Die Alamannen und die Franken Seite 15<br />
Vom frühen Mittelalter bis zum Bauernkrieg Seite 17<br />
Württemberg Seite 20<br />
Im Dreißigjährigen Krieg Seite 21<br />
Nach dem 30jährigen Krieg bis zu Herzog Karl Eugen Seite 23<br />
Napoleonische Zeit bis 1806 Seite 26<br />
Königreich Württemberg Seite 27<br />
Von der Revolution 1848/49 bis 1870 Seite 29<br />
Der Krieg von 1870/71 und die Folgezeit Seite 33<br />
Vom Großen Brand bis zum Ausbruch des ersten Weltkriegs Seite 35<br />
Der erste Weltkrieg 1914-18 Seite 38<br />
Zwischen den Kriegen bis 1933 Seite 39<br />
Das Dritte Reich bis zum zweiten Weltkrieg Seite 40<br />
Der zweite Weltkrieg 1939-45 Seite 43<br />
Nachkriegszeit bis heute Seite 49<br />
Wirtschaftliche Entwicklung Seite 57<br />
Viehzucht Seite 57<br />
Ackerbau Seite 59<br />
Sonderkulturen (Faserpflanzen und Hopfen) Seite 61<br />
Wiesen und Weiden Seite 63<br />
Wein- und Obstbau Seite 64<br />
Der Wald Seite 66<br />
Straßenverhältnisse bis zum Beginn der Motorisierung Seite 69<br />
Gechingen und seine Bewohner Seite 70<br />
Bevölkerungsbewegungen Seite 70<br />
Bauern, Bäuerinnen und Bauernhäuser Seite 72<br />
Auswanderer Seite 77<br />
Berufe Seite 80<br />
Die Handwerker Seite 80<br />
Dienstleistungen Seite 86<br />
Gelegenheitsarbeiter und Angelernte Seite 89<br />
4
Gemeindebedienstete Seite 91<br />
Neue Entwicklungen, neue Bedürfnisse Seite 93<br />
Der Ortsbauernverband Seite 93<br />
Die Milchverwertungsgenossenschaft Seite 94<br />
Der Konsumverein Seite 95<br />
Die Gefriergemeinschaft Seite 95<br />
Die Feuerwehr Seite 96<br />
Der Kindergarten Seite 100<br />
Der Krankenpflegeverein Seite 100<br />
Die Krankenkasse Seite 100<br />
Die VDK Ortsgruppe Seite 101<br />
Der Krieger- und Veteranenverein Seite 101<br />
Die Wasserversorgung Seite 102<br />
Die Stromversorgung Seite 105<br />
Die Post Seite 106<br />
Das Postauto Seite 107<br />
Das Telefon Seite 108<br />
Die Spar- und Darlehnskasse Seite 108<br />
Die Kreissparkasse Seite 109<br />
Die Württembergische Landessparkasse Seite 109<br />
Kirche und Pfarrer Seite 109<br />
Geschichte Seite 109<br />
Die Kirchturmuhr Seite 116<br />
Die Glocken Seite 116<br />
Die Orgel Seite 119<br />
Die Rolle der Kirche im dörflichen Leben Seite 119<br />
Kirchenchor und Posaunenchor Seite 122<br />
Evangelisches Gemeindeblatt Seite 122<br />
Der Friedhof Seite 122<br />
Evangelisches Gemeindehaus Seite 123<br />
Das Pfarrhaus Seite 124<br />
Die Pfarrer Seite 125<br />
Die Mesner Seite 135<br />
Katholische Gemeinde Seite 136<br />
Adventgemeinde Seite 136<br />
Schule und Schulwesen Seite 136<br />
Die Lehrer Seite 140<br />
Die Rektoren Seite 142<br />
Rathaus, Gemeindeverwaltung und Schultheißen Seite 142<br />
Das Rathaus Seite 142<br />
Das Amt Seite 143<br />
Die Schultheißen Seite 145<br />
Die Bürgermeister Seite 150<br />
Kulturelle Entwicklungen durch Vereine und Gruppen Seite 151<br />
Der Liederkranz Seite 151<br />
Der Musikverein Seite 154<br />
5
Der Handharmonikaclub Seite 157<br />
Der Homöopathische Verein Seite 157<br />
Der Schwarzwaldverein Seite 157<br />
Die Volkshochschule Seite 157<br />
Die Sportfreunde Gechingen e.V. Seite 158<br />
Der Reit- und Fahrverein Seite 161<br />
Die Modellsportgruppe Seite 162<br />
Die DLRG Ortsgruppe Seite 162<br />
Die Tracht Seite 162<br />
Der Dialekt Seite 164<br />
Bauernregeln Seite 181<br />
Sprichwörter und Redensarten Seite 182<br />
Kinderreime und - Spiele Seite 183<br />
Aus Gechingen Seite 187<br />
Einzelne Persönlichkeiten Seite 187<br />
Anekdoten Seite 191<br />
Backen und Kochen Seite 201<br />
Eine Inventurliste Seite 202<br />
Anhang Seite 203<br />
Familiensiegel Seite 203<br />
Zeugnisse der Vergangenheit Seite 207<br />
Erstnennung von Gechingen Seite 207<br />
Weitere Urkunden und Inschriften Seite 208<br />
Steine und Gebäude Seite 209<br />
Der Schlossberg Seite 212<br />
Quellen Literaturverzeichnis Seite 213<br />
6
Einführung<br />
Gemeindebeschreibung<br />
Gechingen liegt im Hecken- und Schlehengäu im Tal der Irm, welche die Markung von West<br />
nach 0st durchfließt und diese in zwei ungefähr gleich große Abschnitte teilt. Der südliche<br />
Teil reicht bis ins obere Aischbachtal beim Haselstaller Hof. Die Markungsgrenze führt,<br />
beginnend im Nordwesten beim Stammheimer Eichwäldle, nach Osten über die Straße<br />
Gechingen/Althengstett nördlich des Kirchhaldenweges zur vorderen Achtgrube und dann an<br />
der südlichen Waldgrenze des Lochwaldes entlang über die Damshalde bis zum Hardt an der<br />
Dätzinger Markungsgrenze. Hier biegt sie nach Süden ab, verläuft in südwestlicher Richtung<br />
weiterführend über den Storrenberg und das Schnepfental bis an den Rand des Weilerwaldes.<br />
Ungefähr 800 m folgt sie dem Sträßchen, das von Dachtel nach Stammheim führt, talaufwärts,<br />
erreicht den gemeindeeigenen Weg (Vicinalweg) Gechingen/Gültlingen am Ende der Senke<br />
Irmental und umschließt, einen Sack nach Süden bildend, den Waldteil Grundhau. Vom<br />
Grundhau führt sie nun in Nordrichtung über den Burch und die Senke zwischen Gechingen<br />
und der Hohen Nille (Stammheimer Tal) zum Ausgangspunkt. Das Dorf Gechingen liegt 484<br />
m über NN. Die höchsten Punkte der Gemarkung mit je 570 m liegen im Masenwald und an<br />
der westlichen Markungsgrenze am Burch, der tiefste im Irmtal an der Deufringer<br />
Markungsgrenze mit 455 m. Im Norden grenzt die Markung an Ostelsheim, im Osten an<br />
Dätzingen und Deufringen, im Süden an Dachtel und Gültlingen und im Westen an<br />
Stammheim und Althengstett. Die Markungsgrenze gegen Dätzingen, Deufringen und Dachtel<br />
ist zugleich Kreisgrenze zum Kreis Böblingen. Die Grenzsteine wurden 1989-1993 vom<br />
Arbeitskreis Heimatgeschichte erfaßt und aufgelistet.<br />
Die klimatischen Verhältnisse der Gegenwart:<br />
Jahresniederschläge: 720 - 740 mm<br />
Jahresdurchschnittstemperatur: 7,4 - 7,8° C<br />
Durchschnittstemperatur in der Vegetationszeit Mai - Juli: 14,4° C.<br />
Datum des ersten Frostes: 16.10.<br />
Datum des letzten Frostes: 2.05. Frostfreie Tage: ca. 166<br />
In gewisser Weise hat das Dorf ländlichen Charakter bewahren können, wenn man darunter<br />
vor allem das soziale Gefüge versteht. Freilich wurde die Landwirtschaft längst völlig<br />
zurückgedrängt, Gechingen entwickelt sich immer mehr zur Wohngemeinde, auch kleinere<br />
gewerbliche Betriebe konnten sich ansiedeln.<br />
Die Bewohner Gechingens waren bis zum Ende des zweiten Weltkriegs überwiegend Bauern.<br />
Danach kamen erst Vertriebene aus den deutschen Ostgebieten dazu, dann städtische<br />
Zuwanderer. Auch Gastarbeiter wohnen in Gechingen; ihre Zahl ist rückläufig, ebenso die der<br />
Asylbewerber, die in Gechingen in den letzten Jahren untergebracht sind.<br />
Inzwischen haben sich Neu- und Altbürger aneinander gewöhnt, zumal sich auch für die Alt-<br />
<strong>Gechinger</strong> das Leben stark verändert hat. Heute kann man sagen, die Bewohner Gechingens<br />
"könnet´s mitanander" und sind sich vor allem über die Schönheit und Gemütlichkeit ihres<br />
Dorfes einig und über den Reiz der Landschaft, die es umgibt.<br />
Das Wappen<br />
Das <strong>Gechinger</strong> Wappen stellt in Gold auf blauem Dreiberg einen aufgerichteten Löwen dar,<br />
der in den Pranken einen blauen Abtsstab hält. Die Flagge der Gemeinde ist rot-gelb. Wappen<br />
und Flagge wurden der Gemeinde am 18.7.1955 verliehen. Löwe und Dreiberg sollen an die<br />
Herrschaft der Grafen von Calw erinnern, in deren Wappen sie enthalten sind, während der<br />
7
Abtsstab die Zugehörigkeit zum Kloster Herrenalb und zur späteren Klosterpflege Merklingen<br />
andeutet.<br />
Folgende drei Vorschläge standen 1955 zur Wahl:<br />
l. Das alte Fleckenzeichen von Gechingen war ein Pelikan, der seine Jungen mit dem eigenen<br />
Blut nährt. Dieses Motiv erscheint um 1780 als Siegel. Deshalb schlug 1927 die<br />
Archivdirektion in Stuttgart als Wappen vor: In blauem Schild in rotem Nest ein seine<br />
goldenen Jungen mit rotem Blute fütternder, goldener Pelikan; die Flagge gelb-blau.<br />
2. In dem oben genannten Wappen könnte noch ein liegender blauer Abtsstab enthalten sein.<br />
3. In Blau ein goldener Sparren, Ortsfarben gelb-blau.<br />
Alle drei Vorschläge wurden verworfen, obwohl das Pelikansiegel historisch beweisbar war.<br />
Aus der ältesten Zeit Gechingens<br />
Geologische Verhältnisse:<br />
In Gechingen liegen hauptsächlich zwei Schichten vor, der obere Muschelkalk und der<br />
mittlere Muschelkalk. Wie schon aus dem Namen zu schließen, war unser Gebiet - vor 180<br />
Millionen Jahren - einst Meeresgrund. Die landwirtschaftlich am besten nutzbaren Böden sind<br />
die des mittleren Muschelkalks, im wesentlichen auf einer Höhe zwischen 460 und 550 m,<br />
aber der obere Muschelkalk mit seinen wenig fruchtbaren, steinigen Böden gibt der<br />
Landschaft das Gepräge. Die Steinriegel entlang der Felder, aus mühevoll abgelesenen<br />
Steinen aufgeschichtet und mit den charakteristischen Sträuchern bewachsen, die "Wüsten" -<br />
Trockenwiesen mit reicher Flora und vereinzelten Kiefern und Wacholderbüschen, allenfalls<br />
als Schafweiden zu verwenden - sind typisch für das Hecken- und Schlehengäu.<br />
Auf unserer Markung nimmt der mittlere Muschelkalk einen ziemlich breiten Raum ein. Er<br />
kommt in den unteren Hanglagen des Irmentals, sowie in den Senken des Insentals, des<br />
Mönchgrunds, des Stammheimer Tals, des Irmentals und des Hülsentals vor. Die größte<br />
zusammenhängende Fläche liegt westlich des Dorfes, wo Stammheimer Tal und Irmental<br />
zusammenkommen. Ein Teil der Flächen des mittleren Muschelkalks am Hangfuß, wie<br />
südlich des Dorfes und nördlich der Straße Gechingen-Deufringen, sowie der Grund aller<br />
Senken, sind mit mehr oder weniger mächtigem Gehängeschutt, der teilweise dem oberen<br />
Muschelkalk entstammt, überlagert, zum Beispiel die Gewanne Erdreich und Weidenselden.<br />
Die Talsohle des Irmentals und der untere Teil des Irmentals, die Wolfswiesen, sind mit<br />
alluvialen (aus erdgeschichtlich jüngster Zeit stammenden) Aufschüttungen aufgefüllt. Aus<br />
der Kreidezeit stammende Schichten liegen schließlich den höchsten Erhebungen der<br />
Markung, wie im Masenwald, auf dem Dachteler Berg sowie der Höhe nordwestlich der<br />
Eisengrube auf.<br />
Staubwinde haben Lößlehm mitgeführt und im Windschatten der Berge abgelagert. Er kommt,<br />
auf kleiner Fläche, im oberen Irmental im Gewann Birklen und auf kleinen Stellen im<br />
Gewann Buchenäcker vor. Ein Teil der Böden in der vorderen Achtgrube, in den<br />
Schwertäckern und in den Buchenäckern zeigt Beimengungen von Lößlehm.<br />
Sehr eindrucksvoll ist das Mineralien- und Gesteinsvorkommen in der Sammlung von Viktor<br />
Gebauer dargestellt, auch Fossilien (Versteinerungen) sind darunter. Schon früher hatte man<br />
auf der Markung Fossilien von Muscheln gefunden; Mitglieder des Arbeitskreises konnten in<br />
jüngster Zeit aber noch weitere Versteinerungen auf <strong>Gechinger</strong> Markung entdecken. Es sind<br />
zum Beispiel Überreste von "Terebrateln", Meeresbewohnern, deren Gehäuse dem von<br />
Muscheln sehr ähnlich ist, doch sind die beiden Klappen verschieden groß. Ferner fand man<br />
rädchenartige Stielglieder des Trochiten "Encrinus", der zu den Seelilien gehört. Diese Tiere,<br />
den Seeigeln verwandt, sind mit einem Stiel aus vielen Plättchen (Trochiten) am Meeresgrund<br />
8
festgeheftet, der beim Tod des Tieres oft auseinanderfällt. In Gechingen deckt Trochitenkalk<br />
des oberen Muschelkalks die Markungsteile über 520 - 530 m NN. Auch Fossilien von<br />
Turmschnecken, die ebenfalls im Meer lebten, konnten geborgen werden sowie fossile<br />
Gehäuse von "Nautilus" und Ammoniten der Unterordnung "Ceratitina", frühe Verwandte der<br />
Tintenfische und Kraken. Dazu gehört auch der "Belemnit", dessen Gehäuse im Gegensatz zu<br />
dem von Nautilus- und Ammonitenarten nicht gewunden, sondern langgestreckt ist. Auch von<br />
ihm fand man Überreste, die aber aus längst abgetragenen Schichten der Kreidezeit stammen.<br />
Hinter der Dachtgrube stieß man auf versteinertes Holz.<br />
Die Eiszeit und die Steinzeitmenschen<br />
Durch Klimaverschlechterung war es vor etwa 1,5 Millionen Jahren in Europa zu großen<br />
Veränderungen gekommen (Eiszeit). Die Berge waren mit ewigem Schnee bedeckt und<br />
Gletscher erstreckten sich bis in die Täler und schoben Gesteinsschutt vor sich her. Zwischen<br />
den Kälteschüben gab es wärmere Abschnitte (Zwischeneiszeiten), in denen die Gletscher sich<br />
etwas zurückzogen. Aus dieser erdgeschichtlichen Periode stammen die ältesten Spuren<br />
menschlichen Lebens, die man in unserer Gegend gefunden hat. Die ersten Menschen, die als<br />
unsere unmittelbaren Vorfahren in Betracht kommen, sickerten vor ca. 35 000 Jahren in<br />
kleinen Grüppchen ein. Das handwerkliche und künstlerische Geschick dieser<br />
Steinzeitmenschen war schon gut entwickelt, es handelt sich bei ihnen keineswegs um<br />
Primitive. Von Geröllsteinen (Hornstein, Feuerstein) wurden in der Weise Stücke<br />
abgeschlagen, daß scharfkantige Splitter entstanden, die als Faustkeile, Pfeilspitzen, Messer,<br />
Schaber und Bohrer verwendet werden konnten. Weitere Bedarfsgüter stellten sie aus ihnen<br />
gut zugänglichen Materialien, wie Horn, Knochen und Holzstücken her. Man verstand sich<br />
auch darauf, scharfkantige Steinsplitter mit Birkenteer, der als Klebemasse diente, in Holz<br />
einzulassen, so wurden zum Beispiel gebrauchstüchtige Messer angefertigt. Auch Kunstwerke<br />
entstanden schon vor etwa 30 000 Jahren; in unserer näheren Umgebung fand man<br />
Elfenbeinfiguren in Höhlen der Schwäbischen Alb (Vogelherd, Geißenklösterle).<br />
Josef Strzempek aus Gechingen hat durch Funde von Steinwerkzeugen nachgewiesen, daß auf<br />
der <strong>Gechinger</strong> Markung schon sehr früh Menschen lebten. Das Wasser, das Klima und die<br />
geologischen Gegebenheiten unserer Landschaft bieten günstige Voraussetzungen für<br />
Sammler und Jäger, die wohl einst den <strong>Gechinger</strong> Raum in kleinen Horden durchstreiften. Die<br />
Spuren, die sie hinterlassen haben, erzählen uns einiges über diese frühzeitlichen Vorfahren.<br />
Sie folgten dem Wild, das ihnen Nahrung und Kleidung lieferte, lebten also als Nomaden.<br />
Josef Stzempek fand die meisten Werkzeuge im Insental, im Tal in Richtung Althengstett und<br />
im Tal westlich vom Eichwäldle. Alle drei Täler verlaufen etwa in Nord/Südrichtung. Sie<br />
bieten Schutz vor dem vorwiegend aus Westen kommenden Wind und waren ein günstiger<br />
Platz für einen Unterschlupf. Die zahlreichen Quellen um Gechingen wurden bestimmt von<br />
Großwildherden als Tränken aufgesucht, auch das Irmtal muß einst ein einziges Feuchtbiotop<br />
und daher ein ideales Jagdgebiet gewesen sein. Außerdem ist bekannt, daß ein etwa 100 km<br />
breiter Streifen im süddeutschen Raum während den Eiszeiten zwischen den nordischen und<br />
den alpinen Gletschern freiblieb. In unserer Landschaft kann man keinerlei Spuren von<br />
Gletschertätigkeit entdecken. So fanden hier die Menschen von damals einen geeigneten<br />
Lebensraum.<br />
Die Jungsteinzeit 8 000 bis 2 000 v. Chr.<br />
In der Jungsteinzeit war die Eiszeit langsam einem Klima gewichen, das wärmer war als<br />
heute. Gegen Ende der Jungsteinzeit herrschten gegenüber den Birken- und Kiefernwäldern<br />
9
am Ende der Eiszeit lichte Eichenmischwälder vor, die vorwiegend neben Eichen aus Linden<br />
und Haselsträuchern bestanden.<br />
Wenn man die Jungsteinzeit als Beginn der Grundstruktur der späteren Hochkulturen<br />
betrachtet, reichen ihre Anfänge bis ins 7. oder 8. Jahrtausend v. Chr. zurück. Im fruchtbaren<br />
Gebiet von Euphrat und Tigris vollzog sich um diese Zeit eine Entwicklung, die sich als die<br />
revolutionärste im Lauf der Menschheitsgeschichte erweisen sollte: Aus dem Wildgetreide<br />
wurden allmählich Kulturpflanzen herausgebildet, die Menschen lernten, planmäßig<br />
Nutzpflanzen anzubauen und durch Auswahl des Saatgutes den Ertrag zu verbessern. Aus<br />
wilden Schafen und Ziegen wurden nach und nach Haustiere. Die Bevölkerung konnte rasch<br />
zunehmen und die Siedlungsgebiete dehnten sich, dem vergrößerten Bedarf entsprechend,<br />
nach und nach aus.<br />
In unser Gebiet wanderten die ersten Bauern im 6. Jahrtausend vor Christus aus dem<br />
Donauraum ein. Sie brachten Kenntnisse vom Getreideanbau und anderer Kulturpflanzen mit,<br />
auch Haustiere kannten sie schon. Sie vermischten sich mit der Urbevölkerung, die ihre<br />
Lebensweise nach und nach übernahm. Der Ackerbau vor allem brachte grundlegende<br />
Veränderungen. Man konnte Vorräte anlegen und hatte Besitztümer, für die Jäger keine<br />
Verwendung gehabt hätten. Der Hausbau konnte sich entwickeln, denn nun war ein dauernder<br />
Wohnsitz von Vorteil. Im Lauf der Zeit bildeten sich größere Ansiedlungen und Dörfer. Die<br />
Menschen dieser Zeit verstanden sich auch bereits darauf, Tongefäße herzustellen, nach deren<br />
Verzierung man sie als Bandkeramiker bezeichnet. In neuester Zeit hat man durch Grabungen<br />
in Vaihingen - Ensingen und am Viesenhäuser Hof gute Einblicke in ihr Leben gewonnen, die<br />
sich auf die <strong>Gechinger</strong> Verhältnisse mit großer Sicherheit übertragen lassen, denn flache<br />
Südhänge in Frischwassernähe, wie sie bei uns vorkommen, wurden bevorzugt besiedelt. Dort<br />
wuchsen nur wenige Bäume, was Raum bot für Häuser und Äcker. Im oberen Gäu sind schon<br />
von 0skar Paret aus Dachtel Spuren jungsteinzeitlicher Ansiedlungen nachgewiesen worden.<br />
Man ernährte sich, wie durch Analysen des Inhalts von Vorrats- und Abfallgruben<br />
nachgewiesen, überwiegend von Kulturpflanzen, der Getreideanteil betrug zwischen 75 und<br />
100 %. Es handelt sich um die primitiven Spelzweizenarten Einkorn und Emmer, Gerste war<br />
von untergeordneter Bedeutung. Auch Unkrautsamen, wie die des Weißen Gänsefußes,<br />
wurden zum Verzehr gesammelt. Als weitere Kulturpflanzen gab es Lein, Erbsen, Linsen und<br />
Schlafmohn, bei letzterem wurden neben den fettreichen Samen auch schon die<br />
Arzneiwirkung geschätzt. Sammelpflanzen wie Nüsse, Beeren, Pilze und Holzäpfel, Wurzeln<br />
und Kräuter bereicherten den Speisezettel. Das Fleisch lieferten die Haustiere, Rinder,<br />
Schweine, Schafe und Ziegen, die das ganze Jahr über im Freien gehalten werden konnten, da<br />
das Klima im Vergleich zu heute milder war. Die Jagd auf Wildtiere spielte kaum mehr eine<br />
Rolle. Die bis 40 m langen, schmalen Häuser sind bei allen Bandkeramikern, von Ungarn bis<br />
in die Niederlande, einheitlich konstruiert. Dreierjoche mit tief in den Boden eingelassenen<br />
Pfosten trugen die Dächer. Die Wände waren aus jungen Bäumen und mit Flechtwerk und<br />
Lehm abgedichtet, der aus einer Grube an der Längsseite des Hauses stammte.<br />
Im Appeleshof ist ein Mahlstein aus dieser Zeit vorhanden.<br />
Die durchschnittliche Körpergröße der Frauen betrug, wie man aus Gräberfunden weiß, 1,55<br />
m, die der Männer 1,67 m. Die Lebenserwartung lag bei etwa 30 Jahren, aber sehr viele<br />
Frauen starben schon zwischen 20 und 25 Jahren, weil Schwangerschaft und Geburt ein hohes<br />
Risiko mit sich brachten.<br />
Die Bronzezeit<br />
Bereits zum Ende der Jungsteinzeit, als die Schnurkeramiker ihre schön verzierten Tongefäße<br />
schufen, wurde hin und wieder Kupfer zur Herstellung von Geräten verwendet. Aber erst im<br />
2. Jahrtausend v. Chr. konnte sich dieser neue Werkstoff, der bald mit Zinn zu Bronze legiert<br />
10
wurde, so weit durchsetzen, daß eine ganze Epoche nach dem neuen Metall genannt wurde:<br />
die Bronzezeit. Sie datiert von ca. 2000 - 750 v. Chr. Die Menschen lernten bald, was für<br />
Möglichkeiten dieser Werkstoff bot, sie entwickelten Gußtechniken zur Herstellung einer<br />
Fülle von Geräten und Schmuckstücken. Ab der Bronzezeit gliederte sich nachweislich die<br />
Gesellschaft in Handwerker und Bauern, die Metallverarbeitung erforderte spezielle<br />
Kenntnisse und Fertigkeiten. Die vorwiegende Wirtschaftsform blieb aber bäuerlich. Es gab<br />
schon eine gewisse soziale Hervorhebung einzelner, was sich durch einzelne, reich<br />
ausgestattete Gräber belegen läßt.<br />
Über Funde in Gechingen, die vermutlich aus der Bronzezeit stammen, berichtet Josef<br />
Strzempek: "Die in Gechingen gefundenen Kalksteinwerkzeuge, wie Grabhacke, Grabpickel,<br />
Reibschälchen und Steinhammer, stammen wahrscheinlich aus der Bronze- bzw. Eisenzeit.<br />
Als sich Metallgeräte durchsetzten, geriet die feine Bearbeitung von Hornstein, Knochen und<br />
Geweih in Vergessenheit. Da aber die Metalle selten und teuer waren, stellte man einfache<br />
Geräte, vor allem für die Bodenbearbeitung, in grob zugehauenen Formen aus Kalkstein her.<br />
Fundorte waren das vordere Insental und die Kirchhalde."<br />
Es erforderte große körperliche Kraft, mit diesen Geräten den Acker zu bestellen. Das war und<br />
blieb daher Männerarbeit. In der späten Bronzezeit verdrängte allmählich der Dinkel Einkorn<br />
und Emmer.<br />
Die Kelten und die vorrömische Eisenzeit<br />
Im 8. vorchristlichen Jahrhundert ging die späte Bronzezeit nach und nach in die frühe<br />
Eisenzeit über. Als etwa um 800 v. Chr. das Klima feuchter und kälter wurde, drangen<br />
allmählich die Kelten bei uns ein. Das Wort bedeutet die Tapferen oder die Erhabenen.<br />
Süddeutschland wurde zu einem Zentrum keltischer Besiedlung. Um die Zeit von Christi<br />
Geburt gerieten die meisten keltischen Gebiete unter römischen oder germanischen Einfluß.<br />
Die Kelten waren ein überwiegend bäuerliches, handwerklich sehr begabtes Volk. Durch sie<br />
kam zum Beispiel die Töpferscheibe zu uns. Sie siedelten in Einzelgehöften. Von den Kelten<br />
wurde die Viehzucht bevorzugt, der Ackerbau stand nicht so hoch im Ansehen. Sie ließen sich<br />
daher bevorzugt in Gegenden nieder, in denen ihr Vieh Weide fand, wie bei uns, aber auch auf<br />
der Alb. Die Kelten waren in der Bearbeitung des Eisens der früheren Bevölkerung gegenüber<br />
weit überlegen und setzten sich wohl auch deswegen durch. Eisenerz ist zwar leichter zu<br />
gewinnen und häufiger als Kupfer oder Zinn, jedoch mußte das Eisen geschmiedet werden,<br />
Gußeisen war nicht bekannt. Sehr früh, bereits im 9. Jh. vor Chr., begannen die Kelten<br />
Werkzeuge (Sensen, Sicheln, Pflüge usw.) und Waffen zu schmieden. Schmuck und kleinere<br />
Gegenstände fertigten sie aus Bronze. Auch Silber und Gold wurden verarbeitet. Ab dem<br />
ersten vorchristlichen Jahrhundert stellten die Kelten gewölbte Goldmünzen her, volkstümlich<br />
"Regenbogenschüsselchen" genannt. Spätere Geschlechter glaubten nämlich, die beiden<br />
Enden eines Regensbogens stünden jeweils in solchen goldenen Schüsselchen. Im Besitz der<br />
württembergischen Altertümersammlung in Stuttgart ist so eine 7,5 g schwere goldene<br />
Hohlmünze aus Stammheim - Calw. Auf einer Seite scheint eine Schlange dargestellt zu sein.<br />
Der bekannte Möttlinger Pfarrherr und Gründer des Calwer Verlagsvereins, Christian Gottlob<br />
Barth, besaß einige Keltenmünzen aus dem Oberamt Calw. Auf einer derselben sieht man<br />
einen Vogelkopf und zwei Kugeln.<br />
Auch auf hochentwickelte kunstgewerbliche Arbeiten mit künstlerischer Prägung verstanden<br />
sich die Kelten. Zum Teil sind sie erhalten geblieben, sie wurden in Keltengräbern gefunden.<br />
Die auffallenden Grabhügel der Kelten sind vor allem in Waldgebieten heute noch zu<br />
erkennen. Im Jahre 1978 stieß man in Hochdorf Kreis Ludwigsburg auf das Grab eines<br />
vornehmen Kelten ("Der Keltenfürst von Hochdorf"), das man etwa ins Jahr 500 v. Chr.<br />
datieren kann. Die Grabkammer war unversehrt. Außer reichlichem Goldschmuck, einem<br />
Prunkwagen mit Pferdegeschirr, Trinkgefäßen usw. fand man auch in der Umgebung der<br />
11
Grabanlage die Werkstätten, in denen Teile der Grabbeigaben hergestellt worden waren und<br />
konnte die handwerklichen Techniken der Kelten erschließen.<br />
Auch bei Gechingen müssen Kelten gelebt haben. Auf unserer Markung und in etlichen<br />
Nachbargemeinden haben sich in bewaldeten Gebieten viele kleinere keltische Grabhügel<br />
erhalten. Zwei Grabhügelgruppen sind in Gechingen bekannt: Eine Gruppe mit fünf Hügeln<br />
an der Ortsgrenze zu Dachtel/Deufringen (Dreimarkstein) und eine zweite Gruppe bei der<br />
Kirchhalde am Wasserturm. Ein Hügel dort ist noch gut erkennbar, weitere können nur noch<br />
erahnt werden. Von Grabungen wissen wir folgendes:<br />
Schon im Jahre 1844 wurden durch Pfarrer Klinger acht bronzene Hals-, Fuß-, und Armringe<br />
ausgegraben, die aus zwei Gräbern in der Nähe des heutigen Wasserturms stammen. Die<br />
Hohlringe wurden mittels Bronzedraht an den Enden verbunden oder ineinandergesteckt. Die<br />
meisten sind an den zusammenstoßenden Enden mit eingeritzten 0rnamenten verziert. Von<br />
den acht zum Teil stark beschädigten Ringen sind fünf noch im Württembergischen<br />
Landesmuseum erhalten. Dort wurden die in unserem Heimatmuseum ausgestellten Repliken<br />
hergestellt.<br />
Im Jahre 1948 wurde im Auftrag des Landesamts für Denkmalpflege eine Grabung in der<br />
Hügelgruppe am Dreimarkstein vorgenommen. Denkmalpfleger Stahl berichtet:<br />
"Am 11., 12. und 13. April 1948 habe ich eine Grabung an Hügel 4 der Hügelgruppe<br />
"Dreimarkstein" auf der Gemarkung Gechingen durchgeführt, zusammen mit den Herren<br />
Essig und Kübler. Der Hügel 4 ist der wesentlichste einer Gruppe aus 5 Hügeln, die von mir<br />
im November 1947 vermessen wurde und liegt auf einem sanft geneigten Hang am Fuß des<br />
Dachteler Berges. Die geologische Formation wird durch den oberen Muschelkalk gebildet.<br />
Es wurde ein Schnitt in 0st/Westrichtung von 1 m Breite gezogen. Nach Entfernung der<br />
Bewachsung wurde zuerst der Hügelmittelpunkt ermittelt. Der Hügel hat eine Längsachse von<br />
etwa 16 - 18 m, die Querachse mißt etwa 11 - 12 m. Das Ausheben des Suchgrabens erfolgte<br />
vom höchsten Punkt aus. Unter einer dünnen Schicht von Humus und Wurzelwerk stießen wir<br />
auf eine Steinpackung, die aus Kalksteinen verschiedener Größe bis zu einem Gewicht von 60<br />
kg bestand und eine Dicke von etwa einem halben Meter hatte. Nachdem die Steinpackung<br />
beseitigt war, kam eine Lehmschicht, die nahezu steinfrei war. Nachdem die hellere<br />
Lehmschicht abgetragen war, zeigte sich der gewachsene Boden mit seiner sattgelben<br />
Lehmfarbe. Auf dieser Schicht, am Rande des Hügels 5,15 m von der Hügelmitte, machte ich<br />
den ersten Fund. Es war ein eisernes Hufeisen, etwas kleiner und vorne breiter als die<br />
heutigen, aber größer als die römischen. Seine Form und Lage am Fundort, 35 cm unter der<br />
Hügelaufschüttung, lassen vermuten, daß es merowingisch ist. Um die Hügelmitte war die<br />
Lehmaufschüttung nicht einheitlich gefärbt, sondern durch Humusbeimengung gesprenkelt.<br />
Beim vorsichtigen Weitergraben kamen zuerst die 0berschenkelknochen zum Vorschein. In<br />
Kleinarbeit wurde dann das ganze Skelett freigelegt. Sämtliche Knochen waren sehr weich,<br />
die dünnen Knochen alle vergangen. Die Schädelkapsel war durch die Last der Grabfüllung<br />
geteilt und beide Teile waren gegen die Grabsohle gedrückt. Weitere Fundstücke sind vier<br />
bronzene Ringe, von denen je zwei um Vorderarme und Unterschenkel lagen. Die Armringe<br />
bestanden nur noch aus dünnen Drahtstückchen, die Beinringe aus dickerem Draht, zu<br />
Vollringen geschlossen. Nur der Beinring am linken Fuß konnte unbeschädigt gehoben<br />
werden. Auf der rechten Brustseite lagen die Reste einer Gewandnadel. Auf der Mitte des<br />
Hinterhauptes lag ein bronzenes Drahtstück in zwei Teilen von der Länge einer Stopfnadel.<br />
Innerhalb des linken Armringes lag ein Fundstück, dessen Bedeutung nicht geklärt werden<br />
konnte. Es war ein etwa 4 cm langer eiserner Stift, der an einem Ende zu einem Haken<br />
umgebogen war. Man könnte an einen Dolchgriff denken, aber es waren weder eiserne noch<br />
bronzene Spuren einer angesetzten Dolchklinge aufzufinden. Merkwürdigerweise war der<br />
Bestattung kein Tongefäß beigegeben, in denen den Toten sonst die Wegzehrung für die<br />
12
Ewigkeit bereitgehalten wird. Wohl fand sich über dem linken Beinring ein kleines Randstück<br />
eines Kruges, das war aber wahrscheinlich zufällig an diese Stelle geraten. In der Mitte des<br />
Skeletts, also über dem Leib, war eine dunkel gefärbte Schicht einwandfrei feststellbar. Diese<br />
Verfärbung ist zweifellos durch Verkohlen der Kleidung entstanden. Unter dem Skelett waren<br />
kleine Reste eines Brettes festzustellen, wie bei den vier Flachgräbern von Birkenfeld, die<br />
vermutlich einer späteren Zeit angehören. Dagegen lagen an beiden Längsseiten der Grube die<br />
verkohlten Reste zweier Bretter, jedoch etwa 25 cm über der Skelettebene. Das bedeutet, daß<br />
die Bretter auf dem ehemals gewachsenen Boden lagen und daß also die Grube etwa 25 cm in<br />
den gewachsenen Boden eingetieft war. Die Skelettachse weicht von der Nordsüdlinie um<br />
etwa 20 ° von Norden nach Westen ab, und das Skelett liegt nur wenige Dezimeter von dem<br />
von mir vor der Grabung festgestellten Hügelmittelpunkt entfernt. Der Kopf des Skeletts liegt<br />
im Süden mit Blick nach Norden. Die Körperlänge des hier Bestatteten wird nach den<br />
verschiedenen Knochenlängen auf 1,65 m geschätzt. Das Alter wird nach dem<br />
Abnützungszustand der Zähne mit etwa 40 Jahren angegeben. Nach alledem kann die Zeit der<br />
Bestattung auf etwa 600 v. Chr. geschätzt werden, so daß wir damit in die erste Zeit der<br />
keltischen Besiedlung kommen". (Emil Stahl, Birkenfeld. Bericht gekürzt.)<br />
Die Skelettfragmente sind heute im Museum Appeleshof ausgestellt. Man kann noch an Arm-<br />
und Beinknochen sehen, wo einst die Bronzeringe waren, dort haben sich Oxydationsflecken<br />
gebildet. Wo die Grabbeigaben aber verblieben sind, konnte nicht mehr ermittelt werden.<br />
Der Arbeitskreis Heimatgeschichte, vor allem das Ehepaar Schorpp, hat sich um eine<br />
anthropologische Untersuchung der Skelettfragmente bemüht. Sie ergab, daß es sich um eine<br />
zierliche weibliche Person handelte, etwa 1,55 m groß und etwa 25 Jahre alt, als sie starb.<br />
Eine C14-Analyse erwies, daß der Zeitpunkt ihres Todes um das Jahr 460 v. Chr. zu datieren<br />
ist.<br />
Die Altersbestimmung an drei Skeletten aus Gechingen mit der C14 (Radiocarbon-) Methode<br />
konnte durch großzügiges Sponsoring der Kreissparkasse Calw ermöglicht werden. Sie wurde<br />
an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich durchgeführt, die eine der<br />
modernsten Massenspektrometer-Anlagen Europas besitzt. Mit dieser Methode läßt sich bei<br />
organischem Material das Alter exakt ermitteln.<br />
Im Jahr 1968 führte eine private Gruppe eine Ausgrabung am größten Grabhügel an der<br />
Kirchhalde durch. Leider war der Grabhügel früher schon einmal geöffnet und ausgeraubt<br />
worden, es fanden sich nur noch spärliche Skelettreste, die heute ebenfalls im Museum<br />
Appeleshof ausgestellt sind. Auch hier war, wie die anthropologische Untersuchung ergab,<br />
eine junge Frau zwischen 20 und 30 Jahren bestattet worden, die zwischen 1,50 und 1,54 m<br />
groß war. Bei ihr erbrachte die C14-Altersanalyse ebenfalls, daß sie um das Jahr 460 v. Chr.<br />
gestorben ist.<br />
Damit ist bewiesen, daß in der Zeit um 500 v. Chr. eine keltische Bevölkerung auf <strong>Gechinger</strong><br />
Gemarkung lebte. Damals dürften also die keltischen Grabhügel um Gechingen entstanden<br />
sein. Da die Begräbnisbräuche der Kelten sich im Lauf ihrer Siedlungszeit mehrfach änderten<br />
- vor den Grabhügeln waren Brand- und ab dem 3. Jahrhundert v. Chr. Körperbestattungen in<br />
Flachgräbern üblich, die nur durch Zufall aufzufinden sind - läßt sich nicht mit letzter<br />
Sicherheit sagen, ob es in Gechingen eine kontinuierliche keltische Besiedlung über<br />
Jahrhunderte hinweg gab, man kann aber davon ausgehen.<br />
Auch in unserer Nachbarschaft sind Relikte aus der Keltenzeit erhalten geblieben. Im Württ.<br />
Landesmuseum Stuttgart werden große Steinfiguren (Grabstelen) aus Calw-Stammheim,<br />
Kirchberg und Hirschlanden gezeigt, ebenso ein monumentales Götterbild aus Holzgerlingen.<br />
Aus keltischer Zeit dürften ebenfalls mit Wällen umgebene Befestigungsanlagen stammen, in<br />
die sich die Menschen samt ihrem Vieh bei Gefahr retten konnten, so zum Beispiel auf dem<br />
13
Rudersberg in einer Nagoldschleife zwischen Calw und Kentheim. Auch das <strong>Gechinger</strong><br />
Burggelände könnte in der Keltenzeit schon, entsprechend befestigt, als Zufluchtsstätte<br />
gedient haben. Der Burgenforscher A. Koch schreibt darüber: "Es ist anzunehmen, daß auf<br />
dem Schloßberg eine kleine Waldfliehburg für die Bewohner dieser <strong>Gechinger</strong> Siedlung war.<br />
Der Platz war gut gewählt. Das Tal der Irm war versumpft, daran erinnern die Flurnamen<br />
Riedhalde (Ried ist ein mooriges Gebiet) und Mistwiesen (das althochdeutsche Wort Mist<br />
hatte auch die Bedeutung von Schmutz). Somit hatte die Fliehburg, unter der man sich keine<br />
Burg im heutigen Sinne vorstellen darf, einen gewissen Schutz nach 0sten, der Taleinschnitt<br />
des Torwartsgrunds war sicher auch versumpft, wahrscheinlich war dort eine Quelle.<br />
Vielleicht kam sie vom Dachteler Bergwald und bildete einen Wasserfall an dem steilen Hang<br />
des Torwartsgrundes. Dadurch wäre ein Sumpfgürtel gegen Westen gegeben. Nach Norden<br />
bildete ebenfalls das Sumpftal der Irm den Abschluß. Aber auch nach Osten wäre stellenweise<br />
ein Sumpftal möglich gewesen, durch die Flur Mulde. Man weiß, daß in der Flur Faulhecke an<br />
der Steig noch eine Quelle floß, an welche alte Leute sich noch erinnern können. Der Zugang<br />
zur Fliehburg lag demnach in der Gegend des Festplatzes Bergwald in der Flur Besemer. Der<br />
ganze Wald könnte die Fliehburg gewesen sein und der östliche Zipfel war die letzte<br />
Rettung."<br />
Ähnliche Überlegungen könnten dann zu einer zweiten Besiedlung des Schloßbergs um 1200<br />
geführt haben, als die uns heute bekannte Burg entstand.<br />
Die Kelten haben auch in geographischen Bezeichnungen in unserer engeren Heimat ihre<br />
Spuren hinterlassen, die Namen von Neckar, Enz, Nagold z. B. sind keltischer Herkunft. Die<br />
Sprache hat sich bis zur Gegenwart nur noch in den Varianten erhalten, die in der Bretagne, in<br />
Wales und in Irland (Inselkeltisch) gesprochen werden.<br />
Gechingen in geschichtlicher Zeit<br />
Die Römer<br />
Um die Zeitenwende hatten die Römer ihr Reich bis an Rhein und Donau ausgedehnt, das<br />
gesamte linksrheinische Gebiet war von Cäsar schon 50 vor Chr. erobert worden. Auch<br />
südlich der oberen Donau hatten die Römer sich auf Dauer festgesetzt, die Donau war hier<br />
Reichsgrenze. Der Schwarzwald und das dünn besiedelte Neckarland schoben sich jetzt<br />
winkelartig in römisches Gebiet. Um die Grenze zu verkürzen und um das linksrheinische<br />
Gebiet besser mit dem römischen Besitz südlich der Donau zu verbinden, besetzten die Römer<br />
zunächst den südlichen Schwarzwald und erbauten ab dem Jahre 73-74 n. Chr. eine Straße<br />
von Straßburg über Offenburg durchs Kinzigtal nach Rottweil, die bei Tuttlingen zur oberen<br />
Donau führte. 90 n. Chr. wurde das Gebiet mit der Grenzbefestigung des Neckarlimes, der<br />
von Cannstatt nach Wimpfen führte, auch weiter nördlich vor Einfällen der Germanen<br />
geschützt.<br />
Die Römer blieben über hundert Jahre lang die Herren unserer Heimat. Zunächst waren sie<br />
ausschließlich Besatzungsmacht. Später, vor allem als sich die Grenze noch weiter nach<br />
Norden verschoben hatte und stark befestigt worden war, ließen sich Zuwanderer aus aller<br />
Herren Länder hier nieder. Römische Kaufleute kamen, die mit der einheimischen<br />
Bevölkerung Handel trieben und Ackerbauern siedelten sich unter dem Schutz der römischen<br />
Soldaten an, die sich mit der hier ansässigen, meist keltischen Bevölkerung vermischten.<br />
Unsere Gegend gehörte zum Verwaltungsbezirk "Sumelocenna" (Sülchen bei Rottenburg).<br />
Römische Gutshöfe (Villen) entstanden, Steinbauten, in denen römische Grundbesitzer so<br />
14
leben wollten, wie sie es gewohnt waren. So brauchte man römische Werkstätten,<br />
Ziegelbrennereien, Töpfereien und Steinbruchbetriebe. Zum Schluß der römischen Zeit war<br />
unsere Heimat relativ dicht besiedelt, es gab aber nur kleine Landstädte und ländliche<br />
Siedlungen.<br />
In Gechingen stieß man beim Roden eines Hopfenackers in der Flur "Stöckbrunnen" auf<br />
gebrannte Ziegelsteine, wie sie weder die Kelten noch die Alamannen herstellten oder<br />
benutzten. Vermutlich handelte es sich um den Boden eines Römerhauses. Bei Calw-<br />
Stammheim lag ein großer Gutshof aus der Römerzeit (Villa Rustica), der 1911 freigelegt<br />
wurde, aber auch in Althengstett, Ostelsheim, Simmozheim, Holzbronn, Gültlingen u. a. fand<br />
man die Überreste römischer Hofstellen. Beim Bau der Wasserleitung entdeckte man am<br />
Herdweg Teile einer alten Brücke, die aus der Römerzeit stammen könnte. Das noch<br />
vorhandene "Römersträßle" hat wohl nur den Namen, nicht aber die Herkunft den Römern zu<br />
verdanken. Bei Stichgrabungen fand man keinerlei Hinweise, die auf römischen Straßenbau<br />
hingedeutet hätten.<br />
Aus dem Lateinischen übernommene Wörter sind: Mauer, Kalk, Ziegel, Mörtel, Turm, Keller,<br />
Fundament, Fenster, Kammer, Kamin, Pflaster, Küche, Pfanne, Öl, Wein, Pflaume, Pfirsich,<br />
Pfeffer, Rettich, Teller, Vesper, Sack, Zentner, Pfund, Münze, Markt und Schule. (Für die<br />
meisten dieser Begriffe gilt, daß die jeweils zugehörige Sache unsern Vorfahren erst durch die<br />
Römer bekannt wurde.)<br />
Die Alamannen und die Franken<br />
Im 3.Jahrhundert n. Chr. gerieten die germanischen Völkerschaften in Bewegung. Die<br />
Alamannen ("alle Männer") waren Verbände der germanischen Sueben, die sich zu einem<br />
Vorstoß nach Südwesten zusammengeschlossen hatten. Um 259-260 gelang es ihnen, unser<br />
Gebiet, das zu diesem Zeitpunkt vermutlich schon nahezu völlig von der Vorbevölkerung<br />
verlassen worden war, in Besitz zu nehmen. Versuche der Römer, das Land zurückzuerobern,<br />
scheiterten. Um die Mitte des 4. Jahrhunderts waren rechts des Rheins die ersten<br />
alamannischen Ansiedlungen entstanden - Weiler und dorfartige Siedlungen. Die Steinhäuser<br />
der Römer verödeten, das gut bebaute Land aber bewirtschafteten die Alamannen weiter. Als<br />
gegen Ende des 5. Jahrhunderts die Franken das römische Gallien erobert hatten, kam es<br />
zwischen den beiden rivalisierenden germanischen Stämmen im Jahr 496 zu der<br />
entscheidenden Schlacht bei Zülpich. Die Franken wurden von ihrem König Chlodwig<br />
angeführt. Die Alamannen leisteten erbitterten Widerstand. Chlodwig glaubte die Schlacht<br />
zeitweise sogar verloren und gelobte in der Not, bei einem Sieg zum Christentum<br />
überzutreten. Die Alamannen wurden geschlagen. Chlodwig und 3 000 fränkische<br />
Gefolgsleute wurden Christen. Die Alamannen mußten ihre nördlichen Gebiete abtreten, die<br />
Grenze zum Land der Franken verschob sich nach Süden und verlief quer durch das heutige<br />
Nordwürttemberg. Sie zog sich südlich von Crailsheim, Murrhardt, Marbach zum<br />
Hohenasperg, ein Stück entlang der Glems in Richtung Weil der Stadt nach Calw. Gechingen<br />
kam als Grenzort noch unter fränkische Herrschaft. Auch der nördliche Schwarzwald fiel an<br />
die Franken. Im Jahr 537 übernahmen die Franken auch Restalamannien.<br />
Bei Gechingen läßt sich annehmen, daß es mit zu den ältesten alamannischen Dörfern gehört.<br />
Ortsnamen auf "-ingen" gehören zu den ersten Ansiedlungen, die im 4. bis 5. Jahrhundert<br />
gegründet wurden. Über die Entstehung des Ortsnamens gibt es zwei Vermutungen. Die eine<br />
leitet sich von dem Namen "Gacho" ab. "-ing" war eine Geschlechtsbezeichnung. "Gachoingen<br />
bezeichnet die Mehrzahl, also hieße Gechingen, früher Gachingen "bei den Leuten des<br />
Gacho" (vgl. Bildungen wie "Merowinger" oder "Karolinger"). Die andere Deutung bezieht<br />
sich auf den Wasserreichtum des Ortes. Die Vorsilbe "ge" bedeutet "viele" (Gebirge= viele<br />
15
Berge), Aach oder Gach ist der alte Name für Wasser, daraus könnte ebenfalls Gachingen<br />
"Dorf am Wasser" entstanden sein.<br />
Wie wohl die ersten <strong>Gechinger</strong> lebten? Unser Wissen über die ersten alamannischen Dörfer ist<br />
dürftig, da die Siedlungen heute noch bestehen und Grabungen daher nicht möglich sind.<br />
Schriftliche Zeugnisse gibt es erst aus christlicher Zeit.<br />
Zu Neuansiedlungen schlossen sich fast immer mehrere Familien zu größeren Verbänden<br />
zusammen. Der "Hausherr" war uneingeschränkt der Herr über alles lebende und tote<br />
Inventar, wozu Frau und Kinder, eventuell auch Verwandte mit Kindern, Leibeigene und<br />
Sklaven gehörten. Er gewährte dafür Rechtsschutz. Zwischen freien Bauern und Grundholden<br />
(vom Grundherren in irgendeiner Form Abhängigen) waren die Übergänge wohl nicht völlig<br />
eindeutig festgelegt. Es ist auch möglich, daß schon das noch unbesiedelte Land in<br />
Herrschaftskomplexe aufgeteilt war und so schon bei Neugründungen Abhängigkeit von<br />
Grundherren bestand.<br />
Wahrscheinlich errichteten die Alamannen damals schon ihre Fachwerkhäuser. Die Fächer<br />
füllten sie mit Flechtwerk aus Reisig aus, das sie mit Lehm überkleideten; eine Bauart, die<br />
seither bis vor ca. 150 Jahren in den Gäuorten angewendet worden ist.<br />
Die Alamannen trieben wenig Handel, die Dorfbewohner versorgten sich mehr oder weniger<br />
selbst. Daher gab es früh Werkstätten, in denen das für die örtlichen Bedürfnisse Notwendige<br />
angefertigt wurde. Als erstes kommt da der Grobschmied in Frage. Auch Töpfer gab es<br />
häufiger.<br />
Das meiste, das wir über die Alamannen wissen, verdanken wir den Reihengräberfriedhöfen,<br />
die außerhalb der Dörfer lagen und die vom 5. bis zum 7. Jahrhundert allgemein üblich waren,<br />
als die Körperbestattung sich durchgesetzt hatte. Man beerdigte alle Toten eines Ortes auf<br />
dem gleichen Friedhof in Reihen. Die Toten erhielten Beigaben, mit denen es ihnen<br />
ermöglicht werden sollte, im Jenseits zu bestehen. Dieser Brauch beruht auf religiösen<br />
Vorstellungen. Die Toten waren vollständig bekleidet, den Frauen gab man ihren besten<br />
Schmuck und den Männern Waffen mit, dazu Ton- Bronze- oder Holzgefäße. Die möglichst<br />
vollständige Ausgrabung eines Reihen-gräberfriedhofs läßt Vorstellungen von der Größe des<br />
zugehörigen Ortes und seiner sozialen Struktur zu. Auch die osteologische Untersuchung der<br />
Skelette hat wichtige Erkenntnisse gebracht. Wir wissen, daß die Männer durchschnittlich<br />
1,67 m und die Frauen 1,55 m groß wurden. Fast zwei Drittel der Bevölkerung wurde nicht<br />
älter als 25 Jahre.<br />
Auf einzelnen Gräberfeldern machte man auch kostbare Funde, so muß im 5. Jahrhundert im<br />
benachbarten Gültlingen ein Zentrum germanischer Macht gewesen sein. Man hat Gräber von<br />
Personen gefunden, die überaus reich ausgestattet waren. Zum Beispiel entdeckte man dort in<br />
zwei Männergräbern eine Goldgriffspatha (zweischneidiges germanisches Langschwert,<br />
dessen Griff mit Goldblech beschlagen war), eine außerordentlich seltene Beigabe, die auf den<br />
hohen Rang des Trägers schließen läßt. Der Schmuck bestand aus teilweise sehr schönen und<br />
wertvollen Stücken. Ab dem 6. Jahrhundert finden sich in Gültlingen keine Gräber von<br />
Angehörigen eines besonders vornehmen und reichen Personenkreises mehr, was vermutlich<br />
mit der Schlacht von Zülpich 496 zusammenhängt.<br />
Während der Periode des Landausbaus im 7. Jahrhundert sprechen die archäologischen Funde<br />
in den Friedhöfen für ein System rechtlicher Abhängigkeit des überwiegenden Teils der<br />
Bevölkerung. Eine kleine Oberschicht hatte die wirtschaftliche und politische Macht, diese<br />
Ab-hängigkeitsverhältnisse, die bis weit ins Mittelalter hinein erhalten blieben, zu schaffen<br />
und sie rechtlich abzusichern. Dies muß auf Kosten des sozialen Gleichgewichts geschehen<br />
sein, bedeutet aber nicht, daß alle unfreien Alamannen besitzlos waren. Etwa ein Drittel der<br />
Bevölkerung konnte es zu bescheidenem Wohlstand bringen und die im Lande gefertigten<br />
16
Tuche, Gürtel und Waffen erwerben. Der Rest war im 7. Jahrhundert aber mittellos. Auch das<br />
läßt sich bis zum Ende des Jahrhunderts aus Reihengräberfriedhöfen erschließen. Ein solcher<br />
wurde für Gechingen bisher nicht gefunden, doch auch hier wurden Gräber entdeckt, von<br />
denen man weiß oder annimmt, daß sie aus der Alamannenzeit stammen, so auf dem<br />
Käppelesberg und in der Kreuzstraße. In der Oberamtsbeschreibung von 1860 ist von<br />
Grabfunden die Rede. "Auf dem nordwestlich am Ort gelegenen sogen. Angel wurden im Jahr<br />
1841 zwei Furchengräber aufgefunden, welche Skelette enthielten, denen bronzene Arm-,<br />
Ohren- und Fußringe, eine schön gearbeitete Fibula und kurze, einschneidige Schwerte von<br />
Eisen beigegeben waren. Nur etwa 300 Schritte von dieser Stelle auf dem sogen.<br />
Käppelesberg wurden im Jahr 1845 beim Graben eines Kellers ähnliche Gräber aufgedeckt,<br />
die eiserne Waffen enthielten."<br />
Bei Kanalarbeiten am alten Schulhaus wurde 1953 ein Grab mit Grabbeigaben freigelegt. Die<br />
Funde wurden unter der Leitung Prof. Parets vom Landesamt für Denkmalpflege geborgen. Er<br />
identifizierte die Beigaben als alamannischen Frauenschmuck und datierte die Bestattung ins<br />
siebte bis achte Jahrhundert. In den "Stuttgarter Nachrichten" wurde seinerzeit ausführlich<br />
darüber berichtet und in den "Fundberichten aus Schwaben" u.a. eine Liste der<br />
Schmuckstücke veröffentlicht.<br />
Es gelang dem Arbeitskreis Heimatgeschichte, sowohl die Gebeine als auch die Grabbeigaben<br />
wieder aufzufinden und für das Museum Appeleshof zurückzuerlangen. Die Skelettreste<br />
befanden sich in der Osteologischen Sammlung der Universität Tübingen. Auch bei diesem<br />
Knochenfund konnte eine anthropologische und eine C14-Analyse durchgeführt werden. Der<br />
anthropologische Befund ergab, daß es sich um eine sehr grazile Frau von 20-25 Jahren<br />
handelte. Sie war zwischen 1,55 m und 1,60 m groß. Auch ein kräftiger<br />
Oberschenkelknochen, der nicht zu den übrigen Gebeinen gehören kann, war dabei,<br />
vermutlich ist er einem Manne zuzuordnen.<br />
Durch die Radiocarbon-Analyse ließ sich der Zeitpunkt der Bestattung um das Jahr 645 n.<br />
Chr. festlegen. Es hat sich also bestätigt, daß der Fund aus der Alamannenzeit stammt. Die<br />
Grabbeigaben hatte Prof. Paret dem Heimatmuseum Calw übergeben, von dem sie das<br />
Heimatmuseum Gechingen 1995 zurückerhielt. Es handelt sich um folgende Stücke :<br />
Eine Halskette aus 80, zum Teil mehrfarbigen Glas- und drei Bernsteinperlen<br />
Ein großer Ohrring aus dünnem Bronzedraht, mit durch Punktkreise verziertem kleinem<br />
Polyeder<br />
Eine Rundfibel aus gepreßtem Bronzeblech, durch acht Nieten auf der Unterlagplatte<br />
befestigt, mit Mittelbuckel, Perllinien- und Flechtbandverzierung<br />
Vier Riemenzungen, Bronze, verziert, mit Nieten zur Befestigung an Lederriemen<br />
Ein Armring, Bronze, offen mit Schlangenkopfenden<br />
Ein Bronzering, geschlossen<br />
Eine Spachtel, Bronze, Griff gedreht. In der Öse Rest eines eisernen Ringchens.<br />
Im Fundbericht wurden außerdem zwei kleine quadratische Bronzebeschläge sowie die Reste<br />
von zwei kleinen Eisenringen und Teile eines zweiseitigen Beinkamms aufgeführt. Diese<br />
Teile sind aber verloren gegangen.<br />
Die junge Frau war relativ wohlhabend. Die Scheibenfibel war etwas Besonderes, ebenso die<br />
Bernsteinperlen. Bei der Spachtel handelt es sich um ein Schabewerkzeug mit breiter Klinge,<br />
das wie der Bronzering wohl Teil des Gürtelgehänges war, an dem die alamannische Frau das<br />
trug, was "zur Hand" sein sollte, auch Amulette waren oft dabei. Die Lederriemen, zu denen<br />
die Riemenzungen gehörten, dienten zur Befestigung der Beinkleidung.<br />
Die Reihengräberfriedhöfe wurden gegen Ende des 7. Jahrhunderts aufgegeben. Damals war<br />
Alamannien weitgehend christianisiert. Unter kirchlichem Einfluß ging man dazu über, die<br />
Friedhöfe im Dorf rings um die Kirche anzulegen. Ab 600 sind die ersten Kirchen<br />
17
nachweisbar, zunächst meist als Teil eines Adelshofes. Weil die Franken immer nur eine<br />
dünne Oberschicht stellen konnten, stützte ihre Herrschaft sich von Anfang an auf die Kirche.<br />
Als öffentliches Gebäude einer Dorfgemeinschaft dürften Kirchen zu diesem Zeitpunkt noch<br />
eine Ausnahme gewesen sein. Das wandelte sich dann im Laufe des 8. Jahrhunderts. Da man<br />
ab diesem Zeitpunkt auf Grabbeigaben verzichtete und die Gräber mehrfach nacheinander<br />
belegte, sind sie für die Forschung wertlos. Die ersten Kapellen und Kirchen in unserer<br />
Gegend wurden St. Martin und St. Michael geweiht. Da auch unsere Kirche eine St. Martins-<br />
Kirche ist, nehmen wir an, daß sie aus jener Frankenzeit stammen könnte. Die erste christliche<br />
Kapelle in unserem Ort stand auf dem Käppelesberg, wo der Sage nach früher eine<br />
alamannische 0pferstätte war. Manche Einwohner Gechingens besuchten wahrscheinlich in<br />
den Anfängen des Christentums heimlich noch eine andere 0pferstätte, die sich auf dem<br />
Steinenberg (bei Deckenpfronn) befand.<br />
Für die einfachen Leute hatte die Frankenzeit zunächst wohl kaum Veränderungen gebracht,<br />
sie hinterließ nur oberflächliche Eindrücke. Zwar blieben die Franken in der Verbreitung des<br />
Christentums, das sich langsam durchsetzte, erfolgreich, politisch wurde aber durch unfähige<br />
Nachfolger des Merowingers Chlodwig das Frankenreich bald so geschwächt, daß in seinen<br />
Randgebieten, zu denen Schwaben gehörte, die königliche Gewalt nachließ. Im 6. und 7. Jhdt.<br />
stand Alamannien (Schwaben) ein Herzog aus heimischem Adel als Vertreter des<br />
Frankenkönigs vor.<br />
Vom frühen Mittelalter bis zum Bauernkrieg<br />
Nach dem Tod des letzten Schwabenherzogs Lantfrit wurde das Herzogtum Schwaben<br />
aufgehoben. Ein Aufstand der Alamannen folgte. Karlmann, der Bruder des Karolingers<br />
Pippin, der später die Merowinger absetzte und selbst die Herrschaft übernahm, führte einen<br />
Feldzug gegen die Alamannen. Von ihm wurde 746 der alamannische Adel zu einem<br />
Gerichtstag bei Cannstatt eingerufen und dort vom fränkischen Heer umstellt und<br />
niedergemacht. Das nun führungslose Alamannien wurde fest in das Frankenland<br />
eingegliedert, die Güter der Aufständischen fielen an das fränkische Königsgut. Das Land<br />
wurde in Gaue aufgeteilt und diese von fränkischen Hofbeamten (Grafen) verwaltet. Unter<br />
ihnen entstanden viele neue Orte mit den Endungen -heim und -hausen, -zell und -kirch.<br />
Stammheim und Gechingen lagen im Würmgau, Deufringen im Gau Glehuntare und Dachtel,<br />
Deckenpfronn und Holzbronn in der Bertholdsbar (Bar oder Baar = Verwaltungsbezirk, Bar<br />
bedeutet Gerichtsschranke). Die ersten Gaugrafen, denen unsere Gegend unterstellt war,<br />
waren die Grafen von Calw.<br />
Unter den Karolingern entwickelte sich im 8. Jahrhundert das Lehnswesen, das dann das<br />
ganze Mittelalter hindurch eine Grundlage der Gesellschaftsordnung war. Der ursprüngliche<br />
Gedanke war, daß der oberste Kriegsherr, der König oder Kaiser, verdiente Gefolgsleute mit<br />
Land "belehnte", das aber in seinem Besitz blieb. Die Lehensträger waren zu Kriegsdienst und<br />
Treue ihrem Lehnsherrn gegenüber verpflichtet und konnten ihrerseits Lehensmänner mit<br />
Land belehnen, die dann vom Ertrag ihres Gutes sich Pferd und Rüstung beschaffen mußten,<br />
um ihrem Lehensgeber im Kriegsfall Gefolgschaft zu leisten. Die Bauern waren vom<br />
Kriegsdienst freigestellt und hatten Anspruch auf Schutz, sie mußten aber durch Abgaben und<br />
Frondienste an den Grundherren dessen Aufwendungen für den Kriegsdienst finanzieren. Was<br />
ursprünglich eine vernünftige Übereinkunft auf Gegenseitigkeit gewesen war, entwickelte sich<br />
im Lauf der Zeit zu Rechtlosigkeit und Abhängigkeit auf seiten der Bauern, die an das Land,<br />
das sie bebauten, gebunden blieben. Diese rechtlichen Verhältnisse, die sich schon im 7.<br />
Jahrhundert aus Gräberfunden abzeichneten, sind uns wenig später, im 8. Jhdt., in den<br />
Schenkungen an die großen Klöster am Rande des Alamannengebiets auch schriftlich bezeugt,<br />
18
wie das Beispiel Gechingen zeigt, das samt lebendem und totem Inventar zur Schenkung<br />
wurde.<br />
Mit der Christianisierung und der Ausbreitung der Klöster treten immer mehr schriftliche<br />
Zeugnisse an die Stelle der archäologischen.<br />
Nach dem Tode Karls des Großen im Jahr 814 zerfiel das riesige Frankenreich, seine<br />
Nachfolger waren nicht fähig, es zu erhalten. Der westliche Teil, das spätere Frankreich,<br />
trennte sich vom eigentlichen Reich der Deutschen. Schwaben wurde Herzogtum. Es war der<br />
Schauplatz vieler Kriege und wurde oft verwüstet. Später gelangte Schwaben als das<br />
Stammland der Staufenkaiser zu großer Bedeutung und einer Art Vormachtstellung im Reich<br />
und viele Städte wurden dort zur Stauferzeit gegründet. Weil der Stadt zum Beispiel erhielt<br />
unter den Staufern Stadtrecht. Auch die erste urkundliche Erwähnung Gechingens fiel, so<br />
dachte man bisher, in diese Zeit. Man ging von der gesicherten Nennung im Jahr 1200 aus.<br />
Ein Marquart von Gechingen schenkte dem Kloster Hirsau 2 Huben (Hube oder Hufe ist ein<br />
altes Landmaß). Das Wappenbuch des Landkreises Calw verzeichnet als Erstnennung<br />
Gechingens im Codex Hirsaugiensis das Jahr 1150. Inzwischen liegen neue Erkenntnisse vor.<br />
In einer Reichenauer <strong>Chronik</strong> Anfangs 1500 wird von einer Schenkung um 830 berichtet. Die<br />
sechzehn Orte (teils aus nächster Umgebung), die damals an das Kloster Reichenau fielen,<br />
sind namentlich genannt. Darunter wird auch "Gaichingen", also Gechingen, erwähnt. Die<br />
Schenkung kam von einem Sohn des Calwer Grafen Erlafried (+ 850) mit Namen Noting. Er<br />
war Bischof in dem oberitalienischen Bistum Vercelli. Das ist die erste urkundliche Nennung<br />
des Ortes Gechingen (Heft 1 "Einst und Heute"). Ausführlicher Bericht im Anhang.<br />
Als der letzte Staufer Konradin 1268 enthauptet worden war, verfiel auch das Herzogtum<br />
Schwaben. In dem nun entstandenen Machtvakuum konnten kleine Herren ihre Macht und ihr<br />
Gebiet ausdehnen, das beste Beispiel dafür sind die vorher unbedeutenden Grafen von<br />
Württemberg. Das Geschlecht erlangte 1495 die Herzogswürde, als Ehrung Eberhards V.,<br />
eines begabten und allgemein hochgeschätzten Fürsten. Doch war das Herzogtum<br />
Württemberg viel kleiner als das einstige Herzogtum Schwaben. Auf unserem Boden gab es<br />
mehr als hundert selbständige Herrschaften von weltlichen und geistlichen Herren und<br />
Reichsrittern, denn auch Klöster, Ritter und freie Städte beanspruchten und erhielten<br />
Reichsunmittelbarkeit.<br />
Gechingen selbst ging durch viele Hände, war aber meist in geistlichem Besitz. Man kann sich<br />
die mittelalterlichen Besitzrechte nicht kompliziert genug vorstellen, auch in Gechingen<br />
hatten viele Herren Anspruch auf Abgaben, ob es sich nun um Frondienste oder Naturalien<br />
handelte, auch Steuern in Form von Geld nahmen im Lauf der Zeit einen immer wichtigeren<br />
Platz ein. Um die Verhältnisse ein bißchen anschaulicher zu machen, sei hier aufgeführt, was<br />
wir aus frühen Urkunden über einige Anwesen in Gechingen wissen:<br />
Über Hof und Haus Marquardt/Böttinger, Kirchstraße, ist folgendes bekannt: 1496 erscheint<br />
das Anwesen als Vögtleinshof, das dem Kloster Hirsau zinst. 1515 ist eine Teilung des Hofes<br />
eingetragen. 1547 Änderung des Namens in Sauergut und Linkenhof. (Breitling Hans des<br />
Linken Sohn). 1573 Bau einer Scheuer (Jahreszahl im Kellerhals). 1620 ist das heutige Haus<br />
erbaut. 1622/63 erscheinen Alt Martin Weiß und sein Schwiegersohn Endris Spöhr als<br />
Besitzer und für die Jahre 1632/61 Hyronimus Weiß und Martin Weiß. 1720 gehört Hans<br />
Bernhardt Fischer die eine und Michel Sembler die andere Hälfte.<br />
Folgende Höfe sind außerdem in Urkunden erwähnt: 1453 und 1530 ein Frühmeßhof (für<br />
Vikar oder Helfer des Pfarrers), 1453 ein Waldvogtshof (zinst der geistlichen Verwaltung<br />
Calw), 1496 und 1525 ein Amlungshof (zinst Kloster Hirsau), 1480 Heiligenhof oder<br />
Widdumgut (für den Pfarrer), 1401 und 1720 Spörenhof, Jörg Kielwein, Hans Schneider<br />
(zinsen an das Stift in Sindelfingen). 1388 und 1547 Lindenfels Gut, Langhans Peter. 1622<br />
Brackenheimer Hof. 1720 Scharheinzen Hof, Christian Dichtel. 1720 Hengstetter Pfarrhöfle<br />
(für Pfarrer von Hengstett). 1517 Kraussenhof, Aurelius Krauss und Sohn Jakob. 1746<br />
19
Luppenhof (zinst der geistlichen Verwaltung in Calw). Welcher von diesen Höfen mit denen<br />
im Zinsbuch von 1725 genannten identisch ist, bleibt einer weiteren Nachforschung<br />
vorbehalten.<br />
Verschiedene Güter waren dem Kloster Hirsau zinspflichtig. 1447 wurden 22 Malter Roggen,<br />
5 Malter Dinkel und 5 Malter Habern und 5 Schilling abgeliefert. Im Jahre 1533 waren es 20<br />
Malter Roggen, 13 Malter Dinkel und 60 Malter Habern.<br />
Die Naturalabgaben, soweit es sich um Getreide handelte, der Zehnte also, mußten, wie in<br />
anderen Ortschaften, in die Zehntscheuer, auch Fruchtkasten genannt, geliefert werden. Auch<br />
Gechingen besaß ein solches Gebäude. Es war 39 Fuß (1 Fuß= 0,28 m) lang, 36 Fuß breit, aus<br />
Stein gebaut und hatte zwei Fruchtböden, die 500 - 600 Scheffel faßten. Darunter befand sich<br />
ein großer Keller. An welcher Stelle im Ort der Fruchtkasten stand, ist bis heute unklar. In den<br />
Jahren 1831-1832 wurde er abgebrochen.<br />
1308 verkaufte der Pfalzgraf von Tübingen seinen Besitz in Gechingen um 800 Pfund Heller<br />
an das Kloster Herrenalb, das zu dieser Zeit bis zum Dreißigjährigen Krieg großen<br />
wirtschaftlichen Einfluß hatte. Ein Großteil des Ortes unterstand damit dem Klosteramt in<br />
Merklingen, das dem Kloster Herrenalb gehörte. Auch die Schultheißen wurden von<br />
Merklingen aus eingesetzt und bestätigt. Aus Schätzungslisten des Amtes aus den Jahren 1448<br />
und 1470 ist zu entnehmen, daß es damals in Gechingen 47 vermögende Hausbesitzer gab, 5<br />
Einwohner ohne Haus und 10 völlig Mittellose. Wenn man die durchschnittliche Größe der<br />
Familien dieser Zeit zugrundelegt, kommt man auf eine geschätzte Einwohnerzahl von 350 -<br />
450 Personen.<br />
Auch ein Bild von der Größe des Ortes in dieser Zeit kann man sich machen. Aus der<br />
Amtszeit des Schultheißen Konrad Schneider (ca.1475-1505) wissen wir, daß dieser "Hus und<br />
Hof, Scheuer und Garten mit aller Zugehörd an dem Hengstetter Tor" hatte. Das Anwesen<br />
stand am Ende der Kunzengasse, die etwa da verlief, wo heute der Fleckenparkplatz ist, an der<br />
Stelle, an der sich das Konsumgebäude mit dem "Uffamergamänndle" befand, gerade noch<br />
innerhalb des Dorfzauns (Dorfetter). Der Dorfetter umschloß einerseits den Raum zwischen<br />
Bach und Calwer Straße und andererseits den Bereich zwischen Kirchstraße mit Kirche und<br />
Gäßle, so daß der "Adler", dessen Platz heute das Rathaus einnimmt, schon außerhalb lag.<br />
Zunächst hatte der Dorfetter hauptsächlich eine Schutzfunktion, ähnlich der Stadtmauer bei<br />
den Städten, später aber lag seine Bedeutung vor allem in der Markierung einer Grenze<br />
zwischen Ortschaft und Flur. Es handelte sich im allgemeinen um einen starken Holzzaun.<br />
Die beiden Ausgänge wurden morgens und abends geöffnet bzw. verschlossen.<br />
Alle die vielen Herren, die es in unserem Lande gab, ob weltliche oder geistliche, mußten ihr<br />
Gebiet militärisch sichern, für die Rechtssprechung sorgen, ihre Einkünfte einziehen und<br />
verwalten. Sie gliederten ihren Besitz jeweils in Amtsbezirke, denen ein Vogt oder Amtmann<br />
vorstand. Diese Verwaltungseinteilung des Landes in Ämter war Mitte des 15. Jahrhunderts<br />
abgeschlossen.<br />
Die Dorfgemeinden waren einfacher, aber nach dem Vorbild des Amtssitzes organisiert. An<br />
der Spitze der Dorfgemeinde stand ein Schultheiß, der vom zuständigen Amt ernannt wurde;<br />
vielfach gewannen aber mit der Zeit die Dorfgemeinden ein Recht der Mitwirkung bei der<br />
Besetzung des Schultheißenamtes. Dem Schultheißen stand das Dorfgericht zur Seite,<br />
daneben meist ein Gemeindeausschuß, der sich in späterer Zeit auch "Rat" nannte. Das<br />
Dorfgericht oder Ruggericht rügte Fehler und verhängte kleinere Strafen. Die spätere<br />
Selbstverwaltung der Dörfer nahm hier ihren Anfang.<br />
Während das Bürgertum in den Städten aufstrebte, blieben die Bauern sozial deklassiert und<br />
ohne politischen Einfluß. Es kam immer wieder zu kleineren Bauernaufständen. Auf<br />
württembergischem Gebiet - zu dem Gechingen damals nicht gehörte - erhoben sich die<br />
Bauern im Remstal 1514 im Aufstand des Armen Konrad gegen die Mißwirtschaft Herzog<br />
Ulrichs von Württemberg. Er richtete sich vor allem gegen neue Steuern und griff rasch auf<br />
20
andere Landesteile und sogar auf die Amtsstädte über. Im Tübinger Vertrag, von dem die<br />
Bauern ausgeschlossen blieben, einigte sich Ulrich mit der Landschaft (entspricht ungefähr<br />
dem heutigen Landtag) und mit der Ehrbarkeit. Der Tübinger Vertrag gilt als Grundlage der<br />
altwürttembergischen Verfassung. Der Bauernaufstand wurden niedergeschlagen, einige der<br />
Anführer in Schorndorf enthauptet.<br />
Vom Armen Konrad, wie auch vom Beginn der Reformation (1517) blieb Gechingen zunächst<br />
wohl unberührt. Nicht nur die Oberen der geistlichen Herrschaften hielten am katholischen<br />
Glauben fest, auch das württembergische Gebiet war zur Zeit der Vertreibung Herzog Ulrichs<br />
unter der Zwischenregierung Ferdinands von Habsburg, strikt katholisch. Doch waren sowohl<br />
unter der habsburgischen als auch unter geistlicher Herrschaft die Lebensverhältnisse der<br />
Bauern unbefriedigend. Seit der Reformation, die sie auch als eine soziale Bewegung ansahen,<br />
strebten die Bauern neben einer Verbesserung ihrer Lage, auch "göttliche Gerechtigkeit" an.<br />
Die neue Lehre Luthers durften sie zwar nicht annehmen, aber sie waren doch mit ihr in<br />
Berührung gekommen. Weil der Stadt zum Beispiel neigte der Reformation zu, Johannes<br />
Brenz, der spätere Reformator Württembergs, stammt von dort. Gegen Ende des 16.<br />
Jahrhunderts wurde die Stadt im Zuge der Gegenreformation wieder katholisch.<br />
Zuerst erhoben sich die Bauern 1524 im Süden unseres Landes zum Bauernkrieg, im Frühjahr<br />
1525 flackerte der Aufstand überall in Deutschland auf, das heutige Baden-Württemberg war<br />
ein Zentrum des Aufruhrs. Tillie Jäger schreibt sehr anschaulich darüber, denn auch<br />
Gechingen war unmittelbar betroffen: "Das war eine Aufregung, auch in den Dörfern unserer<br />
Gäulandschaften! Überall diskutierten aufgeregte Bauern, in den Häusern, in den<br />
Dorfwirtschaften, auf der Straße. So durfte es nicht mehr weitergehen mit der Ausbeutung<br />
durch Fürsten, Klöster, Staats- und Kirchendiener! Die alten Lehensrechte, die von den<br />
Grundherren nach Belieben weiter verschachert werden konnten, hatten zu einer heillosen<br />
Verwirrung geführt. So zinsten und fronten in Gechingen die einen an das Kloster Hirsau, die<br />
anderen an die Klöster Herrenalb, Lichtental, Reuthin, an das Chorherrenstift in Sindelfingen<br />
oder gar an den Markgrafen von Baden. Als demütigend und untragbar wurde aber die<br />
Leibeigenschaft angesehen. Als um die gleiche Zeit Luthers Lehre wie im Siegeszug durch<br />
das Land brauste, da brachen überall die Dämme. Das war ein Kommen und Gehen, auch in<br />
Gechingen! Alle Höfe und Gärten waren belegt, mit rastenden Bauerngruppen, mit Pferden<br />
und Gespannen, mit Feldschlangen (Kanonen) und allerlei Belagerungsgeräten. Viele folgten<br />
dem Bauernhauptmann Bernhardt Schwarz von Dagersheim. Dem Abt Johann vom Kloster<br />
Hirsau und selbst der Stadt Calw zeigte man, was die Stunde geschlagen hatte. Mit vereinten<br />
Kräften gelang es, die befestigte Stadt Herrenberg zu erobern. Und alle wollten in Böblingen<br />
mit dabei sein, wenn es galt, der Ungerechtigkeit ein für allemal ein Ende zu bereiten.<br />
Sorgenvoll mögen an jenem 12. Mai des Jahres 1525 die <strong>Gechinger</strong> Frauen an ihre Männer<br />
und Söhne gedacht haben, die mit dem großen Bauernheere in der Nähe des heutigen<br />
Böblinger Bahnhofes Aufstellung nehmen mußten. Welcher Schrecken mag in ihre Glieder<br />
gefahren sein, als noch am selben Tage die Nachricht von der furchtbaren Niederlage der<br />
Bauern bekannt wurde, als die siegestrunkenen Söldner ihre Wut an den Flüchtigen austobten,<br />
als die Nachbardörfer in Rauch aufgingen und in allen Orten erbarmunglose Strafgerichte<br />
abgehalten wurden."<br />
Die Niederlage der Bauern war dem Heer des Schwäbischen Bundes unter Georg Truchseß<br />
von Waldburg, dem "Bauernjörg", zuzuschreiben. Die Schlacht am Goldberg war eine der<br />
blutigsten des Bauernkrieges, 2500 Bauern wurden allein dort niedergemacht. Auch<br />
andernorts wurden die schlecht ausgerüsteten, zersplitterten Bauernheere, die ohne<br />
einheitliche Führung blieben, geschlagen.<br />
Wegen der Teilnahme am Bauernkrieg sollten die Dörfer des Merklinger Amtes, Merklingen,<br />
Gechingen, Althengstett, Simmozheim und Hausen gebrandschatzt werden. Nur durch die<br />
21
Zahlung von 700 Gulden an den Profos des Bundesheeres, Berthold Aichelin, konnte dies<br />
verhindert werden.<br />
Württemberg<br />
Das Kloster Herrenalb, zu dem Gechingen gehörte, stand seinerseits unter der<br />
Schirmherrschaft des Herzogs von Württemberg. Der vertriebene Herzog Ulrich sah seine<br />
Chance, sein Land zurückzugewinnen, darin, daß er den evangelischen Glauben annahm und<br />
sich dem Bund evangelischer Fürsten und Städte (Schmalkaldischer Bund) anschloß. Mit<br />
seiner Hilfe eroberte er 1534 sein Land zurück und führte in Württemberg die Reformation<br />
ein. Dabei wurde, neben vielen anderen, auch das Kloster Herrenalb nach erheblichem<br />
Widerstand säkularisiert, d. h. verweltlicht, seine Einkünfte wurden dem Landesvermögen<br />
zugeschlagen. Gechingen wurde damit württembergisch und evangelisch (Siehe "Zeugen").<br />
Neu erworbene Territorien wurden aber nicht einem der damals vorhandenen<br />
württembergischen Ämter, wie Calw, Nagold, Neuenbürg, Wildberg, Wildbad oder Zavelstein<br />
eingegliedert, sondern dem Land als neue Ämter eingefügt, so auch das Klosteramt Herrenalb.<br />
An seiner Spitze stand nun ein evangelischer Prälat. Gechingen blieb also beim Amt<br />
Merklingen, zu dem auch Hengstett, Simmozheim, Mühlhausen, Schlehdorn, Münklingen,<br />
Cröwelsau, Lehningen, Neuhausen und Hausen gehörten, bis 1808 unter König Friedrich die<br />
Oberämter neu geordnet wurden.<br />
In den geistlichen Ämtern fanden regelmäßig Versammlungen der Schultheißen statt, bei<br />
denen die Anliegen der Dorfgemeinden den Repräsentanten im Landtag, zu denen auch der<br />
Prälat von Herrenalb gehörte, vorgetragen werden konnten. Ein eigentliches Mitspracherecht<br />
bestand freilich nicht.<br />
In der ersten Zeit der württembergischen Herrschaft wurde der <strong>Gechinger</strong> Schultheiß Lorenz<br />
Reißer mit drei Ratsangehörigen nach Böblingen befohlen, um Auskunft über die <strong>Gechinger</strong><br />
Wälder zu geben. Der Besitz des ausgedehnten Gemeindewaldes wurde den <strong>Gechinger</strong>n dort<br />
bestätigt (siehe auch "Der Wald").<br />
1536 gründete Herzog Ulrich das evangelische Stift in Tübingen, das vor allem der<br />
Ausbildung evangelischer Pfarrer dienen sollte - es wurden damals viele gebraucht. Im Stift<br />
wurden von Anfang an begabte, aber wenig begüterte junge Männer aus dem ländlichen Raum<br />
kostenlos ausgebildet. Ein Absolvent aus Gechingen war später Karl F. Brackenhammer.<br />
(Siehe: „Einzelne Persönlichkeiten“).<br />
1547-48 kam Unglück über das Land. Kaiser Karl V., der sich als Schirmherr des<br />
katholischen Glaubens sah, wollte sich gegen Herzog Ulrich und die anderen evangelischen<br />
Fürsten durchsetzen. Es kam zum schmalkaldischen Krieg, in dem die Protestanten<br />
unterlagen. Auch Gechingen wurde in Mitleidenschaft gezogen.<br />
„Nota aus dem <strong>Gechinger</strong> Zinsbuch von 1547-1703: Des gemeldeten Siebenundvierzigsten<br />
Jahr im Monat Januar, als es sehr kalt war, hat Kaiser Karolus der Fünfte durch die Spanier<br />
und Italiener das Land Württemberg hingenommen, dasselbige geplündert und durch eine<br />
streifende Rotte rauben lassen. Gott wolle uns auch fürhin vor Übel bewahren. Amen.“<br />
In Gechingen richteten kaiserliche Soldaten einen Schaden von 28555 Gulden an.<br />
Erst unter Ulrichs Sohn und Nachfolger, Herzog Christoph (1550-1568), der ein fähiger und<br />
gewissenhafter Fürst war, konnte ein Ausgleich zwischen der neuen und der alten Kirche<br />
gefunden werden.<br />
Zurück zu anderen Heimsuchungen, von denen um diese Zeit aus Gechingen berichtet wird:<br />
Im Jahr 1571 war der Winter so streng, daß sogar das Wasser in den Brunnen gefror.<br />
Immer wieder traten Pestepedemien auf. 1594 starben allein in Tübingen 950 Personen an der<br />
Pest. Die Universität wurde teils nach Calw und teils nach Herrenberg verlegt.<br />
22
Aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts stammt das "Neu Buch, in dem ihre Gebräuch<br />
beschrieben sind", das sogenannte Fleckenbuch. Es ist noch heute eine Fundgrube für<br />
Forschungen. Über das "Alt Buch" ist nichts bekannt. Man kann davon ausgehen, daß die<br />
"Gebräuch" auf alte Überlieferungen zurückgehen.<br />
Mit der großen Kirchenordnung, die Herzog Christoph 1559 schuf, und die die Schulordnung<br />
einschloß, sollte unter anderem der Analphabetismus auf dem Lande durch Schule und Kirche<br />
bekämpft werden.<br />
1552 verfügte Herzog Christoph dann die Gleichberechtigung der Kinder bei Erbteilungen<br />
(Realteilung). Das führte später zu einer völligen Zersplitterung des bäuerlichen Besitzes in<br />
Altwürttemberg.<br />
Im Dreißigjährigen Krieg<br />
Im Buch "Heimat Gechingen" von K. F. Essig sind alle Kriegsschicksale unserer Gemeinde<br />
im Dreißigjährigen Krieg (1618-48) ausführlich und genau beschrieben, so daß sich hier eine<br />
Wiederholung erübrigt. Es sollen hier nur Zusammenhänge hergestellt und Ergänzungen<br />
eingefügt werden.<br />
Zunächst blieb unser Ort von den Kriegswirren weitgehend verschont. Erst als König Gustav<br />
II. Adolf von Schweden, der die Sache des Protestantismus hatte retten wollen, gefallen war,<br />
begann für Württemberg das wahre Elend des Krieges. Nach der furchtbaren Niederlage der<br />
evangelischen Seite in der Schlacht bei Nördlingen am 6. Sept. 1634, in der allein viertausend<br />
württembergische Bauern ums Leben kamen., strömten die Reste des geschlagenen Heeres<br />
samt seinen Verfolgern ins Württembergische und verwüsteten und plünderten das schutzlose<br />
Land, wobei es keine Rolle spielte, ob es sich um Verbündete oder Gegner handelte. Herzog<br />
Eberhard III. floh. Calw wurde niedergebrannt, viele Bewohner umgebracht.<br />
Hier sei ein Kinderreim eingefügt, der sich aus dieser Zeit erhalten hat und die Schrecknisse<br />
des Krieges beschreibt:<br />
"Der Schwed isch komma,<br />
Mit Pfeif on Tromma,<br />
Hot älles wegg´nomma,<br />
Hot Fenster naus g´schlaga,<br />
Ond Blei davo traga,<br />
Hot Kugla draus gossa<br />
Ond Baura verschossa."<br />
Ein andrer Kindervers aus Calw nennt sogar namentlich, wenn auch verballhornt, Axel<br />
Oxenstjerna, den schwedischen Reichskanzler, als eine Art Schwarzen Mann:<br />
"Bet, Büable, bet!<br />
Morge kommt der Schwed<br />
Morge kommt der Ochsestearna<br />
Wird mei Büable bete learne,<br />
Bet, Büable, bet!"<br />
Durch die allgemeine Verheerung entstand eine Hungersnot. Ihr folgte die Pest, die auch in<br />
Gechingen wütete. Nach einer Lücke im Totenbuch nimmt Pfarrer Ulrich Kengel die<br />
Eintragungen am 17. August 1635 wieder auf. In den Tagen zwischen 17. - 21. August 1635<br />
starben 21 Menschen und so geht es seitenlang weiter, oft sind es fünf Todesfälle pro Tag.<br />
Besonders erschütternd die Totenliste der Familie des Jakob Brackenhammer. Im<br />
August/September 1635 starben folgende Angehörige an der Pest:<br />
Die Eltern:<br />
Jakob Brackenhammer, *14.4.1579 +14.9.1635<br />
Agatha geb. Knoll *22.3.1579 +18.8.1635<br />
23
Die Kinder:<br />
Anna *23. Trin. 1604 +20.8.1635 oo1628 Hans Ziegerer<br />
Katharina *14.8.1607 +20.8.1635<br />
Barbara *9.5.1615 +7.9.1635<br />
Ursula *14.5.1621 +6.9.1635<br />
Jakob *1623 +19.8.1635<br />
1635 trat auch Frankreich auf der Seite der Schweden und der Evangelischen aktiv in den<br />
Krieg ein. Württemberg war bis zum Ende des Krieges Durchzugsland, Quartier und<br />
Schlachtfeld für Schweden und Franzosen auf der einen, Kaiserliche und Bayern auf der<br />
anderen Seite. Sie hinterließen ein trostlos verwüstetes Land. Von den <strong>Gechinger</strong>n wird<br />
berichtet, daß sie mehrmals in die Wälder flüchten mußten, 1647 suchten sie sogar in Calw<br />
Schutz.<br />
Nach Kriegsschluß wurde Bilanz gezogen: "Es liegen noch wüst 610 Morgen Land, 26 Häuser<br />
und 10 Scheuern sind abgebrannt oder abgebrochen, 97 Bürgerfamilien fehlen oder sind tot."<br />
42 Familien waren noch übrig. Von diesen schweren Verlusten hat sich Gechingen nur<br />
langsam wieder erholt, 1834 zählt man 1107 Einwohner gegenüber schätzungsweise 1400 vor<br />
1618.<br />
Im "Handbuch Baden-Württemberg" von W. Boelcke heißt es: "Die Bevölkerung<br />
Württembergs betrug 1639 nur noch ein Viertel der Vorkriegszeit".<br />
Ein Kaufbrief von 1652 aus Gechingen berichtet von "höchster Kriegsdrangsal":<br />
"12.März 1652. Wir Schultheiß, Bürgermeister und Gericht zu Gechingen, Merklinger Amtes<br />
bekennen hier mit dieser Schrift, daß wir dem hochedel geborenen, gestrengen Herrn Jakob<br />
Friedrich Buwinghausen auf Zavelstein, wieder käuflich abgehandelt haben unser und<br />
Gemeindeflecken durch unser zu Gechingen Wiesental gegen Deufringen fließendes<br />
Fischwasser samt der darob gelegenen Schafweide mit Haselgesträuch und Büschen, der Berg<br />
genannt, an dem Döffinger Pfad hinstreichend, wie solches alles rund eingesteint ist. Vor<br />
etlich Jahren, in unser höchsten Kriegsdrangsal gegen den auch hochedlen, ehrbaren,<br />
gestrengen Herr Jakob Bernhardt von Gültlingen zu Deufringen, Oberstleutnant in kaiserlicher<br />
Majestät Proviantfouragedirektion und Generalproviantmeister, verkauft gehabt haben und ist<br />
hierüber der Kauf mit ihrem gestorbenen Jakob Friedrich als welchen sie durch Erbstreit<br />
gelangen, wieder geschehen für und um 135 Gulden. Darum auf nächst kommenden Tag<br />
Bartholomä dieses laufenden Jahres 1652 zu bezahlen 45 Gulden, desgleichen auf erst<br />
gemeldeten Termin im Jahr 1653 weitere 45 Gulden samt 2 Gulden 15 Kreuzer Zins. Und<br />
dann in Anno 1654 auf solche Zeit wieder 45 Gulden und 2 Gulden 15 Kreuzer Zins. Hierauf<br />
nun so gerade und versehen wir bei unserer Treu und Glauben, solche 135 Gulden samt dem<br />
hierbei zustehenden Zins auf vorgesetztem Termin zu seiner Ihrer gestrengen Sicherhänden<br />
nach Zavelstein oder Calw an welchen Ort wir möchten beschieden werden, ohn all Dero<br />
Kosten und Schaden zu liefern und einzuhändigen. Dessen zu wahren und zu halten geben wir<br />
die Eingangs bei diesem Schreiben berichteten und selbst eigenhändig mit Tauf und Zuname<br />
unterschreiben. Gechingen den 12 März 1652. Gericht Schultheiß Hans Schneider Hans<br />
Brackenhammer Martin Schneider Bürgermeister Paulus Abermann Jörg Wohlpold."<br />
Gechingen hat also damals, um auferlegte Kriegssteuern und Abgaben bezahlen zu können,<br />
dieses beschriebene Land verkauft und nach dem Krieg wieder erworben.<br />
Nach dem Dreißigjährigen Krieg bis zu Herzog Karl Eugen<br />
Im Westfälischen Frieden, 1648, erhielt Eberhard III. sein entvölkertes, verödetes und völlig<br />
verarmtes Land wieder zurück. Im Lauf des Jahres 1649 zogen die letzten Heerhaufen ab.<br />
Schon 1646 mußte Johann Valentin Andreae, der spätere Hofprediger, der die Einäscherung<br />
Calws miterlebt hatte, gegen die Verwahrlosung des Volkes durch den Krieg angehen. Auf<br />
24
seine Initiative geht der Kirchenkonvent zurück, ein Gremium, in dem unter Vorsitz von<br />
Pfarrer und Schultheiß von der Sonntagsentheiligung bis zu Lichtstubenausgelassenheit und<br />
Völlerei, Trinken und Fluchen - die Aufzählung ließe sich verlängern - alles verhandelt und<br />
geahndet werden sollte, das der Obrigkeit nicht genehm war. Der Kirchenkonvent bestand bis<br />
weit ins 19. Jahrhundert hinein.<br />
Nachdem schon unter Herzog Christoph die Volksschulen eingeführt worden waren, galt ab<br />
1648 die allgemeine Schulpflicht, auch für Mädchen.<br />
Calw war schon vor dem Krieg ein bedeutender Handelsplatz gewesen. Die Wolle der Schafe<br />
aus dem Hecken- und Schlehengäu wurde zu Tuch verarbeitet, für das die Calwer Kaufleute<br />
selbst in Italien noch Abnehmer hatten. Ein loser Zusammenschluß der Calwer Handelsherren<br />
bestand schon vor dem Krieg. 1650 vereinigten sich dann die Färber und Kaufleute zur<br />
Calwer Compagnie. Schon seit den Anfängen des Tuchhandels hatten <strong>Gechinger</strong> Weber und<br />
Zeugmacher für die Calwer Herren gearbeitet; an diese Tradition wurde wieder angeknüpft.<br />
Der Wiederaufbau nach dem Dreißigjährigen Krieg war in Gechingen wie überall langsam<br />
und mühevoll. Grundsätzlich erholten sich aber die Dörfer rascher als die Städte und waren<br />
zunächst finanzkräftiger. Ab dieser Zeit nahmen sich die meisten Gemeinden das Recht, ihren<br />
Schultheißen selber zu wählen. Von Stuttgart aus wurden diese Bestrebungen der Dörfer, auch<br />
ein Mitspracherecht zu bekommen, eher gefördert.<br />
Im Forstlagerbuch von 1681 erschien zum erstenmal ein Bild von Gechingen.<br />
Die allgemeinen Verhältnisse waren aber immer noch recht unsicher. Das deutsche Reich war<br />
zerfallen, Frankreich dagegen war reich und mächtig. In dieser Phase begann der französische<br />
König Ludwig XIV. mit seinen Eroberungskriegen, unter denen Württemberg sehr zu leiden<br />
hatte. Von 1667-1697 fanden immer wieder Vorstöße in deutsches Gebiet statt. Im ersten<br />
dieser Feldzüge fielen plündernde französische Soldaten in Gechingen ein und nahmen mit,<br />
was sie kriegen konnten.<br />
Auch im zweiten französischen Raubkrieg im Jahre 1692 mußten die Bewohner leiden. Calw,<br />
schon im Dreißigjährigen Krieg zerstört, wurde 1692 erneut niedergebrannt, ebenso Hirsau. In<br />
Gechingen wurde geplündert, und ein Einwohner kam ums Leben.. "Ist Hans Schneider<br />
22.8.1693 Bauer und Zeugmacher in dem Französischen Einfall von den Soldaten im Wald<br />
erschossen worden."<br />
Die Bauern hatten schon immer geklagt über Ernteschäden durch übermäßige Wildhege, aber<br />
im ausgehenden 17. und das ganze 18. Jahrhundert hindurch gab es ständig Berichte von so<br />
starkem Wildschaden auf den Feldern, daß der Verlust der ganzen Ernte durch das<br />
pflanzenfressende Wild drohte. Zwar mußte man sich nicht mehr vor reißenden Tieren<br />
fürchten, Bären gab es seit dem 16. Jahrhundert nicht mehr, und im 17. Jahrhundert waren<br />
auch die Wölfe ausgerottet, aber die Bauern bangten um ihre wirtschaftliche Existenz. Um<br />
1700 mußten in Gechingen während eines Sommers 30 Mann 47 Nächte lang das Wild hüten,<br />
dennoch wurden die Felder völlig zerstört. Den Schaden mußte die Gemeindekasse bezahlen.<br />
Dazu kam es vor, daß die Bauern, auch während der Ernte, wochenlang bei mangelhafter<br />
Verpflegung Jagdfron leisten mußten.<br />
In krassem Gegensatz dazu ließ Herzog Eberhard Ludwig Schloß und Stadt Ludwigsburg<br />
erbauen. Der Hof versuchte auf jede Art, sich zu bereichern, während das Land Not litt. Kein<br />
Wunder, daß die Menschen ihre Hoffnung auf ein besseres Jenseits setzten, ab 1720 breitete<br />
sich der Pietismus im Lande aus.<br />
Die Willkürherrschaft der Barockfürsten wirkte sich überall aus. Die Abgaben waren hoch,<br />
Bauernsöhne wurden zu den Soldaten gepreßt und buchstäblich verkauft, Soldatenhandel war<br />
zur beliebten Einnahmequelle der Landesfürsten geworden. Auch von Mißernten und<br />
Hungersnöten wird immer wieder berichtet, ganz schlimm war es wohl 1713.<br />
25
In Gechingen forderte am 5. 7. 1733 ein Hochwasser drei Menschenleben; die Wassermassen<br />
müssen so schnell hereingebrochen sein, daß zwei Frauen, die gerade im Stall waren, sich<br />
nicht mehr in Sicherheit bringen konnten. ein Ehemann ertrank, als er nach seiner Frau sehen<br />
wollte. Eine Scheuer wurde fortgerissen.<br />
Der damalige Pfarrer Pommer verfaßte darüber folgendes Gedicht:<br />
"Hier schau, der du hier durchpassierst,<br />
Was sich hier zugetragen,<br />
Wenn du durchs ganze Land marschierst<br />
Kannst andern davon sagen:<br />
Als Gott der Herr dreizehnmal<br />
Das Dorf mit Wasser überall<br />
Und Wassergüssen füllet.<br />
Als man zählt das 33. Jahr und 17hundert,<br />
Den 9.Juli, glaubts fürwahr,<br />
Geschah, was man bewundert.<br />
Das erste Wasser einherschoß,<br />
So gings auf diese Häuser los,<br />
Es reichte diese Höhe.<br />
Drei Menschen wurden gleich ersäuft<br />
Und hin- und hergeschwemmet,<br />
Und da das Wasser kaum entläuft<br />
Die Scheuer am Haus zertrümmert.<br />
Daß dies dem Dorf und unserm Land<br />
Nichts Guts bedeut, ist wohlbekannt,<br />
Gott helf uns überstehen."<br />
Eine Tafel mit diesem Gedicht hing lange Zeit an einem Haus beim Gasthaus Lamm (neben<br />
einer Wassermarke).<br />
Über die Abgaben um 1725 erfahren wir Näheres aus dem Zinsbuch von Gechingen:<br />
"Gächingen Hauptrechte und Fäll von eingesessen leibeigenen Leuten. Von einer jeden<br />
Mannsperson zu Gächingen gesessen dem Kloster Herrenalb mit Leib angehörig, wann sie mit<br />
Tod abgegangen ist, so gefällt bemeldetem Kloster allwegen von Hundert Pfund Werts seines<br />
eigenen verlassenen Guts 1 Gulden in Münz Landeswährung. Und von einer abgestorbenen<br />
leibeigenen Frauensperson gefällt dem Kloster Herrenalb allwegen von Hundert Pfund Wert<br />
ihres eigenen verlassenen Guts zu Hauptrecht 14 Schilling Heller Landeswährung. Eine jede<br />
Frauensperson dem Kloster Herrenalb mit Leib angehörig zu Gächingen gesessen, gibt<br />
gemeldetem Kloster jährlich, solang sie lebt, eine Leibhenne, die werden von ihnen für das<br />
Kloster eingefangen. Wenn sie Kindbetterin ist, wird ihr für dieses Jahr die Abgabe der<br />
Leibhenne erlassen. Auf St. Martinstag seien die von Gächingen schuldig und pflichtig, dem<br />
Kloster zu zahlen 60 Pfund Heller Landeswährung. Ein jede Mannsperson gibt jährlich Steuer<br />
4 Kreuzer 2 Heller. Ewig unablösiger Hellerzins und Haber, genannt Futterhaber auf Martini,<br />
alte Hennen auf die Fastnacht, junge Hühner auf Johannis Babtiste, und Käs auf Walburgis,<br />
auf Häuser, Scheuren, Hofraiten und Gärten fallend."<br />
Das Kloster besaß zu dieser Zeit vier erbliche Höfe mit den ewigen unablösigen Zinsen und<br />
Gülten: "Erster Hof: Michael Bock, Wagner, als Träger und mit ihm Hans Jakob Ginader,<br />
jung Hans Jakob Eisenhardt, jung Jakob Krauss, Michael Gehring, Hans Jakob Mitschelen,<br />
Georg Dreher, Hans Jörg Kielwein und Hans Quinzler haben innen und besitzen einen Hof in<br />
26
Zwängen und Bannen zu Gächingen gelegen, der ist der Inhaber Erbgut und gnädigster<br />
Herrschaft Württemberg von wegen des Klosters Eigentum, daraus Zinsen und geben sie<br />
jährlich auf St. Martin. Zweiter Hof: Hans Bock, Hans Michael Bock, Hans Jörg<br />
Brackenhammer, Hans Jörg Heim, Hans Leonhard Gehring alt, Hans Jakob Ginader jung,<br />
Jakob Gräber, Leonhardt Heim. Dritter Hof: Jung Jakob Gräber, Jakob Schumacher, Hans<br />
Jörg Brackenhammer. Hans Hauptmann(?). Vierter Hof: Hans Breitling."<br />
Einige Jahre später erscheint ein neuer Hof: "Ein Haus, Scheuer und Hof zwischen Adolf<br />
Riehm und der Allmand gelegen, stößt vorne auf die Gemeindegasse und hinten auf den<br />
Calwer Weg." (Vermutlich Appeleshof).<br />
Im österreichischen Erbfolgekrieg 1740-1748 war Württemberg Durchzugsland kaiserlicher<br />
und französischer Truppen. Auch nach Gechingen kamen immer wieder fremde Soldaten,<br />
plünderten und drangsalierten die Einwohner. Im Fleckenbuch steht ein Bericht aus dem Jahre<br />
1741: "An diesem Tag marschierte der Franzos mit vierzigtausend Mann durch das<br />
württtemberger Land, hielt sein Lager bei Mönsheim und Ditzingen, geradewegs dem<br />
Bayernland zu. Hiesiger Ort mußte 6 Wannen Heu und 300 Büschel Stroh leisten, sonsten<br />
hatten wir wenig Beschwernis. Man hielt gutes Commando, als daß man alle Tage 8<br />
Handfröhner und 2 Postpferde ins Lager stellen muß. Der Scheffel Kernen gilt 10 Heller, der<br />
Scheffel Dinkel 4 Heller und die Maß Wein 12-16 Kreuzer. An diesem Tage hatten wir noch<br />
nicht fertig geerntet. Zelg Angel hatte Winterfrucht und wenn es würde eine halbe Ernte, dann<br />
durch den lang anhaltenden Winter, würde ihm der Mai nicht bringen Sonnen, so daß man<br />
meinte, es werde in diesem Jahr gar kein Ende geben. Gott erhalte uns und gebe uns Frieden,<br />
wie Er es uns bescheret hat und daß wir daselbe zu Haus mit unserem schuldigsten Dank<br />
sagen müssen."<br />
1744 erlangte der damals 16jährige Carl Eugen die Herzogswürde. Er war ein launischer,<br />
prunkliebender Fürst, der das Volk noch rücksichtsloser auspreßte als seine Vorgänger.<br />
1772 zählte Gechingen 500 Seelen, der Ort hatte sich also vom furchtbaren Aderlaß des<br />
Dreißigjährigen Krieges noch nicht erholt. 1770 und 1790 herrschten wieder katastrophale<br />
Hungersnöte. Die Calwer Compagnie hatte durch die dauernden Kriegswirren wichtige<br />
Märkte verloren, außerdem war das Unternehmen durch neuartige Web- und Spinnmaschinen<br />
in England so unter Kostendruck geraten, daß es sich nimmer dagegen durchsetzen konnte<br />
und 1797 aufgelöst wurde.<br />
Während seiner langen Regierungszeit besserte Karl Eugen seine Finanzen durch<br />
Soldatenhandel auf; vom Kapregiment, das er an die Holländer verkaufte und das in Südafrika<br />
eingesetzt wurde, weiß man, daß auch einige <strong>Gechinger</strong> dabei waren.<br />
In Frankreich kam es 1789 zur Revolution. Ab 1793 - dem Todesjahr Herzog Karl Eugens -<br />
gab es vier Kriege europäischer Mächte in wechselnden Koalitionen, erst gegen das<br />
revolutionäre Frankreich, dann gegen Napoleon, der im postrevolutionären Frankreich die<br />
Macht an sich gerissen hatte. Kein Wunder, daß einige der durch Kriegswirren, Hungersnöte,<br />
hohe Abgaben und Wildschaden so schwer betroffenen und rechtlosen Einwohner Gechingens<br />
nur in der Auswanderung eine Alternative sahen. Als Friedrich II. von Preußen (der "Alte<br />
Fritz") Siedler für das menschenleere Westpreußen suchte, waren unter den ca. 6000<br />
Württembergern, die seinem Rufe folgten, auch 96 <strong>Gechinger</strong> (Siehe "Auswanderer").<br />
Napoleonische Zeit<br />
Unter den Koalitionskriegen hatte auch Gechingen zu leiden. Wieder wurde Württemberg<br />
zum Durchzugsland. Mehrmals nahmen fremde Truppen in Gechingen Quartier und mußten<br />
verpflegt werden.<br />
27
Am 14.7.1796 kamen zwölf französische Husaren ins Dorf. Wir wissen aus Aufzeichnungen<br />
Pfarrer C. H. Klingers, daß sie höflich von ihm empfangen wurden. Sie aber beschlagnahmten<br />
sein Pferd im Wert von 18 Louisdor. Auch ein Bürger mußte seines hergeben, das 14 Louisdor<br />
wert war. Pfarrer Klinger berichtet weiter: "Ein einzelner Husar zog mich in ein besonderes<br />
Gäßchen, setzte mir eine geladene Pistol auf die Brust und entwendete mir meine versteckte<br />
goldene Uhr im Wert von 55 Gulden. Auch dem Müller, der eine halbe Viertelstunde vom<br />
Dorf entfernt wohnt, wurden gewaltsam 112 Gulden bares Geld geraubt. Es wurde aber im<br />
ganzen Ort niemand verletzt oder mißhandelt."<br />
Eine österreichische Feldwache zwischen Gechingen und Stammheim wurde 1796 von den<br />
Franzosen überfallen, Ostelsheim von ihnen geplündert. Pfarrer Klinger schrieb darüber:<br />
"Während der Kriegsunruhen wurden meist alle Gottesdienste gehalten, außer am 17.7.1796<br />
konnte die Kinderkirche nicht stattfinden, weil über 100 Franzosen einrückten und plündern<br />
wollten. Sie wurden aber von den Bürgern alsdann zurückgedrückt." Solange etwa 1000<br />
Franzosen an der Gemeindegrenze lagerten, wurden die Glocken nicht geläutet. Der Pfarrer<br />
nahm sich seiner Gemeinde mit Rat und Tat an.<br />
Immer wieder wurde Gechingen auch in den folgenden Jahren von kriegerischen<br />
Auseinandersetzungen berührt. Österreichische, kaiserliche und französische Truppen waren<br />
in der Nähe. Im Winter 1797/98 lagen 867 russische Soldaten 64 Tage lang im Ort in Quartier.<br />
Bezeichnend für die Zeit ist ein Lied. Nach der Melodie "Guter Mond, du gehst so stille"<br />
gesungen, machte es seine Runde über die Jahrmärkte und wurde von Hausierern durch das<br />
ganze Land getragen:<br />
"Auch in kaltem Schnee und Winter<br />
Wird der Krieg noch fortgemacht,<br />
Wo die Herden, Schaf und Rinder,<br />
Menschen werden hingeschlacht,<br />
Daß das Blut den Schnee tut färben,<br />
Wieviel Tausend hat verwundt,<br />
Müssen auf dem Schlachtfeld sterben<br />
Und gehn durch den Krieg zugrund."<br />
Der spätere Prälat Karl Friedrich Brackenhammer kam 1810 in der <strong>Gechinger</strong> Mühle zur<br />
Welt.<br />
Königreich Württemberg<br />
Als Napoleon I. ganz Süddeutschland besetzt hielt, kam es zu großen Veränderungen. Herzog<br />
Friedrich von Württemberg verbündete sich mit Napoleon. Dafür erhielt er großzügige<br />
Gebietserweiterungen aus den vorderösterreichischen Landen, reichsstädtischen, geistlichen<br />
und reichsfürstlichen Gebieten und wurde 1806 zum König von Napoleons Gnaden berufen.<br />
Das Königreich Württemberg war doppelt so groß wie Altwürttemberg und hatte ganz<br />
unterschiedliche Strukturen. Friedrich organisierte erst die neuen Gebiete in einer straffen,<br />
vereinheitlichten Verwaltungsgliederung, in der alle Elemente der Selbstverwaltung entfielen,<br />
auch in den Gemeinden (1803). 1805 wurde in Altwürttemberg die Verfassung aufgehoben,<br />
die Verwaltung ebenfalls zentralisiert, der Landtag aufgelöst.<br />
"Die Aufhebung der landständischen Verfassung Altwürttembergs und die Neuorganisation<br />
des jungen Königsreichs führte ab 1806 in wenigen Jahren zu einer völlig neuen Gliederung<br />
und zu einem weitgehenden Strukturwandel der Verwaltungsbezirke. Die absolutistische<br />
Regierung König Friedrichs wollte größere Bezirke. Damals bildete man die königlichen<br />
Oberämter Calw, Nagold und Neuenbürg." (Prof. Dr. Grube). Nach jahrhundertelanger<br />
Zugehörigkeit zum Merklinger Klosteramt kam Gechingen nun zum Oberamt Calw (1808).<br />
28
Damals wurde in Württemberg die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Als Verbündeter<br />
Frankreichs mußte König Friedrich für die Feldzüge Napoleons Soldaten stellen, so auch beim<br />
Rußlandfeldzug 1812. Von Gechingen waren folgende Männer dabei: Johann Michael Bock,<br />
Jakob Adam Breitling, Simon Friedrich Gehring, Johann Martin Gehring, Georg Simon<br />
Gehring, Georg Ludwig Gräber, Jakob Gräber, Christian Heinrich Süsser, Johann Michael<br />
Süsser, Johann Michael Riehm, Johann Jakob Rüffle, Johann Michael Rüffle, Johann Jakob<br />
Kühnle, Johann Jakob Gehring und ein Wagner, über den Näheres nicht bekannt ist. Nur<br />
Jakob Kühnle, Johann Jakob Gehring und der Wagner kehrten zurück. Insgesamt kamen von<br />
15 800 württembergischen Soldaten nur 500 wieder. Die Niederlage Napoleons in Rußland<br />
leitete das Ende der französischen Vorherrschaft in Europa ein. Es gelang König Friedrich<br />
aber, den Gebietsgewinn und den Königstitel zu behalten.<br />
Wie genau und bis in die letzte Einzelheit im Königreich Württemberg alles reglementiert<br />
war, zeigt das kuriose Protokoll über die Spatzenköpfe, das sich aus dieser Zeit in Gechingen<br />
erhalten hat:<br />
"Gechingen Calwer Oberamt, Spatzen-Consignation, von Georgi 1813-1814. Hiebei wird<br />
vordersamt prämittiert, daß vermöge des unterm 6ten Juni 1789 in das Land ergangenen<br />
gnädigsten Befehls wegen der immer häufiger überhandnehmenden, der Landwirtschaft<br />
schädlichen Spatzen zur Ausrottung derselben ein jeder Bürger 1 Dutzend Spatzenköpfe<br />
liefern, und bei der Lieferung aus der Bürgermeisterkasse 6 Kreuzer erhalten, diejenigen aber,<br />
welche dieses nicht leisten würden, in eben dieselbe Kasse 12 Kreuzer zu entrichten haben<br />
sollen." Die <strong>Gechinger</strong> fingen aber keine Spatzen, sondern zahlten lieber ihre zwölf Kreuzer.<br />
Das geht aus einem weiteren Protokoll hervor: "Vermög des Empfangsbuchs von 1813-14<br />
befinden sich im hiesigen Ort 204 Bürger tut à 12 Kreuzer = 40 Gulden 48 Kreuzer. Daß<br />
heuer an Spatzengeld der hiesigen Bürgerschaft nicht mehr aufgerechnet, beurkunden pro<br />
Georgi 1814: Schultheiß und Richter in Gechingen. Johann Michael Schneider, Johann<br />
Friedrich Kappis, Johann Georg Krafft, Georg Simon Spöhr, Johann Georg Däuble, Heinrich<br />
Breitling."<br />
Auch unter König Friedrich waren die Bauern noch leibeigen, so anachronistisch das für die<br />
Zeit nach der französischen Revolution auch anmutet. Einmal wurden <strong>Gechinger</strong> Männer<br />
durch einen Reiter für morgens 7 Uhr nach Münchingen zur Treibjagd befohlen. Sie mußten<br />
in der Nacht zu Fuß nach Münchingen und der Schnee lag einen halben Meter tief. Abends,<br />
als die Jagd vorbei war, erhielten sie dann ein Stück Brot.<br />
1817 ist bei einer Überschwemmung eine Frau in Gechingen ertrunken.<br />
Schon mehrfach war in diesem Buch die Rede von Hungersnöten. Die Ursachen dieser<br />
Hungerzeiten waren einmal die vielen Kleinbetriebe, die durch Bevölkerungswachstum und<br />
die Erbteilungen entstanden waren. Das so zersplitterte Acker- und Weideland ließ keine<br />
vernünftige Bewirtschaftung mehr zu. Der Ertrag der "Äckerle" reichte für die einzelnen<br />
Familien auch in guten Zeiten kaum aus. Dazu kamen die Abgaben für die Herren und Ämter.<br />
Eine weitere Ursache waren die Kriege, in deren Verlauf von 1805 bis 1820 ständig Truppen<br />
durch das Land zogen. Franzosen, Russen und Österreicher wechselten sich ab, und alle<br />
mußten verpflegt werden. Besonders erwähnenswert sind hier die Jahre 1816/17, in ihnen kam<br />
es zur Hungerkatastrophe. Zu allen anderen Beeinträchtigungen kam noch extrem ungünstige<br />
Witterung. Schon 1811 hatten große Regenfälle die Ernte schlecht ausfallen lassen, 1812/13<br />
war es nicht viel besser. 1814 und 1815 folgten mit Mißernten. 1816 schließlich war am 2.<br />
April so starker Frost, daß die Felder nicht bestellt werden konnten und im Juli kamen starke<br />
Hagel- und Schneefälle über das Land. Anfang Oktober fiel dann schon der erste Reif. Viel<br />
konnte nicht geerntet werden, das meiste verfaulte auf den Feldern. Außerdem hatte sich eine<br />
riesige Mäuseplage ausgebreitet. So begann im Winter 1816/1817 das schlimmste Hungerjahr.<br />
Die Menschen ernährten sich von Klee, Wurzeln, Gras, Brennesseln und Beeren. Mehl war<br />
29
nahezu unerschwinglich geworden und wurde mit Holzmehl, Kleie, Treber, Heublumen usw.<br />
gestreckt. Die Teuerung erstreckte sich über den größten Teil Europas. Für die deutschen<br />
Staaten wurde viel russisches Getreide aufgekauft. Der Scheffel (8 Simri) Dinkel stieg auf 48<br />
Gulden, das Simri (ca. 22 Liter) Haber kostete 2 Gulden 40 Kreuzer, ein Simri Gerste 9<br />
Gulden, ein Simri Kartoffeln 3 Gulden 30 Kreuzer, ein Kreuzerweck wog l Lot (ca. 16,7 g).<br />
König Wilhelm I., der 1816 auf König Friedrich gefolgt war, griff ein und erließ Gesetze, um<br />
den Getreidehandel zu sichern und das Spekulantentum zu unterbinden. 1817 wurden auf<br />
Anregung des Königs und seiner sozial denkenden Gemahlin, Königin Katharina,<br />
Speiselokale für die Armen gegründet. Im April wurden die Vorräte aus den königlichen<br />
Fruchtkästen den Bauern als Saatgut zur Verfügung gestellt. Dann war endlich auch das<br />
Wetter gut, so daß man eine reichliche Ernte heimbringen konnte. Dankgottesdienste wurden<br />
abgehalten, es herrschten Jubel und Freude. Aus dieser Zeit stammt ein Erinnerungsblatt, von<br />
dem im Buch "Heimat Gechingen" auf Seite 57 berichtet wird. Es ist im Besitz der Familie<br />
Böttinger, Gartenstraße. Der Text lautet: "1817 zur dankbaren Erinnerung der Güte Gottes,<br />
welche der allgemeinen unerhörten Teuerung durch eine gesegnete Ernte ein Ziel setzte, im<br />
Jahr 1817. Herr, gib uns täglich Brot aus Gnaden immerdar! Vor Mangel, theurer Zeit uns<br />
fernerhin bewahr. Lobe den Herren! Der dein Leben vom Verderben errettet."<br />
Die Familie Schneider Hoher Angel besitzt ein Gedenkblatt, mit der Überschrift:<br />
"Merkwürdige Vorstellung auf die große Theuerung der Jahre 1816 und 1817. Kurze<br />
Übersicht trauriger Kriegsunruhen von 1790 bis in die durch allzu schreckliche Theuerung<br />
drückend eingetretenen Jahre 1816-17".<br />
Älteren Einwohnern ist noch aus Berichten ihrer Großeltern bekannt, daß beim Schulzenhaus<br />
in der Kirchstraße eine verhungerte Frau mit Heu im Mund aufgefunden worden sei. Brot sei<br />
so wertvoll gewesen, daß einige für einen Laib Brot ihre Grundstücke oder ihre Keller<br />
hergegeben hätten.<br />
Viele, vor allem jüngere Leute, faßten in dieser Hungerszeit den Entschluß, auszuwandern. Ihr<br />
beliebtestes Ziel war damals Amerika. "Die Auswanderung nach Amerika erfolgte in zwei<br />
Wellen. Die erste begann 1829 und dauerte bis 1831. Die zweite Welle fand in den Jahren<br />
1852 bis 1854 statt." (Heimberger, Fritz, Sindelfingen).<br />
König Wilhelm setzte sich persönlich für die Förderung der Landwirtschaft ein. Er gründete<br />
die Landwirtschaftliche Schule in Hohenheim und das Landwirtschaftliche Fest in Cannstatt,<br />
das heute als "Cannstatter Volksfest" weltbekannt ist.<br />
1819 gab König Wilhelm dem Land eine Verfassung, die sich an die altwürttembergische<br />
Verfassung (Tübinger Vertrag) anlehnte. 1822 wurde ein Verwaltungsedikt erlassen, das die<br />
Selbstverwaltung der Gemeinden stärkte und ihnen vor allem die Regelung von Finanzfragen<br />
überließ.<br />
Schon 1817 hatte König Wilhelm die persönliche Leibeigenschaft der Bauern aufgehoben.<br />
Abgaben an die Grundherren, die in Naturalien oder Geldzins zu entrichten waren, sollten<br />
durch eine einmalige Zahlung abgelöst werden. In Gechingen war die Bauernbefreiung 1836<br />
beendet.<br />
Nun kommen wir in die Zeit der dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts. Es war eine<br />
friedliche Epoche, die als "Biedermeierzeit" bekannt ist. Unser Land gedieh unter der<br />
segensreichen Regierung Wilhelms I. Nach dem frühen Tode Königin Katharinas hatte er sich<br />
mit Pauline, Prinzessin von Württemberg, wieder verheiratet. Wie Katharina war auch sie eine<br />
Kusine. Zu den beiden Töchtern aus der Ehe mit Katharina kamen noch drei weitere Kinder,<br />
darunter auch Kronprinz Karl.<br />
Wie draußen im Land, so wirkte sich auch in unserem Dorf die günstige Entwicklung<br />
Württembergs aus. Den <strong>Gechinger</strong>n mögen lokale Ereignisse traditionell am wichtigsten<br />
gewesen sein, aber immerhin waren die Ideen der französischen Revolution und ihre Losung:<br />
"Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" bekannt. Einerseits war man für diese Gedanken sicher<br />
30
aufgeschlossen, andrerseits stand man allem, was aus Frankreich kam, eher mißtrauisch<br />
gegenüber. Zu sehr hatten Gechingens Bewohner unter den fremden, durchziehenden Truppen<br />
gelitten - und das waren hauptsächlich Franzosen gewesen.<br />
Wenn man in der <strong>Chronik</strong> blättert, merkt man, wie einfach und anspruchslos das Leben der<br />
<strong>Gechinger</strong> zu dieser Zeit war. Profilierte Persönlichkeiten standen an der Spitze des Ortes.<br />
Das waren im geistlichen Amte die beiden Pfarrer Klinger, Christoph Heinrich (1772 - 1822)<br />
und sein Sohn (1828 - 1862). In der Amtszeit des Sohnes wurde im Jahr 1834 eine neue<br />
Schule gebaut (siehe unter "Schule"). Wegen der Feuersgefahr wurde das Backen in den<br />
Wohnhäusern verboten. Die Gemeinden richteten öffentliche Backhäuser ein, die aus Stein<br />
bestehen mußten. Schon vorher war wiederholt das Backen und Waschen in den Häusern<br />
verboten worden, so 1632 und 1679. Gechingen besaß noch aus dem 17. Jahrhundert ein<br />
Backhaus mit drei Öfen und einer Dörre, doch war es nicht mehr zu benutzen. So baute<br />
Gechingen 1839 ein neues Backhaus in der Metzgergasse.<br />
Die Kosten betrugen: Grabarbeiten 25 Gulden 40 Kreuzer, Maurerarbeiten 709 Gulden 30<br />
Kreuzer, Zimmermann 222 Gulden 5 Kreuzer, Schreiner 72 Gulden 5 Kreuzer, Glaser 28<br />
Gulden 39 Kreuzer, Schlosser 62 Gulden 26 Kreuzer, Schmied 7 Gulden 40 Kreuzer, Hafner 2<br />
Gulden, Gußeisen 36 Gulden. Das Backhaus war bis 1958 in Betrieb und wurde 1964 wegen<br />
Baufälligkeit abgerissen.<br />
Als viele Einwohner bei einer großen Grippeepedemie erkrankten, stellte die Gemeinde zehn<br />
Krankenwärter ein.<br />
Im Oktober 1845 begann mit der Eröffnung der Teilstrecke Cannstatt-Untertürkheim der<br />
geplanten Bahnstrecke Esslingen-Stuttgart-Ludwigsburg das Zeitalter der Eisenbahn auch in<br />
Württemberg.<br />
Von der Revolution 1848/49 bis 1870<br />
In den Jahren 1846 und 1847 herrschte wieder Notz durch Mißernten. 1847 kam es in<br />
Stuttgart und Ulm zu Hungerkrawallen. Im Januar 1848 regte sich überall im Land<br />
Unzufriedenheit. Mißstände, über die vorher wohl nur insgeheim "gebruttelt" worden war,<br />
wurden jetzt öffentlich angeprangert. In Stuttgart wurde in einer stürmischen Versammlung<br />
Presse,- Vereins- und Versammlungsfreiheit, Schwurgericht und Volksbewaffnung verlangt.<br />
Pfarrer Bunz bemerkt in seiner Schrift "Der Franzosenfeiertag" etwas spöttisch: "Jedes<br />
Nestchen wollte seine unblutige Revolution", aber natürlich sahen die Menschen etwaige<br />
Mißstände in ihrer nächsten Umgebung sehr genau und auch Kleinigkeiten bewirkten viel<br />
böses Blut. Wie sehr lokale und nationale Interessen sich mischten, wird deutlich in einer<br />
Adresse, die aus Calw am 6. März an den König gerichtet wurde und in der u. a. gefordert<br />
wurde: "Gebrauch nur deutscher Fabrikate, Weglassung aller Titulaturen, Sitzenlassen von<br />
Hut oder Kappe beim Grüßen, eine deutsche Handelsflotte und überseeische Kolonien."<br />
König Wilhelm I. handelte recht geschickt, indem er den Wünschen der Bürger teilweise<br />
entgegenkam. So entließ er den unpopulären Innenminister Schlayer und bildete aus<br />
Mitgliedern der Opposition im Landtag das liberale "Märzministerium". Das müssen die<br />
"neuen Minister" sein, die in der nachfolgenden <strong>Gechinger</strong> "Geheimakte" erwähnt werden.<br />
Die Geschicke der Gemeinde Gechingen leitete von 1844 bis 1848 der königliche Notar<br />
Friedrich Wilhelm Pregizer. In einer "Geheimakte" - so der Vermerk von Schultheiß Ziegler, -<br />
die jetzt zugänglich ist, wurden auch in Gechingen zum Teil ganz erstaunlich "moderne"<br />
Forderungen gestellt. Sie sei hier nach Möglichkeit im Wortlaut zitiert, soweit nicht der<br />
besseren Verständlichkeit wegen leichte Änderungen notwendig wurden. Man muß sich aber<br />
klarmachen, daß das Wort "demokratisch" damals für die meisten Leute einen negativen<br />
Beigeschmack hatte:<br />
"Im März 1848 machte sich auch in Gechingen Unruhe breit. Demokratische Ideen brachten<br />
die sonst ruhigen Bewohner in Aufregung. Es wurden Versammlungen abgehalten und<br />
31
Mißstände vorgebracht, die sich in der Hauptsache gegen Gemeindeverwaltung, Schultheiß<br />
und Ausschußmitglieder wendeten. Ihnen wurde Amtsmißbrauch und Vetternwirtschaft<br />
vorgeworfen.<br />
In einer Bürgerversammlung am 22.3.1848 wurde folgendes beschlossen:<br />
1. Zu Neubauten soll kein Holz aus den Wäldern unentgeltlich abgegeben werden, außer auf<br />
einige Stücke Eichen- und Tannenklotzholz, da mancher nur aus Luxus baut, um Geld damit<br />
zu verdienen. Das bisher kostenlose Flickholz zum Reparieren soll zu einem angemessenen<br />
Preis abgegeben werden. Dazu soll der Bauauschuß bei jedem aufnehmen, wieviel er bedarf.<br />
Das Lager für Flickholz soll ganz abgeschafft oder auf eine gewisse Menge beschränkt<br />
werden.<br />
2. Das Steineschlagen für die Straßen soll anders geregelt werden. Nur an der Stelle, an der<br />
die Steine gebraucht werden, werden sie auch geschlagen. Es soll auch nicht auf Vorrat<br />
geschlagen werden.<br />
3. Die Abrechnung der Schafweide auf die Grundsteuer soll unterbleiben und das Geld in die<br />
Gemeindekasse fließen.<br />
4. Bei jedem Verkauf soll das Verkaufsprotokoll dabei sein, damit man es gleich<br />
unterschreiben kann.<br />
5.Wie unsere neuen Minister sollen auch Beamte weniger Besoldung erhalten.<br />
6. Der Pferchmeister ist überflüssig, der Bürgermeister kann die Pferche verkaufen, da er ja<br />
das Geld unter Verrechnung bringt.<br />
7. Einen Polizeidiener brauchen wir nicht.<br />
8. Der niedere Mesnerdienst ist überflüssig, der Pfarrer braucht keinen Schütz, das<br />
Uhrenaufziehen kann ein Lehrer mit übernehmen.<br />
9. Jede Arbeit bei der Gemeinde soll öffentlich versteigert werden.<br />
10. Jede Rechnung soll veröffentlicht werden, damit alle Bürger Einsicht darin haben.<br />
11. Keiner soll mehr als ein Amt haben und an der Besoldung nachlassen.<br />
12. Jeder, der ein Amt hat, soll alle Leistungen ohne (zusätzliche?) Bezahlung versehen.<br />
13. Das hiesige Rathaus ist nur für hiesige Angelegenheiten, fremde Verwaltungsgeschäfte<br />
sollen hier nicht bearbeitet werden. Die Zusammenkünfte der Schreiber des Schultheißen<br />
dürfen nicht auf dem Rathaus stattfinden.<br />
Unterschriften: Spöhr, Georg Schautt, Johann Quinzler, Michael Schneider, Georg Quinzler,<br />
Georg Kielwein, Bosch, Wilhelm Wagner, Jakob Georg Riehm, Theurer."<br />
Punkt 3 bedarf der Erläuterung. Für die Nutzung der Schafweide wurden Gebühren verlangt,<br />
die Grundsteuer wurde dann aber um diesen Betrag erniedrigt. Die Unterzeichneten sahen<br />
darin eine ungerechtfertigte Bevorzugung der Schäfer.<br />
In die gereizte Stimmung, die damals das ganze Land ergriffen hatte, platzte die Nachricht<br />
von einem Einfall der Franzosen. Es war nur drei Tage nach der Bürgerversammlung in<br />
Gechingen, am 25. März 1848. Der 25. März war damals ein Feiertag (Mariä Verkündigung).<br />
Darüber berichtet Tillie Jäger: "Mein Großvater erlebte diese Zeit als fünfjähriges Büblein,<br />
sein Vater war der Kommandant der <strong>Gechinger</strong> Bürgerwehr. Diese Wehren hatten in ganz<br />
Württemberg höchste Alarmbereitschaft und schon im Spätherbst eifrig exerziert. Die kleinen<br />
Kerle - es waren auch noch der Maurer-Ferdinand und der Simon Rüffle, genannt der<br />
"Stelzensemme" - mit von der Partie. Wenn sie oben auf dem Hohen Angel die übenden<br />
Männer beobachteten, dachte wohl keiner von ihnen, daß sie einmal zwanzig Jahre später<br />
selbst unter den Waffen stünden in dem Bruderkrieg von 1866, wo in der Schlacht bei<br />
Tauberbischofsheim dem Simon Rüffle eine preußische Kugel das Bein zerschmetterte. Sein<br />
Kamerad, mein Großvater Jakob Friedrich Böttinger, konnte ihm nur noch zurufen: "Semme,<br />
paß uff, se kommet!" Also, davon hatten die drei noch keine Ahnung, als sie mit kleinen<br />
Steinchen nach den steifen Bauernhüten zielten. Aber was war die Ursache von all der Unruhe<br />
und Aufregung in der Beschaulichkeit des Winterdorfes? Drüben, über dem Rhein, in<br />
32
Frankreich, war seit der Revolution von 1789 keine Ruhe mehr eingekehrt. Die Losungen von<br />
"Freiheit - Gleichheit - Brüderlichkeit" ließen sich von Grenzen nicht aufhalten. So standen<br />
also die Bürgerwehren Gewehr bei Fuß, wobei allerdings die Ausrüstung mehr als mangelhaft<br />
war. So kam der 25. März 1848 heran. Plötzlich läuteten das Rathausglöckchen und bald<br />
darauf auch die Kirchenglocken Sturm. Vor dem Rathaus erscholl ein rollender<br />
Trommelwirbel. Die Stammtischgäste vom "Hirsch", "Adler", "Lamm" und "Rößle" stürzten<br />
hinaus und liefen vor das Rathaus. Frauen und Kinder kamen dazu. Wieder wirbelte die<br />
Trommel. Ein Reiter jagte den Kronenbuckel von Calw her herab und stieg vor dem Rathaus<br />
ab. Er hatte eine wichtige Meldung vom Oberamt zu bringen. Doch schon vor ihm war ein<br />
anderer Bote gekommen und hatte den Schultheißen veranlaßt, die Glocken zu läuten. Die<br />
Menge vor dem Rathaus wuchs. Gerüchte gingen durch die Versammlung, die Franzosen<br />
seien schon bei Freudenstadt. Andere wußten, sie seien schon in Altensteig. Da öffnete sich<br />
die Rathaustür und heraus trat der Schultheiß, umgeben von seinen Gemeinderäten. Alles<br />
verstummte, angstvoll hielten die Frauen ihre Kinder an den Händen. Der Schultheiß sprach<br />
mit lauter Stimme: "Bürger, ich habe euch eine ernste Mitteilung zu machen. Der Feind ist in<br />
unser Land eingefallen, schon steht er in Freudenstadt und wird auch bald Calw bedrohen.<br />
Unsere Regierung hat bereits Truppen zusammengezogen. Aber auch wir wollen unseren Teil<br />
tun, und so fordere ich alle Männer auf, sich um 3 Uhr ausgerüstet hier am Rathaus<br />
einzufinden. Johannes Böttinger wird euer Hauptmann sein!" Bravo- und Hurrarufe dankten<br />
dem Schultheißen für seine Worte. Er fügte noch hinzu: "Wer aber hier bleibt, verteidige<br />
unser liebes Gechingen." Die Menschen gingen in gemischter Stimmung auseinander. "Die<br />
schlage mir uff ´s Dach!" schrien die Mutigen, andere verschwanden schnell in ihren Häusern.<br />
Frauen flehten ihre Männer an, doch lieber nicht gegen die französischen Horden zu ziehen.<br />
Aber viele blieben standhaft und sorgten für ihre Ausrüstung. Ein Vater forderte zwar seinen<br />
Sohn zum Zug nach Calw auf, gab ihm aber zum Abschied die weise Lehre: "Des sag i dir,<br />
Gottlieb, wenn oin Franzos siehsch, no gosch durch!" Die Schmiede und Schlosser hatten<br />
Hochbetrieb im Zurichten von Waffen aller Art, wie Mistgabeln, Spießen und Sensen. Die<br />
Sensen mußten geradegestellt werden, damit man mit ihnen stechen konnte. Der<br />
Fleckenschmied fertigte eine besonders fürchterliche Waffe gegen die Franzosen. Er nahm ein<br />
Strohmesser (mit dem ein Mann seine ganze Kraft brauchte, um am Strohstuhl Stroh zu<br />
schneiden), etwa einen Meter lang, arbeitete die Klinge zu einem Spieß um und befestigte die<br />
Handhabe mit Hilfe von Schrauben und Zwingen an einer zwei Meter langen Stange.<br />
In der Zwischenzeit wurde auf dem Rathaus zwischen Schultheiß Pregizer und Kommandant<br />
Böttinger der Feldzugsplan entworfen. Zur dritten Nachmittagsstunde erschienen die Männer.<br />
Welch eine bunte Abwechslung in ihrer Ausrüstung! Pistolen, Gewehre, Mistgabeln und<br />
Sensen, krumme Säbel und kurze Messer, im Gürtel Beile und Hapen (Haumesser). Im ganzen<br />
waren es etwa dreißig Männer, die bereit waren. Der Kommandant hielt von der<br />
Rathaustreppe aus noch eine kurze Rede: "Des sen keine Soldata, des sen Reiber on Dieb !"<br />
(Gemeint waren die Franzosen!) Johannes Böttinger stellte sich an die Spitze des Zuges, und<br />
fort ging es, den Kronenbuckel hinauf und die Calwer Straße hinaus. Als sie nach Stammheim<br />
hinunterkamen, begegnete ihnen ein Fuhrwerk. Auf dem Bock saß ein Bauer und rief: "Laufet<br />
dapfer, die Franzose hen scho Altestoig azend !" Die Kriegerschar setzte ihren Marsch fort.<br />
Gegen 5 Uhr kamen sie in Calw an. Die Kunde von ihrem Eintreffen war vorausgeeilt. Am<br />
Stadteingang begrüßte sie der Stadtschultheiß und vor dem Rathaus wurde Halt gemacht. Es<br />
war für Speis und Trank reichlich gesorgt. In der Zwischenzeit war in Gechingen alles ruhig<br />
verlaufen. Die Verteidiger des Ortes standen auf ihren Posten, alles war gerüstet, aber nichts<br />
geschah. Die Bewohner legten sich zur Ruhe. Da, gegen Mitternacht, kam der Zug der Helden<br />
den Kronenbuckel herunter, es war alles nur blinder Alarm gewesen. Das war das Ende des<br />
Franzosenfeiertichs, der in der Erinnerung alter <strong>Gechinger</strong> fortlebte."<br />
33
Über den Verlauf des denkwürdigen Tages in Stuttgart kann man bei Wilhelm Seytter in<br />
"Unser Stuttgart" nachlesen. Auch da muß die Aufregung groß gewesen sein. Gelbbefrackte<br />
Postillione sprengten in kurzen Abständen vor das Ministerium des Innern, Flüchtlinge mit<br />
Fuhrwerken und Abgesandte der einzelnen Regionen, die in Stuttgart um Hilfe nachsuchten,<br />
waren zu sehen. Stuttgarts Bürger fingen an, sich zu bewaffnen. Der König dagegen sei<br />
bemerkenswert ruhig geblieben. Gerüchte von riesigen Franzosenheeren seien durch die Stadt<br />
geschwirrt, man hörte, daß Oberndorf in Flammen stünde und Horb bedroht sei. Auch in<br />
Leonberg und Böblingen sammelten sich Bewaffnete, außer mit Sensen und Äxten wollten sie<br />
mit Krautstampfern und Küchenschaufeln dem Feind zu Leibe rücken.<br />
Es muß dann einige Mühe gekostet haben, die aufgebrachten Helden davon zu überzeugen,<br />
daß alles nur blinder Alarm gewesen war, und sie wieder nach Hause zu schicken. Die<br />
Schultheißen in den betroffenen Orten, darunter Böblingen, Leonberg, Nagold, Calw,<br />
Freudenstadt, Oberndorf, Sulz, Rottweil, Balingen mußten benachrichtigt werden ( "hat ein<br />
Einfall von dem französischen Gebiete aus auf badisches und württembergisches Gebiet<br />
überall nicht stattgefunden..." hieß es laut Bunz in dem betreffenden amtlichen Schreiben).<br />
Wahrscheinlich entstand die ganze Aufregung am "Franzosenfeiertag" aufgrund bloßer<br />
Gerüchte.<br />
Ende April war in Frankfurt die aus allgemeinen, gleichen Wahlen in ganz Deutschland<br />
hervorgegangene verfassunggebende Nationalversammlung zusammengetreten.Sie<br />
formulierte zunächst die Grundrechte, die einen Polizeistaat in Zukunft verhindern sollten. Im<br />
Dezember 1848 wurden sie veröffentlicht. Als erstes Mitglied des Deutschen Bundes erkannte<br />
sie Württemberg im Januar 1849 an. Noch im gleichen Monat gab es aus diesem Anlaß ein<br />
Fest in Calw. Dabei wurden die für Württemberg wichtigsten Grundrechte im einzelnen<br />
vorgestellt. Da die deutschen Länder voneinander abweichende Verfassungen hatten - wenn<br />
überhaupt - war es schon wichtig, zu erfahren, was für die Württemberger neu war.<br />
Die etwas später erstandene Reichsverfassung sah ein Erbkaisertum vor. Friedrich Wilhelm<br />
IV. von Preußen wurde zum Kaiser gewählt. Er lehnte ab. Die Reichsverfassung wurde aber in<br />
Württemberg zunächst angenommen.<br />
Die Nationalversammlung in Frankfurt bröckelte nach dem negativen Bescheid des<br />
preußischen Königs ab, die meisten Abgeordneten traten aus. Der Rest bildete in Stuttgart das<br />
Rumpfparlament, es waren noch knapp zwanzig Prozent der ursprünglichen Versammlung. Im<br />
Juni 1849 wurde es von der württembergischen Regierung zwangsweise aufgelöst.<br />
Im Oberamt Calw fand am 5. Juli 1849 eine Abstimmung über eine verfassunggebende<br />
Landesversammlung statt. Die Landesverfassung von 1819 sollte reformiert werden. Der<br />
Abstimmungsbezirk II unter Leitung von Kommissar Pregizer aus Gechingen bestand aus den<br />
Orten Gechingen, Stammheim, Deckenpfronn, Althengstett, Dachtel, Holzbronn und<br />
Ostelsheim. Abstimmungsort war Gechingen; alle Wahlberechtigten aus den genannten<br />
Nachbarorten mußten in Gechingen ihre Stimme abgeben.<br />
Auch nach der Auflösung des Rumpfparlaments gab es genügend Liberale, die an den<br />
Grundrechten und der Reichsverfassung festhielten, die Württemberg akzeptiert hatte. Als im<br />
gleichen Jahr die Rekruten einrücken mußten, erschien im Nachrichtenblatt des Oberamtes<br />
Calw folgendes Abschiedswort: "In diesem Augenblick, in welchem ihr, teure Landsleute und<br />
Brüder, im Begriff seid, eine ernste Pflicht zu erfüllen, um zu eurer Fahne zu eilen, rufen wir<br />
euch noch ein Wort des Abschieds zu. Ihr werdet euch nimmermehr zu gesetzwidrigen<br />
Handlungen mißbrauchen lassen oder gar Befehlen gehorchen, die eine Verletzung der<br />
Verfassung enthalten, neben den Pflichten habt ihr Rechte, Grundrechte, welche die deutsche<br />
Nationalversammlung beschlossen hat. Ihr habet das Recht, Beschwerden, Bitten, bei euren<br />
Oberen, den Behörden, Ständekammern und anderen Organen des Staates vorzubringen, und<br />
zwar ohne alle Beschränkung. Ihr habt das Recht, politische Vereine zu besuchen,<br />
34
Volksversammlungen beizuwohnen, Versammlungen unter euch zu veranstalten, sofern ihr<br />
nicht in Widerspruch mit den Vorschriften der Disziplin tretet. Das heißt, sofern nicht die<br />
Ausübung eures Dienstes euch im Wege steht. Im Dienste seid ihr verfassungsmäßigen<br />
Gehorsam schuldig, außer Dienst seid ihr wie jeder andere Staatsbürger. Ihr seid Wächter und<br />
Vollzieher des Gesetzes, ihr beschützet die Freiheit und Ordnung und das Gesetz, unter dem<br />
alle stehen. Der Soldat hört niemals auf, ein Bürger zu sein. Ihr geht einer ernsten Zukunft<br />
entgegen, ihr sollt im Gebrauch der Waffen geübt, zum Kriegsdienst befähigt werden. Indem<br />
ihr euch vom häuslichen Herde trennt, um euch dem Dienste der Waffen zu widmen, erfüllt<br />
ihr eine Bürgerpflicht gegen den Staat und gegen das Vaterland. Aber ihr schwöret auch, die<br />
Verfassung heilig zu halten und euer Gehorsam ist kein blinder, sondern ein<br />
verfassungsmäßiger. Darum vergesset auch nicht euren Ursprung, bedenket stets, daß ihr aus<br />
dem Volke hervorgegangen seid und einst wieder in seine Reihen zurückkehren werdet. Der<br />
Volksverein in Calw". Über hundert Jahre in der Geschichte Deutschlands mußten vergehen,<br />
bis wieder eine Demokratie entstand, die die Soldaten als "Bürger in Uniform" bezeichnete.<br />
In Stuttgart herrschten jetzt aber Bestrebungen vor, die vorrevolutionären Verhältnisse wieder<br />
herzustellen. Auch der alte Deutsche Bund lebte 1851 wieder auf und beschloß sogleich die<br />
Abschaffung der Grundrechte, der nun auch der württembergische Landtag zustimmte. Volle<br />
Glaubens- und Gewissensfreiheit, die Möglichkeit der Zivilehe, die Bauernbefreiung und die<br />
Abschaffung der körperlichen Züchtigung blieben zwar erhalten, aber von demokratischer<br />
Freiheit war keine Rede mehr, auch die politische Einheit Deutschlands wurde nicht erreicht.<br />
Die schlechten Zeiten für die Landwirtschaft wiederholten sich. Um während der Hungerjahre<br />
die größte Not zu lindern, wollte der Kirchenkonvent 1852 in Gechingen eine Suppenanstalt<br />
einrichten. Da aber die Gemeinde der Auffassung war, der Kirchenkonvent maße sich damit<br />
den Rang der gesetzlichen Armenbehörde an, lehnte sie ab.<br />
Am 24. Mai 1854 gab es in Gechingen großen Hagelschaden und Hochwasser. In einer alten<br />
Bibel wird darüber berichtet: "Anno 1854, den 24. Mai, am Mittwochabend vor dem<br />
Himmelfahrtsfest ist ein furchtbares Donnerwetter über unsere Markung hereingekommen<br />
und besonders über das Dinkelfeld Zelg Calw und hat großen Schaden gethan. Es sind<br />
Hagelsteine gefallen, 3 Loth schwer, wie die großen Nüsse, es hat auch die Bäume arg<br />
verwundet. Auch die Klee und Wiesen, so daß man im Augenblick meinte, man müsse die<br />
Äcker wieder aufs Neue bestellen. Ist dann aber wieder alles so herrlich herangewachsen, daß<br />
man sich hat wundern müssen. Nur ist die Ernte etwas später geworden; aber alles ist wieder<br />
gut, daß man gar nichts zu leiden hatte vom Wetterschlag.<br />
Gott allein die Ehr, von ihm kommt alles her, ja, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und<br />
seine Güte währet ewiglich!"<br />
Von 1855-1857 grassierte in Gechingen das Scharlachfieber.<br />
Im Krieg 1866 zwischen Preußen und Österreich stand Württemberg Österreich bei. An der<br />
entscheidenden Schlacht bei Tauberbischofsheim nahmen die <strong>Gechinger</strong> Simon Rüffle und<br />
Jakob Friedrich Böttinger teil. (Siehe auch vorstehenden Bericht von Tillie Jäger).<br />
Werfen wir einen Blick in die Gemeinderatsprotokolle zwischen 1865 und 1870: "Die<br />
jährliche Asche vom Waschhaus, die vom Kesselfeuer anfiel, wurde um 15 Gulden und 12<br />
Kreuzer versteigert." (Siehe auch: Bauern und Bauernhäuser).<br />
"Um der Mäuseplage abzuhelfen, zahlt die Gemeindekasse für hundert tote Mäuse 15<br />
Kreuzer." - "Die Gemeinde Neuhengstett erhielt zum Bau eines Rathauses 20 Gulden." - "Im<br />
Erdgeschoß der Schule wurde eine große Brückenwaage eingebaut." - "Am Waschhaus<br />
entstand ein Mostereianbau." - "Zum Tintenlöschen wurden 4 Simri Rohrauer Sand für 36<br />
Kreuzer gekauft."-<br />
35
1863 wurde der 50. Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig (Oktober 1813), des<br />
entscheidenden Sieges über Napoleon I., auch in Gechingen festlich begangen. Auf dem<br />
Festplatz (Bergwald) war Gestrüpp und Reisig zusammengetragen und abends angezündet<br />
worden. Dabei hielt der Schultheiß eine Rede und lud die Veteranen der Befreiungskriege zu<br />
einem gemeinschaftlichen Essen ins Gasthaus "Adler" ein. Sie verzehrten laut Rechnung<br />
Speisen und Getränke im Wert von 14 Gulden und 24 Kreuzern auf Kosten der<br />
Gemeindekasse. Folgende Veteranen nahmen teil: Johann Michael Class, Michael Süsser,<br />
Friedrich Brenner, Friedrich Eisenhardt, Abraham Bock, Friedrich Ginader, Notar Pregizer,<br />
Forstwart Sattler, Jakob Ginader, Jakob Gehring, Michael Hofmaier, Jakob Kühnle,<br />
Lammwirt.<br />
Der Krieg von 1870/71 und die Folgezeit<br />
1870 kam es zum Krieg zwischen Preußen und Frankreich. Da Württemberg inzwischen mit<br />
Preußen verbündet war, mußten auch württembergische Truppen daran teilnehmen. 35<br />
<strong>Gechinger</strong> marschierten ins Feld. Drei kamen nicht wieder. Die Namen der Gefallenen sind:<br />
Johann Abraham Breitling, gefallen 2.12.1870, Willhelm Heinrich Mörk, gefallen 30.11.1870,<br />
Georg Ludwig Breitling, gestorben 26.10.1870.<br />
Die Familien der ausgerückten Soldaten bekamen von der Gemeinde pro Tag und Mann 6<br />
Kreuzer Löhnungszuschlag.<br />
Am 2. September 1870 wurde bei Sedan der französische Kaiser Napoleon III. mit seiner<br />
Armee vernichtend geschlagen. Die siegreichen Verbündeten schlossen sich zusammen und<br />
am 1. Januar 1871 wurde das zweite Deutsche Reich unter Kaiser Wilhelm I. von Preußen<br />
feierlich gegründet. Fürst Bismarck wurde Reichskanzler. Württemberg war fortan<br />
Bundesstaat des Deutschen Reiches. Der Jahrestag der Schlacht bei Sedan wurde zum<br />
Nationalfeiertag erklärt, dem Sedanstag. Tillie Jäger hat die erste Sedansfeier in Gechingen<br />
geschildert:<br />
"Auch die <strong>Gechinger</strong> wollten nach dem Krieg eine Sedansfeier und einen Sedansplatz. Man<br />
wählte einen Platz auf der Höhe im Bereich der heutigen Bergwaldsiedlung. Von wo aus gibt<br />
es einen schöneren Ausblick auf Felder und Wälder als auf dem Bergwald? In einem Kreis<br />
wurden 12 Linden gepflanzt, die sich im Lauf der Zeit ganz prächtig entwickelten. Nun wurde<br />
ein Fest abgehalten, das noch bis zur Jahrhundertwende Gesprächsstoff bot. Nicht nur<br />
Ansprachen wurden gehalten, man wollte ein richtiges Volksfest feiern mit Speis und Trank.<br />
Tische und Bänke wurden aufgeschlagen, Bierfässer und Eßwaren auf den Platz<br />
hinauftransportiert. Der nagelneue Waschkessel meiner Großmutter mußte als Gulaschkanone<br />
funktionieren. Es wurde Nudelsuppe darin gekocht, natürlich gab es auch Brezeln, Wurst und<br />
Wecken. Die zwölf Linden bekamen den Namen "Friedenslinden". Unser Pfarrer Storz war<br />
damals am 2. September 1872 noch bewegt von dem Dienst, den er während des Krieges in<br />
Gechingen zu tun hatte. Er sprach bei der Einweihung die ahnungsvollen Worte: "Wenn diese<br />
Linden sterben, wird das Reich vergehen." Die Friedenslinden waren in meiner Kinderzeit ein<br />
beliebtes Wanderziel. Einmal hatten die Linden einen großen Tag. Das war im Herbst 1913,<br />
als ganz Deutschland zusammen mit Rußland und Österreich die hundertjährige Wiederkehr<br />
der Völkerschlacht bei Leipzig feierte. Diese Feiern zogen sich über drei Tage hin. Man<br />
wollte bei den Friedenslinden ein Höhenfeuer entfachen, wie im ganzen Land. Es war kein<br />
Haus, das nicht dazu beisteuerte. Am beliebtesten waren gefüllte Holzkörbe mit Scheiten. Als<br />
die Flammen schlugen, brannten in weitem Umkreis vom Schwarzwaldrand bis zu den<br />
Steilhängen der Alb die Feuer. Über dreißig wurden gezählt. Der Festredner an jenem<br />
Oktoberabend war der Buchhändler Friedrich Essig, der Vater unseres Heimatforschers Karl<br />
Friedrich Essig. Sechs von unseren Linden mußten im April 1945 sterben, als Geschütze, die<br />
man dort oben noch in Stellung brachte, sinnlos in die Gegend ballerten !"(Tillie Jäger)<br />
36
1872 wurde die Währung in ganz Deutschland vereinheitlicht. Statt Kreuzer und Gulden gab<br />
es fortan Mark und Pfennig.<br />
Frankreich mußte nach dem Kriege an das Deutsche Reich Reparationen bezahlen, davon<br />
bekam Württemberg ca. 85 Millionen Mark. Mit diesem Geld wurden viele staatliche und<br />
kommunale Einrichtungen erbaut.<br />
1873 und 1877 gab es wieder Hochwasser, wobei 1873 einige Stück Vieh ertranken.<br />
Es war immer Aufgabe der Gemeinde, für die Ortsarmen zu sorgen. Aus dem letzten Viertel<br />
des 19. Jahrhunderts liegen genauere Angaben über ihre Anzahl und die Kosten für die<br />
Gemeinde vor. Die Ausgaben beliefen sich 1873 auf etwa 1300 Mark in Geld und<br />
Lebensmitteln. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch eine Rechnung des Barbiers<br />
Dingler aus dem Jahr 1873. Für das Rasieren eines Ortsarmen, ein Jahr lang, berechnete er der<br />
Armenpflege 5 Mark. 1895 wurden 17 Bedürftige gezählt, 1903 war ihre Zahl um etwa 23%<br />
auf 21 angestiegen.<br />
Für Gechingen und die Nachbargemeinden Stammheim, Holzbronn, Deckenpfronn,<br />
Althengstett und Ostelsheim wurde hier durch Kaufmann Unger im Auftrag der Gemeinde das<br />
traditionelle Zehrgeld für Handwerksburschen verabreicht. Um 1865/66 waren es 71<br />
Durchziehende, von denen jeder 2 Kreuzer erhielt, das waren zusammen 2 Gulden, 22<br />
Kreuzer (1Gulden = 60 Kreuzer).<br />
Kaufmann Unger hatte die Aufgabe übernommen, das Geld auszuzahlen, da das Rathaus nicht<br />
immer besetzt war. Seine Ausgaben machte er dann der Gemeinde gegenüber geltend. Die der<br />
Gemeinde Gechingen entstandenen Auslagen wurden auf die anderen Gemeinden umgelegt.<br />
Aus dem Jahr 1875 ist eine Rechnung, die er der Gemeinde vorlegte, erhalten geblieben.<br />
Offensichtlich rechnet er für zwei Jahre ab, 175 Durchziehende bekamen je 2 Kreuzer, Ungers<br />
"Provision" betrug 35 Kreuzer jährlich.<br />
Um 1884 bekam jeder Handwerksbursche einen Gutschein über 10 Pfennig ausgehändigt. Aus<br />
den Jahren 1884-86 ist aktenkundig, daß Kaufmann Unger 2605 Geschenkgutscheine à 10<br />
Pfennig ausgab und einlöste. Im Lauf der Zeit muß diese Zahl noch gestiegen sein, denn die<br />
Gemeinde ging dazu über, Unger für zwei Monate einen Vorschuß von 50 Mark zu gewähren,<br />
mit dem er dann das Zehrgeld verrechnete. Dies würde 250 Gutscheinen pro Monat<br />
entsprechen. 1897 beschlossen die sechs Gemeinden, mit der Tradition zu brechen und die<br />
Unterstützung aufzuheben mit der Begründung, daß der Zulauf immer größer werde und daß<br />
viele Herumziehende angezogen würden, die diese Gaben nur ausnützten. Wenn man sich die<br />
Entwicklung betrachtet, hatten sie sicher nicht unrecht damit.<br />
Eine Rubrik in den Amtlichen Bekanntmachungen gibt Aufschluß über den Durchschnitt der<br />
Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle in den Jahren 1872, 1873 und 1874 in allen Orten<br />
des Oberamts Calw. Bei Gechingen sind dort 17 Eheschließungen, 48 Geburten und 37<br />
Sterbefälle vermerkt, damit lag die Zahl der Geburten um 23% über der der Sterbefälle, was<br />
so ziemlich der Norm entsprochen haben dürfte. Trotz der damaligen hohen<br />
Säuglingssterblichkeit kann man von einem starken Bevölkerungswachstum ausgehen.<br />
Vom großen Brand bis zum Ausbruch des ersten Weltkreigs<br />
"Das Dorf Gechingen wurde in der Nacht vom 10. auf 11. August 1881 von einer<br />
fürchterlichen Feuersbrunst heimgesucht. Friedlich hatten sich am Abend des 10. August die<br />
Einwohner zur Nachtruhe niedergelegt, um nach Mitternacht furchtbar aus derselben<br />
aufgeschreckt zu werden. Um 12 Uhr brach mitten im Dorf Feuer aus und da die frisch<br />
gefüllten Scheunen dem Feuer ergiebige Nahrung boten, auch der Sturm die Flammen noch<br />
anfachte, verbreitete sich das Feuer mit erschreckender Geschwindigkeit, so daß die rasch<br />
organisierte Feuerwehr des Ortes nicht imstande war, des Feuers Herr zu werden. Bange<br />
Stunden des Harrens waren es, bis die auswärtigen Löschmannschaften bei der Hand sein<br />
37
konnten. Diese trafen das Feuer in einer Ausdehnung an, daß auch sie der Wucht der<br />
Elemente machtlos gegenüberstanden. Erbarmungslos jagte der Sturm die Flammen von Haus<br />
zu Haus. Die Wohnungen, für welche die Gefahr immer drohender wurde, waren zum Teil<br />
noch angefüllt mit dem dorthin geflüchteten Hausrat der zuerst brennenden Häuser. Da<br />
wurden durch Aufräumen und Retten immer mehr Kräfte in Anspruch genommen und der<br />
Arbeit beim Löschen entzogen. Eine Zeitlang konnte auch für die Spritzen das nötige Wasser<br />
nicht beschafft werden, so daß sie mit Unterbrechungen arbeiteten, und so mußten die<br />
Feuerwehrleute vor der Macht des Feuers immer mehr und mehr zurückweichen. Da bekam<br />
wohl jedes den Eindruck, hier kann nur eine höhere Macht helfen und dem Zerstörungswerk<br />
der Elemente Einhalt gebieten. Aus gar manchem angsterfüllten Herzen stieg das heiße Flehen<br />
zu dem Erbarmen des himmlischen Vaters empor !<br />
Diesen schönen Aufsatz hat der Herr Pfarrer Dettinger von Ostelsheim in den Christboten<br />
einrücken lassen, und ich habe es abgeschrieben, um euch dieses zum Lesen zu empfehlen.<br />
Gechingen, 6. Februar 1882 Bernhard Böttinger, Sattler und Tapezierer"<br />
"In der Nacht vom 10. auf 11. August 1881 brach der Brand in der Scheuer des Michael<br />
Gehring, Metzger, heute Rößle, aus. Im Verlauf von wenigen Stunden wurden 52 Gebäude in<br />
Schutt und Asche gelegt. Das Vieh wurde in die Gärten getrieben, glücklicherweise war kein<br />
Menschenleben zu beklagen. Die Dachteler Feuerwehr kam in eine mißliche Lage, sie war im<br />
Hof in der Hohen Gasse zwischen den Häusern Weiß und Schwarz samt ihrer Spritze rings<br />
vom Feuer eingeschlossen. Es war ein Kampf auf Leben und Tod. Zum Glück versiegte der<br />
Brunnen, aus dem sie ihre Spritze speiste, nicht und so konnten sie das Feuer niederdämmen.<br />
An Vieh verbrannten 8 - 10 Schweine und ein Kalb. Das Feuer war so groß, daß sogar<br />
Esslingen am Neckar seine Feuerwehr alarmieren wollte, weil sie glaubten, es brenne in<br />
Stuttgart-Vaihingen. Nur in Weil der Stadt wurde nichts bemerkt, weil der Turmwächter<br />
schlief. Der Amtsdiener Gotthilf Mack sprang im Hemd aufs Rathaus und läutete die<br />
Feuerglocke, er nahm sich keine Zeit mehr, die Hosen anzuziehen."(K. F. Essig)<br />
Aus Unterlagen geht hervor, daß noch sieben Nächte lang bis zum 18. August Brandwachen<br />
aufgestellt werden mußten, dabei waren 142 Mann eingesetzt. Als Feuerreiter, um die<br />
benachbarten Feuerwehren zu alarmieren, wurden entsandt: Johann Fischer nach Calw,<br />
Friedrich Schwarz nach Dachtel, Heinrich Schumacher nach Althengstett, Breitling (Krone)<br />
nach Ostelsheim, Wilhelm Gehring nach Deckenpfronn, Christian Stiegelmaier nach<br />
Deufringen, Samuel Vetter nach Stammheim, Breitling (Lamm) nach Calw (zum 2. Mal),<br />
Jakob Kraushaar nach Aidlingen. Alle benachrichtigten Wehren waren im Einsatz; lediglich<br />
von der Aidlinger Wehr ist kein Nachweis vorhanden. Die Löschmannschaften wurden in den<br />
hiesigen Gastwirtschaften auf Kosten der Gemeinde bewirtet. Von den Bäckern wurde an die<br />
Brandgeschädigten auf Anweisung des Rathauses Brot geliefert, der Laib um 50 Pfennig, die<br />
Kosten übernahm die Gemeinde. Bereits am Tag nach dem Brand, am 12. August 1881, hat<br />
das Königliche Ministerium des Innern einen Abgeordneten nach Gechingen entsandt, den -<br />
wie es heißt - Hochehrwürdigen Oberregierungsrat von Schönlin, zur Erhebung der Sachlage,<br />
zur Beratung der Behörde. Nach Erhebung der allgemeinen Verhältnisse nahm er an der<br />
Beratung des Gemeinderats teil und drückte dem Gemeinderat die Teilnahme der<br />
allerhöchsten Behörde aus. Es wurde über die Art der Abräumung des Brandplatzes debattiert.<br />
Unter anderem wurde vorgeschlagen, daß der Schultheiß diese Arbeiten beaufsichtigen solle,<br />
da die Gemeinderatsmitglieder durch Erntegeschäfte verhindert seien. Der Schultheiß<br />
beauftragte jedoch den Werkmeister Kleinbub aus Calw mit der Wahrnehmung dieses<br />
Geschäfts. Von den Brandgeschädigten waren mit wenigen Ausnahmen alle versichert, die<br />
Versicherung hat an Entschädigung ausbezahlt: Für Gebäude 141.759 Mark, für Mobiliar<br />
88.349 Mark. Die Auszahlung erfolgte etwas schleppend, so daß die Gemeinde mit<br />
Vorschüssen einspringen mußte. An Spenden sind nahezu 10.000 Mark und an Naturalgaben<br />
3.000 Mark eingegangen, die an die Brandgeschädigten verteilt wurden. Die Spenden kamen<br />
38
aus vielen Gemeinden Württembergs. Die Gemeinde selbst hat sich an den<br />
Wiederaufbaukosten mit 34.000 Mark beteiligt. Gemeinderatsprotokoll vom 18. August 1881:<br />
"Nachdem die Kollegien das erste Mal wieder zusammengetreten, um nach dem großen<br />
Brandunglück zu beraten, ist es die dringendste Aufgabe, für Wohnungen im Winter zu<br />
sorgen, da die jetzigen in keiner Weise genügen. Die Gemeinde kann in kurzer Frist<br />
Wohnräume im Farrenstall stellen, wenn ein Stockwerk auf das Haus aufgesetzt wird. Die<br />
Kollegien beschließen, diesen Bau zu errichten."<br />
Die Hohe Gasse und die Metzgergasse sollten so wieder aufgebaut werden, wie sie vorher<br />
gewesen waren, die Hauptstraße dagegen sollte etwas zurückgenommen und das enge,<br />
krumme Gäßle in eine schöne breite Dorfstraße verwandelt werden. Das größte Vorhaben aber<br />
war die neue Straße, die parallel zum Mühlweg angelegt werden sollte, mit einer einheitlichen<br />
Häuserfront. Hier hatte der Schultheiß Ziegler bei seinem Gemeinderatskollegium einen<br />
starken Widerstand zu brechen. Der Überlieferung nach schloß er die Gemeinderäte im<br />
Rathaus solange ein, bis sie vor Müdigkeit einnickten, und dieses Nicken wertete er als<br />
Zustimmung zu seinen Straßenbauplänen. Die Grunderwerbskosten für die Straßen beliefen<br />
sich auf 18.733 Mark.<br />
Schultheiß Ziegler machte den Vorschlag, die Geschädigten in drei Klassen einzuteilen:<br />
Klasse 1 solche, die an der Hauptstraße gelegen,<br />
Klasse 2 Nebenstraßenplätze,<br />
Klasse 3 Hinterhäuser.<br />
Die Festlegung des Preises der einzelnen Klassen wurde den Brandgeschädigten überlassen.<br />
Die Abgebrannten waren mit dieser Regelung einverstanden. Anschließend gab jeder eine<br />
Erklärung ab, wie lang und breit er sein neues Haus zu bauen beabsichtige, um das Projekt<br />
entwerfen zu können." (Otto Weiß, Altbürgermeister)<br />
"Zum Andenken an den großen Brand pflanzte man nach Fertigstellung der neuen Straße<br />
zwischen Gartenstraße und Kreuzstraße die Marienlinde. Sie soll an die großzügige Spende<br />
der Prinzessin Marie von Württemberg, verehelichte Gräfin Neipperg, erinnern. " (Tillie<br />
Jäger)<br />
Fünf Jahre nach dem großen Brand, am 12.August 1886 um 9.00 Uhr, brach im Haus<br />
Schneider/Weiß in der früheren Schafgasse, jetzt Weingartenstraße, ein Brand aus, der von<br />
einem zündelnden Kind verursacht worden war. Die angebauten, oberhalb stehenden<br />
Nachbarhäuser Böttinger/Breitling, in denen sich auch ein Kramladen befand, sowie das Haus<br />
Heim brannten mit ab.<br />
Im Jahr 1883 begann für Gechingen der öffentliche Personennahverkehr. Die Postkutsche<br />
nahm von Dachtel über Gechingen nach Calw den Betrieb auf.<br />
Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein trafen sich in den langen Winterabenden die Frauen und<br />
Mädchen einer alten Tradition gemäß zu gemeinschaftlichen Näh-, Strick- und Häkelarbeiten<br />
("Außelaufa"). Schon im 16. Jahrhundert lassen sich diese "Lichtkärze", die ursprünglich in<br />
der dunklen Jahreszeit Beleuchtung sparen sollten, nachweisen. Da aber auch Burschen dabei<br />
erschienen und mancherlei Allotria getrieben wurde, wurden durch den Kirchenkonvent<br />
strenge Vorschriften für die "Lichtkärze" erlassen, die erhalten geblieben sind.<br />
Wir wollen noch einmal einen Blick in die Gemeinderatsprotokolle aus dieser Zeit werfen.<br />
Den Bauern machten immer wieder Schädlinge das Leben sauer und brachten sie um die<br />
Früchte ihrer Arbeit. Die Rabenplage (gemeint sind Rabenkrähen) nahm 1894 so überhand,<br />
daß die Gemeinde für jeden abgelieferten toten Raben 20 Pfennige bezahlte. 1894/96 wurden<br />
insgesamt 54 Raben abgeliefert. Um 1901 muß die Rabenplage aber so zugenommen haben,<br />
daß sich die Gemeinde veranlaßt sah, für jeden toten Raben 40 Pfennige zu zahlen. Der Feld-<br />
oder Flurschütz erhielt 45 Pfennige dafür. Aber nicht nur Raben, auch Feldmäuse wurden<br />
39
gefangen und abgeliefert. Für eine Maus bekam man 1 Pfennig. Im Jahr 1895 kamen so 18538<br />
tote Mäuse zusammen, was die Gemeindekasse mit 185 Mark und 38 Pfennigen belastete.<br />
1897 war wieder eine Mißernte. Manch bäuerliche Betrieb geriet dadurch in Bedrängnis.<br />
1899 wurde eine Frau bei der Feldarbeit vom Blitz erschlagen.<br />
Ab 1905 war die neue Straße nach Deufringen fertig (siehe "Straßenverhältnisse bis zum<br />
Beginn der Motorisierung“), die Ortsdurchfahrt war seit dem großen Brand gut ausgebaut.<br />
1886 waren die ersten Automobile der Öffentlichkeit vorgestellt worden, und bald danach<br />
begann sich die Kraftfahrzeugindustrie zu entwickeln. Offenbar mußte man sich in Gechingen<br />
schon 1905 Gedanken über den Kraftfahrzeugverkehr machen. Um Unglücksfälle durch allzu<br />
rasch fahrende Motorfahrzeuge innerhalb des Ortes zu verhüten, erließ der Ortsvorsteher<br />
folgende ortspolizeiliche Vorschrift:<br />
„1.Auf sämtlichen Wegen, Straßen und Brücken innerhalb des durch die äußersten Häuser<br />
begrenzten Weichbildes des hiesigen Ortes dürfen Motorfahrzeuge (durch Dampf, Elektrizität,<br />
Benzin, Petroleum und dergleichen Motoren betriebene Fahrzeuge, Automobile,<br />
Motorfahrräder, Straßenlokomotiven) nur mit der Schnelligkeit eines mäßig trabenden Pferdes<br />
gefahren werden. Motorradfahrer, welchen dies nicht möglich ist, haben abzusteigen und das<br />
Rad zu schieben.<br />
2. Der Wagenführer ist zu besonderer Vorsicht in Leitung und Bedienung seines Motorwagens<br />
verpflichtet. Er darf von dem Motorwagen nicht absteigen, solange der Wagen in Bewegung<br />
ist und darf sich von demselben nicht entfernen, solange der Wagen angetrieben ist, auch muß<br />
er die nötigen Vorkehrungen treffen, daß das Fahrzeug von Unbefugten nicht in Bewegung<br />
gesetzt werden kann.<br />
3. Zuwiderhandlungen werden nach Maßgabe des Paragraphen 366 Ziff. 10 des R.Str.G.B. mit<br />
Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft.<br />
4. Der Gemeinderat gibt seine Zustimmung und es wird diese Vorschrift durch Ausschellen<br />
und durch öffentlichen Aushang an den Ortseingängen bekannt gemacht.<br />
Gemeinderat: Ladner, Breitling, Schwarz, Weiß, Gann, Böttinger u. Gehring."<br />
Eine Wasserleitung in Gechingen gibt es seit 1906, elektrisches Licht seit 1910/11.<br />
Der erste Versuch, in Gechingen Industrie ansässig zu machen, datiert aus dieser Zeit. Im<br />
September 1908 eröffnete die Firma Petri aus Ludwigsburg eine Zweigniederlassung mit 19<br />
Handstrickmaschinen. Junge Mädchen verdienten sich ihr Geld mit Strumpfstricken. Wie<br />
lange diese Firma hier am Ort bestanden hat, ist nicht bekannt.<br />
Um die Verkehrsverhältnisse weiter zu verbessern, plante in den Jahren 1904-12 die<br />
württembergische Regierung eine Eisenbahnverbindung durch das Heckengäu. Eine<br />
Trassenplanung führte von Böblingen über Aidlingen-Gechingen-Stammheim zur bereits<br />
vorhandenen Bahnlinie Calw-Weil der Stadt. Die andere Trasse sah eine Verbindung von<br />
Herrenberg über Deckenpfronn-Gechingen-Stammheim vor. Der Ausbruch des ersten<br />
Weltkriegs zerschlug aber alle Pläne.<br />
Der erste Weltkrieg<br />
Im August 1914 kam es durch das Attentat von Sarajewo, dem das österreichische<br />
Thronfolgerpaar zum Opfer fiel, zum Kriegsausbruch. 49 Soldaten aus unserem Ort verloren<br />
in den vier Jahren bis zum Ende des Krieges ihr Leben. Die Namen der im Osten gefallenen<br />
lauten: Rudolf Vetter *28.12.1893 +27.11.1914 Ludwig Schaible *28.1.1890 +5.12.1914 Karl<br />
Gehring *9.4.1889 +19.12.1914 Karl Krauss *6.3.1887 +19.12.1914 Wilhelm Gehring<br />
*21.7.1886 +21.12.1914 Christian Riehm *12.7.1894 +30.12.1914 Richard Breitling<br />
*25.12.1892. +25.6.1915 Otto Ginader *4.6.1892 +28.6.1915 Karl Kühnle *24.6.1881.<br />
+5.9.1916 Richard Dingler *9.12.1879 +18.8.1917 Christian Süsser *11.3.1879 +30.4.1918<br />
40
Im Westen: Hermann Gehring *15.7.1891 +24.8.1914 Julius Mitschele *23.8.1890<br />
+28.8.1914 Ludwig Heim *25.8.1891 +29.8.1914 Ferdinand Gehring *28.10.1881 +9.1914<br />
Paul Mitschele *27.6.1887 +8.9.1914 Jakob Süsser *18.8.1893 +26.9.1914 Heinrich Dingler<br />
*10.5.1881 +20.10.1914 Jakob Wagner 18.12.1873 +9.2.1915 Gottfried Quinzler *7.5.1880<br />
+19.2.1915 Wilhelm Gehring *3.3.1889 +10.5.1915 Richard Ladner *13.8.1891 +30.6.1915<br />
Heinrich Schumacher *2.2.1885 +12.9.1915 Hermann Vollmer *19.2.1889 +21.3.1916<br />
Friedrich Essig *12.9.1879 +27.5.1916 Friedrich Fischer *24.9.1887 +1.7.1916 Rudolf<br />
Theurer *25.7.1894 +1.7.1916 Karl Böttinger *29.1.1886 +4.7.1916 Paul Gehring *10.3.1896<br />
+10.7.1916 Otto Köber *15.12.1893 +5.11.1916 Otto Kielwein *9.10.1896 +5.11.1916 Otto<br />
Dürr *3.10.1895 +10.1.1917 Karl Süsser *24.1.1897 +22.4.1917 Wilhelm Böttinger<br />
*13.9.1888 +20.5.1917 Karl Schumacher *24.11.1886 +13.6.1917 Friedrich Schumacher<br />
*4.9.1885 +15.7.1917 August Süsser *5.10.1896 +27.8.1917 Friedrich Kraushaar<br />
*24.11.1897 +2.9.1917 Friedrich Vetter *19.10.1873 +12.9.1917 Wilhelm Krauss<br />
*13.12.1883 +3.1.1918 Karl Dingler *7.10.1897 +5.8.1918 Paul Gehring *28.10.1890<br />
+9.8.1918 Ludwig Gehring *22.5.1898 +15.8.1918 Otto Kühnle *13.11.1889 +28.8.1918 Karl<br />
Vetter *13.4.1881 +23.9.1918 Gottlob Süsser *26.10.1880 +29.9.1918 Fritz Heim *28.6.1889<br />
+4.10.1918 August Süsser *23.3.1896 +7.10.1918 Josef Bierle *8.10.1898 +1.1.1919<br />
Da fast alle jungen Männer zum Kriegsdienst eingezogen waren, lag die ganze Last der<br />
Feldarbeit auf den Schultern der Frauen und der nicht wehrdienstfähigen Männer. Das<br />
Tagebuch eines alten Bauern berichtet von mühevoller Arbeit, Ablieferungen, verwundeten<br />
Soldaten und der Trauer der Hinterbliebenen. So heißt es am 6.7.1915: "Gefallen sind Richard<br />
Ladner und Wilhelm Gehring. Wenn der Krieg so weitergeht, kommt bald keiner mehr heim."<br />
Am 22.7.1915: "Es werden Leute gesucht, die bei Nacht die Felder bewachen sollen. Den<br />
ganzen Tag streng arbeiten und bei Nacht wachen, das kann niemand!" Am 2.8.1915: "Eine<br />
Kommission hat in den Häusern nach Frucht gesucht und beschlagnahmt." Vier Wochen<br />
später: "Alle Kupfergegenstände sollen abgeliefert werden." Im Dezember: "Französische<br />
Flieger über dem Ort." 7.3.1916: "Heute hat ein Urlauber zu mir gesagt, wenn der Krieg noch<br />
bis Herbst geht, erschießt er sich." Am 31.8.1916 machte der Bauer den Eintrag: "Seife,<br />
Zucker und Fleischkarten geholt, es müssen wieder viele einrücken, wenn das so weitergeht<br />
mit den vielen Feinden, muß alles, was noch laufen kann, fort." - "Wir müssen 8 Zentner Heu<br />
abliefern, wenn nur der ganze Schwindel mal aus wäre", notiert er unter dem 15.5.1918.<br />
1916 mußte ein deutsches Flugzeug wegen Benzinmangels auf den Wolfswiesen notlanden.<br />
Fast die gesamte Einwohnerschaft war bei diesem aufregenden Ereignis auf den Beinen. Ein<br />
Soldat, der in der Mühle dienstverpflichtet war, machte mit seiner Kamera Bilder, die heute<br />
noch erhalten sind.<br />
Gleich zu Beginn des Krieges wurde auch bei uns, wie in anderen Orten, auf Weisung der<br />
Regierung eine Jugendwehr ins Leben gerufen. Im württembergischen Staatsanzeiger von<br />
1914 heißt es: "Zur militärischen Vorbereitung der Jugend wird ein Ausschuß unter<br />
Generalmajor v. Hügel eingesetzt. Die Lehrer werden angewiesen, sogenannte Jugendwehren<br />
an den Schulen einzurichten. Die Übungen sollen an Sonntagen und Mittwoch- und<br />
Samstagnachmittagen gemacht werden. Weil Teile des Lehrstoffes dadurch ausfallen, wird bei<br />
Prüfungen darauf Rücksicht genommen.<br />
Im Unterricht ist verstärkt über den uns aufgezwungenen Krieg und die Ursachen zu<br />
berichten. Der Lehrer leitet den ganzen Strom der großen Zeit, die wir jetzt erleben, in die<br />
Schule. Hier ist der Ort, wo die Kinder der im Feld stehenden Väter über die Vorgänge auf<br />
den Kriegsschauplätzen zu Land und zu Wasser unterrichtet werden. Auch auf die<br />
Erwachsenen ist in diesem Sinne einzuwirken. Aufsatzthemen: Stimmungsbilder über<br />
Mobilmachung, Einquartierungen, Freiwilligkeit, Freiwillige, Siege usw."<br />
41
Im Amtsblatt für das Schulwesen steht zur gleichen Zeit: "Beim Eintritt von hervorragenden<br />
Kriegsereignissen wird eine Schulfeier abgehalten, der Unterricht fällt aus. Der Jugend ist<br />
Größe und der Ernst der jetzigen Zeit zu vermitteln. Gleichzeitig ist an die Spendenfreudigkeit<br />
der Schüler zu appellieren". Die Schüler sammelten Brennesseln zur Stoffherstellung,<br />
Buchen- und Eichenlaub für Soldatenpferde, Eicheln für Schweinefutter und Bucheckern zur<br />
Herstellung von Öl.<br />
Der Gemeinderat bewilligte im November 1914 Mittel zur Anschaffung von Übungsgeräten<br />
für eine Jugendwehr. Es wurden 25 Holzgewehre gekauft und sechs Ausbilder nach<br />
Münsingen zu einem Kurs geschickt. Anfangs war die Jugend mit Begeisterung dabei. Unter<br />
Aufsicht der Lehrer bauten sie im Mönchsgrund Schützengräben. Andernorts aber fiel das<br />
Ergebnis der paramilitärischen Übungen wohl anders aus als geplant. Am 24.11.1915 mußte<br />
die Regierung schon besondere Maßnahmen gegen die aufbegehrende Jugend erlassen. Die<br />
Schultheißen wurden angewiesen, ein besonderes Auge auf die Jugendlichen zu haben und<br />
gegen Ausschreitungen ohne Rücksicht vorzugehen. Bei uns war das nicht notwendig. Die<br />
Jugend auf dem Lande mußte immer hart arbeiten und hatte für aufrührerische Aktivitäten<br />
weder Zeit noch Energie. Auch spielte der zunehmende Mangel an allen Gütern des täglichen<br />
Bedarfs in der Stadt eine größere Rolle als auf dem Land. Zwar waren Lebensmittel, Schuhe<br />
und Kleider überall rationiert und wurden nur auf Karten abgegeben, aber auf dem Land war<br />
die Lage etwas besser, da die Bevölkerung einen Teil der Ernteerträge behalten konnte. Aber<br />
je länger der Krieg dauerte, desto mehr nahmen auch hier Not und Elend zu.<br />
Um dem Arbeitskräftemangel abzuhelfen, kamen im März 1916 zehn Kriegsgefangene nach<br />
Gechingen. Sie waren in einem Neubau in der Gültlinger Straße bei Samuel Vetter<br />
untergebracht und wurden von einem Wachmann beaufsichtigt. Die Gefangenen, meist<br />
Franzosen, waren teilweise keine Landwirte, so daß sie anfangs keine große Hilfe waren. Im<br />
Laufe der Zeit wurden sie aber für viele Höfe unentbehrlich. Die Miete für Unterkünfte der<br />
Gefangenen in Höhe von 1 Mark pro Mann und Monat übernahm die Gemeinde. Das Essen<br />
stellten die Arbeitgeber. Fluchtversuche der hier arbeitenden Gefangenen gab es nicht,<br />
trotzdem mußte der Feldschütz die Augen offenhalten. Er sollte auch auf feindliche Agenten<br />
und Flugzeuge achten.<br />
Bis November 1918 dauerte der schreckliche Krieg. Erst Jahre später konnten die Verluste an<br />
Menschen in etwa ermittelt werden. In Deutschland waren es 1 885 291 Tote.<br />
Im Zusammenhang mit der militärischen Niederlage kam es überall in Deutschland zur<br />
Revolution. In Württemberg verlief sie einigermaßen glimpflich, doch wurde auch hier der<br />
allgemein beliebte König Wilhelm II. zur Abdankung gezwungen, und Württemberg wurde<br />
zur Republik.<br />
Zwischen den Kriegen bis 1933<br />
Am Ende des ersten Weltkrieges kehrten zwei Drittel der ausgerückten Soldaten wieder nach<br />
Hause zurück. Man versuchte, die Vorkriegsverhältnisse wiederherzustellen und Vorhaben,<br />
die durch den Krieg verhindert worden waren, wieder aufzugreifen. Schon im Juli 1919<br />
beschloß der Gemeinderat, für die im Jahr 1917 abgelieferte Rathausglocke eine neue zu<br />
bestellen. "Es sei ein dringendes Bedürfnis und soll in tunlichster Bälde vorgenommen<br />
werden". Im November 1919 bestellte man bei der Firma Kurtz in Stuttgart eine Glocke im<br />
Gewicht von 150 kg zum Preis von 3450 Mark, "da ein geordneter Betrieb ohne Glocke nicht<br />
mehr durchzuführen ist". So hieß es im Protokoll.<br />
Um den vielen arbeitslosen jungen Männern einen Verdienst zu beschaffen, beschloß die<br />
Gemeinde im Jahr 1921, eine Verbindungsstraße vom oberen Angel zur Althengstetter Straße<br />
zu bauen. Am 28.7.1922 war die Straße fertig und konnte eingeweiht werden. Durch den<br />
Beginn der Inflation waren die Baukosten so in die Höhe geschnellt, daß die neue Straße den<br />
Beinamen "Millionensträßle" erhielt. Die Wirtschaft unseres Landes, das sowieso unter der<br />
42
Last der Reparationszahlungen an die Siegermächte litt, geriet durch die Inflation völlig aus<br />
den Fugen. Die Preise kletterten in astronomische Höhen. Im Tagebuch unseres Bauern läßt<br />
sich das gut erkennen:"10.1.1923: 1 Pfund Butter 3400 Mark, 1 Paar Schuhe 1350 Mark.<br />
17.4.1923: 1 Paar Strümpfe 3200 Mark, 1 Kaffeetasse 1000 Mark. 18.5.1923: Hemdenstoff<br />
42000 Mark, Bodenöl 10800 Mark". Besonders deutlich läßt sich der Währungsverfall anhand<br />
des Tabakpreises zeigen. Am 9.1.1923 kostete 1 Päckchen Tabak 200 Mark, am 15.5. 1923<br />
bereits 800 Mark. Ein Ei bekam man um 340 Mark, für 1 Pfund Rindfleisch legte man 4000<br />
Mark auf den Tisch. Im November 1923 war der Höchststand der Inflation erreicht. 1 US-<br />
Dollar kostete 4, 2 Billionen Mark. Erst mit dem Ende der Inflation und der Einführung der<br />
neuen Währung "Rentenmark" am 15.11.1923 erholte sich das Land wieder, und es kam zu<br />
einem bescheidenen Wohlstand. Man begann, sich lange verschobenen Vorhaben wieder<br />
zuzuwenden, so legten Grabungen an der <strong>Gechinger</strong> Burg 1928 den Grundriß frei.<br />
1929 wurden die Schultheißen in Bürgermeister umbenannt.<br />
1929 kam es zu jenem dramatischen Bankenzusammenbruch in New York, der die ganze<br />
Welt in eine Wirtschaftskrise stürzte. Diese führte zu Preisverfall, Bankrotten und zum<br />
Schrumpfen der Wirtschaftsbeziehungen auf der ganzen Welt. Das Heer der Arbeitslosen<br />
wuchs in Millionenhöhe, vor allem in Deutschland. 1932 zählte man im damaligen Reich<br />
6,128 Millionen Arbeitslose und 3 Millionen Kurzarbeiter. Das waren zwei Drittel der<br />
arbeitsfähigen Bevölkerung. Auch hier bei uns begannen wieder Not und Elend einzuziehen.<br />
Verhungern mußte zwar keiner, aber das Geld wurde knapp und knapper. 1932 beschloß der<br />
Gemeinderat, Gutscheine im Wert von 1 und 2 Pfennig abzugeben. Damit sollten die Bettler,<br />
die den Ort geradezu überschwemmten, abgefunden werden. Sie konnten dann damit<br />
Lebensmittel kaufen.<br />
Die jeweiligen Reichsregierungen in Weimar nahmen, um regierungsfähig zu bleiben,<br />
Notverordnungen zur Hilfe, weil sie dazu die Zustimmung des handlungsunfähigen<br />
Parlamentes nicht brauchten. Gehälter, Löhne und Renten wurden gekürzt und die Armut stieg<br />
weiter.<br />
In Gechingen gab es wieder Hochwasser. Am 30.5.1932 zwischen 3 und 4 Uhr morgens ging<br />
ein schweres Gewitter mit Hagelschlag nieder, es war so stark, daß noch am Nachmittag die<br />
Schloßen 60-70 cm hoch lagen. Beim "Lamm" mußten Stege gebaut werden. Es entstand ein<br />
Sachschaden von ca. 100 000 RM.<br />
Im Winter 1932/33 leisteten die Besitzer der Felder am Dätzinger Weg eine vorbildliche<br />
Gemeinschaftsarbeit. Unter der Leitung von Regierungs-Oberlandmesser a. D. Ziegler<br />
entstand eine großzügige Weganlage mit einer Breite von 5 Meter und einer Steigung von 5-<br />
6%. Dadurch bekamen alle Anliegergrundstücke eine bessere Zufahrtsmöglichkeit als bisher.<br />
Die Gemeinde übernahm die Kosten der Steinschlagmaschine. Der neue Weg bekam den<br />
Namen: Heinrich-Ziegler-Weg.<br />
Das dritte Reich bis zum zweiten Weltkrieg<br />
Durch das wachsende Elend bekam eine Partei großen Zulauf: Die Nationalsozialistische<br />
Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). Sie versprach in ihrer sehr geschickten Propaganda<br />
Rettung aus der Not. Viele sahen in ihr die letzte Hoffnung. So stieg in Gechingen die Zahl<br />
der NSDAP-Wähler bei den Reichstagswahlen von 4 Stimmen im Jahr 1928 um das beinahe<br />
Zehnfache auf 39 Stimmen 1930 an. 1932 war es dann noch einmal über das Fünffache mehr:<br />
199 wählten die NSDAP. Bezogen auf die Zahl von rund 500 Wahlberechtigten waren das<br />
1928 0,8%, 1930 7,8% und 1932 39,8% aller Stimmen.<br />
1933 kam Hitler als Reichskanzler in die Regierung und benützte das Ermächtigungsgesetz,<br />
das im Notfall die Regierung dazu befugte, ohne das Parlament Gesetze zu erlassen, um alle<br />
43
anderen Parteien entweder zu verbieten oder gleichzuschalten. Nun traten viele in guten<br />
Glauben in die Partei ein oder warteten ruhig ab, was die neue Regierung leisten würde.<br />
Schon am 25.6.1935 gab der Kreisleiter der NSDAP von Calw in einem Schreiben dem<br />
Bürgermeister bekannt, wer zum Gemeinderat in Gechingen berufen werde. Es waren Ludwig<br />
Gehring, Friedrich Schwarz, Georg Wagner, Albert Schaible, Paul Maier und Friedrich Weiß.<br />
Damit war die demokratische Wahl abgeschafft. Die Abfassung der Gemeinderatsprotokolle<br />
aus jener Zeit läßt die Wandlung gut erkennen. Las man vor 1933 noch "der Gemeinderat<br />
beschließt", so hieß es später "der Bürgermeister verfügt". Auch hier bei uns wurde, wie im<br />
ganzen Land, die demokratische Tradition von der Diktatur und dem Führerprinzip abgelöst.<br />
Am 24.6.1933 ordnete das Ministerium ein Fest der Jugend zur Sonnwendfeier an. Die<br />
Einwände des Gemeinderates, daß die Heuernte in vollen Gange sei und man alle Kräfte dazu<br />
brauche, wurden mit der Weisung, daß die Schulen sich an die Anordnung zu halten hätten,<br />
abgelehnt.<br />
Nachdem am 14.7.1933 das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, welches die<br />
Zwangssterilisation erlaubte, erlassen war, wurde ein großer Propagandafeldzug bis in die<br />
kleinsten Dörfer hinein organisiert. Zur Beschaffung von Werbematerial mußte auch die<br />
Gemeinde beisteuern. 1934 empfahl der württembergische Gemeindetag den Gemeinden, den<br />
neuen Jugendverbänden, wie Hitlerjugend (HJ), Jungvolk und Bund Deutscher Mädchen<br />
(BDM) neben einem passenden Vereinslokal auch einen jährlichen Pro-Kopf-Beitrag von 2<br />
Pfennig auf jeden Einwohner zu geben. Die Gemeinde stellte daraufhin den unteren Raum des<br />
gemeindeeigenen Hauses in der Kirchstraße zur Verfügung. Heizung und Beleuchtung waren<br />
frei. Die <strong>Gechinger</strong> HJ war im sogenannten "Bann 401, Gefolgschaft 18" organisiert.<br />
An der Post in der Calwer Straße brachte die NSDAP eine große Anschlagtafel an, um die<br />
antisemitische Hetzzeitung "Der Stürmer" von dem bekannten Julius Streicher zu<br />
veröffentlichen. Damit wurde mit Schauermärchen Stimmung gegen die Juden gemacht, um<br />
die barbarischen Maßnahmen gegen sie zu begründen. Mit der Parole "Deutscher, kauf nicht<br />
bei Juden" und SA-Posten vor ihren Läden entzog man den jüdischen Händlern die<br />
Existenzgrundlage. In Gechingen waren allerdings gar keine Juden ansässig, in Calw gab es<br />
zwei jüdische Geschäfte. Manche glaubten den antisemitischen Hetzparolen, aber es gab auch<br />
viele, die nicht darauf hörten. Immer noch traten manche in die Partei und ihre Organisationen<br />
ein, teils weil es aus beruflichen Gründen notwendig war oder nur, um bei ihren Kameraden<br />
zu sein. Durch die beginnende Aufrüstung, Notstandsarbeiten und Bau der Autobahnen ging<br />
die Zahl der Arbeitslosen langsam, aber stetig zurück. Dazu kam noch die Wiedereinführung<br />
der allgemeinen Wehrpflicht, die viele jugendliche Arbeitslose von der Straße holte. Auch<br />
begann sich die Wirtschaft weltweit zu erholen, man rechnete es aber den Nationalsozialisten<br />
an. Das alles trug zur Festigung der Diktatur bei. Es kam wieder zu einem gewissen<br />
Wohlstand.<br />
Der Jugend galt das Hauptaugenmerk der NSDAP. Sie sollte ganz in ihrem Sinne erzogen<br />
werden. Reichsjugendspiele, Zeltlager, Fahrten und Sport brachten den nationalsozialistischen<br />
Jugendverbänden großen Zulauf. Mit dem Gesetz vom 1.12.1936 faßte die Regierung dann<br />
die gesamten deutschen Jugendverbände zusammen und unterstellte sie dem<br />
Reichsjugendführer. Kaum jemandem gelang es, sich dieser allumfassenden Organisation zu<br />
entziehen. Die christlichen Jugendverbände wurden in die Hitlerjugend übernommen. Auch<br />
die Schule bezog man mit ein: "Aus der Erwägung heraus, daß im einigen Reich nur eine<br />
gemeinsame Volksschule Platz haben kann, beabsichtigt der Bürgermeister die Einführung<br />
der deutschen Gemeinschaftsschule in Gechingen zu beantragen. Der Religionsunterricht<br />
bleibt im vollen Umfang erhalten". Weiter heißt es: "An die Jugend unsere Gemeinde werden<br />
wie überall, hohe Anforderungen, auch in sportlicher Hinsicht, z.B. im Schwimmen, gestellt.<br />
Insbesondere bei der HJ, dem Arbeitsdienst und der Wehrmacht. Es ist daher erforderlich, in<br />
44
der Gemeinde eine Badegelegenheit, ein Freischwimmbad zu schaffen. Der Bau ließe sich am<br />
besten in den Wiesen am Brühl erstellen und die Speisung könnte von der<br />
Brackenhammerschen Quelle aus erfolgen. Viele Arbeiten können in Gemeinschaftsarbeit<br />
erledigt werden" (Auszüge aus einem Gemeinderatsprotokoll 1936). Es gab einen Beschluß,<br />
die erforderlichen Grundflächen zu erwerben und einen Architekten zu beauftragen. Diese<br />
Pläne haben sich dann durch den Ausbruch des zweiten Weltkriegs zerschlagen.<br />
Der Reichsluftschutzbund (RLB) gründete 1937 in Gechingen zusammen mit den Gemeinden<br />
Stammheim, Althengstett, Ostelsheim und Dachtel eine Gruppe. Zur Schulung der<br />
Bevölkerung wurden benötigt: "30 Gasmasken, 30 Schutzanzüge, 30 Stahlhelme, 3<br />
Kübelspritzen mit je 25 m Schlauch, 2 Decken, 1 Luftschutz-Verbandskasten und<br />
verschiedene Schulungsmodelle. Die Kosten von rund 1200 RM sollen von den einzelnen<br />
Gemeinden aufgebracht werden. Es ist für die Gemeinde schwer, den vielen Anforderungen<br />
gerecht zu werden, welche heute an sie gestellt werden. Die Schulung der Bevölkerung auf<br />
dem Gebiet des Luftschutzes ist aber bei der heutigen modernen Kriegsführung so wichtig,<br />
daß wir nicht zurückstehen können, da wir sonst eine große Verantwortung auf uns nehmen<br />
würden" (Aus einem Gemeinderatsprotokoll 1937).<br />
"Die Einwohner wurden zum Selbstschutz aufgerufen und in Luftschutzgemeinschaften unter<br />
Führung eines Luftschutzhauswartes eingeteilt. In jedem Haus sollte man Schutzräume<br />
einbauen und mit Einbruch der Dunkelheit alle Lichtquellen verdunkeln. Die Organisation<br />
war Aufgabe des Bürgermeisteramts als des örtlichen Polizeiorgans und der ehrenamtlich<br />
tätigen Angehörigen des RLB. Auf dem Dachboden und im Keller sollte alles zur<br />
Brandbekämpfung bei einem etwaigen Fliegerangriff bereitgestellt werden: Wasser, Sand und<br />
Äxte. Jeder Hausbesitzer mußte sich eine Handspritze anschaffen". (Fritz Heimberger,<br />
Sindelfingen)<br />
In der Folgezeit führte man in Gechingen verschiedene Übungen durch. Bei einer wurde<br />
angenommen, ein Flieger werfe Bomben ab. In einem extra dafür aufgebauten Brandschuppen<br />
entzündete man Brandsätze und machte Löschversuche. Auf der Gartenstraße, vor der<br />
Marienlinde, versorgte man die Verletzten. Luftschutzwarte wurden im Saal des Gasthauses<br />
Hirsch geschult. Ein tiefer Keller des Adlerwirts (Haus Dingler, Calwer Straße) diente erst als<br />
Gasraum, in dem die an jeden ausgegebenen Volksgasmasken probiert wurden, später als<br />
Luftschutzraum. Neben all diesen militärischen und paramilitärischen Aktivitäten wurden<br />
natürlich auch gemeinnützige Vorhaben durchgeführt. Den Schuttabladeplatz im Gailer,<br />
gewiß keine Zier für das Ortsbild, schloß man im August 1936 und legte einen neuen<br />
Müllplatz an der Straße nach Ostelsheim an. Der alte Schuttablageplatz wurde zum Festplatz<br />
für nationale Feiertage umgewandelt und mit Bäumen bepflanzt. Heute befindet sich dort ein<br />
Regenüberlaufbecken. Auch führte man eine Teilflurbereinigung durch. Dabei wurde das<br />
Bachbett im unteren Tal Richtung Deufringen so ausgebaut, daß Überschwemmungen nur<br />
noch selten vorkommen sollten. Es waren sechs Kunstbauten, Brücken und Wehre notwendig.<br />
Die Kosten lagen bei 40 000 RM, davon 60 % zu Gemeindelasten. Gleichzeitig mußte die<br />
Quelle der Irm beim heutigen Feuersee neu gefaßt werden, da die Scheuer, aus deren<br />
Grundmauer sie entspringt, repariert wurde. Das Gemeinderatsprotokoll berichtet, wie<br />
schwierig es war, Zement zu beschaffen, der rationiert war, weil er für den Bau des Westwalls<br />
gebraucht wurde. Dadurch kamen auch die Umbauarbeiten am ehemaligen Waschhaus ins<br />
Stocken und konnten erst im Dezember 1938 zu Ende geführt werden.<br />
1936 ereigneten sich zwei Todesfälle, die alle erschütterten: Ferdinand Breitling fiel beim<br />
Tannenzapfensammeln am 11.7.1936 von einem Baum und starb auf dem Weg ins<br />
Krankenhaus Calw. Sechs Wochen vorher stürzte Paul Gehring auf der Fahrt nach Calw an<br />
der Einmündung der Straße bei Stammheim vom Fahrrad. Er fiel die Böschung hinunter und<br />
war sofort tot. Kurz darauf kam es wieder zu drei Unglücksfällen, die aber zum Glück nicht<br />
45
tödlich verliefen. Es gab einen Unfall im Steinbruch, einen beim Holzfällen und einen Sturz in<br />
der Scheuer.<br />
Bei einem Segelflugwettbewerb auf dem Hornberg errang 1938 Karl Schneider zusammen mit<br />
einem Kollegen den Weltrekord im Dauerfliegen mit 21 Stunden und 2 Minuten.<br />
Die Familie Ruopp aus Gruorn bei Münsingen fand bei uns eine neue Heimat. Sie mußte ihren<br />
Heimatort verlassen, weil der dortige Truppenübungsplatz vergrößert wurde.<br />
Auch in Gechingen merkte man die fortschreitende Militarisierung. Im September 1936 stand<br />
im Evangelischen Gemeideblatt: "Heute und morgen, 2. und 3. 9. ist hier Einquartierung.<br />
Alles ist auf den Beinen; eine feine Sache. Gott gebe, daß wir diese Manöver nicht für den<br />
Ernstfall brauchen, für den Krieg. Rußland will unbedingt den Weltbrand". Schneller als<br />
Pfarrer Reusch, der Schreiber dieser Zeilen ahnte, kam der Ernstfall: 1939.<br />
Der Zweite Weltkrieg 1939 - 45<br />
Sofort mit Kriegsbeginn am 1.9.1939 hatte die Gemeinde monatlich etwa 710 RM<br />
Kriegsabgabe zu bezahlen. Dann bekamen wir Einquartierung, und zwar vom 28.8.-2.10. Es<br />
waren 650 Mann. Als diese Soldaten abrückten, folgten erneut 450 Mann, die bis zum<br />
6.12.1939 blieben. Am 25.9.1939 stand am Rathaus zu lesen: "Beim Schießen der<br />
Flackartillerie gegen Flugzeuge müssen die im Freien befindlichen Personen Deckung<br />
nehmen, da sie sonst durch herabfallende Sprengstücke verletzt werden können."<br />
Während täglich Sondermeldungen über deutsche Siege aus dem Radio tönten, wurden die<br />
Lebensmittel- und Kleiderkarten eingeführt.<br />
Rathausanschläge:<br />
26.9.1939: "Heute Vormittag werden auf dem Rathaus Lebensmittelkarten ausgegeben und<br />
zwar von 1/2 8 - 1/2 11 Uhr."-<br />
7.10.1939: "Ein Aufruf des weiblichen Arbeitsdienstes Jahrgang 1920 und 1921 ist am<br />
Rathaus angeschlagen. Die in Betracht kommenden Dienstpflichtigen haben sich sofort in<br />
Calw mit den erforderlichen Papieren schriftlich zu melden."<br />
16.10.1939: "Sämtliche Angehörige der Jahrgänge 1911 und 1912, soweit sie nicht bereits zur<br />
Wehrmacht eingezogen sind, haben sich morgen, Dienstag, 10 Uhr in Calw zur Musterung zu<br />
stellen"<br />
Sämtliche Kraftfahrzeuge wurden entweder beschlagnahmt oder stillgelegt. Anfangs nahm<br />
man die Lebensmittelkarten nicht so ernst, aber nach und nach wurden sie immer wichtiger.<br />
Jedem standen zuächst 2435 Kalorien zu. Im Laufe des Krieges verkleinerte sich die Ration<br />
mehr und mehr. Bei der Einführung der Bezugscheine für Schuhe und Kleidung gab es<br />
Unruhe unter der Bevölkerung. Die Erklärung des Reichswirtschaftsministeriums vom<br />
27.10.1939, daß man mit dem vorhandenen Schuhbestand bis zum Kriegsende auskommen<br />
müsse, löste erstmals eine große Erbitterung aus. Am 19.11.1939 stellte ein Bericht des SS-<br />
Sicherheitsdienstes fest: "Die Stimmung innerhalb der Landbevölkerung ist, wie aus<br />
Württemberg gemeldet wird, geradezu katastrophal, infolge der absolut ungenügenden<br />
Zuteilung von Arbeitsschuhen an die Bauern. Bei den Ernährungsämtern gehen täglich<br />
Drohbriefe ein." - "Streng handhabte man die Bestimmungen über die Ladenschlußzeiten.<br />
Geschäfte mußten schließen, wenn verdunkelt wurde. Benzin und Mineralöle waren als<br />
kriegswichtige Stoffe rationiert; private Verbraucher mußten zurückstehen. Als Treibstoff<br />
immer knapper wurde, ging man zum Betrieb mit Holzgas aus Generatoren über. Zur<br />
Ergänzung der im eigenen Lande erzeugten Rohstoffe sammelte man Altmaterial aller Art.<br />
Später erstreckten sich die Sammlungen auf Lumpen, Papier, Eisen, Metallteile,<br />
Flaschenkapseln, Folien, Tuben, Korken und Knochen. Die Schulen sammelten regelmäßig<br />
jeden ersten Samstag im Monat." (Fritz Heimberger, Sindelfingen)<br />
Die Gemeinde sollte vier öffentliche Luftschutzkeller ausbauen. Je ein Keller im Schulhaus<br />
und einer im Pfarrhaus waren im März 1940 fertig. Die beiden anderen, davon einer im<br />
46
Lehrerhaus und einer im Haus des Bürgermeisters, sollten in Bälde folgen. Auch der private<br />
Ausbau von Luftschutzräumen ging voran, wie z.B. der Keller in der Calwer Straße 24<br />
(gebaut 1793), der früher als Weinkeller zum "Hirsch" gehört hatte. Auf die Verdunklung<br />
legte man großen Wert, der Gemeindediener und die Luftschutzwarte sowie die Feuerwehr<br />
machten häufig die ganze Nacht über Kontrollgänge und brachten diejenigen, welche<br />
nachlässig waren, zur Anzeige.<br />
Rathausanschläge:<br />
8.12.1939: "Die Abdunklung in Gebäuden wird in letzter Zeit vielfach ungenügend und<br />
fahrlässig durchgeführt. Die Einwohnerschaft wird erneut aufgefordert, für eine vollständige<br />
Abdunklung aller Lichtquellen bei Eintritt der Dunkelheit zu sorgen. Mit Kontrollen ist zu<br />
rechnen."<br />
15.9.1942: "Es wird allen Einwohnern zur Pflicht gemacht, ihre Wohnungen und sonstigen<br />
Räume vollständig zu verdunkeln, weil sonst das ganze Dorf in Gefahr ist. Säumige werden<br />
empfindlich bestraft."<br />
Kraftfahrzeuge brauchten Blenden aus Stoff oder Pappdeckel für ihre Scheinwerfer; das rote<br />
Schlußlicht mußte abgedunkelt werden. Wer nachts auf die Straße ging, durfte nur<br />
Taschenlampen mit Blaulicht verwenden. Selbst Feuer auf dem Felde mußten bei Einbruch<br />
der Dunkelheit gelöscht werden.<br />
1942 bestimmte eine neue Verordnung, daß der Polizeidienst in den Gemeinden mit weniger<br />
als 5000 Einwohnern von der Gendarmerie übernommen werden soll.<br />
"Die Überwachung der Zivilbevölkerung wurde immer schärfer gehandhabt. Jeder über 15<br />
Jahre alte deutsche Staatsangehörige mußte sich eine Kennkarte besorgen, mit der er sich<br />
ausweisen konnte". (Fritz Heimberger, Sindelfingen) Die Feldschützen waren angewiesen, auf<br />
feindliche Agenten und Spione, die eventuell als Fallschirmspringer landen könnten, ein<br />
wachsames Auge zu haben. Im Herbst 1942 kam es dann zu einer Begebenheit, die sich nur<br />
durch die allgemeine Sorge und Anspannung erklären läßt. Es war schon dunkel, als ein paar<br />
halbwüchsige Jungen verstohlen, wie sie meinten, vom Apfelklauen ins Dorf zurückkamen.<br />
Sie gingen im Gleichschritt mit ihren genagelten Schuhen, damit man meinen solle, es sei<br />
bloß einer, weckten aber gerade damit das Mißtrauen eines zufälligen Beobachters, der im<br />
Dorf sonst keineswegs als "verschrocken" galt. Ein Dorfpoet schrieb später:<br />
"Em Gleichschritt gohts der Gailer rei, als ob`s bloß oiner wär, oiner henderm andra drei, do,<br />
pletzlich kommt a Ma en d´Quer. . . .<br />
Dr Ma isch an dr Ulma gstanna, hot os, on mir ehn au net kennt. Mir waret graoße Kerle,<br />
lange, dia grad wie er jetzt Angscht g´het hent.<br />
Mit ra Latern zo gleicher Stond hot der alt Rechner Abort gleert. Dort isch der Obekannte<br />
nomm ond hot dean uffgeklärt:<br />
"Des kenntet Fallschirmjäger sei, dia muaß mr schnellstens fassa! Mit dr Latera hennadrei,<br />
mer derf`s net saua lassa!"<br />
Da im Gasthaus "Hirsch" zur gleichen Zeit eine Parteiversammlung tagte, stürzte der Mann<br />
zum Hintereingang hinein und alamierte die Anwesenden:"Ganz außer Atem bat er hier, es<br />
war kein Grund zum Scherzen:"Bitte schnellstens ein Glas Bier zur Beruhigung meines<br />
Herzens!"<br />
Dui Nachricht hot wia a Bomb eigschlaga. "Wo send se na?", will jeder wissa. Die<br />
Versammlung war, mer kaos ruhig saga, fermlich übern Haufa gschmissa.<br />
"Auf Männer, nicht lang diskutieren, das Vaterland ischt in Gefahr. Keine Zeit ist zu<br />
verlieren. Auf in den Kampf, der Feind isch da!"<br />
Was em Ort no war an Waffa hot mer schnellstens hola lau. Ao d´Parteiführung hot jetzt<br />
missa schaffa, on mit uff Patrullje gau.<br />
47
D`Landwehr hot mer alamiert on´s Iberfallkommando vo Calb kommt iber Hengstett, wenns<br />
pressiert, weils dort vermutlich zerschta knallt.<br />
Bis gega Morga isch des ganga, koa Feind war weit on breit, on mancher hot bei diesem<br />
Fanga omsonscht sich uff an Orda gfreit!"<br />
Doch zurück zu den weiteren Ereignissen. Wie im ersten Weltkrieg kamen des<br />
Arbeitskräftemangels wegen wieder Kriegsgefangene, Franzosen, Polen, Russen und<br />
sogenannte "Ostarbeiter" (zwangsverpflichtete polnische und russische Zivilarbeiter und -arbeiterinnen)<br />
hierher. Die genaue Anzahl läßt sich heute nicht mehr feststellen, es werden<br />
ungefähr 60 Personen. Diese Gefangenen und Arbeiter wurden von der Bevölkerung<br />
unterschiedlich behandelt, was sich dann beim späteren Einmarsch der Franzosen auswirken<br />
sollte. Die meisten hatten ein gutes Verhältnis zu ihren Arbeitgebern, so daß noch Jahre nach<br />
dem Krieg einige Franzosen Gechingen besuchten. Neben der Arbeit in der Landwirtschaft<br />
waren die Gefangenen im alten Steinbruch, beim Bau des Fußwegs nach Deckenpfronn und<br />
des Feldweges im Hilsental eingesetzt. Untergebracht waren sie im "Vöhringer Häusle"; im<br />
Erdgeschoß die Franzosen und oben die Polen. Auch das Wachpersonal kampierte dort. Im<br />
ehemaligen HJ Heim in der Kirchstraße hausten weitere russische Gefangene. Die<br />
Gefangenen wurden streng bewacht, aber die Zivilarbeiter durften sich im Ort frei bewegen,<br />
sie hatten lediglich Ausgangsbeschränkung von 21-5 Uhr. Übertretungen bestrafte man mit<br />
zwei Wochen Straflager oder 20 RM. Von einer Begebenheit soll berichtet werden:<br />
Vereinzelte Landwirte beklagten sich bei den Wachtposten der Gefangenen über schlechte<br />
Arbeitsleistungen. Daraufhin kam ein paar Tage später ein ortsfremdes SS-Kommando, das<br />
die Gefangenen so verprügelte, daß sie tagelang krank waren und nicht arbeiten konnten. Das<br />
hatten die Bauern nicht gewollt. Viele empörten sich darüber, aber keiner getraute sich, das<br />
auch laut zu äußern. Nur Wilhelm Essig, Landwirt und Molkereirechner, schrieb einen Brief<br />
an den Kreisleiter in Calw, in dem er u. a. ausführte, daß eine solche Behandlung von<br />
Gefangenen einem humanen Volk wie dem deutschen schlecht anstehen würde und man sollte<br />
doch auch bedenken, daß Ähnliches vielleicht einmal auch unseren Vätern und Söhnen<br />
zustoßen könnte. Ein mutiger Brief, der in jenen Zeiten das Todesurteil bedeuten konnte. Am<br />
Tage darauf erschien gleich die Gestapo (geheime Staatspolizei) und versuchte unter<br />
Todesdrohungen, Wilhelm Essig zu bewegen, sich von diesem Brief zu distanzieren. Zwei<br />
Tage und Nächte lang wurde er auch von seiner Frau, seiner Verwandtschaft und Kameraden<br />
bearbeitet. Er weigerte sich jedoch und blieb bei seinem Standpunkt: "Was ich gesagt habe,<br />
habe ich gesagt!" Nur durch Vermittlung eines Herrn Leppe, dem Vorsitzenden des Verbands<br />
der Träger der goldenen Verdienstmedaille (aus dem ersten Weltkrieg), dem Wilhelm Essig<br />
angehörte, wurde das Verfahren niedergeschlagen. Er stand aber weiter unter Beobachtung<br />
und Kontrolle.<br />
Das Abhören von Feindsendern war streng verboten und wurde hart bestraft. Natürlich hörten<br />
einige Menschen trotzdem ausländische Sender, sie mußten aber über das Gehörte schweigen<br />
und durften sich nicht erwischen lassen.<br />
Die Landwirte und ihre Erzeugnisse wurden ständig beaufsichtigt und die Ablieferungspflicht<br />
mußte unbedingt eingehalten werden. Der Reichsnährstand, die Partei bzw. ihre Vertreter<br />
meldeten Verstöße zur Bestrafung. Vor allem das Mahlen von Getreide und die Berechtigung<br />
dazu überprüfte man laufend. Auch die Ölmühlen in Stammheim und Schafhausen unterlagen<br />
diesen Kontrollen. Die Landwirte sollten nicht mehr für sich haben, als ihnen zugeteilt war.<br />
Trotz des Krieges konnten nicht alle anderen Aufgaben der Gemeindeverwaltung verschoben<br />
werden. Nach 1924 und 1936 wurde auch 1943 eine Teilflurbereinigung durchgeführt.<br />
Betroffen waren Grundstücke im Deufringer Tal, Weingarten und im Insental.<br />
48
Ab Juli 1944 nahm der Luftkrieg an Stärke zu. Aus dem Gemeinderatsprotokoll vom 2.8.:<br />
"Am Mittwoch, den 19.7., etwa um 11 Uhr vormittags, wurden sieben Sprengbomben<br />
westlich (etwa 50 Meter) des Wasserreservoirs abgeworfen. Zwei Trichter befanden sich auf<br />
der Straße, drei rechts und zwei links in unmittelbarer Nähe. Zwei weitere schwere<br />
Sprengbomben wurden gleichzeitig im Gewann "Gemeine Äcker" (jetziges Industriegebiet)<br />
abgeworfen. Durch Zufall wurde die Hauptleitung der Wasserversorgung getroffen und<br />
zerstört. Die Reparatur nahm man sogleich in Angriff, daß am Freitag, den 21.7., die Leitung<br />
wieder in Ordnung war. 30 Meter neue Leitung wurden eingebaut. Glücklicherweise entstand<br />
an den nahen Gebäuden im Gailer nur geringer Schaden." Kaum hatte sich die Gemeinde von<br />
dem Schrecken erholt, zogen am Freitag, 21.7.1944 bei bewölktem Himmel sehr viele<br />
Flugzeuge (Kampfverbände) über unsere Markung. Dabei fielen am Ortsende, Richtung<br />
Deufringen, neun Sprengbomben und eine Luftmine. Eine davon fiel auf das Grundstück des<br />
Fotografen Otto Weiß, nahe der Gärtnerei, und verursachte in dort großen Schaden, bei den<br />
der Gewächshäusern und Frühbeeten, wurde das Glas völlig zerstört. Die anderen Bomben<br />
fielen über den Bach in die Wiesen und in die Äcker der Gewanne "Mühlhecke" und<br />
"Mulden". An Gebäuden entstand nur geringer Schaden. Die Trichter, die teilweise 100 cbm<br />
Fassungsvermögen hatten, wurden in Gemeinschaftsarbeit aufgefüllt. Unter dem Eindruck der<br />
Angriffe suchte die Bevölkerung sich zu schützen, und so begann eine Gruppe von<br />
Einwohnern unter Leitung von Dr. Stein den Bau eines Luftschutzstollens im "Schießerrain".<br />
Der Stollenbau entwickelte sich von selbst zu einer öffentlichen Angelegenheit und auch der<br />
Bürgermeister schaltete sich ein. Die Geländeaufnahme (Schnitt) wurde durch das<br />
Vermessungsamt Calw veranlaßt und ergab, daß über dem Stollen die erforderliche<br />
Deckungsmasse vorhanden war. Die Gemeinde beteiligte sich mit Holzlieferungen,<br />
Geldzuweisungen und der Stellung von Aufsichtspersonal an dem Bau. Es waren zwei<br />
Stollen, die etwa 47 Meter auseinanderlagen. Die Stollenhöhe betrug zwei Meter und im<br />
Innern der Stollen waren Gasschleusen vorgesehen. Die Eingänge sollten durch Mauern, 2,50<br />
m hoch und 1 m stark, gedeckt werden. Das über dem Stollen liegende Erdreich war 10-15 m<br />
stark, also viel sicherer als die Hauskeller. - Da die seitherige Alarmierung der Bevölkerung<br />
recht mangelhaft war, unternahm Bürgermeister Schmidt alle Anstrengungen, um eine<br />
elektrische Alarmsirene für den Ort zu beschaffen. Schon im März 1944 bestellte er eine<br />
Sirene, aber durch die Materialknappheit und den komplizierten Instanzenweg dauerte es bis<br />
März 1945, ehe das Gerät geliefert wurde. Doch konnte das dazugehörende elektrische<br />
Steuergerät aus den gleichen Gründen nicht beschafft werden, so daß mit einem Handschalter<br />
ein- und ausgeschaltet werden mußte, um einen Heulton zu erzeugen. Ein weiteres Problem<br />
war auch der Stromanschluß, da Elektromaterial nicht zu bekommen war. Anfang April 1945<br />
war dann die Sirene provisorisch angeschlossen und betriebsbereit - gerade noch rechtzeitig,<br />
um vor den noch folgenden Angriffen zu warnen. Durch die schweren Luftangriffe auf die<br />
deutschen Großstädte evakuierte die Regierung Frauen und Kinder auch hierher und brachte<br />
sie in leerstehenden Wohnungen und Zimmern unter.<br />
Im Jahr 1942 führte Bürgermeister Schmidt vorausschauend aus: "Es ist nach dem Kriege eine<br />
Belebung der Bautätigkeit zu erwarten. Die schulentlassene Jugend wird im Raum Böblingen-<br />
Sindelfingen reichlich Beschäftigung finden. Für die Gemeindeerweiterung ist die Aufstellung<br />
eines Ortsbauplanes notwendig, da die Herstellung neuer Häuser nicht mehr willkürlich<br />
erfolgen kann. Außerdem muß ein Projekt für die Kanalisierung aufgelegt werden, um die<br />
dauernden Wasserschäden zu beenden". Diese mitten im Kriege erstellte Prognose wurde<br />
dann 10-15 Jahre später verwirklicht.<br />
In Gechingen waren die letzten Tage des Krieges die schlimmsten. Feindliche Jagdflieger<br />
machten Jagd auf Bauern, die ihre Felder bearbeiteten und beschossen sie mit<br />
Maschinenwaffen. In Deckenpfronn wurde ein Bauer auf dem Acker erschossen ebenso in<br />
Simmozheim. Die auf dem Lerchenberg stationierte Wetterfunkstelle zog immer wieder die<br />
49
Fliegerangriffe auf sich. Am 8.12.1944 zählte man zum Beispiel 22 Bomben. "Öffentliche<br />
Luftgefahr", "Fliegeralarm" und "Entwarnung" wechselten sich mehrmals am Tage ab. Die<br />
Einwohner waren verängstigt und aufgeregt. Am 18.10.1944 erfolgte der öffentliche Aufruf<br />
zur Bildung des Volkssturmes. Jeder deutsche Mann vom 16. bis zum 60. Lebensjahr wurde<br />
zum Dienst mit der Waffe verpflichtet. Der Dienst fand nach Arbeitsende und an Sonntagen<br />
statt. Anfangs war der Volkssturm zum Schanzen-bau eingesetzt; später errichteten seine<br />
Mitglieder Panzersperren und kleine Feldbefestigungen (Schützenlöcher) an sämtlichen<br />
Ortseingängen, um das Vorrücken der feindlichen Truppen zu erschweren. In Gechingen stand<br />
der Volkssturm unter Führung des Ortsgruppenleiters. Im Frühjahr 1945 übergab dieser die<br />
Leitung an den früher schon erwähnten Landwirt und Molkereirechner Wilhelm Essig. Ihm,<br />
der im 1. Weltkrieg die höchste Mannschaftsauszeichnung, die goldene Verdienstmedaille,<br />
erhalten hatte, traute man die Verteidigung des Ortes zu. Wilhelm Essig sagte bei der<br />
Übernahme: "Ja, ich übernehme den Volkssturm und sorge dafür, daß keiner ein Gewehr in<br />
die Hand nimmt." Der Ortsgruppenleiter tat so, als hätte er nichts gehört. Wilhelm Essig<br />
ignorierte in der Folge alle aus Calw kommenden schriftlichen Befehle, die den Volkssturm<br />
zu verschiedenen Einsätzen anforderten. Einen Tag vor der Besetzung durch französische<br />
Truppen kam eine SS-Streife, um ihn wegen Befehlsverweigerung zu verhaften. Sein Sohn<br />
warnte ihn noch rechtzeitig, daß er sich verstecken konnte und die Streife unverrichteter<br />
Dinge wieder abzog. Gechingen wurde also nicht vom Volkssturm verteidigt. Das war auch<br />
mit ein Grund, weshalb es nicht zerstört wurde. Eine Einheit der deutschen Wehrmacht kam<br />
auf ihrem Rückzug durch unseren Ort und bezog eine Stellung beiderseits der Stammheimer<br />
und Althengstetter Straße. Es war die 1. Kompanie des Infantrieregiments 816. Ihr<br />
Gefechtsstand war im Grabenweg in der Kirchhalde. Um den Panzern der Franzosen den<br />
Vormarsch zu erschweren, fällte man die großen schönen Tannenbäume entlang der<br />
Althengstetter Straße und warf sie quer über den Weg. In gleicher Weise verfuhr man mit den<br />
Linden an der Straße nach Dachtel. Schon vorher waren von der Bevölkerung und dem<br />
Volkssturm an den Straßen sogenannte "Panzerdeckungslöcher" gegraben worden. Von diesen<br />
Löchern aus sollten Einzelkämpfer mit Panzerfäusten die feindlichen Panzer erledigen. Am<br />
20.4.1945 vormittags warfen französische Jagdflugzeuge Spreng- und Brandbomben über<br />
dem Ort ab. Beim Anflug fielen auch Bomben auf Stellungen der Wehrmacht in Höhe des<br />
Steinbruchs an der Calwer Straße, weitere landeten bei der Kirche und dem alten Schulhaus.<br />
Dabei kamen im Ort vier Menschen ums Leben, darunter ein fünfzehnjähriger Junge, dem es<br />
den Fuß abriß. Weitere Bomben gingen auf die Scheuer des Gasthauses "Rößle" und das Haus<br />
Böttinger nieder. Dort starben zwei Menschen. Insgesamt kamen folgende Einwohner ums<br />
Leben:<br />
Gottfried Gwinner *17.4.1859, Christian Maier *27.4.1878, Gottlob Niethammer *15.5.1896,<br />
Pauline Rössler *17.10.1906, Albert Schneider *3.8.1929, Wolfgang Schweizer *30.1.1941.<br />
Ein französischer Kriegsgefangener, Julius Charrier, wurde total zerfetzt. Auch unter den<br />
einquartierten Soldaten gab es Verwundete. Die Toten wurden später auf Anweisung der<br />
französischen Besatzungsmacht ohne Feierlichkeiten beerdigt.<br />
Zwei Wohnhäuser und drei Scheuern brannten ab: Eine Scheuer im Hof des Gasthauses<br />
"Rößle", eine Scheuer von Gottlob Böttinger, Metzgergasse, eine Scheuer von Härtkorn, das<br />
Wohnhaus von Gottlob Böttinger, Metzgergasse, das Wohnhaus von Luise Böttinger, Hohe<br />
Gasse. Die Feuerwehr und die Einwohner konnten eine Ausbreitung des Feuers verhindern.<br />
Den ganzen Tag lang bis in den Abend zogen deutsche Truppen durch den Ort, mal Richtung<br />
Stammheim, dann wieder Richtung Deufringen. Da von Westen die Franzosen und aus dem<br />
Raum Heilbronn die Amerikaner vorstießen, herrschte wildes Durcheinander. Große Teile der<br />
deutschen Truppen lösten sich im Ostelsheimer Wald auf. Einige zerstreuten sich, andere<br />
besorgten sich Zivilkleider, und wieder andere gingen in Gefangenschaft. Ihre Ausrüstung lag<br />
noch einige Zeit im Wald. Am 20.4. wurden die Nachbarorte Deckenpfronn und Stammheim<br />
50
schwer bombardiert. Die Brand- und Phosphorbomben richteten verheerenden Schaden an. In<br />
beiden Ortschaften fiel die Hälfte aller Häuser dem Feuer zum Opfer. Den folgenden Tag<br />
waren die <strong>Gechinger</strong> mit Aufräumungsarbeiten beschäftigt. Eine letzte deutsche Kolonne mit<br />
schweren Geschützen, die auf dem Bergwald in Stellung gewesen war, zog durch den Ort<br />
Richtung Deufringen ab. Gegen Mittag rannte plötzlich ein junges Mädchen durch das Dorf<br />
und rief ihrem Vater, der mit Dachdecken beschäftigt war, zu: "Vatter, komm schnell hoim,<br />
d´Franzosa kommat d´Wolfwiesa rei!" Diese Nachricht verbreitete sich mit Windeseile durch<br />
den ganzen Ort. Einige wollten es zwar nicht glauben, doch die Mehrzahl rannte nach Hause<br />
und schloß sich ein. Unser beherzter Mitbürger, Doktor Stein, hißte die weiße Fahne und<br />
verhütete dadurch Schlimmeres. Er wußte, daß der Volkssturm unter Wilhelm Essigs Führung<br />
den Ort nicht verteidigen würde. Dr.Stein, der französisch sprach, teilte dies dem<br />
kommandoführenden Offizier mit. Dieser stand über Funk mit Flugzeugen in Kontakt. Im<br />
Falle einer Verteidigung wären sicher wieder Bomben gefallen. Aber so wurde Gechingen<br />
kampflos besetzt und ein Ortskommandant übernahm die Macht. Er schickte alle<br />
arbeitsfähigen Männer zur Althengstetter und Dachtler Straße, um die gefällten Bäume zu<br />
beseitigen. Die französischen Truppen, es waren in der Mehrzahl Marokkaner, biwakierten in<br />
den Häusern am Ortsrande und richteten sich zur Verteidigung ein. Sie zogen am nächsten<br />
Morgen nach Deufringen weiter, nur eine kleine Besatzung blieb hier. Zwei deutsche<br />
Soldaten, die bei den Kämpfen am 17. und 18.4. am "Doppelten Wald" gefallen waren,<br />
wurden auf dem Friedhof beigesetzt. Trotz aller Beschwernisse und Übergriffe der Besatzung<br />
atmete die Bevölkerung doch auf, daß der Krieg endlich aus war. Leider bezahlten viele<br />
<strong>Gechinger</strong> den sinnlosen Krieg mit ihrem Leben.<br />
Es sind gefallen:<br />
Im Süden: Werner Maier *14.10.1921 +30.1.1944,<br />
Karl Frohnmaier *7.3.1921 +28.4.1944,<br />
Karl Böttinger *5.4.1926 +12.7.1944<br />
Im Westen: Friedrich Gerlach *24.1.1907 +20.1.1945 vermißt 10.1.1945 Elsaß,<br />
Hans Bierle *24.12.1927 +18.4.1945,<br />
Walter Bantel *6.5.1923 +26.11.1944,<br />
Fritz Dingler *20.10.1917 +24.10.1944,<br />
Kurt Kühnle *22.8.1925 +17.9.1944,<br />
Wilhelm Härtkorn *20.8.1895 +16.12.1945,<br />
Paul Böttinger *16.12.1926 +23.12.1944,<br />
Paul Geppert *8.1.1909 +16.2.1945<br />
Im Norden: Hermann Wagner *16.8.1904 +18.8.1945<br />
Im Osten: Gustav Gutmann *28.2.1912 +24.7.1941,<br />
Karl Bantel *27.9.1921 +20.7.1943,<br />
Paul Wagner *22.1.1913 +26.7.1941,<br />
Eugen Dingler *12.10.1919 +29.7.1941,<br />
Adolf Dingler *29.10.1910 +14.12.1942,<br />
Karl Gehring *3.6.1924 +29.7.1943,<br />
Karl Govaers *6.6.1913 +7.8.1943,<br />
Wilhelm Weiß *2.12.1915 +8.8.1944 vermißt 16.8.1944, Rumänien<br />
Adolf Weiß *1.6.1904 +14.8.1944 vermißt 8.8.1944 Rumänien,<br />
Reinhold Eisenhardt *8.10.1924 +9.8.1944 vermißt 22.8.1944 Rumänien,<br />
Robert Schmid *8.5.1924 +14.8.1944 vermißt 6.10.1944 Rumänien,<br />
Heinrich Böttinger *21.11.1913 +22.8.1943,<br />
Jakob Lambert *18.11.1920 +28.8.1942,<br />
Karl Gauß *27.5.1910 +28.8.1943,<br />
Max Eichelbaum *9.8.1907 +6.9.1944,<br />
51
Hans Eichelbaum *19.9.1910. + 1.1945,<br />
Heinrich Weiß *2.9.1913 +8.9.1941,<br />
Christian Kielwein *13.7.1913 +17.9.1947,<br />
Gerhard Kühnle *21.1.1928 +April 1945,<br />
Paul Mack *14.9.1918 +4.10.1944,<br />
Alfred Breitling *19.11.1920. +7.10.1941,<br />
Hermann Breitling *20.7.1908, +13.11.1943,<br />
Wilhelm Böttinger *3.7.1901 +10.10.1942,<br />
Eugen Schumacher *1.3.1906 +17.10.1944 vermißt Litauen,<br />
Friedrich Schneider *21.6.1921 +18.10.1944,<br />
Otto Schumacher *15.11.1922 +27.10.1944,<br />
Wilhelm Rex *3.10.1917 +31.10.1943 vermißt Tschaplinko UDSSR<br />
Eugen Bühler *24.4.1908 +3.11.1943 vermißt Kiew UDSSR,<br />
Karl Gehring *25.3.1923 +9.11.1942,<br />
Walter Groß *1.1.1922 +9.11.1943 vermißt Okt.1943 Witebsk UDSSR<br />
Fritz Heim *13.11.1923 +24.11.1946,<br />
Walter Böttinger *21.4.1924 +2.12.1943,<br />
Wilhelm Süßer *21.6.1912 +3.12.1941,<br />
Albert Schaible *20.4.1915 +7.12.1944,<br />
Fritz Schumacher *4.11.1904 +7.12.1944,<br />
Fritz Gann *4.2.1920 +18.12.1944,<br />
Ernst Breitling *28.11.1911 +19.12.1945,<br />
Wilhelm Wagner *25.9.1906 +5.3.1945 vermißt Fürstenberg-Oder<br />
Karl Böttinger *23.9.1902 +30.10.1944,<br />
Emil Weiß *1.12.1904 +15.2.1943,<br />
Robert Stahl *15.4.1909 +22.7.1944,<br />
Erwin Gräber *27.1.1921 +10.1.1943 vermißt Stalingrad UDSSR,<br />
Hermann Dingler *26.11.1909 +13.1.1945 vermißt Lyk Ostpreußen:<br />
Christian Dingler *2.6.1913 +16.5.1945,<br />
Paul Breitling *25.12.1908 +16.1.1943,<br />
Hermann Breitling *4.3.1914 +12.7.1942,<br />
Willi Mörk *28.9.1926 +20.1.1945 vermißt Kreuzberg Ostpreußen:<br />
Willi Wurst *19.2.1923 +23.1.1945,<br />
Gerhard Wurst *5.7.1925 +10.8.1944,<br />
Otto Schneider *5.3.1899 +27.1.1945 vermißt Benschen/Posen,<br />
Wilhelm Gehring *10.3.1910 +28.1.1943 vermißt Woronesch UDSSR,<br />
Eugen Gehring *19.2.1909 +31.12.1945 vermißt Freienwalde/Oder,<br />
Ernst Ohngemach *23.8.1914 +14.2.1942 vermißt Orel Bolchow UDSSR,<br />
Friedrich Köhnert *10.7.1904 +15.2.1945,<br />
Eugen Rüffle *4.9.1905 +18.2.1943,<br />
Georg Vollmer *3.6.1908 +22.2.1945,<br />
Paul Gehring *14.1.1910 +27.2.1942,<br />
Hermann Gehring *24.3.1920 +10.8.1944,<br />
Eugen Schmohl *27.4.1922 +2.3.1943,<br />
Erwin Spöhr *6.1.1908 +12.3.1945 vermißt Strehlen Oberschlesien:<br />
Willy Vetter *26.8.1909 +5.3.1942,<br />
Rudolf Vetter *20.1.1917 +30.12.1941,<br />
Walter Gräber *1.6.1927 +15.3.1945,<br />
Bernhard Dürr *9.5.1925 +18.3.1944 vermißt Dubno UDSSR,<br />
Richard Brackenhammer *11.11.1908 +18.9.1943 vermißt Leningrad UDSSR,<br />
52
Ernst Brackenhammer *13.6.1907 +18.4.1945 vermißt Küstrin.<br />
Theo Schneider *14.7.1924 +25.3.1945,<br />
Emil Lutz *2.10.1902 +10.4.1945,<br />
Paul Schaible *4.6.1921 +13.4.1945,<br />
Otto Kühnle *16.5.1913 +16.4.1944 verm. Tarnopol,<br />
Otto Kielwein *25.1.1922 +17.4.1943,<br />
Hermann Kielwein *24.8.1923 +30.10.1944,<br />
Wilhelm Lipp *20.11.1909 +26.4.1944,<br />
Paul Essig *24.12.1922 +28.4.1945 vermißt Dresden-Leipzig,<br />
Eugen Böttinger *20.11.1922 +30.4.1944,<br />
Rudolf Benz *27.8.1914 +1.5.1945,<br />
Hermann Mörk *10.6.1917 +18.5.1944 vermißt Witebsk UDSSR,.<br />
Wilhelm Fischer *3.11.1909 +28.5.1944,<br />
Otto Schmid *21.6.1916 +31.5.1943,<br />
Walter Pfeifle *6.1.1920 +1.6.1943 vermißt Stalingrad UDSSR,<br />
Fritz Schwarz *6.5.1920 +15.6.1944 vermißt Orscha UDSSR,<br />
Willi Gehring *4.12.1919 +22.6.1944 vermißt Minsk UDSSR,<br />
Willi Gräber *22.8.1922 +24.6.1944 vermißt Orscha UDSSR,<br />
Richard Gehring *19.9.1920 +28.6.1942,<br />
Pfarrer Lilienfein *6.12.1909 +1.7.1941,<br />
Eberhard Breitling *7.9.1913 +16.7.1941,<br />
Fritz Dürr *23.3.1915 +18.7.1943,<br />
Richard Mörk *17.1.1914 +8.5.1943,<br />
Armin von Büren *14.10.1919 +13.12.1941,<br />
Weltweit ließen 27 Millionen Soldaten und 25 Millionen Zivilisten ihr Leben. Mehrere<br />
Millionen kamen in Gefangenschaft und wurden oft erst nach Jahren wieder entlassen<br />
Für alle Völker, die vom Krieg betroffen waren, waren die Jahre von 1939-45 eine düstere<br />
Zeit, geprägt von Angst, Verfolgung, Tod und Schrecken. Fast in jeder Familie waren nahe<br />
Angehörige ums Leben gekommen, Städte und Dörfer waren durch Beschuß oder Bomben<br />
verwüstet und Millionen hatten ihre Heimat als Flüchtlinge oder Vertriebene verlassen<br />
müssen.<br />
Nachkriegszeit bis heute<br />
Anfang Mai 1945 kam eine französische Einheit in den Ort, die ungefähr zwei Wochen lang<br />
hierblieb. Am Ortsausgang beim Haus Bierle wurde später ein Schlagbaum errichtet. An der<br />
Markungsgrenze nach Deufringen stand ein weiterer, der die Grenze zwischen der<br />
französischen und der amerikanischen Zone bezeichnete. Da einige Landwirte sowohl hüben<br />
als auch drüben Felder bewirtschafteten, erhielten sie sogenannte Passierscheine, die in<br />
verschiedenen Sprachen ausgestellt waren. Von Mai bis Ende Juni durfte die<br />
Gemeindeverwaltung nicht arbeiten. Die Besatzungsmacht regierte und befahl. Im Mai<br />
mußten alle Rundfunkgeräte, zusammen 184, von der Musiktruhe bis zum selbstgebauten<br />
Detektor, abgeliefert werden, außerdem 17 Fotoapparate. Sämtliche Waffen, Gewehre,<br />
Pistolen, auch Teile davon, sowie Munition, insgesamt 185 Stück, kamen am 26.5.1945 zur<br />
Ablieferung. Jede Familie hatte am 20.6. abzugeben: Einen Zivilanzug, bestehend aus Rock,<br />
Weste, Hose und Hut, ein Hemd mit Kragen, zwei Taschentücher, eine Unterhose, ein Paar<br />
Socken, eine Krawatte, ein Paar Schuhe. Alles mußte sich in gutem Zustand befinden. Zum<br />
gleichen Zeitpunkt wurden Bücher und Illustrierte mit nazistischem Inhalt eingesammelt.<br />
Auch später forderte die Militärregierung noch so einiges, wie Rathausanschläge aus dieser<br />
Zeit beweisen:.<br />
53
18.10.1946: "Es wird darauf hingewiesen, daß sämtliche Butterfässer und Zentrifugen sofort<br />
auf dem Rathaus abzuliefern sind. Stichproben in den Häusern durch die Militärregierung sind<br />
möglich."<br />
19.10.1946: "Den säumigen Eierablieferern wird eine letzte Frist gegeben. Die Strafe beträgt 4<br />
RM für jedes nicht abgelieferte Ei. Heute abend ist von jedem Geflügelhalter je ein Ei pro<br />
Henne abzuliefern."<br />
30.4.1947: "Auf Anordnung der Militärregierung muß die Heuablieferung sofort durchgeführt<br />
werden. Es wird restlose Ablieferung verlangt. Jeder landwirtschaftliche Betrieb, auch solcher<br />
ohne Vieh, hat 30 kg Heu oder 50 kg Stroh abzugeben."<br />
17.5.1947: "In Anbetracht der großen Not wurde die totale Ablieferungspflicht für Kartoffeln<br />
angeordnet. Von jedem Ar Anbaufläche müssen mindestens noch 1 kg abgeliefert werden."<br />
12.6.1947: "Laut Mitteilung des Gouverneurs ist ab sofort das Backen von Kuchen und<br />
Kleingebäck verboten."<br />
Selbstverständlich mußte der hier einquartierte Kommandant verpflegt werden, u.a. bekam er<br />
vom Mai bis Juni 1945 32 Mittag- und Abendessen. Die Truppen wurden mit Holz und Heu<br />
beliefert. Für die Versorgung der Bevölkerung im Landkreis waren anfangs nur 40% der Brot-<br />
, Butter- und Fleischproduktion freigegeben. Die Vieh- und Getreideabgaben waren deshalb<br />
hoch, und die Bewirtschaftung ging verstärkt weiter. Auch die Lebensmittelmarken blieben in<br />
Kraft. Jeder Erwachsene hatte vom 16. bis 30. September 1946 Anspruch auf 4500 g Brot und<br />
240 g Fleisch. Die Lebensmittelmarken wurden am Anfang des Monats ausgegeben, jedoch<br />
wurden die Marken jeweils in "Zuteilungsperioden" aufgerufen, die je nach Versorgungslage<br />
kürzer oder länger sein konnten, ebenso wich die Art und Menge der zugeteilten Lebensmittel<br />
oft erheblich voneinander ab.<br />
Im Laufe der nächsten zwei Jahre wurde die Versorgung immer schlechter. 1947 und Anfang<br />
1948 herrschte überall Mangel: "Januar 1948, 110. Zuteilungsperiode: Zucker 125 g,<br />
Nährmittel 250 g, Fett 12,5 g, Fleisch 100 g, Brot 1750 g." Das Fett, 12,5 g, reichte gerade,<br />
um zwei Brotschnitten zu bestreichen. Im November 1948 war die Fleischration auf 75g in<br />
der Woche zusammengeschrumpft, Wurst inbegriffen. Erst ab 1949 verbesserte sich die<br />
wirtschaftliche Lage, und die Lebensmittelkarten konnten nach und nach abgeschafft werden.<br />
Doch zurück in das Jahr 1945. Am 30. Juni erschienen bei dem noch amtierenden<br />
Bürgermeister Schmidt zwei Vertreter des antifaschistischen Kreisvertrauensrat Calw. Sie<br />
hatten den Auftrag, in unserer Gemeinde einen Vertrauensrat zu bilden. Nach Beratung und<br />
Abstimmung wählte man einen Rat mit neun Mitgliedern. Die Landwirte waren durch fünf,<br />
die Gewerbetreibenden durch zwei und die Arbeitnehmer ebenfalls durch zwei Mitglieder<br />
vertreten. In einer anschließenden Beratung der Vertreter von Calw und Gechingen wurde<br />
dem nicht teilnehmenden Bürgermeister Schmidt einstimmig das Vertrauen ausgesprochen.<br />
Der Rat erwartete aber, daß alles, was an die Nazipartei erinnerte, verschwinde. Dann wählte<br />
man noch eine Dreimannkommission für die Viehablieferung an die Militärregierung. Am<br />
14.8.1945 wurden alle Bürgermeister des Kreises nach Calw berufen. Capitän Frenot,<br />
Gouverneur der Militärregierung, sprach über die Ernährungslage, die Rückführung der<br />
verschleppten Zwangsarbeiter, Kriegsgefangenen und Umquartierten, außerdem über das<br />
Transportwesen und die Beschlagnahmungen. Er erklärte, daß für das deutsche Volk ein in<br />
jeder Beziehung sehr schwerer Winter bevorstünde. Der Kreis hätte ab sofort wöchentlich 60<br />
Stück Schlachtvieh zu liefern. Auf unsere Gemeinde entfielen als erste Umlage 10 Stück<br />
Großvieh. Als Bürgermeister Schmidt wieder zu Hause war, erfuhr er telefonisch, daß mit<br />
dem Vieh auch 5 Fahrräder abzugeben waren. In Althengstett war die Ortskommandantur, der<br />
auch Gechingen unterstellt war. Es handelte sich um die 8. Kompanie des Inf. Reg. 126. Der<br />
Kommandant befahl, bis 1.10. 50 Raummeter Holz zu schlagen und nach Althengstett zu<br />
54
ingen. Dazu waren zwei Arbeitsschichten mit je 12 Mann an 8-10 Tagen notwendig. Das<br />
Holz schlug man im oberen Heiligenwald. Überall im Kreis Calw war in ähnlicher Weise<br />
Holz zu schlagen und abzuliefern.<br />
Für die dort in Quartier liegenden Truppen mußten 100 Wolldecken nach Teinach gebracht<br />
werden. An die Kommandantur in Ostelsheim waren zu liefern:<br />
Am 5.8.: 350 kg Kartoffeln, 150 Eier, 15 kg Butter, 5 kg Zwiebeln, 50 kg Gemüse, 2 kg Malz,<br />
4 kg Fett, 1 kg Knoblauch und 5 Schafe.<br />
Am 20.10.: 40 Zt. Kartoffeln, 60 kg Erbsen, 50 kg Linsen und ein großer gußeiserner Ofen.<br />
Am 5.9.45 wurde der Fabrikant Emil Wagner von den Franzosen zum ersten Landrat der<br />
Nachkriegszeit für den Kreis Calw ernannt. Wie einst der Amtmann war er total abhängig,<br />
aber für alles zuständig, sowohl für die Sicherung der Ernährung und die Versorgung mit<br />
Wirtschaftsgütern als auch für den Verkehr. Außerdem hatte er die ehemaligen Landes- und<br />
Reichsbehörden, wie Post und Bahn, zu leiten.<br />
Die Zonengrenze sollte außer dem Personen- auch den Güterverkehr sperren. Gerade im Kreis<br />
Calw, der ja im Grenzbereich lag, gab es dadurch in vielen Bereichen unerträgliche<br />
Mangelzustände. So fanden bald trotz strikten Verbots Kompensationsgeschäfte über die<br />
Zonengrenze hinweg statt. Als Tauschgüter wurden Lebensmittel, Holz, Spirituosen, Textilien<br />
und feinmechanische Erzeugnisse eingesetzt.<br />
Der im Schießerrain gebaute Luftschutzstollen sollte auf Anweisung der Militärbehörde<br />
gesprengt werden, doch die Gemeinde vereinbarte, daß das Stollenholz im Quergang und im<br />
hinteren Eingang bis zur Gasschleuse ausgebaut wurde. Anschließend schüttete man die<br />
Eingänge zu. Eine Sprengung hätte mit Sicherheit einen Schaden an den umliegenden<br />
Gebäuden verursacht.<br />
Durch schwere Wolkenbrüche waren einige Straßen so schlecht, daß Reparaturen sinnlos<br />
erschienen. Im September bezeichnete Bürgermeister Schmidt den Ausbau der Kanalisation<br />
als vordringliche Aufgabe der Zukunft. In der gegenwärtigen Lage gab es dazu allerdings<br />
keine Möglichkeit.<br />
Im Zuge der "politischen Säuberung" wurde Bürgermeister Schmidt entlassen und Wilhelm<br />
Gräber vom Kreis als neuer Bürgermeister kommissarisch eingesetzt, dazu wurde ein<br />
sechsköpfiges Gemeinderats-Komitee gebildet, das am 15.11.1945 erstmals zusammentrat.<br />
Diese Verwaltung blieb im Amt, bis die am 15.9.1946 durchgeführte erste demokratische<br />
Nachkriegswahl einen neuen Gemeinderat und einen neuen Bürgermeister brachte. Es war in<br />
dieser Zeit nicht leicht, allen Forderungen der Besatzungsmacht nachzukommen und diese<br />
gegenüber den Bürgern zu vertreten. Otto Weiß erklärte in seiner Antrittsrede am 1.10.1946:<br />
"Es wird mein äußerstes Bestreben sein, stets unparteiisch zu sein und jedermann, ohne<br />
Ansehen seiner Person oder politischen Haltung, die gleichen Rechte, aber auch die gleichen<br />
Pflichten einzuräumen." Ein Versprechen, welches er, wie seine späteren Wahlerfolge zeigten,<br />
auch gehalten hat. Die neue Verwaltung hatte gleich ihre erste Bewährungsprobe mit der<br />
Verteilung und Auswertung von Volkszählungsbogen zu bestehen. Die Zählung ergab 935<br />
Einwohner, 31 seither Vermißte und 35 Kriegsgefangene hatten sich brieflich gemeldet.<br />
1946/47 erlaubten die Militärbehörden den Vereinen wieder die Aufnahme ihrer Tätigkeiten.<br />
Noch im Laufe des Jahres gab es Landtagswahlen in der französisch besetzten Zone und eine<br />
Volksabstimmung über die Verfassung von Württemberg-Hohenzollern. Die neue Verfassung<br />
wurde mit 268 661 gegen 116 013 Stimmen angenommen.<br />
Auch die Feldwege hatten unter dem Wetter so gelitten, daß der Gemeinderat im Juli 1946<br />
beschloß, nach Artikel 173 der Gemeindeordnung Hilfsdienste anzuordnen. Leistungspflichtig<br />
war von jedem landwirtschaftlichen Betrieb eine Person. Sämtliche Pferde- und Ochsenhalter<br />
55
hatten Fahrdienst zu leisten. Drei Tage lang mußte ohne Entschädigung gearbeitet werden, für<br />
die Arbeit darüber hinaus wurden für die Stunde 60 Reichspfennig bezahlt.<br />
Mit den Abgaben ging es weiter. Für 1947 waren 80 Schweine und 1 875 Doppelzentner<br />
Kartoffeln zu liefern, außerdem eine größere Menge weißer Bettwäsche. Erschwert wurde die<br />
Erfüllung der Quote durch das schlechte Wetter in jenem Sommer, Hagelschläge vernichteten<br />
Hafer und Gerste fast vollständig.<br />
Aus den Orten und Städten des Umlandes zogen viele Bewohner zu Fuß in die Dörfer,<br />
manche sogar mit Handwagen, um Lebensmittel einzutauschen oder zu hamstern. Zur<br />
Erntezeit waren die Felder von Ährenlesern überlaufen, die auf diese Weise ihre Rationen<br />
erhöhten. Weitere Holzeinschläge wurden angeordnet im Gewann "Pfutsch" und "Birkwald".<br />
Die 39 Arbeiter der SAFT (Societé Alsacienne d`Exploitations Forestières et de Transports -<br />
Elsässische Gesellschaft für Holzeinschlag und Transport) waren in Privatquartieren<br />
untergebracht. In der Küche im Gasthaus "Hirsch", aus der diese Arbeiter verpflegt wurden,<br />
geschah am Freitag, den 21.11.1947, ein Unglücksfall, bei dem eine junge <strong>Gechinger</strong>in das<br />
Leben verlor. Die Holzhauer kamen wie jeden Tag kurz nach 18 Uhr vom Wald nach Hause<br />
und nahmen im Speiseraum Platz. In der Küche nebenan wurde von der Hirschwirtin und drei<br />
Gehilfinnen das Essen gekocht. Ein zum Holzkommando gehörender 52jähriger Mann aus<br />
dem Elsaß betrat vom Hof kommend die Küche. Er hatte ein Jagdgewehr in der Hand, dem er<br />
die Patronen entnahm. Er glaubte, das Gewehr sei nun entladen, legte zum Spaß den Lauf<br />
einer 22jährigen Frau an die Hüfte und drückte ab. Ein Schuß löste sich, die Verletzte brach<br />
zusammen und starb trotz Operation im Calwer Krankenhaus.<br />
Seit Jahrzehnten hatte es keine so schlechte Ernte gegeben wie im Jahre 1948. Die<br />
Hauptursache war das Fehlen von Düngemitteln. Auch die Obsternte ließ sehr zu wünschen<br />
übrig. Dagegen gab es viele Kartoffeln. Das unter Zwangsbewirtschaftung angebaute Gemüse<br />
war durch die schlechte Witterung völlig verdorben, es konnte nichts geerntet werden. Ein<br />
Lichtblick in diesem Jahr war das Wegfallen der Passierscheine, dadurch wurde der Verkehr<br />
zwischen den besetzten Zonen erleichtert. Als Start für eine neue Zukunft erwies sich die<br />
Währungsreform am 20.7.1948. Jeder erhielt ein "Kopfgeld" von 40 DM. Die Sparkonten<br />
wurden 10:1 abgewertet.<br />
Das Jahr 1948 endete mit Gemeinderats- und Kreistagswahlen. Bürgermeister Otto Weiß<br />
wurde mit Mehrheit wiedergewählt und am 5.1.1949 in sein Amt eingesetzt. Ein besonderes<br />
Problem war nun die Einweisung und Unterbringung von Flüchtlingen und Ausgewiesenen in<br />
leerstehende Zimmer und Wohnungen. Im Januar 1949 sollte die Gemeinde wieder 126<br />
Personen aufnehmen. Da die Beschaffung von Bettzeug große Schwierigkeiten bereitete,<br />
kaufte die Gemeinde 23 Strohsackgarnituren beim Umsiedleramt. Wegen der Verlagerung der<br />
Hollerith-Werke (heute IBM) von Hechingen nach Sindelfingen/Böblingen benötigten die<br />
Mitarbeiter dieser Firma Wohnraum, den die Gemeinde Gechingen zur Verfügung stellen<br />
sollte. Es wurden dann etwa 50 Werksangehörige hier untergebracht. Dafür entfiel vorläufig<br />
die vorgesehene Aufnahme von Flüchtlingen. Zum Hollerith-Werk gelangten die Arbeiter mit<br />
dem Postbus, der seit der Aufhebung des Passierscheinzwanges wieder regelmäßig verkehrte.<br />
Im Juni 1950 betrug die Einwohnerzahl 1035 Personen, davon 463 männliche und 572<br />
weibliche, darunter 79 Kinder von 0-5 Jahren und 150 von 6-14 Jahren, 62 waren Jugendliche<br />
von 14-18 Jahren. Gechingen hatte 282 Haushalte. Auf ein Wohngebäude kamen<br />
durchschnittlich 4 Personen.<br />
1950 gestaltete Lehrer F. Binder mit der Unterklasse eine Heimatausstellung im Schulhaus.<br />
Nach der Führung durch die Schule, in der neben vielen alten Dokumenten, Büchern,<br />
Trachten und Bildern auch Gemälde der vier <strong>Gechinger</strong> Kunst- und Heimatmaler gezeigt<br />
werden konnten, sangen die Schüler Heimatlieder. K. F. Essig sprach über seine<br />
Forschungsarbeiten aus der <strong>Gechinger</strong> Geschichte. Lehrer Binder wies in seiner Rede darauf<br />
56
hin, daß diese Ausstellung die Notwendigkeit eines Heimatmuseums klar erweise. Leider<br />
verfolgte man damals diese Anregung nicht weiter, die Umstände waren dagegen. Es gab<br />
Wichtigeres zu tun, zum Beispiel so notwendige Arbeiten wie Bachregulierung und<br />
Kanalisation. Im ersten Abschnitt korrigierte man den Bach und zwar von der Wette<br />
(Feuersee) bis zum Ortsausgang. Ein offener Bachlauf kam aus technischen Gründen nicht in<br />
Frage. Es war zweckmäßig, die 450 m lange Strecke ganz unterirdisch zu führen. Aus<br />
Kostengründen beschloß man, den Bau in eigene Regie zu nehmen unter Leitung von<br />
Gemeinderat und Wegmeister Eugen Schwarz. Ein Jahr später, im Oktober 1951, waren die<br />
Maßnahmen fast abgeschlossen. Die Baukosten betrugen samt dem Ausbau des<br />
Feuerlöschteiches 111 500 DM. Damit waren die Voraussetzungen für die Kanalisation<br />
geschaffen. Als erstes wurde die Leitung vom Gasthaus "Adler"-Kunzengasse-Metzgergasse-<br />
Bach in Angriff genommen, denn das war die Strecke, an der immer die stärksten<br />
Beschädigungen durch Regenfälle auftraten. 1952 waren die Dachtler und Dorfäckerstraße<br />
kanalisiert, weil man zur Beschleunigung der Arbeiten einen Bagger eingesetzt hatte. Als<br />
dann 1953 die Gartenstraße auch fertig war, hatte man den alten Ortskern mit einem<br />
Kostenaufwand von nur etwa 200 000 DM entwässert. Die Einwohner wurden mit keinerlei<br />
Anliegerbeiträgen belastet, sogar die Rohre für die Hausanschlüsse gab es kostenlos. Zur<br />
gleichen Zeit konnten die Arbeiten am Feuerlöschteich beendet werden. Der Stundenlohn für<br />
die Arbeiter betrug damals 1,20 DM.<br />
Ein weiteres großes Vorhaben war der Bau neuer Feldwege und Steigen. Die Steigen im<br />
"Nonnental" und "Stockauf" waren schnell fertig, dagegen mußte für die neue Steige nach<br />
Dachtel die Pfarrscheuer erworben, abgebrochen und eine Brücke über den Bach gebaut<br />
werden. Die neuen Steigen brachten eine wesentliche Erleichterung für die Landwirtschaft.<br />
Die Kosten teilten sich die Gemeinde, der Staat und die Grundstückseigentümer.<br />
Langsam begann sich auch der private Wohnungsbau zu regen. Für die ersten Bauten im<br />
"Kreuz" und in den "Hochtennen" erstellte die Gemeinde einen Ortsbauplan.<br />
Die Ortsstraßen waren, wie schon berichtet, in einem üblen Zustand. 1921 hatte man sie zum<br />
letztenmal instandgesetzt. Durch das Einlegen der Kanalisationsrohre hatte sich der<br />
Straßenzustand noch mehr verschlechtert. 1953 teerte und walzte man die Straßen und versah<br />
sie, soweit möglich, mit Bordsteinen und Gehwegen. Dabei wurde auch gleich der Dorfplatz<br />
in der Metzgergasse angelegt und zwar auf dem Platz der durch Bomben am 20. April 1945<br />
zerstörten Häuser.<br />
Ende 1953 hob der Gemeinderat die Wohnraumbewirtschaftung auf. Diese hatte viel Ärger<br />
verursacht. Von nun an konnte jedermann seine Wohnung wechseln oder vermieten wie er<br />
wollte. Das war ein weiterer Schritt zur Normalisierung der Verhältnisse.<br />
Um den Ort herum sammelte sich seit einigen Jahren in den Hecken zunehmend Unrat an.<br />
Jetzt beschloß der Gemeinderat, daß eine Müllabfuhr eingerichtet werden sollte. Vorgesehen<br />
war eine einmalige Abholung pro Monat, wobei der Müll von den Bürgern selbst aufgeladen<br />
werden sollte.<br />
Trotz der 1937 durchgeführten Bachregulierung im unteren Tal waren dort wieder<br />
Maßnahmen notwendig geworden, die nun in Angriff genommen wurden. Das Bachbett war<br />
zum Teil erheblich ausgewaschen, außerdem mußte es im Zuge der Flurbereinigung an<br />
manchen Stellen verlegt werden. Die Arbeiten zogen sich in Etappen über Jahre hin.<br />
Die Flurbereinigung wurde 1950 in Angriff genommen. Sie war von absoluter Notwendigkeit.<br />
Durch die Realteilung bei Todesfällen waren die Äcker immer kleiner geworden. Schon in der<br />
Oberamtsbeschreibung von 1860 ist vermerkt: "Die Markung ist so sehr vertheilt, daß die<br />
meisten Grundstücke nur 1/4-1/2 Morgen betragen." Das waren 8 bis 16 ar. Mit der<br />
Abwanderung der Arbeitskräfte in die Industrie und dem Einsatz von leistungsfähigeren<br />
landwirtschaftlichen Maschinen wurden die kleinen Äcker immer unrentabler. Im Verlauf der<br />
57
Umlegung bezog man nachträglich sogar die Grundstücke mit ein, die schon 1903, 1924, 1936<br />
und 1943 der Flurbereinigung unterlegen waren. Als 1959 die Zuteilung erfolgte, war eine<br />
Parzellenminderung von 5:1 erreicht und ca. 760 ha waren umgelegt worden. Alle betroffenen<br />
Grundstücke müssen in vollem Umfang auch bei Erbfällen erhalten bleiben. Im Lauf der<br />
Flurbereinigung wurden auch ca. 40 km Feldwege befestigt. Die Gesamtkosten für diese<br />
Maßnahmen beliefen sich auf 700 000.- DM, wobei ein staatlicher Zuschuß von 50% gewährt<br />
wurde.<br />
Nachdem der Gemeinderat schon 1955 mehrmals über den Bau einer Mehrzweckhalle beraten<br />
hatte, erfolgte die Bauausschreibung im Februar 1956. Man entschied sich für eine Halle mit<br />
einem Grundriß von 12 x 35 m im früheren Garten der Familie Ziegler an der Althengstetter<br />
Straße. Vorgesehen war eine Mehrzweckhalle mit Bühne, ein Übungsraum für die Vereine<br />
sowie eine Küche und ein Schankraum. Im Untergeschoß sollten zwei Räume für den<br />
Kindergarten, ferner Wannen und Duschbäder, eine Waschküche, eine Backstube und die<br />
Hausmeisterwohnung Platz finden. Die beiden Häuser "Mörk" und "Kneib" mußten dem<br />
Neubau weichen und wurden abgebrochen. Dadurch konnte auch die Althengstetter Straße<br />
verbreitert werden. Am 30.12.1957 konnte die neue Halle eingeweiht werden. Zur Eröffnung<br />
wurde das Theaterstück "Der Letzte seines Stammes" unserer Heimatdichterin Tillie Jäger<br />
aufgeführt.<br />
Weiter baute die Gemeinde ein Försterhaus und einen neuen Farrenstall in der<br />
Dorfäckerstraße. Die Ansiedelung von Industriebetrieben zur Stärkung der Finanzkraft war<br />
schon immer ein Anliegen der Verwaltung gewesen. Den Anfang machte 1948 die Firma<br />
Motoren-Dürr in der Angelstraße. Da sie sich im Laufe der Jahre immer mehr vergrößerte,<br />
wurde ein Umzug notwendig. Vorgesehen war zunächst, ins "Kreuz" auszuweichen, doch das<br />
war aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht realisierbar. An der Gültlinger Straße wurde<br />
dann ein Industriegebiet ausgewiesen, in dem heute neben dem Neubau der Firma Motoren-<br />
Dürr mehrere kleinere und mittlere Betriebe stehen.<br />
Die Bundeswehr plante in den Jahren 1956-1961, in den Gewannen "Hinteres und Vorderes<br />
Lehen" Munitions- und militärische Schießanlagen einzurichten. Von den Bürgern und den<br />
Gemeinderäten wurde dieses Projekt lange diskutiert. Sie entschieden sich dann mit Mehrheit<br />
gegen den Bau der Anlagen.<br />
Durch die gute Wirtschaftsentwicklung nahm die Bautätigkeit zu. Die Baugebiete "Gültlinger<br />
Straße", "Oben im Gailer" und "Angelländer" wurden erschlossen. Schon um dort die<br />
Wasserversorgung zu sichern, wäre der Bau eines Hochbehälters angebracht gewesen. Wegen<br />
der 1960 begonnenen Baues der Bergwaldsiedlung wurde er dann zwingend notwendig. Die<br />
Kosten des Hochbehälters beliefen sich auf 320 000 DM. Die Siedlung Bergwald umfaßt 100<br />
Grundstücke, die mit Gebäuden im Landhausstil bebaut wurden. Die Erschließungskosten<br />
betrugen ca. 1 300 000 DM, wozu noch die Kosten für die notwendig gewordene Kläranlage<br />
kamen. Sie wurde im Oxidationsgrabensystem erstellt und im Frühjahr 1964 in Betrieb<br />
genommen. Die Kosten beliefen sich auf 220 000 DM.<br />
Um für die Landwirte, die im Altort keine Ausdehnungsmöglichkeiten mehr hatten, Platz zu<br />
schaffen, wurden von der Württembergischen Landsiedlung Aussiedlerhöfe gebaut. 1959 sind<br />
in den Gewannen "Stockauf", "Damshalde" und "Weidenselten" fünf Höfe erstellt worden.<br />
Das alte Rathaus war wegen der zunehmenden Bevölkerung und den dadurch wachsenden<br />
Verwaltungsaufgaben zu klein geworden, weshalb man einen Neubau plante. Durch den Kauf<br />
und Abbruch des Gasthauses "Adler" entstand ein zentraler Platz, der für ein neues Rathaus<br />
geeignet war. 1971 begannen die Bauarbeiten, die am 8.12.1972 abgeschlossen waren. Jetzt<br />
hatte die Gemeinde ein repräsentatives Verwaltungsgebäude, in welchem auch noch drei<br />
Geschäfte unterkamen. Mit dem "Steckenpferd" öffnete man das Rathausfoyer den<br />
58
Hobbykünstlern für Ausstellungen aller Art. Das alte Rathaus, umgebaut und renoviert, dient<br />
nun als Kinderstube, als Übungsmöglichkeit für den Chor und beherbergt den örtlichen<br />
Polizeiposten. Gleichzeitig wurden im Zuge der Ortskernsanierung zwei Scheuern und ein<br />
Wohnhaus an der Kunzengasse abgerissen. So entstand ein großer Dorfplatz, der auch<br />
genügend Parkplatz bietet und den Busverkehr nach Dachtel erleichtert.<br />
Mit der Aufstellung neuer Bebauungspläne befriedigte die Gemeinde die steigende Nachfrage<br />
nach Bauplätzen. Nacheinander wurden die Gebiete "Angel I, II und III", "Zellenäcker",<br />
"Weingarten", "Furt", "Dorfäcker I und II" und "<strong>Gechinger</strong>" erschlossen und im Verlauf der<br />
siebziger Jahre bebaut.<br />
Fast hundert Jahre lang hatte das Waschhaus am Feuersee seinen Dienst getan, zuerst mit<br />
Kesseln und Holzfeuerung; vor dem Zweiten Weltkrieg dann schon mit elektrischer<br />
Waschmaschine. 1957 wurde die Wäscherei in die Gemeindehalle verlegt und 1971<br />
eingestellt, weil die einzelnen Haushalte sich immer mehr eigene Waschmaschinen<br />
anschafften.<br />
Neunzehn Jahre lang, von 1954 bis 1973, führte Familie Staiger im Auftrag der Gemeinde die<br />
Müllabfuhr durch. Wegen der Schließung unseres Müllplatzes trat die Gemeinde dem<br />
Zweckverband "Mülldeponie Simmozheim" bei, die den Müll zentral sammelte und abfuhr.<br />
Anläßlich der letzten Fahrt des alten "Kutterautos" verfaßte Heinz Krugler folgende Zeilen:<br />
"Wie das knattert,<br />
Nur so rattert,<br />
Blechern scheppert,<br />
Grausig kleppert,<br />
So kommt´s stöhnend,<br />
Fauchend, dröhnend<br />
Und mit mächtigem Gebrumm<br />
In dem ganzen Flecken rum,<br />
Vorne drin die Staigerin.<br />
Kuttereimer,<br />
Da noch einer!<br />
Wie die fliegen,<br />
Laßt nichts liegen!<br />
Hinten rein geht,<br />
Was herumsteht.<br />
Wieder sind die Fäßla leer.<br />
"Auf geht´s Leutla, Kutter her!"<br />
So ruft laut die Staigerin.<br />
Wie das rumpert,<br />
Schrecklich wumpert.<br />
Hartes Stoßen<br />
In der großen<br />
Autotonne.<br />
Eis und Sonne.<br />
"Kommt´s au dick vo obe rah,<br />
Samschtigs sent mir immer da!"<br />
Lacht da nur die Staigerin.<br />
59
Letzte Runde,<br />
Alter Kunde,<br />
Rollt der Wagen<br />
Ohne Klagen<br />
Nach viel Dreck<br />
Nun ins Eck.<br />
Neue Bräuche ziehen ein.<br />
So wie´s war, wird´s nimmer sein.<br />
Sagt auch Dank der Staigerin."<br />
1971 erreichte die Diskussion um die Verwaltungsreform ihren Höhepunkt. Da Bestrebungen<br />
im Gang waren, den Kreis Calw aufzulösen, trat an Gechingen die Frage heran, wie man sich<br />
entscheiden sollte. Deckenpfronn und Dachtel orientierten sich sofort zum Kreis Böblingen,<br />
während Ostelsheim und wir noch zuwarteten. Zur Diskussion stand auch die Eingemeindung<br />
unseres Ortes und Stammheims in die große Kreisstadt Calw. In einer öffentlichen Sitzung am<br />
10.3.1972, zu der fast alle Einwohner kamen, entschied sich die Mehrheit für die<br />
Selbständigkeit. Dieses Ziel konnte 1973 dadurch erreicht werden, daß Gechingen einem<br />
Verwaltungsverband, bestehend aus Althengstett, Ostelsheim, Simmozheim, Neuhengstett<br />
und Ottenbronn, beitrat. Seinen Beitritt machte Gechingen davon abhängig, daß es<br />
selbständiger Teilverwaltungsraum bleiben konnte. Der Kreis Calw und mit ihm unsere<br />
Gemeinde kamen am 1.2.1973 zur Region Nordschwarzwald mit dem Sitz in Pforzheim. Wir<br />
wechselten damit auch vom Regierungsbezirk Südwürttemberg (Tübingen) zum<br />
Regierungsbezirk Nordbaden (Karlsruhe) über. Die Befürchtungen, daß der Kreis Calw<br />
aufgelöst werden könnte, bewahrheiteten sich nicht. Als Kuriosum sei hier vermerkt, daß eine<br />
Karlsruher Zeitung wenig später unser gutes Schwäbisch als "ostbadischen" Dialekt<br />
bezeichnete!<br />
Eine Erweiterung und Renovierung der Gemeindehalle, die lange Jahre auch als<br />
Schulturnhalle benutzt wurde, war dringend notwendig geworden. Am 7.2.1976, nach rund<br />
zehnmonatiger Bauzeit, erfolgte die Übergabe an die Bevölkerung. Bald danach wurde dort<br />
der Seniorentreffpunkt gegründet, eine Initiative, an der sich die Kirchen, die bürgerliche<br />
Gemeinde und eine Schar freiwilliger Helfer beteiligen. Heute trifft sich der Kreis auch häufig<br />
im evangelischen Gemeindehaus. Das abwechslungsreiche Programm wird von Vereinen,<br />
Gruppen, Schule und Bürgern gestaltet.<br />
Wegen der vielen Neubaugebiete trat eine Überlastung der Kanäle auf, ein Gesamtkanalplan<br />
wurde notwendig. Dieser sah den Bau von sechs Regenüberlaufbecken (RÜB) und zwei<br />
Regenrückhaltebecken (RRB) vor. Diese Becken erbaute man im Lauf der folgenden Jahre.<br />
Beim überlasteten Hauptsammler mußten auf der ganzen Länge die alten Rohre gegen neue<br />
mit größerem Querschnitt ausgewechselt werden.<br />
Als der langjährige Bürgermeister Otto Weiß 1978 in den Ruhestand trat, fand im September<br />
1978 eine Bürgermeisterwahl statt. Zwei Bewerber standen sich in einem spannenden<br />
Wahlkampf gegenüber. Mit 776 gegen 722 Stimmen konnte sich Herr Rainer Dannemann<br />
gegen seinen Mitbewerber durchsetzen.<br />
Die Schwerpunkte in den Jahren 79/80 waren einmal der dringend erforderliche Bau einer<br />
größeren Kläranlage und die Erschließung des Baugebiets "Gailer" mit rund hundert<br />
Baugrundstücken. Immer noch herrschte große Nachfrage nach Bauplätzen.<br />
Der 1978 aufgegebene Farrenstall wurde umgebaut und von der Feuerwehr und dem Bauhof<br />
bezogen. Der Bauhof und seine Mitarbeiter richteten im "Gailer", beim Finkenweg und auf<br />
dem Bergwald Spielplätze ein. - Bald geriet der Bauhof aber in Platz- und Raumnot. Ende<br />
1989 erwarb die Gemeinde das Anwesen einer Baufirma auf dem Angel und konnte nun dem<br />
60
Bauhof einen größeren Platz zur Verfügung stellen. Die Feuerwehr wird die frei werdenden<br />
Räume für Schulungszwecke nutzen.<br />
1980 war ein Jahr der Wahlen, Landtagswahl, Bundestagswahl und Gemeinderatswahl folgten<br />
aufeinander.<br />
1981 besuchte der Landrat unsere Gemeinde. Der Bürgermeister machte ihn mit unserem Ort,<br />
seiner Struktur und seinen öffentlichen Einrichtungen bekannt. Bei der anschließenden<br />
Rundfahrt durch die Markung besichtigte man auch das Gelände, auf dem verschiedene<br />
Bürger gerne die Anlage eines Golfplatzes veranlaßt hätten. Der Antrag war abgelehnt<br />
worden, weil der Golfplatz Naturschutz und Landwirtschaft beeinträchtigt hätte. Um die<br />
Umwelt zu schützen und die Gemarkung sauber zu halten, führen Schule und Vereine seit<br />
einigen Jahren regelmäßige Feld- und Waldreinigungen durch. Alteisen-, Glas- und<br />
Batteriecontainer wurden aufgestellt, um das Müllaufkommen zu verringern. Für die<br />
bedrohten Kleintiere, wie Frösche und Salamander, legte man als Biotop einen kleinen See an.<br />
Das Waldsterben machte auch vor unserer Gemeinde nicht halt. Unsere 500 ha Wald sind und<br />
waren von jeher ein gewichtiger Bestandteil des Gemeindevermögens. Der Gemeinderat<br />
verfaßte eine Denkschrift über das Waldsterben und sandte sie an alle politischen<br />
Persönlichkeiten. Darin heißt es: "Allein in unserer kleinen Gemeinde mit 3 200 Einwohnern<br />
und etwa 500ha Mischwald ist durch das Waldsterben ein Verlust von ca. 100 000 DM<br />
anzunehmen". Diese Denkschrift zeigte keine nennenswerte Wirkung. - Man glaubt heute<br />
aber, daß durch die Muschelkalkböden in unserem Gebiet der saure Regen zum Teil<br />
neutralisiert wird und das Waldsterben sich langsamer ausbreitet. Zur Vorsorge bringt man<br />
Kalk durch Gebläse auf den Waldboden, da bereits Laubbäume, neben dem hauptsächlich<br />
betroffenen Nadelwald, erste Krankheitssymptome zeigen.<br />
Im Jahr 1984 gab es wiederum drei Wahlen, Landtagswahl, Europawahl und<br />
Gemeinderatswahl. Damals wurde der Fleckenplatz, die neue Ortsmitte, fertig. Mit<br />
verschiedenen Pflasterungen und Baumbepflanzung gelang es, den Platz ansprechend zu<br />
gestalten.<br />
Eine große Aufgabe stellte der Plan und Bau einer neuer Sporthalle auf dem Angel dar. Die<br />
Baukosten erhöhten sich durch verschiedene Umstände von 3 auf 6 Millionen DM. Im Januar<br />
1990 konnte dann die Halle mit einem Einweihungsfest, bei dem viele Gäste anwesend waren,<br />
der Allgemeinheit übergeben werden. Die Vereine, der Sportverein an der Spitze, verfügen<br />
nun über eine großzügige Halle für die verschiedensten Sportarten und andere Zwecke.<br />
Seit 1988 beschäftigt den Gemeinderat die Frage nach einem Standort für die neue<br />
Erddeponie. Nach Schließung des alten Areals bei der Bergwaldsiedlung konnte der<br />
Erdaushub nach Althengstett auf die dortige Deponie gebracht werden, jedoch unter der<br />
Bedingung, daß Gechingen dann im Gegenzug den Althengstetter Erdaushub auf eine neue<br />
Deponie übernimmt. Jetzt wird ein Gelände an der Straße nach Althengstett benutzt.<br />
Im Ortskern gab es verschiedene Veränderungen. Durch Abbruch von einigen alten Häusern<br />
wurde Platz für einen großen Neubau mit Einkaufszentrum geschaffen. Weitere Pläne hatte<br />
die Gemeinde mit der sogenannten "Salzscheuer" und einer benachbarten Scheuer. Hier<br />
entstand ein Neubau mit einer Arzt- und einer Massagepraxis. In dem danebenliegenden<br />
Gebäude "Appeleshof" ist das Heimatmuseum untergebracht. Für ein neues Baugebiet<br />
"Kirchberg" sind die Planungen vollendet, die ersten Gebäude sind bereits fertig und bezogen.<br />
Weitere Baugebiete am Ortsrand in Richtung Bergwaldsiedlung sind vorgesehen. Der Kreis<br />
hat seit 1990 die Uhlandstraße, die Calwer Straße und die Straße nach Althengstett ausgebaut.<br />
An der Straße nach Althengstett entstand ein Radweg, vor allem für die Schüler, die in<br />
Althengstett weiterführende Schulen besuchen. Zur Zeit, 1994, wird die Straße nach<br />
Deufringen neu ausgebaut und teilweise mit einem Radweg versehen. Der Zufall will es, daß<br />
vor genau hundert Jahren der Bau dieser Straße beschlossen wurde.<br />
61
Wirtschaftliche Entwicklung<br />
Viehzucht<br />
1773 schon machte sich Pfarrer Mayer, der sich bleibende Verdienste um die Modernisierung<br />
der Landwirtschaft erworben hat, Gedanken über das richtige Verhältnis zwischen<br />
Viehbestand und bewirtschafteter Fläche. Die Großviehhaltung war auch für Ackerbauern<br />
unerläßlich, denn man brauchte Zugvieh zum Getreideanbau, ebenso den Dung der Tiere zur<br />
Verbesserung des Ertrags von Feldern und Wiesen.<br />
Obwohl bei uns der Ackerbau dominierte, unterschied man die Bauern nach der Art ihrer<br />
Zugtiere in:<br />
a) Kühbauern, die von ihren Zugtieren Milch und Kälber bekamen,<br />
b) Ochsenbauern, deren Zugtiere man mästen und schlachten konnte,<br />
c) Pferdebauern, deren Tiere weder Milch noch Fleisch gaben.<br />
Übersicht über den Tierbestand in Gechingen seit 1860<br />
Rinder Pferde Schweine Schafe Ziegen Geflügel<br />
1860 423 46 93 481 15<br />
1939 775 60 424 267<br />
1950 627 40 167 239 14 723<br />
1984 414 111 311 243 3610<br />
1992 287 154 378 444<br />
Bei den ersten drei Zählungen hatte Gechingen jeweils so um die tausend Einwohner. Durch<br />
bessere Bewirtschaftung u.a. durch den Einsatz von Maschinen und Düngung konnte der<br />
Anbau von Futter für die Tiere und damit die Anzahl der Rinder gesteigert werden. In der<br />
Oberamtsbeschreibung von 1860 steht ausdrücklich: "Der meist aus einer rothen Landrace<br />
bestehende Rindviehbestand ist sehr bedeutend und bildet eine namhafte Erwerbsquelle,<br />
indem mit Vieh ein lebhafter Handel auf benachbarten Märkten getrieben wird."<br />
Die Haltung von Großvieh barg für den einzelnen Bauern immer ein gewisses Risiko. Schon<br />
vor 1840 existierte deshalb im damaligen Oberamt Calw ein Viehversicherungsverein, in dem<br />
sehr wahrscheinlich auch <strong>Gechinger</strong> Bauern Mitglieder waren. Unter dem Namen<br />
"Ortsviehversicherungsverein Gechingen" wurde dann für die Gemeinde Gechingen im Jahre<br />
1843 ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit gegründet. Der Verein hatte die Aufgabe<br />
und den Zweck, Verluste an Vieh durch Notschlachtungen und plötzlichen Tod zu ersetzen.<br />
Das geschah dadurch, daß die nichtgeschädigten Mitglieder das genießbare Fleisch eines<br />
Tieres abnahmen und bezahlten. Im Falle der Ungenießbarkeit mußten sie Barzahlung leisten.<br />
20 % des Schadens trug der Besitzer selbst. Der Verein unterhielt ein Schlachthaus beim<br />
Feuersee, welches auch an Nichtmitglieder vermietet wurde, bis die Gemeinde im Jahr 1967<br />
ein eigenes Schlachthaus in der Dorfäckerstraße baute. In den Jahren 1855, 1866 und 1921<br />
gab sich der Verein neue Satzungen. 1866 gründete der damalige Schultheiß Ziegler den<br />
Verein neu, nach der stillschweigenden Auflösung einige Jahre vorher. Auch nach der<br />
Inflation 1923 war eine Neugründung durch Schultheiß Schmidt notwendig. Der Verein hatte<br />
bis 1956 im Durchschnitt 170 Mitglieder und einen versicherten Viehbestand von ca. 550<br />
Stück. 1968 besaßen die 86 Mitglieder noch 325 Stück Vieh. Von da an sank die<br />
Mitgliederzahl ständig ebenso die Zahl der Tiere, so daß es im Jahre 1979 nur noch 25<br />
Mitglieder mit zusammen 73 Stück Vieh gab. Dadurch war die Belastung bei einem<br />
62
Schadensfall für die einzelnen Mitglieder so hoch, daß sich die Versicherung nicht mehr<br />
lohnte und deshalb der Verein aufgelöst wurde.<br />
Das Jahr 1950 markiert, wie aus der Tabelle deutlich hervorgeht, einen Einschnitt in der<br />
Geschichte des Dorfes, das vor großen Wandlungen stand. 1950 war noch Nachkriegszeit. Der<br />
Bestand an Großvieh war relativ hoch. Lebensmittelimporte spielten noch keine große Rolle,<br />
die Landwirtschaft lohnte sich damals noch, es gab auch für die <strong>Gechinger</strong> kaum andere<br />
Möglichkeiten, sich den Lebensunterhalt zu sichern. Ab 1950 nahm die Bevölkerung<br />
sprunghaft zu, bis 1984 war sie auf 3300 Bürger gestiegen. Die vielen Neubürger sind<br />
größtenteils im Raum Böblingen/Sindelfingen in der Großindustrie beschäftigt, wie die<br />
meisten Alt-<strong>Gechinger</strong> inzwischen auch, die Zahl der bäuerlichen Betriebe ging zurück,<br />
ebenso die Rinderhaltung. Als Zugtiere werden Rinder nicht mehr gebraucht und durch<br />
Milchquotierung und Schließung der Molkerei ist auch die Milchviehzucht nicht mehr<br />
lohnend. Die Pferde sind 1984 und 1992 keine Zugtiere mehr, bei dem Bestand handelt es sich<br />
ausschließlich um Reitpferde. Die Zahl der Schweine dagegen, die von 1860 bis 1939 um<br />
mehr als das Vierfache angestiegen war, fiel zwischenzeitlich zurück, hat aber fast wieder den<br />
Vorkriegsstand erreicht. Schafe gibt es in Gechingen wieder fast so viel wie 1860 nachdem<br />
über hundert Jahre lang der Bestand bei ca. 250 Tieren stagnierte. In der<br />
Oberamtsbeschreibung von 1860 heißt es: "Auf der Weide laufen etwa 500 Stücke Schafe,<br />
welche theils den Bürgern, theils dem Ortsschäfer gehören, jeder Schafeigenthümer entrichtet<br />
für ein Schaf 32 kr. und für das Lamm 20 kr., was der Gemeindekasse neben der<br />
Pferchnutzung etwa 6-700 fl. einträgt. Die Wolle kommt nach Kirchheim und in die<br />
Umgegend." Nun hat im ganzen Hecken- und Schlehengäu die Schafzucht Tradition, die teils<br />
recht geringen Böden taugten immer noch als Schafweide. Die Wolle wurde schon um die<br />
Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert in Calw, teilweise auch in Wildberg zu Wolltuch<br />
verarbeitet. 1510 erließ Herzog Friedrich, der dem aufblühenden Gewerbe wohlgesonnen war,<br />
die erste Tuchordnung. Die Produkte der Calwer Zeugmacher, allen voran das "Engelsait"<br />
(englisch Satin), ein glatter, langhaariger Wollstoff, waren überall geschätzt und wurden bis<br />
nach Italien exportiert. Anfang des 17. Jahrhunderts teilten sich die Tuchhersteller. Die Färber<br />
übernahmen den Handel, die Zeugmacher das Weben. 1611 wurden die Zeugmacher<br />
"gebannt", das heißt, sie konnten ihre Ware nunmehr nur noch über vorgeschriebene<br />
"Verleger" absetzen, die sich 1622 zur Gesellschaft der "Gesamten Färber und<br />
Handelsgenossen zu Calw" zusammenschlossen. Diese Zeit war die große Zeit der Calwer<br />
Zeugmacherei und nicht nur ein Großteil der Calwer Bürger, sondern auch viele Bewohner der<br />
umliegenden Dörfer lebten davon. Damals hatte auch unser Ort, wie man heute sagen würde,<br />
eine Industriebevölkerung, das waren die Weber. So kam es, daß Gechingen, bevor der<br />
dreißigjährige Krieg auch unsere Gegend erreichte, eine Einwohnerschaft von ca. 1400<br />
Personen aufwies, mehr, als sich damals von der Landwirtschaft ernähren konnten. Auch nach<br />
dem 30jährigen Krieg - die eigentliche Calwer Compagnie (CC) wurde erst 1650 gegründet -<br />
arbeiteten mit Sicherheit <strong>Gechinger</strong> für die Calwer Verlagsherren und die Schafzucht war<br />
weiterhin bedeutend. Die CC bestand bis 1796, ihr Niedergang hatte schon 1730 eingesetzt,<br />
als die wirtschaftlichen Voraussetzungen sich verschlechterten. Das Zeugmachergewerbe ging<br />
zwar dadurch völlig zurück, für die Wolle der Schafe fanden sich aber, wie beschrieben,<br />
immer noch Abnehmer. Um 1900 war die Schafweide zeitweise verpachtet.<br />
Bekannte Schäfer in Gechingen waren: Paul Heinrich Schaible 1880-1968, Albert Schaible<br />
1883-1957.<br />
Ackerbau<br />
Nach der alamannischen Landnahme ist Gechingen eine bäuerliche Siedlung gewesen, in der<br />
der Ackerbau die Hauptrolle spielte und der Ertrag der Felder die Existenzgrundlage war. In<br />
63
ganz Europa hatte sich schon sehr früh die Drei-Felder-Teilung der Feldflur durchgesetzt, die<br />
Winterzelg, die Sommerzelg und die Brache, wie wir sie bis zu den fünfziger Jahren unseres<br />
Jahrhunderts noch hatten.<br />
1. Jahr: Winterfrucht (Dinkel)<br />
2. Jahr: Sommerfrucht (Gerste und Hafer)<br />
3. Jahr: Brache (unbebautes Land)<br />
Urkundlich ist die Dreifelderwirtschaft seit der Zeit Karls des Großen (um 800)<br />
nachgewiesen; betrieben wurde sie sicher schon früher. Sie sollte der Erhaltung der<br />
Fruchtbarkeit des Bodens dienen, die für die Bewohner so wichtig war. Die einzelnen Höfe<br />
hatten Äcker in Streulage, die auf alle drei Zelgen verteilt waren. Da die Felder aber nicht<br />
durch Wege voneinander abgeteilt waren, mußten sie einheitlich bestellt werden, um zu<br />
verhindern, daß durch Fuhren usw. die Äcker der Nachbarn geschädigt wurden, aber auch,<br />
weil die Zelg als Ganzes nur zeitlich beschränkt bebaut werden durfte. Nach der Ernte wurden<br />
die Äcker von allen gemeinsam zur Weide für das Vieh genutzt, ebenso die Brache den<br />
Sommer über. So war die Einhaltung der Dreiteilung der Ackerfläche Pflicht, sämtliche<br />
Dorfbewohner mußten sich dem Flurzwang fügen. Ursprünglich hatte die ganze Gemeinde<br />
das Recht, die Bestellung der Feldflur einvernehmlich zu regeln, im Lauf der Zeit übernahm<br />
ein Herrenhof die Befugnis, die Äcker zur Benutzung freizugeben oder zu sperren. Im<br />
Sommerfeld konnten auch Wicken, Linsen und Hirse angebaut werden. Auf der Brachflur<br />
wurde nichts ausgesät. Der Name kommt von "brechen". Umgepflügt, mit dem Pflug<br />
umgebrochen, wurde sie zumindest vor der Aussaat des Wintergetreides.<br />
Durch Rodungen, die im Lauf der Zeit durch die Bevölkerungsentwicklung nötig wurden -<br />
den Alamannen gelang es bald nicht mehr, ihr Gebiet auszudehnen, da sie mächtige Nachbarn<br />
hatten - konnte zusätzliches Ackerland gewonnen werden, das dem "Zwing und Bann" nicht<br />
unterlag.<br />
Schon bei den Alamannen war Getreide, ergänzt durch Hülsenfrüchte, die Grundlage der<br />
Ernährung. Es zeichnet sich aus durch gute Lagerfähigkeit, außerdem kann man die<br />
verschiedensten Speisen daraus zubereiten. Zunächst verwendete man es zu Mus, Suppen und<br />
Brei, seit dem 8. Jahrhundert wurde das Getreide hauptsächlich zu Brot verarbeitet. Das<br />
Brotgetreide in Gechingen war von altersher der Dinkel, der schlichtweg als Korn bezeichnet<br />
wurde. Er liefert ein wertvolles, kleberreiches Mehl. Erst in unserem Jahrhundert wurde er<br />
nach und nach vom Weizen verdrängt. Weizen ist ertragreicher, aber auch empfindlicher und<br />
anspruchsvoller. Doch gelang es durch Züchtung neuer Sorten und durch verbesserte<br />
Düngemethoden, ihn auch bei uns anzubauen.<br />
Im Mittelalter bis zum 16. Jahrhundert lag der durchschnittliche Gertreideverbrauch bei 250<br />
kg pro Person und Jahr. Heute ist er auf ca. 70 kg gesunken. Da im Mittelalter die Erträge nur<br />
das 2,5 - 3fache der Saatmenge ausmachten, erntete man von einem Hektar etwa 400 - 600 kg.<br />
Vermindert um die als Saatgut für die nächstjährige Bestellung gebrauchte Menge, blieb<br />
gerade soviel, wie für den Jahresverbrauch einer Person erforderlich war. 1860 trug laut<br />
Oberamtsbeschreibung der Morgen (o,315 ha) in Gechingen 10-12 Scheffel Dinkel, 6-8<br />
Scheffel Hafer und 4-6 Scheffel Gerste. Umgerechnet ergibt das beim Dinkel ca 750 - 900 kg<br />
pro Hektar. Heute rechnet man mit Erträgen von 4000 kg und mehr Getreide pro Hektar. Die<br />
Ertragssteigerung dürfte auch auf verbesserte Pflüge zurückzuführen sein. Hafer war<br />
Futtergetreide; da der Hafer keinen Kleber enthält, eignet er sich nicht zum Brotbacken. Doch<br />
werden sich die älteren <strong>Gechinger</strong> noch an Suppe oder Brei aus Habermehl erinnern, sie<br />
galten als besonders sättigend und waren daher in den Jahren der Nachkriegszeit sehr beliebt,<br />
wie schon in alter Zeit. Der gute Geschmack wurde durch Dörren erreicht, das der Bäcker im<br />
64
Backofen vornahm. Der so vorbehandelte Haber wurde zur Mühle gebracht. Habermehl hatte<br />
eine hellbräunliche Farbe.<br />
Gerste wurde als Futtergerste oder auch als Braugerste angebaut. In der Kriegs- und<br />
Nachkriegszeit röstete man auch Gerste auf Kuchenblechen im Backofen. Sie wurde dann mit<br />
der Kaffeemühle gemahlen und als Kaffeersatz verwendet.<br />
Kartoffeln setzten sich erst im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts langsam durch. Breits 1750<br />
wurden sie in Gechingen angebaut, wie aus der Besoldungsliste des damaligen Pfarrers hervor<br />
geht. Als man mit der Stallfütterung begann, wurde die Brache für Klee und Hackfrüchte<br />
genutzt, so daß im wesentlichen die Dreiteilung der Flur erhalten blieb. Rotklee mußte schon<br />
in die Sommerfrucht gesät werden, als Unterkultur bei Hafer oder Gerste. Er brachte dann im<br />
zweiten Jahr in der Zelg Brache den Ertrag als Futtermittel. 1860 werden Kartoffeln, Klee,<br />
Esparsette, weiße Rüben, Hanf und etwas Reps als Bebauung der Brache genannt. Außerdem<br />
baute man später das "Wickafuader" dort an. Das war eine Mischung aus Erbsen, Wicken,<br />
Gerste und Hafer, die als Grünfutter zwischen Heuet und Ernte geschnitten wurde. Danach<br />
wurde der Acker umgepflügt und war dann ein Brachacker. Esparsette und Luzerne (Ewiger<br />
Klee) waren genügsame Futterpflanzen. Sie mußten nicht jedes Jahr neu ausgesät werden und<br />
brachten auch bei Trockenheit Erträge. Das Grundstück, auf dem man sie anbaute, mußte in<br />
jeder Zelg zugänglich sein. Vom Landwirtschaftsamt Wildberg stammt folgender Überblick<br />
über die Entwicklung der Landwirtschaft in Gechingen in den letzten fünfzig Jahren:<br />
"Die Landwirtschaft hatte in Gechingen von jeher eine große Bedeutung. Im Jahr 1939 betrug<br />
die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe 230 und die Nutzfläche 850 ha. Damals hatte<br />
Gechingen 938 Einwohner. Bedingt durch Boden, Klima und Höhenlage wurde neben<br />
Getreideanbau auch Futteranbau betrieben. Es wurden gezählt: 775 Stück Rindvieh, davon<br />
487 Milchkühe, 60 Pferde, 267 Schafe, 424 Schweine, 3289 Stück Geflügel. Bis zum Jahre<br />
1957 hatte sich die Zahl der Betriebe auf 170 verringert und die Nutzfläche auf 760 ha<br />
verkleinert. Die Betriebsgrößen lagen unter 10 ha, nur drei Betriebe bewirtschafteten zwischen<br />
10 und 15 ha. Wegen der beengten baulichen Verhältnisse im Ortskern waren viele<br />
Gebäudeverhältnisse unzureichend, eine Erweiterung aus Platzmangel meist nicht möglich.<br />
Nach der Flurbereinigung und der Aussiedlung von sieben Betrieben begann ein starker<br />
Strukturwandel in unserer Gemeinde. Dazu kam ein großes Arbeitsplatzangebot in den<br />
benachbarten Industriestädten. Dies hatte zur Folge, daß die Zahl der landwirtschaftlichen<br />
Betriebe weiter abnahm; gleichzeitig aber die Größe der einzelnen Betriebe zunahm. Heute<br />
gibt es in Gechingen nur noch acht hauptberufliche Landwirte. Die gesamte Nutzfläche<br />
beträgt 650 ha. Viele Höfe gaben wegen Betriebsumstellungen und der Milchquotierung die<br />
Viehhaltung auf. Dafür nahm die Zahl der gehaltenen Schafe und Pferde zu."<br />
Sonderkulturen (Faserpflanzen und Hopfen)<br />
Auch Flachs oder Lein, eine der ältesten Kulturpflanzen, wurde bei uns angebaut. Sie blüht<br />
blau und wird 60 - 120 cm hoch. Die Frucht ist eine Kapsel. Auch der kleine, flachgedrückte,<br />
braune Samen, den sie enthält, läßt sich vielfältig nutzen - als Arznei, aber auch zur<br />
Ölgewinnung. Ende Juli bis Anfang August wird der Flachs geerntet, nicht etwa gemäht,<br />
sondern mit den Wurzeln aus dem Boden gerissen ("gerupft"), damit man möglichst lange<br />
Fasern erhält. Dann wird er in kleine Garben gebunden und zum Trocknen aufgestellt. Nach<br />
dem Einfahren der Ernte werden zunächst die trockenen Fruchtkapseln entfernt, das geschieht<br />
mit dem "Reff", einer Art Kamm aus Holz oder Eisen. Das Reffen war eine langwierige<br />
Arbeit. Zur Fasergewinnung mußten die Faserbündel von dem holzigen Rindengewebe befreit<br />
werden. Das geschieht durch die "Röste", in der die holzigen Bestandteile verrotten und<br />
dadurch abgelöst werden können, so daß die Faserbündel übrigbleiben. Beim Rösten wird<br />
entweder der Flachs auf Stoppelfeldern oder Wiesen dünn ausgebreitet, feucht gehalten und<br />
mehrmals gewendet. Diese "Tauröste" nimmt vier bis zehn Wochen in Anspruch. Schneller<br />
65
geht es mit der Kaltwasserröste, wobei die Garben 1 - 3 Wochen lang senkrecht in kleine<br />
Gräben gestellt werden. Nach der Röste muß der Flachs wieder getrocknet oder "gedarrt"<br />
werden, dann wird er gebrochen. Das Trocknen nimmt man am besten in einem noch warmen<br />
Backofen vor, ähnlich wie das Dörren von Zwetschgen. Dabei kam es aber leicht zu Bränden,<br />
so daß das Flachsdarren im Dorf verboten wurde. Deshalb entschloß man sich meist, vor dem<br />
Dorf eine Flachsdarre anzulegen. Auch in Gechingen muß es so gewesen sein. Ein altes Foto<br />
zeigt die Frauen des Dorfes in der "Brechgaß" beim Flachsbrechen, im Hintergrund ist ein<br />
Graben zu erkennen, der auf beiden Seiten mit Steinen ausgekleidet ist, die ihn etwas<br />
überragen. Quer über dem Graben liegt ein Holzrost, darauf kam der Flachs. Die Feuerstelle<br />
liegt etwas entfernt, nur Warmluft und Rauch sollten durch einen unterirdischen Kamin ins<br />
Innere der Flachsdarre ziehen. Aber völlig ausschließen konnte man die Brandgefahr auch hier<br />
nicht, auf unserem Foto sieht man, daß für alle Fälle ein Eimer mit Wasser bereitstand.<br />
Durch das Brechen zerbersten die holzigen Teile und fallen zum Teil hier schon ab, die Fasern<br />
bleiben erhalten und werden durch "Schwingen" über ein hölzernes Messer von den letzten<br />
Holzresten befreit. Anschließend wird der Flachs gehechelt, wodurch die langen Fasern<br />
isoliert und die gröberen, kurzen als "Werg" entfernt werden. Die so gewonnenen Flachsfasern<br />
werden dann in sogenannte "Docken" gebündelt. Diese sind das Ausgangsmaterial für die<br />
Leinenindustrie und für die bäuerliche Leinenherstellung. Wie beim Brechen fanden sich auch<br />
zum Flachsspinnen die Frauen und Mädchen zusammen. In den Spinnstuben wurde abends<br />
erzählt und gesungen, die Dorfjugend traf sich dort, was oft von der Obrigkeit gar nicht gern<br />
gesehen wurde. - In Gechingen ist mehrere Male der Kirchenkonvent eingeschritten. Es gibt<br />
ein Kirchenkonventsprotokoll vom 22.1.1798 (siehe "Kirche"), das nur Frauen und Mädchen<br />
in Begleitung ihrer Mütter erlaubte, die Spinnstuben (Lichtkärze) zu besuchen. Höchstens acht<br />
Personen ohne die Hausgenossen waren zugelassen usw.<br />
Bis zum fertig gesponnenen Garn war die Flachsverarbeitung Frauensache. Der Rest war<br />
Männerarbeit. Das Leinengarn wurde im Haus verwoben. Die meisten Bauern hatten ihren<br />
eigenen Webstuhl. Die natürliche Farbe der so erzeugten Leinwand ist gelblich-braun. Um die<br />
frischgewobenen Tücher weiß zu bekommen, mußten sie gebleicht werden. Die Gemeinde<br />
Gechingen hatte einen fest angestellten Bleicher (siehe "Berufe") Als die Leineweberei<br />
zurückging und kein Bleicher mehr beschäftigt wurden, bleichten die Frauen selber. Sie legten<br />
in der Frühe ihre Tücher auf dem Gänswasen aus und holten sie abends wieder ab.<br />
Daß auch früh Hanf angepflanzt und dann versponnen wurde, geht aus dem Calwer<br />
Wochenblatt von 1830 hervor. In einer Anzeige der Gemeinde werden 500 Schneller (Rollen)<br />
gutgesponnenes, hänfenes Garn an den Meistbietenden verkauft.<br />
1860 heißt es vom Hanf in der Oberamtsbeschreibung, daß er "sehr gut gedeiht und häufig<br />
gebaut wird". Hanf erbringt im Verhältnis zur Anbaufläche eine größere Menge spinnbare<br />
Faser als Flachs. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts dürfte Hanf bei uns angepflanzt<br />
worden sein, als der Flachs schon verschwunden war (Hanfländer im oberen Tal). Allerdings<br />
wurde im zweiten Weltkrieg und in den Nachkriegsjahren noch einmal in geringer Menge<br />
Flachs angebaut, hier ging es aber häufig um die Gewinnung von Leinöl. Jedoch wurde auch<br />
die Fasergewinnung noch durchgeführt.<br />
Heute gibt es in Gechingen keinen Flachs- und Hanfanbau mehr. Verschwunden sind auch die<br />
Hopfenkulturen, weder die modernen Hopfengärten noch die Äcker mit den langen<br />
Fichtenstangen und den daran emporwachsenden Hopfenranken sieht man nicht mehr.<br />
Die Dreifelderwirtschaft mit ihrem strengen Flurzwang ließ erst im 19. Jahrhundert den<br />
Anbau von Hopfen zu, weil ein Hopfenacker nicht in den Fruchtwechsel einbezogen werden<br />
kann. In der Oberamtsbeschreibung von 1860 heißt es: "In neuerer Zeit hat man auch den<br />
Hopfenbau mit gutem Erfolg eingeführt."<br />
66
Der Hopfen zählt zur Gattung der Hanfgewächse und ist eine zweihäusige Schlingpflanze. Die<br />
Fruchtzapfen der weiblichen Pflanze liefern einen wichtigen Rohstoff zur Bierherstellung, das<br />
Hopfenmehl, das vor allem Bitterstoffe enthält, die dem Bier den würzigen Geschmack<br />
verleihen. In Hopfengärten angebaut werden nur die weiblichen Pflanzen. Vor dem<br />
Einpflanzen der Stecklinge muß das Feld tief umgegraben werden. Nur tiefgründige Böden<br />
sind zum Anbau geeignet, vor allem Kalkböden. Die Stecklinge holten die Bauern aus dem<br />
Herrenberger Anbaugebiet. Einmal gepflanzt, war der Austrieb für 10-12 Jahre gesichert. Im<br />
zeitigen Frühjahr wurde der kurze Stock, der im Herbst nach der Ernte stehenblieb,<br />
zurückgeschnitten, damit die jungen Triebe sprossen konnten. Rasch wurde es dann Zeit, die<br />
8-10 m hohen Fichtenstangen einzusetzen. Mit dem schweren Hopfeneisen machte man<br />
Löcher und setzte vorsichtig, damit die Triebe nicht beschädigt wurden, die Stangen ein. In<br />
der späten Wachstumsphase und zu Beginn der Blütezeit spritzte man den Hopfen mehrmals,<br />
um Schädlinge abzuhalten. Kam dann die Ernte heran, schnitt man die Ranken unten ab, legte<br />
die Stange um und nahm die Ranken vorsichtig ab. Deren starken unteren Teil verwahrte man,<br />
er konnte bei der Getreideernte als Garbenbinder verwendet werden. Vor Gebrauch weichte<br />
man die Abschnitte dann einige Zeit in Wasser ein, damit sie geschmeidig wurden.<br />
Waren die Ranken in der Scheuer, begann das Hopfenzopfen. Das war eine fröhliche Zeit für<br />
das Dorf. Meist saß die ganze Verwandtschaft dabei zusammen, größere Hopfenbauern hatten<br />
auch bezahlte Aushilfskräfte. Jeder Pflücker hatte seine bestimmte Familie, bei der er jedes<br />
Jahr pflückte. Manches frohe Lied wurde bei der Arbeit gesungen, die Jugend lernte dabei von<br />
den Älteren. So gab man eine große Fülle von Volks- und Heimatliedern weiter.<br />
Nach dem Hopfenzopfen begann die Feinarbeit. Der Hopfen mußte getrocknet und gedörrt<br />
werden. Auf der Bühne, auf den Speichern, den Fruchtböden und wo sonst ein geeigneter<br />
Platz war, stellte man die Hopfendarren auf. Auch im Gemeindebackhaus, über den Backöfen,<br />
wurde Hopfen gedörrt. Ein gut aufbereiteter, gesunder, wohlriechender Hopfen brachte einen<br />
schönen Erlös.<br />
Wie sehr der Hopfenanbau in Gechingen verbreitet war, kann man an manchem hochgiebligen<br />
Bauernhaus sehen - nach dem großen Brand wurden ja viele neu gebaut. Da liegen oft drei<br />
Hopfenböden übereinander, damit man genügend Platz hatte, um den Hopfen zu darren.<br />
Eine technische Änderung beim Anbau des Hopfens trat in den Zwanziger Jahren ein. Man<br />
begann, moderne Drahtanlagen aufzustellen, welche über Jahre stehen bleiben konnten.<br />
Große, schwere Baustangen wurden als Gerüst mit Flaschenzügen hochgestellt und mit<br />
starken Drähten am Boden verankert. In der Höhe spannte man Längsdrähte und von dort aus<br />
senkrechte Drähte zu den einzelnen Stöcken. Diese senkrechten Drähte konnte man aus der<br />
Verankerung lösen und den reifen Hopfen im Herbst herunterziehen. Das jährliche Aufstellen<br />
und Abbauen der vielen einzelnen Stangen fand damit sein Ende. In Gechingen wurden 1934<br />
etwa 154 ar Hopfen angebaut. Davon waren 8 ar auf schlechtem Boden, so daß das Oberamt<br />
Calw 3 ar aushauen ließ. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde der Hopfenanbau zu<br />
Gunsten des Getreideanbaus eingestellt. 1940 gab es 1 RM Prämie für jeden ausgehauenen<br />
Stock.<br />
Wiesen und Weiden<br />
Die Wiesen waren für die Gewinnung von Heu wichtig, das als Viehfutter im Winter<br />
gebraucht wurde. Gechingen hatte zu Anfang des 19. Jahrhunderts in dem damaligen Pfarrer<br />
Heinrich Theodor Klinger einen Mann, der sich, wie viele Pfarrer seiner Zeit, um die Hebung<br />
der Landwirtschaft Gedanken machte, so auch um Pflege und Bewirtschaftung der Wiesen.<br />
Seit 1839 leitete er einen landwirtschaftlichen Verein in Calw. 1849 erschien von ihm<br />
folgender Beitrag für die "Nachrichten aus dem Oberamt Calw":<br />
67
"Wenn wir unsere schönen Thäler in Wald und Gäu betrachten und nicht blos auf das<br />
Anmuthige und Romantische, sondern auch auf das Nützliche sehen, so werden wir uns<br />
gestehen müssen, das der Ertrag erhöht werden könnte, wenn man die Wiesen besser<br />
behandelte, vor allem zweckmäßiger bewässerte. Und Wässerungsanlagen könnten noch<br />
manche, unbeschadet der Wasserwerke, in Haupt- und Seitenthälern der Nagold angelegt,<br />
manche dürre oder sumpfige Plätze zu saftreichen Triften umgewandelt werden. Ja, wenn uns<br />
nur Jemand an die Hand ginge! Ich weiß einen solchen Mann, und derselbe ist weit bekannt,<br />
es ist der Wiesenbaumeister Hafner von Hohenheim. Dieser hat schon in seinem Fach in<br />
vielen Gegenden Großes geleistet. Gegenwärtig ist derselbe im Oberamt Sulz und ich habe die<br />
Bitte an die Zentralstelle eingereicht, denselben auf seiner Rückreise auch zu uns zu senden,<br />
um seine Belehrungen und Rathschläge jedem Fragenden mitzutheilen. Ich zweifle nicht, daß<br />
dieser Bitte Gehör gegeben wird, und zwar also, daß es keine Kosten für unsere Kassen<br />
verursacht. Aber umso trauriger wäre es, wenn diese Gelegenheit nicht benüzt würde. Ich<br />
ersuche daher alle Wiesenbesizer, besonders aber die Ortsvorsteher; in Überlegung zu ziehen,<br />
wo es bei ihren Thälern fehlt, wie sie besser wässern, neue Wiesen anlegen, schlechte<br />
verbessern könnten, und dann sich mit Herrn Hafner in Verbindung zu sezen. Wird meine<br />
Bitte gewährt, so geschieht die Anzeige des Tags der Ankunft Herrn Hafners in Calw von mir<br />
in diesem Blatte. Gechingen, 11.Mai 1849. Pfarrer Klinger"<br />
Ob Pfarrer Klinger wohl von den Verhältnissen in Gechingen ausging? Die Wiesen im Tal<br />
waren seit langer Zeit durch Bewässern besonders ertragreich. Noch heute kann man im<br />
oberen und unteren Irmtal, an den seitlichen Hängen, sich lang hinziehende Gräben erkennen.<br />
Sie dienten bis in die späten fünfziger Jahre unseres Jahrhunderts zum Bewässern der Wiesen.<br />
So lange existierte eine Wässerungsgemeinschaft, in der genaue Regeln dafür sorgten, daß<br />
kein Wiesenbesitzer benachteiligt wurde. Das in die Gräben eingeleitete Wasser wurde vom<br />
betreffenden Grundstücksbesitzer mit Brettern gestaut und in die Wiese abgeleitet. Dabei kam<br />
es immer wieder zu Verstößen, so daß schon früh Verordnungen mit Strafandrohungen<br />
erlassen werden mußten.<br />
Aus dem Fleckenbuch von 1647: "Wenn ein ungenügend Wasser im Tal und zu Zweit oder<br />
mehr wässern wollen, sollen sie schuldig sein, das Wasser miteinander zu teilen und<br />
miteinander wässern.<br />
Wässerung der Wiesen 1697."Wann ein ungeteiltes Wasser im Tal lauft und zwei oder mehr<br />
wässern wollten, sollen sie schuldig sein, das Wasser miteinander zu teilen und zu wässern."<br />
Anschließend folgen jeweils komplizierte Vorschriften, die in allen Einzelheiten festlegen,<br />
wie die Teilung des Wassers zu bewerkstelligen ist.<br />
Der Müller Balthes Wagner lag 1668 mit der Gemeinde im Streit wegen angeblichen<br />
Wassermangels durch die Wiesenwässerung.<br />
"Actum, den 18.Mai Anno 1668.<br />
Dato klagt Balthas Wagner, Müller gegen die ganze Gemeinde, dergestalten sie ihm das<br />
Wasser zur Mühle nicht völlig zukommen lassen, sondern mehr als zur Hälfte für ihre<br />
Wässerung gebrauchen tun. Welches ihm dann sehr nachträglich sei, daß er also nun auf ein<br />
ganz Wasser habe, bittet die Inhaber der Wiesen anzuhalten, ihm selbiges angedeihen zu<br />
lassen. Der Vogt von Leonberg soll solches nach altem Herkommen mit gerichtlichem<br />
Bescheid für die Wässerung, der Gemeinde übergeben."<br />
Schultheiß und Gericht von Gechingen widerstehen dieser Klage und sind nicht der Meinung,<br />
daß das Wasser allein dem Müller zustehe, laut Herkommen gehöre ihnen das halbe Wasser<br />
den Sommer über zur Wässerung der betreffenden Wiesen. Sie wollen nachweisen, daß vor 50<br />
und mehr Jahren die vorigen Müller mit soviel Wasser, wie es der jetzige Müller habe,<br />
zufrieden gewesen seien. "Wie er denn auch Wasser genug habe und dieser nur ohne Not<br />
klagen tue". Die Gemeinde hofft auf günstigen Bescheid, weil der Müller nichts beweisen<br />
68
kann und so will sie mit ruhigem Gewissen abwarten. Der Müllerknapp, Michael Riehm, der<br />
über 50 Jahre lang in der Mühle gedient hat und Martin Schneider, des Gerichts, und Hans<br />
Knoll, über 80 Jahre alt, sind als Zeugen vorgeschlagen.<br />
Michael Riehm gibt an, nachdem er auf seine Aussagepflicht hingewiesen wurde, daß vor<br />
diesem und vor mehr als 50 Jahren das halbe Wasser, das vom Flecken herabfließe, den<br />
Inhabern der Wiesen zwischen Flecken und Mühle zur Wässerung zuständig sei und die<br />
damaligen Müller mit dem übrigen halben Wasserteil, samt dem Bronnenwasser, das ober der<br />
Mühle entspringt, wohl zufrieden waren und deswegen noch keine Klage geführt worden sei.<br />
Das gleiche sagt auch Martin Schneider, 78 Jahr alt. Hans Knoll, 84 Jahr alt, sagt, daß voriger<br />
Mühleninhaber jederzeit mit dem halben Dorfwasser zufrieden gewesen sei. Es sei oft<br />
geschehen, daß zu Wässerungszeiten, obwohl er Wasser genug hatte, der (jetzige?) Müller mit<br />
dem Korn und Kernen aus der Mühle nach Döffingen gefahren, damit er die Leute nötigen<br />
konnte, daselbst zu mahlen und "dieses nur ein Ursach zum Klagen sei. Sintemalen ihm nur<br />
ein Mahlwerk Wasser gehöre, den der Weiherbronnen allein treiben tue".<br />
Hier ist der obrigkeitliche Bescheid:<br />
Nach altem Herkommen wird dem Müller die Hälfte des Dorfwassers überlassen. Wenn die<br />
Stellfalle am Bach zu hoch ist, muß sie neu eingestellt werden. "Es wird erwartet, daß damit<br />
der Streit erledigt ist und sich die Parteien wieder recht und bürgerlich zueinander verhalten.<br />
Andernfalls droht eine Strafe von zwei kleinen Frevel."<br />
Die Oberamtsbeschreibung von 1860 gibt an: "Der Wiesenbestand ist ausgedehnt und liefert<br />
ein gutes, nahrhaftes Futter, welches, wegen des namhaften Viehstandes, im Ort selbst<br />
verbraucht wird; die Wiesen, von denen etwa 1/3 wässerbar sind, ertragen durchschnittlich 20-<br />
25 Centner Heu und 8-10 Centner Oehmd pr. Morgen." - Ein württembergischer Morgen<br />
entspricht 0,315 ha.<br />
Bevor sich die Stallfütterung durchsetzte, wurden die Brache, die Stoppelfelder nach der<br />
Getreideernte, teilweise auch die lichten Wälder als Weideland für das Vieh genützt, die<br />
Wiesen allenfalls, wenn das Öhmd eingebracht war. Schafweide auf dem Ödland des oberen<br />
Muschelkalks gab es im Hecken- und Schlehengäu immer reichlich, es war zu nichts anderem<br />
zu verwenden. Schon in den Zeiten, als man das Vieh noch auf die Weide trieb, waren im<br />
Winter, wenn das Vieh im Stall war, die Wiesen als Schafweide freigegeben. Der Pferch (die<br />
Hürden, in denen die Schafe über die Nacht blieben) gehörte der Gemeinde. Er, d.h. das Recht<br />
zu seiner Aufstellung, wurde von der Gemeinde verkauft. Innerhalb dieser Umzäunung fiel<br />
eine nicht unbedeutende Menge Kot von den Tiere an, der als Dünger begehrt war. Auch für<br />
die Stoppeläcker und die Wiesen ab November galt die Beweidung wegen des Schafmists als<br />
Vorteil.<br />
Wein - und Obstbau<br />
Wenn man den Flurnamen "Weigert" hört, denkt man an den Weingärtner oder Winzer.<br />
Auch der Familienname Quinzler leitet sich von Wenzer, also Winzer ab. Der Wein war das<br />
Hauptgetränk im Mittelalter und sein Anbau war früher viel weiter verbreitet als heute, auch<br />
in schlechten Lagen. So ist es gut möglich, daß dieser Flurnamen auf den dort inzwischen<br />
längst aufgegebenen Weinbau zurückgeht, der im Nachbarort Stammheim nachweislich<br />
noch länger betrieben wurde. Unsere Vorfahren tranken allerdings nicht den einfachen Wein,<br />
sondern sie fügten wie die Römer Gewürze, Kräuter, Beeren oder Honig hinzu, kochten ihn<br />
und tranken ihn heiß. Auf diese Art konnten auch schlechte und saure Weine, wie sie zum<br />
Beispiel in Gechingen nicht anders sein konnten, genießbar gemacht werden. Weinbau<br />
treffen wir um 1350 sogar in Norddeutschland an. Mitte des 15. Jahrhunderts änderte sich<br />
jedoch das Klima in Europa und die durchschnittliche Jahrestemperatur sank um 1-2° C. Das<br />
führte zum Erliegen des Weinbaus in extrem ungünstigen Lagen. In Württemberg allerdings<br />
wurde noch im 17./18. Jahrhundert in vielen Regionen auf Geheiß der Obrigkeit der<br />
69
Weinbau ausgedehnt. In guten Weinjahren war der Wein sehr billig. In Württemberg kostete<br />
1426 ein Eimer alter Wein 13 Kreuzer und 1481 konnte man eine Maß für ein Ei bekommen.<br />
Der "Eimer" ist ein altes Maß und entspricht gut 300 l.<br />
Von der Mühseligkeit der Arbeit im Weinberg, aber auch von der hierzu nötigen<br />
Sachkenntnis, mögen die folgenden Verse von Hans Sachs (1494-1576) eine Vorstellung<br />
vermitteln:<br />
"Der Rebmann.<br />
Ich bin ein Häcker im Weinberg.<br />
Im Früling hab ich harte werk.<br />
Mit graben, pältzen und mit hauwen<br />
Mit Pfäl stossn, pflantzen und bauwen<br />
Mit auffbinden und schneiden die Reben<br />
Biss im Herbst die Traubn Wein geben. . . "<br />
Etwa: Ich hacke im Weinberg, besonders im Frühjahr muß ich hart arbeiten. Ich muß graben,<br />
veredeln und hacken, Pfähle setzen und Pflanzungen anlegen, die Reben aufbinden und<br />
schneiden, damit im Herbst die Trauben Wein geben.<br />
"Pältzen" oder "beltzen" nannte man das Veredeln von Bäumen und auch von Rebstöcken.<br />
Die Arbeit im Weinberg hat sich also vom 17. Jahrhundert bis zur Mitte dieses Jahrhunderts<br />
nicht wesentlich geändert.<br />
Der Wein war lange vor dem Most das Volksgetränk, das Mosten ist noch nicht so uralt, wie<br />
wir glauben. Nun hatte man schon in der Jungsteinzeit die Früchte wilder Apfel- und<br />
Birnbäume gesammelt, sie auch wohl für den Winter durch Dörren haltbar gemacht.<br />
Zumindest Apfelbäume wurden zu dieser Zeit auch schon kultiviert. Doch war, außer dem<br />
geringen Bestand in manchen Gärten, in Württemberg der Obstbau nur wenig verbreitet. Erst<br />
unter Herzog Karl Eugen (1728-1793), der in den letzten zwanzig Jahren seines Lebens von<br />
seinem Musterbetrieb in Hohenheim aus sich um die Hebung der Landwirtschaft bemühte,<br />
kam der Weinbau auf den schlechteren Lagen zusehends zum Erliegen zu Gunsten des<br />
Obstbaus, um den sich auch Friedrich Schillers Vater, Kaspar Schiller, als Baumschuldirektor<br />
auf der Solitude verdient machte.<br />
Ebenso wurde unter König Wilhelm I. und König Karl der Anbau von Obst gefördert und<br />
nahm kontinuierlich zu. Noch in der Oberamtsbeschreibung von 1860 heißt es allerdings von<br />
Gechingen: "Die Obstzucht, welche sich hauptsächlich auf die um das Dorf gelegenen<br />
Baumgärten beschränkt, ist nicht bedeutend und erlaubt keinen Verkauf nach Außen, sondern<br />
es wird noch viel Obst auswärts zugekauft; vorzugsweise werden Zwetschgen und von<br />
Kernobst Luiken, Goldparmänen, Palmischbirnen, Knausbirnen etc. gezogen." Die vielen<br />
Streuobstwiesen, die es früher in Gechingen gab, die Apfel- und Birnbäume entlang der<br />
Wege, dürften also erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts aufgekommen sein und mit ihnen das<br />
Mosten. Es begann nach der Obsternte im Herbst und war früher eine zeitaufwendige Arbeit.<br />
"Feif bis sechs Ma hend z' don ghed wäge zwoa oder drei Oamer Mooschd" (wobei "Eimer"<br />
das alte Weinmaß von ca. 300 l bedeutet). Man schüttete das Obst, Äpfel und Birnen, in einen<br />
großen Stein- oder Holztrog, in dem von Hand ein runder, schwerer Stein hin- und hergewälzt<br />
wurde. Dieser Stein sah ähnlich aus wie ein Mühlstein, mit einer langen, hölzernen Achse in<br />
der Mitte, um die er hin- und hergedreht werden konnte. Die zerquetschte Obstmasse kam mit<br />
Wasser zusammen in die Presse. Der auslaufende Süßmost wurde wie Wein in Fässern<br />
vergoren. Dieses Getränk durfte in keinem Haus fehlen. Ohne Wasserzusatz entstand der<br />
"Saft" - er galt schon als etwas Besonderes und Besseres. Manchmal wurde der Most auch mit<br />
purpurroten Schlehensaft gefärbt.- Trotz aller Arbeit war es aber doch ähnlich wie bei der<br />
Weinlese ein Fest, wenn im Dorf gemostet wurde:<br />
70
"Äpfel geits, on des net wia,<br />
landauf, landab on auch hia<br />
Do siehd mr d' Leid se lesa, uf de Waga lada<br />
zur Moste brenga on zur Preß na traga.<br />
On wenn's na afangt en de Fässer z'laufe,<br />
isch au s' meischde Gschäfd schau dau,<br />
da denkt koaner me dra, Bier z' kaufa,<br />
wie mr sonst vielleicht häd dau."<br />
Wenn vor der Ernte der Most ausging, wurden oft Zibeben (Rosinen) gekauft und zum<br />
Mosten mit Wasser angesetzt. Ca. 70 Pfund Zibeben kamen in ein 300 Literfaß mit Wasser.<br />
Der gegorene "Zibebemooscht" wurde oft unterschätzt - er war so stark, daß er manchen<br />
Rausch erzeugte.<br />
Als Tafel- und Lagerobst eigneten sich nur wenige Sorten der in Gechingen wachsenden<br />
Äpfel und Birnen. Außer zu Most wurden vor allem Birnen nach wie vor zu Dörrobst<br />
verarbeitet, ebenso Zwetschgen. Auch wurden die schönsten Schlehenbeeren ausgesucht und<br />
auf dem Ofen getrocknet. Im Winter kaute man sie solange, bis nur noch der Kern übrig war.<br />
Wildwachsende Beeren wurden noch bis Ende der fünfziger Jahre fleißig in den Wäldern und<br />
an den Hecken gesammelt. Was nicht frisch verzehrt wurde, wurde, wie auch der Ertrag der<br />
Beerensträucher im Garten und teilweise das Steinobst, eingemacht oder zu "Gsälz" verkocht,<br />
was gegenüber dem Dörren aber eine viel neuere Form der Konservierung ist und sich erst in<br />
unserem Jahrhundert durchgesetzt hat. Das Eindünsten (Sterilisieren) mit dem bekannten<br />
Apparat, den zugehörigen Gläsern usw. wurde erst 1894 entwickelt. Das Haltbarmachen mit<br />
Zucker durch Marmeladenherstellung war zwar schon viel früher bekannt, da aber Zucker bis<br />
zur Vervollkommnung der Zuckergewinnung aus Zuckerrüben sehr teuer war, verbot sich<br />
diese Art der Konservierung auf dem Land von selber.<br />
In Gechingen gibt es schon seit 1956 eine Gefriergemeinschaft, so daß es hier schon seit über<br />
vierzig Jahren verbreitet ist, auch auf diese schonende Weise das Obst haltbar zu machen.<br />
Der Wald<br />
Der ausgedehnte Gemeindewald stellt bis heute einen beträchtlichen Teil des Vermögens der<br />
Gemeinde dar. Ursprünglich war um Gechingen Laubwaldgebiet mit Vorherrschaft der Buche,<br />
untermischt hauptsächlich mit Eichen. Nadelbäume konnten sich nur da behaupten, wo sie<br />
kahlgeschlagene Flächen besiedeln konnten oder damit aufgeforstet wurde. In den lichten<br />
Laubwäldern ist der Graswuchs sehr stark. So wurde der Wald als Viehweide und im Herbst,<br />
wo es zusätzlich auch noch Bucheckern und Eicheln gab, zur Schweinemast genutzt. Buchen<br />
sind empfindlich gegen Tritte und gegen Verbiß. Bei zunehmender Bevölkerungszahl und<br />
anwachsendem Viehbestand wurden die Wälder geschädigt. Dazu kam die übermäßige<br />
Wildhege der Herren, die in den Wäldern das "Gejaid" hatten. Erst ab der Einführung der<br />
Stallfütterung konnten die Wälder sich zunächst wieder erholen, sofern Gras und Laub nicht,<br />
wie es später vor allem in mageren Jahren geschah, als Viehfutter und Laubstreu eingeholt<br />
wurden. Das Entfernen der schützenden und humusbildenden Gras- und Laubdecke ließ den<br />
Waldboden verarmen und die nachwachsenden Bäume verkümmern.<br />
Die Jagd war in den Händen des Prälaten von Hirsau, von dem es dann zur Reformationszeit<br />
auf das württembergische Fürstenhaus kam. Aktenkundig ist, daß damals der Schultheiß mit<br />
drei Ratsangehörigen in Böblingen über die <strong>Gechinger</strong> Wälder befragt wurde. Den<br />
71
<strong>Gechinger</strong>n wurde bestätigt, daß die Wälder schon seit undenklichen Zeiten zu Gechingen<br />
gehörten. Die Bauern waren aber verpflichtet, dem neuen Herren Jagdfronen zu leisten, auch<br />
mußten sie für ihn Hunde halten und das erlegte Wild zu dem Ort führen, wo es der Herzog<br />
hinhaben wollte. (siehe auch unter "Württemberg")<br />
Aus dem Forstlagerbuch von 1583:<br />
"Gechingen der Fleck hat einen Wald, die Kirchhalden: Ist Brennholz, ungefähr 100 Morgen,<br />
ein Jungwald.<br />
Item haben sie einen Wald, den Dachtler Berg, Bau und Brennholz, ungefähr 60 Morgen, ist<br />
schön gewachsen und soll nächstes Jahr zu Brennholz geschlagen werden.<br />
Item das Weiler, Bau und Brennholz, 200 Morgen. 100 Morgen vor 30 Jahren abgehauen.<br />
Item ein Wald der Burch, 10 Morgen meist Brennholz ohne Langholz."<br />
Der Förster war damals in Stammheim, das Forstamt hatte seinen Sitz in Böblingen.<br />
Aus dem Fleckenbuch von 1614:<br />
"Anno 1614 haben Schultheiß, Bürgermeister, Gericht, folgende Holzordnung beschlossen:<br />
Zu jedem Neubau soll aus des Flecken Waldungen gegeben werden:<br />
10 große, eichene Stämme<br />
40 große, tannene Stämme<br />
30 kleine tannene Stämme<br />
Je nach Neubaugröße kann die Gemeinde die Holzgabe mindern oder mehren.<br />
Bei Umbauten oder Reparaturen entscheidet die Gemeinde, wieviel Holz dazu gegeben wird."<br />
Diese Bestimmung führte im Lauf der Zeit zu Mißbrauch oder wurde doch bis aufs äußerste<br />
ausgenutzt und zwar anscheinend vor allem von den wohlhabenderen Einwohnern. Jedenfalls<br />
bezieht sich der Einspruch der Bürgerversammlung vom 23.3.1848 darauf (siehe: "Von der<br />
Revolution 1848/49 bis 1870").<br />
1693 heißt es: "Kein Bürger darf einem Fremden Brennholz verkaufen. Wenn einer im Walde<br />
unbefugt Holz holt, soll er mit 1 Pfund Heller bestraft werden."<br />
Jeder Bürger hatte ein Recht auf die "Gab", eine gewisse Menge von Brennholz aus dem<br />
Wald, das ihm kostenlos zustand. Der Umfang der "Gab" richtete sich nach der Größe der<br />
Familie.<br />
Über das Weiden von Vieh in den Wäldern:<br />
"Gechingen der Fleck, Merklinger Amts, haben in ihren eigenen und commun Waldungen seit<br />
undenklichen Zeiten her den Trieb und die Weidgerechtigkeit gehabt, daß sie mit all ihrem<br />
Vieh, Ochsen, Kühen, Pferden und Schweinen nach ihrem Gefallen dieselben nützen und<br />
genießen können, ohne alle Beschwerden."<br />
Das wurde dann später abgeschafft und behördlich verboten. Offenbar hatte man erkannt, daß<br />
die Waldweide auf lange Sicht den Wald zugrunde richtete. 1791 findet sich ein Vermerk, daß<br />
die Forsten in einem desolaten Zustand seien. 1831, bei der Ablösung des Zehnten, werden<br />
die Wälder wieder erwähnt; anscheinend haben sie sich zu diesem Zeitpunkt bis zu einem<br />
gewissen Grad erholt. Inzwischen hatte sich wohl auch die Stallfütterung nach und nach<br />
durchgesetzt. Die Entnahme von Waldheu und Laubstreu ließ sich aber, vor allem in<br />
Notzeiten, nicht ganz vermeiden, doch wurde sie streng reglementiert.<br />
Aus dem Lagerbuch des Heiligen von 1701 u.1746:<br />
"Des Heiligen St.Martin Wälder:<br />
30 Morgen, 36 Ruthen an einem Stück, des Heiligen Wald oder auch des Heiligen Platten<br />
genannt, gegen den Haselstaller Grund, zwischen des gemeinen Flecken Wald und unten auf<br />
die Egarten, sei die Länge solcher 30 Morgen vorgleichen 108 Ruthen und die Breite 42<br />
Ruthen. Mit großen, besonders gemachten und gesetzten Steinen, rings umsteint. Und seien<br />
die Steine 13, nämlich 4 Feldsteine, worunter der Eine oben gegen die Herrschaft und<br />
Fleckenwaldung mit einem H bezeichnet auf der einen Seite, gegen den Haselstaller Hof sein<br />
72
zwischen beiden Feldsteinen 3 Steine, worunter der Dritte gegen den folgenden mit einem H<br />
bemerckt, auf der anderen Seite gegen den Deckenpfronner Pfad sein zwischen selbigen<br />
Feldsteinen noch 4 Stein, unter welchen oben ebenmäßig mit einem H bezeichnet, der Dritte<br />
glatt und der Vierte mit einem H G notiert, dann oben und unten allwegen ein glatter Stein."<br />
Dieser Wald war also Eigentum der kirchlichen Gemeinde.<br />
1712 wurde ein Wildzaun, vor allem gegen die Wildschweine, errichtet. Die Bauern hatten<br />
schon immer unter der Jagdleidenschaft der Herren zu leiden und unter der übertriebenen<br />
Schonung des Wildes, das die Äcker verwüstete und oft genug die Ernte dezimierte oder gar<br />
vernichtete.<br />
1715 gab es eine Jagd in Gechingen.<br />
1718 wurden Nachtwachen eingerichtet, um Wildschaden zu verhüten.<br />
Im 18. Jahrhundert befaßten sich Angehörige der Calwer Compagnie mit dem Holzhandel.<br />
Gechingen besitzt heute ca. 473,2 Hektar Mischwald.<br />
Die Namen der einzelnen<br />
Abteilungen lauteten um 1900 1980 erfolgte eine Neugliederung<br />
1.Bergwald 1.Bergwald<br />
a.Mühlhecke<br />
b.Riedhalde a.Schlossberg<br />
c.Schlossberg b.Torwartsgrund<br />
d.Untere Großbuch c.Großbuch<br />
e.Obere Großbuch d.Forchen<br />
f.Torwartsgrund Nord e.Bergbösch<br />
g.Dachtlerberg Nord<br />
h.Torwartsgrund Süd<br />
i.Dachtlerberg Süd<br />
j.Forchen<br />
2.Weiler 2.Weiler<br />
a.Maasen a.Maasen<br />
b.Herdweg b.Herdweg<br />
c.Lichte c.Lichte<br />
d.Finsterschlag d.Schimpfentannen<br />
e.Schimpfentannen e.Buschacker<br />
f.Buschäcker f.Wasserteich<br />
g.Trauf g.Kohlplatte<br />
h.Birkwald h.Hilsental<br />
i.Wasserteich i.Schnepfental<br />
j.Kohlplatte j.Lindenbusch<br />
k.Hülsental Ost k.Weilerstich<br />
l.Hülsental West l.Zigeunerloch<br />
m.Torweg m.Heiligenwald<br />
n.Weilereck n.Hofäcker<br />
o.Weilerstich<br />
p.Bühlwald<br />
q.Schnepfental Ost<br />
73
.Schnepfental West<br />
s.Lindenbusch<br />
t.Oberes Zigeunerloch<br />
u.Oberer Gerberwald<br />
v.Oberer Heiligenwald<br />
w.Obere Hofäcker<br />
x.Unteres Zigeunerloch<br />
y.Unterer Gerberwald<br />
z.Unterer Heiligenwald<br />
aa.Untere Hofäcker<br />
3.Grundhau 3.Grundhau<br />
a.Pfutsch a.Hofpfad<br />
b.Hofpfad b.Hochrain<br />
c.Grund<br />
d.Hochrain<br />
4.Burch 4.Burch<br />
5.Kirchhalde 1-6 5.Kirchhalde<br />
a.Obere Kirchhalde<br />
b.Vordere Kirchhalde<br />
c.Räderstall<br />
d.Hintere Kirchhalde<br />
6.Bergbösch<br />
Die Wälder bestehen zu ca 60 % aus Nadelbäumen. Der Rest setzt sich aus ca 35 % Buche<br />
und 5 % Eiche zusammen.Der Holzverkauf aus den Wäldern brachte der Gemeinde schon in<br />
früheren Zeiten regelmäßige Einnahmen. Von 1862 an finden sich in Abständen Anzeigen<br />
über Holzverkauf in der Calwer Zeitung.<br />
Im Jahre 1906 erlöste die Gemeinde für einen Raummeter Scheiterholz 12-18 Mark, für einen<br />
Raummeter Tannenholz 6-10 Mark.<br />
Die mittleren Einnahmen der Jahre 1981-1990 aus dem Holzverkauf lagen bei DM 493 897.-.<br />
Die Ausgaben im Mittel für den gleichen Zeitraum betrugen DM 334 257.-, so daß ein<br />
mittleres Jahresergebnis von DM 159 640.- in die Gemeindekasse floß.<br />
Anfang des Jahres 1990 fegten drei große Stürme über das Land. Etwa 8000 Festmeter<br />
Sturmholz fielen an. Die Stürme richteten nicht nur bei den Fichten und Tannen großen<br />
Schaden an, auch achtzig- bis hundertjährige Buchen wurden vom Orkan umgerissen.<br />
Das gegenwärtige Waldsterben bringt einen Verlust von DM 100.000.- pro Jahr. So waren<br />
z.B. 1984 30 % der Wälder geschädigt, und zwar fielen 60% der Tannen unter die Schadstufe<br />
1, 10 % unter Schadstufe 2, bei steigender Tendenz. Um dem Waldsterben entgegenzuwirken,<br />
begann man 1985, Kalk in den Wäldern auszubringen.<br />
Straßenverhältnisse bis zum Beginn der Motorisierung<br />
Die Straßenverhältnisse waren zu Beginn des 19. Jahrhunderts bei weitem nicht so gut wie<br />
heute. Zwar wurde im 18. Jahrhundert in Württemberg mit dem Bau eines Straßennetzes nach<br />
heutigen Begriffen begonnen, es gab aber 1787 erst 286 km gepflasterte Fahrdämme<br />
74
(Chausseen). Um den Straßenbau zu finanzieren, hatte 1772 Herzog Carl Eugen von<br />
Württemberg eine Straßensteuer festgesetzt. Die Verordnung macht deutlich, wie damals der<br />
Personen- und Güterverkehr ablief. Der Text lautet:<br />
". . . . und zwar sollen 1.: Auf eine Stunde weit von 1 Pferd an einem beladenen Güterwagen,<br />
Kutschen oder anderen Gefährten, 3 Heller, bei einem leeren Wagen 1 und einen halben<br />
Heller gegeben werden. 1 Pferd, 2 Ochsen oder 2 Kühe zahlen je 3 Heller, Schafe, Schweine,<br />
Hammel, Gaißen und Kälber von 1-10 Stück 3 Heller. Von dieser Abgabe sind befreit:<br />
Hofleute, Militär, Postillions, Gesandte, Fronfahrten aller Art und die Feuerleute. Das<br />
Straßengeld wird von extra Einzugsstationen kassiert. Die Schultheißen der an den Straßen<br />
gelegenen Orten sorgen dafür, daß jeder bezahlt."<br />
Auch das Gewicht der Fahrzeuge war beschränkt:". . kein Fuhrmann darf über 60 Zentner<br />
laden und nur 6 Vorspannpferde nehmen." - Diese Maßnahme war notwendig, um den<br />
Zustand der Straßen zu erhalten. Diese Vorschriften sollten uns zu denken geben, wenn wir<br />
heute über zu viel Bürokratie klagen.<br />
In Gechingen existierte zwar ein Wegenetz, aber die Straßen waren, wie die meisten<br />
Landstraßen, nach heutigen Begriffen Feldwege mit teilweise schlechtem Unterbau.<br />
Gewohnheiten vieler Generationen und dauernde Benützung haben diese Wege meist schon in<br />
vorgeschichtlicher Zeit entstehen lassen. Von den nachfolgenden Bewohnern wurden sie dann<br />
übernommen. Sie gingen, nicht zuletzt aus militärischen Gründen, aber auch weil in den<br />
versumpften Tälern keine Verkehrswege möglich waren, über die Höhen. So z. B. die<br />
Ochsenstraße, die vom Jägerberg über Ostelsheim und Döffingen nach Sindelfingen führt. Die<br />
alte Straße nach Deufringen, heute noch als Feldweg vorhanden, zieht sich in halber<br />
Höhenlage am Berg talwärts. Die sogenannte "Römerstraße" kommt von Deckenpfronn und<br />
führt laut Oberamtsbeschreibung 1860 unter der Bezeichnung "Hochsträß" über die zu<br />
Gechingen gehörende Flur "Altenburg" (gemeint ist der "alte Burch") nach Althengstett.<br />
Benützt wurden die Straßen um unser Dorf von Fuhrwerken und Fußgängern, ab und zu mal<br />
vielleicht von einer Chaise, und führten über Gelände bergauf und bergab. Irgendeine Art von<br />
organisiertem Personenverkehr gab es noch nicht. Wie isoliert noch zu Beginn des 19.<br />
Jahrhunderts eine Dorfgemeinschaft lebte, wenn der Ort nicht an einer Handelsstraße lag,<br />
macht ein Brief deutlich, der sich aus dieser Zeit erhalten hat. Der <strong>Gechinger</strong> Johannes<br />
Böttinger schreibt am 12. März 1832 aus der Kaserne in Ludwigsburg an seine Eltern:<br />
"Vielgeliebte Eltern und Geschwister, . . . . Auf 0stern oder auf Kirchweih bekomme ich<br />
vielleicht Urlaub, dann werde ich euch besuchen. Aber ein Tag Urlaub nützt mir nichts, da<br />
könnte ich ja doch nicht zu euch kommen. Ihr wißt ja selbst, daß es weit ist, und wenn ich je<br />
zwei Tage bekommen würde, so hätte ich gerade mit Hin- und Herlaufen zu tun."<br />
Jedoch stieg auch in Gechingen nach und nach der Verkehr, und die Einsicht setzte sich<br />
durch, daß die alten Straßen dem nicht gewachsen waren. Allmählich kamen auch die ersten<br />
landwirtschaftlichen Maschinen auf, die die Straßen stärker beanspruchten. In der<br />
Oberamtsbeschreibung von 1860 heißt es: ". . . .landwirthschaftliche Neuerungen, wie<br />
verbesserte Pflüge, Walzen, Repssämaschinen, einfache Joche etc. haben Eingang gefunden."<br />
Die erste richtige Straße nach heutigen Maßstäben, die hier gebaut wurde, war 1830 die nach<br />
Althengstett. Ebenso wurde eine Verbesserung bzw. ein Neubau der Straße in Richtung<br />
Deufringen immer dringlicher. Die erste Straße dorthin, von der wir wissen, führte durch die<br />
Riedhalde. Die <strong>Gechinger</strong> Burg lag zumindest in ihrer Nähe, so daß sie eine Kontrollfunktion<br />
für den Verkehr auf dieser Straße gehabt haben dürfte. Nach 1730 zog die Deufringer Straße<br />
auf halber Höhe über die heutige Bergwaldsiedlung den Dachteler Bergwald entlang. So war<br />
Dachtel "naheliegender" als Deufringen und die erste Postkutschenlinie, die durch Gechingen<br />
führte (seit 1883), verkehrte von Dachtel über Gechingen nach Calw.<br />
1895 beschloß dann endlich der Gemeinderat laut Protokoll:<br />
75
"Es wird eine neue Straße nach Deufringen gebaut, Gechingen bezahlt 2/3, Deufringen 1/3 der<br />
Kosten." 1901 konnte die neue Trasse vermessen werden. Die Meßgehilfen, Christian Gehring<br />
und Friedrich Breitling, erhielten pro Tag und Mann je 2 Mark. Der Kostenvoranschlag belief<br />
sich auf 34 000 Mark. Im Protokoll heißt es weiter: "Gechingen möge ein Staatsbeitrag von 33<br />
1/3 % gewährt werden, da Gechingen für Deufringen einen Zuschuß von 5000 Mark zur<br />
Verfügung stellt". Diese 5000 Mark gab Gechingen der, wie es in einem anderen Protokoll<br />
heißt, "armen Gemeinde Deufringen", da sonst der Straßenbau nicht zustande gekommen<br />
wäre. Gechingen lag nämlich mit seiner Steuerkraft im alten Oberamt Calw an dritter Stelle<br />
nach Calw und Stammheim. Auch Aidlingen mußte für Deufringen einen Beitrag leisten.<br />
Am 25. Juni 1905 war die Straße fertig und wurde von Schultheiß Ladner, Gemeinderat<br />
Ludwig Schwarz und Bürgerausschußmitglied Dingler abgenommen.<br />
Im Zusammenhang mit diesem Straßenbau steht die erste Flurbereinigung in Gechingen. Von<br />
1903-1908 wurden 58 ha im Deufringer Tal umgelegt.<br />
Gechingen und seine Bewohner<br />
Bevölkerungsbewegungen<br />
Die Merklinger Schätzungslisten von 1448 und 1470 zählen in Gechingen: Vermögende<br />
Hausbesitzer 47, Einwohner ohne Haus 5, völlig Mittellose 10. Geschätzte Zahl der<br />
Einwohner: Ungefähr 350-450 Personen. (Siehe "Vom frühen Mittelalter bis zum<br />
Bauernkrieg"). Aus noch früheren Jahrhunderten liegen keine Bevölkerungungszahlen vor.<br />
Um 1618 lebten 140 Familien in Gechingen. Wenn man den früher üblichen Kinderreichtum<br />
berücksichtigt, kommt man auf von ca. 1 400 Einwohner. Das sind mehr, als Ackerbau und<br />
Viehzucht in Gechingen zu jener Zeit ernähren konnten. Bei der damals aufblühenden ersten<br />
Industrie im Lande, der Tuchherstellung, die von Calw aus betrieben wurde und der in allen<br />
Dörfern ringsum Zeugmacher und Weber zuarbeiteten, waren auch viele <strong>Gechinger</strong><br />
beschäftigt, die Männer als Weber, die Frauen als Spinnerinnen, und hatten davon ihr<br />
Auskommen.<br />
Der 30-jährige Krieg dezimierte den Einwohnerstand auf ca. 430 Personen im Jahr 1650. Nur<br />
sehr langsam stieg die Einwohnerzahl wieder an. Erst in der Zeit zwischen 1950 und 1965<br />
wurde der Stand von 1618 überschritten. Gründe für das schwache Bevölkerungswachstum<br />
gab es viele: Einer war die enorm große Säuglingssterblichkeit, die durch Hungersnöte noch<br />
verstärkt wurde. Dann ging der Verdienst oder Nebenverdienst durch die Zeug- und<br />
Tuchweberei laufend zurück. Die Arbeit wurde immer schlechter entlohnt und ab 1797, als<br />
die Calwer Compagnie aufgeben mußte, entfiel dieses Einkommen ganz. Durch Mißwirtschaft<br />
der Landesherren und dadurch bedingt, steigende Abgaben, auch durch übermäßige Wildhege,<br />
die Ernteeinbußen und vermehrte Jagdfronen mit sich brachte, stieg die Neigung, vor allem<br />
bei jungen Leuten, auszuwandern. Vom Soldatenhandel war Gechingen ebenfalls betroffen,<br />
auch junge Männer von hier wurden als Söldner ins Ausland verschachert.<br />
1772 zählte man 500 Seelen. Im Jahre 1821 war die Bevölkerung sprunghaft auf 1 002<br />
Einwohner angestiegen. 1834 hatte Gechingen dann 1107 Ortsangehörige, davon waren 545<br />
männlichen und 562 weiblichen Geschlechts. Im Jahre 1860 wird Gechingen als Bauerndorf<br />
geschildert (Oberamtsbeschreibung); Gewerbetreibende gab es nur für die lokalen<br />
Bedürfnisse. Einen Höchststand erlangte die Einwohnerzahl im Jahr 1880 mit 1 230 Personen.<br />
Diese Entwicklung wurde wahrscheinlich durch die im Anfang des 19. Jahrhunderts nach und<br />
nach beginnende allgemeine Erhöhung der Ernteerträge möglich. Die Verbesserung des<br />
Saatguts hatte dazu geführt, auch wurden neugewonnene wissenschaftliche Erkenntnisse über<br />
Düngung und Fruchtwechsel nach und nach umgesetzt. Dazu beigetragen hat sicher auch die<br />
Stallfütterung, die sich immer mehr verbreitete. Vor allem König Wilhelm I. (er regierte 1816-<br />
76
64) war sehr darauf bedacht, den Ackerbau zu heben. Die ersten landwirtschaftlichen<br />
Maschinen sind in dieser Zeit allmählich eingeführt worden. Die Gefahr der Hungersnöte war<br />
aber noch keineswegs gebannt, sie wurden aber seltener.<br />
Ab 1900 mit 1 088 Einwohnern sank der Stand der Bevölkerung wieder langsam, was mit der<br />
zunehmenden Industrialisierung Württembergs und der damit einsetzenden Landflucht<br />
zusammenhängen dürfte. Noch um die Mitte des 19. Jhdts. war Württemberg weit<br />
überwiegend von der Landwirtschaft geprägt, aber schon 1912 machte der<br />
Bevölkerungsanteil, der von Industrie und Handel lebte, fast die Hälfte (49,5%) der<br />
Einwohner Württembergs aus. Die Auswanderung war dagegen ganz zurückgegangen.<br />
Im Jahr 1940 gab es 936 Einwohner in Gechingen. Eine erste Steigerung läßt sich 1950<br />
ablesen. Unser Ort hatte in diesem Jahr 1 035 Bewohner, davon waren 744 Erwachsene über<br />
18 Jahren. In den folgenden 15 Jahren bis 1965 stieg die Bevölkerungszahl langsam auf 1 905<br />
Einwohner an. Dann kam es durch rege Bautätigkeit und den Zuzug vieler neuer Mitbürger zu<br />
einem rascheren Anstieg. Im Jahr 1979 wurde die Zahl von 3000 Einwohnern überschritten.<br />
Seitdem nimmt die Bevölkerung wieder langsamer zu. Im Jahre 1989 waren es ca. 3 400<br />
Einwohner. In den genannten Zahlen der letzten Jahre sind die ausländischen Mitbürger<br />
immer mit eingerechnet. Die ersten Gastarbeiter kamen etwa 1960 nach Gechingen. 1966<br />
waren es dann 145 Personen. 1981 erreichte die Zahl der Ausländer mit 481 ihren Höhepunkt,<br />
das waren etwas über 15 % der Gesamtbevölkerung. Durch die nachlassende Konjunktur<br />
sahen sich dann aber manche Gastarbeiter veranlaßt, wieder in ihre Heimat zurückzukehren,<br />
so daß 1984 nur noch 428 und 1985 nur noch 354 Ausländer in Gechingen wohnten. Der<br />
größte Teil der in ihre Heimat zurückkehrenden Gastarbeiter waren Türken. Ihr Anteil betrug<br />
im Jahr 1981 noch 213 Personen, bis 1985 war er auf 123 Personen gesunken. Auch bei den<br />
italienischen Gastarbeitern fiel in dem entsprechenden Zeitraum die Zahl von 131 auf 102<br />
Personen. Bei der drittstärksten ausländischen Gruppe, den Jugoslawen, ist ein<br />
gleichbleibender Stand von 56 Einwohnern zu verzeichnen. Insgesamt gesehen war der<br />
Bevölkerungsanteil der ausländischen Mitbürger rückläufig. Das änderte sich, als der<br />
Gemeinde ausländische Asylberwerber zugewiesen wurden. Die Zahl der Asylsuchenden<br />
schwankt zwischen 30 und 50 Personen. Aber auch hier sinkt auf Dauer der Zustrom.<br />
Bauer, Bäuerinnen und Bauernhäuser<br />
In der Oberamtsbeschreibung von 1860 steht folgendes über die <strong>Gechinger</strong>:<br />
"Die im allgemeinen körperlich kräftigen Einwohner, welche seit Menschengedenken von<br />
epedemischen Krankheiten verschont blieben, sind sehr fleißig und finden ihre<br />
Nahrungsquellen in Feldbau und Viehzucht, indem die Gewerbe, mit Ausnahme einer<br />
Ziegelhütte, nur den örtlichen Bedürfnissen dienen. Schildwirtschaften bestehen drei und ein<br />
Kaufmann wie auch ein Krämer sind vorhanden.<br />
Die Vermögensumstände gehören zu den besseren des Bezirks, indem der sogenannte<br />
Mittelstand vorherrscht und eigentlich Arme sich nur wenige im Ort befinden. Der<br />
vermöglichste Bürger hat einen Besitz von 33 Morgen, während der größte Theil der<br />
Einwohner 10-15 Morgen besitzt, die Unbemittelten haben 1-2 Morgen und nur wenige sind<br />
ohne Grundbesitz. Die Markung ist so sehr vertheilt, daß die meisten Grundstücke nur 1/4-1/2<br />
Morgen betragen."<br />
Der Fleiß, der hier den <strong>Gechinger</strong>n nachgesagt wird, war auch vonnöten. Schon Hans Sachs<br />
beschreibt die Bauernarbeit folgendermaßen:<br />
"Der Bauwer<br />
Ich aber bin von art ein Bauwer<br />
Meine Arbeit wirt mir schwer und sauwr.<br />
Ich muß Ackern, Seen und Egn<br />
77
Schneyden, Mehen, Heuwen dargegn<br />
Holtzen und einführen Hew und Treyd<br />
Gült un Steuwr macht mir viel hertzleid<br />
Trink Wasser und iß grobes Brot<br />
Wie denn der Herr Adam gebot."<br />
(„Ich aber bin von Art ein Bauer. Meine Arbeit wird mir schwer und sauer. Ich muß ackern,<br />
säen und eggen, schneiden, mähen und heuen, holzen und Heu und Getreide einführen.<br />
Abgaben und Steuern machen mir viel Herzeleid. Ich trinke Wasser und esse grobes Brot, wie<br />
es der Herr schon Adam geboten hat.")<br />
So mühsam, wie hier für das 16. Jahrhundert beschrieben, war die Arbeit der Bauern bis weit<br />
in unser Jahrhundert hinein. Erst als sich landwirtschaftliche Maschinen durchgesetzt hatten,<br />
wurde sie leichter. Es soll jetzt die Getreideernte in Gechingen geschildert werden, wie sie vor<br />
dem Maschinenzeitalter vor sich ging. (soweit die älteren <strong>Gechinger</strong> sich noch erinnern<br />
können oder vom Hörensagen wissen.)<br />
Teilweise wurde noch um die Jahrhundertwende das Getreide mit der Sichel geschnitten,<br />
dadurch fielen weniger Körner aus den Ähren. Sensen verwendete man nur für Hafer. Später<br />
nahm man Sensen auch für das Brotgetreide. Während das Schneiden mit der Sichel noch<br />
vorwiegend Frauen besorgt hatten, arbeiteten mit der Sense im allgemeinen die Männer.<br />
"Wenn mr gmäht hod, isch mer morgens um drui fort", so erzählte mir ein alter <strong>Gechinger</strong>.<br />
Von 1/2 5 Uhr bis 9 Uhr wurde ununterbrochen gearbeitet, dann gab es eine Pause, Brotessen<br />
oder Vesper. Um 11 Uhr läutete die große Kirchenglocke und die Frauen eilten nach Hause,<br />
um zu kochen und das Vieh im Stall zu versorgen. Nach dem Mittagessen, das den Männern<br />
von den Frauen aufs Feld gebracht wurde, ging die Arbeit bis 18 Uhr weiter. Vor dem<br />
Abendessen mußte dann erst noch das Vieh versorgt werden.<br />
Bei Gras mähte man vom stehengebliebenen Gras weg ("wegmäha"). Aber bei der<br />
Getreideernte wurde gegen das noch nicht Gemähte geschnitten ("namähe"). So konnten die<br />
Halme nicht auf den Boden fallen. Gehilfen, meist Frauen, nahmen sie mit der Sichel auf und<br />
legten sie auf dem abgemähten Feld in Reihen zu "Sammletsen" aus ("weglega"). Bei gutem<br />
Wetter blieb das ausgelegte Getreide 2-3 Tage lang liegen, damit die Körner hart wurden und<br />
das Stroh gut trocken war. War das Wetter dagegen schlecht, mußte man alle paar Tage<br />
"omdreha", d. h., das Untere nach oben wenden, sonst wäre das Korn "ausg´waase"<br />
(ausgewachsen). Man konnte es auch "ufböckle" (zu kleinen Garben binden,) von denen<br />
jeweils ein paar mit den Ähren nach oben zusammengestellt wurden.<br />
Zum Einholen der Ernte wurden die Sammletsen a´grecht, d.h. man rechte soviel zusammen,<br />
daß es mit den Armen gut aufgenommen und auf das Garbaseile gelegt werden konnte<br />
("a´traga"). Vier Armvoll brauchte man etwa für eine Garbe. - Ehe die Garbaseile sich<br />
durchsetzten, verwendete man zum Garbenbinden auch Hopfenranken oder Strohseile. Das<br />
Auslegen der Garbaseile war im allgemeinen Kinderarbeit. Das Klötzle mußte auf der<br />
richtigen Seite der Garbe liegen und dem Binder geboten werden, wenn er auf der Garbe<br />
kniete und sie mit dem Seil zusammenspannte. Auch dieses Bieten war Kinderarbeit.<br />
Als Erntewagen hatten viele keinen speziellen, großen Wagen, schon aus Platzgründen. Zur<br />
Heuernte konnte der Mist- oder Futterwagen verlängert und zum Leiterwagen umgerüstet<br />
werden ("ufrichta"). Hinten wurde das Wagengestell dann durch eine drehbare Welle<br />
abgeschlossen. Diese Spannwelle war ein Teil der Spannvorrichtung, mit der man eine Heu-<br />
oder Garbenladung zusammenpreßte und damit für den Transport befestigte. Über die gesamte<br />
Wagenlänge kam der Wiesbaum ("Wiesboom"), er wurde mit Seilen so verspannt, daß die<br />
Ladung auch auf hochbeladenen Wagen festhielt. Die Spannseile liefen über die Welle und<br />
wurden festgezurrt mit Hilfe der "Wellnägel", die man in Löcher der Spannwellen einführen<br />
und diese damit drehen und so die Seile in der Spannung halten konnte. - Nachdem das Öhmd<br />
eingebracht worden war, wurde der Wagen wieder "a(b)g´richtet" bis zur nächsten Heuernte.<br />
78
Zu den Arbeiten im Herbst, Winter und Frühjahr, wie Kartoffel- und Rübenernte und<br />
Futterholen genügte der kleine Wagen.<br />
Zum "Uflada" waren zwei Mann vonnöten, einer, der die Garben bot und einer, der sie im<br />
Wagen aufschichtete. Zuerst mußte das Gestell des Wagens mit Garben aufgefüllt werden.<br />
Die restlichen Garben wurden in "Glecken" ("Gelegen") angeordnet. Hier lagen die Garben<br />
quer zum Wagen, die Strohseite nach außen, in der Mitte die Ähren und zwar so, daß je zwei<br />
sich gegenüberliegende Garben mit den Ähren überdeckten. Die Garben ragten hüben und<br />
drüben etwas über die Leiterbäume hinaus. In einem Gleck hatten 16 - 20 Garben Platz. Ein<br />
Wagen konnte mit drei bis vier Gleck beladen werden, man mußte aber die Kräfte der<br />
Zugtiere und die Beschaffenheit des Weges berücksichtigen. Auf steilen Strecken war der<br />
Wagen bereits mit drei Gleck gut beladen.<br />
In der Scheuer angekommen, zog man die Garben mit Hilfe des "Grechrädles" (eines<br />
Holzrads, das oben am First befestigt war), nach oben. Über das Grechrädle lief ein Seil, das<br />
mit einem Haken versehen war, der in das Garbaseil eingehängt wurde. Wichtig war, daß<br />
beim Binden der Garbe darauf geachtet wurde, daß ihr Schwerpunkt auf der Ährenseite lag,<br />
schon das Beladen des Erntewagens ging so leichter vonstatten und die Garben ließen sich<br />
beim Hochziehen und auch beim Stapeln besser handhaben. In den oberen Geschossen der<br />
Scheuer ("Baarn") schichtete man die Garben reihenweise auf.<br />
Im Spätherbst begann der Flegeldrusch, der sich bis in den Winter hineinzog. Hermann<br />
Schmid erzählt in seinen Lebenserinnerungen: "Im Winter, wenn die Feldarbeit eingestellt<br />
war, wurde gedroschen. Wagen, Karren, alles was in der Tenne war, kam raus. Der Boden<br />
wurde sauber gefegt, einer ging die Leiter hoch und warf die Garben runter, bis der Boden auf<br />
beiden Seiten voll war. Dann wurden sie aufgemacht und auseinandergebreitet, daß Ähren<br />
gegen Ähren lagen. Nachdem gedroschen war, wurden die Garben umgedreht und auf der<br />
anderen Seite bearbeitet. Zum Schluß band man das Stroh zusammen und zog es in die<br />
Scheune hoch. Die Frucht wurde mit der Putzmühle gereinigt, in Säcke abgefüllt und auf die<br />
Bühne getragen, dort ausgeleert und wochenlang getrocknet."<br />
Gedroschen wurde meistens von 6 bis 8 Uhr, danach gab es zum Morgenessen Haberbrei.<br />
Dann arbeitete man weiter bis zum Mittagessen um 12 Uhr, anschließend putzte man die<br />
Frucht. Putzmühlen gab es seit 1860, Dreschmaschinen kamen um 1900 in Gebrauch. Um den<br />
Takt beim Flegeln zu halten, gab es für Anfänger besondere Sprüche, z.B. bei drei Dreschern:<br />
"Friß Roßdreck." Bei vier Mann hieß es: "Kraut on Spätzle" oder "Suppen schlappen", bei<br />
fünf Dreschern: "Schuldes, du Zipfel", bei sechs: "Katz hat Supp nagschlabbert."<br />
Auch die Arbeit der Bäuerinnen war schwer. Zur Feldarbeit mußten sie ihr Teil beitragen, die<br />
Bestellung der Gärten blieb ihnen meist ganz überlassen. Auch im Stall leisteten sie einen<br />
großen Teil der anfallenden Arbeiten, die Kleintierhaltung oblag ihnen gänzlich. Sie zogen<br />
den Nachwuchs auf, kochten, wuschen, putzten, flickten, spannen und schneiderten die<br />
benötigten Kleider. Der Arbeitstag dauerte durchschnittlich 15 - 16 Stunden. Durch die vielen<br />
Geburten, acht bis zwölf Kinder pro Familie waren die Regel, starben viele Frauen in jungen<br />
Jahren. Dann war der Witwer der Kinder wegen gezwungen, schnellstens wieder zu heiraten.<br />
Die Kindersterblichkeit lag um 1850 in Württemberg bei 34 %, das heißt, von 100 Säuglingen<br />
überlebten nur 66.<br />
Zurück zur Frauenarbeit: Eine der wichtigste Aufgaben war das Versorgen der Familie mit<br />
Nahrung. Damit verbunden war auch die Vorratshaltung und das Haltbarmachen von<br />
verderblichen Nahrungsmitteln. Brot wurde alle 8 bis 14 Tage im Gemeindebackhaus<br />
gebacken. Als Triebmittel für den Teig verwendete man Sauerteig ("Hefel"). Die fertigen,<br />
großen, runden Brotlaibe wurden im Keller auf der "Brothange" gelagert. Das war ein Brett,<br />
das an Ketten von der Kellerdecke hing, zum Teil mußte das Brot auch noch darauf mit<br />
Hauben aus Drahtgitter vor Ratten geschützt werden. Am Backtag, an dem die Frauen nicht so<br />
79
viel Zeit zum Kochen hatten, gab es allgemein Spickleng zum Essen, einen Kartoffelkuchen,<br />
der im Backhaus auch gleich gebacken wurde - eine <strong>Gechinger</strong> Spezialität (Siehe „Rezepte“).<br />
Die Mahlzeiten wurden zum allergrößten Teil aus selbst erzeugten Lebensmitteln zubereitet.<br />
Mehlspeisen spielten traditionell eine große Rolle, aber auch Kartoffeln, Milch und Eier.<br />
G´standene (saure) Milch und Kartoffeln aus der Hand (Pellkartoffeln) mit Salz, das gab es oft<br />
zum Abendessen oder auch g´standene Milch, in die Brot eingebrockt wurde. Im Sommer und<br />
Herbst kam auch selbstgezogenes Gemüse oder Salat auf den Tisch, im Winter gab es sehr<br />
häufig Kraut. Ein Ländle im Krautgarten und eine Krautstande für das Sauerkraut gehörten zu<br />
jedem Haushalt. Auch Hülsenfrüchte, vor allem Linsen ("Leisa") waren ein Winteressen. Hin<br />
und wieder gab es wohl auch Dampfnudeln, Schwedaknöpfla oder Ofenschlupfer mit Schnitz<br />
ond Zwetschga. Auch Suppen galten als vollwertiges Gericht, vor allem abends; Milchsuppe<br />
konnte auch schon morgens aufgetischt werden. Da gab es Brennte (Mehl-)Supp und<br />
Riebelessupp, Habersupp, Wasserspätzle, Grieß- und Nudelsupp. Fleisch und Wurst kamen<br />
nur selten vor.<br />
Auch die Küchenarbeit war hart und mühsam. Wasser mußte bis 1906, als Gechingen eine<br />
Wasserleitung bekam, von offenen Brunnen, die oft viele Meter vom Haus entfernt waren, in<br />
Eimern oder Kübeln geholt werden. Das Wasser, wie auch andere schwere Lasten, zum<br />
Beispiel die Backschüssel mit Brotteig, trugen die Frauen meist auf dem Kopf, auf den vorher<br />
ein "Bauscht" gelegt wurde.<br />
Schmutzwasser schüttete man in die Gosse.<br />
In der allerersten Zeit hatte man zum Kochen eine ausgemauerte Feuerstelle mit offenem<br />
Kamin, Kessel, Pfanne, Rührlöffel und ein eiserner Bratspieß waren, nebst ein paar irdenen<br />
Gefäßen, die ganzen Küchengeräte. Später hatte man große, gemauerte Herde. Sie bestanden<br />
aus einem gemauerten Block, auf dem das Feuer offen brannte. Darüber war der Rauchfang,<br />
in dem Fleisch und Wurst geräuchert werden konnten. Die Küchen waren damals immer rußig<br />
und voller Rauch und meist kleine Räume, ausschließlich für die Küchenarbeit bestimmt. Ab<br />
Beginn des 19. Jahrhunderts kamen nach und nach gußeisernen Herde auf, bei denen die<br />
Feuerung sich unter einer Eisenplatte befand. Ein Blechrohr ragte in den Kamin. Nun war die<br />
Arbeit in der Küche nicht mehr ganz so unangenehm. Feuerpolizeiliche Vorschriften, die die<br />
Abschaffung der nach unten offenen, besteigbaren Kamine und enge Zugkamine verlangten,<br />
verhalfen dazu, die Küchen allmählich rauch- und rußfrei zu machen. Nun konnte die Hitze<br />
effektiver genutzt und das Feuerholz gespart werden. In manchen Küchen gab es auch für<br />
einige Zeit offene und geschlossene Herdstellen nebeneinander.<br />
Die großen Küchenherde mit Holzfeuerung kennen die Älteren von uns wohl noch alle. Die<br />
einzelnen Kochstellen waren mit Herdringen abgedeckt, von denen man je nach Größe des<br />
Kochhafens oder der Pfanne einige oder alle entfernen konnte, so daß es möglich war, über<br />
offenem Feuer zu kochen. Manche Häfen waren auch zweiteilig, der obere Teil stand etwas<br />
über und wurde mit diesem Rand auf die entsprechend aufgedeckte Kochstelle gesetzt, die<br />
untere Hälfte, die direkt im Feuer hing, hatte einen kleineren Durchmesser. Gerichte, die nur<br />
gelinder Hitze bedurften, köchelten auf der heißen Herdplatte. Natürlich waren Häfen und<br />
Pfannen immer vom Feuer rußgeschwärzt.<br />
Später bevorzugte man größere Küchen, in denen meist auch ein Tisch als Arbeitsplatte oder<br />
für einen schnellen Imbiß stand, die Küche eignete sich jetzt auch eher als Aufenthaltsraum.<br />
Oft wurde auch das Säufutter in der Küche vorbereitet und gekocht, da brauchte man Platz.<br />
Nun setzten sich die emaillierten Herde durch, wie man sie vor allem in Form von<br />
Beistellherden vielfach heute noch hat.<br />
Für die meisten Frauen war der Waschtag ein besonders gefürchteter, weil überaus<br />
anstrengender Tag. Am Abend zuvor mußte die Wäsche eingeweicht werden. Die<br />
Einweichlauge wurde aus Holzasche gewonnen. Diese enthält wasserlösliche Pottasche, die<br />
80
wie Soda wirkt und benützt werden kann. Ein Korb wurde mit einem alten Stück Stoff, dem<br />
Aschentuch, ausgelegt, Asche hineingegeben und mit kochendem Wasser übergossen. Das so<br />
abgeseihte Wasser enthielt nun die gelöste Pottasche und konnte zum Einweichen verwendet<br />
werden. Die festen Ver-brennungsrückstände blieben auf dem Tuch im Korb zurück. Am<br />
andern Morgen wurde die Wäsche mit Kernseife eingeseift und auf dem Waschtisch oder auf<br />
einem Brett eingebürstet, vor allem an stark verschmutzten Stellen. Vor der Zeit der<br />
beheizbaren Waschkessel wurde die vorbehandelte Wäsche dann in einem Zuber mit auf dem<br />
Herd zum Kochen erhitzten Wasser gebrüht, in späterer Zeit im Waschkessel gekocht, wobei<br />
man sie mit dem Wäschestampfer bearbeitete. Der Waschkessel, der sich im 19. Jahrhundert<br />
nach und nach überall durchsetzte, war transportabel, denn man wartete nach Möglichkeit<br />
gutes Wetter ab und wusch meist im Freien. Er bestand aus einem gußeisernen, runden<br />
Ofenteil, das mit Schamotte ausgekleidet war und auf metallenen Beinen ruhte wie ein<br />
Stubenofen. Durch ein Ofentürle war er ganz normal zu heizen, das Ofenrohr ragte in die Luft.<br />
Der eigentliche Kessel war in den Ofenteil eingelassen, der die untere Partie des Kessels wie<br />
ein Wulst umgab. Direkt oberhalb dieses Wulstes waren Handgriffe am Kessel angebracht,<br />
damit man diesen nach Bedarf herausheben konnte.<br />
Wenn die Wäsche gut gekocht hatte, benutzte man die Wäschezange, um sie aus der heißen<br />
Lauge herauszuheben. Kleinere Stücke konnte man direkt mit ihr fassen, bei größeren war sie<br />
eine Hilfe, um das Wäschestück so über den hölzernen Waschlöffel zu ziehen, daß man damit<br />
das Stück herausholen konnte. Zuber mit Wasser zum Schwenken, die auf Holzböcken stehen<br />
konnten, standen neben dem Waschkessel bereit, da hob man die Wäsche hinein und bewegte<br />
(schwenkte) sie mit dem Waschlöffel. Auch da wurde die Wäsche noch einmal<br />
durchgemustert und wenn ein Teil nicht ganz sauber geworden war, wurde es nachbehandelt.<br />
Das Schwenken wurde noch ein paarmal mit frischem Wasser wiederholt, beim letztenmal<br />
kam Waschblau oder Sil ins Schwenkwasser. Darin ließ man die Wäsche einige Zeit liegen.<br />
Zum Auswinden brauchte man bei den großen Stücken zwei Personen, die Frauen halfen sich<br />
am Waschtag gegenseitig aus.<br />
Zum Aufhängen der Wäsche wurde ein Waschseil gespannt. Dieses wurde an großen Bäumen<br />
befestigt. An manchen Häusern gab es auch Haken für das Waschseil und in manchem Hof<br />
oder Garten fest eingemauerte Wäschestotzen zu diesem Zweck. Wenn man schwere<br />
Wäschestücke auf die oft recht lange Leine hängte, hatte man Stützen in Form von Latten,<br />
etwa in der Länge von Bohnenstecken. Diese hatten oben eine Kerbe, die der Dicke des<br />
Waschseils entsprach. Man verhinderte mit ihnen, daß das Waschseil zu weit nach unten hing<br />
und die Wäsche womöglich am Boden schleifte.<br />
Bett- und Tischwäsche mangelten die Frauen von Hand mit einer Holzmangel. Sie mußte von<br />
zwei Personen bedient werden, wobei die eine, häufig ein Kind, "triebelte" und die andere das<br />
Wäschestück, wenn nötig der Walzenbreite entsprechend zusammengelegt, zwischen die<br />
beiden sich drehenden Walzen schob und dann auseinandergezogen hielt, daß es glatt gepreßt<br />
wurde.<br />
Kleinere Wäschestücke wurden gebügelt. Entweder hatte man ein Holzkohlen- oder ein<br />
Stahlbügeleisen. Letzteres war hohl und hatte an der hinteren Seite eine Klappe, in die der<br />
erhitzte Bügelstahl eingelegt werden konnte. Bei beiden Arten war es sehr schwierig, die<br />
Bügeltemperatur so einzurichten, daß die Wäsche geglättet, aber nicht versengt wurde. Nach<br />
dem Zusammenlegen gehörte noch das Verstauen in den Wäscheschrank zur großen Wäsche.<br />
Das Ganze war eine sehr zeitaufwendige Arbeit, die sich oft zwei bis drei Tage lang hinzog.<br />
Verständlich, daß früher die Wäsche nicht so oft gewechselt wurde wie heute.<br />
Der Wäscheschrank war der Stolz der Hausfrau, den sie mit selbstgestickten Sprüchen<br />
schmückte. Zum Beispiel: "Was Rocken, Webstuhl und Nadel gemacht, wird hier fein<br />
säuberlich untergebracht. Willst Du das Ganze richtig verwalten, gilt´s Neues zu schaffen und<br />
81
Altes erhalten."Oder: "Geblüht im Sommerwinde, gebleicht auf grüner Au, liegt still es nun<br />
im Spinde als Stolz der deutschen Frau."<br />
Die Mädchen saßen an den Winterabenden bei Kerzen- oder Petroleumlicht und nähten<br />
oder stickten an ihrer Aussteuer, lange bevor sie einen Bräutigam hatten. Viel Wäsche<br />
bedeutete viel Ansehen und Reichtum. Monogramme in Bettwäsche, Handtüchern und<br />
Taschentüchern wiesen für das ganze Leben aus, was in die Ehe eingebracht wurde.<br />
Wäsche und Kleidung war in früherer Zeit im Vergleich zu den allgemeinen<br />
Lebenshaltungskosten sehr teuer oder recht mühsam herzustellen - und die Frauen gingen<br />
äußerst sorgsam damit um und versuchten, die einzelnen Stücke möglichst lange zu<br />
erhalten. Da wurden feine Wäschestücke gewiefelt auch Tisch- und Taschentücher, Socken<br />
und Strümpfe kunstgerecht gestopft, oder, wenn sie zu sehr zerrissen waren, neue Spitzen<br />
an- oder neue Fersen eingestrickt. Bei Strümpfen wurde, wenn die Länge noch gut war, ein<br />
neues Fußteil angestrickt. Selbstgestrickte Socken, vor allem Männersocken, besetzte man<br />
von Anfang an auf dem Sohlenteil mit Stoff, damit das Gestrickte beim Gebrauch geschont<br />
wurde. Kleidungs- und Wäschestücke wurden, vor allem wenn sie an Strapazierstellen<br />
dünn ("blöd") geworden waren, unterlegt. Nur das Ausbessern zerissener Teile, wobei ein<br />
Stück Stoff ("Blätz") ein- oder darübergesetzt wurde, nannte man flicken.<br />
Besonders bemühte man sich um die Bettwäsche, damit sich die möglichst lange hielt. Die<br />
Ecken der Deckbettbezüge ("Ziachen") wurden durch Unterlegen verstärkt und innen ein<br />
Bändel angenäht, dem jeweils ein Bändel an den Ecken des Inletts entsprach. So ließen<br />
sich die Ziachen am Deckbett festbinden, was zugleich auch das Bettenmachen erleichterte.<br />
Nun noch einiges über bäuerliches Wohnen (ca. 1860): Kam man in ein altes Bauernhaus,<br />
gelangte man zunächst in den geräumigen Flur ("Ern"), in dem Gerätschaften wie Geschirre,<br />
Peitschen und andere Dinge an der Wand hingen. Eine Tür führte zum Stall, kleine Fenster<br />
erhellten diesen. Über eine Treppe gelangte man vom Flur zum Wohnstock und zur Küche,<br />
deren Wände mit Kalk geweißt waren. In der Ecke stand der aus Backstein aufgemauerte<br />
Herd, über dem sich der offene Rauchabzug befand. Das Schüsselbrett mit Kochtöpfen und<br />
Schüsseln, Messingpfannen, Zinntellern usw. war an der Wand angebracht. Vor dem Fenster<br />
hing das "Hafenbritt", der Aufbewahrungsort für die irdenen Milchtöpfe und die Melkkübel.<br />
Die Bauernwohnstube lag immer neben der Küche, damit sie von dort aus beheizt werden<br />
konnte. Die Wand zur Küche war durchbrochen und der Herd, als sogenannter Hinterlader, in<br />
die Stube geschoben. Bei dem damals noch üblichen System des offenen Rauchfangs war das<br />
Schüren sicher eine unangenehme, schmutzige Arbeit, aber die Stube wenigstens blieb frei<br />
von Ruß und Qualm. Der Stubenofen hatte meist schon ein Ofenrohr, das in den offenen<br />
Rauchabzug mündete. Auf der Stubenseite des Ofens war entweder eine eiserne Platte mit<br />
Wappen und Verzierungen oder die ganze Wand wurde mit Tontafeln verkleidet. Diese<br />
Plättchen waren mit Sprüchen bemalt, die von Liebe, von Essen und Trinken sowie über<br />
Beobachtungen aus der Natur berichteten. Aber auch Rätsel, Volkslieder- oder<br />
Gesangbuchverse waren beliebt. Hergestellt wurden solche Tontafeln in Dachtel, Gärtringen,<br />
Simmozheim und Weil der Stadt. In Gechingen ist eine Fotografie bekannt, die aus dem Jahr<br />
1920 stammt und vier Ofenplättchen mit folgenden Sprüchen zeigt:<br />
"Um der Wölfe willen will der Faule nicht pflügen, so muß er in der Ernte betteln und<br />
nichts kriegen." - "Eh ich ließ meinen Schatz ließ ich's Leben auf dem Platz." - "Sei ohne<br />
Falsch wie die Tauben." Auf dem vierten Plättchen stand: "Georg Simon Gehring 1760".<br />
Dieser lebte von 1760 bis 1840; er war Metzgermeister und mit Anna Margaretha<br />
geb.Rüffle verheiratet. (Weitere Ofensprüche unter "Reime").<br />
Über dem Ofen hing ein Stangengerüst, das "Ofengrähm" zum Trocknen von Wäsche. Hinter<br />
dem Ofen und entlang der Wand gab es Sitzgelegenheiten für mehrere Personen, wie sie einst<br />
82
esonders beim "Lichtkarz" zusammenkamen. In der anderen Ecke des Zimmers stand der<br />
Tisch aus Eichenholz mit zwei oder drei Stühlen. Eine Wiege, ein Spinnrad und eine Kunkel<br />
ergänzten das Mobiliar. Wände und Decken der Wohnstube waren oftmals mit Holz<br />
verkleidet.<br />
Es gab nur ein - nicht heizbares - Schlafzimmer, in dem das Ehepaar mit den kleineren<br />
Kindern nächtigte. Die Größeren schliefen auf dem Dachboden, ebenso das Gesinde. In der<br />
Schlafstube, auch "Kammer" genannt, standen die beiden Bettladen. Sie füllten fast den<br />
ganzen Raum aus. Dann gab es noch den dazu passenden Kasten und ein Kinderbett oder die<br />
Wiege.<br />
Unsere Vorfahren bauten Fachwerkhäuser, wie sie vereinzelt in Gechingen noch erhalten sind.<br />
Teilweise trotzen sie schon seit 400 Jahren Sturm und Wetter. Die mächtigen Balken, aus<br />
denen sie gezimmert sind, sind ineinander eingelassen und mit starken Holzpflöcken<br />
verdübelt. Die Zwischenräume oder Gefache waren mit einem Geflecht aus Buchen- oder<br />
Haselnußstecken ausgefüllt, das dann mit einem Lehm/Strohgemisch beworfen wurde. Die<br />
Bauordnung von 1654 forderte bei Neubauten das Ausriegeln mit Stein, dazu verwendete man<br />
bei uns Feldkalksteine. Die Dächer waren zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges durchweg<br />
noch mit Stroh gedeckt, das dann aber auf behördliche Anordnung nach und nach durch<br />
Ziegel ersetzt wurde, so daß es 1860 in Gechingen kein Strohdach mehr gab. Schon 1773<br />
gründete Herzog Karl Eugen die Württembergische Gebäudebrandpflichtversicherung, die bei<br />
Feuer- und Sturmschäden einsprang.<br />
Auswanderer<br />
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts war die wirtschaftliche Lage vieler <strong>Gechinger</strong> Familien kritisch<br />
geworden. Dafür gab es mehrere Gründe. Einer davon war zweifellos das Real-<br />
teilungsgesetz, das bei Erbfällen alle Erben gleichermaßen berücksichtigte und Grund und<br />
Boden ebenso aufteilte wie den Rest der Habe. So kam es zu einer Zerstückelung der Äcker,<br />
durch die die gesamte Flur in immer mehr und immer kleinere Flächen zerteilt wurde, bei<br />
zunehmender Bevölkerung wurden die Gütle immer kleiner und boten für die Besitzer selbst<br />
in guten Zeiten keine ausreichende Existenzgrundlage mehr. Nach Mißernten kam es zu<br />
Hungersnöten, gerade im ausgehenden 18. Jahrhundert folgte eine Hungerperiode auf die<br />
andere in immer kürzeren Abständen. Dazu kam, daß es in Gechingen, wie in allen Dörfern<br />
rings um Calw, viele Weberfamilien gab, die ihre Produkte der Calwer Zeughandelskompanie<br />
zulieferten und von diesem Verdienst ganz oder teilweise lebten (Siehe auch "Weber und<br />
Zeugmacher" unter "Berufe"). Sie waren durch den Niedergang der Calwer Companie, der um<br />
1730 eingesetzt hatte und sich bis zu ihrer Auflösung 1797 hinzog, schwer betroffen.<br />
Schlecht bezahlt waren diese Heimarbeiter immer, die Armut unter ihnen war groß, aber nun<br />
war ihre Lage hoffnungslos geworden. Es muß zu dieser Zeit ungefähr 50 Weberfamilien hier<br />
gegeben haben. Die Gemeinde war zwar verpflichtet, die größte Not unter ihnen zu lindern;<br />
auf dem Rathaus wurden Brote verteilt, die größeren Bauernhöfe gaben Kartoffeln und Rüben<br />
ab, aber Aussicht auf eine grundsätzliche Besserung ihrer bedrängten Lage bestand nicht.<br />
Einfuhren maschinell gewobener Tuche aus England und die steigende Beliebtheit von Baumwollstoffen<br />
hatten die einheimische Produktion überflüssig gemacht. In der Landwirtschaft<br />
gab es in den mehrheitlich kleinbäuerlichen Familienbetrieben keine Arbeitsplätze. Da bot<br />
sich die Auswanderung nach Westpreußen geradezu an. König Friedrich II von Preußen<br />
versprach Siedlungsland in Westpreußen, das heute polnisches Gebiet ist. 1781 setzte die<br />
Auswanderung ein und erreichte ihren Höhepunkt um 1782; die letzten Nachzügler brachen<br />
1803 auf. 96 Menschen aus Gechingen, Leineweber, Zeugmacher, Taglöhner, Schmiede und<br />
Zimmerleute aber nur wenige Bauern waren dabei. Der Auswanderungssog riß viele mit.<br />
83
Zwanzig Auswanderer kehrten bald wieder zurück. Die anderen siedelten sich in Westpreußen<br />
an und betrieben vorwiegend Land-wirtschaft.<br />
Bei den Auswanderern nach Amerika lassen sich außer wirtschaftlichen auch andere Gründe<br />
für diesen Schritt vermuten. Dem Ruf des preußischen Königs zu folgen, versprach eine<br />
gewisse Sicherheit, außerdem mögen die Auswanderungswilligen von Beginn an von Preußen<br />
unterstützt worden sein. Nach Amerika aber mußte jeder die Reise selber organisieren und<br />
auch bezahlen. Bei den fünf <strong>Gechinger</strong>n, die schon zwischen 1750 und 1765 nach Amerika<br />
zogen, war wohl die Lust auf Abenteuer das maßgebliche Motiv.<br />
Böttinger, Anna Marg. *12.5. 1728, nach Amerika,<br />
Breitling, Andreas *1.9.1731, nach Amerika,<br />
Diechtel, Joh.Georg *22.7.1720, in die Neue Welt,<br />
Schnepf, Anna Maria *26.7.1748, in die Neue Welt<br />
Weiß, Anna Magd. *16.3.1749, in die Neue Welt.<br />
Über ihr Schicksal ist nichts bekannt.<br />
Um 1750 wanderte ein Gräber, Johannes, Beck, *7.12.1731 mit seiner Frau Maria Agnes geb.<br />
Flick aus Althengstett nach Philadelphia aus. Von ihnen existiert ein Brief über Erbschaftsangelegenheiten.<br />
Für die im Jahre 1852 erneut einsetzende Welle der Auswanderung, diesmal nach den USA.<br />
dürfte aber hauptsächlich die zu dieser Zeit recht kritische Lage der Landwirtschaft<br />
ausschlaggebend gewesen sein. Trotz Modernisierung und Steigerung der Erträge hatten<br />
schlechte Ernten erneut Hungersnöte verursacht, denn die Bevölkerung war stark gewachsen<br />
(in Gechingen seit 1772 um mehr als das Doppelte). In den Kirchenkonventsprotokollen der<br />
damaligen Zeit ist zu lesen, daß die Armen oft tagelang ohne Nahrung waren, und daß selbst<br />
gegen Geld nichts zu haben war. Insgesamt wanderten 202 Personen aus Gechingen bis ca.<br />
1880 ab.<br />
Bei manchen mögen auch politische Gründe eine Rolle gespielt haben, so die gescheiterte<br />
Revolution von 1848, die sie veranlaßte, der Heimat enttäuscht den Rücken zu kehren.<br />
Seitdem Württemberg 1806 Königreich geworden war, war die Auswanderung geregelt<br />
worden und mit verschiedenen Bedingungen verbunden.<br />
1. Die Person mußte volljährig sein.<br />
2. Der Militärdienst war vorher abzuleisten.<br />
3. Wegen eventueller Schuldenforderungen waren Bürgen zu stellen.<br />
Ab 1850 kam noch dazu:<br />
4. 150 Gulden Reisegeld.<br />
5. Ein Transportvertrag mit einer offiziellen Agentur.<br />
6. Eine Gebühr für die Entlassung aus dem Bürgerrecht.<br />
Wer sein Heimatrecht weiter behalten wollte, mußte beim Oberamt Reisegenehmigung und<br />
Reisepaß beantragen. Wer ohne Genehmigung auswanderte, hatte sein Heimatrecht verloren.<br />
Viele Gemeinden versuchten, unliebsame, zum Teil asoziale Personen und Familien, die der<br />
Gemeindekasse zur Last fielen, nach Amerika abzuschieben. Die Gemeinde bezahlte die<br />
Überfahrt und die Reisekosten, das kam sie billiger, als diese Leute jahrelang zu unterhalten.<br />
Sie mußten dafür auf ihr Heimatrecht schriftlich verzichten. Auch von Gechingen sind einige<br />
derartige Fälle bekannt. So wurden z.B. einer ledigen Frau im Jahre 1838 die Kosten der<br />
Überfahrt nach Amerika in Höhe von 550 Gulden bezahlt.<br />
Einer der Auswanderungsagenten war in Calw Kaufmann Bock, der im Calwer Wochenblatt<br />
im Jahre 1849 inserierte: "Nur über Bremen nach Amerika! Nach vielen Erfahrungen ist die<br />
Reise für Auswanderer nach Amerika über Bremen die beste, schnellste und sicherste. Ich rate<br />
daher den Weg über Bremen zu machen. Die Kost auf den Bremerschiffen ist sehr gut, die<br />
84
Behandlung vorzüglich, die Verdecke der Schiffe sind geräumig und man zahlt von Bremen<br />
bis New York nebst freier Kost 68 Gulden. Am 1. und 15. jeden Monats gehen Schiffe ab."<br />
Ein weiterer Calwer Agent war Heinrich Hutten. 1852 stand von ihm folgende Anzeige im<br />
Wochenblatt: "Spezial-Agentur der 16 regelmäßigen Postschiffe zwischen Havre und New<br />
York. Die Abfahrten erfolgen das ganze Jahr hindurch am 4., 11., 19.,und 27. jedes Monats.<br />
Es fahren ab:<br />
Am 19.Mai Wilhelm Tell 1500 Tonnen mit Kapitän Willard<br />
Am 27.Mai Helvetia 1200 Tonnen mit Kapitän Marsh<br />
Am 4.Juni Admiral 1000 Tonnen mit Kapitän Bliffins<br />
Am 11. Juni Samuel M.Fox 1500 Tonnen, Kapitän Ainswort<br />
Am 19. Juni St.Dennis 1000 Tonnen, Kapitän Follausbek<br />
Den Anverwandten und Freunden derjenigen 67 Personen, welche auf den Schiffen New York<br />
und Isaak Bell abfuhren (haben wir Nachricht), (sie) sind nach einer glücklichen Fahrt von 24<br />
Tagen wohlbehalten in New York eingetroffen."<br />
Emil Georgii, Generalagent für Bremen und Hamburg, ließ 1884 in das Wochenblatt drucken:<br />
"Nach Amerika befördere ich jede Woche mit den Dampfern des norddeutschen Lloyd<br />
Ab Bremen a 90.-Mark<br />
Mit dem Schnelldampfer 100.- Mark<br />
Mit freier Fahrt ab Frankfurt 110.- Mark<br />
Über Antwerpen 80.- Mark<br />
Mit freier Fahrt ab Mannheim 95.- Mark<br />
Über Rotterdam 80.- Mark<br />
Mit freier Fahrt ab Mannheim 90.- Mark<br />
Über Havre 90.- Mark<br />
Alles mit vollständiger Schiffsausrüstung und 300 Pfund Freigepäck, täglich 1/2 Liter guten<br />
Rotwein. Kinder unter 2 Jahren frei. Fahrzeit 8 - 11 Tage."<br />
1886 inserierte Georgii: "Über Havre mit 200 Pfund Freigepäck ab Straßburg mit<br />
vollständiger Schiffsausrüstung. Ein Kind pro Familie ist ganz frei, von 3 - 8 ein Drittel, von 8<br />
- 12 Jahren die Hälfte des Preises. Die Beförderung erfolgt direkt vom Eisenbahnwagen auf<br />
den Seedampfer, so daß keine Kosten entstehen. Die neuen prachtvollen Schnelldampfer von<br />
7200 Tonnen und 8000 PS legen die Reise zwischen Havre und New York in der Regel in 7 -<br />
8 Tagen zurück."<br />
Im Jahre 1859 stand im Calwer Wochenblatt: "Aus New York erhalte ich folgendes<br />
Schreiben: Hier kommen oft junge Leute an, ohne Beschäftigung zu finden.Sie haben nur ein<br />
paar Taler in der Tasche und wissen nicht, was sie beginnen sollen. Häufig werden sie unter<br />
leeren Versprechungen hingehalten, bis der letzte Cent verzehrt ist. Aber hier in unserer<br />
Gegend, im Staate Ohio finden junge kräftige, nicht arbeitsscheue Leute Arbeit. Es werden<br />
gesucht: Grobschmiede, Zimmerleute, Schneider, Schuhmacher, Bauernknechte, Ärzte,<br />
Apotheker, Hauslehrer, Weibspersonen aller Art, überhaupt Leute, die Lust haben zu arbeiten.<br />
Es wird sich für jeden ein Plätzchen finden, vor allem auch für Bauernfamilien, auch wenn sie<br />
wenig Geld haben. Die Gegend hier ist gesund und die hiesigen Ansiedler durchgängig<br />
wohlhabend. Im Namen von Dr. Henry Linggen, John Wolf, John Truck, Daniel Kissling, alle<br />
im Counties Montgommery, Buttler und Preble. Staat Ohio. C. Stählin Notar in Heilbronn."<br />
Es fehlte aber auch nicht an Warnungen vor Neppern und Betrügern an die Adresse der<br />
Auswanderungswilligen. Das Königliche Oberamt Calw gab in der Zeitung und an alle<br />
Schultheißenämtern am 30. Mai 1846 bekannt daß die Auswanderer dazu angehalten werden<br />
sollen, beim Abschluß von Verträgen besondere Vorsicht walten zu lassen, da schon viele<br />
Fälle von Betrügereien bekannt geworden seien. "Die Schultheißen werden angewiesen, diese<br />
Warnung allen Auswanderer ans Herz zu legen. Vor allem sollen die Auswanderer die Reise<br />
85
nicht vorher antreten, bevor sie eine schriftliche Zusage der Schiffsgesellschaft mit<br />
Einschiffungsdatum in den Händen halten."<br />
Am 17. Dez. 1867 erschien folgende Warnung des Oberamtes Calw: "Die Auswanderer<br />
werden dringend ermahnt, vor ihrer Ankunft in Amerika sich durch keinerlei Vorspiegelungen<br />
zur Erwerbung von Eisenbahnbillets verleiten zu lassen. Manche Agenten betrügen ihre<br />
Kunden dabei, indem sie 36 - 180 % mehr verlangen als die Billets kosten. Derartigen<br />
Angeboten, von wem sie auch seien und von wem sie auch ausgehen, sind keinerlei Folge zu<br />
geben. Alle Auswanderungsagenten werden von der königlichen Regierung auf dieses<br />
hingewiesen."<br />
Fünf junge Männer aus Gechingen, zwischen 15 und 21 Jahre alt, waren von dem<br />
spektakulären Untergang des amerikanischen Schiffs "Powhattan" betroffen. Sie hatten sich<br />
darauf von Le Havre aus nach Nordamerika eingeschifft. Das Schiff kämpfte drei Tage lang in<br />
Sichtweite der Leute am Ufer unweit von New York mit den Wellen. Hilfe war nicht möglich.<br />
Am 15. April 1854 ging das Schiff unter, niemand konnte gerettet werden.<br />
250 Personen ertranken, darunter 148 Württemberger, auch unsere <strong>Gechinger</strong>.<br />
Die Abwanderung hörte erst auf, als nach dem gewonnenen Krieg von 1870/71 die<br />
Industrialisierung zunahm und damit mehr Arbeitskräfte im Land beschäftigt werden konnten.<br />
Eine genaue Liste der Auswanderer ist im Ortssippenbuch nachzulesen.<br />
Berufe<br />
Die Handwerker<br />
In Württemberg konnten sich Handwerker schon früh auch auf den Dörfern niederlassen.<br />
Zum Beispiel läßt sich nachweisen, daß es in unserem Dorf schon im 16. Jahrhundert einen<br />
Bäcker, drei Schneider, einen Schmied und einen Schreiner gab. In anderen Gegenden war<br />
durch die starre, städtische Zunftordnung, die aufs genaueste die Anzahl der Meister<br />
regelte, das Handwerk auf die Städte beschränkt.<br />
Um sich bei andern Meistern fortzubilden, Land und Leute kennenzulernen und Erfahrungen<br />
zu sammeln, war in den Zunftordnungen festgelegt, daß die jungen Gesellen auf Wanderschaft<br />
gehen mußten. In deren Verlauf arbeiteten sie kürzere oder längere Zeit in anderen Städten<br />
und wechselten die Stelle häufig. Solange sie - zu Fuß natürlich, mit dem "Ränzlein auf dem<br />
Rücken" - unterwegs waren, hatten sie Anspruch auf Unterstützung durch die Zünfte, aber<br />
auch Gemeinden und Städte pflegten ein Zehrgeld zu verabreichen. Das Wanderwesen war<br />
streng geregelt, das Beherrschen festgelegter Gebräuche dokumentierte die<br />
Handwerkszugehörigkeit. Pässe oder gar Wanderbücher gab es zuerst noch nicht, der<br />
Lehrbrief oder ein Taufzeugnis genügte als Ausweis. Auch viele Handwerksburschen aus<br />
Gechingen, seien es Schmiede, Schreiner, Glaser oder Metzger, waren früher "auf der Walz".<br />
Sie kamen dabei auch ins benachbarte Ausland, in die Schweiz, in das Elsaß oder nach<br />
Österreich.<br />
Auch als sich im 19. Jahrhundert die Gewerbefreiheit nach und nach überall durchgesetzt<br />
hatte, blieb der alte Brauch der Wanderschaft noch lange erhalten. In Gechingen genossen die<br />
"Handwerksbuurscht" kein großes Ansehen, aber man hielt sich an den Brauch und zahlte den<br />
durchreisenden Handwerkern ein Zehrgeld aus. (siehe: "Der Krieg von 1870/71 und die<br />
Folgezeit")<br />
Solange die Städte am Zunftwesen festhielten und genau bestimmt war, wieviel Gesellen<br />
und Lehrlinge ein Meister halten durfte, konnten sich keine größeren Betriebe bilden. Unter<br />
der Schirmherrschaft der Herzöge entwickelten sich aber schon im Württemberg des 17.<br />
Jahrhunderts die ersten Industrien. Die bedeutendste war die Zeughandelskompagnie in<br />
86
Calw, die in ihrer Blütezeit über tausend Weber, Zeugmacher und Färber sowie 3000 -<br />
4000 Spinnerinnen und Kämmer, die meist Angehörige der Weber waren, beschäftigte.<br />
Die Weber oder Zeugmacher<br />
Die Zeugmacherei und Weberei in Gechingen ist eng mit der Calwer Compagnie verbunden.<br />
In Calw, als württembergischer Oberamtsstadt, sahen die Herzöge das Entstehen der<br />
Tuchindustrie mit Wohlwollen. Die erste Tuchordnung in Württemberg wurde 1510 für Calw<br />
erlassen. Selbsterzeugte Wolle aus der Schafzucht im Heckengäu wurde zu einem leichten,<br />
glatten, langhaarigen Wollstoff verarbeitet (englisch Satin = "Engelsaith"), der von Calw aus<br />
vor allem nach Italien exportiert wurde. Herzog Friedrich I. von Württemberg (1593 - 1608)<br />
insbesondere förderte die aufstrebende Industrie, in Calw lebten zu Beginn des 17.<br />
Jahrhunderts zwei Drittel der Bevölkerung davon. Nun ließen die Calwer Tuchherren auch in<br />
Heimarbeit weben, wie wir heute sagen würden. Auf den Dörfern ringsum, natürlich auch in<br />
Gechingen, dürfte es sich bei den Heimarbeitern um Leute gehandelt haben, die einen<br />
Webstuhl hatten (er kostete damals neu sieben Gulden, gebraucht vier Gulden) und es<br />
verstanden, damit umzugehen. Sicher besaßen einige, wenn nicht alle von ihnen, noch etwas<br />
Land, das sie neben der Weberei bestellten, sie waren nun aber vom Ertrag des Bodens nicht<br />
mehr so abhängig. Vermutlich wurde Weberei zum Hausgebrauch auch schon vor und neben<br />
der Auftragsarbeit her betrieben. Man weiß, daß in Gechingen ein Bernhardt Schneider 1560<br />
am Bach ein Färberhäuschen besaß. Es ist anzunehmen, daß er auf eigene Rechnung färbte,<br />
vielleicht Wifling - ein grobes Gewebe, das besonders für Weiberröcke, aber auch für die<br />
Hosen der Männer verwendet wurde und das die Bauern selbst herstellten. Es wurde dunkel<br />
gefärbt, schwarz oder blau, auch grün. Beim Wifling bestand der Zettel (Kette) aus Leinen,<br />
der Einschlag aus Wolle.<br />
Das Gewerbe der Tuchmacherei war in Calw so rasch gewachsen, daß die Bereiche geteilt<br />
wurden. Die Zeugmacher beschränkten sich auf das Weben, die Färber übernahmen noch den<br />
Tuchhandel. Die Heimarbeiter wurden an Verlagsherren (bestimmte Händler) gebunden<br />
(gebannt), denen sie ausschließlich zuliefern mußten (1611). Wenn das von den<br />
Heimarbeitern gewebte Tuch von den Calwer Verlagsherren nicht abgenommen wurde, erhielt<br />
es einen Stempel und durfte dann frei verkauft werden.<br />
Die Verlagsherren schlossen sich 1622 zur Gesellschaft der "Gesamten Färber- und<br />
Handelsgenossen zu Calw" zusammen. Aus dem gleichen Jahr stammt auch eine Verordnung,<br />
die besagt, daß die Elle (ca. 61,5 cm) Engelsaith höchstens zwölf Kreuzer kosten darf.<br />
Engelsaith war ein billiger Wollstoff, der auch nur eine geringe Breite hatte. Andere<br />
Wolltuche kosteten bis zu 36 Kreuzer die Elle.<br />
Ab etwa 1565 gab es in Gechingen Zeugmacher, die in Calw unter Vertrag standen. Erst<br />
waren es drei Familien, ihre Zahl wuchs aber rasch an. Nach dem Dreißigjährigen Krieg, der<br />
Gechingen und Calw stark in Mitleidenschaft gezogen und die Einwohnerschaft stark<br />
dezimiert hatte, lebten der Tuchhandel und die Zeugmacherei erstaunlich rasch wieder auf.<br />
1650 gründeten die Calwer Färber und Kaufleute erneut eine Gesellschaft: Die Calwer<br />
Compagnie (CC). Sie bestand bis 1797. Freilich hatte ihr Niedergang schon um ca 1730<br />
eingesetzt. Allmählich kamen Baumwollstoffe auf den Markt, zu deren Herstellung vor allem<br />
in England Maschinen entwickelt wurden und Fabriken entstanden. Dieser Konkurrenz war<br />
die CC nicht gewachsen, der Absatz ließ nach. Die Armut der Heimarbeiter rings um Calw,<br />
die nie üppig bezahlt worden waren, wuchs ständig, denn sie wurden immer schlechter<br />
entlohnt. Eine Weberfamilie konnte zum Schluß trotz fleißigster Arbeit nicht einmal mehr das<br />
Existenzminium verdienen. Die CC mußte 1797 aufgeben. (Siehe auch: "Auswanderer").<br />
Neben der Wolle wurde auch hier angebauter Flachs verwoben. Das geschah aber immer nur<br />
für den Eigenbedarf. Die Flachskultivierung und -verarbeitung bis zum fertigen Garn war<br />
87
ausschließlich Frauensache, das Weben und Bleichen unterstand im allgemeinen den Männern<br />
(Siehe auch: "Sonderkulturen").<br />
Hans Sachs schreibt über den (Leine-)Weber:<br />
"Ich bin ein Weber zu Leinen Wat, Handzwehl, Facilet, und wer Lust zu Bettziechen hett . .<br />
."<br />
(Ich bin ein Weber, stelle Stoffe zu Leinenkleidung, zu Hand- und Taschentüchern her, und<br />
wer gerne Bettbezüge möchte . . .)<br />
Zur Zeit, in der Hans Sachs lebte, im 16. Jahrhundert, bestand nicht nur Bett- und<br />
Haushaltwäsche ausschließlich aus Leinen, sondern auch die gesamte Unterwäsche und ein<br />
gut Teil der Oberbekleidung. In allen zeitgenössischen Darstellungen tragen die Bauern<br />
zwilchene Kittel. "Zwilch" oder "Zwillich" ist ein kräftiges Leinengewebe aus doppeltem<br />
Faden.<br />
Die selbstgewobenen Leintücher verschwanden erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Der<br />
Name "Leintuch" hat sich bis heute gehalten, auch wenn das "Leintuch" längst aus Baumwolle<br />
ist.<br />
Der Wagner<br />
"Ich mach Räder, Wägen und Kärrn.<br />
Auch mach ich dem Bauwren den Pflug<br />
Und darzu auch Schleyfen und Egn."<br />
(Ich verfertige Räder, Wagen und Karren, auch mach ich dem Bauern den Pflug, dazu auch<br />
Bahnschlitten und Eggen.) dichtet Hans Sachs. An diesem Berufsbild des Wagners hat sich<br />
jahrhundertelang nichts geändert. Ein großer Vorrat an gutem Holz war für die<br />
Wagenherstellung notwendig, die wichtigste Arbeit des Wagners. Stabil mußten die Wägen<br />
sein, denn schwere Lasten mußten auf oft nahezu unpassierbaren Wegen und Straßen<br />
befördert werden.<br />
Aus der Werkstatt des Wagners kamen auch Stiele für Werkzeuge, wie Pickel, Schaufeln,<br />
Hauen, Hämmer und Schlegel, dazu Leitern für die Landwirtschaft und alle möglichen<br />
Gegenstände, vom Heurechen bis zum Leiterwägelchen. Jedoch konnte der Wagner allein oft<br />
kein fertiges Produkt liefern, dazu war noch die Arbeit des Schmiedes notwendig.<br />
Zu den Anfangszeiten der Automobilherstellung war dieser Beruf noch immer sehr wichtig,<br />
waren doch früher die tragenden Teile der Karosserien in Holz ausgeführt<br />
Bekannte Wagner in Gechingen waren: Jakob Friedrich Kielwein 1874-1956, Friedrich Jakob<br />
Gann 1878-1960, Hermann Schmid 1905-1983.<br />
Der Schmied<br />
"Der Schmidt.<br />
Ich Huffschmidt ka die pferd beschlagn<br />
Darzu die Räder, Karn und Wagn."<br />
(Ich bin Hufschmied und kann Pferde beschlagen,<br />
dazu die Räder, Karren und Wagen.)<br />
Einen Schmied gab es wohl schon im Dorf seit der Gründung durch die Alamannen. Zum<br />
erstenmal schriftlich erwähnt wurde er um 1550. Er genoß eine gewisse Sonderstellung im<br />
Ort, und zwar als Helfer in der Not bei allen möglichen Krankheiten und Unfällen vor allem<br />
bei Tieren, zuweilen auch bei Menschen. Der Weg zum Tierarzt war oft weit und vor allem<br />
im Winter beschwerlich, oft unmöglich. Der Schmied war im Ort und mit seiner Hilfe konnte<br />
gerechnet werden. Sei es bei einem kranken Pferd, bei einer Fehlgeburt im Stall - der Schmied<br />
88
war zur Stelle. Seine Hauptaufgabe war das Beschlagen der Zugtiere, Kühe, Ochsen und<br />
Pferde.<br />
Bekannte Schmiede in Gechingen waren: Johannes Gehring 1849-1894, Karl Gottlob Stürner<br />
1873-1956, Karl August Breitling 1876-1937, Eugen Breitling 1906-1976.<br />
Der Nagler<br />
„Ein Nagelschmid bin ich genannt<br />
Mach eysern Negel mit der Hand<br />
Allerley art auff meim Amboß<br />
Kurtz und Lang, Klein und auch Groß."<br />
Vergessen ist heute der Beruf des Nagelschmieds, der ein Zweig des Schmiedehandwerks war.<br />
Zeitweise waren in Gechingen mehrere Nagelschmiede tätig, welche Nägel in allen Größen<br />
hersstellten.<br />
Der Sattler<br />
Wo es Zugtiere und Wagen gab, brauchte man den Sattler, dessen Arbeit darin bestand, die<br />
Verbindung zwischen Tier, Mensch und Fahrzeug herzustellen. Ein Meisterwerk waren die<br />
Kummet, mit Beschlägen und Messingrosetten, die in der Sonne blitzten. Der Sattler wußte<br />
genau, wie er dem Tier durch die Form, die Anpassung, die Polsterung und den Sitz auf der<br />
Brust die Arbeit erleichtern konnte. Aber auch andere Arbeiten gab es für den Sattler genug,<br />
sein Lager enthielt Leder in allen Qualitäten, Riemen, Seile, Stricke, Treibriemen für Motoren,<br />
nicht zu vergessen die meist sehr schönen Decken für die Pferde. Sie waren oft kunstvoll mit<br />
Leder eingefaßt und am Ende über Eck eingestickt der Name des Besitzers. Stand eine<br />
Hochzeit in Aussicht, war der erste Weg zum Sattler. Die Aussteuer der Braut sollte ein Leben<br />
lang halten. Der Stolz der Braut wurde sichtbar, wenn der ganze Besitz mit den<br />
handgearbeiteten Matratzen hoch auf dem Leiterwagen zur zukünftigen Heimat der Braut<br />
geführt wurde. Ebenso wie der Wagner war auch der Sattler in der Anfangszeit der<br />
Automobilherstellung unentbehrlich. Sitze und Polster entstanden unter seinen<br />
fachmännischen Händen.<br />
Bekannte Sattler in Gechingen waren: Otto Karl Breitling 1881-1937, Paul Vetter 1912-,<br />
Richard Schwarz 1918-1978.<br />
Der Müller.<br />
„Wer Korn und Weitz zu malen hat<br />
der bring mirs in die Mül herab<br />
Denn schütt ichs zwischen den Mülstein<br />
Und mal es sauber rein und klein<br />
Die Kleyen (Kleie) gib ich treuwlich zu."<br />
So beschreibt Hans Sachs die Aufgaben des Müllers.<br />
Die <strong>Gechinger</strong> Mühle wird urkundlich schon im Jahr 1330 erwähnt. Mit ihrem Besitz waren<br />
Privilegien für Wasserrechte und Einzugsgebiete verbunden. Um 1550 gehörte die Mühle der<br />
Familie Bock.<br />
Streit hatte der Müller Balthasar Wagner mit der Gemeinde im Jahre 1668. Wagner klagte,<br />
daß die Bürger ihm durch Wässern der Wiesen das Wasser ableiten würden und es daher nur<br />
für einen Mahlgang reiche. Das Gericht entschied zu Gunsten der Bürger, es sei ein Recht aus<br />
alten Zeiten, die Wiesen zu bewässern. Das galt bis in das 19. Jahrhundert. (Siehe auch<br />
"Wiesen und Weiden").<br />
Im Jahr 1763 kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem damaligen <strong>Gechinger</strong> Müller<br />
Jakob Weinbrenner und zwei Müllern in Deufringen, die Frucht von den <strong>Gechinger</strong>n Bauern<br />
abholten, um sie in ihren Mühlen in Deufringen zu mahlen. Der Müller Weinbrenner<br />
89
eantragte beim Herzog für sich und seine Nachkommen die Übertragung der alleinigen<br />
Zuständigkeit für das Mahlen des Getreides der <strong>Gechinger</strong> Bauern. Der Herzog antwortete am<br />
7. Januar 1764, daß diesem Ersuchen entsprochen wird und der Ort Gechingen in seine Mühle<br />
gebannt ist (d. h., daß die <strong>Gechinger</strong> in der <strong>Gechinger</strong> Mühle mahlen lassen müssen). Es<br />
erging auch eine Anweisung an den Schultheißen, dafür zu sorgen, daß der herzogliche Befehl<br />
beachtet wird.<br />
Johann Jakob Brackenhammer (1743 - 1804) war der erste Brackenhammer auf der Mühle,<br />
die seither ununterbrochen im Besitz der Familie ist.<br />
1796 raubten plündernde Soldaten dem Müller Brackenhammer 112 Gulden.<br />
Der Ölmüller<br />
1803 wurde an der "Reibe" die Schwarzmaierische Öl-, Reib- und Schleifmühle trotz des<br />
Widerstands der Gemeinde und der Anlieger erbaut. Herzog Friedrich hatte den Streit, der<br />
fünf Jahre lang dauerte, zugunsten von Schwarzmaier entschieden. Bernhardt Schwarzmaier<br />
hatte aber folgende Auflagen, die auch seinen Nachkommen galten, einzuhalten:<br />
1. Keine Wohnung in das Gebäude einzubauen, keine Landwirtschaft dort zu treiben und<br />
keine Übernachtungen zu erlauben<br />
2. Das Gebäude so niedrig zu bauen, daß kein Schatten auf die Grundstücke der Nachbarn<br />
fallen kann<br />
3. Nur zu mahlen, wenn der Müller Brackenhammer Wasser übrig hat<br />
4. Sofort mit Mahlen aufzuhören, wenn ein Wiesenbesitzer seine Grundstücke wässern will<br />
Im März 1907 brannte die Mühle aus ungeklärten Gründen ab und wurde nicht wieder<br />
aufgebaut.<br />
Der Ziegler (Ziegelhersteller)<br />
"Der Ziegler<br />
Ein Ziegler thut man mich nennen<br />
Auss Lättn kan ich Ziegel brennen."<br />
Die Flurnamen "Dachtgruben" und "Lehmgrube" (Lehmgrube kommt auf unserer Markung<br />
viermal vor) deuten auf den Grundstoff für den Beruf des Zieglers hin. Von Hand formte er<br />
aus Lehm Dachziegel und Mauerziegel und brannte sie in selbstgebauten Öfen. Auf den<br />
Dächern alter Häuser kann man heute noch handgestrichene Ziegel antreffen.<br />
Ein Aufschwung der Ziegelei trat ab 1782 ein, als Herzog Karl Eugen eine Bestimmung<br />
erließ, die besagte, daß alle Stroh- und Schindeldächer innerhalb von zwei Jahren mit Ziegeln<br />
zu decken seien, andernfalls bei einem Brandschaden Abzüge vorgenommen würden. Diese<br />
Verordnung hing mit der Gründung der Pflichtbrandversicherung aus dem Jahre 1773<br />
zusammen. In Gechingen wurden bald alle Dächer umgedeckt. Das ist aus den Protokollen<br />
von 1860 ersichtlich, in denen kein Strohdach mehr aufgeführt ist.<br />
Um 1850 erbaute Samuel Vetter in der Gültlinger Straße einen Ziegelofen, der lange in<br />
Betrieb war. Es dreht sich dabei wohl um die in der Oberamtsbeschreibung von 1860<br />
erwähnte Ziegelhütte "indem die Gewerbe, mit Ausnahme einer Ziegelhütte, nur den örtlichen<br />
Bedürfnissen dienen".<br />
Der Korbmacher<br />
Ein sehr altes Handwerk, das auch heute noch ausgeübt wird, ist das Korbmachen.<br />
Holzkörbe, Futterkörbe, Obst- und Getreidekörbe bis hin zu Sesseln stellten bzw. stellen die<br />
Korbmacher her. Als Rohmaterial dienen Weidenruten, die geschält und gespalten werden.<br />
Vor der Verarbeitung werden sie längere Zeit gewässert, um sie biegsamer zu machen.<br />
Die einfachen Futter- oder Holzkörbe ("Zoane") aus ungeschälten Weidenruten, wie sie im<br />
bäuerlichen Haushalt vielfältige Verwendung fanden, waren meist selbstgeflochten.<br />
90
Bekannter Korbmacher in Gechingen war Albert Samuel Vetter 1885-1957.<br />
Der Küfer<br />
Die Herstellung von Wein- und Mostfässern aus Eichenholz war die Hauptbeschäftigung des<br />
Küfers. Außerdem stellte er Güllefässer, Wasch- und Badzuber sowie Kübel aller Größen,<br />
Schöpfeimer und Gelten her. Das gerade gewachsene Holz spaltete er passend in verschiedene<br />
Längen und ließ es ein bis zwei Jahre im Freien trocknen. Die Faßdauben dämpfte man mit<br />
Feuer und Wasser und preßte sie dann mit Reifen in die Form. Genaues und pünktliches<br />
Arbeiten war unbedingt notwendig, damit die verschiedenen Behälter dicht wurden.<br />
Bekannte Küfer in Gechingen waren: Wilhelm Krafft 1879-?, Georg Ludwig Wagner 1880-<br />
1939, Christian Wolf 1904-1966, Christian Wagner 1908-1991.<br />
Der Seiler<br />
Seile und Stricke für die Landwirtschaft fanden ständig Abnehmer. Man brauchte sie zum<br />
Verspannen der Erntewagen, zum Anbinden der Tiere, zum Hochziehen der Garben in der<br />
Scheuer, als Waschseil usw. Auf der sogenannten "Seilerbahn" wurden aus dem aus eigenem<br />
Hanfanbau gewonnenen Garn Seile und Stricke von Hand gedreht, da Wasserkraft nicht zur<br />
Verfügung stand.<br />
Bekannter Seiler in Gechingen war Christian Friedrich Stiegelmaier 1860-1973.<br />
Der Hafner (Töpfer)<br />
"Den Leymen (Lehm) tritt ich mit meim Fuß<br />
Mit Har gemischt, darnach ich muß<br />
Ein klumpen werffen auff die Scheiben<br />
Die miss ich mit den Füssen treiben<br />
Mach Krüg, Häffen, Kachel un Scherbe<br />
Thu sie denn glassurn und ferben<br />
Darnach brenn ich sie in dem Feuwer."<br />
Ein reicher Vorrat an irdenen Milch- und Schmalzhäfen, sowie allerhand Krüge und die<br />
Krautstande, Schüsseln, ja sogar Töpfe aus Ton - all diese Erzeugnisse des Hafners fanden<br />
sich in jedem Haushalt. Da das Brennen aber aufwendig war, hat man die Töpferware schon<br />
früh auf dem Hafenmarkt gekauft.<br />
Weitere Berufe<br />
Noch heute gebräuchlich, aber alt, sind folgende Handwerksberufe: Bäcker, Metzger,<br />
Schuhmacher oder Schuster, Schneider, Zimmermann, Schreiner, Glaser,<br />
Buchbinder, Maurer, Schlosser, Flaschner, Mechaniker, Kaufleute und Maler.<br />
Bekannte Vertreter ihres Standes in Gechingen waren:<br />
Bäcker: Christian Heinrich Böttinger 1855-1933, Karl Mörk 1867-1944, Wilhelm Friedrich<br />
Mörk (Schulhausbeck) 1868-1934, Karl Heinrich Kappis 1872-1942, Christian Heinrich<br />
Gräber (Dorfbeck) 1880-1962, Wilhelm Friedrich Vetter 1882-1924, Friedrich Rex 1889-<br />
1970.<br />
Früher vergab die Gemeinde jedes Jahr das Brezelbacken neu und sorgte auch dafür, daß<br />
immer ein anderer Bäcker an der Reihe war. Einen Laden hatten sie in der Regel nicht.Die<br />
Leute brachten ihren Brotteig, Hefenkranz, Gugelhopf und Spickling (Kuchen) zum Backen.<br />
Um 1550 wird ein Bäcker mit Namen Abermann erwähnt.<br />
Metzger: Georg Ludwig Gehring 1864-1938, Jakob Friedrich Dingler 1855-1944, Ludwig<br />
Karl Schneider 1885-1971, Emil Ayasse 1911-1980.<br />
Meist hatten die Metzger eine Gastwirtschaft, manchmal auch einen kleinen Laden dabei. Sie<br />
besorgten bei den Bauern die Hausschlachtung.<br />
91
Schuhmacher oder Schuster: Johann Daniel Wagner 1798-1866, Adam Heim 1814-1892,<br />
Johann Wilhelm Wagner 1830-1892, Johann Jakob Krauss 1841-1920, Christian Friedrich<br />
Schneider 1855-1938, Gottlob Schneider 1870-1951, Christian Georg Schneider 1887-1964,<br />
Rudolf Dingler 1899-1950, Karl Dingler 1905-1992, Richard Kielwein 1907-1950.<br />
Die Schuhmacher mußten Schuhe anmessen und anfertigen, vor allen Dingen haben sie<br />
Schuhe geflickt. Einen Laden hatten sie selten.<br />
Schneider: Georg Friedrich Böttinger 1852-1939, Simon Friedrich Riehm 1865-1948,<br />
Christian Heinrich Krauss 1877-1960, Robert Stahl 1909-1944.<br />
Näherin: Katharine Jakobine Wagner 1874-1950, Marie Eisenhardt 1897-1957, Emma<br />
Kübler geb. Wagner 1904-1992.<br />
Um 1550 gab es im Ort drei Schneider. Da Wolltuche und Leinwand im Dorf selbst<br />
hergestellt wurden, wurden zumindest für die Herstellung der Festkleidung Schneider<br />
gebraucht. Die Schneider waren meist sehr darauf bedacht, daß sie allein für die Oberkleidung<br />
zuständig waren, den Näherinnen blieb die mühselige Weißnäharbeit und natürlich das<br />
Ausbessern (Wiefeln und Flicken).<br />
Zimmermann: Johann Jakob Schwarzmaier 1781-1841 (Erbauer des alten Schulhauses),<br />
Johann Georg Schwarzmaier 1810-1873, Georg Ludwig Wuchter 1858-1933, Gottlob<br />
Friedrich Lutz 1897-1972, Fritz Gottlob Kühnle 1907-1959.<br />
Die Zimmerleute planten, entwarfen, fertigten und beaufsichtigten den Bau des Fachwerkhauses.<br />
Schreiner: Johann Georg Breitling 1841-1913, Gottlob Heinrich Köber 1853-1932, Wilhelm<br />
Heinrich Gehring 1860-1947, Christian Weber 1865-1925, Friedrich Georg Weiß 1876-1927,<br />
Christian Friedrich Mitschele 1878-1937, Georg Ludwig Schwarzmaier 1884-1963, Karl<br />
Holwein 1884-1973, Wilhelm Friedrich Theurer 1892-1931, Christian Ruopp 1899-1980,<br />
Paul Richard Dürr 1900-1968.<br />
Von den Schreinern stammen die schönen alten Bauernmöbel, von denen einige im Museum<br />
Appeleshof zu sehen sind. Außerdem fertigten sie Wand- und Deckenvertäfelungen und<br />
Türen.<br />
Um 1550 ist ein Schreiner erwähnt.<br />
Glaser: Christian Friedrich Class 1850-1911, Wilhelm Gottlob Class 1864-1943, Karl<br />
Ludwig Gehring 1886-1962.<br />
Die Glaser stellten komplette Fenster her und setzten zerbrochene Scheiben ein.<br />
Buchbinder: Karl Gotthilf Böttinger 1870-1943, Ferdinand Georg Breitling 1872-1963.<br />
Die Buchbinder reparierten Bücher, die aus dem "Leim" gingen, banden Akten des Rathauses<br />
und der Kirche zu Büchern. Die gesammelten Jahrgänge von Zeitschriften wurden von ihnen<br />
zu schönen Bänden gebunden. Sie hatten kleine Läden, in denen sie Schulbedarf und allerlei<br />
Kram verkauften.<br />
Maurer: Ferdinand Georg Gehring 1843-1933, Karl Friedrich Mörk 1897-1955, Karl Gottlob<br />
Riehm 1899-1966.<br />
Schlosser: Gustav Adolf Gräber 1863-1938, Karl Gustav Gräber 1902-1968.<br />
Flaschner: Christian Essig 1855-1904, Karl Härtkorn 1863-1918, Wilhelm Bernhard<br />
Härtkorn 1895-1945, Georg Eugen Eisenhardt 1896-1958.<br />
Mechaniker: Friedrich Gehring 1847-1906, Gottfried August Dongus 1884-1957.<br />
Kaufleute: Ernst Unger 1843-1901, Friedrich Hubel 1856-1926, Wilhelm Vöhringer 1865-<br />
1938, Christian Friedrich Süsser 1879-1918, Gottlob Paul Schwarz 1885-1949, Karl Bühler<br />
1890-1943, Karl Schwenk -1982.<br />
Maler: Gottlob Mörk 1865-1907, Paul Heinrich Gann 1884-1965, Otto Böttinger 1913-1979.<br />
Dienstleistungen<br />
92
Der Wirt<br />
Schon um 1550 gab es zwei Wirte im Dorf. Die Oberamtsbeschreibung von 1860 berichtet<br />
dann von drei "Schildwirthschaften", es waren der "Adler", das "Lamm" und der "Hirsch".<br />
Zu den Wirtschaften gehörten teilweise auch Sudhäuser, in denen eigenes Bier gebraut wurde,<br />
so beim "Adler", beim "Lamm" und in der "Krone". Das Sudhaus vom "Lamm" wurde 1809<br />
erbaut. Unsere Hopfenbauern belieferten auch die im Ort ansässigen Bierbrauer. Schade, daß<br />
in Gechingen nicht mehr gebraut wird, obwohl die Sudhäuser teilweise heute noch stehen!<br />
War der Sud mißlungen, konnte man dieses Bier billig haben. Darüber schrieb ein Dorfpoet:<br />
"Hier trinkt man jetzt 8-Pfennigbier, trink nur, wer trinken kann, denn nirgends trinkt man<br />
solches Bier. Brüder, nur herein! Denn wer von diesem Bierchen trinkt, ist nachher pudelwohl<br />
und manches frohe Lied erklingt auf dieses Stoffs Symbol."<br />
Am Samstagabend versammelten sich die Stammgäste, die Wirtin stellte ihnen eine Schüssel<br />
mit Sauerkraut hin, davon konnte essen, wer Lust hatte.<br />
Um das Bier kühl zu halten, wurde im Winter das Wasser im oberen Tal gestaut und das Eis<br />
später abtransportiert und gelagert. Das "Lamm" hatte dort einen Eissee, der bis in die<br />
zwanziger Jahre benützt wurde. Im Haus Schwarz, in der Althengstetter Straße, befanden sich<br />
zwei große Keller, in denen das Eis gelagert wurde.<br />
Das Bierbrauen kann auf eine uralte Tradition zurückblicken. Schon die Sueben und<br />
Alamannen kannten diese Kunst. Allerdings wurde in den frühesten Zeiten Hafer zum Brauen<br />
verwendet und das Bier noch ohne Hopfen hergestellt. Erst später, in den Klöstern, wurde das<br />
Bier, wie wir es heute kennen, aus Gerstenmalz mit Zusatz von Hopfen entwickelt. Bis zum<br />
13. Jahrhundert blieb Bier das Volksgetränk.<br />
In der "Krone" hing folgender Spruch von 1870:<br />
"Solche Gäste liebe ich,<br />
die ehrbar discutieren<br />
Essen ,Trinken, zahlen mich<br />
und friedsam abmarschieren."<br />
Und im "Rößle" konnte man lesen:<br />
"Die Rose blüht,<br />
der Dorn, der sticht,<br />
wer gleich bezahlt,<br />
vergißt es nicht."<br />
Eine Aufstellung der <strong>Gechinger</strong> Gasthäuser und ihrer Wirte ist im Ortssippenbuch<br />
nachzulesen.<br />
Der Bote<br />
Eine wichtige Funktion für den Ort hatten die Boten, in Gechingen "Bott" genannt. Sie hielten<br />
die Verbindung zur Oberamtsstadt und zu den Nachbargemeinden aufrecht. Heute noch ist<br />
sprichwörtlich: "Der lauft wia a Bott!", was besagt, daß jemand sehr ausgreifend und<br />
zielbewußt marschiert. Heute kann man es kaum mehr nachvollziehen, welche enormen<br />
Entfernungen die Boten zu Fuß, wie es bis Ende des 19. Jahrhunderts selbstverständlich war,<br />
zurücklegten und das bei jeder Witterung.<br />
Aus dem Botenlied von 1556:<br />
"Im Winter leid ich an der großen Kält,<br />
im Herbst mich dann Ungewitter quält.<br />
Im Sommer leid ich große Hitz,<br />
ich mich oft beim Wirt versitz.<br />
Eh´ ich verdiene meinen Lohn,<br />
93
so ist er er oft zu schnell verdon.<br />
So lauf ich Botschaft über Feld,<br />
einem Jedem für sein gutes Geld."<br />
Vielen ist noch der Zweibott Jakob Wagner (1870 - 1946) in Erinnerung. Seinen Namen<br />
bekam er, weil er jeden Tag pünktlich nachmittags um 2 Uhr von Gechingen aus aufbrach.<br />
Sein Weg führte über Stammheim nach Calw; zuerst von 1900 - 1905 zu Fuß um 95 Pfennig<br />
pro Tag, dann mit dem Fahrrad und ab 1911 mit Pferd und Wagen. Er brachte die Post nach<br />
Calw und zurück. Auf eigene Rechnung beförderte er mit dem Wagen auch Personen. Im<br />
Winter benützte er einen Schlitten, aber nie, ohne eine Wärmflasche mitzunehmen. Außer der<br />
Postbesorgung erledigte er auch kleinere Aufträge, z.B. holte er Arzneimittel aus der<br />
Apotheke und ähnliches. Nebenher betrieb er noch eine kleine Landwirtschaft und arbeitete<br />
im Wald. Anfang der zwanziger Jahre übernahm dann die neue Postautolinie Gechingen-<br />
Ehningen einen Teil seiner Arbeit.<br />
Von 1901 bis 1926 fuhr der Bott Bitzer aus Dachtel jeden Morgen mit seinem Pferdewagen<br />
über Gechingen nach Calw und besorgte die Post. Zu seiner letzten Fahrt schrieb 1926 ein<br />
unbekannter Dichter:<br />
"Zu Bitzers letzter Postfahrt !<br />
Nach langen schweren 25 Jahren<br />
kommt Jakob Bitzer heut das letzte Mal gefahren.<br />
Die neue Zeit hat diesem grauen Kopf<br />
geschnitten eben auch den alten Zopf.<br />
Selbst Jakobs Pferden wird der Weg zu schwer,<br />
in flotter Fahrt kommt jetzt ein Auto her.<br />
Ach, du gute, alte, württemberger Zeit,<br />
seit Preußens Geist ist zu End deine Herrlichkeit!<br />
Leb wohl, du pflichtgetreuer Bote!<br />
Du hast verdient die beste Note.<br />
Wir wünschen auch auf ferneren Wegen<br />
dir Gottes Glück und reichen Segen !"<br />
Der Barbier (Balbierer)<br />
Der Barbier oder Balbierer (Friseur) war gleichzeitig Wundarzt und Zahnarzt in einem und<br />
ein sehr wichtiger Mann im Ort, denn der nächste Arzt befand sich in der Stadt Calw. In<br />
Versen aus dem Jahr 1568 heißt es:<br />
"Ich bin beruffen allenthalbn<br />
Kan machen viel heilsamer Salbn<br />
Frisch Wunden zu heiln mit Gnaden<br />
Dergleich Beinbrüch und alte Schaden."<br />
Ferner rühmt sich der Barbier in diesem Spruch, daß er Zähne ausbrechen kann. Eine andere<br />
Behandlung kranker Zähne war zu dieser Zeit nicht möglich. Über das Zahnbrechen gibt es<br />
auch einen alten Spruch, der mehr über die Härte der Zeit als über besonders schonende<br />
Methoden aussagt:<br />
"Wolher, wer hat ein bösen Zan<br />
Denselben ich aussbrechen kan<br />
On wehtagn, wie man gbiert die Kinder."<br />
1878 verrechnete der Barbier und Wundarzt Dingler (1851-1930) pro Krankenbesuch 30<br />
Pfennig. Ein Verband kostete 40 Pfennig und ein Bericht an den Oberamtsarzt 30 Pfennig.<br />
94
Teurer war das Zurückdrücken eines Bruches mit 1 Mark. Für das ganzjährige Rasieren eines<br />
Mannes bekam er 5 Mark. Bei kleineren Beschwerden half sich die Bevölkerung mit<br />
Naturheilmitteln.<br />
Der Bader<br />
"Wolher ins Bad Reich unde Arm<br />
Das ist jetzund geheitzet warm<br />
Mit wolschmacker Laug ma euch wescht<br />
Denn auff die Oberbank euch setzt<br />
Erschwitzt, denn werdt ir zwagn und gribn<br />
Mit Lassn das Blut ausstriebn<br />
Denn mit dem Wannenbad erfreuwt<br />
Darnach geschorn und abgefleht."<br />
(Hinein ins Bad, arm und reich, es ist jetzt warm geheizt. Man wäscht euch mit<br />
wohlriechendem Waschwasser, dann setzt man euch auf die obere Bank, damit ihr schwitzt,<br />
dann werdet ihr abgewaschen und gerieben und zur Ader gelassen, dann mit dem Wannenbad<br />
erfreut, danach geschoren und abgeflöht). So schildert Hans Sachs die Badefreuden des 16.<br />
Jahrhunderts.<br />
Um 1560 war am Bach das Badhaus, betreut von einem Jakob Niethammer. Später erscheint<br />
ein Jörg Röckle als Besitzer. Er nahm pro Person 2 Kreuzer Badgeld.<br />
Die Dienstboten<br />
Der Bauernverband stand um die Mitte des 19. Jahrhunderts unter Leitung des rührigen<br />
<strong>Gechinger</strong> Pfarrers Heinrich Theodor Klinger. Der in den "Nachrichten für das Oberamt<br />
Calw" im Jahre 1849 erschienene Artikel schildert eine Preisverteilung an "brave<br />
Dienstboten", die auf Veranlassung des Bauernverbandes stattfand.<br />
"Zu der am 30. vorigen Monats zum Andreas-Feiertag im Waldhorn zu Calw<br />
ausgeschriebenen Preisvertheilung durch den Bauernverband an brave Dienstboten, meldeten<br />
sich drei männliche und elf weibliche Personen, welche sämtlich die erforderlichen<br />
Eigenschaften hatten, um Preise zu erhalten. Sie wurden folgendermaßen eingetheilt:<br />
Männliche Dienstboten:1. Preis mit 8 fl. (Gulden): Johann Jakob Wolf, aus Möhringen,<br />
Oberamt Stuttgart, vom Jahr 1815 bis 1837 bei dem im Jahr 1837 gestorbenen Rittmeister und<br />
Gutsbesitzer v. Vischer in Calw, nun in Diensten des Sohnes auf dem Ihinger Hof und in<br />
Calw. 2. Preis mit 7 fl.: Johann Georg Mattes, von Simmozheim, Wochenlöhner bei<br />
Löwenwirt Bauser, daselbst seit 8 1/2 Jahren. 3. Preis mit 6 fl.: Johann Georg Volz von<br />
Altbulach, seit 7 1/2 Jahren bei Adlerwirt Stoll und dessen Ehevorfahren in Oberkollwangen.<br />
Weibliche Dienstboten: 1. Preis mit 8 fl.: Anna Barbara Bohnaker von Feldstetten, Oberamt<br />
Münsingen, seit 34 Jahren bei Pfarrer Mohl in Neuweiler und dessen Eltern in Feldstetten. 2.<br />
Preis mit 7 fl.:Anna Maria Grob von Altdorf, Oberamt Böblingen, seit 9 1/2 Jahren bei<br />
Schuhmacher Walz in Dachtel. 3. Preis mit 6 fl.: Johanna Dorothea Nüssler von Sindelfingen,<br />
seit 9 1/2 Jahr bei Kaufmann Seeger in Calw. Diese beiden mußten bei gleichen Dienstjahren<br />
um den 2. und 3. Preis losen, welches, wie angemerkt, entschied. Der Ausschuß beschloß<br />
einstimmig, die bei den männlichen Dienstboten übriggebliebenen dritten Preise an die<br />
weiblichen zu vertheilen, somit erhielten weiter: 4. Preis mit 5 fl.: Luise Friederike<br />
Kesselbach von Heidelberg, seit 9 1/4 Jahren bei Georg Dörtenbach in Calw. 5. Preis mit 5 fl.:<br />
Friederike Rapp von Urach, seit 8 1/4 Jahren bei Revierförster Salzmann in Liebenzell. 6.<br />
Preis mit 4 fl.: Marie Engelfried von Calw, seit 8 1/4 Jahren bei Kaufmann Schumm daselbst.<br />
Diese beiden hatten ebenfalls darum zu losen. 7. Preis mit 4 fl.: Christiane Euting von Nagold,<br />
seit 8 Jahren bei Bäckermeister Kramer in Calw. 8. Preis mit 3 fl.: Rosine Müller von<br />
Zavelstein, seit 7 Jahren bei Johann Georg Kübler, Bauer in Neuweiler. 9. Preis mit 3 fl.:<br />
95
Anna Katharina Höpfer von Deckenpfronn, seit 7 Jahren bei Johann Breitling, Bauer in<br />
Gechingen. Ehrenbriefe erhielten: Catharina Nothaker von Stammheim, seit 6 3/4 Jahren bei<br />
Bäckermeister H. Haydt in Calw, und Marie Catharine Gehring von Gechingen, seit 6 1/2<br />
Jahren bei Bäckermeister Brackenhammer, daselbst.<br />
Der Vorstand des landwirtschaftlichen Vereins im Oberamt Calw. Pfarrer Klinger zu<br />
Gechingen."<br />
Dieser Artikel ist in mehr als einer Hinsicht hochinteressant. Offenbar war es damals schon<br />
(wie noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein) recht verbreitet, "in Stellung" zu gehen und<br />
zwar zum ganz überwiegenden Teil für jüngere, ledige, weibliche Personen. Es war durchaus<br />
möglich, als bewährte, "altgediente" Kraft, sich eine Lebensstellung zu erringen. Die meisten<br />
Mädchen werden aber geheiratet haben.<br />
Die Mädchen vom Lande waren harte Arbeit bei wenig Freizeit gewöhnt und erwiesen sich<br />
meist als zuverlässig und tüchtig.<br />
Wenn man ihre Arbeitgeber betrachtet, so sind es meist Wirte, Bäcker, Kaufleute, auch<br />
Pfarrer, bei denen von den Ehefrauen erwartet wurde, daß sie ihre Männer bei der beruflichen<br />
Arbeit unterstützten Nur zwei Bauern sind darunter, was darauf hinweist, daß die bäuerlichen<br />
Betriebe ganz überwiegend Familienbetriebe waren, in denen man ohne Gesinde auskam.<br />
Ähnlich wie der Militärdienst bei den jungen Männern war eine Stellung als Dienstmädchen<br />
für die jungen Frauen die Gelegenheit, andere Verhältnisse kennenzulernen, außerdem hatten<br />
sie die Chance, Geld für ihre Aussteuer zu verdienen.<br />
Gelegenheitsarbeiter und Angelernte<br />
Die Strohflechter<br />
Um 1850 herum betätigten sich Frauen und auch gebrechliche Männer als Strohflechter. So<br />
entstanden z.B. Hausschuhe, Mehlkörbe, Bienenkörbe und Bodenmatten aus geflochtenem<br />
Stroh. Der damalige Pfarrer Klinger inserierte 1849 in der Calwer Oberamtsnachrichten<br />
und nahm auch Bestellungen für Strohware entgegen.<br />
Die Herstellerinnen von Totengedenkbildern<br />
Diese Arbeit wurde meistens von Frauen ausgeübt. Solche Bilder waren in Württemberg - und<br />
hier hauptsächlich in den protestantischen Gegenden - seit Anfang des 19. Jahrhunderts<br />
gebräuchlich. Verwandte, Freunde oder Nachbarn spendeten nach einem Todesfall ein solches<br />
Trauerandenken. Die Bilder sollten die Hinterbliebenen trösten und an den Verstorbenen<br />
erinnern. Die Form und Ausstattung der Totengedenkbilder war sehr unterschiedlich. Vom<br />
rechteckigen bis zum ovalen oder runden Bild kamen alle Formen vor. Unter dem Glas finden<br />
sich Gebilde aus Stoff, Papier oder Menschenhaaren, die zu Blumen, Schriftzügen und<br />
Bildern verarbeitet wurden. Auch Goldpapier, Glasperlen, Wachsfigürchen oder Fotos wurden<br />
zu Ensembles zusammengestellt. Immer wieder tauchen dabei bestimmte Motive auf, wie<br />
Kränze, Grabsteine, Kreuze oder Engel. Dieser Brauch ging Ende des vorigen Jahrhunderts<br />
durch die Verbreitung der Fotografie zu Ende. Leider sind in Gechingen nur noch zwei dieser<br />
Totengedenkbilder erhalten geblieben. Auf einem kann man noch folgendes Gedicht lesen:<br />
"Nachruf.<br />
Von Freundinnen sei dir nun heut,<br />
das letzte Denkmal jetzt geweiht.<br />
Bis jener große Tag erscheint,<br />
wo uns die Liebe neu vereint.<br />
Gott hat dich von der schlimmen Zeit,<br />
durch einen frühen Tod befreit.<br />
96
Auch deine Mutter ruft dir zu:<br />
Komm, Tochter hier ist wahre Ruh.<br />
Leb wohl, getreues Vaterherz,<br />
mein früher Abschied bringt dir Schmerz.<br />
Großvater, du wirst dort mich sehen,<br />
wenn wir verklärt am Throne stehen.<br />
Wir weihen dir aus treuem Sinn,<br />
auch dieses kleine Denkmal hin.<br />
Dort in dem Reich der Seligkeit,<br />
wird unserer Liebe Band vereint.<br />
Du wirst als wohlgeschmückte Braut,<br />
mit einem anderen Mann getraut.<br />
Dann bricht nach kurzer Pilgerbahn,<br />
dein Hochzeitstag im Himmel an.<br />
Elisabeth Katharina Kühnle, gest.11.1.1869.<br />
Zum Andenken von ihren Freundinnen."<br />
In Gechingen wurden diese Art Bilder "Kranzkästen" genannt.<br />
Der Kreidegräber<br />
Der im Gewann "Herdweg" vorkommende feine Ton, der sogenannte "Trips" wurde früher<br />
abgegraben und zum Reinigen der Lederhosen und zum Putzen von Metallgegenständen<br />
verwendet.<br />
Der Kalkbrenner<br />
Im Mai 1965 wurde bei Kanalisationsarbeiten im Baugebiet "Angel" ein Kalkofen<br />
angeschnitten. Auf dem Boden lag über einer dünnen Holzkohlenschicht eine etwa 30 cm<br />
starke Schicht Kalk. Der die Grube umfassende Boden bzw. Fels war stark ausgeglüht. Ein<br />
Beweis, daß in unserer kalksteinreichen Gegend schon sehr früh, ab 1400 etwa, der Beruf des<br />
Kalkbrenners ausgeübt worden ist. Der Kalkstein wurde nach dem Erhitzen als gebrannter<br />
Kalk zum Herstellen von Mörtel und zum Ausweißen der Stuben und Ställe verwendet.1869<br />
erichtete der damalige Ziegler Samuel Vetter gegenüber seinem Haus in der Gültlinger Straße<br />
auf dem heutigen Grundstück Dingler einen Kalkofen. Später kam noch ein Kalkloch dazu,<br />
aus dem die Hausfrauen Kalk zum Einlegen der Eier holten.<br />
Der Samensammler<br />
In seinen Lebenserinnerungen berichtet Hermann Schmid über das Samensammeln: "Die<br />
Zapfen von Tannen, Fichten, Buchen und Forchen wurden gesammelt und nach Nagold<br />
gefahren und dort verkauft. 8 Mark für den Zentner, das war ein schönes Geld, und ich machte<br />
mit. In der Frühe nahm ich die 30sprossige Leiter und zwei Säcke. An der ersten Buche die<br />
Leiter angestellt und rauf ging´s! Ich pflückte und ging von Ast zu Ast, bis alles leer war.<br />
Dann ging ich runter, um zu sehen, wo noch weitere Samen wären. An zwei großen Ästen<br />
hingen noch welche, aber von oben waren sie nicht zu erreichen. Also stellte ich meine Leiter<br />
so, daß sie gerade noch den untersten Ast erreichte, kletterte hoch und stand auf der 28.<br />
Sprosse. Von dort wollte ich den nächsten Ast fassen, aber es reichte nicht. Ich stieg deshalb<br />
auf die letzte, die 30. Sprosse, aber auch so klappte es nicht. Sollte ich noch höher, vielleicht<br />
von den Leiterspitzen aus, ich griff nach einem Ast, mußte ihn loslassen, dadurch schnellte er<br />
gegen meine Leiter. Ein Krach - sie brach in der Mitte auseinander - wieviele Saltos ich beim<br />
Fallen schlug, weiß ich nicht mehr." Hier verlief der Sturz glücklicherweise glimpflich,<br />
Hermann Schmid trug keine Verletzungen davon, jedoch gab es bei solchen Unfällen oft auch<br />
Tote. Einige wagemutige Sammler machten sich nicht die Mühe, von einem abgeernteten<br />
97
Baum erst abzusteigen, sondern kletterten ganz hoch in den Wipfel und brachten diesen durch<br />
Schaukeln in die Höhe des nächsten Baumes, dessen Äste sie dann packten, um sich<br />
hinüberzuschwingen. Die Zapfen wurden gepflückt, auf den Boden geworfen und später<br />
eingesammelt. Die Samen wurden in Nagold in der sogenannten "Staatsklenge" gesammelt,<br />
ausgesät und in Baumschulen gezogen. Mit den Setzlingen wurden und werden Wälder<br />
aufgeforstet.<br />
Gemeindebedienstete<br />
Die meisten Ämter wurden von der Gemeinde für kürzere oder längere Zeit immer wieder<br />
aufs Neue vergeben, und zwar im "Abstreich". Jeder interessierte Bürger konnte sich melden<br />
und bei der Gemeinde ein Angebot einreichen, zu welchen Bedingungen bzw. Entlohnung er<br />
das Amt übernehmen werde. Der billigste Bieter bekam dann, wenn Gemeinderat und<br />
Bürgerausschuß zugestimmt hatten, das Amt oder die Arbeit übertragen. Es handelte sich<br />
dabei um mehr oder weniger umfangreiche Nebentätigkeiten, die ein Zubrot verschafften.<br />
Außer den anschließend gesondert aufgeführten gab es noch Mausfänger, Baumwart,<br />
Bahnschleifer (Straßen freimachen im Winter), Feuerschauer, Waldmeister, Waldschütz,<br />
Feldschütz, Grabenschauer (Freihalten von Wasserabzugsgräben), Mostereiaufseher,<br />
Waschhausaufseher, Maß- und Gewichtsvisitatoren, Steinklopfer, Farrenwärter, Totengräber,<br />
Kalk- u.Ziegelschauer sowie Backhausaufseher.<br />
Der Bleicher<br />
Um frischgewobene Leinwand weiß zu bekommen, mußte sie gebleicht werden. Zu diesem<br />
Zweck mußte man im Sommer die Tuchbahnen im Freien in der Sonne auslegen, Wasser<br />
darauf gießen und die Bahnen öfters umdrehen. Diese Arbeit verrichtete der Bleicher, der das<br />
Tuch bei Tag und Nacht bewachte. Zu seiner Unterbringung erbaute die Gemeinde um 1880<br />
das "Bleicherhäusle" auf dem Festplatz (Bergwald). Später wurde die Hütte abgebrochen und<br />
als Wetterhäuschen in der Nähe des heutigen Hasenhofes aufgebaut. Der Bleicher erhielt für<br />
seine Arbeit 6 - 9 Mark pro Woche von der Gemeinde. Das Bleichen kostete pro Elle 3<br />
Pfennig. Im Jahr 1880 wurden z.B. 2 219 Ellen Tuch gebleicht. Als sich die Anstellung eines<br />
Bleichers durch die Gemeinde nicht mehr lohnte, bleichten die Frauen ihr Tuch selber.<br />
Der (Flecken-)Schütz<br />
Die Aufsicht im Waschhaus hatte um 1560 der Dorfschütz, er mußte alle Tage ins Waschhaus<br />
gehen und aufpassen, daß die "Weiber nicht unnütz mit den Kessel umgehen". Das Waschen<br />
zu Hause war wegen der Feuergefahr verboten.<br />
Wir wissen auch, daß ca. 1610 der Fleckenschütz täglich zweimal zum Schulzen und einmal<br />
in der Bürgermeister Häuser zu gehen hatte, um Anweisungen zu holen. Ferner mußte er im<br />
Backhaus danach schauen, daß das Bachholz, von dem jede Familie ihr eigenes hatte, richtig<br />
geschnitten war (Kerbholz). Nach der Anzahl der Kerben im Backholz wurde der Backpreis<br />
berechnet.<br />
Der Nachtwächter<br />
Die Nachtwächter gab es lange Zeit in unserem Ort. Sie hatten dafür zu sorgen, daß die Gatter<br />
an den Toren geschlossen waren und die Einwohner bei Gefahr alarmiert wurden. Auch bei<br />
Bränden, die bei den damaligen offenen Feuerstellen in den Häusern häufig waren, sollten die<br />
Nachtwächter Alarm geben. Später kam auch das Laternenanzünden als weitere Aufgabe<br />
hinzu. Von den Schultheißen mußten die Nachtwächter öfters verwarnt werden, da einige<br />
ihrem Dienst nur unvollkommen nachkamen. Zur besseren Kontrolle führte man um die<br />
98
Jahrhundertwende ein Schlüsseluhrensystem ein. An sechs Stellen im Ort wurden kleine<br />
Blechkästen montiert, in denen Schlüssel hingen, die der Nachtwächter bei seiner Runde in<br />
eine Uhr einführen mußte. Ein eingelegtes Kontrollblatt zeichnete die Uhrzeit auf. Nach 1865<br />
war es Sitte, daß in der Neujahrsnacht die Nachtwächter vor jedem Haus sangen und<br />
Glückwünsche zum neuen Jahr überbrachten. Dafür erhielten sie Geld oder Naturalien. Da die<br />
jungen Burschen immer kräftig mitsangen und mitgrölten, mußte der Gemeinderat gegen<br />
diesen Lärm, der oft bis in die Morgenstunden ging, etwas unternehmen. Für das folgende<br />
Jahr erhielten die Nachtwächter mehr Lohn, damit sie das Singen in der Neujahrsnacht nicht<br />
mehr nötig hatten. Ob dies etwas geholfen hat, ist nicht überliefert.<br />
1916 wurde ein Antrag an das Bezirksamt wegen Abschaffung der Nachtwächter abgelehnt.<br />
Erst im Jahr 1921 mußte der letzte <strong>Gechinger</strong> Nachtwächter, Friedrich Kühnle, seinen<br />
Abschied nehmen.<br />
Der Amtsdiener<br />
Aus einem Protokoll von 1841:<br />
"Ich beziehe als Amtsdiener eine jährliche Besoldung von 24 Gulden, wofür ich wöchentlich<br />
dreimal nach Calw gehen muß und öfters zum Tragen der Bücher und Akten einen weiteren<br />
Gehilfen brauche. Pro Gang also 9 Kreuzer, bei einer Entfernung von 1 1/2 Stunden, bei der<br />
gebirgigen Strecke auch im Winter, mit größter Anstrengung. Die Belohnung steht also in<br />
keinem Verhältnis, weshalb ich um Erhöhung bitte". Diese wurde nicht genehmigt.<br />
Die Hebamme<br />
Ein uralter weiblicher Beruf ist der der Hebamme. Die erste schriftliche Erwähnung in<br />
Gechingen stammt aus dem Jahr 1659. Dort heißt es: "Der Hebamme sind zu zahlen, von<br />
jeder Frau die ein Kind gebiert, 4 Schilling. Von der Gemeinde für ein Jahr 2 Pfund Heller, 3<br />
Simri Roggen, 3 Scheffel Dinkel. Ihr Mann ist frei von Frohnen und Wachen." 1747 heißt es<br />
über die Besoldung der Hebamme: "Jährlich erhält sie 2 Gulden und 9 Kreuzer und für 4<br />
Schilling Dinkel. Die Weiber, welche sie brauchen, sollen ihr 8 Kreuzer und 4 Heller geben.<br />
Ihr Mann ist frei von Frohnen und Wachen. Im "Fleckenbuch" von 1649 sind drei<br />
Hebammen namentlich aufgeführt. Sie hießen: Margaretha Quinzler geb. Kappis, Anna<br />
Brackenhammer geb. Maurer und Agnes Schneider geb. Mitschele. Bei dem damaligen<br />
Kindersegen hatten die Hebammen sicher viel zu tun. Über die letzte <strong>Gechinger</strong> Hebamme,<br />
Emma Wuchter, berichte ich in dem Kapitel "Personen".<br />
Der Vieh- und Schweinehirt<br />
Verschwunden ist auch der Berufsstand des Vieh- und Schweinehirten, nur der Flurname<br />
"Viehtrieb" erinnert noch heute an diese Tätigkeit. Im Fleckenbuch von 1741 steht: "Den 24.<br />
August sind nachstehende Dienst und Ämter durch Schultheißen, Bürgermeister, Gericht und<br />
Rat wieder vergeben und ersetzt worden: Der Schafhirtendienst ist dem Michael Böttinger<br />
wieder für ein Jahr anvertraut worden um den alten Lohn. Den Wald- und Feldschützendienst<br />
dem Hans Leonhard Stürner um den alten Lohn. Den Kühehütedienst dem Michael Ziegerer,<br />
den Fleckenschützendienst dem Hans Jakob Ziegerer und die halbe Nachtwache um den<br />
halben Lohn. Den Schwein- und Geishütedienst dem Hans Jakob Bocken um den alten Lohn.<br />
Die Fleckenschmiede samt der halben Nachtwache um den alten Lohn an Kraushaar." Die<br />
Hirten hatten die Aufgabe, das gesamte Vieh der Gemeindemitglieder auf den<br />
gemeindeeigenen Wiesen zu hüten und zu bewachen. Die Schafzucht war früher schon weit<br />
verbreitet, die Wolle wurde versponnen. 1906 verpachtete die Gemeinde das Schafweiderecht<br />
über ca. 3.000 Morgen auf die Dauer von drei Jahren. Die Weide durfte im Vorsommer mit<br />
200, im Nachsommer mit 300 Schafen beschlagen (beweidet) werden. 1840 hieß es: "Die<br />
Weide ernährt im Vorsommer 600, im Nachsommer 800 Stück Schafe."<br />
99
Der Rindenschäler<br />
Die "Kirchhalde" war in vergangenen Zeiten ganz mit Eichen bewachsen. Da gab es Arbeit für<br />
den Rindenschäler. Mit dem Räppeleisen entfernte er die Eichenrinde von den Stämmen und<br />
verkaufte sie an die Gerbereien in Calw, die mit Eichenrindenlauge ihre Felle gerbten. Die<br />
Gemeinde stellte für das Rindenschälen in den Gemeindewäldern Leute an und verkaufte die<br />
Rinde auf eigene Rechnung.<br />
Der Straßenwart<br />
Mit Besen und Schaufeln bewaffnet, traf man an den Straßen die Straßenwarte. Sie hatten für<br />
die Sauberkeit und Instandhaltung der Straßen und Wege zu sorgen. Abflußgräben mußten<br />
freigemacht und kleinere Schäden mit Schotter ausgebessert werden. Es gab für jede<br />
Landstraße einen extra Straßenwart. Bis in die jüngste Vergangenheit waren zwei Originale,<br />
nämlich die Straßenwarte Ernst Ohngemach und Gottlob Böttinger, im ganzen Ort bekannt.<br />
Der Untergänger<br />
Die Untergänger, auch Felduntergänger genannt, hatten die wichtige Aufgabe, die Grenzsteine<br />
zu sichern bzw. neu zu setzen.<br />
In der alten deutschen Zehntordnung heißt es: "Wo einer wissentlich Marksteine ausgrabet,<br />
den soll man in die Erde graben bis an den Hals und soll dann nehmen vier Pferde, die des<br />
Ackers nicht gewohnt sind und einen Pflug, der neu ist und sollen die Pferde nicht mehr<br />
gezogen und der Knecht nicht mehr gepflügt, noch der Pflughalter nicht mehr den Pflug<br />
gehalten haben und ihm nach dem Hals pflügen, bis er ihm den Hals abgepflügt hat." Solche<br />
grausamen Strafanordnungen für frevelhafte Grenzsteinversetzer lockerten sich im<br />
Spätmittelalter zu Landesverweisung, Gefängnis, Geldstrafen oder Stockschlägen. Den<br />
Grenzsteinen drohten auch Gefahren durch Hochwasser, Unwetter und Erdbewegungen. Für<br />
den Untergänger war es daher oft ein Problem, die alte Stelle wieder zu finden, an der der<br />
Stein gestanden hatte. Im "Recht der Grenzen" von Beck aus dem Jahre 1739 steht: "Man<br />
pflegt es aber bei der äußerlichen Bezeichnung der Steine nicht zu lassen, sondern es werden<br />
auch inwendig etliche Steinlein beigelegt, welche man Zeugen, Geheimnis, Merkzeichen,<br />
Loszeichen oder Jungen, item Beleg, Gemerk, Beilagen nennet. Im Herzogtum Württemberg<br />
nennen sie die Untergänger Eier und sehen sogleich der Hebung der Marksteine nach, ob der<br />
Stein seine Eier habe oder nicht." Solche Beigaben, bei uns Zeugen genannt, gab es auch in<br />
Gechingen. Vorhanden sind noch aus Ton gebrannte größere und kleinere Kegel, oben mit<br />
einem großen "G" gekennzeichnet und viereckige Tonplättchen mit der Inschrift "Gechingen".<br />
In Gechingen verloren die Zeugen 1899 ihre Beweiskraft durch die neue Art der Vermessung.<br />
Gleichwohl blieb es bis 1960 bei diesem Brauch. Wer unter einem Grenzstein nach Zeugen<br />
sucht, macht sich strafbar, da alle Grenzsteine unter Denkmalschutz stehen, laut Gesetz vom<br />
6.12.1983. Diebstahl oder Beschädigung von Grenzzeichen ist kein Kavaliersdelikt und wird<br />
hart bestraft.<br />
Neue Entwicklungen - neue Bedürfnisse<br />
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich, durch Verbesserungen im Bereich der Landwirtschaft,<br />
neuartige Maschinen, Fruchtwechselwirtschaft, Ausbau des Straßennetzes und damit der<br />
Transportverhältnisse, Zunahme der Bevölkerung, neue Bedürfnisse, denen durch Selbsthilfe,<br />
aber auch durch die Gemeinde Rechnung getragen werden mußte.<br />
Der Ortsbauernverband<br />
100
Schon ab 1839 gab es im damaligen Oberamt Calw einen landwirtschaftlichen Verein unter<br />
der Leitung des rührigen <strong>Gechinger</strong> Pfarrers Heinrich Theodor Klinger. Wieviele <strong>Gechinger</strong><br />
Bauern damals Mitglied im Ortsbauernverband waren, läßt sich heute nicht mehr feststellen.<br />
Als sicher gilt, daß es nach dem ersten Weltkrieg eine Ortsgruppe des Bauernbundes in<br />
Gechingen gab. Belegt sind aus dieser Zeit Reisen und Besichtigungen von Mustergütern,<br />
außerdem eine fleißige Vereinstätigkeit, auch des Hausfrauenvereins, unter Leitung von<br />
Katharine Weiß, Hohe Gasse. Das Jahr 1933 machte dem Bauernbund, wie vielen anderen<br />
Vereinen auch, ein Ende. Er wurde aufgelöst und dem sogenannten "Reichsnährstand"<br />
eingegliedert. Die Bauern in Gechingen schloß man in der Ortsbauernschaft zusammen, an<br />
deren Spitze der Ortsbauernführer stand. Er überwachte die Ausführung der Anordnungen, die<br />
der Reichsbauernführer über die Landesbauernführer und Kreisbauernführer gab. Es wurde<br />
nicht nur die eigentliche Landwirtschaft vom Reichsnährstand erfaßt, sondern auch alle<br />
Berufe, die mit der Be- und Verarbeitung sowie der Verteilung landwirtschaftlicher<br />
Erzeugnisse zu tun hatten, also auch die Müller, Bäcker und Mehlhändler. Mit Hilfe des<br />
Reichsnährstandes versuchte das nationalsozialistische Regime Deutschland von der Einfuhr<br />
von Lebensmitteln aus dem Ausland unabhängig zu machen. Die Bauern wurden so zu einem<br />
Glied der nationalen Verteidigung und der Kriegswirtschaft. Nach Kriegsende gründete sich<br />
die Ortsbauerngemeinschaft des Bauernverbandes in Gechingen am 7.3.1948 mit 35<br />
Mitgliedern neu. Um 1950 zählte der Ortsbauernverband Gechingen 74 Mitglieder. Eine<br />
wichtige Aufgabe des Verbands war die Mitwirkung bei der anstehenden Flurbereinigung.<br />
Auch wurden Stäubapparate und Rapskäferfanggeräte angeschafft.<br />
Im Jahr 1953 wurde in Gechingen das Kreiserntedankfest ausgerichtet und gefeiert. Alle<br />
Vereine und die Schule beteiligten sich daran. Tausende von Besuchern sahen einen<br />
einmaligen Festumzug mit Schülergruppen, Erntewagen, Früchtewagen, "Lichtstube",<br />
"Lichtgang", Sichelhenke (Fest bei Beendigung der Ernte) und Blumenwagen.<br />
In den folgenden Jahren schaffte der Ortsverband mehrere Unkrautspritzen an, die den<br />
Mitgliedern zur Verfügung standen. Auch ein Klauenpflegestand wurde gekauft. Im Jahr 1978<br />
wurde die Saatreinigungs- und Beizanlage vom Ortsverband übernommen. Die Mitgliederzahl<br />
des Verbandes stieg bis 1965 ständig. Damals hatte sie mit 109 Mitgliedern einen Höchststand<br />
erreicht. Seither sinkt der Mitgliederstand wegen Betriebsaufgaben wieder. Im Jahr 1985<br />
zählte der Ortsverband Gechingen 70 Mitglieder.<br />
Die Ortsobmänner seit der Wiedergründung im Jahr 1948 waren:<br />
Von 1948 - 1970 Fritz Mörk<br />
Von 1970 - 1979 Otto Mörk<br />
Von 1979 - 1989 Heinz Marquardt<br />
Von 1989 - heute Gerd Böttinger<br />
Die Milchverwertungsgenossenschaft<br />
Vermutlich im Jahr 1894 wurde die Genossenschaft, kurz MVG genannt, gegründet und im<br />
Februar 1895 ein Grundstück von Johann Georg Eisenhardt erworben. Den Plan zur<br />
Errichtung eines einstöckigen Molkereigebäudes unterzeichnete Vorstand Unger. Eine<br />
Eintragung im Grundbuch der Gemeinde lautet, daß laut Statut vom 28.10.1895 eine MVG als<br />
freie Genossenschaft existiert und sich um die Verwertung der hier erzeugten Milch bemüht.<br />
Der größte Teil der Milch wurde zu Butter verarbeitet oder an private Milchhändler verkauft.<br />
Das Jahr 1918 brachte die Überleitung der MVG in eine GmbH. In dieser Zeit belief sich die<br />
Mitgliederzahl auf ca. 190 Personen. Im Jahr 1920 wurde eine großzügige<br />
Gebäudeerweiterung durchgeführt und der Maschinenpark vergrößert, außerdem wurde ein<br />
Kleesamenreiber angeschafft.<br />
101
Im Inflationsjahr 1924 schließt der Jahresbericht vom März 1924 mit einem Gewinn von 39<br />
Billionen, 234 Milliarden, 232 Millionen, 468 Tausend, 837,25 Papiermark ab. (Das waren<br />
39,23 Goldmark!) Für einen Liter Milch erhielten die Bauern damals bis zu 3.000 Mark. Ein<br />
großer Teil der Butter wurde in 5-Pfund-Stangen verpackt nach Hildesheim verschickt. Dazu<br />
war der Bau einer Kühlanlage notwendig. Doch schon 1930 wurde die Butterungsanlage<br />
stillgelegt und dafür Rahm produziert. Die MVG erhielt beim Landwirtschaftlichen Hauptfest<br />
in Stuttgart 1930 den ersten Preis. Daraufhin bot die Milchverwertung Stuttgart AG<br />
Zusammenarbeit an und die MVG Gechingen beteiligte sich an der AG. Die Abhängigkeit<br />
vom privaten Handel war damit zu Ende. Auf der DLG (Deutsche<br />
Landwirtschaftsgenossenschaft) Ausstellung 1932 in Mannheim erzielte die MVG Gechingen<br />
wiederum den ersten Preis für Frischmilch. Die Milch wurde mit Pferdewagen nach<br />
Gärtringen oder Althengstett gefahren. Dabei stürzte im Februar 1934 bei Glatteis der Wagen<br />
in Althengstett um. Der Schaden betrug 140 Reichsmark und wurde bei der Gemeinde<br />
Althengstett angemeldet.<br />
Ein Anbau an das Molkereigebäude wurde 1938 begonnen, nachdem fünf Tonnen Zement<br />
zugeteilt worden waren. Dadurch wurde Platz geschaffen für einen Hochdruckdampfkessel<br />
und eine moderne Entrahmungsanlage. Während des zweiten Weltkrieges war in der Molkerei<br />
auch die Eiersammelstelle.<br />
Im April 1945 mußte die Milchannahme ganz eingestellt werden, da ein Abtransport wegen<br />
der Kriegsereignisse nicht mehr möglich war. Im Mai kam dann vom Landratsamt Calw der<br />
Auftrag, die Milch nach Calw zu liefern, aber der Transport machte zu große Schwierigkeiten,<br />
außerdem wurde der zugesicherte Milchpreis nicht bezahlt. Die gesamte Verwaltung der<br />
MVG mußte im Zuge der politischen Säuberung zurücktreten. Durch die Aufteilung des<br />
Landes in Besatzungszonen kam die MVG zur Milchversorgung Pforzheim.<br />
Eine neue Saatgutreinigungsanlage wurde 1954 gekauft und die TBC-Aktion erfolgreich<br />
durchgeführt.<br />
Mit einem Kostenaufwand von DM 24 000.- wurde 1959 eine neue Molkereieinrichtung<br />
eingebaut und von da an praktisch nur noch die Milch gesammelt. Die Milchanlieferung<br />
erreichte 1962 mit 1 Million 6 000 Liter ihren Höchststand. Ein Artikel der "Kreisnachrichten<br />
Calw" aus dem Jahr 1965 berichtet über die Arbeit der MVG:<br />
"Wenn in Gechingen die Milch abgeliefert wird<br />
Auch in Gechingen ist die Landwirtschaft in den letzten Jahren zurückgegangen. Dennoch hat<br />
das Dorf noch einen gesunden Bauernstand mit einer zum Teil nach modernsten<br />
Gesichtspunkten ausgerichteten Viehhaltung. Während der Charakter der Landgemeinde in<br />
den ständig wachsenden Neubaugebieten keine typisch ländlichen Züge mehr trägt, ist der<br />
Hauptort wie eh und je echt bäuerlich geblieben. Hinzu kommen 8 Aussiedlerhöfe als Beispiel<br />
dafür, daß in Gechingen auch der Fortschritt im Rahmen des Möglichen nicht zu kurz kommt.<br />
Das bäuerliche Leben ist deshalb weiterhin ein wichtiger Faktor im Leben des Dorfes<br />
überhaupt. Landwirtschaftliche Traktoren, Maschinen und andere Fuhrwerke gehören etwa<br />
ebenso zum Ortsbild wie morgens und abends die vielen Milchkannen, die - getragen oder<br />
gefahren - zur Milchsammelstelle gebracht werden. Rund 100 Anlieferer sind zum Beispiel in<br />
den Abendstunden gegen 7 Uhr unterwegs. Besonders gerne ist hier die Jugend bei der Sache,<br />
denn der Gang zur Milchsammelstelle hat zweifellos seine guten Seiten: Man trifft sich, man<br />
spricht über alles, und - was man an Neuigkeiten noch nicht erfahren haben sollte, erfährt man<br />
bestimmt beim Schwätzle an der Molke. Die ganze Ablieferung der Milch ist in den<br />
Abendstunden die Sache von gut einer halben Stunde. Durchschnittlich 2 400 Liter fließen aus<br />
den Kannen durch den Meßapparat in die 3 000 Liter fassende Tiefkühlwanne, deren Inhalt<br />
am nächsten Morgen nach Pforzheim in die Molkerei kommt. Den früheren Vorsitzenden der<br />
Milchgenossenschaft - Eugen Böttinger - trafen wir bei der Entnahme der Fettproben, die das<br />
A und O für die Bezahlung sind. "Die Proben kommen nach Pforzheim zum<br />
102
Milchprüfungsring", erklärte uns Eugen Böttinger, der uns als Milchpreis bei Fettgehalten von<br />
3,5 - 4,5 % 28 - 35 Pfennig pro Liter nannte. "Ein Fettgehalt von 4,5 % ist jedoch schon die<br />
oberste Grenze", erfuhren wir im Verlauf des Gesprächs von Ludwig Ruopp, der zusammen<br />
mit Frau Erika Utz die Sammelstelle betreut. Gleichzeitig mit der Milchanlieferung wird auch<br />
Milch an die Verbraucher abgegeben. Täglich sind es etwa 200 Liter. Käse und Butter gibt es<br />
nur für die Milcherzeuger. Die Milchverwertungsgenossenschaft Gechingen ist alles in allem<br />
ein wichtiges Glied in der Versorgung mit einem der bedeutendsten Nahrungsmittel."<br />
1970 konnte die MVG ihr 75-jähriges Bestehen feiern. Doch zeigten sich jetzt schon<br />
rückläufige Tendenzen. 1971 hatte die MVG bei 114 Mitgliedern noch 55 Milchlieferanten.<br />
Nachdem 1975 der Ortsmilchverkauf auf Grund EG-Gesetzen entfallen mußte, stellten sich<br />
auch wirtschaftliche Überlegungen über die weitere Zukunft der MVG. So kam es 1978 zur<br />
Verschmelzung mit der MVG Nördlicher Schwarzwald. Zuvor mußte noch das<br />
Molkereigebäude verkauft und mit dem neuen Besitzer ein Mietvertrag über einen Raum, der<br />
als Milchsammelstelle mit Kühlanlage dienen sollte, abgeschlossen werden. Mit dem<br />
Bauernverband konnte eine Einigung über die Übernahme der Saatgutreinigungsanlage erzielt<br />
werden. Am 1.12.1978 löste sich die MVG dann endgültig auf.<br />
Der Konsumverein<br />
Die Filiale wurde um 1922 im Hause Calwer Straße 11 eingerichtet, das damals dem<br />
Korbmacher Haueisen gehörte. Er oder sein Vorgänger Schuhmacher Jauch bauten in jenen<br />
Jahren an das bestehende Gebäude an. Haueisen war auch der erste Leiter dieser Filiale. Bis<br />
1971 blieb der Konsum dort, dann konnten im neuen Rathause größere Räume bezogen<br />
werden, um die zahlreichen Kunden besser bedienen zu können.<br />
Die Gefriergemeinschaft<br />
Es war 1955, als sich ein Kreis von etwa 20 Personen traf, um die Idee einer zentralen<br />
Gefrieranlage in die Tat umzusetzen. Bei Preisen von 2000 DM für eine einzelne Anlage<br />
war dies ein guter Gedanke. Vom Spätherbst bis zum Dezember 1955 wurden verschiedene<br />
Anlagen in der Umgebung besichtigt, weitere Interessenten gewonnen und eine<br />
Gefrieranlage bestellt. Die Anlage mit 56 Truhen `a 200 Liter kostete pro Truhe 550 DM.<br />
Bei der Inbetriebnahme im April 1956 waren noch 10 Truhen unverkauft, doch nach ca.<br />
einem Jahr waren dann alle belegt. Untergebracht ist die Gefrieranlage im Untergeschoß<br />
des früheren WLZ (Württembergische Lagerhaus Zentrale) Lagerhauses in der<br />
Dorfäckerstraße. In der ersten Zeit waren es vor allem Landwirte, die dort Lebensmittel<br />
einlagerten, heute sind auch viele Privathaushalte dabei. Während in manchen umliegenden<br />
Ortschaften die Gefrieranlagen nach und nach wegen zu großer Reparaturkosten stillgelegt<br />
wurden, arbeitet die <strong>Gechinger</strong> Anlage dank guter Wartung noch einwandfrei. Nur einmal<br />
in 30 Jahren mußte unter hektischen Umständen der Motor ersetzt werden. Die Herren<br />
Steimle und Benz und lange Zeit Eugen Schwarz warteten das Kühlaggregat in<br />
vorbildlicher Weise. Herr Groß, von Anfang an Rechner der Gefriergemeinschaft, sorgte<br />
dafür, daß bei den Mitgliedsbeiträgen - sie liegen derzeit bei monatlich 70.- DM - ein<br />
Betrag für anfallende Reparaturen zur Seite gelegt wurde.<br />
Die Feuerwehr<br />
Jahrhundertelang löschte man Brände durch Wasser aus Bütten, aus denen man mit ledernen<br />
Eimern schöpfte, die dann in der Menschenkette von Hand zu Hand gingen. Die ganze<br />
Einwohnerschaft war verpflichtet, zu helfen. Am 17.1.1655 heißt es in einem<br />
Gemeinderatsprotokoll:"...wofern ein Fremder in unseren Flecken eindringen (sich<br />
niederlassen) will, der solle dem Flecken uff das Rathaus einen Eimer (Feuereimer) machen<br />
lassen." In den württembergischen Landesordnungen von 1552, 1567 und 1621, in denen<br />
103
esondere Abschnitte "Von Brünsten" enthalten sind, war bei letzteren nur die Löschpflicht<br />
und die gegenseitige Beistandspflicht der Gemeindemitglieder festgelegt. Im ersten Drittel des<br />
18. Jahrhunderts folgten drei im wesentlichen gleichlautende Feuerordnungen (von 1703,<br />
1716 und 1730), welche zwar zunächst bloß für die Residenzstädte Stuttgart und Ludwigsburg<br />
erlassen waren, aber allmählich - auch nach dem Willen der Landesregierung - in anderen<br />
württembergischen Orten entsprechend angewendet wurden. Im Jahr 1752 wurde sodann ein<br />
württembergisches Gesetz, die Landfeuerordnung, erlassen, welche ausdrücklich und der<br />
Form nach für alle Gemeinden des Landes zu gelten hatte und auf diese die Bestimmungen<br />
der früheren "Stadt-Feuer-Ordnung" anwandte. Diese Landfeuerordnung von 1752<br />
verpflichtete schon alle Gemeinden zur Anschaffung von Löschgerätschaften, sowie sämtliche<br />
Gemeindeeinwohner ohne Unterschied des Standes zur Hilfeleistung bei Brandfällen. Noch<br />
fehlten aber jegliche Vorschriften über die geeignete Verwendung der zur Hilfeleistung<br />
Verpflichteten auf der Brandstätte und über eine sachverständige Leitung der<br />
Löschmaßnahmen. An eine etwaige Einübung der Hilfsdienstpflichtigen für den Ernstfall war<br />
überhaupt noch nicht gedacht. Erst die für das junge Königreich Württemberg erlassene, auf<br />
die im April 1808 verkündete Feuerpolizeiordnung folgende, allgemeine Feuerlöschordnung<br />
vom 20. Mai 1808 brachte weitere Verbesserungen. Dort wurde bestimmt, daß die<br />
Bürgerschaft, besonders auch die "Erwachsenen ledigen Leute, Gesellen und Knechte des<br />
Orts" nach dem Grad ihrer Brauchbarkeit und entsprechend ihren handwerklichen<br />
Sonderkenntnissen, in Rotten einzuteilen sind. Auch waren nun genaue Vorschriften über die<br />
Leitung der Löscharbeiten und über die nach dem Brandfall zu ergreifenden Maßnahmen<br />
gegeben. In den nächsten 50 Jahren (bis 1852) wurden in Württemberg etwa 16 freiwillige<br />
Feuerwehren, meist in Oberamtsstädten, gebildet. Die Königliche Regierung hatte im März<br />
1819 (auf dem Weg über die vier Kreisregierungen), unter Hinweis auf die in Heilbronn<br />
bereits bestehende und als gut erprobte derartige Einrichtung, zur Bildung von organisierten<br />
und eingeübten Feuerlöschmannschaften in den größeren Gemeinden aufgefordert. Die in der<br />
Residenzstadt Stuttgart schon im Jahr 1847 erstmalig angeregte Gründung einer Freiwilligen<br />
Feuerwehr kam erst 1852 endgültig zustande. Eigentliche freiwillige Feuerwehren, die<br />
halbwegs zweckentsprechend ausgerüstet waren und regelmäßige Übungen abhielten, wurden<br />
erst im Jahr 1847 in Württemberg gegründet. Die ersten hierbei waren einmal eine 200 Mann<br />
starke Freiwillige Lösch- und Rettungsanstalt in Heilbronn und zum andern die<br />
"Pompierskorps" ( "pompiers" französisch = Feuerwehr) in Reutlingen und Tübingen, je seit<br />
Mai 1847. Im gleichen Jahr folgte noch die Gründung der Freiwilligen Steigerkompanie in<br />
Ulm und diejenige der Freiwilligen Feuerwehr in Schwäbisch Hall. Schon im Jahr 1869 war<br />
vom Königlichen Ministerium des Innern der Entwurf zu einem neuen Gesetz über das<br />
Feuerlöschwesen in Württemberg ausgearbeitet worden. Der Entwurf wurde jedoch, wohl<br />
wegen der Kriegszeiten (1870-1871) nicht zum Gesetz erhoben, aber allem nach galt er doch<br />
in manchen Punkten schon als Richtlinie. Durch diesen Beschluß wurde erreicht, daß vom<br />
Jahr 1872 ab in allen württembergischen Gemeinden, welche noch Feuerlöschpumpen mit<br />
Beiträgen aus der Zentralkasse anschafften oder anschaffen wollten, nun ausgerüstete<br />
Steigerabteilungen und Pflichtfeuerwehren entstanden. Der damalige Oberamtsbezirk Calw<br />
besaß 1872 nur vier organisierte Wehren, Calw, Hirsau, Liebenzell und Simmozheim. Bis<br />
1877 kamen noch Althengstett, Dachtel, Deckenpfronn, Gechingen, Neubulach und<br />
Stammheim dazu.<br />
Über die allgemeine Feuerlöschordnung vom 20. Mai 1808 erfahren wir aus einem <strong>Gechinger</strong><br />
Gemeinderatsprotokoll von 1821 folgendes: "Ferner wurde weiter vorgetragen, daß die<br />
Pferdsbauern bei vorkommenden Feuersbrünsten wegen geringen Lohn um weitere Anzeig zu<br />
machen, nicht zufrieden seyen und begehren fernerhin eine bessere Belohnung für zu<br />
prostierenden Feuerritt. Es wurden demnach von dem Gemeinderath und Bürger-Collega<br />
104
estimmt, daß zu der Feuerspritze vier Pferd angeordnet werden sollen und jedem Pferd zu<br />
fahren an Lohn zugesichert werden und zwar von der ersten Stund 1 Schilling, von der<br />
zweiten 30 Kreuzer, bei der dritten 30 Kreuzer. Falls aber dieselben bey einer Brunst<br />
anlangten und die Pferd beibehalten würden, bis dann die Spritze nicht mehr gebraucht würde,<br />
so solle für jedes Pferd wegen Aufwarten per Tag 32 Kreuzer erhalten. Ferner solle dem der<br />
gegen den Feuer reitet, per Stund an Lohn zugerichtet werden 1 Schilling und demjenigen,<br />
welcher in die nachbarlichen Orte weitere Anzeig machen müßte, solle jedem per Stund zu<br />
Lohn zugerichtet werden 40 Kreuzer."<br />
1856 heißt es: "Für die Feuerlöschgerätschaften sollen 12 in Eisen gebundene und mit Ölfarbe<br />
angestrichene Butten angeschafft werden. Junge kräftige Bürger wird man mit der Führung<br />
derselben bekannt machen. Bei Bränden außerhalb werden die Buttenträger mit dem<br />
Fuhrwerk hingefahren." Bei einem Brand in Aidlingen am 28.11.1856 waren 18 Mann der<br />
Buttenträgermannschaft eingesetzt.<br />
1858: "Der Zustand der vorhandenen Feuerspritze erregt den Wunsch, eine neue, leichtere<br />
Spritze, namentlich zum Gebrauch bei auswärtigen Bränden, anzuschaffen."<br />
In Gechingen bestanden Feuerrotten, aus Buttenträgern, Spritzenmannschaft und<br />
Steigermannschaft zusammengesetzt. Insgesamt waren es ca. 70 Mann. Alle jungen Männer,<br />
die ins aktive Bürgerrecht eintraten, hatten ein "Feuereimergeld" von je 1 Gulden zu<br />
entrichten. 1860 kamen so 8 Gulden in die Kasse, 1866 12 Gulden. Als es am 20.1.1862 in<br />
Deufringen brannte, waren 31 Mann der Spritzenmannschaft dort bei der Brandbekämpfung<br />
tätig.<br />
1863 wird erstmals das <strong>Gechinger</strong> Spritzenhaus erwähnt. Es handelt sich jedoch nicht um das<br />
bekannte Spritzenhaus, das erst 1873 aus der Schulscheuer entstanden ist, sondern um ein<br />
kleineres Gebäude, das oberhalb des Kirchplatzes am Geißbiegel stand (bei Haus Wittel). Im<br />
Februar 1871 beschädigte ein Sturm das Häuschen, so daß Reparaturen in Höhe von 3 Gulden<br />
und 52 Kreuzer anfielen. Deshalb wurde die Schulscheuer 1873 mit einem Aufwand von 207<br />
Gulden zu einem Spritzenhaus umgebaut. 1892 mußte der Boden des Gebäudes ausgegraben<br />
und mit Schotter und Sand so gerichtet werden, "daß die Spritzen gut auslaufen können“. Am<br />
10.5.1867 wurden beide Feuerspritzen probiert. Die Spritzenmeister waren: Jakob Gehring,<br />
Schmied und Johann Gräber, Schlosser. Im Oktober des gleichen Jahres waren 38 Mann bei<br />
einem Brand in Deckenpfronn eingesetzt. Im Mai 1872 taten 12 Feuerreiter aus Gechingen<br />
Dienst bei einem Brand in Ostelsheim.<br />
Am 28.10.1872 wurde dann auch in Gechingen die Freiwillige Feuerwehr gegründet. In den<br />
Statuten von 1872 steht u.a.: "Das Korps besteht aus dem Kommandanten, dem Adjudanten,<br />
dem Kassier, zwei Tambours, drei Hornisten, 1 Zug Steiger, 1 Zug Schutzmannschaft, 2 Züge<br />
Spritzmannschaft nebst zwei Spritzenmeistern und deren Stellvertretern. Die<br />
Buttenmannschaft besteht aus 18 Mann. Zum Bedienen der Feuerspritzen, Hydrophor<br />
genannt, benötigt man zwei Gruppen, die sich gegenseitig ablösen. Die Hornisten haben die<br />
Aufgabe, mit Hilfe von verschiedenartigen Trompetenstößen den Mannschaften die Befehle<br />
des Kommandanten zu übermitteln." Es gab 24 verschiedene Signale mit der Trompete,<br />
außerdem noch vier Pfeifsignale. Die erste Kompanie Steiger hörte auf das Signal: "Ihr<br />
Steiger, gebet Achtung, man ruft euch jetzo vor!" Für die zweite Kompanie<br />
Spritzenmannschaft galt das Signal: "Die Spritzen vor, zweite Kompanie !" Die dritte<br />
Kompanie, Hydrophormannschaft, hörte auf: "Hydrophor, Hydrophor !" Die vierte Kompanie,<br />
Buttenmannschaft, auf: "Mehr Wasser her, die Spritz ist leer, mehr Wasser her, die Spritz ist<br />
leer!" Die fünfte Kompanie, die erste Rettungsmannschaft, hörte auf das Signal: "Oh, die<br />
fünfte Kompanie, scheute einen Brand noch nie !" Die sechste Kompanie, zweite<br />
Rettungsmannschaft, auf: "Auf ihr Männer, rettet geschwind, doch tragt ja nichts unter den<br />
105
Wind!" (Die geretteten Möbel usw. sollten nicht in der Windrichtung gelagert werden, da ein<br />
Ausdehnen des Brandes in diese Richtung zu befürchten war.)<br />
Noch im gleichen Jahr schaffte man folgende Gerätschaften an:<br />
4 Hackenleitern je 27 Gulden, 1 Rettungsschlauch 60 Gulden, 1 Rettungskorb 8 Gulden, 3<br />
Signalhörner in B 19 Gulden 30 Kreuzer, 1 Messinghupe 3 Gulden 30 Kreuzer, 4 kleine<br />
Hupen 4 Gulden, 12 Schrillpfeifen 3 Gulden, 16 Drillichanzüge 20 Gulden 56 Kreuzer, 14<br />
Helme und 14 Beile 22 Gulden 24 Kreuzer, 21 Gurtenhaken 37 Gulden 48 Kreuzer, 22<br />
Seilhaken 17 Gulden 36 Kreuzer, 18 Gurtenringe 2 Gulden 42 Kreuzer, 70 Feuerwehrhelme<br />
272 Gulden 15 Kreuzer, 1 Flaschenzug mit Seilen 37 Gulden 54 Kreuzer, 12 Laternen, Haken<br />
mit Seil und Kette 56 Gulden 30 Kreuzer, 1 Anstelleiter 10 m lang u.2 Dachleitern 56 Gulden,<br />
1 Hydrophor mit Saugschläuchen, 1 Schlauchwagen 1513 Gulden, 9 Schläuche mit<br />
Normgewinden 172 Gulden 44 Kreuzer 2 Hakenleitern, 2 Dachleitern 46 Gulden.<br />
In der Lokalfeuerlöschordnung von 1889 heißt es: "Bei Brandfällen im Ort geschieht die<br />
Alarmierung durch Läuten aller Glocken, Signale der Hornisten und Tambours. Bei<br />
auswärtigen Bränden durch Läuten der großen Glocke und Signale der Feuerwehr."<br />
Die neue <strong>Gechinger</strong> Feuerwehr hatte ihren ersten auswärtigen Einsatz am 23.8.1874 bei einem<br />
Großbrand in Wildberg. Aber schon im Juli 1872 war sie bei einer Übung in Böblingen mit<br />
dabei. Zum 10. Deutschen Feuerwehrtag in Stuttgart, der vom 11.-14.August 1877 stattfand,<br />
war die <strong>Gechinger</strong> Wehr mit einem Sonderzug von Althengstett aus angereist und beteiligte<br />
sich an dem 11000 Mann starken Festzug.<br />
Ihren größten Einsatz hatte die Wehr 1881 beim großen Brand in Gechingen (Siehe: "Vom<br />
großen Brand bis zum Ausbruch des ersten Weltkriegs"). Dieses Unglück wurde zum Anlaß,<br />
weitere vier Buttenspritzen zum Preis von 290 Mark anzuschaffen. Bei einem Brand in<br />
Ostelsheim am 26.1.1885 rückten vier Mannschaftszüge mit acht Pferden aus und am 11.8.<br />
zu einem Brand nach Althengstett 25 Mann. Zwei Brände in Gechingen, 1887 und 1891<br />
konnten von der Wehr gelöscht werden. Zwei weitere Brände 1891 in Ostelsheim machten<br />
den Einsatz von insgesamt 68 Mann notwendig.<br />
1901 waren 250 m Schlauch und 12 eiserne Butten als Ersatz für die alten hölzernen Butten<br />
nötig, außerdem ein Helm für den Kommandanten in den württembergischen Farben mit<br />
weißem Busch, Emblem und Schuppenband.<br />
Die <strong>Gechinger</strong> Feuerwehr war lange Jahre über 70 Mann stark. Einen Bericht über den Einsatz<br />
aller Einwohner im Brandfall verdanken wir Luise Weiß geb. Gehring:<br />
"Dienstag, den 2. Juni 1903. Mittags 12 Uhr.<br />
Als wir am Mittagessen saßen, fuhr nach vorangegangenem Blitzen und Donnern ein<br />
fürchterlicher Blitz nieder, der alle zittern machte, welchem auf der Stelle ein solcher<br />
Donnerschlag folgte, daß alles erbebte und jedes meinte, es sei selbst getroffen worden. Einige<br />
Minuten nachher entstand Feueralarm, wo es jetzt schon ziemlich hagelte. Der Blitz schlug in<br />
die Scheuer des Christian Stiegelmaier im Gailer, welche sofort in hellen Flammen stand und<br />
total niederbrannte unter Hagel und strömendem Regen. Die ganze Einwohnerschaft hat nun<br />
ununterbrochen gearbeitet, um wenigstens das Wohnhaus zu retten, was auch dank schwachen<br />
Windes gelang. Solange dort gearbeitet wurde, schlug ein zweiter Blitzschlag in das Schwarz-<br />
Dongus´sche Haus, doch ohne zu zünden, was noch ein großes Glück war, denn an zwei<br />
Stellen wäre an ein Löschen nicht zu denken gewesen. Es war auch in diesem Unglück noch<br />
von Glück zu sagen. Diese Gewitter, denn es kam eines hinter dem anderen, mindestens drei,<br />
entluden sich sämtlich auf unserer Markung. Rings um uns regnete es kaum, bei uns dagegen<br />
waren einige nahe daran, Wassersnot zu bekommen. In den Gärten und in den Hopfen hat es<br />
ziemlich Schaden gemacht, wir wollen uns aber noch zufrieden geben in der Hoffnung, daß<br />
Gott uns verschont hat vor der großen Wassersnot wie vor 30 Jahren 1873."<br />
106
1897 beging die <strong>Gechinger</strong> Wehr ihr 25-jähriges Jubiläum und ehrte aus diesem Anlaß 12<br />
Mitglieder mit dem Feuerwehrdienstehrenabzeichen.<br />
Der 12 Juli 1936 war ein großer Tag für die <strong>Gechinger</strong> Feuerwehr, fand doch der<br />
Kreisfeuerwehrtag in Gechingen statt. 24 auswärtige Feuerwehren zogen in einem großen<br />
Festzug durch den Ort. Vormittags fand eine Feuerwehr- und Luftschutzübung statt.<br />
Infolge der Vereinheitlichung der Feuerwehren im ganzen Reich im Jahre 1937 hatte auch die<br />
hiesige Feurwehr die Rechtsform eines eingetragenen Vereins erhalten. Auf den 1.4.1941<br />
wurden alle Feuerwehrmänner zu Hilfspolizisten bestellt und unterstanden damit dem SS-<br />
Reichsführer Himmler. Als Dienstgrad wurden die Bezeichnungen Truppmann,<br />
Obertruppmann und Haupttruppmann eingeführt. Während des 2.Weltkriegs, ab 12.<br />
September 1940, hatte die Feuerwehr einen Nachtwachdienst, die sogenannte "Fliegerwacht"<br />
auf freiwilliger Basis übernommen. Zu den Aufgabengebieten gehörte u. a. die Kontrolle der<br />
Verdunklungsvorschriften.<br />
Nach Kriegsende mußte auf Anordnung der französischen Besatzung die Feuerwehr auf eine<br />
Sollstärke von 21 Mann reduziert werden. Gleichzeitig wurde die Feuerwehrabgabe erhöht.<br />
Im Lauf der Zeit passte man den Fuhrpark und die Ausrüstung den steigenden Anforderungen<br />
an. So wurde 1973 ein Gerätefahrzeug mit Notstromaggregat bzw. Gerätesatz beschafft, im<br />
darauffolgenden Jahr Funksprechgeräte. Seit 1980 steht ein modernes Tanklöschfahrzeug 16<br />
in der Halle des neuen Feuerwehrgerätehauses, das zum größten Teil in freiwilligen<br />
Arbeitsstunden der Feuerwehrmänner 1977 ausgebaut wurde. Nachdem auch<br />
Funkmeldeempfänger, schwere Atemschutzgeräte und ein neues Löschfahrzeug 16 TS<br />
angeschafft wurden, ist die Wehr auch für andere Aufgaben als die Bekämpfung von Bränden,<br />
gerüstet. Bei technischen Einsätzen, bei Verkehrsunfällen, Ölalarmen u.ä. konnte sie schon<br />
des öfteren ihr Können unter Beweis stellen. Zur Zeit zählt die Freiwillige Feuerwehr<br />
Gechingen etwa 40 Mitglieder. Der Gerätebestand im Jahr 1985: 1 TLF 16<br />
(Tanklöschfahrzeug), LF 16 TS (Löschfahrzeug), 1 Gerätewagen Öl, 1 TSF 4,10<br />
Atemschutzgeräte, 40 Funkmelder.<br />
Durch den Auszug des Bauhofes aus dem Feuerwehrgebäude 1990 hatte die Wehr die<br />
Möglichkeit, Schulungs- und größere Umkleideräume zu schaffen. Im Frühsommer 1992<br />
konnten die in Eigenarbeit ausgebauten Räume bezogen werden. Damit ging ein lang gehegter<br />
Wunsch der Mannschaft in Erfüllung.<br />
Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Gechingen<br />
Johannes Quinzler 1. 1. 1872 - 23.10.1892 (Glasermeister)<br />
Jakob Friedrich Böttinger 23.10. 1892 - 15.07.1900 (Bauer)<br />
Joh.Jakob Gräber 15.07. 1900 - 29.05.1910 (Dreher)<br />
Bernhard Gottlob Gehring 29.05. 1910 - 1919 (Bauer)<br />
Karl Ludwig Gehring 1919 - 04.1945 (Hirschwirt)<br />
Paul Dingler 04. 1945 - 1947 (Bauer)<br />
Eugen Breitling 1947 - 1973<br />
Rolf Erbele 1973 - 1974<br />
Karl Bräuhäuser 1974 - heute<br />
Der Kindergarten<br />
Die Kleinkinderschule oder der Kindergarten, wie es heute heißt, wurde am 17.Juni 1853<br />
eingeweiht. Das Calwer Wochenblatt meldete damals: "Am 17. Juni wurde in Gechingen in<br />
einem freundlich gelegenen Parterrezimmer des Schulgebäudes eine Kleinkinderschule mit<br />
zwei Lehrerinnen und 80 Kindern feierlich eröffnet." Aus den alten Dokumenten geht weiter<br />
107
hervor, daß die Betreuerin im Jahr 1880/81 pro Tag 1 Mark Lohn erhielt, das waren pro Jahr<br />
298 Mark. Das gleiche Entgelt wurde auch im Jahr 1883/84 bezahlt. Katharine Gräber leitete<br />
die Kleinkinderschule bis zum Januar 1900. Dann hörte sie altershalber auf. Die Gemeinde<br />
sandte auf ihre Kosten die neue Bewerberin, Rosine Schaible, zur Ausbildung als<br />
Kindererzieherin nach Grossheppach. Diese Ausbildung kostete damals 114 Mark. Rosine<br />
Schaible trat ihren Dienst am 30.4.1901 an und betreute ganze Generationen von jungen<br />
<strong>Gechinger</strong>n, bis zu ihrem Dienstende 1937. Sie starb 1947 im Alter von 77 Jahren. 1926<br />
besuchten 73 Kinder, 1929 61 Kinder den Kindergarten. Ab 1929 stand Rosine Schaible eine<br />
Helferin zur Seite. Ihre Nachfolgerin und eine Helferin betreuten im Jahr 1944 ungefähr 44<br />
Kinder. Bis 1956 befand sich der Kindergarten im alten Schulgebäude. Danach zog er in den<br />
Neubau der Gemeindehalle um. Da die Zahl der Kinder ständig zunahm, wurden diese<br />
Räumlichkeiten bald zu klein. Ein weiterer Raum entstand 1975 bei dem Umbau bzw. der<br />
Erweiterung der Gemeindehalle. Doch auch diese beiden Gruppenräume deckten den Bedarf<br />
nicht. Da die Schule den Pavillion in den Wolfswiesen nicht mehr brauchte, wurden dort zwei<br />
weitere Kindergartengruppen eingerichtet. Im Jahr 1980 besuchten 112 Kinder den<br />
Kindergarten, betreut von vier Erzieherinnen und vier Helferinnen. 1984 wurde der<br />
Kindergarten in den Wolfswiesen durch einen Anbau von 80 qm vergrößert, um den Kindern<br />
noch mehr Spiel- und vor allem Turnmöglichkeiten zu bieten. Da Gechingen ein sehr<br />
kinderfreundlicher Ort ist, wurde mit einem Aufwand von ca. DM 500.000.- im Gebiet<br />
"Weingarten" bei den Tennisplätzen 1987 noch ein weiterer Kindergarten gebaut und<br />
inzwischen vergrößert.<br />
Der Krankenpflegeverein<br />
Protokoll vom 2.11.1921: "Der neu gegründete Krankenpflegeverein, der mit 190 Mitgliedern<br />
ins Leben gerufen wurde, hat mitgeteilt, daß er demnächst eine Krankenschwester von der<br />
Diakonissenanstalt Stuttgart bekommen werde. Für dieselbe sei u.a. eine Wohnung und auch<br />
das erforderliche Heizmaterial zu beschaffen. Der Gemeinderat möge im Interesse dieser<br />
wohltätigen Einrichtung die frühere Forstwartwohnung und auch das erforderliche Heizmaterial<br />
unentgeltlich zur Verfügung stellen. Die Nützlichkeit dieser Einrichtung wird<br />
anerkannt und nach Beratung ist Beschluß :<br />
1. Dem Krankenpflegeverein in stets widerruflicher Weise die Forstwartwohnung<br />
unentgeltlich zu überlassen.<br />
2. Der Krankenschwester bis auf weiteres jährlich je 1 rm Buche- und Tannenholz sowie 25<br />
buchene Wellen zur Verfügung zu stellen.<br />
Zur Beurkundung : Gemeinderat. "<br />
Zunächst verlief alles wunschgemäß. Am 8.Februar 1932 wurde der Verein dann nochmals<br />
gegründet, nachdem er in den Jahren 1929-30 wegen Geldmangel aufgelöst wurde. (Weltwirtschaftskrise)<br />
Um 1950 hatte er 223 Mitglieder. Nach einer zweijährigen Pause, in der<br />
keine Krankenschwester zur Verfügung stand, übernahm 1972 Hermine Gehring geb. Folsche<br />
dieses Amt, das sie mit Hingabe ausübte. Als sie dann 1979 aus gesundheitlichen Gründen<br />
aufgab, fand sich in Margot Dingler eine neue tüchtige Kraft. Seit 1978 ist der<br />
Krankenpflegeverein Gechingen Mitglied der Diakoniestation Althengstett. Außer Frau<br />
Dingler sind noch drei weitere Schwestern im Einsatz.<br />
Die Krankenkasse<br />
Die Allgemeine Krankenkasse Gechingen wurde 1890 als Hilfskasse gegründet. Das hatte<br />
folgenden Grund: Die Arbeitgeber brauchten den Hilfskassenmitgliedern, im Gegensatz zu<br />
den Mitgliedern der Allgemeinen Ortskrankenkassen, keinen Arbeitgeberanteil an den<br />
Beiträgen zu zahlen. Deswegen stellten manche Arbeitgeber nur Arbeiter ein, die einer<br />
Hilfskasse angehörten. Die Mitglieder waren hauptsächlich in der Land- und Forstwirtschaft<br />
108
und als Dienstboten tätig. Dazu kamen noch unständig Beschäftigte und<br />
Wandergewerbetreibende. Auch auf Heimarbeit und sonstige Personen erstreckte sich die<br />
Hilfskasse. Die Kasse hatte den Zweck, ihre Mitglieder im Krankheitsfalle zu unterstützen,<br />
und bei Beerdigungen einen Kostenanteil zu übernehmen. Im Gründungsprotokoll hieß es:<br />
"Betreff Beginn der Allgemeinen Krankenkasse Gechingen (eingeschriebene Hilfskasse).<br />
Wohllöblichen Schultheißenamt bringen wir ergebenst Anzeige, daß unser Verein, nachdem<br />
die am 24. Januar 1890 eingereichten Statuten von der hohen Kreisregierung am 9. Februar<br />
1890 die Genehmigung erhielten, mit 1. März 1890 unter dem Titel "Allgemeine<br />
Krankenkasse Gechingen" (eingeschriebene Hilfskasse) in Wirksamkeit tritt. Der Ausschuß<br />
besteht aus nachstehenden Personen:<br />
1. Vorstand Christian Class<br />
2. Vorstand Friedrich Gehring<br />
Ausschußmitglieder: Ferdinand Breitling, Gottlob Weinbrenner, Friedrich Böttinger, August<br />
Vetter<br />
Schriftführer Friedrich Hubel<br />
und ersuchen Wohllöbliches Schultheißenamt, bezugnehmend auf Paragraph 19 unserer<br />
beigefügten Statuten um Legimation unseres Vorstands. Gechingen, 1.März 1890"<br />
Als Eintrittsgeld waren bei der Aufnahme in die AKG, gestaffelt in drei Klassen, 0,50 - 2<br />
Mark zu bezahlen. Der wöchentliche Beitrag betrug in den ersten Jahren<br />
in der 1. Klasse 0,10 Mark<br />
in der 2. Klasse 0,06 Mark<br />
in der 3. Klasse 0,04 Mark.<br />
Im Laufe der Jahre steigerte sich der wöchentliche Beitrag bis auf 0,80 Mark, 0,52 Mark und<br />
0,36 Mark. Die AKG bezahlte ihren Mitgliedern freie ärztliche Behandlungen, Brillen,<br />
Bruchbänder u.ä. Heilmittel, außerdem im Falle der Erwerbsunfähigkeit vom ersten Tage an<br />
ein Krankengeld in Höhe der Hälfte des für den Beschäftigungsort festgesetzten ortsüblichen<br />
Taglohnes eines gewöhnlichen Arbeiters. Beim Tode eines Mitglieds erstattete die AKG den<br />
Hinterbliebenen<br />
in der 1. Klasse 35 Mark<br />
in der 2. Klasse 20 Mark<br />
in der 3. Klasse 14 Mark.<br />
Aus einer Abrechnung von 1912 geht hervor, daß der Mitgliederbestand im Berichtsjahr bei<br />
120 männlichen und 25 weiblichen Personen lag. Ein Sterbefall und 298 Krankheitstage sind<br />
für 1912 verzeichnet. Die Kassenrechnung mit 1 553,37 Mark Einnahmen und 1 368,84<br />
Mark Ausgaben schließt mit einem Kassenbestand von 184,53 Mark ab. Nach den<br />
vorhandenen Unterlagen existierte die Allgemeine Krankenkasse Gechingen (AKG) bis etwa<br />
1914. Über ihre Auflösung gibt es keinen Nachweis.<br />
Die VdK Ortsgruppe<br />
Die Ortsgruppe des VdK (Verein der Kriegsgeschädigten, Hinterbliebenen und<br />
Wehrdienstopfer) wurde in Gechingen 1950 gegründet. Kriegsgeschädigte und Hinterbliebene<br />
aus den zwei Weltkriegen sind Mitglieder. Die Ortsgruppe zählte bei ihrer Gründung 42<br />
Personen. Der VdK gab und gibt seinen Mitgliedern Hilfe und Unterstützung bei Problemen<br />
mit Behörden und Ämtern. Damit das gesellige Leben nicht zu kurz kommt, werden<br />
Versammlungen und Ausflüge durchgeführt. Zur Zeit zählt die Ortsgruppe Gechingen 38<br />
Mitglieder.<br />
Die Vorsitzenden seit der Gründung bis heute sind Richard Vetter, Paul Breitling, Alfred<br />
Hack und Dr. Klaus Ruck.<br />
109
Der Krieger- und Veteranenverein<br />
Dieser Verein wurde vermutlich von heimkehrenden Soldaten des Feldzuges gegen Rußland<br />
(1813) gegründet. Die früheste Erwähnung des Veteranenvereins steht im Calwer<br />
Wochenblatt vom Juli 1841. Darin werden die <strong>Gechinger</strong> Veteranen zu einer Versammlung<br />
nach Calw aufgerufen.<br />
Zum Andenken an die Schlacht von Sedan (1870), bei der Napoleon III. gefangengenommen<br />
wurde, führte der Verein an den Sedanstagen festliche Veranstaltungen durch. Im April 1902<br />
gründeten 32 Mitglieder unter der Leitung von Maurermeister Morgenthaler einen<br />
Militärverein neben dem damals noch aus 26 Mitgliedern bestehenden Veteranenverein. Die<br />
nach dem ersten Weltkrieg zurückgekommenen Soldaten führten die Tradition fort. 1925<br />
bauten die Ver-einsmitglieder in Eigenregie im Dachteler Bergwald eine Schießbahn. Die 200<br />
m lange Anlage hatte einen natürlichen Kugelfang und wurde lange Jahre eifrig benützt.<br />
Durch den Kriegsausbruch 1939 wurde der Schießbetrieb auf der Anlage beendet. Schon<br />
vorher, nämlich im Jahr 1934, mußte der Krieger- und Veteranenverein dem<br />
nationalsozialistischen Kyffhäuser-Bund beitreten bzw. wurde gleichgeschaltet und unterstand<br />
damit der NSDAP. Das Ende des zweiten Weltkriegs bedeutete auch das Ende des Krieger-<br />
und Veteranenvereins.<br />
Die Wasserversorgung<br />
Liste der bekannten Brunnen um 1880:<br />
1. Bernbrunnen bei der Scheuerquelle, im Hof Rüffle<br />
2. Rohrbrunnen, bei der Post Dachteler Str.<br />
3. Fleckenbrunnen, Hauptstr. vor der Bäckerei<br />
4. Kellerquelle oder Hausbrunnen, Brunnenstr. Haus Böttinger<br />
5. Marienlindenbrunnen, Ecke Kreuz- u. Gartenstr.<br />
6. Friedhofbrunnen<br />
7. Pumpbrunnen vor dem Friedhof, Parkplatz<br />
8. Schafgassbrunnen, vor Haus Kühnle/Lang<br />
9. Calwer Weg Brunnen, Calwer Str. Haus Gehring<br />
10. Hengstetter Straßen Brunnen, gegenüber Haus Wuchter/Gemeinde<br />
11. Angelbrunnen, Angelstr. bei der Linde<br />
12. Dachtler Straßen Brunnen, im Hof Gräber<br />
13.Deufringer Straßen Brunnen 1, Kreuzstr. vor Haus Breitling/Neubau<br />
14. Gäßlesbrunnen, vor Haus Quinzler<br />
15. Geißbiegelbrunnen, Kirchstr. vor Haus Marquardt<br />
16. Hauptstraßen Brunnen, im Hof "Rößle"<br />
17. Oberer Brunnen, Calwer Str. bei Scheuer Esslinger<br />
18. Ipserquelle, Gartenstr. Haus Wagner<br />
19. Scheurenquelle, Brunnenstr. Scheuer Böttinger<br />
20. Rathausbrunnen, beim alten Rathaus<br />
21. Außenimdorfbrunnen, Dorfäckerstr. bei Haus Zech<br />
22. Deufringer Straßen Brunnen 2, Mühlweg bei Haus Kühnle<br />
23. Appeleshofbrunnen, Hof zwischen Kirch- u. Calwerstr.<br />
24. Kapellenbergbrunnen oder Calwer Straßen Brunnen, oberhalb der "Krone"<br />
25. Weiherbrunnen, Mühlquelle, Wasser für Aidlingen<br />
26. Hummel- oder Hundsbrunnen, an der Straße zur Mühle<br />
27. Klingelbrunnen, im Brühl<br />
28. Galgenbrunnen, Uhlandstr.<br />
29. Heinrichsbrunnen, Ecke Calwer- u. Dorfäckerstr.<br />
30. Wehrbrunnen, Standort unbekannt<br />
110
Vor dem Bau der Wasserleitung im Jahr 1906 hatte unser Ort etwa 76 Pump- oder<br />
Ziehbrunnen. Der am oberen Angel soll über 30 m tief gewesen sein. Daß es bei der<br />
Benutzung dieser Brunnen Probleme gab, zeigt folgendes Protokoll vom 26. September 1887:<br />
"Die Besitzer des Schafgassbrunnens haben Streitigkeiten unter sich in Beziehung auf ihre<br />
Anteile an dem Brunnen und haben die Bezahlung einer Rechnung des Glasers Gehring im<br />
Betrag von 9,20 Mark verweigert, um endlich die Eigentumsverhältnisse des Brunnens zu<br />
regeln. Nach den öffentlichen Büchern (Güterbüchern) haben sie unbestrittene Anteile wie<br />
folgt:<br />
1. Die Gemeinde 1/12, erworben von dem verstorbenen Georg Böttinger,<br />
2. Georg Schautt, Witwe , 1/12,<br />
3. Karl Schaible, Schäfer, 1/12,<br />
4. Johann Georg Eisenhardt, Witwe, 1/12,<br />
5. Ludwig Gräber, Bäcker, 1/12 (von Wildbret erworben),<br />
6. Ludwig Gräber, den Anteil seines alten Hauses mit 1/12,<br />
7. Johannes Breitling, Bauer, 1/12,<br />
8. Friedrich Böttinger, Gemeinderat, 1/12,<br />
9. Jakob Süsser, Witwe, 1/12,<br />
10.Wilhelm Kühnle, Bauer, 1/12.<br />
Diese Besitzer haben bisher gegen einen Wasserzins von 1,14 Mark folgende Personen<br />
Wasser holen lassen:<br />
1. Adam Schaible<br />
2. Ferdinand Gehring<br />
3. Georg Schmid<br />
4. August Köber<br />
5. Friedrich Breitling jun.<br />
6. Georg Köber.<br />
Diese sollen auch fernerhin Wasser holen dürfen, wogegen der Vertreter der Gemeinde,<br />
Schultheiß Ziegler, sich verwahrt in Bezug auf Ferdinand Gehring und Georg Schmid, da<br />
diesen ein eigener Brunnen zu Gebot gestanden und sie dieses Anrecht vergeben haben.<br />
Schließlich wird festgesetzt:<br />
1. Daß diese künftig 1,20 Mark pro Jahr bezahlen sollen.<br />
2. Daß Ferdinand Gehring und Georg Schmid bloß solange Wasser aus dem Brunnen holen<br />
dürfen, als kein Wassermangel eintritt.<br />
3. Als Vertreter der Brunnengemeinschaft und zugleich als Kassierer wird Friedrich Böttinger<br />
sen. gewählt.<br />
4. Es wird beschlossen, daß eine steinerne Umfassung des Brunnens hergestellt wird und daß<br />
bei fernerem Bedarf an der Bedeckung die Gemeinde, wie bei allen Brunnen, Bretter<br />
unentgeltlich abzugeben habe. Die letzte Rechnung für den Diel mit 8 Mark soll auf die<br />
Gemeinde übernommen werden, womit der Gemeinderat einverstanden ist.<br />
5. Der Brunnenzins ist je auf 30.Dezember 1887 erstmals zahlbar.“<br />
Es folgen sämtliche Unterschriften der Obengenannten.<br />
Durch den manchmal auftretenden niederen Wasserstand der Brunnen sah sich der<br />
Gemeinderat veranlaßt, 1904 die Quelle im oberen und unteren Tal messen zu lassen. Im Jahr<br />
1905 wurde von Stuttgart ein Gutachten angefordert, das die Zuleitung des Wassers der<br />
Quellen vom oberen Tal ohne Pumpwerk zum Inhalt hatte.<br />
Im Protokoll vom 20. Mai 1905 heißt es:<br />
"Infolge Beschlusses vom 17. Februar des Jahres hat am 5. des Monats eine Besichtigung der<br />
für eine neue Wasserversorgung ins Auge gefaßten Quellen im oberen Tal durch einen<br />
111
Beamten des Königlichen Bauamtes für das öffentliche Wasserversorgungswesen in Stuttgart<br />
stattgefunden. Das Ergebnis ist in einem schriftlichen Gutachten niedergelegt, welches zur<br />
Verlesung kommt. Hiernach ist eine zweckmäßige Wasserversorgung ohne allzu große Opfer<br />
ausführbar. Die Quellenmessung ergab als Zufluß der Quelle 1 (obere Quelle) 2 lsec, der<br />
Quelle 2 (untere Quelle) 1,5 lsec, insgesamt also 3,5 Liter pro Sekunde. Während einer<br />
Zugrundelegung eines Wasserbedarfs pro Kopf und Tag von 80 Liter ist eine<br />
Quellenergiebigkeit von 1,1 Sekundenliter für Gechingen genügend. Bei der am 19. Dezember<br />
vorigen Jahres nach vorausgegangener abnormer Trockenheit durch Wasserbautechniker<br />
Kleinbub aus Calw vorgenommenen Quellenmessung lieferte Quelle 1 1,0 lsec, Quelle 2<br />
dagegen, welche ca. 120 m talabwärts ist und 1,5 m tiefer liegt, 0,9 lsec, zusammen also 1,9<br />
Liter pro Sekunde oder täglich 164 160 Liter, so daß bei 1 088 Einwohnern auf jeden Kopf in<br />
24 Stunden rund 150 Liter entfallen, während wie schon oben bemerkt, ein Wasserbedarf von<br />
80 Litern = 1,1 lsec, genügen würde. Von dem Techniker des Königl. Bauamtes für das<br />
Wasser-versorgungswesen wurde weiter festgestellt, daß der Ursprung der unteren Quelle ca.<br />
8m über der Straßenfläche des höchstgelegenen Ortsteiles liegt, während für den weitaus<br />
größten Teil des Orts durch die Quellenzuleitung ein natürlicher Druck von 20 - 25 m sich<br />
erzielen ließe. Die Erstellung eines Pumpwerks kommt hierdurch nicht in Frage. Die<br />
Notwendigkeit einer Wasserversorgung wird von beiden Collegien anerkannt.<br />
Die Gesamtkosten des Unternehmens werden nach einer Schätzung seitens des Technikers auf<br />
ca. 45 000 Mark zu stehen kommen.<br />
Nach eingehender Besprechung wurde zunächst zur Abstimmung geschritten, mit dem<br />
Ergebnis, daß sich der Gemeinderat mit sämtlichen 8 Stimmen für den Bau einer<br />
Wasserleitung erklärt hat, während sich der Bürgerausschuß mit 4 Stimmen gegen 1 Stimme<br />
gegen das Unternehmen ausgesprochen hat.<br />
Beschluß:<br />
1. Schnellstens ein vollständiges Wasserversorgungsprojekt auf Gemeindekosten<br />
auszuarbeiten.<br />
2. Herrn Oberbaurat Ehmann, Stuttgart die Oberleitung zu übertragen.<br />
3. Die Grundstücke mit den darauf entspringenden Quellen im oberen Tal zu erwerben."<br />
Am 20.Januar 1906 wurden dann die Bauarbeiten ausgeschrieben und am 4. März 1906 der<br />
erste Spatenstich für den Bau der neuen Wasserleitung getan. Schon Anfang Juni 1906<br />
strömte das Wasser in die Häuser. Es floß mit eigenem Gefälle in höher gelegene Ortsteile.<br />
Ein Reservoir, das 2 500 hl faßte und heute noch besteht, sammelte das Wasser. Im Ort<br />
wurden zahlreiche Hydranten erstellt, die im Brandfall reichlich Wasser lieferten. Die<br />
Gesamtkosten betrugen ca. 70 000 Mark. Die Bevölkerung war begeistert von dieser<br />
Neuerung und die Feuerwehr feierte ein Wasserfest.<br />
Für die richtige Instandhaltung der neuen Wasserleitung wurde im Juni 1908 ein<br />
Wassermeister angestellt (Karl Härtkorn).<br />
Die Wasserversorgung für die Gemeinde Gechingen war damit auf lange Sicht sichergestellt,<br />
nur in den Gebäuden im oberen Angel traten besonders in trockenen Jahren Schwierigkeiten<br />
auf.<br />
Infolge der anhaltenden Trockenheit in den Jahren 1947 bis 1949 und 1950 hatte sich die<br />
Quellschüttung von 3,5 l/sec im Jahr 1906 auf 0,91 l/sec verringert. Die Gemeinde mußte<br />
etwas unternehmen, um neue Wasserquellen zu erschließen.<br />
Durch die Fassung einer Quelle am Ortsausgang Richtung Deufringen und den Bau eines<br />
Pumphäuschens dort sowie einer kurzen Druckleitung zur nächstliegenden Leitung wurde das<br />
Problem gelöst.<br />
Neue Baugebiete, hauptsächlich der Bau der Bergwaldsiedlung und der Aussiedlerhöfe,<br />
machten Erweiterungen der Wasserversorgung notwendig. Dazu wurde in der Kirchhalde ein<br />
112
Wasserturm erstellt, der durch zusätzliche Pumpen gespeist wird. Er versorgt jetzt die<br />
höhergelegenen Gebiete unseres Ortes. 1963 beschloß der Gemeinderat, Wasserzähler in die<br />
einzelnen Häuser einbauen zu lassen und einen Kubikmeterpreis von 30 Pfennig zu erheben.<br />
Bis dahin war der Wasserbezug kostenlos. An der Brühlquelle traten Verunreinigungen auf,<br />
die umfangreiche Umbaumaßnahmen notwendig machten. Die verschiedenen Zuläufe wurden<br />
neu gefasst, darüberhinaus schaffte man eine Querverbindung zur Niederzone der<br />
Steckbrunnenquelle. Gleichzeitig begann man mit dem Bau einer getrennten Druck- und<br />
Falleitung zum Wasserturm.<br />
1984 entstand beim Wasserturm ein zusätzlicher Wasserbehälter und eine<br />
Aufbereitungsanlage. Der Wasserbehälter hat ein Volumen von 1.250 Kubikmeter, die<br />
Wasseraufbereitungsanlage hilft, das Wasser bei evtl. Verunreinigungen zu filtern. Die<br />
Gesamtkosten für diese Maßnahmen betrugen ca. 2 Millionen DM. 1988 wurde der 25 Jahre<br />
alte Wasserturm renoviert und mit einem neuen Außenanstrich versehen. Jetzt können 1.500<br />
Kubikmeter Wasser im Erdbehälter gespeichert werden. Die schon früher vorhandenen<br />
Behälter fassen 200 Kubikmeter. Diese Kapazität reicht für ca. drei Tage. Alle diese<br />
Investitionen in die Wasserversorgung des Ortes machten laufende Erhöhungen des<br />
Wasserbezugspreises notwendig.<br />
Die Stromversorgung<br />
Aus dem Gemeinderatsprotokoll vom 8.4.1897 ersehen wir, daß das Anzünden der<br />
Straßenlaternen damals vom jeweiligen Nachtwächter je ein Jahr lang abwechslungsweise zu<br />
besorgen war. Die Laternen waren mit Öl gefüllt, hingen über der Straßenmitte und konnten<br />
mit Hilfe von Seilen herabgelassen werden. Eine ziemlich aufwendige Arbeit, wenn man sie<br />
mit den heutigen Verhältnissen vergleicht.<br />
Hermann Schmid beschreibt dies in seinen Lebenserinnerungen so:<br />
"Alle 100 m stand ein Holzmasten, 8 m lang, 0,20 m stark, daran hing eine Laterne. Sie war<br />
ca. 35 x 50 cm groß, ringsum ein Eisenrahmen mit Glas, innen ein Behälter mit Erdöl. Die<br />
Lampe wurde mit einer Kurbel über ein Zahnrad und Drahtseil heruntergelassen, angezündet<br />
und wieder hinaufgezogen."<br />
Das 20. Jahrhundert brachte die Elektrizität. Die Gemeinde Gechingen konnte sich 1906 noch<br />
nicht entschließen, dem neugebildeten "Gemeindeverband zum Zwecke der Einrichtung eines<br />
Elektrizitätswerks behufs Versorgung der Gemeinden des Bezirks Calw mit elektrischem<br />
Licht und Kraft" beizutreten. Die 15 Interessenten, die sich bei der Gemeinde meldeten,<br />
mußten noch zwei Jahre lang warten.<br />
Im Jahr 1908 beschlossen der Gemeinderat und Bürgerausschuß einstimmig, dem<br />
obengenannten Gemeindeverband beizutreten. Als Vertreter Gechingens in den<br />
Verbandsausschuß wurden Bürgermeister Ladner und Gemeinderat Hubel gewählt. Im Jahr<br />
1911 wurde dann vom Gemeinderat in einer Sitzung am 4.7. folgendes beschlossen:<br />
"1. In betreff der Straßenbeleuchtung wird bestimmt, daß anzubringen sind, je eine Lampe<br />
a) bei der Kronenwirtschaft,<br />
b) beim Gasthaus zum "Adler" (heute neues Rathaus),<br />
c) an der Straße nach Althengstett bei Ludwig Wuchters Haus (Nr.30),<br />
d) beim Rathaus (altes Rathaus),<br />
e) oben an der Metzgergasse (beim "Lamm"),<br />
f) beim Waschhaus (am Feuerlöschteich),<br />
g) am Bach beim Wohnhaus Fritz Weiß Witwe (Dachteler Str.11),<br />
h) an der Hauptstraße bei Gehring auf der Mauer (Nr.2),<br />
i) an der Gartenstraße (Nr.13).<br />
2. Im Schulgebäude sind folgende Lampen einzurichten:<br />
a) im Lokal der Mittelklasse 3 größere Lampen,<br />
113
) für die Beleuchtung der Treppe 1 Lampe,<br />
c) im Lokal der Unter- und Oberklasse je 1 größere Lampe über dem Pult,<br />
d) in der Wohnung des Oberlehrers eine größere Lampe im Wohnzimmer und je eine in<br />
Schlafzimmer und Küche,<br />
e) im Zimmer des Unterlehrers 1 Lampe,<br />
f) in der Wohnung des Hauptlehrers in der Calwer Straße 3 Lampen.<br />
Die Einrichtung der elektrischen Beleuchtung geschieht ganz auf Kosten der Gemeinde.<br />
Dagegen haben die Lehrer für die Beschaffung der Leuchtkörper selbst aufzukommen und die<br />
Bezahlung des Stromverbrauchs zu übernehmen. Im Falle eines Stellenwechsels sind die<br />
Lampen in dem Zustand abzutreten, wie solche von den abgehenden Stelleninhabern<br />
übernommen worden sind.<br />
3. Eine erforderliche Anzahl von Lampen soll auch im Rathaus eingerichtet werden."<br />
Im Lauf des Jahres 1911 wurden auch die Privathäuser mit Leitungen und Strom versorgt. Auf<br />
dem Hohen Angel wurde die erste Trafostation gebaut und mit einer Leitung von Althengstett<br />
her versorgt, die über die Kirchhalde führte.<br />
Das Futter für 10 Stück Vieh schnitt man mit der elektrischen Futterschneidmaschine für<br />
einen Monat mit einem Aufwand von 1 Mark. Die Kilowattstunde kostete 1913 45 Pfennige<br />
und deshalb war in vielen Häusern nur eine Lampe, mit einer schwachen Glühbirne bestückt.<br />
Kein Vergleich zu unseren heute gut ausgeleuchteten Räumen!<br />
Das Elektrizitätswerk an der Station Teinach konnte schon im November 1910 durch<br />
Fremdstrombezug in Betrieb gehen und einige Gemeinden mit Strom beliefern. Mit 3<br />
Gasturbinen von 700 PS Leistung wurde dann ab April 1911 eigener Strom erzeugt.<br />
"Die stürmische Entwicklung erlaubte es, im Mai 1913 mit dem ehrgeizigen Projekt einer<br />
Wasserkraftanlage zu beginnen. Dazu wurde an der Talmühle ein Wehr errichtet und ein mehr<br />
als 2 km langer Wasserstollen bis Station Teinach durch den Berg getrieben. Im Kraftwerk<br />
wurden zwei Francis-Zwillingsturbinen mit liegenden Wellen installiert, die mit zwei<br />
Drehstromgeneratoren direkt gekoppelt sind. Diese Anlage ging im Januar 1915 in Betrieb.<br />
Mit ihr war es möglich, auch in den schweren Zeiten des ersten Weltkrieges und den Jahren<br />
danach die Stromlieferungen einigermaßen aufrecht zu erhalten."<br />
(Auszug aus dem Jahrbuch für den Kreis Calw 1985)<br />
Trotzdem mußte im ersten Weltkrieg in Gechingen ein Trafo abmontiert werden, um<br />
anderswo eine Lücke in der Stromversorgung zu schließen. Der Gemeinderat beantragte<br />
deshalb am 12.November 1920 beim E-Werk Teinach die Verstärkung und den Wiedereinbau<br />
des Trafos, da der Verbrauch an elektrischem Strom stark zugenommen habe.<br />
Im Jahr 1939 wurden die Gemeindeverbände enteignet und das E-Werk Teinach in die<br />
Energieversorgung Schwaben (EVS) überführt, ohne die Gemeinden zu befragen. 1949<br />
schlossen sich die Gemeinden zu einem neuen Gemeindeverband zusammen.<br />
1958 wurde wie im ganzen Land, auch in Gechingen die Stromversorgung von 220 Volt auf<br />
380 Volt umgestellt. Die seitherigen Giebelanschlüsse wurden aus Sicherheitsgründen<br />
abmontiert und dafür Dachständer angebracht. Dazu wurden neue Leitungen verlegt,<br />
außerdem die alte Trafostation am Angel abgebrochen. Eine neue Trafostation entstand 1959<br />
wenige Meter daneben. Gleichzeitig erweiterte und erneuerte man die Straßenbeleuchtung.<br />
Die Neubaugebiete stattete man mit Erdkabeln aus. Der Bau von weiteren Trafostationen und<br />
die elektrische Versorgung unseres Ortes durch eine sogenannte "Ringleitung" waren<br />
notwendig. Dadurch ist die Stromversorgung auch bei Störungen besser gewährleistet.<br />
Die Post<br />
"Staatliche Einrichtungen für die sichere und rasche Beförderung von Nachrichten und<br />
Personen waren schon im römischen und fränkischen Reich vorhanden. Ursprünglich dienten<br />
sie allerdings nur der Öffentlichkeit und konnten von Privatpersonen nicht in Anspruch<br />
genommen werden. Unter Graf Eberhard wurden in Württemberg die ersten regelmäßig<br />
114
verkehrenden Boten eingesetzt. Sie beförderten die Post nach Berlin, Wien, Prag, Straßburg<br />
und in andere europäische Städte, mit denen Württemberg in Beziehung stand. Die Privatpost<br />
dagegen wurde von Postillionen oder "Metzger-Boten" befördert. Die Metzger hielten in der<br />
Regel Pferde, kamen bei Viehkäufen weit im Land herum und trafen andere Metzger, denen<br />
sie die Sendungen übergeben konnten. Aus diesen Anfängen entwickelten sich regelmäßige<br />
Botengänge und Ritte.<br />
Schon 1490 beauftragte Kaiser Maximilian die Herren von Taxis, seine Amtspost von Wien<br />
nach den Niederlanden zu transportieren. 1536 ernannte Karl V. Baptist von Taxis zu seinem<br />
Generalpostmeister, wodurch die Postbeförderung im ganzen Reich eine Angelegenheit des<br />
Hauses Taxis wurde. Am 6.November 1597 ließ Kaiser Rudolf II. das Nebenbotenwerk, also<br />
die Metzgerboten, die auch Briefe von Italien über Deutschland nach den Niederlanden<br />
beförderten, verbieten. Weil sich die Postbeförderung zu einem lukrativen Geschäft<br />
entwickelte, entspann sich ein 250-jähriger Kleinkrieg zwischen dem Kaiser als Reichsherrn<br />
einerseits und den Herzögen als Landesfürsten andererseits. Die Landesfürsten versuchten<br />
immer wieder, eigene Posteinrichtungen zu schaffen. Am 26.Juni 1622 erließ Herzog Johann<br />
Friedrich von Württemberg eine Verordnung, welche bestimmte, "was die Postmeister und<br />
Metzger der Posten halber zu thun schuldig sind, und wie es sonst in allem Andern mit dem<br />
Postwesen gehalten werden soll". Nach dem 30-jährigen Krieg, als die Fürsten ihre Länder<br />
absolut regierten, errichtete Herzog Eberhard Ludwig ab 1709 ein vorbildliches Postwesen in<br />
Württemberg. Es wurden neue Straßen und Poststationen angelegt, wobei unser Gebiet von<br />
der Postlinie Stuttgart-Straßburg, die Württemberg mit den Besitzungen in Frankreich<br />
(Montbeliard), verband, versorgt wurde. Neu war vor allem, daß die herzogliche Post nun<br />
auch Waren und Personen beförderte.<br />
Wieder griff der Kaiser ein und im Jahr 1775 wurden alle württembergischen<br />
Posteinrichtungen für 30 Jahre an die inzwischen in den Fürstenstand erhobenen<br />
Erbreichspostminister von Thurn und Taxis vergeben. Erst 1851, als sich die<br />
württembergischen Staatseisenbahnen weigerten, die Taxis'sche Post zu befördern, und diese<br />
somit nicht mehr konkurrenzfähig war, ging das gesamte Postwesen in Württemberg gegen<br />
Bezahlung von 1 300 000 Goldgulden an den württembergischen Staat über. Im selben Jahr<br />
wurden die ersten Briefmarken herausgegeben und die Postämter mit neuen Stempeln<br />
ausgestattet."<br />
(Calwer Kreisnachrichten 1987)<br />
Württemberg wurde bei der Reichsgründung 1871 die Verwaltung der Post mit eigenen<br />
Briefmarken zugestanden. Diese Regelung bestand bis zum 21.3.1920.<br />
In Gechingen wurde am 1.12.1883 eine Poststelle eingerichtet.<br />
Der erste Posthalter Ludwig Weiß stellte im Erdgeschoß seines Hauses gegenüber dem alten<br />
Rathaus einen Raum zur Verfügung, der durch einen Holzverschlag mit Schalter abgeteilt<br />
war. Ein Briefträger, der diese Arbeit nebenher verrichtete (sein Hauptberuf war Schneider),<br />
trug die Post im Ort aus. Kamen Telegramme an, besorgte sie der Posthalter persönlich. Für<br />
50 Pfennig stellte er zu Fuß Telegramme nach Dachtel zu. Als Ludwig Weiß 1912 starb, baute<br />
Christian Vetter in seinem Garten an der Calwer Straße ein neues Haus und richtete dort 1913<br />
die Poststelle ein. Bis zur Fertigstellung dieses Gebäudes war sie provisorisch im Haus<br />
Hauptstraße 9 untergebracht. Christian Vetter und später seine Frau, sein Sohn Hermann<br />
Vetter versahen in dem Postgebäude an der Calwer Straße ihren Dienst. Die Räume wurden<br />
durch verschiedene kleine Umbauten den steigenden Anforderungen angepaßt.<br />
Am 1.10.1984 wurde die Poststelle Gechingen wegen ständiger Zunahme des Brief- und<br />
Paketverkehrs Postamt. 1986 zog die Post in neue größere Räume in der Dachteler Straße um.<br />
Poststellenleiter in Gechingen:<br />
115
1883 - 1912 Ludwig Weiß<br />
1913 - 1943 Christian Vetter<br />
1943 - 1951 Luise Vetter geb.Gehring<br />
1951 - 1984 Hermann Vetter<br />
1984 - 1990 Max Ufer<br />
1990 - heute Herr Sieber<br />
Das Postauto<br />
Zur gleichen Zeit, wie die Poststelle, am 1.12.1883 nahm auch eine Postbotenfahrt von<br />
Dachtel über Gechingen nach Calw ihren Betrieb auf. Die Kutsche beförderte außer der Post<br />
auch Personen. Die Kurszeiten waren jeden Werktag:<br />
Ab Dachtel 6.30 Uhr<br />
An Gechingen 6.50<br />
Ab Gechingen 7.00<br />
An Calw 8.30<br />
Ab Calw 10.00<br />
An Gechingen 11.30<br />
Ab Gechingen 11.40<br />
An Dachtel 12.10<br />
Der Bezirks- und Handelsverein Calw ließ im Juni 1921 die Gemeinde Gechingen wissen, daß<br />
zur Aufrechterhaltung der Postverbindung Dachtel-Gechingen-Calw die Gemeinde einen<br />
jährlichen Beitrag von 200 Mark zu leisten habe. Die Gemeinde Gechingen war sich bewußt,<br />
daß diese Verbindung unter allen Umständen notwendig war und leistete den Beitrag unter der<br />
Maßgabe, daß auch Stammheim sich mit dem gleichen Betrag beteilige.<br />
1926 richtete die Post eine Kraftpostverbindung von Gechingen über Aidlingen nach<br />
Ehningen ein, die dann 1937 durch die Linie Calw-Gechingen-Aidlingen-Böblingen abgelöst<br />
wurde. Dazu mußte 1926 von der Gemeinde Gechingen eine Kraftposthalle in der<br />
Dorfäckerstraße gebaut werden.<br />
Durch diese Omnibuslinie war Gechingen mit den Städten Böblingen und Sindelfingen<br />
verbunden. Das trug viel zu Entwicklung unseres Dorfes bei. In den 80-Jahren trennte sich die<br />
Post wieder vom Personenverkehr, der seitdem von der Bundesbahn durchgeführt wird.<br />
Das Telefon<br />
Das erste Telefon in unserer Gemeinde wurde am 26.10.1889 eingerichtet, und zwar in der<br />
erwähnten Poststelle von Ludwig Weiß. Für seinen Telefonbereitschaftsdienst erhielt er eine<br />
kleine Vergütung von der Gemeinde. 1913 zog die Telefonvermittlungsstelle mit der<br />
Poststelle um in das neue Gebäude des Christian Vetter an der Calwer Straße.<br />
Im Laufe der Zeit nahm die Zahl der Telefonanschlüsse zu, und da auch die Gemeinden<br />
Deckenpfronn, Dachtel und Deufringen zum Ortsnetz Gechingen gehören, war der Bau einer<br />
kleinen Vermittlungszentrale notwendig. Sie wurde 1934 im früheren Arrestlokal im<br />
Erdgeschoß des alten Rathauses eingerichtet. Nach weiteren Erweiterungen des Telefonnetzes<br />
wurde die Zentrale in einem Anbau der Kraftposthalle in der Dorfäckerstraße untergebracht.<br />
Gechingen besaß im Jahr 1950 12 Telefonanschlüsse.<br />
Durch die rasche Vergrößerung des Ortes in den 50- und 60-Jahren stieg die Nachfrage nach<br />
Telefonanschlüssen rapide an. Der Bau einer neuen großen vollautomatischen Zentrale in der<br />
Dachteler Straße deckt nun auch die künftige Nachfrage nach Fernsprechanschlüssen.<br />
116
Die Spar- und Darlehenskasse<br />
Gegründet wurde der Darlehenskassenverein am 24. Januar 1889. 62 der Anwesenden<br />
unterschrieben die Statuten und wählten Friedrich Ziegler zum Vorsteher des Vereins. Das<br />
Eintrittsgeld betrug 2 Mark. Zum 21.12.1891 hatte der Verein bereits 73 Mitglieder und eine<br />
Bilanzsumme von ca. 12 800 Mark. Nach zehnjährigem Bestehen des Darlehenskassenvereins<br />
Gechingen eGmbH betrug die Bilanzsumme 30 656,98 Mark. Bei Beginn des ersten<br />
Weltkrieges wurde bereits ein Geschäftsvolumen von 47 188,63 Mark erreicht, so daß sich<br />
Gechingen schon damals durch eine gute Eigenkapitalausstattung auszeichnete. Das<br />
Geschäftsguthaben belief sich auf 1 763,06 Mark und die Rücklagen auf 3 128,27 Mark,<br />
wobei 31,82 Mark an Dividende zur Verteilung kamen. Bedingt durch die Kriegsereignisse<br />
und aufgrund der dadurch verursachten Geldentwertung wies die Bilanz von 1918 bereits ein<br />
Volumen von 234 522,93 Mark aus. Diese Entwicklung setzte sich fort bis in die<br />
astronomischen Größen der Inflation. Am 17. Januar 1924 hatte dann eine außerordentliche<br />
Generalversammlung darüber zu befinden, ob der Darlehenskassenverein weiter bestehen<br />
sollte, denn bis auf einen kleinen Warenbestand hatte man alles verloren. Während der<br />
Inflation wurde der Geschäftsanteil stetig heraufgesetzt, zuletzt waren 5 000 Mark als<br />
Geschäftsanteil zu bezahlen.<br />
Aufgrund der Aktion "Gleichschaltung" wurde bei der Generalversammlung 1935 das neue<br />
Einheitsstatut des Reichsverbandes der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften -<br />
Raiffeisen e.V. - eingeführt. Damit verbunden war auch die erste Umfirmierung von Darlehenskassenverein<br />
Gechingen eGmbH in "Spar- und Darlehenskasse eGmbH Gechingen".<br />
Außerdem wurde die Verwaltung auf drei Vorstands- und sechs Aufsichtsratmitglieder<br />
reduziert und der Rechner auf unbestimmte Zeit gewählt (Vorher mußte der Rechner jeweils<br />
nach vier Jahren neu gewählt werden). Vom 26.8.1939 bis zum 18.3.1940 wurden die<br />
Kassengeschäfte in die Abend- und Nachtstunden verlegt, da der Rechner eingezogen worden<br />
war und die Geschäfte von den Vorstandsmitgliedern erledigt wurden. Die Umstellung auf<br />
DM brachte 1948 so viele Schwierigkeiten mit sich, daß man selbst bei der<br />
Generalversammlung am 14.5.1950 noch nicht in der Lage war, genaue Angaben zu machen,<br />
da die Ausgabe der Bilanzierungsvorschriften durch die Militärregierung sich verzögert hatte.<br />
Erst bei der am 25.10.1952 im "Adler" stattfindenden Generalversammlung konnte die<br />
Reichsmark-Schlußbilanz und die DM-Eröffnungsbilanz vorgelegt werden. Mit einem<br />
Kostenaufwand von DM 31 000.- wurde 1950 ein neues Lagergebäude erstellt. Bei der 84.<br />
Generalversammlung wurde zum zweiten Mal der Firmenname geändert. Aus der "Spar- und<br />
Darlehenskasse eGmbH" wurde die "Genossenschaftsbank Gechingen eGmbH". Gleichzeitig<br />
wurde die Haftung des einzelnen Mitglieds auf 1 000 DM beschränkt. Bei dem 75-jährigen<br />
Jubiläum am 3.5.1964 wurde dann der Firmenname zum dritten Mal geändert, und zwar in<br />
"<strong>Gechinger</strong> Bank eGmbH". Seit 1978 gehört die <strong>Gechinger</strong> Bank zur Calwer Volksbank. Die<br />
Bilanzsumme stieg weiter an und überschritt am 31.Dezember 1985 bei der Gesamtbank die<br />
200 Millionen DM-Grenze. Im Jahr 1986 trat das 6 000 Mitglied der Bank bei. - 1987 feierte<br />
die Calwer Volksbank ihr 125-jähriges Bestehen. - 1989 konnte die Bank neue Räume im<br />
einem neuerstellten Wohn- und Geschäftshaus an der Calwer Straße beziehen. - Am 6. August<br />
1989 fand ein "Tag der offenen Tür" zum 100-jährigen Gründungstag des "Spar- und<br />
Darlehensvereins Gechingen" statt. - Die Calwer Volksbank und die Volksbank Weil der<br />
Stadt schlossen sich zu den Vereinigten Volksbanken zusammen.<br />
Die Kreissparkasse.<br />
Die Anfänge der Kreissparkasse Calw in Gechingen liegen in den zwanziger Jahren.<br />
Kaufmann Wilhelm Vöhringer, Calwer Straße 97, wurde von der damaligen Calwer<br />
Oberamtssparkasse zum ersten Ortssparpfleger - die frühere Bezeichnung für den<br />
Zweigstellenleiter - berufen. Ab 1928 war die Zweigstelle in der Hand der Familie Schneider.<br />
117
Karl Schneider, Land- und Gastwirt (zum Lamm), betreute die Zweigstelle der<br />
Kreissparkasse. Ab 1964 übernahm seine Tochter, Eugenie Benz, für 12 Jahre die<br />
Sparkassengeschäfte. Während in diesen Zeiten die Zweigstelle weitgehend im Nebenberuf<br />
geführt wurde, änderte sich dies 1978, als neue moderne Räume im Hause Kienzle bezogen<br />
wurden. Es stehen jetzt mehrere fest angestellte Mitarbeiter bereit, um die Kunden fachgerecht<br />
zu bedienen.<br />
Die Württembergische Landessparkasse<br />
Buchbindermeister Karl Böttinger, der in der Metzgergasse 10 wohnte, übernahm 1897 die<br />
Vertretung der Württembergischen Landessparkasse. Im April 1922 konnte Böttinger das<br />
25jährige Jubiläum der Agentur feiern. Von 1938 bis 1975 führte dann Kaufmann Schwenk<br />
die Vertretung weiter.<br />
Kirche und Pfarrer<br />
Geschichte<br />
Mit der Eroberung des Gäus durch die Franken hielt auch das Christentum nach und nach<br />
Einzug. Das besetzte Land wurde in Bistümer eingeteilt, Gechingen gehörte zum Bistum<br />
Speyer. Überall entstanden Kirchen und Kapellen, die erste in Gechingen vermutlich am<br />
Steidachpfad, dem Weg zum Gewand "Lehen", oder auf dem "Käppelesberg". Die ersten<br />
Kirchen waren sogenannte Eigenkirchen. Sie gehörten dem adeligen Herrn, auf dessen Grund<br />
sie standen, und waren meist Teil seines Hofes. Er setzte auch den Geistlichen ein. Für dessen<br />
Unterhalt und den der Kirche stand ihm der Kirchenzehnte zu.<br />
Die dörflichen Gemeinden wurden zunächst durch wandernde Missionare, meist Mönche aus<br />
den Klöstern, versorgt. Seit ca. 700 gibt es die ersten Kirchen "mitten im Dorf"", wie wir sie<br />
heute kennen, anfangs einfache Holzbauten. Die Kirche stand gewöhnlich neben dem Freihof<br />
und bildete mit diesem zusammen den beherrschenden Mittelpunkt des Ortes. Der Freihof von<br />
Gechingen war wahrscheinlich das "Schulzenhaus" (heute Haus Marquardt/Böttinger<br />
Kirchstraße).<br />
Unsere Martinskirche verdankt ihren Namen dem Schutzpatron der Franken, dem Heiligen<br />
Martin, was auf eine sehr frühe Gründung in der Frankenzeit hinweist. Stammheim war<br />
anscheinend die Urpfarrei, von der aus Althengstett und Gechingen christianisiert wurden.<br />
Deufringen mit einer St. Veitskapelle wurde Filial von Gechingen. Nach den ältesten<br />
Unterlagen bildete Gechingen mit der Kapelle in Deufringen eine Pfarrei. Der Plebanus<br />
(Leutepriester) lebte von einem Einkommen, das ihm die adlige Herrschaft oder das Kloster,<br />
das die Pfarrei gestiftet hatte, ausgeworfen hatte. Der Stifter einer Kirche mußte nicht nur für<br />
den Unterhalt des Pfarrers und des Mesners besorgt sein, sondern auch die Kirche mit Gütern<br />
ausstatten, um ihre bauliche Unterhaltung, Inneneinrichtung und was sonst noch dazu gehört,<br />
zu gewährleisten. Diese Mitgift des Stifters, der sogenannte Kirchensatz, war Voraussetzung<br />
für die Gründung einer Kirche. Er sollte sie samt Pfarrer und Mesner vom Kirchenherren<br />
unabhängig machen. Nutzen durfte sein Eigentümer nur das, was über die Verpflichtungen<br />
und Verbindlichkeiten, zu deren Ablösung der Kirchensatz vorgesehen war, hinausging. In<br />
Gechingen gehörten der Heiligenwald, sowie sogenannte Fruchtgülten und Landachtfrüchte<br />
zum Kirchensatz, auch Hellerzinsen waren später dabei. Dem Eigentümer des Kirchensatzes<br />
stand ferner das Patronatsrecht zu (das Vorschlagsrecht für den Pfarrer).<br />
Gechingen hatte schon sehr früh Beziehungen zur Markgrafschaft Baden, da die Markgrafen<br />
mit dem Calwer Grafenhaus verwandt waren. Weil die männliche Linie der Grafen zu Calw<br />
schon im 13. Jhdt. ausstarb, gelangte ihr Besitz durch Heirat der Grafentochter an die<br />
Pfalzgrafen von Tübingen bzw. deren Lehensleute, die Truchsessen von Waldeck, die sicher<br />
118
auch nahe Verbindungen zur Burg Gechingen hatten. Von den Tübingern und den Waldeckern<br />
erwarb im Jahr 1308/09 das Kloster Herrenalb große Teile Gechingens. Herrenalb wurde<br />
damit der Grundherr der weltlichen Dorfgemeinde.<br />
Die Kasten- und Schirmvogtei des Klosters Herrenalb oblag bis 1338 der Markgrafschaft<br />
Baden. Dann ging sie nach heftigem Streit an die Grafen von Wirtemberg über. Für<br />
Gechingen war dieser Vorgang deshalb von Bedeutung, da Württemberg nach der<br />
Reformation die Klöster säkularisierte, ihren Besitz einzog und Gechingen somit<br />
württembergisch wurde. Die Klosterämter blieben aber als württembergische Oberämter mit<br />
einem evangelischen Prälaten an der Spitze erhalten.<br />
Der Kirchensatz und alle damit zusammenhängenden Besitztümer waren aber offenbar bei<br />
den Truchsessen von Waldeck verblieben. Im Staatsarchiv in Stuttgart findet sich unter den<br />
Akten des Klosters Herrenalb ein Pergament in lateinischer Sprache vom 23.4.1404, in dem<br />
ein <strong>Gechinger</strong> Pfarrer erwähnt wird. In der Urkunde heiß es: " . . . . Vorgeschlagen wird<br />
Heinrich Durhubel, Pfarrer in Gechingen, von den Brüdern Konrad und Heinrich, Truchsessen<br />
von Waldeck. . . "<br />
Bei Sattler, "Topographische Geschichte des Herzogtums Württemberg, Stuttgart 1784" wird<br />
genau erläutert:<br />
"Wie denn Grav Eberhard (Eberhard III., der Milde, bis 1417) zu Würtemberg im Jahr 1413<br />
von Heinrich, Truchsess von Waldek einen vierten Teil an der Vogtei zu Dachtel, ingleichen<br />
dessen Sohn Grav Eberhard (Eberhard IV., bis 1419) der jüngere auch von disem und seines<br />
Bruders Sohn Konrad von Waldeck 1417 alle ihre Rechte, die sie an Leuten und Gütern<br />
gehabt, welche in das Schloß Waldeck gehöret, ingleichen den Kirchensaz und Zehenden<br />
zu Dachtel und Gechingen . . . , auch im Jahre 1419 von Heinrich Truchsess von Waldek<br />
dem älteren alle seine noch übrigen Güter und Gülten zu Dachtel, Kalw, Wildberg, Ensingen,<br />
Lengenfeld (oder Leinfelden) und Schwieberdingen, samt dem Kirchensaz zu Münklingen<br />
und Gechingen um 1183 Pfund Hlr. und endlich Grav Ludwig zu Würtemberg (Ludwig I.,<br />
1419-1450) von Tristram und Wilhelm von Waldek, alle übrigen Gerechtigkeiten an den<br />
Kirchen zu Gechingen und Dachtel erkauft haben." Der letzte Kauf ist, nach der<br />
Oberamtsbeschreibung von 1860, im Jahr 1428 zustandegekommen.<br />
Es muß damals also schon eine Pfarrei samt Kirche in Gechingen bestanden haben. Da die<br />
ältesten Teile des Turms romanische Stilelemente aufweisen, dürfte zumindest der Turm<br />
damals schon ca. 200 Jahre alt gewesen sein.<br />
In der Zeit zwischen 1428 und 1453 (in "Heimat Gechingen" erscheint die Jahreszahl 1440)<br />
muß Württemberg den Kirchensatz, das Mesnerlehen und den halben Fruchtzehnten an den<br />
Markgrafen von Baden veräußert haben; denn 1453 schenkte der Markgraf Jakob von Baden<br />
dem von ihm gegründeten Chorherrenstift Baden-Baden den <strong>Gechinger</strong> Kirchensatz. Auf<br />
besonderen Wunsch des Stifters wurde dieser dem Stift per Dekret durch den Papst<br />
einverleibt. Dem Markgrafen war unsere Kirche also offensichtlich so wichtig, daß er bereit<br />
war, dafür ein päpstliches Dekret zu bezahlen.<br />
Bis zum Jahre 1806 blieb es so, daß das Stift Baden-Baden die <strong>Gechinger</strong> Pfarrherren<br />
vorschlug (das Patronatsrecht hatte), daß aber Württemberg sie konfirmierte (bestätigte). Ein<br />
in jenem Jahr (1806) geschlossener Staatsvertrag zwischen Württemberg und Baden<br />
bereinigte territoriale und rechtliche Verhältnisse und gegenseitige Ansprüche zwischen<br />
beiden Ländern.<br />
Die dem Stift in Baden zustehenden Einkünfte zog der sogenannte badische Klosterschaffner<br />
ein (Schaffner bedeutet hier Aufseher, Beauftragter). Auch das blieb so bis 1806.<br />
Die Rechte an kirchlichem und weltlichem Besitz waren vielfach aufgespalten und Anteile<br />
konnten getrennt veräußert werden. So brachte eine Agnes von Gültlingen, die um 1460 in das<br />
Frauenkloster Lichtenstern eintrat, Rechte in Gechingen ein, die das Kloster 1473 für 300<br />
119
Gulden an das Kloster Hirsau verkaufte. Es handelt sich offenbar um den halben<br />
Kirchenzehnten. (siehe auch unter "Pfarrer Balthasar Wagner, 1562-66").<br />
Auch der Markgraf von Baden hat keineswegs alle Rechte, die er von Württemberg erworben<br />
hatte, dem Chorherrenstift Baden-Baden übertragen. Sein Titel war damals auch "Grav von<br />
Pforzheim" und da der Schwarze Predigerorden in Pforzheim das "Gefälle des Heiligen<br />
Martin" (die Abgaben, die der Kirche zustanden, um ihren Unterhalt zu sichern) Ende des 15.<br />
Jhdts. besaß, wäre denkbar, daß der Markgraf in beiden Städten Stiftungen gemacht hat.<br />
Dieses "Gefälle" kaufte die Gemeinde Gechingen 1497 vom Schwarzen Predigerorden in<br />
Pforzheim, eine Abschrift der Kaufurkunde ist im Rathaus Gechingen erhalten geblieben.<br />
"Folgt der Kaufbrief, wie des Heiligen Gefäll von dem Convent zu Pforzheim erkauft worden,<br />
zugerichtet anno Christi 1497, dessen Original bei anderen, des Heiligen Briefen liegt."Wir,<br />
Prior und der Convent Gemeines Predigerordens des Closters zu Pforzheim, bekennen uns<br />
öffentlich mit diesem Brief, daß wir verkauft und zu kaufen geben haben, alle unsere Zins<br />
Hellergült, Roggengut, Dinkel, Haber, völlig und zeitlich, auch ein Maß Magöl, wie das mit<br />
allem Brauch, Nutz und Besitzung inne gehabt haben, bis auf diesen Tag, nach Dato dieses<br />
Briefes, dem Heiligen oder welcher das will zu seinen selber Händen kaufen und ablösen, wie<br />
das miteinander überkommen, alles in dem Dorf Gechingen und ihrer Markung, die diesen<br />
Namen hat. Unserm oben gemeldetem Prior und Convent unterworfen ist, allen Häusern,<br />
Äckern und Wiesen nicht ausgenommen. Und ist dieser Kauf geschehen 1 PH? Boben um 1<br />
Pfund Heller, 1 Malter Dinkel um 8 Pfund Heller, 1 Malter Haber um 7 Pfund Heller, zahlbar<br />
in Württemberger Geld und Münze, das macht in einer Summe MXXIV Pfund Heller und 2<br />
Heller, die wir als bar bezahlt und unser Besitz sind und wir Kraft dieses Briefes dem oben<br />
gemeldetem Prior und Convent übergeben und jedem der davon besonders betroffen ist<br />
Nachricht geben. In dem gemeldeten Dorf Gechingen all unsere Gerechtigkeit, Nutzen,<br />
Brauchung und Besitzung auch Briefs und Register wie wir sie bisher innegehabt haben, also<br />
daß die genannten Heiligen alle darin begriffen, hinförder zu Gechingen lagen, mit allen<br />
solchen Zinsen und Gülten damit zu tun und lassen, verkaufen, verleihen, versetzen, also wie<br />
mit anderen eigenen Gütern ungehindert und ohngefragt, unsre und all unsere Nachkommen<br />
kein Anspruch nach solchen Zinsen füro nimmermehr haben, noch etwas zu bestimmen,<br />
weder mit Gericht oder Ohngericht Beistand. Und ohne gefährdende Arglist, geloben, daß bei<br />
Worten Treue, stets zu halten und dem Allem zu wahren verkündet haben wir, oben<br />
gemeldeter Prior und Convent unseren Conventsiegel gehängt an diesen Brief, der gegeben ist<br />
nach der Christi Geburt Unseres Herrn Jesu Christi, als man zählt 1497."<br />
Die Gemeinde stellte damit die Erhaltung der Kirche sicher, behielt sich aber ein<br />
Kontrollrecht vor. Deshalb sind im Rathaus Rechnungen der Kirchenpflege (Heiligenpflege)<br />
und Lagerbücher (Zinsbücher) des Heiligen aufbewahrt.<br />
Die ältesten Inschriften an und in der Kirche stammen aus dem Jahr 1481. Sie bezeichnen<br />
sicher nicht das Baujahr der Kirche, vielmehr wurde in diesem Jahr wahrscheinlich eine<br />
größere Renovierung abgeschlossen. Da aber kein sicherer Nachweis über das wahre Alter<br />
unserer Kirche zu erbringen ist, wird 1481 als das "Geburtsjahr" der Martinskirche betrachtet.<br />
Eine der beiden Inschriften befindet sich über dem südwestlichen Eingang zur Kirche. Dort<br />
steht auf einem eingemauerten Stein: "In honorem sancti Martini est dedicata illa ecclesia<br />
anno domini 148 (letzte Zahl fehlt, erschlossen) Bertholdus Dieringer Plebanus,<br />
Heinericus Wieland Lapicida."(Zu Ehren des Heiligen Martin wurde diese Kirche geweiht im<br />
Jahre des Herrn 148 Berthold Dieringer, Pfarrer, Heinrich Wieland, Steinmetz). In der<br />
Mitte der Inschrift befand sich das Wappen der Markgrafen von Baden, das später entfernt<br />
wurde. Die zweite Inschrift aus diesem Jahr ist Pfarrer Dieringers Grabplatte, die später an der<br />
Wand am Aufgang zur Empore angebracht wurde. Sie lautet: "Anno domini MCCCCLXXXI<br />
obijt bertholdus dieringer de alten bullach plebanus ecclesie cuius anima requiescat in pace<br />
amen." - "Im Jahre des Herrn 148 starb Berthold Dieringer aus Altenbulach, Pfarrer dieser<br />
120
Kirche. Seine Seele ruhe in Frieden Amen." Diese Grabplatte stammt nicht von dem<br />
obengenannten Steinmetz. Es wird angenommen, daß diese Jahreszahl 1481 auch das Jahr der<br />
Einweihung der Kirche ist.<br />
Um das Jahr 1522, also in der vorreformatorischen Zeit, muß unser Gotteshaus einen<br />
Altarschrein besessen haben. Einem Zufallshinweis verdanken wir die Nachricht über zwei<br />
geschnitzte Figuren des Schreins. Die erste Erwähnung über die Figuren fanden wir in dem<br />
Buch von Julius Baum "Bildwerke des späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts" von 1917.<br />
Hier heißt es auf Seite 266: "Abbildung 318 zeigt den Heiligen Petrus auf dem linken Fuß<br />
stehend, den rechten vorstreckend. Er hält in der erhobenen Rechten ein Buch, gegen das sein<br />
bärtiges, kahles Haupt gesenkt ist. Über die geballte Linke ist der Mantel derart geworfen, daß<br />
das gegurtete Gewand auf der Brust sichtbar bleibt. Es fehlen: die Nase, eine Zehe des rechten<br />
Fußes, und der Schlüssel in der Linken. Fassung größtenteils zerstört. Der Mantel war golden,<br />
Lindenholz, Rückseite ausgehöhlt, Höhe 1,23 m, Breite 0,38 m, aus Gechingen, Oberamt<br />
Calw." - "Abbildung 319 zeigt den Heiligen Martin, langsam reitend. Das schwerfällige Pferd<br />
in Trabstellung. Der Heilige in Amiktus, Alba, Dalmatika und Pluviale (Name von Kirchengewändern),<br />
die Mitra auf dem Haupte, wendet den Oberkörper nach rechts, dem Bettler zu, der<br />
unter dem Kopf des Pferdes kniet und mit der Rechten nach dem Mantelsaum des Bischofs<br />
langt. Dieser war dargestellt, wie er eben ein Stück seines Mantels abzuschneiden im Begriff<br />
ist, den die Linke hält. Es fehlen: Der Bettler, von dem nur noch ein Fuß und der rechte Arm<br />
erhalten sind, der rechte Arm des Heiligen Martin, seine Nase, Teile der Mitra und der<br />
Mantelfalten sowie der Schwanz des Pferdes. Statt der ursprünglichen Fassung ein gleichfalls<br />
größtenteils zerstörter weißer Anstrich, Lindenholz, Rückseite ausgehöhlt. Die Figur stand<br />
wohl in einem Schreinaufsatz. Höhe 0,94 m, Breite 0,59 m. Aus Gechingen, Oberamt Calw.<br />
Beide Figuren aus dem Jahr 1522 nach nicht nachzuprüfenden Angaben im Inventar der<br />
Sammlung Paulus. 1866 aus der Sammlung Paulus erworben." Seitdem waren die Figuren im<br />
Besitz des Landesmuseums Stuttgart. Der Heilige Petrus befindet sich dort im Alten Schloß,<br />
während der Heilige Martin seit ca. 1956 im Heimatmuseum Sindelfingen steht. Die oben<br />
erwähnte Sammlung Paulus soll von einem Oberkirchenrat Paulus stammen, der zur Zeit<br />
König Karls (1864 - 1891) gelebt hat. Dem Landesmuseum fehlen nach Auskunft von Dr.<br />
Meurer weitere Erkenntnisse über Paulus.<br />
Wann genau unsere Kirche und unser Dorf evangelisch wurden, wissen wir nicht. Zwar wird<br />
die Reformation in Württemberg auf 1535 festgesetzt nach der Rückkehr Herzog Ulrichs, und<br />
das Volk nahm in der Mehrheit die Lehre Luthers freudig an, aber die Klöster leisteten<br />
teilweise heftigen Widerstand, auch erlitt die evangelische Sache mancherlei Rückschläge.<br />
Mit Sicherheit aber kann man annehmen, daß vor 1550 der Übergang vollzogen war.<br />
Was die Verhältnisse ein bißchen schwierig machte - der Kirchensatz blieb in badischem, also<br />
"ausländischem" Besitz und zwar bei der katholisch gebliebenen Linie der Markgrafen von<br />
Baden-Baden. Im Zinsbuch des Klosters Herrenalb von 1725 erfahren wir folgendes über den<br />
Pfarrer von Gechingen: "Der Kirchensatz und Herrschaft der Pfarrer zu Gechingen gehört dem<br />
Stift zu Baden, die Kastenvogtei aber gnädigster Herrschaft Württemberg. Das Kloster<br />
Herrenalb hat zu Gechingen auf dem Kirchhof ein eigenes Kornhaus gehabt, das ist vor Jahren<br />
in einer Brunst abgegangen, ist gegen dessen von Gechingen und sonst männiglich aller<br />
Steuer und Beschwerden ganz frei gewesen." Ob in diesem Kornhaus nun aber Korn der<br />
Pfarrei gelagert wurde, ist nicht mehr festzustellen. Denkbar wäre es, denn Herrenalb bzw. das<br />
Klosteramt Merklingen war die vorgesetzte württembergische Behörde.<br />
Von einem schweren Brandunglück erzählt eine Inschrift am Kirchturm. "Anno 1561 mense<br />
aprilis turris hec fulmine coelitus delapso tacta et usque ad imum scissa est et tandem 1568<br />
anno reaedificari cepta eodemque absoluta." Das heißt: "Im Jahre 1561 im Monat April wurde<br />
121
dieser Turm durch einen Blitz vom Himmel getroffen, bis unten hin gespalten; und schließlich<br />
im Jahre 1568 begann man, ihn wiederaufzubauen; im selben Jahr wurde man damit fertig."<br />
Über dem südlichen Kircheneingang befand sich früher eine Inschrift: "1568 Lorentz<br />
Manner." Der Name stammt wahrscheinlich von einem Handwerksmeister, der damals die<br />
Bauarbeiten ausgeführt hat.<br />
Im Fleckenbuch von 1679 - 1748 findet man folgenden Eintrag: "Den 24. August ist<br />
Schultheiß, Gericht und Rat wieder versammelt gewesen. NB. Weil am 11. Dezember der<br />
Paulus Gräber, Fleckenschmied, gestorben ist, kommt von Simmozheim Bernhard Strohm. In<br />
diesem Jahr 1743 wurde 55 Schuh (1 Schuh = ca. 28 cm) in der Länge an unserer Kirche<br />
neben der neuen Sakristei gebaut. Unser Herrgott gab Segen und gutes Wetter. Vom 1. Mai<br />
bis 1. September wurden sie fertig, so daß am 12. Sonntag Trinitatis am Egidiustag (der<br />
Heilige Egidius wurde im Mittelalter sehr verehrt und zu den 14 Nothelfern gezählt) von<br />
Herrn Special Bregen aus Calw im Beisein ihrer Gnaden, Herrn Regierungsrat und<br />
Oberamtmann zu Merklingen, neben mehr als 2 000 Menschen so zu Lieb hierhergekommen,<br />
in Gottes Namen der Heiligen Dreifaltigkeit zu Ehren angefangen worden. Es ist das ganze<br />
Werk aus des Heiligen Kasten erbaut worden (Kirchenvermögen), außer der Schultheiß<br />
Johann Bernhard Kappis, der hat den eingemachten Stuhl an dem großen Kirchturm auf seine<br />
und seiner Nachkommen und Erben Kosten zu seinem Angedenken machen lassen, welcher<br />
auch zu ihrem Eigentum sei und verbleiben soll. Hiesige Kommun hat dem jetzigen<br />
treueifrigen Herrn Pfarrer Johann Martin Pommer sehr viel zu verdanken, welcher nicht nur<br />
alle guten Taten hier gemacht, sondern vielmehr selbst Hand angelegt und unter seiner und<br />
des Schultheißen Kappis Inspektion alles geschehen. Unser Herrgott erhalte die liebe Kirche<br />
vor allem Unglück und Schaden."<br />
Über dem südwestlichen Portal zum Kirchsaal ist eine Rose aus rotem Sandstein angebracht<br />
mit der Jahreszahl 1743, sie wurde höchstwahrscheinlich zum Abschluß der Bauarbeiten<br />
eingesetzt.<br />
Bei dem obengenannten Herrn Special Bregen handelt es sich um den damaligen Spezialsuperintendenten,<br />
(heute Dekan) Johann Christoph Breg. Er lebte von 1739 bis 1751 in Calw,<br />
geboren wurde er in Stuttgart 1682, verstorben ist er in Murrhardt 1752.<br />
Weitere Arbeiten an der Kirche wurden im Jahr 1772 durchgeführt. Im Kirchenkonventprotokoll<br />
vom 5.4.1772 heißt es (im Text wörtlich, Orthographie modernisiert): "Nachdem<br />
man wahrgenommen, daß seit einigen Jahren der allhiesige Kirchturm durch gewaltsame<br />
Sturmwinde und eingedrungenes Regenwasser sehr großen Schaden erlitten, so daß der<br />
Hauptstern (Balkenkonstruktion) außerhalb des Turms in der Mitte gänzlich verfaulte, die<br />
Gratstücke samt den Kreuzbälken nimmer habhaft, die darauf befindliche Helmstange samt<br />
dem zentnerschweren Kreuz, Knopf, und Hahnen, gesunken, und zu befürchten, es möchte<br />
durch den Verzug der Reparatur ein noch größerer Schaden entstehen, durch einen Sturm alles<br />
vollends abgerissen, und nicht nur das Turmdach, sondern auch das Kirchendach totaliter<br />
zusammengeschlagen werden, so habe ich subsignierter Johannes Machtloff, Maurermeister<br />
und Landschieferdecker auf Verlangen der allhiesigen Kirchen- und Communvorsteher den<br />
Kirchturm nebst einigen Urkundspersonen und dem Zimmermann Class beaugenscheinigt,<br />
den Schaden pflichtgemäß angezeigt und meine Arbeit aufs genaueste spezifiziert. Weil ich<br />
mich bei dem ganzen Geschäfte vieler Lebensgefahr exponieren muß, so prätendiere ich vor<br />
meiner Arbeit 75 Gulden nebst 4 Gulden zu ein Paar Schuh, ein Paar Strümpf und eine<br />
Gesundheitsflasche dem uralten Brauch gemäß."<br />
Im Jahre 1825 wurde eine kleine, helle Sakristei gegen Süden der Kirche erbaut, die aber nicht<br />
heizbar war. Bei der Kirchenrenovierung 1953 wurde beim Abnehmen der Kanzel ein<br />
Portalbogen mit der Jahreszahl 1825 gefunden. Bei diesem Bogen handelt es sich vermutlich<br />
um den alten Zugang zur Sakristei.<br />
122
Aus dem Jahre 1862 gibt es eine Inventarliste für unsere Martinskirche. Sie verfügte damals<br />
über: 1 Nachtmahl-Kelch aus Silber, 1 Hostien-Büchse, 6 zinnerne Nachtmahl-Kannen, einen<br />
kleinen Bücherkasten, einen großen Bücherkasten, einen Tisch, einen Stuhl, einen Schemel, 3<br />
Glocken, eine gute Uhr, eine Orgel, diverse Kanzel-, Altar- und Taufsteintücher.<br />
Eine durchgreifende Erneuerung und Vergrößerung der Kirche fand zwischen 1865 und 1867<br />
statt. Die Kirche, ursprünglich romanisch, wurde dabei in den jetzigen, neugotischen Stil<br />
umgebaut. An der Ostseite entstand ein Anbau von ca 11 ½ m (40 Schuh) Länge und ca. 11,7<br />
m (20 Schuh) Breite. Dadurch wurde für etwa 120 Personen Platz gewonnen. Zunächst wurde<br />
auf der nördlichen Seite eine regelmäßige Fenstereinteilung vorgenommen, gleichzeitig die<br />
jetzige Sakristei errichtet. Ebenfalls dürfte bei diesem Umbau der heutige Treppenaufgang zur<br />
Empore erstellt worden sein, da vorher von der Notwendigkeit der Beseitigung des<br />
"unschönen Stiegenhauses" die Rede war, einer überdachten Außentreppe, wie sie heute noch<br />
bei manchen Kirchen zu sehen ist. Anschließend wurde die Südseite umgebaut, wobei die<br />
Fenster im gotischen Stil errichtet und wie auf der Nordseite mit dreifarbigem Glas versehen<br />
wurden. Die Fenster bestanden aus etwa 10 cm großen Rauten, die auf die Spitze gestellt und<br />
in Blei gefaßt waren. Ihre Farben waren rot, blau und gelb.<br />
Der Haupteingang wurde ganz neu in Quadern und gotischer Arbeit ausgeführt. Der Turm<br />
bekam ebenfalls einen Eingang von außen. Bis dahin war vermutlich der einzige Zugang zum<br />
Turm durch den 1953 zugemauerten Torbogen im Kirchsaal möglich. Alle Eingänge wurden<br />
mit Türen aus massivem Eichenholz versehen. Im Zusammenhang mit der<br />
Kirchenrenovierung stiftete Schultheiß Otto Friedrich Ziegler einen neuen hölzernen, gotisch<br />
gearbeiteten Altar im Wert von 150 Gulden. Pfarrer Storz gab ein Lutherbild im Wert von 11<br />
Gulden, das neben der Kanzel aufgehängt wurde. Für Taufstein, Altar und Kanzel wurde eine<br />
neue, scharlachrote, mit gelbseidenen Borten versehene Bedeckung aus der Stiftungspflege für<br />
150 Gulden angeschafft. Außerdem wurde die Kirche außen verputzt. Der gesamte<br />
Kostenaufwand für die Baumaßnahmen 1865 - 1867 betrug ca. 11 000 Gulden, welcher von<br />
der Stiftungspflege allein getragen worden ist. Die Mittel dazu konnten aus dem Heiligenwald<br />
beschafft werden.<br />
Am 13.11.1874 trat der Stiftungsrat zusammen, um über den weiteren Ausbau unserer<br />
Martinskirche zu beraten. Aus dem Protokoll ersehen wir: "Die Orgel ist in nächster Zeit und<br />
damit das Innere der Kirche fertig, aber der Turm paßt zur Kirche in seiner jetzigen Bauart<br />
nicht mehr. Nun liegt bereits der neue Plan vor. Derselbe wird genehmigt und beschlossen: Im<br />
nächsten Frühjahr ist mit dem Bau des Turmes zu beginnen." Nach einem späteren Protokoll<br />
wurden die Pläne für den Umbau des Turms von Architekt Feldweg aus Hirsau und<br />
Baumeister Nüssle aus Stammheim gefertigt. Zur Ausführung kam eine Kombination aus<br />
beiden Plänen, wobei Oberamtsbaumeister Nüssle die Bauleitung übertragen wurde. Der<br />
Kirchturm wurde erhöht und mit einem "Pyramidendach" versehen. Dazu eine Beschreibung<br />
von Architekt Feldweg: "Der (alte) Turm hat vom Boden bis zur Gurte eine Höhe von 56<br />
Schuh, 16 m. Hierauf sitzt der abzubrechende Glockenstock, welcher auf drei Seiten von<br />
Fachwerk und auf der Westseite von Stein konstruiert, nur 4 m hoch ist, worauf das 4,6 m<br />
hohe Zeltdach sitzt. Gesamthöhe 24,6 m. Die von Stein aufzusetzenden zwei neuen<br />
Stockwerke über der oben genannten Turmgurte haben eine Gesamthöhe von 8,72 m, die<br />
Höhe der Pyramide 11,44 m. Der Turm erhält coupierte Ecken und geht im Pyramidendach in<br />
ein vollständiges Achteck über. Baukosten: 6 191 Gulden (10 586 Mark)." Das Kreuz auf dem<br />
Kirchturm, Gewicht 126 Pfund, wurde von Friedrich Gehring, Schlosser in Gechingen, um 43<br />
Gulden angefertigt, die Schalläden wogen 1 917 Pfund und kosteten 766 Gulden.<br />
Da bei dem neuen Turm auf jeder der vier Seiten ein Zifferblatt vorgesehen war - vorher war<br />
das nicht der Fall - ließ man im Hüttenwerk Wasseralfingen vier Uhrentafeln anfertigen. Aus<br />
123
einem Frachtbrief der Königlich Württembergischen Eisenbahn geht hervor, daß sie 400 Kilo<br />
wiegen. Sie kosteten 262 Mark.<br />
Der Umbau des Turmes wurden von dem Erlös des an die bürgerliche Gemeinde um 12 000<br />
Gulden verkauften Heiligenwaldes bestritten.<br />
Weitere Baumaßnahmen an der Kirche von 1879 bis heute:<br />
Um 1880 wurde auf der Kirchenbühne ein neuer, astloser Boden verlegt. Diese Bühne wurde<br />
zum Hopfentrocknen an <strong>Gechinger</strong> Bürger verpachtet. Das Regenwasser vom Kirchendach<br />
und Kirchplatz wurde in eine Dole geleitet.<br />
Ab 1892 wurde der Kirchplatz als Turnplatz für die Schüler genutzt. Er wurde mit Sand<br />
hergerichtet und mit Kastanienbäumen zum Sonnenschutz bepflanzt.<br />
1893 wurde die Kirche im Winter zum erstenmal beheizt mit eisernen Öfen, die ca. 900 Mark<br />
gekostet haben. Die Besucher, vor allem die Kinder, begrüßten diese Maßnahme.<br />
1914 wurde in der Kirche elektrische Beleuchtung eingerichtet.<br />
1928 bekam das Turmdach eine neue Bedeckung. Der damalige Schieferdecker beendete seine<br />
Arbeit mit einem Handstand auf dem Turmkreuz.<br />
Aus dem Tagebuch der Luise Weiß geb.Gehring: "Anfang Dezember 1921 sind auch zwei<br />
Ehrentafeln für unsere im Krieg gefallenen Helden in der Kirche angebracht worden, welche<br />
die Namen sämtlicher Gefallenen und Vermißten enthalten, 49 an der Zahl. Sodann wurden<br />
sämtliche Kränze (jeder Gefallene hatte seinen Lorbeerkranz) abgenommen und den<br />
Angehörigen übergeben. Es war ein schöner Schmuck der Kirche und wurde sehr vermißt."<br />
Nach dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges und den seit 1943 verstärkten feindlichen<br />
Luftangriffen mußte auch die Kirchengemeinde Gechingen die nötigen Einrichtungen für den<br />
Selbstschutz schaffen. Nach einer Besichtigung am 23.Juni 1943 wurde folgendes angeordnet:<br />
"1. Der Turm ist durch Brandbomben nicht leicht zu treffen, an dem steilen Dach prallen diese<br />
ab. Das Übergreifen eines Feuers aus dem Kirchenschiff kann durch das Anbringen einer<br />
Brandmauer in der Turmöffnung des Erdgeschosses und der Empore verhindert werden.<br />
2. Auf dem oberen Dachboden ist der Bauschutt zu entfernen. Fünf gefüllte Sandtüten sind am<br />
Treppenaufgang bereitzustellen.<br />
3. Im unteren Dachboden ist das gespaltene Holz in der Mitte aufzusetzen, loses Reisig ist zu<br />
entfernen.<br />
4. 10 gefüllte Sandtüten müssen am Eingang bereitgestellt werden. Desgleichen eine<br />
Luftschutzhandpumpe und ein Behälter mit mindestens 50 Liter Wasser, ferner zwei<br />
Feuerpatschen und eine Schaufel.<br />
5. Im Erdgeschoß sind neben jedem Eingang fünf Sandtüten und je eine Luftschutzhandpumpe<br />
und ein Behälter mit mindestens 50 Liter Wasser aufzustellen.<br />
6. Sämtliche Leuchten sind mit dunklem Stoff abzuschirmen.<br />
Vollzugsmeldung am 1. August 1943.<br />
Luftschutzleiter Schmidt, Pfarrer Lemp."<br />
Am 20. April 1945 richteten Fliegerbomben an der Kirche beträchtlichen Schaden an. Er<br />
wurde von der ganzen Gemeinde notdürftig behoben.<br />
Am 1. Mai 1951 wurden bei einer Bauschau größere Schäden an der Kirche festgestellt:<br />
Gestühl und Boden waren schadhaft, ebenso das Dach. Die Kirchenmauer hatte Risse, der<br />
Schlußstein im Torbogen im Turm gegen die Kirche zu hatte sich gesenkt. Am 21. September<br />
1953 begannen nach der Frühandacht die Abbrucharbeiten. Die alten Emporen sollten entfernt<br />
und die Orgelempore versetzt werden. Beim Abnehmen der Emporenbrüstungen stellte sich<br />
heraus, daß sie ursprünglich bemalt und später übermalt worden waren. Es handelte sich um<br />
biblische Darstellungen aus dem alten und neuen Testament, Christi Himmelfahrt und Jakobs<br />
Heirat. Auch die zwölf Apostel waren zu erkennen. Als die Orgelempore abgebrochen wurde,<br />
um die Mauer zu verlegen, kam ein alter beschrifteter Balken zum Vorschein, der die Stifter<br />
von Bildern aus der Barockzeit nennt. An der südlichen Langschiffwand war unter dem Putz<br />
124
eine Beschriftung vorhanden, u.a. fand man den Namen von Bürgermeister Schneider, der von<br />
1796 - 1828 sein Amt ausübte.<br />
Nach Räumung der Kirche von den riesigen Emporen kam die Schönheit des Kirchenschiffes<br />
erst richtig zur Geltung. Leider traten auch Schäden am Turm zutage, weshalb dieser<br />
unterfangen werden mußte. Der Turmbogen - er könnte eine frühere Chornische im Turm<br />
gewesen sein - mußte zugemauert werden, damit der Turm, dessen Fundamente nachgegeben<br />
hatten, wieder festen Halt bekam. Die Sakristeiwand wurde abgebrochen, um die Decke tiefer<br />
legen zu können. Die bis dahin bunten Kirchenfenster wurden durch helle, in fünf Farben<br />
leicht getönte, in Blei gefaßte, rechteckige Gläser ersetzt. Das runde Fenster über dem Altar,<br />
vor der Renovierung durch die Orgel verdeckt, wurde von der Kunstglaserei Saile als<br />
Buntfenster mit fünf biblischen Motiven gestaltet. Das Gestühl, das schon vor dem ersten<br />
Weltkrieg beanstandet worden war, wurde durch ein neues ersetzt und eine elektrische<br />
Heizung eingebaut.<br />
Die Arbeiten gingen nicht zuletzt dank des unermüdlichen Einsatzes Pfarrer Ulmers zügig<br />
voran, bereits am 25. Dezember 1953 konnte der Kirchsaal provisorisch eingeweiht werden<br />
und am Palmsonntag, dem 11.April 1954, weihte Prälat Schlatter die Kirche.<br />
Im Jahre 1960 wurden Renovierungsarbeiten am Kirchturm durchgeführt, der Turm erhielt<br />
auch einen neuen Verputz.<br />
1981 gedachte die Evangelische Kirchengemeinde der 1481 erfolgten Weihe der Kirche mit<br />
einem großen, mehrtägigen Fest, das von allen Seiten regen Zuspruch fand. Den Festvortrag<br />
hielt Professor Dr. Hansmartin Decker-Hauff; eine geistliche Abendmusik und ein großer<br />
Festgottesdienst seien als herausragende Aktivitäten genannt.1988 erfolgte mit einem<br />
Kostenaufwand von ca. DM 260.000.- die Erneuerung des Kirchendaches.<br />
Die Kirchturmuhr<br />
Die <strong>Gechinger</strong> Pfarrbeschreibung von 1827 stellte fest: "In dem Turm befindet sich eine Uhr,<br />
welche Viertel und Stunden schlägt." Dies galt seither als ältester Hinweis auf eine<br />
Kirchenuhr in Gechingen. Jetzt fand sich aber noch ein älteres Dokument über eine<br />
Kirchturmuhr und zwar eine Rechnung vom 22. April 1811: "Unterzeichneter Christian Karl<br />
Veiel hatte in Gechingen den 20. April 1811 die Uhr mit vier Werken auseinandergemacht<br />
und die Aufzugsräder mit Kloben befestigt. Das Werk wiederum zusammengesetzt. Samt der<br />
Versäumnis habe verdient zwei Gulden. Den 22. April war der Aufzugshaken an dem<br />
Viertelwerk abgebrochen, somit die Uhr wiederum auseinandergemacht, einen neuen Haken<br />
hineingemacht und das Werk zusammengesetzt. Samt dem Versäumnis habe verdient<br />
nochmals zwei Gulden, macht zusammen vier Gulden. Christian Karl Veiel, Schlosser und<br />
Uhrmacher in Calw."<br />
Im Jahr 1841 schaffte sich die Kirchengemeinde eine neue Uhr an. Der einheimische<br />
Schlossermeister Friedrich Gehring stellte sie her und gab 6 Jahre Garantie darauf: "Aber nur,<br />
wenn sie richtig aufgezogen und nicht den Schulbuben überlassen wird." Damals mußten die<br />
Uhren täglich aufgezogen werden, und die Lehrer, die dafür verantwortlich waren, übertrugen<br />
dieses Amt den Schulbuben, die dann wohl nicht immer sehr schonend mit dem Werk<br />
umgingen. Aus diesem Grund wurde die Pflege und das Aufziehen der neuen Uhr dem<br />
Schlosser Gehring übertragen. 1856 war jedoch eine umgreifende Reparatur der Uhr fällig.<br />
Die Kosten beliefen sich auf 60 Gulden. 1862 ist in der Inventarliste der Kirche (siehe diese)<br />
ausdrücklich "eine gute Uhr" erwähnt. Beim Umbau des Turmes wurden vier neue<br />
Uhrentafeln angeschafft, das Uhrwerk konnte man aber offenbar weiterhin verwenden.<br />
Im Jahr 1928 wurde dann eine neue Kirchenuhr erworben, die elektrisch aufgezogen wurde.<br />
Dem Mesner ersparte man damit die Mühe des täglichen Aufziehens. Die Kosten dieser Uhr,<br />
die die Firma Perrot aus Calw lieferte, beliefen sich auf RM 5 228.-. Unsere heutige<br />
125
Kirchturmuhr, im Jahr 1967 eingebaut und ebenfalls von der Firma Perrot geliefert, ist<br />
vollelektrisch und elekromechanisch. 1996 wurde die Uhr dann nochmals umgebaut, sie hat<br />
jetzt elektronische Funksteuerung.<br />
Die Glocken.<br />
Schon im Jahr 1495 bekam unsere Kirche ein Geläut. Es bestand aus drei Glocken, die alle<br />
von Bernhart Lachamann aus Heilbronn gegossen worden sind. Lachamann der Ältere war<br />
von 1481 - 1517 als Glockengießer tätig. Ihm folgte sein Sohn Bernhart von 1517 - 1524.<br />
"Der Typ ihrer Glocken ist stets derselbe, angefangen vom Körper der Glocke mit<br />
Kronenplatte auf doppelter Vorlage, schwach gerundetem Übergang der Haube zur Schulter,<br />
glatter Flanke und der Kronenbildung aus stets glatten Bügeln von rechteckigem Querschnitt<br />
und mit scharfem Knick. Die Inschrift aus klaren, breitgestalteten Minuskeln<br />
(Minuskelschriften bestehen ausschließlich aus kleinen Buchstaben) wird von einem<br />
Tatzenkranz eingeleitet und durch große paragraphen-förmigen Zeichen nach den einzelnen<br />
Wörtern getrennt. Das Schriftband wird von den glatten, derben Stegen durch freie Zonen<br />
geschieden." (Aus dem deutschen Glockenatlas von Württemberg-Hohenzollern.) Im Kreis<br />
Calw gab oder gibt es noch mehr Glocken von Lachamann, so in Zwerenberg (von 1494), in<br />
Stammheim (von 1505), in Sulz am Eck (von 1505) und in Wildberg (von 1511).<br />
Unsere größte Glocke hat ein Gewicht von 1 200 kg, einen Durchmesser von 1,20 m und eine<br />
Höhe von 88 cm. Ihr Ton ist F. Auf ihr steht: "0sanna heis ich, in unser Fraven Er levt ich,<br />
bernhart lachamann gos mich 1495." - Die mittlere Glocke wiegt 700 kg, hat einen<br />
Durchmesser von 102 cm und eine Höhe von 80 cm und klingt in As. Die Inschrift lautet:<br />
"Jesus nazarenus rex Judeorum (Jesus von Nazareth, König der Juden) bernhart lachamann<br />
gos mich 1495." Das Gewicht der kleinen Glocke ist nicht mehr bekannt. Die Ausführung war<br />
wie bei den beiden anderen, sie hatte den Ton B, und trug folgende Inschrift: "Hilf Jesus<br />
Maria. bernhart lachamann gos mich 1495." Das Geläut in den Tönen F, As und B ist kein<br />
harmonischer Klang, sondern ein melodisches Motiv, und zwar das Tedeum-Motiv. (Te deum<br />
laudamus = Dich, Gott, loben wir). Die drei Glocken blieben in Jahrhunderten unverändert in<br />
unserer Kirche.<br />
Im Jahr 1875 wurde wegen der Turmerhöhung der Glockenstock abgebrochen. Die Glocken<br />
ließ man auf den Kirchhof herunter und nach Fertigstellung des neuen Turmes zog man sie<br />
wieder hinauf; für diese Zeit sicher eine technische Meisterleistung. Gegen Ende des ersten<br />
Weltkrieges, 1918, mußte die kleinste Glocke zum Einschmelzen für militärische Zwecke<br />
abgegeben werden. Es wurde ein Antrag an die Behörden gestellt, in dem hieß es: "Der<br />
überaus seltene Fall eines vollständigen Geläutes von Bernhard Lachamann sollte zur<br />
Befreiung von der Abgabe Veranlassung geben." Aber dieser Antrag fand keine Zustimmung.<br />
Luise Weiß geb. Gehring schrieb dazu in ihr Tagebuch: "Am 31. Juli 1918 wurde die kleine<br />
Glocke heruntergenommen, wurde zu-sammengeschlagen und zum Schalladen<br />
hinausgeworfen. Erst auf den 15. Hammerschlag bekam sie den ersten Sprung. Sie wird zu<br />
Kriegszwecken verwendet und Menschen werden nun damit zusammengeschossen. Es ist<br />
traurig und zum Weinen, wenn man bedenkt, wieviel Freud und Leid seit 1495 die Glocken<br />
mit ihrem harmonischen Geläute so manches Menschenalter hindurch Erquickung gespendet<br />
haben."<br />
1923 konnte dann eine neue Glocke angeschafft werden. Dazu Luise Weiß: "Den 17. August<br />
1923 wurde wieder eine neue Glocke hinaufgemacht."<br />
Am oberen Rand der Glocke stand: "Hilf, Herr, aus dieser Not!", am unteren Rand: "Die<br />
Gemeinde Gechingen 1923". Die neue Glocke wog 400 kg. In der Mitte der Glocke befand<br />
sich ein rundes Bildchen mit einem Knaben, der in jeder Hand eine Glocke trug. Dieses<br />
126
Bildchen war mit: "Heinrich Kurtz in Stuttgart" signiert. Im zweiten Weltkrieg mußte auch<br />
diese Glocke wieder für Kriegszwecke hergegeben werden.<br />
Im Gemeindeblatt vom August 1939 lesen wir folgendes über die Glocken: "Die Klagen, daß<br />
sich die 11 Uhr-Glocke so schwer läuten lasse, kann nur von der mangelhaften Aufhängung<br />
der Glocke herrühren. Da wir auch einen außergewöhnlich starken Verbrauch an Glockenseil<br />
haben, fast jedes Jahr müssen die Seile erneuert werden, dieses Jahr wieder um 17 Mark, ist es<br />
nötig, die Glockenaufhängung baldmöglichst zu überprüfen. Glockengießer Kurtz, Stuttgart<br />
machte ein Gutachten und einen Kostenvoranschlag, woraus hervorgeht, daß bei der<br />
mangelhaften Aufhängung unserer beiden großen Glocken die Gefahr besteht, daß sie<br />
zerspringen. Außerdem werden durch die starken Stöße die Verzapfungen des Stuhles<br />
gelockert." Doch durch den Beginn des zweiten Weltkrieges mußten die notwendigen<br />
Reparaturarbeiten bis 1953/54 zurückgestellt werden, als bei der umfassenden Renovierung<br />
auch Schäden im Turm behoben wurden.<br />
Für die im 2. Weltkrieg abgelieferte kleine Glocke lieferte 1951 die Glockengießerei Kurtz<br />
aus Stuttgart eine neue Glocke mit einem Gewicht von 535 kg im Ton B und folgender<br />
Inschrift: "Gegossen ward ich in schwerer Zeit, um die gefallenen Helden trag ich Leid."<br />
Am 31. Dezember 1958 beschloß der Kirchengemeinderat die Anschaffung einer elektrischen<br />
Glockenläutanlage. Im Protokoll steht die Begründung: "Der Gesundheitszustand der<br />
Mesnerin, deren Dienst sich die Gemeinde so lange als möglich erhalten möchte, macht<br />
diesen Beschluß notwendig." Die Rede ist hier vom unvergessenen "Kasper-Rösle", an das<br />
sich heute noch viele <strong>Gechinger</strong> freundlich dankbar erinnern.<br />
Unsere Glocken läuten zur Zeit nicht nur zur Einladung zum Gottesdienst. Die Morgenglocke<br />
ertönt um 7.00 Uhr und will zum Morgengebet wecken. Das Läuten um 11.00 Uhr soll auf die<br />
einbrechende Finsternis bei der Kreuzigung Jesu hinweisen. Früher war es auch ein Signal für<br />
die auf den Feldern arbeitenden Frauen, heimzugehen und das Mittagessen zu kochen. "Elfe,<br />
Weib, koch! Zwölfe wird´s doch", heißt ein bekannter Spruch. Das Läuten um 15 Uhr soll<br />
zum Gedenken an die Todesstunde Jesu mahnen. Die Abendglocke, im Winter um 16.30 Uhr,<br />
im Sommer um 20.30 Uhr, erinnert an die Stunde des Begräbnisses Jesu. Dieses Abendläuten<br />
hieß "Uffemärgeläuda" von "Ave Marialäuten" und war das Signal für Kinder und<br />
Jugendliche, schnell nach Hause zu gehen. Lange Zeit war es bei uns üblich, daß man beim<br />
Läuten der Glocken die Arbeit im Haus oder auf dem Felde unterbrochen und die Hände zum<br />
Gebet gefaltet hat. Das Gebet beim Läuten der Abendglocke lautet:<br />
"Mensch bedenk, was das bedeutet,<br />
daß man diese Glocke läutet.<br />
Es bedeutet abermals<br />
unsres Lebens Ziel und Zahl.<br />
Sieh, der Tag hat abgenommen,<br />
bald wird auch der Tod herkommen.<br />
Darum Mensch, o schicke dich,<br />
daß du sterbest seliglich.<br />
Befiehl dem Engel, daß er kommt<br />
und uns bewach, dein Eigentum.<br />
Schick uns den lieben Wächter zu,<br />
daß wir vorm Satan haben Ruh.<br />
So schlafen wir im Namen dein<br />
und laß die Englein bei uns sein<br />
und die heilige Dreieinigkeit.<br />
Wir loben dich in Ewigkeit."<br />
1996 wurden die beiden großen Glocken und der Glockenstuhl gründlich überholt, zum Teil<br />
waren die Arbeiten schon 1939 für notwendig erachtet worden. Durch jahrhundertlanges<br />
127
Schlagen waren im Metall Spannungen aufgetreten, die mit der Zeit zum Zerspringen der<br />
Glocken geführt hätten. In einer mehrtägigen Prozedur wurden durch vorsichtiges Erhitzen<br />
auf 600°C im Holzkohlenfeuer die Spannungen gelöst. Am unteren Rand der Glocken, dem<br />
Schlagring, waren die Glocken so beschädigt, daß mehrere Kilogramm Bronze aufgeschweißt<br />
werden mußten; die Klöppel wurden durch neue ersetzt.<br />
An die Stelle der verrosteten Blechschalläden kamen neue aus Eichenholz, und die Stahljoche,<br />
an denen die Glocken seither aufgehängt waren und die gleichfalls in schlechtem Zustand<br />
waren, wurden durch schwere Eichenholzjoche ersetzt. Beide Maßnahmen dienen zugleich<br />
der Verbesserung des Glockentons.<br />
Da sich gezeigt hatte, daß die drei Läutemaschinen, die senkrecht über dem Glockenstuhl<br />
angebracht worden waren, die Turmschwingungen verstärkt hatten, wurden neue Läutemaschinen<br />
auf einen Balkenausleger am Glockenstuhl montiert. So können die Schwingungen<br />
sich nicht vom Glockenstuhl auf den Turm übertragen.<br />
Die Kosten für Reparaturen an Glocken, Uhr und Turm werden je zur Hälfte von der<br />
bürgerlichen Gemeinde mitgetragen. Das geht auf das Jahr 1890 zurück, als Grundstücke und<br />
Geldvermögen aus dem Besitz der Kirche an die bürgerliche Gemeinde übergingen, um z. B.<br />
die Armenpflege zu finanzieren. Die Kirchengüter waren aber größer als die damit<br />
übernommenen Verpflichtungen, deshalb wurde vertraglich festgelegt, daß die bürgerliche<br />
Gemeinde künftig für die Hälfte der Reparatur- und Unterhaltskosten für Glocken, Uhr und<br />
Turm aufkommen muß.<br />
Die Orgel<br />
Orgeln in den Dörfern kamen erst im 17. und 18. Jahrhundert auf. Bis dahin wurde der<br />
Gesang in der Kirche von sogenannten Vorsängern angeführt, meistens vom Lehrer und von<br />
Schülern. Der älteste Hinweis auf eine Orgel in unserer Kirche ist 1751 zu finden. Um 9<br />
Gulden für jedes Register wurde sie repariert. Die nächste Reparatur war 1759 fällig.<br />
70 Jahre später wird in einer Pfarrbeschreibung erwähnt, daß in der Kirche eine "gute Orgel"<br />
stehe. Es ist vermutlich in der Zwischenzeit eine neue Orgel angeschafft worden, denn damals<br />
konnte man noch keine so dauerhaften Orgeln bauen wie heute.<br />
1842 kaufte man eine neue Orgel mit 11 Registern. Viktor Gruol aus Bissingen, vermutlich<br />
der Orgelbauer, spielte am 1. Advent 1842 zum ersten Mal auf dem Instrument. Ein Jahr<br />
später wurde die Orgel für 100 Gulden lackiert und reich vergoldet. Diese Gruolorgel hatte,<br />
wie auch die anderen aus dieser Werkstatt, einen warmen und tiefen Ton, der dem<br />
Zeitgeschmack nicht entsprach. 32 Jahre später mußte sie wegen angeblich schlechter Qualität<br />
einer neuen weichen. Die neue Orgel mit 16 Registern wurde dann auch bemalt und vergoldet,<br />
laut Rechnung von 1875 zum Preis von M 293,74. Diese Orgel steht nach vielen Reparaturen,<br />
Änderungen und Erweiterungen bis zum heutigen Tag in unserer Kirche. Sie hat einen<br />
wunderbaren Klang und funktioniert noch immer.<br />
Luise Weiß geb. Gehring schreibt in ihrem Tagebuch: "Im Sommer 1917 holten sie hier<br />
unsere schönen Orgelpfeifen und das Rathausglöckle zu Kriegszwecken, zum Erschießen so<br />
vieler junger braver Männer und Familienväter. Das Herz blutet einem, ja man könnte sich<br />
blind weinen bei so vielen traurigen Hiobsbotschaften. Unsere Kirchenglocken dürfen wir<br />
vorerst behalten, weil es ein vollständiges Geläute ist und hohen Kunstwert hat." Ein paar<br />
Seiten weiter steht: "Im Dezember 1921 sind wieder Orgelpfeifen angebracht worden, worauf<br />
jetzt eine Schuld von 3 000 Mark ruht, trotz Opfer und Kirchenkonzert."<br />
1932 wurde ein Orgelmotor eingebaut, doch bis Anfang der fünfziger Jahre wurde der<br />
Blasebalg noch von den Schülern getreten, was auch heute noch bei Stromausfall möglich ist.<br />
Um 1958 erstellte die Orgelfirma Weigle ein Positiv mit 3 Registern zur Verstärkung des<br />
zweiten Manuals, das an der Brüstung vor dem Spieltisch aufgestellt wird. Die zwei räumlich<br />
von einander getrennten Registergruppen sind eine große Seltenheit.<br />
128
Im Spätsommer 1992 wurden Wartungsarbeiten an der Orgel durchgeführt, sie wurde<br />
überholt, gereinigt und anschließend frisch gestimmt.<br />
Die Rolle der Kirche im dörflichen Leben<br />
Etwa seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts sind genügend schriftliche Zeugnisse aus dem<br />
Alltagsleben erhalten, daß wir uns in groben Zügen ein Bild von dieser Zeit machen können.<br />
Eine besonders gute Quelle dafür sind die Kirchenkonventsprotokolle. Der Kirchenkonvent<br />
war eine Aufsichtsbehörde, die 1644 landesweit eingeführt worden war, um der Verwilderung<br />
der Sitten durch den Dreißigjährigen Krieg gegenzusteuern. Den Vorsitz führten Pfarrer und<br />
Schultheiß gemeinsam, die Beisitzer wurden von den Vorsitzenden bestimmt. Der<br />
Kirchenkonvent traf sich in gewissen Zeitabständen. Er hatte vor allem die Aufgabe eines<br />
Sittengerichts. Die Heilighaltung des Sonntags und der Besuch der Gottesdienste und des<br />
Abendmahls wurden kontrolliert. Zuspätkommen und Schwatzen beim Gottesdienst wurden<br />
streng geahndet. Eigens aufgestellte und vereidigte Personen, die "Kirchenrüger", hatten das<br />
zu überwachen, Kontrollgänge während des Gottesdienstes durch den Ort zu machen und alle<br />
Vergehen dem Konvent zu melden. Der Kirchenkonvent wandte sich gegen das Tanzen und<br />
Spielen, gegen Wirtshausbesuche, gegen Fluchen, Lärmen und Zanken. Darüberhinaus fühlte<br />
sich der Kirchenkonvent verantwortlich für das Bestellen von Pflegern und Vormunden,<br />
Versorgen der Ortsarmen, Aufsicht über die Lehrherren und Lehrlinge sowie die gesamte<br />
Schulverwaltung. Alle Verstöße gegen die Regeln der kirchlichen und weltlichen<br />
Gemeinschaft, vom Einschlafen während der Predigt bis zum Umgang der Geschlechter<br />
miteinander, vom Wasserholen am Brunnen bis zum Ehestreit, wurden durch den Konvent<br />
unter Vorsitz des Ortsgeistlichen untersucht und gegebenenfalls bestraft. Der Konvent konnte<br />
sogar Einweisungen bis zu drei Tagen in den Ortsarrest verfügen. Die eingehenden Strafgelder<br />
gingen an die Kirchenkasse.<br />
Aber auch Hilfe für Notleidende und Arme kam vom Kirchenkonvent. Während der Hungerjahre<br />
von 1845 - 1852 nahm die Kirchengemeinde eine Schuld von 500 Gulden auf, um die<br />
schlimmste Zeit, bis staatliche Hilfe vom Kamaralamt (Finanzamt) kam, zu überbrücken.<br />
1852 beschloß der Kirchenkonvent, eine Suppenanstalt einzurichten. Die weltliche Gemeinde<br />
weigerte sich, weil sie den Kirchenkonvent nicht als gesetzliche Armenbehörde anerkennen<br />
wollte.<br />
Die Einrichtung des Kirchenkonvents bestand etwa 200 Jahre lang. Ab 1855 löste der Pfarrgemeinderat,<br />
aus dem 1886 der Kirchengemeinderat hervorging, den Kirchenkonvent ab.<br />
Schon zuvor hatte das weltliche Polizeirecht einige seiner Befugnisse übernommen. Die<br />
freieren Anschauungen, die sich während des 19.Jahrhunderts entwickelt hatten, machten<br />
einen gewissen Wandel in der Bedeutung und in den Aufgaben der kirchlichen Behörde<br />
notwendig.<br />
Geblieben sind die Protokolle des Kirchenkonvents als Zeugnisse der Zeit. - So war es um<br />
1800 auch in Gechingen Brauch, daß sich die ledigen jungen Mädchen und Burschen abends<br />
zum Spinnen und zum Schwatzen trafen. Bei diesen Treffen, den sogenannten "Lichtkärzen",<br />
kam es häufig zu "Unfug", so daß der Kirchenkonvent einschritt. Eine Entscheidung des<br />
<strong>Gechinger</strong> Kirchenkonvents vom 22. Januar 1798 lautete:<br />
"Untersuchung wegen der "Licht-Kärze", welche im hiesigen Ort bisher sehr gewöhnlich<br />
gewesen und wobei schon soviel Unfug verübt worden ist, wird folgende Verordnung<br />
gemacht:<br />
1. Ohne erhaltene Erlaubnis von dem Kirchenkonvent darf durchaus keine Licht-Karz oder<br />
Licht-Gang gehalten werden.<br />
2. Das Kirchenkonvent darf aber Licht-Kärzen nur solchen Hausvätern und nur in solchen<br />
Häusern gestatten, welche unbescholten sind und wo durchaus kein Unfug geduldet wird.<br />
129
3. Es dürfen nur acht Personen ohne die Hausgenossen erscheinen.<br />
4. Diese acht Personen dürfen nur weiblichen Geschlechts sein.<br />
5. Mannsleut und besonders ledige Burschen dürfen bei empfindlicher Strafe nicht erscheinen.<br />
6. Die ledigen Mädchen müssen ihre Mütter mitbringen.<br />
7. Die Nachtwächter und Scharwärter sind angehalten, diese Licht-Kärze fleißig und öfters zu<br />
besuchen.<br />
8. Sollen noch zwei Personen, vom Magistrat benannt, nämlich Richter Kraft und Ratsverwandter<br />
Maier, den Licht-Kärzen beiwohnen und ihre unparteiische sorgfältige<br />
Aufmerksamkeit auf alle Übertretungen zu haben und diese sogleich beim Pfarramt anzeigen,<br />
wo es dann der Kirchenkonvent exemplarisch abbestraft.<br />
Das Oberamt zu Merklingen, der Schultheiß und Magistrat zu Gechingen, der Pfarrer zu<br />
Gechingen."<br />
Noch 1872 durfte die Lichtkarz nur in den Häusern gehalten werden, in denen keine<br />
Schulkinder wohnten.<br />
Aus der Lichtkarz entwickelte sich später der "Außelauf", bei dem sich auch ältere Leute<br />
trafen. Man strickte, flickte, häkelte und stickte, tauschte Neuigkeiten aus und die Älteren<br />
erzählten von früher.<br />
Aus dem Kirchenkonventprotokoll vom 8. Jan. 1773:<br />
"1. Michael R. wurde herbeordnet, weil er am Thomastag nach Stuttgart zu Markt gefahren<br />
und trotz Verbot nicht zu Hause geblieben ist. Deshalb wird er um 1/2 Pfund Heller bestraft.<br />
2. Zur Rede gestellt wurde die Witwe des Johannes B. wegen mancherlei Unarten und<br />
Unordnungen, die in ihrem Hause vorgegangen sind. Sie wird ernstlich verwarnt."<br />
In der Pfarregistratur wird eine Aufzeichnung von Pfarrer Christoph Heinrich Klinger über<br />
den Reformationstag am 31.10.1817 aufbewahrt, der besonders festlich begangen wurde, weil<br />
es sich um den 300. Jahrestag der Reformation handelt.<br />
"Die Kirche wurde aus- und inwendig gereinigt und geweißelt. Vor dem Haupttor waren zwei<br />
Rottannen befestigt, die mit Girlanden aus Reis und Blumen umhängt waren, ebenso die vier<br />
Ecken des Altars. Auf der Kanzel zierte das bemalte Brustbild Dr. Luthers ein grüner Kranz<br />
mit schönen Blumen. Der Haupteingang und einzelne Stühle in der Kirche waren mit<br />
rottannenen Mayen von Laub und Blumen behängt, welches alles einen rührenden Anblick<br />
gewährte. Um 1/2 10 Uhr fing der Gottesdienst an. Eine Prozession vom Rat- und Schulhaus<br />
aus begab sich in die Kirche. Zuerst die kleinen Schülerknaben, dann die kleinen<br />
Schülermädchen mit einem Lehrer, gefolgt von den großen Knaben und den großen Mädchen.<br />
Dann kamen die ältesten Sonntagsschüler, der Knabe den Kelch, das Mädchen die Bibel<br />
tragend und die anderen Sonntagsschüler und Schülerinnen. Es folgten die Geistlichen,<br />
Magistrat, Bürgerausschuß, alle paarweise. Die Gemeinde schloß sich größtenteils an."<br />
Die Pfarrer waren früher verpflichtet, alle paar Jahre über ihren Ort in einem Pfarrbericht ihrer<br />
vorgesetzten Behörde Auskunft über das kirchliche Leben im Ort zu geben. Nachfolgend<br />
einiges aus den Pfarrbeschreibungen der Jahre 1892 - 1910. Im Jahre 1892 waren alle 1208<br />
Einwohner Gechingens evangelisch. Die Gottesdienste waren morgens immer sehr gut<br />
besucht, zu den Mittagsandachten kamen überwiegend Frauen. Die Abendbetstunden wurden<br />
im Jahre 1892 fast nur von Frauen besucht, die Männer kamen erst ab dem Jahr 1894, als der<br />
Pfarrer in diesen Stunden auch über die politische Lage und die Geschichte sprach. 30 - 50<br />
Männer besuchten dann die Bibelstunden. Mit der Einhaltung der Sonntagsruhe waren die<br />
Pfarrer im großen und ganzen zufrieden, sie beklagen nur, daß an den Feiertagen gearbeitet<br />
wird, sogar Mist wird aufgeladen! Die sonntägliche Stille wird darauf zurückgeführt, daß die<br />
<strong>Gechinger</strong> allgemein als "sehr mäßig und nüchtern im Trinken (wohl aus Sparsamkeit!)"<br />
beschrieben werden. Erwähnenswert fand der Pfarrer 1910 die <strong>Gechinger</strong> Verwandtschaft.<br />
Wer irgendwie miteinander verwandt ist, hält zäh zusammen. Dabei ist so ziemlich die ganze<br />
130
Gemeinde unter sich verwandt. Die Familiennamen Böttinger, Breitling, Dingler, Gehring<br />
machen weitaus die Mehrzahl der Bewohner aus. Über das Familienleben in Gechingen<br />
äußerte er 1910 sehr lobend, während 1892 folgende Episode erwähnt wird: "Eine Frau kam<br />
klagend zum Seelsorger, sie werde geschlagen von ihrem Mann. (Sehr böses Maul, hat's<br />
ehrlich verdient.) Der Grund der Ehezwistigkeiten scheint der Geld- und Herrschaftsteufel zu<br />
sein, weniger das Saufen und eheliche Untreue." Auch beklagt sich der gleiche Pfarrer über<br />
die relativ vielen unehelichen Geburten. "Diese sind in der Regel Großstadt-Sünden, die<br />
Mädchen sind in Stuttgart, Pforzheim, Frankfurt als Mägde, haben dann ihr Wochenbett hier<br />
und lassen das Kind bei den Eltern in Kost."<br />
Aus einem Pfarrbericht des Jahres 1905 erfahren wir über die kirchlichen Bräuche zu dieser<br />
Zeit:<br />
Taufe<br />
Taufen werden zum größten Teil während der sonntäglichen Christenlehre vollzogen.<br />
Haustaufen kommen äußerst selten vor. Seit 1902 wird eine Gebühr von 2 Mark für die Taufe<br />
erhoben, nur uneheliche Kinder werden kostenlos getauft.<br />
Konfirmation<br />
Vor der Konfirmation wird die Kirche von den Konfirmanden geschmückt. Die Mädchen<br />
reinigen die Kirche und verfertigen Kränze. Die Knaben bringen in der Kirche<br />
Tannenbäumchen und Girlanden an. Die Kinder erhalten bei der Einsegnung Denksprüche,<br />
jedes Kind wird einzeln eingesegnet. Am Konfirmationstag besteht die nicht auszurottende<br />
Sitte, daß Verwandte und Bekannte den Kindern kleine Geldbeträge ins Haus bringen. Am<br />
Nachmittag wird häufig vom Pfarrer und Lehrer mit den Konfirmanden ein kurzer<br />
Spaziergang gemacht. Am Sonntag nach der Konfirmation nehmen die Konfirmanden das<br />
erste Mal am Abendmahl teil und werden am Nachmittag ins Pfarrhaus, Knaben und Mädchen<br />
gesondert, eingeladen. Sie erhalten dort ein Konfirmandentestament.<br />
Hochzeiten<br />
Bei Trauungen mit Hochzeitspredigt wird zum Beginn des Gottesdienstes ein beliebiges Lied<br />
gesungen. Nach Gebet und Segenswunsch zum Anfang der Trauung "Von Dir, Du Gott der<br />
Einigkeit ", nach der Trauung: "So segne sie . . . ". Bei stillen Hochzeiten findet nur ein<br />
Orgelspiel statt. Stille Hochzeiten dürfen auch an Samstagen und Sonntagen stattfinden,<br />
andere Hochzeiten an diesen Tagen nicht. Es bereitete anfangs Schwierigkeiten, dem<br />
Eindringen der Samstagshochzeiten zu wehren. Traubibeln werden seit 1860 unentgeltlich<br />
ausgegeben. Der Pfarrer beteiligt sich an der weltlichen Feier, die fast ausnahmslos im<br />
Wirtshaus stattfindet, nicht.<br />
Bestattungen<br />
Bis 1882 war es üblich, daß Pfarrer und Lehrer am Grab eine Rede hielten. Dies wurde durch<br />
Beschluß des Pfarrgemeinderates abgeschafft, so daß nur noch der Pfarrer die Grabrede hält.<br />
Die gewöhnliche Zeit für Beerdigungen ist mittags 1 Uhr, für Kinderbeerdigungen<br />
nachmittags. Lehrer und Sänger gehen um 1 Uhr unter Geläute an das Trauerhaus, wo einige<br />
Verse gesungen werden. Darauf setzt sich der Leichenzug unter dem Geläute aller Glocken in<br />
Bewegung, voran die Schüler mit dem Lehrer, dann die Träger mit dem Sarg, dahinter die<br />
Männer, sodann die Frauen. Ein- bis zweimal wird unterwegs abgestellt und gesungen, wobei<br />
das Geläute pausiert. Der Pfarrer schließt sich bei der Kirche dem Zug an, er folgt unmittelbar<br />
hinter dem Sarge. Am Grabe beginnt die Feier mit dem Gesang der Schüler, hierauf folgt<br />
Eingangsgruß, Gebet, Rede ohne förmlichen Lebenslauf. Gebet, Vaterunser, Versenkung des<br />
Sarges mit Gesang und Einsegnung folgen. Bei kleineren Kindern nachmittags beteiligt sich<br />
kein Lehrer und kein Chor. Ein Leichentrunk ist hier nicht üblich.<br />
131
Kirchenchor und Posaunenchor<br />
Ein Kirchenchor besteht seit 1884. Es nehmen daran einige Männer und eine größere Anzahl<br />
Frauen teil. Geleitet wird er vom Lehrer, der zugleich Organist ist. Der Kirchenchor singt an<br />
den Festtagen, außerdem auch bei Trauungen und Begräbnissen. Soviel aus dem Jahre 1905.<br />
Den Kirchenchor gibt es heute noch, er umfaßt ca. 35 Sängerinnen und Sänger und wird seit<br />
Jahren von Herrn Kasper geleitet. Darüber hinaus gibt es in Gechingen noch einen<br />
Begräbnischor, welcher nur an Beerdigungen singt.<br />
Seit 1967 hat die Evangelische Kirchengemeinde Gechingen einen Posauenchor mit etwa 30<br />
Mitgliedern. Ebenso wie der Kirchenchor umrahmt der Posaunenchor die Gottesdienste. Sehr<br />
beliebt ist auch das "Ständchen", das der Posaunenchor allen Mitbürgern ab dem 80. Lebensjahr<br />
darbringt. 1992 konnte der Chor sein 25jähriges Jubiläum mit einem Festgottesdienst und<br />
einem Bläserkonzert feiern.<br />
Evangelisches Gemeindeblatt<br />
Der damalige Pfarrer Andler brachte im Oktober 1905 ein "Evangelisches Gemeindeblatt für<br />
Gechingen" heraus, das bis 1908 erschien. Eine Spalte auf der vierten Seite berichtete über<br />
Begebenheiten aus der Ortschronik von Paul Heinrich Andler. Der Preis betrug 36 Pfennig im<br />
Jahr bei 12 Ausgaben. 1906 hatte das Blatt in Gechingen 135 Abnehmer. Das Blatt ging aus<br />
finanziellen Gründen ein.<br />
Pfarrer Reusch begann am 1.1.1936 wieder neu, bis er 1941, als aus kriegswirtschaftlichen<br />
Gründen (Papierknappheit) das Erscheinen einstellen mußte.<br />
Der Friedhof<br />
Bis zur Anlegung des heutigen Friedhofes war der "Kirchhof" um die Kirche herum die<br />
Begräbnisstätte für die <strong>Gechinger</strong> Bürger. Es handelt sich um den Bereich des Schulgartens<br />
südlich der Kirchhofmauer und westlich des abgebrochenen Feuerwehrgerätehauses, wo heute<br />
das Gemeindehaus steht. Vielleicht hat mancher beim Blättern im Buch "Heimat Gechingen"<br />
auf Seite 63 die Abbildung Alt-Gechingens aus dem Kieser'schen Forstlagerbuch von 1681<br />
betrachtet. Dort ist die Mauer des alten Kirchhofes um die Kirche noch zu sehen.<br />
Der jetzige Friedhof wurde im Jahre 1730 angelegt. Für unsere Ahnen mag es nicht leicht<br />
gewesen sein, die Toten nicht mehr im Schatten der Martinskirche zu bestatten, sondern auf<br />
einen geeigneten Platz auf freier Feldmark auszuweichen. Der war am südlichen Hang<br />
oberhalb der Wolfswiesen gefunden und bald mit einer festen Mauer von Kalksteinen<br />
umgeben. Der Eingang wurde wohl erst später erweitert und war anfangs wahrscheinlich mit<br />
einem Holztor verschlossen. 1813 - 14 mußte der Friedhof wesentlich erweitert werden.<br />
Damals erwarb man um 135 Gulden ein Grundstück von Johannes Rüffle. Es galt nun, den<br />
neuen Teil dem vor-handenen Friedhof anzugliedern. Die Gemeinde wollte eine Mauer<br />
errichten, das Kameralamt Hirsau, als die zuständige Finanzverwaltung, befürwortete einen<br />
Wall mit Graben. Der Wall hätte dann mit einer Hecke bepflanzt werden sollen. Das aber<br />
lehnten die <strong>Gechinger</strong> ab. Sie fürchteten den Spott der lieben Nachbarn, wenn sie einen<br />
Kirchhof besessen hätten, der halb mit einer Hecke und halb mit einer Mauer umgeben<br />
gewesen wäre. Der offizielle Einwand aber war, daß die Toten so nicht genügend verwahrt<br />
seien und das zu Aberglauben Anlaß geben könnte, außerdem wäre den Wildschweinen kein<br />
Halt geboten. Dem Einspruch wurde stattgegeben, die Gemeinde bekam ihre Mauer bewilligt.<br />
Am Beginn des neuen Teils ist die Jahreszahl 1814 beim westlichen Ende des alten Friedhofes<br />
in einem Stein in der Außenmauer eingemeißelt.<br />
Wann die erste Grablegung im erweiterten Teil des Friedhofs stattgefunden hat, ist nicht<br />
bekannt. Unser Friedhof ist nicht reich an historischen Grabstätten, deshalb sollten die<br />
132
wenigen wertvollen Zeugen der Vergangenheit festgehalten werden. An der mittleren<br />
Quermauer sind zwei Gedenkplatten eingelassen, von denen die eine die lapidare Inschrift<br />
trägt: "Vater Klinger, gestorben 1830". Unmittelbar neben dem Brunnen findet man eine Tafel<br />
mit der Inschrift: "G. A. Hartmann, 43 Jahre Schullehrer dahier von 1788 - 1831, geb. am 1. 9.<br />
1764, gest. 17. 12. 1831". Von dem Hartmann'schen Denkstein sind es nur wenige Schritte bis<br />
zu dem auf eigenem Boden stehendem Erbbegräbnis der Familien Schumacher - Ziegler. Auf<br />
dem Schild am Eingang steht: "Die Stifter für die Familie sind Georg Ludwig Schumacher<br />
und Magdalene 1851". Am östlichen Mauerrand befinden sich zwei geborstene Platten. Auf<br />
der einen stand: "Johann Georg Kappis, drei Jahre Schultheiß hier (1828 - 1831) geb.<br />
26.1.1780 und fand ihre Ruhestätte neben ihm seine Ehefrau Catharine Barbara geb. Rüffle".<br />
Ein weiterer Zeuge aus alter Zeit ist der wuchtige Gedenkstein Gehring im Friedhof. Die<br />
Beschriftung dieses Steines stammt wahrscheinlich von Pfarrer Klinger, denn das geschilderte<br />
Unglück geschah im Jahr 1827, während dessen Amtszeit in Gechingen. Vikar Klinger, der<br />
Sohn, hat laut Inschrift die Leichenpredigt gehalten. Der auf den vier Seiten des Steines<br />
verteilte Text liest sich im Uhrzeigersinn:<br />
1. Seite: "Hier ruht die zerschlagene Hülle des schnell endenden Mitbruders Joh. Michael<br />
Gehring. Geschehen den 19.April 1827."<br />
2. Seite: "Nicht weit von dieser stillen Stätte, wo mein zerschlagener Körper ruht, fand ich ein<br />
schnelles Sterbebette durch eines scheuen Tieres Wuth. War gleich gewaltsam schnell mein<br />
Ende, kam doch mein Geist in Gottes Hände."<br />
3. Seite: "Seinem ihm unvergeßlichen Vater und dem neben ihm ruhenden Kinde weiht diß<br />
Denkmal der Liebe der dankbare Sohn, Johann Michael Gehring."<br />
4. Seite: "Leichentext genommen von Vicar Klinger aus Klagelieder Jeremia, im 3. Kapitel<br />
der 1., 4. und 24. Vers. Ich bin ein elender Mann usw."<br />
Es handelte sich um Johann Michael Gehring, geboren am 9.8.1759, verheiratet am<br />
12.11.1782 mit Agnes Katharina geb. Rüffle. Sie hatten zwei Kinder, Marie Katharine, geb.<br />
13.8.1783 und Johann Michael, geb. 1.8.1788, der ihm den Gedenkstein setzte. Das "neben<br />
ihm ruhende Kind" ist wahrscheinlich die kleine Enkelin Gottliebin, die am 21.5.1827 im<br />
Alter von acht Monaten starb, eine Tochter Johann Michael Gehrings junior.<br />
Die nächste größere Erweiterung des Friedhofes fand im Jahre 1964 statt, notwendig<br />
geworden durch die steigenden Einwohnerzahlen. Die Fläche vergrößerte sich um das<br />
Doppelte. Gleichzeitig baute man eine Leichenhalle, wie schon lange geplant war. Nun<br />
konnten auch Aussegnungen auf dem Friedhof durchgeführt werden. Am Totensonntag 1965<br />
wurden die Halle und das Ehrenmal für die Toten eingeweiht.<br />
1979 und 1988 wurden durch das rasche Bevölkerungswachstum erneut Erweiterungen nötig.<br />
1989 entstanden nochmals 44 neue Grabplätze.<br />
1980 machte der <strong>Gechinger</strong> Friedhof Schlagzeilen in der Presse. Eine auswärtige junge Frau<br />
wurde hier unter falschem Namen beerdigt. Einige Zeit später wurde der Leichnam wieder<br />
ausgegraben, um das Rätsel seiner Herkunft zu klären.<br />
Evangelisches Gemeindehaus<br />
Bereits 1936 rief Pfarrer Reusch zu Spenden für ein Gemeindehaus auf. Dieses Haus sei für<br />
die kirchliche Gemeindearbeit unbedingt nötig. 1938 gründete Pfarrer Lilienfein einen Verein<br />
zum Bau eines Gemeindehauses, der aber von der Gestapo wieder verboten wurde. Erst 1983<br />
konnte die Kirchengemeinde den Bau dann in Angriff nehmen. Auf dem Platz der früheren<br />
Schule zwischen Pfarrhaus und altem Rathaus entstand das neue Gebäude. Im Oktober 1984<br />
war das Richtfest. Die Kosten beliefen sich nach Fertigstellung des Gebäudes auf 1,6<br />
Millionen DM reine Baukosten, von denen ein großer Teil durch tatkräftige Mithilfe von<br />
Gemeindemitgliedern und die Kirchengemeinde Gechingen aufgebracht wurde. Das Haus<br />
dient der Jugendarbeit, auch Chorproben, Altennachmittage, Hauskreise und<br />
133
Gemeindesonntage werden darin abgehalten. In der angenehmen und freundlichen<br />
Atmosphäre fühlen sich alle <strong>Gechinger</strong> zu Hause.<br />
Das Pfarrhaus<br />
Aus verschiedenen Unterlagen zur Pfarrerbesoldung geht hervor, daß das Stift zu Baden das<br />
Pfarrhaus samt Scheuer zu unterhalten hatte. Der Amtmann zu Merklingen, Leonhart<br />
Breitschwerdt, verfertigte eine detaillierte Besoldungsliste über das Einkommen der<br />
<strong>Gechinger</strong> Pfarrer, nachdem sich nach Pfarrer Wagner (Pfarrer in Gechingen von 1562-66)<br />
auch sein Nachfolger über die zu geringen Einkünfte beschwert hatte. Darin stellt er fest:<br />
"Item er (der Pfarrer) hat auch Behausung . . . nach aller nothdurft . . " Ebenso berichtet<br />
Pfarrer Heinrich Christoph Klinger in einer Pfarrbeschreibung ca. 250 Jahre später über das<br />
"Collegiat-Stift Baden, dem auch die Erbauung und Erhaltung der Pfarrwohnung zukam."<br />
Das Pfarrhaus steht neben der Kirche in einem großen Garten. Es wurde erbaut um 1677,<br />
nachdem man das alte Gebäude bis auf die Grundmauern abgerissen hatte.<br />
Im Jahr 1830 wurde das Pfarrhaus gründlich umgebaut und renoviert. Das Haus hatte früher in<br />
seinem Untergeschoß landwirtschaftliche Räume. Zur Pfarrei gehörte nämlich das<br />
Widdumgut, das Pfarrgut, zu beiden Seiten des Furtbaches sowie die Einkünfte des halben<br />
Heuzehnten. Auf dem Widdumgut lag die Pflicht zur Haltung eines Ebers. Der Pfarrer hatte<br />
auch das Recht, auf der Gemeindewiese 6 Stück Rindvieh und 25 Schafe weiden zu lassen.<br />
Allerdings mußte er sich auch anteilsmäßig an den Unkosten für den Hirten beteiligen. Diese<br />
Verhältnisse veränderten sich radikal, als 1827 die Pfarrgüter in Gechingen zum größten Teil<br />
verkauft, der Erlös zur Staatskasse eingezogen und die Zinsen "als ein künftiger<br />
Pfarrbesoldungstheil zur Geldbesoldung des Pfarrers geschlagen" wurden, wie es in einer<br />
"Note der Königlichen Finanzkammer des Schwarzwaldkreises an das evangelische<br />
Consistorium in Stuttgart" vom Dezember 1827 heißt. (Siehe auch "Auction im Pfarrhause"<br />
bei Pfarrer Christoph Heinrich Klinger 1827). Mit dem Wegfall des größten Teils der<br />
Landwirtschaft entsprach das Pfarrhaus den veränderten Gegebenheiten nicht mehr.<br />
Die Kosten des Umbaues 1830 beliefen sich auf: Maurer 540 Gulden, Gipser 80 Gulden,<br />
Schlosser 184 Gulden, Hafner 3 Gulden, Maler 85 Gulden, Pflästerer 27 Gulden, insgesamt<br />
919 Gulden. Bezahlt wurden diese Rechnungen aus der Königlich Württembergischen<br />
Staatskasse, das Stift war seit dem Staatsvertrag von 1806 nicht mehr zuständig. In der<br />
Oberamtsbeschreibung von 1860 heißt es lapidar: "Das vor etwa zehn Jahren bedeutend<br />
erneuerte Pfarrhaus unterhält der Staat."<br />
Das versicherte Inventar im Pfarrhaus betrug 1862:<br />
2 tannene Kästen 10 Gulden<br />
1 Kleiderkasten 3 Gulden<br />
1 Kommode mit Pult 15 Gulden<br />
2 Bücherständer 10 Gulden<br />
1 Thermometer 1 Gulden<br />
Mehrere Bücher 20 Gulden<br />
1891 wurde wieder eine Renovierung durchgeführt<br />
Die Pfarrscheuer stand neben dem Pfarrhaus und wurde 1952 abgebrochen. Über das<br />
Grundstück führt heute die Straße nach Dachtel.<br />
Die Pfarrer<br />
Nach Unterlagen von K. F. Essig, der Württembergischen Landesbibliothek, dem<br />
Landeskirchlichen Archiv und der Sigelliste, aus Lagerbüchern von Gechingen und<br />
Deckenpfronn und nach Kircheninschriften:<br />
134
1330: Conrad von Waldeck (Stiftungsbrief über eine Meßpfründ zu Calw. Sattler: Geschichte<br />
der Grafen von Württemberg, Band 1 Seite 146)<br />
1404: Heinrich Durhubel. Urkunde vom 23.4.1404 im Staatsarchiv: "Vorgeschlagen wurde<br />
Heinrich Durhubel, Pfarrer in Gechingen, von den Brüdern Konrad und Heinrich, Truchsessen<br />
in Waldeck. "<br />
1407: Johannes Ruhmisz aus Pforzheim am 13.1.1407 (Urkunde HSTA Repertoire Herrenalb<br />
A 489-Nr. 329)<br />
1437: Hans Stieger. Im Deckenpfronner Lagerbuch erscheint er als Zeuge unter einem<br />
Gültbrief des Hans Wagner, den dieser zur Beurkundung seiner Abgaben an die Kirche in<br />
Deckenpfronn ausstellen mußte.<br />
1481: Bertold Dieringer * um 1400 +1481. Auf seiner Grabplatte in der Kirche ist folgende<br />
Inschrift: "Im Jahr des Herrn 1481 starb Bertold Dieringer, Alten Bullach, Plebanus<br />
(Leutepriester). Geboren 1400. Seine Seele ruhe in Frieden." Während seiner Amtszeit wurde<br />
die Kirche erbaut (renoviert). (Siehe dazu auch: "Die Kirche Geschichte")<br />
Die weiteren bekannten Pfarrer sind evangelisch.<br />
1547: Heinrich Schneider *vor 1507 in Gechingen +vor 1548, oo um 1540 mit Appolonia.<br />
Geistliches Lagerbuch.<br />
1547: Johann Schneider +1585 in Feuerbach oo um 1530 mit Anna, 7 Kinder. Geistliches<br />
Lagerbuch.<br />
1553-58: Magister Paul Heller. Vorher in Warmbronn 1542, Döffingen 1548-53. Sigel.<br />
1558-62: Magister Sebastian Bloss *Münsingen oo mit Anna Catharina.<br />
Der Sohn Jakob wurde Pfarrer in Heidenheim, Sohn Ernst Pfarrer in Beinstein.<br />
Sebastian Bloss war vorher in Hirsau 1556-58, nachher Dekan in Wildberg 1562-70 und<br />
Stadtpfarrer in Hornberg 1570-90. Sigel.<br />
1562-66: Magister Balthasar Wagner *Balingen. Vorher in Grossbottwar 1561, nachher in<br />
Truchtelfingen 1566 - 71, Dekan in Tuttlingen 1571 - 79. (Sigel und Lagerbuch).<br />
Von Magister Balthasar Wagner (1562) stammt das älteste erhaltene Schreiben eines<br />
<strong>Gechinger</strong> Pfarrers über seine Besoldung. Es ist ein sehr langer Brief: "An den<br />
Durchlauchtigsten Herzog Christoph." Pfarrer Wagner beklagt sich bitterlich, weil seine<br />
Einkünfte hinten und vorne nicht reichen. Interessant ist dieser Brief vor allem deshalb, weil<br />
er eine Aufstellung seiner Einkünfte macht, denn der Herzog soll selber beurteilen, "ob ein<br />
Pfarrherr dabei bleiben möge oder nicht. Ich habe verschiedene Beschwerden, die einem<br />
Pfarrherrn sonderlich beschwerlich und überlästig sind".<br />
Den weitaus größten Teil der Besoldung machen Naturalien aus, hier handelt es sich vor allem<br />
um Getreide, Stroh und Heu von den Abgaben der Bauern, auf die der Pfarrer ein Anrecht hat,<br />
aber auch Ernteerträge vom Widdumhof. -"Widumgüter: Wiesen 6 Morgen, Äcker in allen<br />
Zelgen miteinander 16 Morgen. Die Äcker muß ich mit großer Last anbauen, also daß ich bei<br />
solcher Belastung auch mich schmerzlich erhalten mag, werde auch in solcher großen<br />
Anstrengung und bauern in meinem Studium oftmals nicht wenig verhindert", schreibt Pfarrer<br />
Wagner. An anderer Stelle heißt es: " Ferner will ich samt meiner Hausfrau erhalten werden,<br />
so wird dies nicht erfordern, daß wir schier wie andere Bauern schaffen und arbeiten müssen,<br />
da wir beide ziemlich schwach und zu solchen schweren Arbeiten untauglich sind." - Oder:<br />
"Wein kann ich mir nicht kaufen und mit Wasser kann man nicht in der Kirche und auf dem<br />
Feld arbeiten." - Da es offenbar auch Mißernten gab, mußte der Pfarrer sogar Schulden<br />
machen, unter anderem, um Saatgut zu kaufen.<br />
Unglaublich niedrig für heutige Begriffe ist die Besoldung in Geld. Balthasar Wagner gibt an:<br />
"Stift zu Baden gibt 18 Gulden auf Georgi, 9 Gulden auf Martini." An Hellerzins und<br />
ähnlichem kommen noch 3 - 4 Schilling jährlich ungefähr dazu. (Vergleiche auch<br />
Besoldungsliste Pfarrer Ehemann, Pfarrer in Gechingen von 1750-1772)<br />
135
Balthasar Wagner kommt mit folgendem Antrag zum Schluß:<br />
"Bitte abermals Eure fürstlichen Gnaden ganz untertäniglich und hochgeflissentlich um:<br />
Kleiner Zehnten Heu, Obst, Erbsen und Werg . . . Sie wolle mir hilfreich und erbötig sein,<br />
auch hinsichtlich der Pfarrei, daß mir entweder von Eurer fürstlichen Gnaden oder vom Stift<br />
zu Baden die Gabe dafür gnädiglich gereicht und gegeben wird. . . Wenn ich aber sehe, daß<br />
meine Geschäfte leichter gemacht werden, wäre ich sehr zufrieden. Dies will ich auch<br />
fürderhin in aller Untertänigkeit mit meinem Gehorsam und meinem Gebet zeigen und Eurer<br />
Fürstlichen Gnaden zu jeder Zeit zu dienen. Eurer Fürstlichen Gnaden williger, gehorsamer<br />
M. Balthasar Wagner."<br />
Dieser Brief wurde offenbar in Merklingen, als dem zuständigen Amt, eingereicht und löste<br />
eine wahre Briefflut aus. Zunächst wurde er mit einer Art Aktennotiz nach Herrenalb<br />
geschickt. ("Lieben Getreuen, was uns heutigentags der Pfarrer zu Gechingen, Mg. Balthasar<br />
Wagner . . ." etc.)<br />
Herrenalb schrieb dann an den "Durchlauchtigsten, Hochgeborenen Fürsten und Herrn, Herrn<br />
Christophen, Herzogen zu Wirtemperg und Teck . . . "etc.)<br />
Von Stuttgart aus ging ein Brief nach Baden, "Pfarrherrn zu Gechingen Balthasar Wagnern<br />
belangend".- "Hat sich der Pfarrherr zu Gechingen, Magister Balthasar Wagner geringer<br />
Besoldung halb beklagt."<br />
Kanzler und Räthe zu Baden schreiben zurück über "Pfarrers zu Gechingen Besoldung" dem<br />
"Durchleuchtigsten Hochgebornen Fürsten und Herrn, Herrn Christoffen Hertzogen zu<br />
Wirtemberg und Teckh, Graven zu Mümpelgard, unserem gnedigsten Fürsten und Herrn".<br />
Sie geben zu bedenken, (im Namen oder im Auftrag unseres gnedigsten Fürsten Hans<br />
Philiberts? Markgraven zu Baden und Graven zu Pforzheim), daß das Stift auch für den<br />
Unterhalt des Pfarrhauses samt der Scheuer aufkommen muß und außerdem das Kloster<br />
Hirsau das Recht auf den halben Zehenden in Gechingen hat und sich deswegen an der<br />
Besoldungserhöhung, wenn sie denn zustande käme, beteiligen müsse. So wird auch Hirsau<br />
angeschrieben.<br />
Hirsau seinerseits wendet sich wieder an Herzog Christoph, die Pfarrei Gechingen betreffend.<br />
Die Herren legen die Kopie eines Schriftstücks bei - es Brief zu nennen, wäre zu wenig, es<br />
handelt sich eher um eine Broschüre - in dem sich die Äbtissin des Frauenklosters<br />
Lichtenstern, von dem Hirsau den halben Zehnten erworben hat, mit diesem offenbar<br />
ergiebigen Thema ausführlichst befaßt. Inzwischen ist eine lange Zeit verflossen. Von<br />
irgendeinem greifbaren Ergebnis der Eingabe Balthasar Wagners ist nirgendwo die Rede, der<br />
Pfarrer tritt 1566 eine andere Stelle an.<br />
1566-77: Magister Daniel Ziegler, *ca. 1540 in Wildberg, als Sohn des Vogtes in Hornberg,<br />
Peter Ziegler. oo vor 1575 mit Sabina, Witwe des Pfarrers Ruff in Gültstein.<br />
Sohn Daniel wurde später Pfarrer in Gechingen.<br />
D. Ziegler war von 1564 - 66 in Adelberg, von 1577 - 1615 Dekan in Wildberg.<br />
Er begann 1566 das Eheregister, 1574 das Taufregister und 1577 das Totenregister anzulegen.<br />
Mehrere Schreiben an das Stift Baden sind von ihm erhalten, in denen es um<br />
Besoldungsfragen geht. (Sigel.)<br />
1577-84: Johannes Hartmann, *in Bottwar, oo in 1. Ehe mit Barbara Büchsenstein aus Calw,<br />
in 2. Ehe 1585 auch mit einer Calwerin. 1565 - 67 war er Diakon in Calw, 1567-77 Pfarrer in<br />
Simmozheim. (Sigel.)<br />
1584-1603: Magister Noah Braitter + am 12.5.1603 in Calw, oo vor 1584 mit Maria.<br />
Er war 1571-73 Präzeptor in Hirsau, 1573 - 76 Diakon in Nagold, 1576 - 84 Pfarrer in<br />
Dachtel.<br />
Im 16. Jahr seiner Amtszeit schreibt er an den Fürsten in Baden wegen der Besoldung.<br />
Von Braitters Nachfolger stammt folgende Notiz über seinen Amtsvorgänger:<br />
136
"Als er noch im Leben, hat er sich zum Gevatter erbeten lassen, als er aber verschieden, hat an<br />
seiner Statt Hans Herzog das Kind auf die Tauf gehoben und Anna Brackenheimerin." Braitter<br />
muß also völlig überraschend gestorben sein, denn zwischen Geburt und Taufe eines Kindes<br />
lagen damals meist nur wenige Tage. (Sigel.)<br />
1603-12: Magister Daniel Ziegler jun., Sohn des Magisters Daniel Ziegler, der von 1566 - 77<br />
in Gechingen war. Er heiratete vor 1605 Catharina Schmidlin<br />
Sohn Daniel wurde später Pfarrer in Güglingen, er und noch weitere fünf Kinder sind in<br />
Gechingen geboren.<br />
1612-38: Magister Ulrich Kengel *um 1581 in Deckenpfronn, + Oktober 1638. oo in 1. Ehe<br />
mit Licia, 2. Ehe am 4.8.1635 mit Margareta Hirt. Er hatte eine große Kinderschar.<br />
Auch Ulrich Kengel macht Eingaben der Besoldung wegen, 1612 schreibt Ulrich Kengel<br />
deswegen an Herzog Johann Friedrich. (1608-1628) Ein Brief von Herrenalb an Baden in<br />
dieser Sache ist erhalten.<br />
Von 1606-08 war er Pfarrer in Schwarzenberg, 1608-12 in Dachtel.<br />
Ulrich Kengel war Pfarrer in Gechingen, als 1634 die für Württemberg so verhängnisvolle<br />
Schlacht bei Nördlingen stattfand. 4000 Bauern aus dem württembergischen Aufgebot<br />
verloren dabei ihr Leben; durch unser Gebiet strömten die Truppen des geschlagenen Heers<br />
und ihre Verfolger, alle ohne Unterschied plünderten und mordeten, führten das Vieh weg und<br />
brannten Städte und Dörfer nieder. Da das Land nicht bebaut werden konnte, gab es im<br />
nächsten Jahr eine große Hungersnot, der die Pest folgte.<br />
Ulrich Kengel begann am 17.8.1635 wieder mit dem Totenbuch, nachdem die letzte<br />
Eintragung am 30.4.1583 war. Über ihn schreibt sein zweiter Nachfolger: "Ungefähr Mitte<br />
Oktober 1638 verstarb der rechtschaffene und gelehrte Magister Ulrich Kengel, der 27 Jahre<br />
mit der größten Treue der hiesigen Pfarrei vorstand; er ist wohl wert, daß sein Name neben<br />
seinen Schafen verzeichnet werde, als Hirte den Zug der Toten beschließend."<br />
Es ist ein großer Zug, den er beschließt. Als etwa um 1650 die Bilanz des Krieges gezogen<br />
wird, waren von 140 Familien noch 43 übrig. (Sigel u. Pfarrarchiv)<br />
1638-40: Gechingen hatte in diesen Jahren keinen eigenen Pfarrer und war die Filiale von<br />
Ostelsheim. (Sigel.)<br />
1640-44: Magister Georg Ludwig Trautwein, + in Nürtingen. Pfarrer in Trichtlingen 1628-35,<br />
in Ostelsheim 1635-40. oo mit Anna. 1640 wurde dem Paar eine Tochter geboren. Von Pfarrer<br />
Trautwein gibt es eine Nominationsurkunde, die sehr deutlich den Weg durch die Instanzen<br />
zeigt, wenn man Pfarrer in Gechingen werden wollte. Der Kandidat mußte sich zuerst in aller<br />
Form beim (katholischen) Stift in Baden bewerben, das ihm dann aufgrund der Tatsache, daß<br />
dem Stift das "Jus Patronatus (das Patronatsrecht) von alters hero ohndisputirlich . . zusteht",<br />
Brief und Siegel darauf gab, daß er nominiert worden war, und das Konsistorium in Stuttgart<br />
wurde gebeten, ihn zu konfirmieren (bestätigen).<br />
Bemerkenswert ist, daß die Bürokratie in dem verwüsteten und entvölkerten Land immer noch<br />
funktionierte und man sich an Brauch und Herkommen zu halten hatte, egal, was in der<br />
Pfarrei vorgegangen war.<br />
Zeitweilig war Georg Ludwig Trautwein auch für Dachtel und Stammheim zuständig. Er<br />
beklagt sich in einem Schreiben an das Stift zu Baden: "Ich muß trotz Leibesblödigkeit,<br />
mangelnder Kleidung und schlechtem Wetter die Nachbargemeinden versorgen. Ist aber kein<br />
Vicarius vorhanden."<br />
Von 1644-48 war Trautwein in Deckenpfronn. (Sigel.)<br />
1644-47: Magister Friedrich Pfaff *9.11.1616 in Langenbeutingen. Friedrich Pfaff war in<br />
Wildberg von 1638-44 und heiratete dort am 7.6.1642 Anna Justina Magirus, Tochter des<br />
Stadtpfarrers Johann Jakob Magirus in Beilstein und seiner Frau Justine geb. Jung. Das<br />
Ehepaar Pfaff hatte drei Kinder.<br />
137
1647 floh der Pfarrer mit anderen <strong>Gechinger</strong> Bürgern nach Calw; denn immer wieder kamen<br />
marodierende Truppen in unser Gebiet. Unterwegs starb seine Frau.<br />
Von 1647-85 war Friedrich Pfaff dann Pfarrer in Steinheim an der Murr.<br />
Sein Vikar in Gechingen war 1647 Joh. Christoph Wild. (Sigel)<br />
1648-74: Georg Wochele *11.12.1612 in Aidlingen, als Sohn des Webers u. Bürgermeisters<br />
Hans Wochele und der Katharina geb. Reisser. Er war von 1636-48 Pfarrer in Deufringen und<br />
starb am 6.3.1674 in Gechingen.<br />
1. Ehe am 18.10.1636 mit Catherina Schütz aus Calw, Tochter des deutschen Schulmeisters<br />
Johannes Schütz. Von den acht Kindern des Paares starben zwei, bevor sie ein Jahr alt waren,<br />
drei zwischen zwei und zehn Jahren innerhalb ganz kurzer Zeit im Jahre 1650. Für diese drei<br />
steht im Totenbuch: "Der liebe Gott wolle sie alle drei an seinem großen Tag mit Freude zum<br />
ewigen Leben erwecken."<br />
Katharina Wochele war schon am am 1.5.1649 gestorben.<br />
2. Ehe am 5.11.1649 mit Agnes Mayer, Tochter des Hans Mayer aus Calw.<br />
Ein Sohn Johannes *8.12.1664 +22.3.1739 oo 1688 Gräber wurde in Gechingen Hirschwirt,<br />
badischer Schaffner und Zoller. (Sigel)<br />
1674-83: Magister Ernst Friedrich Binder * Böblingen. Heirat mit Anna Juditha. Er war von<br />
1668-74 in Loffenau und von 1683-1715 in Heimerdingen. In Gechingen wurden ihm fünf<br />
Kinder geboren. (Sigel)<br />
1683-90: Magister Johann Philippus Demler, oo mit Anna Barbara. Johann Philippus Demler<br />
war von 1676-83 in Neuweiler.<br />
Sohn Philippus Jakobus *7.7.1685 in Gechingen. (Sigel)<br />
1690-1723: Magister Johann Konrad Pommer *1658 in Calw, als Sohn des Johann Leonhard<br />
Pommer, Chirurg und der Ursula geb. Eble. M. Pommer war 1688 in Marschalkzimmern.<br />
1. Ehe am 20.5.1690 mit Anna Barbara Schill aus Calw, +1739, Tochter des Bürgermeisters<br />
Jakob Schill und der Elisabeth geb. Stuber, Calw. Aus der Ehe gingen zehn Kinder hervor.<br />
Ein Sohn, Johann Martin, wurde Pfarrer in Gechingen.<br />
1723 machte Pfarrer Pommer eine Eingabe an den Herzog wegen der Schafhaltung.<br />
In einem weiteren einem Protokoll von 1732 heißt es: "Von Gottes Gnaden Eberhard Ludwig,<br />
Herzog zu Württem-berg. Unsern Gruß zuvor, liebe Getreuen! Auf Magister Johann Conrad<br />
Pommer, Pfarrers zu Gechingen um gnädigste Conzession 100 Schafe gleich halten zu dürfen.<br />
Unterthänigst eingereicht Memorial und des Zahlmeisters Wolfs dabei erstatteten Bericht. Ist<br />
unser gnädigster Befehl hiermit, du wollest die Commun dahin anweisen, daß die Ihrem<br />
Pfarrer eine größere Anzahl, so es nach Proportion eines Pfarramtes und eines Besitzer gab, so<br />
halte. Und übern Winter kann Vater Pommer berechtigterweise unter die anderen Tiere<br />
treiben und auch nach Gusto den gemeinen Pferch dem Pfarrer nach Gebühr zukommen<br />
lassen. Daran befiehlt unser Will und Meinung und wir verbleiben Dir im Guten. Oeconome<br />
Cameralis (etwa: Finanzverwaltung) Stuttgart."<br />
Magister Pommer starb am 26.3.1737 in Gechingen. (Sigel und Lagerbuch)<br />
1723-49: Magister Johann Martin Pommer, Sohn des Johann Conrad Pommer und der Anna<br />
Barbara geb. Schill, *6.11.1699 in Gechingen, + am 12.12.1749 in Gechingen.<br />
1. Ehe am 6.5.1732 mit Maria Sabina geb. Meyer *in Calw 1709 + am 20.2.1749 in<br />
Gechingen, Tochter von Marx Meyer und Marie Katharina geb. Demler. Dem Paar wurden elf<br />
Kinder geboren, von denen aber die meisten im Kleinkindalter starben.<br />
2. Ehe am 9.9.1749 mit Friederike Margareta Simon geb. Schill Witwe des Pfarrers Simon in<br />
Ehningen/BB. Vater Johann Marx Schill von Calw.<br />
Magister Johann Martin Pommer hielt 1723 die erste Konfirmation mit 6 Knaben und 4<br />
Mädchen und begann das Konfirmationsregister. Die Konfirmation wurde in Württemberg am<br />
11.12.1722 eingeführt. Wörtlich heißt es: "Solle fürohin niemand mehr das erste Mal zum hl.<br />
Abendmahl, es seye denn, daß sie vor in der Kirche vor Angesicht der ganzen Gemeinde ihren<br />
138
Taufsbund erneuert haben." Pfarrer Pommer wird 1743 im Fleckenbuch als "treueifrig"<br />
gerühmt und seine Verdienste um den Umbau der Martinskirche hervorgehoben. (siehe "Die<br />
Kirche Geschichte")<br />
(Sigel und Lagerbuch)<br />
1750-72: Magister Johannes Ehemann, *1723 in Schorndorf +22.5.1772 in Gechingen. Eltern:<br />
Johannes Ehemann, Kollaborator und Maria Dorothea aus Schorndorf.<br />
Johannes Ehemann war, bevor er nach Gechingen kam, in Schorndorf, Göppingen und<br />
Stuttgart tätig.<br />
Am 4.5.1750 verheiratete er sich mit Susanne Magdalena geb. Brodhag. Sie wurde geboren<br />
am 4.9.1726 als Tochter des Stadtpfarrers von Sindelfingen, Johann Burkhard Brodhag, und<br />
seiner Frau Julie Heinerike geb. Moser und starb am 4.7.1772.<br />
Die älteste Tochter, Sophie Magdalena, geb. 2.1.1751 - sie bekam noch zehn Geschwister -<br />
wurde später Pfarrfrau in Gechingen; sie heiratete 1772 Pfarrer Klinger.<br />
Von Pfarrer Ehemann liegt eine Besoldungsliste vom 14.3.1750 vor:<br />
"Geldbesoldung von Baden 24 Gulden<br />
Vom Heiligen 19 Gulden, 43 Kreuzer<br />
Hellerzins 1 Gulden, 30 Kreuzer<br />
Summa 44 Gulden, 13 Kreuzer<br />
Naturalbesoldung (durch die bürgerliche Gemeinde)<br />
Roggen: 3 Scheffel à 3.00 9 Gulden<br />
Dinkel: 24 Scheffel, 2 Vierling à 1.30 36 Gulden, 5 1/2 Kreuzer<br />
Haber: 10 Scheffel, 2 Simri, 3 Vierling à 1.00 10 Gulden, 21 1/2 Kreuzer<br />
Erbis (Erbsen): 2 Simri 3 Vierling 1 Gulden, 4 1/2 Kreuzer<br />
Stroh: 1 Fuder 1 Gulden, 30 Kreuzer<br />
Stammholz:10 Klafter à 1.00 10 Gulden<br />
Reisach (Reisig): 200 Büschel 40 Kreuzer<br />
1/4 Küchengarten 34 Kreuzer<br />
Krautgarten zu 300 Setzlingen 25 Kreuzer<br />
1 und 1/2 Viertel Baum- und Grasgarten 1 Gulden 41 Kreuzer<br />
Mannsgewand und Stiefel 27 Gulden<br />
10 Jauchert Acker à 1.00 10 Gulden<br />
Landecht Früchten 1 Gulden 10 Kreuzer<br />
Heu: 7 1/2 Wannen 22 Gulden 30 Kreuzer<br />
Kleiner Zehnten zur Hälfte an Erbis,<br />
Wiecken, Linsen, Bohnen, Hanf, Flachs,<br />
Kraut, Rüben und Grundbirnen 15 Gulden<br />
Viehweid: 6 Stück Rindvieh und 25 Schafe 4 Gulden, 40 Kreuzer<br />
Kirchen- und Schulvisitation, Kinderexamen<br />
und Ämterersetzung 2 Gulden, 30 Kreuzer<br />
Summa 199 Gulden, 24 1/2 Kreuzer<br />
Accidentia (sonstige Einnahmen) 16.00 Gulden<br />
Fideliter extrahiert, (treulich ausgeschrieben) den 14.3.1750<br />
Fürstlich Consistorial Canzelist." (1 Fuder = 17,63 hl, 1 Scheffel = 176 l, 1 Simri<br />
22 l, 1 Vierling 5,5 l, 1 Wanne ca. 12 cbm, 1 Klafter 3,3 cbm, 1 Jauchert 576 qm)<br />
Die Besoldungsliste ist noch um folgenden Vermerk ergänzt:<br />
139
"Von der Communalwaldungen: Die Holtzbesoldung wurde kraft eines herzoglichen<br />
Regierungsdekrets vom 23.10.1719 dahingehend dekriert und bestätigt. Der Wiesen- und<br />
..?.futterzehnte wurde aber der Pfarrei am 3. November 1760 gnädigst zuerkannt."<br />
(Sigel und Lagerbuch)<br />
Später erfolgte die Holzbesoldung durch die bürgerliche Gemeinde, von der hier die Rede ist, in<br />
Geld. Erst 1964 wurde diese Bezahlung, die in Höhe von 500-700 DM jährlich lag und an die<br />
Evangelische Pfarrgutsverwaltung in Stuttgart abzuführen war, mit DM 16066 abgelöst. Damit<br />
wurde eine jahrhundertealte Vereinbarung zwischen Landeskirche und Gemeinde aufgehoben.<br />
Nach diesem Vertrag war die Gemeinde verpflichtet, jährlich ca. 15 Raummeter buchene<br />
Scheiter, ca. 7 Raummeter eichene Scheiter, ca. 7 Raummeter tannene Scheiter und ca. 150 Stück<br />
buchene Wellen (als Büschel zusammengebundenes Prügelholz) in natura oder in Geld<br />
abzuliefern.<br />
1772-1828: Magister Christoph Heinrich Klinger *19.2.1748 in Wildbad, als Sohn des<br />
Försters Joh. Michael Klinger und Rebekka geb. Sattler.<br />
1. Ehe am 27.9.1772 mit Sophie Magalena geb. Ehemann, Tochter des <strong>Gechinger</strong> Pfarrers<br />
Ehemann, *2.1.1751, +30.10.1793. Das Paar hatte vier Kinder, die Sophie Magdalena alle<br />
überlebte.<br />
2. Ehe am 6.8.1794 mit Christiane Dorothea geb. Theuss aus Freudenstadt, *20.11.1765, als<br />
Tochter des Stadtschreibers Theodor Theuss und der Christina Margareta geb. Ulmer. Der<br />
Sohn Heinrich Theodor Christian aus dieser Ehe wurde Pfarrer und seines Vaters Nachfolger<br />
in Gechingen.<br />
Selten werden die dürren Zahlen im Dorfsippenbuch so beredt, wie im Fall Pfarrer Klingers.<br />
Die junge Sofia Magdalena Ehemann, die seine erste Frau wurde, verlor 1772 innerhalb von<br />
sechs Wochen beide Eltern, und eine ganze Reihe jüngerer Geschwister - das jüngste knapp<br />
einjährig - waren zu versorgen. Pfarrer Klinger, damals 24 Jahre alt, muß sich unmittelbar<br />
nach dem Tod Pfarrer Ehemanns bei dem Stift in Baden um die Pfarrstelle in Gechingen (er<br />
war der letzte <strong>Gechinger</strong> Pfarrer, der in Baden nominiert wurde) beworben haben, denn schon<br />
vier Wochen nach dem Tod Pfarrer Ehemanns war er der nominierte Kandidat für die<br />
Pfarrstelle in Gechingen. Am 4. Sept. 1772 von Württemberg konfirmiert, heiratete er die<br />
Tochter seines Vorgängers am 27. 10. 1772. Von den vier Kindern des Paares starben drei<br />
ganz früh, nur die Älteste, Heinerike Sofie, wuchs heran, aber kaum zwanzigjährig, starb auch<br />
sie. Ihre Mutter überlebte sie nur um drei Wochen.<br />
1794 verheiratete Pfarrer Klinger sich zum zweitenmal. Nach einer Totgeburt 1797 kam 1801<br />
Sohn Heinrich Theodor zur Welt. Sein Vater war damals 53 Jahre alt.<br />
Man kann sich unschwer vorstellen, warum Pfarrherr und Gemeinde ein so enges, vertrauensvolles<br />
Verhältnis zueinander hatten, sie hatten Freud und Leid zusammen erlebt und sich<br />
gegenseitig mit Sicherheit beigestanden. (Vergleiche auch "Napoleonische Zeit",<br />
Koalitionskriege) Als 80jähriger noch bekennt Pfarrer Klinger, es sei sein Wunsch, "wenn ich<br />
den Rest meiner Tage in der Mitte meiner von mir väterlich geliebten Gemeinde beschließen,<br />
und einst mein Staub sich mit dem Staube derer mengen würde, zu deren Seelenheil von mir<br />
mehr als 18 tausend Gottesdienste unter des Höchsten Beistand gehalten wurden." -<br />
Pfarrer Christoph Heinrich Klinger feierte am 17.7.1822 seine fünfzigjährige Amtszeit in<br />
einer Gemeinde, gewiß ein seltenes Ereignis. Der Dekan und sämtliche Geistliche der Diözese<br />
Calw gratulierten dem Jubelgreis mit einem Gedicht, welches vom typographischen Comptoir<br />
Calw gedruckt und verbreitet wurde. Der Dekan bestätigte 1828, daß Pfarrer Klinger längst<br />
eine Beförderung hätte suchen können, aber nie eine Veränderung begehrte.<br />
1827 wurden die Pfarrbesoldungsgüter verkauft und der Erlös zur Staatskasse eingezogen. Die<br />
Zinsen sollten zur Geldbesoldung des Pfarrers geschlagen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt<br />
muß Pfarrer Klinger die mit dem Pfarramt verbundene Landwirtschaft geführt haben; denn im<br />
140
Jahre 1827 lesen wir im Calwer Wochenblatt: "Auction im Pfarrhause. Bis nächsten Mondtag,<br />
den 15. d. M., morgens 8 Uhr, wird im hiesigen Pfarrhause eine Versteigerung von<br />
ökonomischen Gegenständen aller Art gehalten werden. Namentlich wird bemerkt: 2 Wägen,<br />
1 Pflug, 1 Schlitten, Pferdegeschirr, 1 1/2 jähriges Hengstfohlen. Auch wird eine Hobelbank<br />
nebst beinahe vollständigem Schreiner-Handwerkszeug abgegeben."<br />
1828 werden dann eine Partie Bienenstöcke, 2 Bienenkappen und dergleichen angeboten. Der<br />
im Jahre 1829 erfolgte Verkauf von einem eisernen Ofen mit 535 Pfund Gewicht und einem<br />
Kanonenofen hängt sicher mit dem Umbau des Pfarrhauses zusammen, der 1830 durchgeführt<br />
wurde.<br />
Es ist bekannt, daß Pfarrer Christoph Heinrich Klinger noch im Jahre 1823 den Pfarrer von<br />
Deckenpfronn vertrat und zu Pferd nach Deckenpfronn ritt.<br />
In den letzten Jahren seiner Amtszeit wurde er von seinem Sohn Heinrich Theodor Klinger als<br />
Vikar unterstützt. Mit Schreiben vom 21.5.1828 bat Magister Christoph Heinrich Klinger<br />
alleruntertänigst um seine Entlassung und allergnädigste Ernennung seines Sohnes zu seinem<br />
Amtsnachfolger. Sein Dekan und die Gemeinde Gechingen unterstützten das Gesuch.<br />
Er schrieb: "Nach 56jähriger Dienstzeit möchte ich mich gerne in den Ruhestand begeben. . .<br />
"-<br />
"Ich kam 1772 als Pfarrer auf den hiesigen Dienst, der nach dem damaligen Anschlag 200<br />
Gulden und jetzt 605 Gulden beträgt."<br />
(Zum Vergleich: 1850 war die Jahresbesoldung des Pfarrers auf 1145 Gulden, 24 Kreuzer<br />
gestiegen.)<br />
Pfarrer Klinger starb am 1.11.1830 in Gechingen. (Sigel und Pfarrarchiv)<br />
1828-62: Pfarrer Heinrich Theodor Christian Klinger *13.4.1801 als Sohn des <strong>Gechinger</strong><br />
Pfarrers Christoph Heinrich Klinger.<br />
1. Ehe am 18.9.1828 mit Luise Franziska geb. Schweikardt, Tochter des Eberhardt Friedrich<br />
Schweikardt aus Stammheim und der Elisabeth Modeste geb. Weiß *14.6.1809 +11.6.1835.<br />
Die so jung gestorbene Frau hinterließ drei kleine Kinder, zwei andere waren schon vor ihr<br />
gestorben.<br />
2. Ehe am 14.6.1836 mit Marie Albertine Pauline geb. Schweikardt, verwitwete Memminger,<br />
Schwester der ersten Frau. *19.10.1806 +10.8.1861. Zu einem gemeinsamen Sohn kam noch<br />
eine Tochter aus erster Ehe der Frau.<br />
Pfarrer Heinrich Theodor Klinger war ein äußerst rühriger Mann, der sich viele Verdienste<br />
erworben hat. 1825 gründete er einen Leseverein im Oberamt Calw, in dem Zeitschriften und<br />
Bücher ausgeliehen wurden. Er war auch der Gründer des 1839 entstandenen Landwirtschaftsvereins<br />
und des Gustav-Adolf-Vereins im Oberamt Calw. Mit Zeitungsanzeigen versuchte<br />
Heinrich Theodor Klinger Heimarbeit nach Gechingen zu bringen, besorgte vielen<br />
Jugendlichen Lehrstellen und beschäftigte arme, alte Menschen mit Strohschuhflechten usw.<br />
Im Pfarrhaus ließ er Ortsarme über den Winter leinenes Garn spinnen (1843) und sorgte mit<br />
einer Versteigerung für den Verkauf der Ware.<br />
Heinrich Theodor Klinger setzte sich auch für einen fortschrittlichen Schulunterricht ein.<br />
Auszug aus dem Konventbericht von 1854:<br />
"Die Tochter des Schulmeisters Hofmann von Deufringen soll so lange als Industrie-Lehrerin<br />
angenommen werden, bis etliche Andere zum Unterricht tauglich sind. Sie wird wöchentlich 2<br />
Gulden 42 Kreuzer erhalten, wobei sie für die Nachmittage von Mittwoch und Samstag frei<br />
erhält, an welchen die Rosine Werner den Unterricht für die kleineren Mädchen zu erteilen<br />
hätte."<br />
(Industrie-Schulen bzw. -lehrerinnnen sollten Kindern der Armen Fertigkeiten vermitteln, die<br />
sie dazu befähigten, Lohnarbeiten auszuführen, wobei es sich in Gechingen vor allem um<br />
Mädchen und den Bereich der Textilherstellung und -bearbeitung gehandelt haben wird.)<br />
141
Anläßlich des 25jährigen Amtsjubiläums Pfarrer Klingers 1853 erschien ein großer Artikel<br />
über ihn im Calwer Wochenblatt. Unter anderem heißt es hier: "Während der Amtsführung<br />
des Vaters und Sohnes vom 17.7.1772 bis 1853, also in 81 Jahren, hielten Gottesdienste: der<br />
Vater 19 159, der Sohn: 10 237, zusammen 29 396, dabei waren Predigten vom Vater 5 097,<br />
vom Sohne 3 119, zusammen 8216. Taufen vom Vater 1863, vom Sohne 1369, zusammen<br />
3232. Communikanten vom Vater 94 016, vom Sohne 56 752, zusammen 150 468.<br />
Auswärtige Gottesdienste hielt der Vater 1 691, der Sohn 496, zusammen 2187. Die<br />
Gemeinde Gechingen zählte im Jahre 1772 500 und im Jahr 1853 1200 Seelen. Im ganzen<br />
Ort leben nur noch drei Personen, die nicht vom Vater oder Sohn getauft worden sind."<br />
Pfarrer Heinrich Theodor Klinger starb in Gechingen am 14.5.1862.<br />
(Sigel und Pfarrarchiv)<br />
1862-71: Pfarrer Martin Storz, vorher Pappelau, Dekanat Blaubeuren, trat am 27.8.1862 sein<br />
Amt in Gechingen an. In seiner Amtszeit wurde von 1865-67 die Kirche umgebaut und<br />
renoviert. Martin Storz war kränklich. (Pfarrarchiv)<br />
1872-81: Pfarrer Paul Albrecht Dörr *23.4.1821 in Erpfingen, +31.1.1881 in Gechingen. Er<br />
war vorher Pfarrer in Steingebronn, Münsingen. Seine Eltern waren Imanuel Gottlob Dörr,<br />
Pfarrer in Oppelsbohm und Eberhardine Friederike geb. Bauer.<br />
Paul Albrecht Dörr heiratete am 14.7.1869 Emma Luise Amalie geb. Grözinger aus<br />
Pfummern, Tochter des Pfarrers in Dapfen, Gottlob Jakob Grözinger und der Henriette<br />
Christiane geb. Dorner, mit welcher er einen Sohn hatte.<br />
Während der Amtszeit von Paul Albrecht Dörr wurde eine neue Orgel angeschafft und der<br />
Kirchturm erhöht.<br />
Das Einkommen des Pfarrers betrug 1872 2330 Mark jährlich. Auch Paul Albrecht Dörr war<br />
kränklich. (Pfarrarchiv)<br />
1881-90: Pfarrer Max Friedrich Barth *18.4.1840 in Stuttgart, vorher seit 1873 Pfarrer in<br />
Deufringen.<br />
Am 10.6.1890 stand im Calwer Wochenblatt folgendes:<br />
"Herr Pfarrer Barth von Gechingen hat seine Stelle mit Möhringen vertauscht und läßt ihn<br />
seine Gemeinde mit Bedauern scheiden, da er hier 8 Jahre in treuer Pflichterfüllung tätig war.<br />
Als seltener Fall sei erwähnt, daß dies seit ca. 130 Jahren der erste Geistliche ist, der von hier<br />
eine andere Stelle bezog." (Pfarrarchiv)<br />
1890-97: Pfarrer Wilhelm Keller *23.10.1842 in Weiler +2.2.1904 in Ebingen. Die Eltern<br />
waren Wilhelm Keller, Pfarrer in Möglingen und Pauline geb. Nast. W. Keller war vorher in<br />
Lampolshausen, Dekanat Neuenstadt.<br />
Am 12.5.1873 heiratete er Anna geb. Eytel *4.10.1854, ihre Eltern waren Wilhelm Eytel,<br />
Pfarrer in Gerlingen und Marie Henrietta Luise geb. Knapp. Pfarrer Keller und seine Frau<br />
hatten sechs Kinder. Er wurde später Stadtpfarrer in Ebingen.<br />
1896 beantragte Wilhelm Keller, daß sein Sohn Eugen, der das Predigtexamen bestanden<br />
hatte, ihm als Vikar zugeteilt werde. Der Bitte wurde entsprochen. (Pfarrarchiv)<br />
1897-1908: Paul Heinrich Andler *22.5.1861 in Crailsheim als Sohn des Diakons Friedrich<br />
Ludwig Emil Andler und der Eugenie geb. Georgii.<br />
Heirat am 25.9.1894 mit Amalie Marie Mathilde geb. Hilbert, Tochter des Kanzleirates<br />
Johann Karl Friedrich Hilbert und Babette geb. Bumiller aus Stuttgart.<br />
Pfarrer Andler hatte zwei Söhne, deren Ältester in Giengen a. d. Brenz geboren wurde, wo<br />
Pfarrer Andler amtierte, ehe er nach Gechingen kam. 1908 wurde Andler erster Stadtpfarrer in<br />
Besigheim und später Kirchenrat in Stuttgart.<br />
Pfarrer Andler gründete in Gechingen den Jünglingsverein, der sich im Pfarrhaus<br />
versammelte. Im Oktober 1905 ließ er eine Zeitung erscheinen, die den Namen<br />
"Evangelisches Gemeindeblatt für Gechingen" führte.<br />
Im Calwer Wochenblatt konnte man am 19.2.1908 lesen:<br />
142
"Heute verließ uns nach beinahe 10jähriger Tätigkeit Pfarrer Andler mit seiner Familie, um<br />
das Dekanat Besigheim zu übernehmen. Am gestrigen Sonntag hielt er in der gutbesuchten<br />
Kirche seine treffliche Abschiedspredigt. Der Kirchenchor ehrte den Scheidenden mit einem<br />
Ständchen und heute begleiteten Mitglieder des bürgerlichen- und Kirchengemeinderates die<br />
Pfarrfamilie auf die Station Althengstett. Dabei kam es dort zu einem Unfall. Frl. Jakobine<br />
Wagner von hier sollte einige Tage lang bei der Einrichtung des Hauses in Besigheim Hilfe<br />
leisten. Beim Abspringen vom Gefährt blieb dieselbe mit den Kleidern hängen und trug einen<br />
komplizierten Beinbruch davon." (Pfarrarchiv)<br />
1908-12: Pfarrer Hermann August Beitter *27.3.1866 in Münchingen als Sohn des<br />
Wundarztes Christoph Heinrich Beitter und Friederike geb. Beitter aus Münchingen. Heirat<br />
am 5.9.1893 mit Amalie Eugenie geb. Lessing * 11.5.1865, Tochter des Pfarrers Gustav Adolf<br />
Lessing und Clara Francisca geb. Maier aus Talheim. Zunächst war H. A. Beitter Pfarrer in<br />
Enzberg. Seine drei Kinder wurden geboren, ehe er die hiesige Pfarre übernahm.<br />
Intrigen des <strong>Gechinger</strong> Wundarztes, der um seine Existenz fürchtete, weil der Pfarrer<br />
Kenntnisse der homöopathischen Heilkunde hatte und offenbar mit Erfolg anwandte, führten<br />
zum vorzeitigen Amtsende in Gechingen.<br />
Am 29.9.1912 stand folgender Artikel im Calwer Wochenblatt:<br />
"Nicht geringe Aufregung verursachte in der Gemeinde Gechingen die Nachricht, daß unser<br />
Seelsorger, Herr Pfarrer Beitter, uns verlassen wolle. Wir verlieren nicht nur einen ausgezeichneten<br />
Seelenarzt, sondern auch auch einen tüchtigen Arzt für leibliche Gebrechen. Aber<br />
gerade dadurch, daß er seine homöopathische Heilkunde kostenlos zur Verfügung stellte, hat<br />
er sich eine Feindschaft zugezogen. Bei jedem geringen Anlaß sorgte ein anonymer<br />
Briefeschreiber dafür, Pfarrer Beitter bei der höheren Stelle zu verdächtigen. Könnten nicht<br />
unsere Ortsväter dem hinterhältigen Briefeschreiber das Handwerk legen?"<br />
Am 22.10.1912 hieß es weiter:<br />
"Noch im Laufe dieser Woche wird Herr Beitter uns verlassen. In seiner schlichten<br />
Bescheidenheit hat er jede öffentliche Verabschiedung abgelehnt. An zwei Gemeindeabenden<br />
konnte jedoch die Einwohnerschaft zeigen, daß sie zu ihrem Pfarrer steht. Wir wünschen ihm<br />
und seiner Familie alles Gute an seinem neuen Wirkungskreis."<br />
Am 25.10.1912:<br />
"Die gesamte Einwohnerschaft von Gechingen stand Spalier, als Pfarrer Beitter mit Familie<br />
unseren Ort verließ. Alle winkten und riefen ihm ein Lebewohl zu. Viele ließen es sich nicht<br />
nehmen, mit ihren Wagen und Kutschen die Abreisenden nach dem Bahnhof Gärtringen zu<br />
begleiten. Wie zu erfahren war, soll der anonyme Briefschreiber Pfarrer Beitter an seinem<br />
neuen Ort bereits als gemeingefährlich angeschwärzt haben. Dieser Schreiber spricht sich<br />
selber sein Urteil! Wir hoffen, daß der Ränkeschmied dort kein Gehör findet."<br />
Von Gechingen aus ging Pfarrer Beitter 1912 nach Bodelshausen und übernahm dann 1913<br />
ein Kirchenamt bei der Hospitalpflege in Stuttgart. (Pfarrarchiv)<br />
1913-28: Pfarrer Karl Wilhelm Otto Grundgeiger *25.3.1871 in Öhringen als Sohn des<br />
Oberlehrers Otto Grundgeiger und Maria geb. Scharr aus Öhringen. Heirat am 4.7.1901 mit<br />
Helene Julie geb. Bach, *9.6.1874 Tochter des Buchbinders Christoph Bach und Maria geb.<br />
Liesching aus Stuttgart. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor.<br />
Pfarrer Grundgeiger war vorher in Mähringen bei Ulm tätig. (Pfarrarchiv)<br />
1928-37: Pfarrer Paul Traugott Reusch *10.2.1901 in Dharwar/Ostindien, als Sohn des<br />
Pfarrers Traugott Friedrich Reusch und Marta geb. Ensinger. Heirat am 11.9.1930 mit<br />
Margareta geb. Plank *23.4.1908, Tochter des Stadtpfarrers Reinhold Plank und Anna geb.<br />
Mayer aus Winnenden. Der älteste Sohn Klaus ist in Gechingen geboren. "Aus Dankbarkeit<br />
gegen Gott für die glückliche Ankunft des ersten Buben" steuerte Pfarrer Reusch 100.-RM für<br />
die Anschaffung eines elektrischen Orgelmotors bei, der das mühselige Orgeltreten<br />
überflüssig machte.<br />
143
Pfarrer Paul Traugott Reusch war vorher in Gnadental und Nürtingen, später in<br />
Neuenstadt/Kocher.<br />
Am 20.3. 1932 wurde in der Kirche auf seine Veranlassung hin zum erstenmal ein Rundfunkkonzert<br />
übertragen und zwar die Bach´sche Osterkantate. Die Übertragung wurde von den<br />
Besuchern sehr gelobt.<br />
Der sogenannte Kirchenkampf schlug auch bei uns Wellen. Die Führung der NSDAP suchte<br />
1933 eine einheitliche Evangelische Reichskirche zu schaffen, und die nationalsozialistisch<br />
ausgerichteten "Deutschen Christen" betrieben massiv die "Entjudung" von Kirche und Lehre.<br />
Landesbischof Wurm wurde zum Wortführer des Widerstands der Evangelischen Kirche<br />
gegen das Regime, war dadurch scharfen Angriffen ausgesetzt, und das Verlesen seiner Briefe<br />
wurde verboten. Umso höher ist der Mut Pfarrer Reuschs zu werten, der im Auftrag des<br />
Kirchen-gemeinderates ein Telegramm an den Reichsbischof Müller sandte. Der Text lautete:<br />
"Erschüttert über die rechtswidrigen und lügnerischen Machenschaften der "Deutschen<br />
Christen" in der Evangelischen Kirche, stellt sich unsere Gemeinde geschlossen hinter<br />
unseren Landesbischof Wurm und weist alle in Presse und Rundfunk über ihn verbreiteten<br />
unwahren Nachrichten zurück. Wer bewußt nur die halbe Wahrheit sagt, der lügt. Wer bewußt<br />
im kirchlichen Amt nur auf eine kleine Gruppe hört, geht Irrwege. Wir fordern Aufhebung der<br />
Notverordnung vom 15. April, da die Bedingungen dazu fehlen."<br />
In einem Schreiben vom 12.1.1934 an den in Stuttgart erscheinenden "NS-Kurier" verwahrte<br />
sich Pfarrer Reusch gegen die "Art und Weise, wie mit unserem Landesbischof Wurm in der<br />
Presse umgegangen wird. Ich höre immer wieder mit Empörung, wie in Ihrem Blatt, zu dessen<br />
Lesern auch ich gehöre, über kirchliche Fragen berichtet wird. Gehört es nicht zu den ersten<br />
Regeln des Anstandes und der Wahrhaftigkeit, daß man bei einem Streit beide Parteien<br />
anhört? Hat weiter Ihre Redaktion so wenig Begriff von den Gesetzen der menschlichen<br />
Psyche, daß sie wagt, in der Öffentlichkeit der Politik den Vorrang zu geben vor der Religion<br />
und unseren Landesbischof zurechtweisen zu wollen? Gegenüber Vorgängen, wie sie der<br />
Bischof rügt, muß die Kirche selbstverständlich scharf auftreten, denn sie gehören zum<br />
kirchlichen Leben und scheinen trübe Hintergründe zu besitzen." (Pfarrarchiv)<br />
1937-41: Pfarrer Karl Lilienfein *6.12.1909 in Backnang, gefallen am 1.7.1941 in Rußland.<br />
Heirat am 12.8.1937 mit Elsbeth geb. Höchel aus Backnang. Karl Lilienfein war vorher in<br />
Stuttgart und Brenz.<br />
Pfarrer Lilienfein gründete 1938 einen Evangelischen Gemeindeverein. Dessen Ziele waren:<br />
1. Ungeschmälerter Dienst der Kirche zur Verbreitung von Gottes Wort.<br />
2. Enger Zusammenschluß der Gemeindemitglieder.<br />
3. Gründung eines Gemeindehelferkreises.<br />
4. Bau eines Gemeindehauses.<br />
Am 20.6.1939 wurde der Evangelische Gemeindeverein durch Beschluß der Gestapo verboten<br />
und aufgelöst.<br />
Daß auch Pfarrer Lilienfein mit dem weiterschwelenden Kirchenstreit zu tun bekam, zeigt ein<br />
Brief vom 20.6.1938 von der Kreisleitung der NSDAP. Ein Mann, der seine Predigten in der<br />
Kirche überwachte, meldete der Partei, Pfarrer Lilienfein habe die NSV<br />
(Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) beleidigt. Pfarrer Lilienfein wußte sich gegen diese<br />
Behauptung mit Erfolg zu wehren. (Pfarrarchiv)<br />
1941-46: In diesen Jahren hatte die Gemeinde keinen ständigen Pfarrer. Zur Aushilfe waren<br />
tätig:<br />
1941 - 44 Pfarrer Lempp von Stammheim<br />
1944 - 45 Pfarrer Wennberg<br />
1945 Pfarrer Haage<br />
1946 Pfarrer Schwarzmaier<br />
144
Am 23.8.1941 mußte der Pfarrer eine Erklärung für die Gestapo unterschreiben, daß er<br />
Kanzelverkündigungen des Landesbischofs Wurm nicht mehr verlesen würde. Der<br />
Bürgermeister wurde als Aufpasser verpflichtet. Die Auseinandersetzungen mit Pfarrer<br />
Lilienfeins Amtsverwesern dauerten mit unterschiedlicher Heftigkeit bis 1945 an. Nur weil<br />
man diesen Streit während der Dauer des Krieges für unzweckmäßig hielt, verschob das<br />
Regime die "Abrechnung" mit den Widerstrebenden auf die Zeit nach dem "Endsieg".<br />
(Pfarrarchiv)<br />
Die Pfarrer aus der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg sind nur aufgelistet und Besonderheiten<br />
angemerkt. Ihre Lebensdaten stehen unter Datenschutz.<br />
1946-50: Pfarrer Adolf Zielke<br />
1951-59: Pfarrer Theodor Ulmer<br />
Er übernahm später eine Stelle als Religionslehrer in Stuttgart.<br />
1959-72: Pfarrer Adolf Burkhardt, geboren in Asperg, zog 1972 nach Bissingen/Teck und trat<br />
1991 in den Ruhestand. Er war Vorsitzender des Internationalen Christlichen Esparanto-<br />
Bundes.<br />
Evangelisches Gemeindeblatt vom 5.4.1992:<br />
"Seit über 30 Jahren, so Landrat Peter Braun bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes<br />
am 19.3.1992 in Esslingen, habe sich Pfarrer Burkhardt ehrenamtlich für die Belange der<br />
Kultur, der Sprachwissenschaft, der Ökumene und der internationalen Verständigung<br />
eingesetzt. 25 Jahre habe er sich dem Aufbau der jetzt in Aalen beherbergten Deutschen<br />
Esparanto-Biliothek gewidmet. Die weltweit beachtete Spezialsammlung umfaßt über 10 000<br />
Buchtitel und rund 900 Zeitschriften aus mehr als 50 Ländern."<br />
1972-86: Pfarrer Werner Kenner * Nellingen<br />
1986-heute: Pfarrer Michael Beck * Waldorf-Haslach<br />
Er amtierte vorher in Österreich.<br />
Die Mesner<br />
Das Mesnerlehen, vom Stifter zum Unterhalt des Mesners bestimmt, gelangte mit dem<br />
übrigen Kirchensatz um 1440 an die Markgrafschaft Baden. Rund hundert Jahre später, im<br />
Jahre 1539, verlieh der damalige Markgraf Ernst von Baden dieses Lehen an seinen<br />
Mundkoch Franz Kaag bzw. dessen leibliche Erben. Die Verleihungsurkunde lautet wie folgt<br />
(Orthographie moderni-siert):<br />
"Dokument von 1539, das Mesnerlehen betreffend. Wir, Ernst von Gottes Gnaden, Markgraf<br />
zu Baden und Hochberg, Landgraf zu Süßenberg, Herr zu Röteln und Badenweiler usw. Wir<br />
tun kund und bekennen mit diesem Brief, daß wir uns und unsere Erben unserem Mundkoch<br />
und lieben Getreuen, Franz Kaag und seinen ehelichen Leibeserben in Ansehen seines<br />
untertänigst getreuen Dienstes, so er weiland dem hochgeborenen Fürsten, unserem<br />
freundlichen lieben Bruder Herrn Philippen, Markgraf zu Baden usw. löblichen und seligen<br />
Gedächtnis und uns lange Jahre bewiesen hat, und fürhin tun soll und mag, das Mesneramt zu<br />
Gechingen, welches durch tödlichen Abgang Heinrichen Klebergers kürzlich erledigt,<br />
gnädiglich geliehen habe und tun das in und mit Kraft dieses Briefes. Also, daß er und die<br />
Gemeldeten, seine ehelichen Leibeserben dasselbige Mesneramt durch sich selbst oder andere<br />
dazu taugliche Person besetzen, verwalten und versehen und dagegen die Nutzung so daselbe<br />
Mesneramt hat, empfangen, nutznieß und gebrauchen sollen und mögen mit aller Zugehörung<br />
und Gerechtigkeit. Dermaßen wie es gemeldeter Heinrich Kleberger in Zeit seines Lebens und<br />
seiner Vorderen innegehabt, genützt und genossen haben. Doch wollen wir, und das ist unsere<br />
Meinung, daß des genannten Mundkoch jetzige Hausfrau es, gleich ob sie den Tod ihres<br />
Mannes erlebt, solch Mesneramt ihr Lebenlang jetzt gemeldeter Maßen nießen, auch erst nach<br />
ihrem Tode, auf ihre beide Leibeserben wie obgemeldet fallen soll ohne Gefährde. In Urkund<br />
145
mit unsrem anhangenden Insiegel besiegelt; gegeben in unserer Stadt Pforzheim auf den 27.<br />
Tag des Monats Juni nach Christi unseres lieben Herrn Geburt 1539."<br />
Bis etwa 1840 hatte die hiesige Mesnerstelle den Kaag´schen Erben jährlich 20 Gulden<br />
abzuliefern. Man bedenke, 300 Jahre lang blieb diese Forderung bestehen! Schließlich ging<br />
den <strong>Gechinger</strong>n die Geduld aus, zumal die Familie Kaag einer anderen Konfession angehörte.<br />
Es entwickelte sich ein langwieriger Prozeß, der unser Dorf viel Geld kostete. Der Prozeß<br />
wurde vom damaligen Stadtschultheißen, Johann Bräuning von Sindelfingen, im Amt von<br />
1826 - 1832, als Abwesenheitsvormund eines Georg Friedrich Dannkann von Rastatt geführt.<br />
1835 konnte die Gemeinde Gechingen das Mesnerlehen erwerben.<br />
Aus dem Jahre 1797 stammt ein Dokument, das vom Mesnerlehen und seiner Abgrenzung<br />
durch Marksteine handelt. Die Steine waren mit einem großen eingehauenen M und einer<br />
Nummer versehen. Mitglieder des Arbeitskreises versuchten, diese Steine aufzufinden und<br />
damit das Mesnerlehen zu lokalisieren, sie mußten aber feststellen, daß in der Flur keine<br />
Steine mehr vorhanden sind. Durch Zufall wurde dann in einem Hof in der Hauptstraße ein<br />
Stein entdeckt. Er trägt die Nr. 5 und ein M., er ist bis jetzt der einzige Zeuge über die<br />
Versteinung des Mesnerlehens. Offenbar stieß es aber schon 1797 auf Schwierigkeiten, den<br />
genauen Umfang des Mesnereilehens festzustellen, wie der folgende Bericht beweist:<br />
"Zelg Calw = 49 Morgen, Zelg Angel = 54 Morgen 1 Viertel, Zelg Staig = 44 Morgen, 2<br />
Viertel.<br />
Das hier allegerierte (angeführte) Mesnerei Zehent Lagerbuch selbst ist also das einzige<br />
Dokument, welcher den Umfang dieses Zehend Rechtes begründet und welches im Jahr 1604<br />
durch den damaligen Amtsschreiber Drötsog in Merklingen erneuert worden. Bei dem Mangel<br />
einer specieficierten Beschreibung dieses in vielerlei Distrikten bestehenden<br />
Mesnereizehenden und einer Versteinung desselben mußten daher notwendig mancherlei<br />
Irrungen, Strittigkeiten und Klagen zwischen den beiderseitigen Zehend Rechten und<br />
Auszählern entstehen, welche ohne eine Renovation weder amtlich noch gerichtlich erörtert<br />
werden könnten. Weswegen man sich von Seiten des Herzoglichen Kirchenrates zu Vornahme<br />
einer ordentlichen Renovation entschlossen und solches Geschäft unter den Vorbehalt des<br />
Klosterbeitrags von den interessierten Teilen dem Forstrenovator Christian Heinrich Hahn<br />
gnädigst übertragen hat. Unter Beiziehung des gegenwärtigen Schulmeisters und Mesners,<br />
Georg Andreas Hartmann mit ihren gegenwärtigen Inhabern, Nebenliegern und Anstößer aufs<br />
neue gefertigt und beschrieben, sofort mit erhabenen Steinen und aufgehauenen Zeichen<br />
untergänglich (Siehe auch "Der Untergänger" bei "Berufen") vermarken lassen, wie hiernach<br />
das Weitere umständlich zu erfahren sein wird."<br />
Lange Zeit war es vielerorts, auch in Gechingen, üblich, daß der Lehrer gleichzeitig auch den<br />
Mesnerdienst versah.. Am 31.7.1899 wurde ein entsprechendes Gesetz erlassen und gegen<br />
Ende des 19. Jahrhunderts auch in Gechingen die Mesnerei vom Schuldienst getrennt.<br />
Das Gras auf dem Friedhof gehörte mit zu den Einkünften des Mesners. Anfang 1800 heißt es:<br />
"3 Kirchhöfe zu genießen. 3/4 im Mess, Ertrag etwa 6 Gulden." Als Mesner- und Lehreramt<br />
getrennt wurden, mußte der Lehrer, wenn er das Gras weiterhin wollte, dem Mesner 5 Gulden<br />
bezahlen.<br />
1894 wurde der Mesner entlassen, weil er in seiner Freizeit öffentlich Marionettenspiele<br />
aufführte, eine Tätigkeit , die sich, laut Kirchengemeinderat, "mit dem Ansehen des Mesners<br />
in der Gemeinde nicht verträgt". Allerdings war dem Betreffenden schon vor Antritt seines<br />
Dienstes künftig das Puppentheaterspielen untersagt worden.<br />
Ein Kirchengemeinderatsbeschluß von 1904 lautet: "Der Jahresgehalt des Mesners beträgt 150<br />
Mark, als Orgeltreter noch 50 Mark dazu und für das Aufziehen der Kirchturmuhr noch 5,50<br />
Mark extra. Der Mesner hat zu läuten bei den Gottesdiensten, Hochzeiten, Betstunden,<br />
146
Beerdigungen. Weiteres Läuten: Alle Tage um 11 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, um 18-19 Uhr<br />
Abendläuten.“<br />
Eine Aufstellung vom 2.6.1904 legt fest:<br />
"1. Täglich 4 x läuten à 5 Pf. =365 x 5 =73 Mark, abgerundet, weil Sonntags nur 2 x zu läuten<br />
ist, 70 Mark<br />
2. Läuten zu Gottesdiensten mit 2 Zeichen und Herrichten der Kirche à 15 Pf. 140 x 15= 21<br />
Mark<br />
3. 25 Werktags-Kinderlehre 1 Zeichen à 5 Pf.= 1,25 Mark<br />
4. Beerdigungen, Läuten und Begleiten 25 x 10 Pf.= 2,50 Mark“<br />
Katholische Gemeinde<br />
Nach dem zweiten Weltkrieg kamen auch Katholiken in unseren seit der Reformation rein<br />
evangelischen Ort. Sie schlossen sich mit Glaubensgenossen aus den Gemeinden Aidlingen,<br />
Deufringen, Lehenweiler und Dachtel zur Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt zusammen.<br />
In Gechingen wohnen ca. 750 Katholiken, die die Gottesdienste in Mariä Himmelfahrt in<br />
Aidlingen oder St. Fidelis in Dachtel besuchen. An jedem zweiten Samstag findet um 18.30<br />
Uhr eine Vorabendmesse in der <strong>Gechinger</strong> Martinskirche in Gechingen statt.<br />
Adventgemeinde<br />
Im Herbst 1919 wurde die Glaubensgemeinschaft mit 11 Personen in Gechingen gegründet.<br />
Zuerst wurden die Versammlungen in Wohnzimmern der Mitglieder abgehalten. Schon früh<br />
entstand eine eigene Jugendabteilung. Die Prediger kamen bis 1930 von außerhalb. Seither<br />
verrichteten zwölf Glaubensverkünder ihren Dienst.<br />
Die Raumnot war eklatant, die Gemeinde mußte zeitweise von der Calwer Adventgemeinde<br />
beherbergt werden. So beschloß man, eine eigene Kapelle in Gechingen zu errichten. Der<br />
Bauplatz auf dem "Käppelesberg" wurde der Gemeinde von einem Mitglied geschenkt und<br />
dank finanzieller Hilfe der Stuttgarter Gemeinschaftsleitung konnte der Bau Ende 1963 in<br />
Angriff genommen werden. Unter Mithilfe der ganzen Adventgemeinde wurde die Kapelle<br />
nach zwei Jahren fertiggestellt. Heute zählt die Adventgemeinde Gechingen nur knapp 30<br />
Mitglieder. 1995 feierte sie ihren 75. Geburtstag und gleichzeitig das 30jährige Bestehen der<br />
Kapelle.<br />
Schule und Schulwesen<br />
Herzog Christoph erließ 1559 die Große Kirchenordnung, in der auch die Schulordnung<br />
enthalten war. Darin heißt es zur Einführung: "Damit dann auch die Jugend in und bei unserer<br />
deutschen Schule, mit der Furcht Gottes, rechter Lehr und guter Zucht, wohl unterrichtet und<br />
erzogen, und hierunter Gleichheit seie, so wollen wir, daß im solchen folgende Ordnung<br />
gehalten werde."<br />
Vorgesehen war neben den Lateinschulen in den Städten eine möglichst umfassende<br />
Schulbildung auch auf dem Land in "deutschen Schulen". Den Zeitpunkt des ersten<br />
Schulunterrichtes in Gechingen können wir nicht mehr rekonstruieren. Das älteste Dokument<br />
über einen Lehrer und somit über die Schule in unserem Ort stammt vom 10. 3. 1581 und<br />
lautet kurz: "Altschulmeister Hans Aumersch stirbt." Es gibt aber von diesem Zeitpunkt an<br />
immer wieder Hinweise darauf, daß der Schulunterricht kontinuierlich weiterlief, obwohl es<br />
noch keine allgemeine Schulpflicht gab. Sie wurde erst 1648 eingeführt<br />
In der württembergischen Schulordnung von 1723 hieß es: "Es sollen aber die Schulmeister in<br />
dem züchtigen der Ruten mäßigen Gebrauch machen, die Kinder nicht bei den Haaren ziehen,<br />
auf die Köpfe schlagen oder dergleichen, sondern in den Strafen ziemliche Maß zu halten."<br />
147
Aus einer Notiz aus dem Jahr 1743 können wir ersehen, wie damals über die Besetzung einer<br />
freien Schulmeisterstelle entschieden wurde: "Es wurde Session (Sitzung) vom ganzen<br />
Magistrat und 4 Deputierten aus der Gemeinde gehalten, um sowohl einen neuen Schulmeister<br />
(zu wählen), als auch der hinterlassenen Witwe etwas zu geben. Wenn ein Lediger<br />
Schulmeister werden sollte, so solle derselbe der Witwe eine Vierteljahrbesoldung frei<br />
zukommen lassen, desgleichen von allen Schulgeldzehnten außer den Nebeneinkünften, die<br />
gehören ihm allein." Der gewählte Lehrer hieß Jörg Kappis und war ein Sohn des damaligen<br />
Schultheißen.<br />
Von ihm stammt ein Schriftstück über die Schule: "Es ist bei letzter Schulvisitation mir<br />
aufgegeben worden, das was in allhiesigem Schulhaus mangelhaft und nötig zu machen wäre,<br />
auf Papier zu bringen, damit man es einem löblichen Magistrat vortragen könne. Und wäre<br />
folgendes:<br />
Erstlich ist der Schulofen mangelhaft und ist an demselben die unterste Platte gesprungen,<br />
welche zu binden nötig.<br />
Ferner wäre an dem genannten Ofen außerhalbs ein kleines Türlein nötig mit Eisen<br />
beschlagen, weil bei stürmischen Wetter kein Feuer im Ofen brennen will und man dabei zu<br />
besorgen hat, weil die Schuljugend an demselben aus und eingeht, aus Vorwitz mit dem Feuer<br />
zu spielen und ein größeres Unglück daraus entstehen könnte.<br />
Drittens: Sind die Schultische in einem sehr üblen Stand, welche eine gute Reparation nötig<br />
hätten.<br />
Viertens: Wäre ein Laden zu machen nötig in dem Schulgang und wäre das Tor in dem<br />
Schulgang ebenfalls in einen guten Zustand zu stellen."<br />
Es muß also damals schon ein Schulhaus gegeben haben. Das älteste bekannte Schulgebäude<br />
stand an das (alte) Rathaus angelehnt.<br />
Die Lehrer waren damals nicht so gut ausgebildet wie heute, es waren oft alte Soldaten,<br />
Veteranen, die unterrichteten. Als um 1785 eine herzogliche Verordnung befahl, daß die<br />
Landschulmeister auch die Rechenkunst lehren sollten, erklärten einige alte Schullehrer, daß<br />
sie lieber ihren Dienst aufgeben würden als das zu tun.<br />
Die Schulmeister teilten früher ganz das Leben der Gemeinde, waren sie doch mit der Arbeit<br />
auf ihren Schulgütern an die gleichen Voraussetzungen gebunden und hatten die selben<br />
Sorgen wie die Mehrheit der bäuerlichen Bevölkerung.<br />
Wie aus einer Rechnung von 1810 hervorgeht, besuchten damals schon 176 Kinder die<br />
Schule. Es heißt da: "Bei der auf Georgi 1810 abgehaltenen Schulvisitation ist jedem<br />
Schulkind ein Kreuzer Brot gegeben worden. So sind es nach beiliegendem Schulzettel<br />
gewesen = 176 Kinder. Simon Kielwein, Beck, hat gebacken, macht zusammen: 2 Gulden 56<br />
Kreuzer, welche vom Heiligenpfleger bezahlt wurden."<br />
Die Volksschule wurde erst zweiklassig, später dann dreiklassig geführt.<br />
In den Jahren 1833/34 wurde ein neues Schulhaus gebaut, welches dann bis 1969 benutzt<br />
wurde. Außer den Klassenräumen befand sich die Dienstwohnung für den Lehrer darin, und<br />
im Untergeschoß waren ursprünglich Ställe, denn mit der Lehrerstelle war lange, auch ein<br />
landwirtschaftlicher Betrieb verbunden. Später baute man statt der Ställe einen Kindergarten<br />
und die Gemeindewaage ein.<br />
Der Kostenvoranschlag für diese neue Schule betrug:<br />
Mauerarbeit 2.450 Gulden 3 Kreuzer<br />
Gipserarbeit 201 Gulden 15 Kreuzer<br />
Zimmerer 1.022 Gulden 7 Kreuzer<br />
Schreiner 881 Gulden 20 Kreuzer<br />
Glaser 266 Gulden 33 Kreuzer<br />
Schlosser 457 Gulden 46 Kreuzer<br />
148
Flaschner 33 Gulden 36 Kreuzer<br />
Pflästerer 80 Gulden<br />
Maler 96 Gulden 40 Kreuzer<br />
Hafner 6 Gulden<br />
zusammen 5.495 Gulden 20 Kreuzer.<br />
Am 17. 7. 1834 wurden u. a. folgende Reime von Pfarrer Klinger in den Grundstein eingelegt:<br />
"Von alten, vergangenen Zeiten zu lesen<br />
ist man jederzeit, Freunde, begierig gewesen.<br />
Man denkt so gerne an sie zurück<br />
und preist oft allein nur der Alten Geschick.<br />
Über Gegenwart hört man viel Murren und Klagen,<br />
nur immer vom Glück der Altväter sagen.<br />
Doch gleicht sich im Ganzen der Zeiten Lauf,<br />
bis Gott im Himmel sie löset auf.<br />
Wie jetzt es steht im Vaterlande,<br />
besonders in unserem Gemeindeverbande,<br />
dies zeichnen wir auf für die spätere Zeit<br />
und legen es in den Grundstein heut.<br />
Man nimmt gegenwärtig an, daß auf der ganzen Erde 1.000 Millionen Menschen wohnen, von<br />
diesen kommen auf die Juden 2.500.000 auf die Christen 200 Millionen, auf die<br />
Mohammedaner 140 Millionen, auf die Heiden 650 Millionen. Nach der letzten Zählung 1832<br />
hat Württemberg 1.578.147 Einwohner, nämlich 768.385 männliche und 809.782 weibliche.<br />
Unser Ort zählte am 1. November dieses Jahres 545 männliche und 562 weibliche, zusammen<br />
1.107 Einwohner. Schulkinder sind hier 211, Bürger samt Witwen 270. Das<br />
Gemeindevermögen beläuft sich auf 9.000 Gulden, nicht eingerechnet 1.428 Morgen Wald,<br />
das Stiftungsvermögen auf 14.720 Gulden. Andere Merkwürdigkeiten vom Vaterlande sind in<br />
einem besonders beiliegenden Buch genau enthalten. Jahrhunderte kommen, Jahrhunderte<br />
scheiden! Aus einem Legendenbuch von 1809, Seite 356."<br />
Beim Abbruch des Gebäudes im Jahre 1982 wurden im Grundstein nur ein paar Münzen und<br />
ein zerstörtes Dokument gefunden.<br />
Neben dem Schulhaus errichtete man das Feuerwehrgerätemagazin. Der als Gerätemagazin<br />
genutzte Teil war von unten zugänglich. Darüber, unterm Dach war bis 1833 die Scheuer des<br />
Eisenhardtschen Hauses untergebracht, die ihre Zufahrt von oben hatte. Ab 1872 wurde der<br />
Scheuernteil des Gebäudes dann als Schulscheuer (Holzlager) benützt.<br />
In der Zeit von 1866 bis 1882 gab es an der <strong>Gechinger</strong> Schule einen Realschulzug. Diese<br />
Realschule wurde auch von auswärtigen Schülern besucht, die sich hier für die<br />
Aufnahmeprüfung in die Lehrerseminare vorbereiteten. Manche dieser jungen Leute wohnten<br />
bei <strong>Gechinger</strong> Familien und brachten zusätzliches Geld ins Dorf. Schon im Gründungsjahr<br />
1866 hatte die Realschule 42 Schüler. Das Schulgeld betrug 2 Gulden im Jahr. Der erste<br />
Mittelschullehrer hieß Büttner. Er wohnte in dem Haus des früheren Bürgermeisters und<br />
Notars Pregizer in der Calwer Straße, das als weitere Dienstwohnung für Lehrer diente. Als<br />
Gehalt bezog Herr Büttner 500 Gulden pro Jahr. Bürgernutzen, Wohnung und Garten wurden<br />
mit 35 Gulden angerechnet. Als Schulbrennholz standen ihm 50 buchene und 50 tannene<br />
Wellen (Bündel) zu. 1869 vergrößerte man die Räume der Mittelschule im dritten Stock des<br />
Schulhauses. Die Kosten hierfür betrugen 250 Gulden.<br />
1874 bis 1875 war das Jahr mit den höchsten Schülerzahlen. 48 Kinder besuchten die<br />
<strong>Gechinger</strong> Mittelschule. Von da an sank die Schülerzahl allerdings stetig. 1882 wurde die<br />
Schule aufgelöst, die restlichen 25 Schüler wurden in die Oberklasse der <strong>Gechinger</strong><br />
Volksschule übernommen.<br />
Einige Zahlen über die Entwicklung der Schülerzahlen in der Volksschule:<br />
149
1865/66 171 Schüler. Pro Schüler mußten 20 Kreuzer Schulgeld bezahlt werden.<br />
1884/85 229 Schüler und 75 Sonntagsschüler wurden von drei Lehrkräften unterrichtet.<br />
1900/01 181 Schüler und 43 Fortbildungsschüler wurden gezählt.<br />
Einer Ortsbeschreibung von 1905 entnehmen wir: "Die Volksschule umfaßt drei Klassen. Die<br />
Unterklasse für das 7. bis 10., die Mittelklasse für das 10. bis 12. und die Oberklasse für das<br />
12. bis 14. Lebensjahr. Die Unter- und die Oberklasse ist mit je einem ständigen, die<br />
Mittelklasse mit einem unständigen Lehrer besetzt. In der Oberklasse ist Zeichnen<br />
obligatorisch, außerdem als fakultatives Fach Französisch eingeführt. Für die Mädchen<br />
besteht freiwilliger Arbeitsunterricht." Die Mädchen bekamen noch zusätzlich Unterricht in<br />
einer Näh- und Strickschule. Dieser Unterricht dauerte im Schuljahr 1865/66 zum Beispiel 42<br />
halbe Tage, dafür erhielten die beiden Lehrerinnen je 15 Kreuzer Entgelt. Es waren dies die<br />
Witwe Anna Maria Vollmer und Maria Jehle von Gechingen.<br />
1897 wurde die Stelle des Lehrers der Oberklasse neu ausgeschrieben. Das Jahresgehalt<br />
betrug: Bar 1011,00 Mark, als Zulage für Zeichnen und französischen Sprachunterricht waren<br />
235,00 Mark vorgesehen. Dazu kamen 18,6 Zentner Dinkel, Gartengenuß 5a 30qm,<br />
Bürgergabe 50 - 70 Wellen Holz. Der Lehrer der Unterklasse erhielt jährlich: Bar 954,88<br />
Mark, 19 Zentner 37 Pfund Dinkel, Gartengenuß 3a 8qm, Bürgergabe 50 - 70 Wellen Holz.<br />
Ordnung und Zucht in der Volksschule wurden von Pfarrer und Kirchenkonvent streng<br />
überwacht. Unentschuldigte Schulversäumnisse rügte der Konvent im Beisein der<br />
betreffenden Schüler und Eltern öffentlich, was als Schande galt. Später wurden<br />
Übertretungen vom Lehrer dem Schultheißen gemeldet, der dann die Strafen festsetzte. So<br />
waren zum Beispiel 1901 vier Schüler der Oberklasse ohne Aufsicht im Gasthaus "Rößle" in<br />
Dachtel. Sie wurden dafür mit je drei Stunden Ortsarrest bestraft. Den acht Schülern, die 1902<br />
im Gasthaus "Adler" waren, erging es ähnlich. Wenn an den Schulversäumnissen die Eltern<br />
oder Ausbilder schuldig waren, weil sie den Schüler oder die Schülerin durch häusliche oder<br />
berufliche Arbeiten vom Schulbesuch abhielten, verhängte der Schultheiß Strafen.Von 1 Mark<br />
bis zu einem Tag Haft. So z. B. 1906, als ein Mädchen zu Hause bleiben mußte, um Kinder zu<br />
hüten. Auch einem Ausbilder, der seinen Fortbildungsschüler nicht in die Abendschule ließ,<br />
sondern ihn beschäftigte, wurde bestraft.<br />
Die Schulzeit dauerte 7 Jahre, danach kam noch die sogenannte Fortbildungsschule, die bis<br />
zum 18. Lebensjahr ging und von den Lehrern abwechselnd abends für die Knaben und<br />
nachmittags für die Mädchen gehalten wurde. Dies war die Vorgängerin der späteren<br />
Berufsschulen.<br />
Die Räum-lichkeiten der Schule reichten noch bis zum Ende des zweiten Weltkrieges völlig<br />
aus, erst ca. 1960 wurden Klagen über die räumliche Enge laut. Die zu niederen Räume und<br />
schlechte Beleuchtung wurden reklamiert. Außerdem mußten die Fußböden noch von Hand<br />
eingeölt werden.<br />
1956 zählte die <strong>Gechinger</strong> Schule in 8 Klassen 97 Schüler. 1960 waren es bereits 128 Schüler.<br />
Ein Um- oder Neubau stand zur Debatte. Die Gemeinde entschied sich für einen Neubau.<br />
Kurzfristig wurde die 4. Klasse in einen 1965 erbauten Pavillion in den Wolfswiesen<br />
ausgelagert. Dieses Gebäude wird heute als Kindergarten benutzt. Da die Schülerzahlen,<br />
durch die neuen Baugebiete weiter anstiegen, erstellte man am 1. Dezember 1966 als<br />
Zwischenlösung auf dem Platz des künftigen Schulgeländes zwei Pavillions. Dem Architekten<br />
gelang es, diese zwei Pavillions so mit dem Neubau zu verbinden, daß der ganze Komplex<br />
heute eine Einheit darstellt. Die neue Grund- und Hauptschule erhielt den Namen<br />
"Schlehengäuschule" und wurde am 13. September 1969 eingeweiht.<br />
Das alte Schulgebäude samt dem ehemaligen Feuerwehrgerätemagazin wurde 1982<br />
abgebrochen. Heute steht an dieser Stelle das Evangelische Gemeindehaus.<br />
150
1976 entschied das Schulamt, daß an die <strong>Gechinger</strong> Hauptschüler nach Althengstett zur<br />
Schule gehen mußten, weil in Gechingen aufgrund nicht ausreichender Schülerzahlen keine<br />
Hauptschule mehr geführt werden könne. Die dadurch freiwerdenden Klassenräume wurden<br />
in dieser Zeit von Sonderschülern aus dem Kreis Calw benutzt. Die Schüler der Klassen 9 der<br />
Hauptschule von Althengstett wurden nach Gechingen gefahren und hier unterrichtet.<br />
Lediglich die damaligen Klassen sieben und acht wurden nach Althengstett verlegt, die<br />
Hauptschulklassen fünf und sechs blieben in Gechingen.<br />
In den Jahren 1976 bis 1978 bemühten sich Bevölkerung, Gemeinderat und<br />
Gemeindeverwaltung um Rücknahme dieser Verfügung des Schulamts. 1979 schließlich<br />
hatten sie Erfolg. Am 17. 4. 1979 teilte das Staatliche Schulamt Bürgermeister Dannemann<br />
mit: "Ab dem Beginn des neuen Schuljahres am 1. 8. 1979 wird wieder eine Grund- und<br />
Hauptschule in Gechingen geführt, und die Hauptschüler aus Gechingen scheiden aus der<br />
Nachbarschaftshauptschule in Althengstett aus."<br />
Heute unterrichten etwa 20 Lehrkräfte 250 bis 260 Schüler in ca. 350 wöchentlichen<br />
Unterrichtsstunden. Die Schlehengäuschule und ist ein "Vorreiter" in Bezug auf das<br />
sogenannte EBA (Erweitertes Bildungsangebot an der Hauptschule). Noch heute - trotz der<br />
finanziell schwierigen Situation - bestehen Arbeitsgemeinschaften, die von Schülern<br />
gewünscht und durchgeführt werden. Dabei steht ein verantwortlicher Lehrer als Koordinator<br />
im Hintergrund. Die Arbeiten werden außerhalb der normalen Unterichtszeit durchgeführt.<br />
Jedes Angebot sollte mit einem Ziel, das auch dargestellt wird, abgeschlossen werden.<br />
Grundsätzlich soll den Hauptschülern dadurch die Möglichkeit gegeben werden, ihre<br />
Fähigkeiten zu erkennen, zu fördern und zu beweisen.<br />
Im Jahre 1974 konnte in kurzer Bauzeit neben der Schule eine Kleinschwimmhalle erstellt<br />
werden. Außer den Schülern steht das Bad auch der Bevölkerung und den Vereinen zur<br />
Verfügung. Im Jahre 1984 besuchten ca. 11.220 Schüler und 28.800 Erwachsene das<br />
Hallenbad.<br />
1994 feierte die Schlehengäuschule ihr 25jähriges Jubiläum unter reger Beteiligung der<br />
Bevölkerung mit einem großen Schulfest und einem vergnüglichem Abend für Eltern und<br />
Lehrer.<br />
Die Lehrer<br />
um 1580: Altschulmeister Hans Aumersch stirbt.<br />
um 1584: Hans Kraußhaar *10.3. 1591<br />
oo um 1550 Walpurga +15. 3.1579<br />
1590 - 1625: Jakob Niethammer *um 1570 +14.12.1635<br />
oo 3.6.1590 Walpurga Spiegel *Gärtringen, 6 Kinder<br />
um 1592: Martin Riehm *um 1569 +3.10.1635<br />
oo 27.11.1592 Barbara Klein, 8 Kinder<br />
um 1613: Konrad Riehm *23.3. 1595 +20.12.1669 in Darmsheim<br />
oo 17.11.1613 Irmela Eisenhardt *4.2.1590 in Hengstett +17.2.1680 in Döffingen<br />
um 1619: Martin Riehm *18.4. 1597 +18.2.1675 (36 Jahre Dienst in Gechingen)<br />
1.oo 5.10.1619 Barbara Merk *um 1600 in Aidlingen,<br />
2.oo 7.10.1662 Elisabeth Baumann * Calw, 4 Kinder<br />
1626 - 1635: Jakob Niethammer<br />
151
um 1650: Hans Jerg Koch *2.3. 1624 +18.1.1711<br />
oo 14.10.1650 Agnes Riehm *2.9.1623 +11.5. 1687 4 Kinder<br />
um 1675: Jakob Koch *3.9.1653 +26.9.1729,<br />
1.oo 16.9.1675 Agnes Schneider *10.7.1653 +vor 1720,<br />
2.oo 11.6.1720 Anna Margareta Mayer *10.2.1690 5 Kinder<br />
um 1698 :Johann Peter Schnauffer *Calw<br />
1.oo 12.7.1698 Anna<br />
2.oo 18.11.1727 Anna Katharina Kappis *1.7.1701 +21.6. 1775 7 Kinder<br />
um 1727: Johann Jakob Schnauffer (Barbier) *22.7.1701 +vor 26.9.1743,<br />
1.oo 8.7.1727 Anna Maria Gräber *9.8.1704 +vor 1733,<br />
2.oo 6.10.1733 Margareta Gehring *25.12.1711 +vor 1736,<br />
3.oo 28.11.1736 Anna Rosine Nüßle *Oberjesingen 7 Kinder<br />
um 1743: Georg Ludwig Kappis *26.8.1722 +21.11.1757,<br />
1.oo 14.7.1744 Christina Maria Hecker *7.7.1726 +um 1748,<br />
2.oo 22.7.1749 Anna Katharina Hagenlocher *5.10.1728 in Ostelsheim +22.2.1770 8 Kinder<br />
Kappis wurde am 17.8.1743 von Schultheiß, Pfarrer und Gemeinderat einstimmig als<br />
Schulmeister verpflichtet. Er mußte der Witwe seines Vorgängers eine<br />
Vierteljahresbesoldung geben.<br />
1758 - 1788: Georg Simon Kappis *28.11.1728 +14.10.1788<br />
oo 14.11.1758 Eva Katharina Fellnagel *20.1.1740 +17.6.1809 11 Kinder<br />
1788-1831: Georg Andreas Hartmann *13.9.1764 in Althengstett +17.12.1831<br />
oo 30.7.1789 Anna Johanna Rahmenstein *Eltingen. 4 Kinder<br />
Auf dem Friedhof kann man eine Tafel mit der Inschrift finden:<br />
"G. A. Hartmann, 43 Jahre Schullehrer dahier von 1788 - 1831, geb. am 1. 9. 1764, gest. 17.<br />
12. 1831".<br />
Um 1809: Georg Ludwig Schneider *17.8.1784 +Untertürkheim<br />
oo 21.11.1809 Eva Katharina Brackenhammer *10.12.1785 + Untertürkheim. 4 Kinder<br />
um 1829: Karl Gotthilf August Hartmann *18.12.1800 +4.4.1838<br />
oo 21.5.1829 Christiane Luise Schneider *7.12.1810 3 Kinder<br />
um 1829: Gottlieb Christoph Kopp*11.1.1801 in Dachtel, +13.1.1875,<br />
1.oo 29.6.1829 Johanna Luise Mammel *31.3. 1809 in Malmsheim, +4.11.1829 in Dachtel,<br />
2.oo 31.10.1831 Rosine Magdalena Deuble *2.6. 1811. 7 Kinder<br />
um 1839: Johann Jakob Jässle *7.4.1805 Horrheim, +Sept.1884<br />
oo 26.11.1839 Ernestine Philippine Bohnenberger *26.9. 1811 in Neuenbürg,<br />
Lehrer Jässle war der Gründer des Liederkranzes.<br />
um 1856: Johann Büttner, Mittelschullehrer, *23.3. 1825 in Gärtringen,<br />
oo 10.1. 1856 Johanna Kopp *7.1.1832 in Dachtel.<br />
152
1875 - 1887: Traugott Christian Frieß *12.6.1849 in Renningen,<br />
oo 13.5.1875 Rosine Pauline Koch *14.7.1854 Rohrdorf 8 Kinder.<br />
Frieß ging nach Aalen.<br />
um 1875: Jakob Schmid *25.6. 1847 in Ofterdingen,<br />
oo 9.12. 1875 Luise Karoline Friederike Haug *26.9.1845 in Garnberg, 8 Kinder.<br />
Jakob Schmid war Mittelschullehrer und ging nach Freudenstadt.<br />
um 1884 - 1897: Johann Georg Schürger *14.5.1858 in Wildenthierbach,<br />
oo 15.4.1884 Rosine Gottliebin Finkbeiner *31.12. 1853 in Schönegrund, 5 Kinder.<br />
Er ging nach Berlin-Tempelhof.<br />
um 1888: Gottlob Heinrich Pfäffle *18.11.1862 in Hausen a.W.,<br />
oo 4.8.1888 Barbara Dieter *17.7.1863 in Derendingen, 1 Kind.<br />
Er ging nach Truchtelfingen.<br />
um 1895: Georg Michael Eduard Kömpf. Er ging nach Ennabeuren.<br />
1896 - 1906: Gottlieb Friedrich Daniel Günther *20.5.1867 in Nagold,<br />
oo 21.9.1896 Dorothea Kirschner *24.4.1871 in Wimsheim. 4 Kinder<br />
Er ging nach Nagold.<br />
1897 - 1901: Lehrer Staiger, suspendiert<br />
1900 - 1904: Georg Friedrich Wiedmann *28.2.1864 in Heimsheim,<br />
oo 27.10.1891 Christina Pauline Gommel *14.5.1869 in Schöckingen 4 Kinder.<br />
Er ging 1904 nach Ostheim.<br />
1904 - 1912: Adolf Albrecht Friedrich Hofmann *5.12.1875 in Crailsheim,<br />
oo 4.10.1902 Julie Eugenie Volz *12.11.1878 in Fluorn, 1 Kind.<br />
Er ging nach Besigheim.<br />
1906 - 1914: Friedrich Bullinger, Oberlehrer. Er ging nach Schorndorf.<br />
1912 - 1916: Friedrich Süßer *10.5.1886 in Stachenhausen,<br />
oo 13.3.1913 Eugenie Martha Emma Rettich *Stuttgart. 1 Kind<br />
Er ging nach Alpirsbach.<br />
1917 - 1928: Friedrich Schrempf *30.8.1890 +1928<br />
1917 - 1929: Gustav Grötzinger *10.1.1891 in Renningen,<br />
oo 19.7.1919 Emilie Luise Brunner *13.9.1892 in Blaubeuren. 1 Kind<br />
Er ging nach Blaubeuren.<br />
um 1919: Friedrich Ziegler *27.11.1893 in Busenweiler,<br />
oo 29.2.1919 Pauline Jäger *3.12.1894 Stuttg.Gaisburg, 1 Kind<br />
1928 - 1941: Karl Gotthilf Heckeler *10.1.1898 in Ditzingen, +1941<br />
oo 26.5.1928 Rosine Maria Beutel *15.5.1899 in Winnenden, 2 Kinder.<br />
1929 - 1938: Andreas Sehburger. Er ging nach Calw. 2 Kinder<br />
153
1930 - 1937: Karl Friedrich Essig *13.12.1902 in Gechingen, +3.8.1956<br />
oo 20.10.1932 Hedwig Anna Eberhardt *12.5.1903 Stuttgart +24.12.1976, 4 Kinder.<br />
Er ging nach Althengstett.<br />
1932 - 1933: Paul Friedrich Vetter *22.9.1910 in Gechingen, +13.11.1986 in Würzbach,<br />
oo 26.1. 1946 Anneliese Essig, Würzbach.<br />
1936 - 1937: Otto Schneider *29.1.1916 in Gechingen, oo Stieringer, Nagold.<br />
1938 - 1949: Karl Lorenz (1941-1948 Kriegsdienst)<br />
1946 - 1968: Paul Adolf Gottlob Schwarz *7.1.1903 in Gechingen, +17.1.1985,<br />
1.oo 24.7. 1931 Elise Klara Weinmann * 13.1.1910 in Neuhengstett +20.6.1939,<br />
2.oo 6.7.1940 Gertrud Schlecht *6.7.1905 in Stuttgart +15.1.1995, 3 Kinder<br />
1949 - 1957: Friedrich Binder<br />
1957 - ?: Helmut Pumbo *Holstre Estland<br />
Die Lehrer ab 1965 sind im Ortssippenbuch nachzulesen.<br />
Rektoren:<br />
Hans Stahl, Hartmut Benzing , Hans Büxenstein, Gerd Danisch<br />
Rathaus, Gemeindeverwaltung und Schultheißen<br />
Das Rathaus<br />
Mitten im Altort steht das alte Rathaus. Es wurde vor 1475 erbaut, 1857 gründlich renoviert<br />
und 1909 mit einem neuen Treppenhaus versehen. Aus der Zeit von Schultheiß Jörg Breitling<br />
(1525-1530) wissen wir, daß das Rathaus damals im allgemeinen leerstand und nur zu<br />
Amtsgeschäften besetzt war, es sei denn, der Schultheiß hatte auf seinem Kornboden im<br />
Rathaus zu tun.<br />
Gegen Ende des 16. Jahrhunderts gibt eine Rechnung über das Rathaus Auskunft:<br />
"Inventarium über des Flecken Haus und Vorrat.<br />
3 tannene Tafeln<br />
1 Tisch von Tannenholz<br />
1 kleine abschließbare Truhe für Geld und Akten<br />
1 Eisen zum Zeichen (Brenneisen)<br />
1 eiserner Leuchter und 2 Flinten<br />
3 Zwillichkittel und 2 Feuerfahnen<br />
1 Schrand ohne Lehne (mehrsitzige Bank)<br />
1 alter Kasten."<br />
Auf dem Rathausdach hängt in einem Türmchen auf dem First das Rathausglöcklein. Unsere<br />
Vorfahren lebten ohne Uhren. Während die Kirchenglocken mit ihrem Läuten zu bestimmten<br />
Tageszeiten das Zeichen zum Aufstehen gaben oder die Zeit zum Kochen signalisierten oder<br />
daran erinnerten, daß die Kinder nach Hause und ins Bett mußten oder daß es Zeit zum Beten<br />
war, wurde mit dem Rathausglöcklein bis vor ca. 30 Jahren geläutet, wenn bei der Gemeinde<br />
etwas Besonderes anlag. Betätigt hat es der Gemeindepfleger oder der Schütz. Die Bürger<br />
154
wurden damit aufgerufen, verschiedenen Zahlungs- oder sonstigen Verpflichtungen<br />
nachzukommen, auch sollte auf Ver-anstaltungen der Gemeinde aufmerksam gemacht<br />
werden. Ob die Bürger zum Entrichten der Grundsteuer, des Holzgelds, der Hagelschaden-<br />
versicherung, der Feuerwehrabgabe aufgefordert oder auf Versteigerungen, Schafpferch-<br />
verkauf, Kartoffelkäfersammeln, Obstverkauf, Vergabe der Farrenwiesen und<br />
Akkordvergaben aller Art hingewiesen werden sollten, alles wurde durch das<br />
Rathausglöckchen angekündigt. Säumige wurden durch nochmaliges kräftiges Bimmeln<br />
gemahnt, endlich zu erscheinen. Der helle Klang der Rathausglocke alarmierte aber auch die<br />
Einwohner bei Kriegsgefahr und Feuersnot. Beim großen Brand 1881 rannte der damalige<br />
Nachtwächter Mack im Nachthemd auf das Rathaus und weckte mit der Glocke die Leute auf.<br />
Da im letzten Krieg die Luftschutzsirene erst im April 1945 nach monatelangem Papierkrieg<br />
montiert wurde, benutzte man die Rathausglocke auch zum Alarmieren bei Fliegeralarm. Seit<br />
wann das Glöcklein dort oben hängt, wissen wir nicht genau. Während des ersten Weltkrieges<br />
mußte es im Sommer 1917 abgeliefert werden; es sollte zu Munition verarbeitet werden. Nach<br />
Kriegsende 1918 beschloß der Gemeinderat im November 1919: "Da ein geordneter Betrieb<br />
auf dem Rathause ohne Glocke nicht durchführbar ist, wird die Firma Kurtz in Stuttgart<br />
beauftragt, eine neue Glocke im Gewicht von 150 Kilo und dem Preis von 3450 Mark zu<br />
liefern."<br />
Als in den sechziger Jahren unseres Jahrhunderts die Bevölkerung so stark zugenommen<br />
hatte, daß das Rathaus für die Verwaltungsaufgaben zu klein geworden war, beschloß die<br />
Gemeinde einen Neubau. Das Gasthaus "Adler" wurde gekauft und abgebrochen und auf<br />
diesem zentralen Platz das neues Rathaus errichtet. 1972 waren die Bauarbeiten<br />
abgeschlossen.<br />
Das alte Rathaus, 1980 umgebaut und renoviert, ist ein Schmuckstück unseres Ortes<br />
geworden. Es dient als Kinderstube, enthält einen Übungsraum für den Chor und beherbergt<br />
den örtlichen Polizeiposten.<br />
Das Amt<br />
Der Name "Schultheiß" entstand aus "Schuld", jemand etwas schuldig sein und "heischen,“<br />
etwas fordern. Der Schultheiß hatte die Gemeindeglieder dazu anzuhalten, ihre Schuldigkeiten<br />
gegenüber den Fürsten oder Grundherren zu entrichten. Die Bezeichnung "Schultheiß" wird<br />
um das Jahr 536 zum erstenmal genannt. Die Franken bezeichneten damit den Ortsrichter,<br />
also den Ortsvogt der Herrschaft. Als Zeichen seiner Gewalt führte er den Gerichtsstab mit der<br />
Schwurhand. Der Schultheiß hatte den Vorsitz im Dorfgericht, das aus sieben bis zwölf<br />
Geschworenen bestand. Die Mitglieder wurden in alten Protokollen mit ihrem Namen und<br />
dem Zusatz "des Gerichts" aufgeführt. Im Volksmund hießen sie "die Herren". Der wichtigste<br />
von ihnen war der Gemeinderechner, anfangs "Heimbürge", später "Bürgermeister" genannt.<br />
Seine Aufgabe war die Verwaltung des Gemeindevermögens, worüber er jährlich Rechnung<br />
legen mußte. In Gechingen hieß er "Gemeindepfleger". Der Bürgermeister, auch Dorfmeister<br />
oder Bauernmeister genannt, war ursprünglich der Vorsteher und Vertreter der Gemeinde und<br />
wurde von ihren Bürgern gewählt, der Schultheiß der Vertreter der Herrschaft und wurde von<br />
ihr ernannt.<br />
Als Gechingen 1308 an das Kloster Herrenalb fiel, wurde es vom Klosteramt Merklingen aus<br />
verwaltet. Der Schultheiß wurde von dort eingesetzt und bestätigt. Unmittelbarer Vorgesetzter<br />
des <strong>Gechinger</strong> Schultheißen war der Klosteramtmann in Merklingen. Das änderte sich auch<br />
nicht, als das Kloster säkularisiert und württembergisch wurde. Die württembergischen<br />
Herzöge ließen die Klosterämter bestehen, an ihrer Spitze stand nun ein evangelischer Prälat.<br />
Die Gesamtheit der Städte und Ämter bildete die Landschaft, ihr Organ war der Landtag. Bei<br />
Klosterämtern vertrat der Prälat an ihrer Spitze das Klosteramt im Landtag, es gab<br />
155
egelmäßige Versammlungen der Schultheißen, die dort dem Prälaten die Angelegenheiten,<br />
von denen sie wünschten, daß sie im Landtag zur Sprache kämen, vorbringen konnten.<br />
Wenn man die Liste der uns bekannt gewordenen <strong>Gechinger</strong> Schultheißen im Hinblick auf<br />
ihre Amtszeiten betrachtet, fällt auf, daß, bis auf Lorenz Reisser II (1550-1558) und dadurch<br />
bedingt, der anschließende Schultheiß Lorenz Weiß (1558-1565), sie immer fünf Jahre lang<br />
oder ein Mehrfaches davon amtierten, Schultheißenwechsel trat jeweils zum Ende einer<br />
Dekade oder deren Hälfte ein (z.B. 1525, 1530, 1540, 1550). Auch nach der Unterbrechung<br />
1558, die sich durch einen unvorhersehbaren Notfall, wie Krankheit oder Tod, erklären ließe,<br />
stellte sich der alte Rhythmus schnellstmöglich wieder ein. Es wäre denkbar, daß der<br />
Schultheiß jeweils nach fünf Jahren im Amt bestätigt werden mußte und es dann entweder zur<br />
Verlängerung seiner Dienstzeit um fünf Jahre oder zu einem Amtswechsel kam.<br />
In der ersten Zeit der bekannt gewordenen Schultheißen sind Verwandtschaften nachgewiesen<br />
(Lorenz Reisser I und II z. B. waren Vater und Sohn); aber die Unterlagen sind um diese Zeit<br />
noch so lückenhaft, daß man nicht entscheiden kann, ob sie aus Gechingen kamen oder von<br />
außerhalb. Nur von Hans Mitschele (1570-1580) wissen wir sicher, daß er gebürtiger<br />
<strong>Gechinger</strong> war.<br />
Gegen Ende des 16. Jahrhunderts wurden die Amtszeiten unregelmäßig. Etwa um die gleiche<br />
Zeit übernahmen nachweislich ausschließlich ortsansässige <strong>Gechinger</strong> Bürger das<br />
Schultheißenamt. Weitaus die meisten waren gebürtige <strong>Gechinger</strong>, vereinzelt kommen auch<br />
eingeheiratete vor, die jedoch alle schon längere Zeit in Gechingen lebten, ehe sie das<br />
Schultheißenamt antraten. Letzteres gilt auch für Jakob Niethammer (1616-1635), der zwar<br />
als Schulmeister von außerhalb kam und auch nicht mit einer <strong>Gechinger</strong>in verheiratet war,<br />
doch natürlich in Gechingen Bürgerrecht hatte. Es läßt sich nicht denken, daß Schultheißen<br />
aus Gechingen ohne die Zustimmung der Bürger ihr Amt antraten, also lediglich von der<br />
vorgesetzten Behörde ernannt wurden. So mag überall die Entwicklung dahingehend<br />
verlaufen sein, daß die Gemeinden mehr und mehr Mitspracherecht bei der Besetzung des<br />
Schultheißenamts bekamen. Es war deshalb folgerichtig, daß sich nach dem Dreißigjährigen<br />
Krieg in Altwürttemberg die Gemeinden das Recht nahmen, ihren Schultheißen selbst zu<br />
wählen. In Gechingen sind bis 1844, als Notar Pregizer aus Calw Schultheiß wurde, nur<br />
<strong>Gechinger</strong> im Amt gewesen, die fast alle immer wieder aus den gleichen Familien kamen und<br />
vielfältig miteinander verwandt waren, oft auch über ihre Frauen.<br />
Der Bürgermeister war als Vertreter der Gemeinde an die zweite Stelle gerückt. Zum<br />
Bürgermeister gehörte der Rat, seine Mitglieder wurden in den Protokollen mit ihrem Namen<br />
und dem Zusatz "des Rats" aufgeführt. Der Rat war also der Ausschuß der Gesamtgemeinde.<br />
Gericht und Rat bildeten zusammen die Ehrbarkeit. Die Aufgaben waren etwa die gleichen<br />
wie beim Nachfolger, dem heutigen Gemeinderat.<br />
Schultheiß und Bürgermeister, die meist Bauern und Handwerker waren, waren immer mehr<br />
auf die Dienste der beamteten Schreiber angewiesen, auch bei den komplizierten<br />
Erbauseinandersetzungen, bei Aufstellung von Inventarien usw. genügten die Dienste der<br />
Schulmeister bald nicht mehr. Als das Verwaltungswesen schwieriger wurde, mußten die<br />
Gemeinden zuweilen auch die Unterstützung der Aktuare und Notare als Außenbeamte von<br />
Oberamt und Amtsgericht in Anspruch nehmen..<br />
Ein Beispiel, wie die Obrigkeit das Leben der Bürger beeinflußte und regelte, ist die<br />
nachstehende "Heiratserlaubnis" von 1768. Jeder Heiratswillige mußte sie beim Kloster-<br />
0beramt in Merklingen schriftlich einholen. Nach Genehmigung des Heiratsgesuchs wies<br />
dann der Oberamtmann brieflich den Pfarrer und den Schultheißen an, die Trauung<br />
vorzunehmen. Ein solcher Brief lautete:<br />
"Hochwohlerwürdiger und Hochgelehrter Herr Pfarrer und geliebter Schultheiß!<br />
156
Am 6. Mai ist der Herzoglich gnädige Befehl ergangen, daß sich Johann Jakob Gehring,<br />
Bürger und Zeugmachergesell zu Gechingen mit Maria Agnes Braitlingin, daselbst, gegen<br />
Erlegung eines Reichsthalers verheiraten dürfe. Ihr könnt jetzt die Proklamation und<br />
Kopulation vornehmen, aber dabei besorgt zu sein, daß die zwei Reichsthaler zuvor bezahlt<br />
sind. Mit der Gnade Gottes belassen. 13. Oktober 1768. Oberamtmann Öttinger"<br />
Der Oberamtmann in Merklingen war der Vertreter der staatlichen Behörde, aber aus diesem<br />
Brief geht klar hervor, daß kirchliche und staatliche Obrigkeit - zumindest auf dem Dorf - als<br />
Einheit angesehen wurden.<br />
Der Schultheißeneid lautete um 1772: "Ihr werdet geloben und schwören, daß Ihr dem<br />
gemeinen Flecken Gechingen getreu und hold sein wollet, dessen Schaden mit möglichstem<br />
Fleiß warnen und wenden, seinen Nutzen schaffen und fördern werdet, den Untertanen und<br />
Amtsangehörigen, den Reichen wie den Armen, den Einheimischen wie den Fremden ohne<br />
Ansehen der Person rechtmäßigen, ehrbaren und unparteiischen Bescheid geben wollet.<br />
Ferner habt Ihr als ein gutgesinnter, tugendhafter und eifriger Schultheiß, der von Gott in<br />
seinem Wort so teuer anbefohlenen Witwen und Waisen, Verlassenen und Hilflosen Euch<br />
unverzüglich anzunehmen, auch insgemein zu des Fleckens Wohlfahrt und unter Euren<br />
Mitbürgern die möglichste Glückseligkeit zu verbreiten."<br />
Als es Friedrich von Württemberg unter Napoleon gelang, sein Gebiet auf mehr als das<br />
Doppelte zu vergrößern, und Württemberg Königreich wurde, hob er in Altwürttemberg 1805<br />
die Verfassung auf. Der Landtag wurde aufgelöst. Die Verwaltung, auch auf kommunaler<br />
Ebene, wurde zentralisiert. Dem Königreich Württemberg (seit 1806) fehlten zunächst alle<br />
Elemente der Selbstverwaltung. Die Schultheißen wurden auf Lebenszeit ernannt, die<br />
Amtsbezirke neu eingeteilt, ihre Gebiete im allgemeinen vergrößert. Alle Klosterämter, auch<br />
Herrenalb, wurden abgeschafft. Gechingen wurde 1808 dem Oberamt Calw zugeschlagen.<br />
Ziemlich sicher wurde in Gechingen nicht so heiß gegessen, wie gekocht wurde. Der<br />
Schultheiß zu dieser Zeit war Johann Michael Schneider, er war von 1796-1828 im Amt, hatte<br />
es also schon angetreten, als Friedrich, damals noch Herzog, zur Regierung kam, und<br />
überdauerte die gesamte Herrschaftszeit des Monarchen. Ebenso übten Pfarrer Klinger und<br />
Schulmeister Georg Andreas Hartmann schon vor Regierungsantritt Friedrichs ihr Amt aus.<br />
So mögen Veränderungen, wie die nunmehrige Zugehörigkeit zum Oberamt Calw, von den<br />
<strong>Gechinger</strong>n als nicht so einschneidend empfunden worden sein, denn die Männer an der<br />
Spitze des Dorfes blieben die alten - bis 1828 Schultheiß und Pfarrer, bis 1831 Schulmeister<br />
Hartmann.<br />
Unter König Wilhelm I (seit 1816) wurden die Verhältnisse wieder liberalisiert. Die<br />
Verwaltung der Finanzen und die Regelung von Gemeindeangelegenheiten blieben fortan den<br />
Kommunen selber überlassen, auch der Polizeidienst wurde in Selbstverwaltung<br />
übernommen. Bürgermeister und Gemeinderat wurden auf Lebenszeit von den Bürgern<br />
gewählt. Neben dem Gemeinderat gab es noch den Bürgerausschuß, der keine Beschlüsse<br />
fassen durfte, aber den Gemeinderat überwachte. Der Schultheiß führte, wie seither,<br />
nebenberuflich die Geschäfte der Gemeinde, auch bei ihm war vorgesehen, daß er auf<br />
Lebenszeit im Amt verblieb.<br />
Von August Lämmle ist ein Spruch überliefert, der die Rechte und Pflichten eines<br />
Schultheißen wiedergibt:<br />
"Red du.<br />
Gott hört zu.<br />
Das Alte heg.<br />
Das Neue wäg.<br />
Das Recht wohl miß.<br />
Eigenen Vorteil vergiß.<br />
157
Zu gemeinem Nutz<br />
Hau, stich und trutz.<br />
Der Wort zwei<br />
Sein besser denn drei.<br />
Wo ein Ding faul,<br />
Da brauch das Maul.<br />
Sonst schweig still:<br />
Das ist Gott`s Will. "<br />
Württemberg, das immer zäh an der Überlieferung festhielt, behielt den Namen "Schultheiß"<br />
bis 1929 bei. Der Name "Bürgermeister" hat sich dann reibungslos eingebürgert.<br />
Die Schultheißen<br />
Der "Amtmann" von ca. 1450 - 1475.<br />
Vom ersten nachweisbaren Amtsinhaber wissen wir den Namen nicht, doch sein<br />
Schwiegersohn und späterer Nachfolger Konrad Schneider sagte bei einer Zeugenvernehmung<br />
aus: "Als mein Schwäher (Schwiegervater) Amtmann in Gechingen war, sind 2 Pfändungen<br />
gewesen".<br />
Der Amtmann dürfte um 1450 seinen Dienst aufgenommen und ihn bis ungefähr 1475<br />
ausgeübt haben.<br />
Konrad Schneider von ca. 1475 - 1505.<br />
Aus den Akten sehen wir, daß er um 1500 beinahe 30 Jahre im Amt war. An einer anderen<br />
Stelle ist die Rede von "des Schultheißen Kunrad Schneiders Hus und Hof, Scheuer und<br />
Garten mit aller Zugehörd an dem Hengstetter Tor."<br />
Hans Breitling von ca. 1505 - 1525.<br />
Er ist im Lagerbuch von 1547 erwähnt, hat um 1520 eine Margareta geheiratet und starb um<br />
1559.<br />
Jörg Breitling von ca. 1525 - 1530<br />
Wir wissen wenig über ihn, er hat um 1525 geheiratet und zinst dem Kloster Reutin,<br />
Wildberg. Der Lohn eines Schultheißen betrug damals sieben Gulden im Jahr, dazu kamen<br />
dann noch Tagegelder für Käufe und Verkäufe<br />
Lorenz Reisser von ca. 1530 - 1540.<br />
Er heiratete um 1525 eine Ursula.<br />
Von Lorenz Reisser ist aktenkundig, daß er mit drei Ratsangehörigen nach Böblingen<br />
befohlen wurde, um Auskunft über die <strong>Gechinger</strong> Wälder zu geben.<br />
Michael Riehm von ca. 1540 - 1550.<br />
Er wird im Güterlagerbuch 1547 erwähnt und heiratete um diese Zeit eine Barbara. Er starb<br />
vor 1559.<br />
Lorenz Reisser II von ca. 1550 - 1558.<br />
Er war ein Sohn des Schultheißen Reisser, heiratete am 14.12.1572 eine Ursula Eisenhardt aus<br />
Dachtel und starb am 28.6.1580.<br />
Lorenz Weiß von ca. 1558 - 1565.<br />
Zusammenhänge mit den heute hier lebenden Weiß ließen sich nicht feststellen. Es fehlen<br />
auch alle sonstigen Angaben.<br />
158
Steffen Bastian von ca. 1565 - 1570.<br />
Er war der Schwiegersohn des Schultheißen Michael Riehm.<br />
Hans Mitschele von ca. 1570 - 1580.<br />
Er hieß auch der Oberhans oder Vollmitschele und stammt mit Sicherheit aus Gechingen. Er<br />
heiratete um 1553 eine Christina. Zwei Söhne gingen nach auswärts.<br />
Hans Schneider II von ca. 1580 - 1589.<br />
Er heiratete um 1577 eine Agnes.<br />
Jakob Fellnagel von ca. 1589 - 1605.<br />
Um 1575 heiratete er Anna Brackenhammer aus Gechingen.<br />
Hans Schneider III von ca. 1605 - 1615.<br />
Er war der Sohn des Hans Schneider II, von Beruf Knapp, das heißt Zeugmacher. Am<br />
11.2.1590 heiratete er Anna Abermann, die um 1570 geboren wurde und am 10.9.1658<br />
verstarb.<br />
Jakob Niethammer von ca. 1616 - 1635.<br />
Er war von Beruf Schulmeister, wurde um 1570 geboren und verheiratete sich am 3.6.1590<br />
mit Walpurga Spiegel von Gärtringen. Jakob Niethammer starb am 14.12.1635 mit 65 Jahren,<br />
er blieb also bis zu seinem Tod im Amt.<br />
Georg Quinzler von ca. 1635 - 1644.<br />
Georg (Jerg) Quinzler wurde am 15.1.1608 geboren, sein Todestag ist nicht bekannt. Im Jahre<br />
1633 heiratete er Margareta Kappis.<br />
Hans Brackenhammer von ca. 1644 - 1660.<br />
Er wurde am 6.1.1603 geboren und heiratete am 28.11.1626 Agatha Vogt. Auch Hans<br />
Brackenhammer war bis zu seinem Tod am 3.6.1660 im Amt. Als er mit seiner Familie und<br />
anderen <strong>Gechinger</strong>n 1647 nach Calw flüchtete, wurde ihm dort ein Kind geboren, das bald<br />
darauf starb.<br />
Hans Schneider IV von ca. 1660 - 1668.<br />
Er wurde am 23.12.1598 geboren, als Sohn des Schultheißen Hans Schneider und starb am<br />
22.11.1668 mit 70 Jahren. Am 22.5.1621 hatte er sich mit Katharina Gerlach aus Ostelsheim<br />
verheiratet. Alle fünf Kinder starben in jungen Jahren.<br />
Bernhard Kappis von ca. 1668 - 1678.<br />
Bernhard Kappis kam am 13.3. 1632 zur Welt, sein Todestag ist unbekannt. Mit Agatha<br />
Brackenhammer, Tochter des Schultheißen Hans Brackenhammer, schloß er am 15.11. 1653<br />
die Ehe.<br />
1662 verkauften Schultheiß und Waisengericht im Namen Hans Brackenheimers "der<br />
blödigkeitshalber an Ketten liegt", Felder und Wiesen.<br />
Leonhard Röckle von ca. 1679 - 1690.<br />
Leonhard (Lienhardt) Röckle, von Beruf Bader, wurde um 1643 in Aidlingen geboren. Um<br />
1670 verheiratete er sich mit Maria Wohlpold aus Gechingen. Er starb um 1695<br />
159
Hans Ziegerer von ca. 1690 - 1694.<br />
Er war der Enkel des Schultheißen Hans Brackenhammer, wurde am 10.2.1643 geboren und<br />
starb um 1700. Am 7.7.1663 verheiratete er sich das erste Mal mit Christina Mitschele und<br />
das zweite Mal um 1700 mit einer Margareta.<br />
Hans Jakob Eisenhardt von ca. 1694 - 1730.<br />
Hans Jakob Eisenhardt, geboren am 5.9.1653, Todestag unbekannt, verheiratete sich das erste<br />
Mal am 29.6.1675 mit der Tochter des Schultheißen Bernhard Kappis, Agatha Kappis.<br />
Nachdem Agatha Kappis am 24. 4.1696 starb, heiratete Hans Jakob Eisenhardt am 26.1.1697<br />
Christiana Rephuhn.<br />
Hans Jakob Eisenhardt hatte die längste Amtszeit, die ein <strong>Gechinger</strong> Schultheiß je hatte, er<br />
brachte es auf 36 Dienstjahre.<br />
Hans Jakob Eisenhardt von 1730 - 1735.<br />
Als Sohn des Schultheißen Hans Jakob Eisenhardt wurde er am 5.3.1678 geboren. Sein<br />
Todestag ist unbekannt. Er war badischer Stiftsschaffner (Verwalter der Güter des Collegiat-<br />
Stifts Baden-Baden in Gechingen). Am 20.10.1696 schloß er die Ehe mit Anna Magdalena<br />
Heider.<br />
Hans Bernhardt Kappis von ca. 1735 - 1748.<br />
Als Sohn des Schultheißen Bernhardt Kappis wurde er am 6.12.1698 geboren und starb am<br />
26.1.1767. Die Ehe schloß er am 4.11.1721 mit Anna Katharina Böttinger.<br />
Johann Georg Quinzler von ca. 1748 - 1768.<br />
Er wurde als Urenkel des Schultheißen Georg Quinzler am 13.4.1707 geboren. Er starb am<br />
6.5.1778 durch einen Sturz in der Scheuer. Mit der Urenkelin des Schultheißen Hans Jakob<br />
Eisenhardt, Agatha Köhler, ging er am 14.10.1727 die Ehe ein.<br />
Johann Jakob Brackenhammer von ca. 1768 - 1796.<br />
Er war der erste Brackenhammer auf der Mühle, von Beruf Beck und Lammwirt. Geboren am<br />
3.12. 1719, verstorben am 10.6.1796, heiratete er am 23.10.1742 Marie Agnes Hecker. Als sie<br />
am 8.9.1748 starb, heiratete Johann Jakob Brackenhammer am 22.10. 1749 Anna Magdalena<br />
Schnauffer.<br />
Johann Michael Schneider von ca. 1796 - 1828.<br />
Er war von Beruf Chirurgus und wurde am 11.3.1757 als Urenkel des Schultheißen Jakob<br />
Niethammer geboren. Am 30.10.1783 verheiratete er sich mit der Enkelin des Schultheißen<br />
Hans Bernhardt Kappis, Maria Katharina Kappis. Johann Michael Schneider starb am<br />
31.7.1836 mit 79 Jahren.<br />
Johann Georg Kappis von ca. 1828 - 1831.<br />
Er war der Enkel des Schultheißen Hans Bernhardt Kappis und wurde am 11.12.1780 geboren<br />
und starb am 5.10.1832. Mit Katharina Barbara Rüffle ging er am 14.5.1805 die Ehe ein.<br />
Christof Friedrich Ziegler von 1831 - 1832.<br />
Am 5.3.1793 wurde Christof Friedrich Ziegler in Waiblingen geboren und verheiratete sich<br />
am 2.2.1818 in Gechingen mit Katharina Wochele, die aber schon am 9. 10.1820 verstarb. Sie<br />
war die Tochter des Hirschwirtes Georg Achatius Wochele. Die zweite Ehe wurde am 21. 4.<br />
1822 geschlossen. Die Braut war die Urenkelin des Schultheißen Johann Georg Quinzler,<br />
Marie Magdalena Kühnle. Christof Friedrich Ziegler verstarb am 19.1.1833.<br />
160
Johann Georg Quinzler von 1832 - 1841.<br />
Der Bier- und Lammwirt Johann Georg Quinzler wurde am 17. 7.1778 geboren, als Enkel des<br />
Schultheißen Johann Georg Quinzler und heiratete am 23.2.1802 Rosine Magdalena Gehring,<br />
Tochter des Lammwirts Johann Georg Gehring. Johann Georg Quinzler starb am 5.8.1848.<br />
Zu Quinzlers Amtszeit wurde überall die "Bauernbefreiung" durchgeführt, das heißt, die auf<br />
dem Boden liegenden Lasten, wie Naturalabgaben, Geldzinsen und Frondienste wurden mit<br />
Geld abgelöst (siehe auch "Königreich Württemberg", unter "Gechingen in geschichtlicher<br />
Zeit"). Über Schultheiß Quinzler erschien zu dieser Zeit folgende Notiz im Calwer<br />
Wochenblatt:<br />
"Calw (Öffentliche Belobung)<br />
Nachgenannte Ortsvorsteher werden wegen der von ihnen bei Vollziehung der Ablösungsgesetze,<br />
namentlich der Böden- und Frohnablösungsgesetze vom 27. und 28. Okt. 1836 in<br />
ihren Gemeinden bewiesenen besonderen Thätigkeit, in Folge Auftrags der K. Kreisregierung,<br />
hiemit öffentlich belobt, nämlich:<br />
Schuldheiß Quinzler und Rathsschreiber Schraishan in Gechingen<br />
Schuldheiß Ayasse zu Neuhengstätt<br />
Schuldheiß Repphun zu Simmozheim und<br />
Schuldheiß Roller zu Stammheim.<br />
Den 6. Juni 1839. K. Oberamt. In leg. Abw. des OAmtm. der ges. Stellvertreter<br />
Akt. Buttersack."<br />
Am 19. Jan. 1839 erschien in der gleichen Zeitung eine Annonce, die auf die öffentliche<br />
Versteigerung von "gut gesponnenem hänfenen Garn" hinwies. Unterzeichnet war mit:<br />
"Gemeinschaftliches Amt. Pfarrer Klinger. Schuldheiß Quinzler." Das läßt darauf schließen,<br />
daß die Bestrebungen des Pfarrer Heinrich Theodor Klinger (siehe diesen), den armen Leuten<br />
in Gechingen zusätzliche Verdienstmöglichkeiten zu schaffen, von Schultheiß Quinzler voll<br />
unterstützt wurden und geistliche und staatliche Obrigkeit eine Einheit bildeten.<br />
Georg Ludwig Schumacher von 1841 - 1844 und 1848 - 1865.<br />
Georg Ludwig Schumacher, Bauer, wurde am 7.2.1800 geboren und verstarb am 19.6.1880.<br />
Am 15.5.1827 heiratete er die Tochter Eva Katharine des Schultheißen Johann Georg Kappis,<br />
die aber zehn Jahre später am 8.9.1837 starb. Sie hinterließ fünf Kinder, so daß Schumacher<br />
am 1.5.1838 Anna Maria Schneider ehelichte. Ein weiteres Kind kam aus dieser Ehe, die<br />
durch den Tod der zweiten Ehefrau am 20.11.1839 getrennt wurde. Am 27.5.1844 verheiratete<br />
der Witwer sich zum dritten Mal mit der Witwe des Schultheißen Christof Friedrich Ziegler,<br />
Marie Magdalena Kühnle, die inzwischen ihren zweiten Mann, den Ratschreiber Christian<br />
Friedrich Schraishan, verloren hatte. Diese Ehe blieb kinderlos.<br />
Friedrich Wilhelm Pregizer von 1844 - 1848.<br />
Der königliche Notar Friedrich Wilhelm Pregizer wurde am 24. 5.1794 in Grünbach bei<br />
Freudenstadt geboren. Er heiratete in Calw am 13.10.1827 Auguste Friederike Speidel aus<br />
Großsachsenheim. 1846 erbaute er das Haus Calwer Straße 22 in Gechingen. Warum er nur<br />
vier Jahre lang Schultheiß war, konnte noch nicht geklärt werden. Entweder waren die Bürger<br />
mit seiner Amtsführung nicht zufrieden, was mit den Unruhen von 1848 zusammenhängen<br />
könnte (siehe auch "Von der Revolution 1848/49 bis 1870" unter "Gechingen in<br />
geschichtlicher Zeit“), oder sie konnten sich nicht damit abfinden, daß jemand von außerhalb<br />
des Dorfes Schultheiß wurde. Sein Todestag ist nicht bekannt. Er starb in Calw.<br />
Zweite Amtszeit Georg Ludwig Schumachers von 1848-1865<br />
161
Als Folge der Revolution von 1848 wurden kirchliche und staatliche Befugnisse mehr und<br />
mehr getrennt. Zum Beispiel beschloß der Kirchenkonvent 1852, eine Suppenanstalt<br />
einzurichten. Die bürgerliche Gemeinde weigerte sich, weil sie den Kirchenkonvent nicht als<br />
gesetzliche Armenbehörde anerkennen wollte.<br />
Otto Friedrich Ziegler von 1865 - 1895.<br />
Er wurde als Sohn des Schultheißen Christof Friedrich Ziegler am 18.11.1831 in Gechingen<br />
geboren. Er war zunächst Ratsschreiber in Gechingen und heiratete am 8.2.1853 die Tochter<br />
des Schultheißen Georg Ludwig Schumacher, Katharina Magdalena Schumacher.<br />
Schultheiß Ziegler muß ein selbstbewußter, selbständig denkender und handelnder Mann<br />
gewesen sein, der Auseinandersetzungen nicht scheute. Viele voneinander abweichende<br />
Gerüchte, wie er nach dem großen Brand eine aufgelockertere Bauweise an der Gartenstraße<br />
und eine breite Ortsdurchfahrt durchsetzte; sicher ist, daß er dem Gemeinderat seinen Willen<br />
mehr oder weniger aufzwang. Heute noch wird diese weitblickende Entscheidung von den<br />
Verkehrsteilnehmern gewürdigt, auch wenn viele nicht wissen, auf wen sie zurückgeht.<br />
Als Schultheiß Ziegler im Calwer Wochenblatt angegriffen worden war, weil er an einer Versammlung<br />
nicht teilgenommen hatte, setzte er sich in der gleichen Zeitung folgendermaßen<br />
zur Wehr:<br />
"Obwohl ich dem Hrn. Berichterstatter über die <strong>Gechinger</strong> Volksversammlung keine<br />
Rechenschaft über meine Handlungen oder Unterlassungen schuldig bin, so muß ich doch<br />
kurz bemerken, daß ich bloß deshalb durch meine Abwesenheit glänzte, weil dies Andere<br />
durch ihre Anwesenheit thaten.<br />
Schultheiß F. Ziegler."<br />
Schultheiß Ziegler konnte sich also auch schriftlich sehr gewandt ausdrücken und machte von<br />
dieser Gabe ohne Scheu Gebrauch. Bezeichnend für ihn ist ein Schriftwechsel, der sich ergab,<br />
als einem <strong>Gechinger</strong>, der in der Schweiz lebte, aber noch <strong>Gechinger</strong> Bürgerrecht hatte, die<br />
Heiratserlaubnis verweigert wurde. Die Eheschließung war inzwischen eine zivilrechtliche<br />
Angelegenheit geworden, damit traten moralische Ansprüche gegenüber finanzielle<br />
Erwägungen zurück. Eine Heirat wurde untersagt, wenn eine Gemeinde befürchtete, daß die<br />
aus der Ehe zu erwartenden Nachkommen von ihr "verhalten" werden mußten, weil die<br />
eigenen Mittel des Paares nicht ausreichten. Unser aus-wärtiger <strong>Gechinger</strong> stellte sicherlich<br />
einen Extremfall dar. Nachdem die zahlreichen Nachkommen aus seinen zwei Ehen über<br />
Jahrzehnte hinweg die Armenkasse der Gemeinde Gechingen stark in Anspruch genommen<br />
hatten, wollte der <strong>Gechinger</strong> Gemeinderat eine dritte Ehe nicht zulassen. Der Pfarrer von<br />
Bürgeln in der Schweiz versuchte, durch eine Eingabe beim württembergischen<br />
Innenministerium den Beschluß rückgängig zu machen, aber Schultheiß Ziegler stellte in<br />
einem Brief ans Innenministerium dar, weshalb die Gemeinde Gechingen gegen weiteres<br />
"unkontrolliertes Vermehren der Familie" war und beharrte auf der Verweigerung der<br />
Heiratserlaubnis, es sei denn, die ganze Familie nähme fortan Gechingen zum Wohnsitz.<br />
Schultheiß Ziegler starb am 6.7.1895 und wurde unter großer Anteilnahme der <strong>Gechinger</strong> am<br />
8. Juli begraben. Es kamen auch viele Auswärtige, denn er war als Vorstand des "Westlichen<br />
Gäusängerbundes" ein weit über Gechingen hinaus bekannter Mann.<br />
Karl Wilhelm Ladner von 1895 - 1918.<br />
Karl Wilhelm Ladner wurde am 22.4.1858 in Marbach am Neckar geboren und starb am 14.8.<br />
1918. Am 3.3. 1891 schloß er die Ehe mit Rosine Wilhelmine Kühnle, einer Verwandten des<br />
Schultheißen Johann Georg Quinzler. Der älteste Sohn, Richard Ladner, ist 1915 im ersten<br />
Weltkrieg gefallen.<br />
162
Ladner war Verwaltungsaktuar und vor seiner Wahl zum Schultheißen zehn Jahre lang in<br />
Gechingen tätig. Ein Wahlkomitee veröffentlichte vor der Wahl eine Art Flugblatt, in dem es<br />
heißt: "Ein Ortsvorsteher, der sein Amt ersprießlich und zum Segen der Gemeinde und ihrer<br />
Bürger führen soll, muß neben den nötigen Kenntnissen und Charaktereigenschaften in erster<br />
Linie frei und unabhängig nach allen Seiten sein, er soll in politischer Beziehung über den<br />
Parteien stehen und er darf insbesondere auch durch keine geschäftlichen Rücksichten, die<br />
ihm den freien Blick trüben und unparteische Entscheidungen erschweren, gebunden sein."<br />
Das könnte man auch heute noch unterschreiben.<br />
Die Schrift entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, wenn man berücksichtigt, daß Ladner<br />
einen Fabrikanten als Mitbewerber um das Schultheißenamt hatte, der ihm nur knapp<br />
unterlag.<br />
Ladner führte die Gemeinde in einer schwierigen Zeit. Er und auch seine Nachfolger hatten<br />
eine Fülle von Aufgaben zu bewältigen, auf die in der allgemeinen Geschichte des Dorfes<br />
(siehe diese) näher eingegangen wurde.<br />
Gottlob Schmidt von 1918 - 1945.<br />
Er wurde am 2.10.1888 in Renningen geboren und heiratete am 30.5.1929 die Tochter des<br />
Schultheißen Karl Wilhelm Ladner, Maria Emma Ladner. Gottlob Schmidt starb am 3.4.1963.<br />
Auch Gottlob Schmidt war vor seiner Wahl zum Schultheiß Verwaltungsbeamter.<br />
Die Bürgermeister ab 1945<br />
Wilhelm Gottlob Gräber von 1945 - 1946.<br />
Wilhelm Gottlob Gräber wurde am 5.12.1886 geboren, er war Landwirt und Kellner und<br />
heiratete am 15. 5.1920 Rosine Pauline Kielwein. Zwei Kinder konnte das Ehepaar<br />
großziehen. Wilhelm Gottlob Gräber wurde am 1.11.1945 kommissarisch als Bürgermeister<br />
eingesetzt und war bis September 1946 im Amt.<br />
Otto Weiß von 1946 - 1978.<br />
Otto Weiß wurde am 27.1.1916 geboren und erlernte den Kaufmannsberuf. Er wurde dann<br />
zum Militär einberufen und nach seiner Rückkehr zum Bürgermeister gewählt. Am 12. 9.1953<br />
heiratete er Lotte Gehring.<br />
Rainer Dannemann von 1978 - 1994.<br />
Rainer Dannemann wurde am 29. 1.1944 geboren und heiratete am 26.8.1966 Monika geb.<br />
Koch.<br />
Jens Häußler von 1994 - heute<br />
Kulturelle Entwicklung<br />
durch Vereine und Vereinigungen<br />
Der Liederkranz<br />
Lehrer Jässle war der Gründer des Liederkranzes Gechingen. 1840 trafen sich unter seiner<br />
Leitung 15 Sänger zur ersten Chorprobe. Da in jener Zeit überall Gesangsvereine entstanden,<br />
kam bald der Wunsch auf, sich einer größeren Gemeinschaft anzuschließen. Als sich in<br />
Göppingen 1849 der Schwäbische Sängerbund zusammenfand, war der <strong>Gechinger</strong><br />
Liederkranz mit dabei. Mit Begeisterung nahm der junge Verein an Sängerfesten in<br />
Ludwigsburg 1856 und Tübingen 1857 teil. Damals war eine Fahrt in diese Städte noch fast<br />
163
eine Weltreise und nicht so einfach wie heute. Die damals ersungenen Pokale nehmen noch<br />
heute einen Ehrenplatz in den Vereinsräumen ein.<br />
Lehrer Jässle leitete den Verein bis 1868. Durchschnittlich waren es 20 Sänger. Danach ruhte<br />
die Vereinstätigkeit für ca. 4 Jahre, bis 1872 unter der Leitung des Lehrers Schwäble ein neuer<br />
Anfang gemacht wurde. Die nächsten Jahre waren eine unruhige Zeit für den Verein durch<br />
ständigen Wechsel in der Chorleitung, die nacheinander die Lehrer Büttner, Frieß und<br />
Pfrommer übernahmen. Im Jahr 1884, Vorstand war damals der weitblickende und tatkräftige<br />
Schultheiß Ziegler, wurde im Zusammenwirken mit Ernst Unger am 24. Mai der westliche<br />
Gäusängerbund, schlicht "Westgau" genannt, gegründet.<br />
Charakteristisch für diese Zeit war die Durchführung von Sängerwettstreiten, die anfangs<br />
jährlich, später noch alle zwei Jahre stattfanden. Der Verein war unter der musikalischen<br />
Leitung von Lehrer Pfäffle (1889 - 1897), Lehrer Wilhelm Breitling (1900 - 1901), Lehrer<br />
Günther (1902 - 1908) und Lehrer Bullinger (1908 - 1914) sehr aktiv an diesem Geschehen<br />
beteiligt. Die Vereinsleitung in diesen Jahren lag nacheinander bei Karl Maier, Karl Breitling<br />
und Ludwig Weiß. Der erste Weltkrieg brachte einen tiefen Einschnitt in das Vereinsleben;<br />
viele Sänger mußten einrücken. Zwei treue Sänger kehrten nicht mehr zurück.<br />
Nachdem sich das Leben nach dem Ende des Krieges wieder etwas normalisiert hatte, fanden<br />
sich am 1. Juni 1919 die Sänger wieder zusammen und begannen einige Monate danach unter<br />
der Leitung von Hauptlehrer Baier aus Dachtel wieder mit regelmäßigen Singstunden.<br />
Vorsitzender war bis 1921 der bereits erwähnte Ludwig Weiß. Danach wurde Otto Schaible<br />
zu seinem Nachfolger gewählt, der 1937 zum Ehrenvorstand ernannt wurde.<br />
1922 fand in Schömberg ein Preissingen statt, an dem sich der Verein erstmals nach<br />
Kriegsende wieder beteiligte. Die Aktivitäten der Vereinsangehörigen beschränkten sich nicht<br />
nur auf die Pflege des Liedgutes, sondern erstreckten sich auch in den schauspielerischen<br />
Bereich. Dabei hatte sich eine Laienspielschar zusammengefunden, die sich mit großem<br />
Erfolg selbst an schwierige Aufgaben heranwagte und u.a. auch Stücke der Heimatdichterin<br />
Tillie Jäger aufführte.<br />
1923 übernahm Oberlehrer Unger aus Stuttgart die Chorleitung. In erfolgreicher<br />
Zusammenarbeit mit den Vizedirigenten Adolf Breitling und Hauptlehrer Sehburger errang<br />
der Verein von 1923 bis 1931 fünf 1a und zwei 1b Preise. Dabei erreichte der Liederkranz<br />
zweimal die beste Tagesleistung und wurde 1928, der damaligen Klassifizierung<br />
entsprechend, in die Klasse "Kunstgesang" aufgenommen. Am 7.6.1931 feierte der Verein im<br />
Rahmen eines Gauliederfestes sein 90-jähriges Bestehen.<br />
Das Jahr 1935 brachte einen Höhepunkt in der Vereinsgeschichte. Bei einem Sängerfest in<br />
Freudenstadt erreichte der Liederkranz im "erschwerten Kunstgesang" die Bestleistung des<br />
Tages, die mit der Note "vorzüglich" bescheinigt wurde. Die begeisterten Zuhörer spendeten<br />
langanhaltenden Beifall.<br />
Durch einen Erlaß der damaligen Regierung mußten alle Vereine ihre Vermögen dem Staat<br />
übereignen. Um dem zu entgehen, machte der Liederkranz kurz entschlossen einen<br />
Vereinsausflug an den Bodensee und verbrauchte dabei das ganze Vereinsvermögen.<br />
1939 stand wieder ein Wechsel in der Chorleitung an, da Chorleiter Unger wegen<br />
Arbeitsüberlastung den Dirigentenstab niederlegte, den Lehrer Lorenz übernahm. Rudolf<br />
Unger wurde in Würdigung seiner Verdienste zum Ehrenchormeister ernannt. Lehrer Lorenz,<br />
der damals in die Bresche sprang, konnte nur zwei Jahre lang das Dirigentenamt ausüben, da<br />
er 1941 zur Wehrmacht eingezogen wurde. Doch erzielte der Liederkranz bei einem<br />
Wertungssingen unter seiner Leitung 1939 in Althengstett die Note "sehr gut". 1941 stellte<br />
sich Ehrenchormeister Unger wieder zu Verfügung und hat durch seinen Einsatz unserem Ort<br />
den Gesangverein erhalten können. Auch während des Krieges konnte die chorische Arbeit in<br />
eingeschränktem Umfang fortsetzt werden. So war man in der Lage, bei fast allen<br />
164
Trauergottesdiensten zu singen. Am Ende des Krieges hatte der Verein 13 gefallene und acht<br />
vermißte Sänger zu betrauern.<br />
Trotz der großen Lücken, die der zweite Weltkrieg hinterlassen hatte, war es möglich, die<br />
Arbeit des Liederkranzes fortzusetzen. Die Chorleiter Adolf Gehring und Rudolf Unger<br />
arbeiteten gut zusammen, unterstützt durch die damaligen Vorsitzenden Wilhelm<br />
Schumacher, Karl Böttinger und Otto Vetter. So konnte der Liederkranz am 26. und 27. Mai<br />
1951, im Rahmen des ersten Gauliederfestes des nach dem Krieg wieder erstandenen<br />
Westgaus, in Gechingen nachträglich sein 110-jähriges Jubiläum feiern. Es wurde ein<br />
gelungenes Fest.<br />
Am 26.10.1952 wurde in Ludwigsburg der Schwäbische Sängerbund nach dem Krieg neu<br />
gegründet. Als ehemalige Mitgründer nahm der Liederkranz Gechingen mit einer Abordnung<br />
daran teil. Im gleichen Jahr erreichte der Chor bei einem Wertungssingen in Dachtel unter der<br />
Leitung von Adolf Gehring mit dem Chor "Der Wagen rollt" die Tagesbestleistung mit der<br />
Benotung "sehr gut".<br />
Schon 1951 gab es Überlegungen, dem bis dahin reinen Männerchor einen Frauenchor anzugliedern.<br />
Mit dreißig aktiven Sängerinnen startete der Frauenchor sehr erfolgreich. Seither<br />
singen beide Chöre getrennt oder gemischt zur Freude aller Zuhörer. 1953 war der Verein für<br />
kurze Zeit ohne Dirigent. Dann hat sich jedoch mit dem Musiklehrer Reinhold Schäffer aus<br />
Stuttgart rasch ein neuer Chorleiter gefunden. Im Januar 1955 verstarb der Ehrenchormeister<br />
Rudolf Unger. Der Liederkranz geleitete seinen geschätzten und verehrten Dirigenten zu<br />
seiner letzten Ruhestätte und wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.<br />
Erfolgreiche chorische Arbeit in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre wird durch folgende<br />
Ereignisse dokumentiert: 1955 durch die Teilnahme an einem Gaufest in Simmozheim, wobei<br />
dem Liederkranz für den Chor "Der Einsiedler" das Prädikat "mit Auszeichnung" zuerkannt<br />
wurde. Auch die Auftritte beim Rundfunksingen 1955 und 1959 fanden bei den Hörern guten<br />
Anklang, was durch begeisterte und dankbare Schreiben belegt ist, die dem Liederkranz<br />
zugesandt wurden. Als besondere Anerkennung darf auch die Überreichung der Zelterplakette<br />
am 15.3.1958 gewertet werden. Im Rahmen der Bundesversammlung des Schwäbischen<br />
Sängerbundes wurde dem Verein von Präsident Dr. Weiß diese Auszeichnung überreicht. Sie<br />
ist eine Stiftung des ehemaligen Bundespräsidenten Prof. Dr. Theodor Heuss und wird an<br />
Vereine verliehen, die bereits auf eine 100-jährige Tradition zurückblicken können.<br />
Einer großen Herausforderung hatte sich der Verein in der Osterwoche 1961 mit der<br />
Aufführung der Johannes-Passion von Heinrich Schütz gestellt. Es war für Sänger und<br />
Zuhörer ein großes Erlebnis, daß dieses gewaltige Werk in der Martinskirche aufgeführt<br />
werden konnte.<br />
1965 war Jubiläumsjahr. 125 Jahre waren seit der Gründung des Liederkranzes vergangen. In<br />
Verbindung mit einem Gauliederfest wurde ein umfangreiches Festprogramm mit einem<br />
großen Festzug geboten. Die Feier wurde zu einem vollen Erfolg und zu einem Erlebnis, an<br />
das sich viele Beteiligte noch heute gerne erinnern. Der damalige Vorsitzende, Otto Vetter,<br />
mußte aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niederlegen und wurde für 14-jährige treue<br />
Dienste zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Als sein Nachfolger wurde Karl Mörk Vorsitzenden<br />
gewählt. Auch in den Jahren danach war der Verein unter Chorleitung von Reinhold Schäffer<br />
weiterhin aktiv. Höhepunkte in dieser Zeit waren 1966 die Aufführung der Operette "Die<br />
Winzerliesel", bei der eine Laienspielgruppe unter der Regie von Eugen Breitling mit<br />
Unterstützung des Chores eine hervorragende Leistung bot. Dem folgte 1967 ein gelungenes<br />
Konzert für Männer-, Frauen- und gemischten Chor. 1969 fuhr der Verein am 11.4. zum<br />
Süddeutschen Rundfunk zu Bandaufnahmen, die am Pfingstsonntag gesendet wurden.<br />
Nach fast 19 Jahren des Wirkens in Gechingen mußte sich der Verein Ende Juli 1970 von<br />
Chorleiter Reinhold Schäffer trennen. Bis ein geeigneter Nachfolger gefunden wurde<br />
165
übernahmen Vizedirigent Otto Gann und als Stellvertreter Karl-Heinz Dürr die Leitung der<br />
Chorproben. Am 24.9.1971 konnte Konrektor Hartmut Benzing als neuer Chorleiter die erste<br />
Singstunde mit dem gemischten Chor abhalten. Der neue Chorleiter und heutige<br />
Gauchormeister im Hermann-Hesse-Gau konnte seine Leistungen in den nächsten Jahren<br />
eindrucksvoll unter Beweis stellen. Schon im Juni 1972 wurde unter dem Motto "Über Länder<br />
und Meere" das erste Konzert durchgeführt, gefolgt von einem festlichen Adventskonzert im<br />
gleichen Jahr, das zusammen mit dem Kirchenchor gestaltet wurde. Das Jahr 1975 brachte<br />
wieder einen Wechsel in der Vorstandschaft. Nach 10-jährigem Wirken legte Karl Mörk sein<br />
Amt nieder. Zu seinem Nachfolger wurde Hans Gräber gewählt.<br />
Im Juni 1976 fand in Berlin das Chorfest des Deutschen Sängerbundes statt. Als Vertreter des<br />
Westgaus war der Liederkranz mit dabei. Schon am 6. November folgte der nächste<br />
Höhepunkt dieses ereignisreichen Jahres. Ein Querschnitt durch die "Romantische Oper",<br />
besetzt mit Solisten aus der Staatsoper Stuttgart und begleitet vom Orchester Spieß, wurde zu<br />
einem musikalischen Hochgenuß und einem Meilenstein in der Vereinsgeschichte.<br />
Am 15. Mai 1978 wurde nach monatelanger Probenarbeit ein Auftritt des Liederkranzes bei<br />
einem Konzert für chorische Gebrauchsmusik in der Sindelfinger Stadthalle durch guten<br />
Erfolg belohnt. Auch beim jährlichen Familien- und Unterhaltungsabend, wurde im Oktober<br />
des gleichen Jahres mit der Operette "Maske in Blau" etwas Besonderes geboten. Im Herbst<br />
1979 folgte ein Wunschkonzert, wobei Chorleiter Benzing aus den eingegangenen<br />
Wunschzetteln ein ansprechendes Programm zusammenstellte.<br />
Vom 13. bis 17. Juni 1980 war der Liederkranz auf einer beeindruckenden Reise in Wien, bei<br />
der die Teilnehmer sowohl etwas geboten haben als auch etwas geboten bekamen.<br />
Im Rahmen einer "Geburtstagsfeier" wurde am 25. und 26. Oktober 1980 das 140-jährige<br />
Bestehen des Liederkranzes gefeiert.<br />
Eine überraschend große Resonanz fand die Einladung zur Gründung eines Jugendchors. Mit<br />
40 Mädchen und Jungen kamen weit mehr Kinder als erwartet zur ersten Chorprobe,. Als<br />
Jugendleiter stellte sich Max Musshafen zur Verfügung.<br />
Im Spätherbst 1981 beteiligte sich der Liederkranz an einer Veranstaltung des Schwäbischen<br />
Sängerbundes in Böblingen. Mit Frauenchor, Männerchor und gemischtem Chor wurden<br />
Beiträge zum Thema "Das deutsche Volkslied im Wandel der Zeiten" mit gutem Erfolg<br />
vorgetragen. Am 6. November 1991 führte der Liederkranz wieder einen Konzertabend mit<br />
einem Potpourri aus der Operette "Glückliche Reise" durch. Erstmalig war auch der<br />
Jugendchor mit von der Partie. Ende November galt es, "500 Jahre Martinskirche Gechingen"<br />
zu feiern. Aus diesem Anlaß fand eine Festwoche statt. Dabei wirkte der Verein bei einer<br />
festlichen Abendmusik in der Kirche mit.<br />
Vom 15. bis 19. Juni 1983 zog es den Verein nach Frankreich. Ein offizieller Empfang durch<br />
die Gemeinde St. Germain Les Corbeil bei Paris und das Konzert in der Kirche waren<br />
unvergeßliche Erlebnisse für die Teilnehmer.<br />
Mitte September gab es einen Wechsel im Amt des Jugendleiters. Gerhard Busch löste Max<br />
Musshafen ab, die Arbeit des Jugendchors ging nahtlos weiter. Vom 31. Mai bis 3. Juni 1984<br />
reiste der Jugendchor nach St. Germain Les Corbeil und führte zusammen mit dem dortigen<br />
Schulchor ein Konzert durch. Der Gegenbesuch im gleichen Jahr mit einer festlichen Matinée<br />
war ein echter Beitrag zur deutsch-französischen Freundschaft.<br />
Im November wurde unter dem Motto "Die Welt entlang mit Hohnerklang" ein<br />
Orchesterkonzert durchgeführt. 1986 folgte wieder ein Opernkonzert mit hervorragenden<br />
Solisten, ein chorischer Höhepunkt der 80er Jahre.<br />
Am 12.6.1987 feierte Chorleiter Hartmut Benzing sein 25-jähriges Jubiläum mit vielen<br />
geladenen Gästen. Ende 1987 und im ersten Halbjahr 1988 wurde der Verein überwiegend<br />
vom Jugendchor repräsentiert. Veranstaltungen in Trossingen, Haigerloch und Gechingen<br />
166
waren erfolgreich. Im November 1988 kamen Kompositionen aus vier Jahrhunderten zur<br />
Aufführung; es war ein Konzert auf hohem Niveau.<br />
Zu einem wahren Ohrenschmaus wurde am 21. 10. 1989 ein Konzert in der Martinskirche.<br />
Ein umfangreiches Programm mit Werken vom Barock bis zur Moderne übertraf alle<br />
Erwartungen. Ein schöner Erfolg für den Jugendchor, die Aureliussängerknaben Calw und den<br />
Jugendchor Stein-Eisingen! Jugendleiter Gerhard Busch übergab sein Amt an Harald Kramer.<br />
Im Jahr 1990 feierte der Verein mit der ganzen Bevölkerung sein 150. Jubiläum. Ein bunter<br />
Festzug, an dem sich alle örtlichen Vereine und Gruppen beteiligten, zog durch den Ort. 19<br />
Vereine fanden sich zu einem Kritiksingen ein, das ein musikalischer Leckerbissen wurde<br />
Der Jugendchor hatte 1991 den Schulchor von St.Germain zu Gast. Ein Gegenbesuch in<br />
Frankreich erfolgte wenig später.<br />
Anfang 1992 fand ein Wechsel im Vorstand des Liederkranzes statt. Hans Gräber, der zum<br />
Ehrenvorsitzenden ernannt wurde, legte nach langem Wirken sein Amt in die Hände von<br />
Günther Rummel. Im November 1992 führte der Liederkranz unter dem Motto "Vom<br />
Nordseestrand zum Schwabenland" ein gelungenes Konzert durch. Auch bei einer<br />
Morgenfeier 1993, im Rahmen des 2. Chortages des Hermann-Hesse-Gaus in Stammheim,<br />
wirkte der Liederkranz mit. Im Januar 1995 übergab Harald Kramer nach mehrjähriger<br />
Tätigkeit als Jugendleiter sein Amt an Iris Bühler.<br />
Noch nie ist im Liederkranz die Geselligkeit zu kurz gekommen. Man traf und trifft sich<br />
regelmäßig bei Familien- und Unterhaltungsabenden, Faschings- und Tanzveranstaltungen<br />
(Frühlingsball), Sommerfesten (Lindenblütenfest), Ausflügen, Wanderungen, Gautagen oder<br />
Treffen mit anderen Vereinen. Im Vordergrund jedoch stand und steht, gestern wie heute, die<br />
Förderung und Pflege des Chorgesangs als Vereinsaufgabe.<br />
Der Musikverein<br />
Sieben Musikfreunde waren es, die im Jahre 1877 die Musikkapelle Gechingen ins Leben<br />
gerufen haben, und zwar: Gehring Karl alt, Maier Friedrich, Gräber Jakob, Vetter Samuel,<br />
Stiegelmaier Heinrich, Reichert Jakob und Ginader Fritz. Georg Gehring, der Vater des<br />
Mitbegründers Karl Gehring, ein Bauersmann mit überdurchschnittlichen musikalischen<br />
Gaben, finanzierte damals den Kauf der Instrumente und wirkte in der Kapelle mit.<br />
Musikdirektor Speidel von Calw erteilte den Anfängern zwei Jahre lang Unterricht, bis die<br />
Kapelle von Karl Gehring selbst geleitet werden konnte. In den 90-er Jahren des vorigen<br />
Jahrhunderts wurde die Leitung der Kapelle von Kaufmann Kaltenmark, der Militärmusiker<br />
war, mit gutem Erfolg übernommen. Um das Jahr 1905 bestand der Verein fast ausschließlich<br />
aus alten Leuten. Da neue Kräfte nicht gewonnen werden konnten, ruhte zunächst die<br />
Tätigkeit der Kapelle. Im Jahr 1921 fanden sich wieder einige Musikfreunde zusammen, die<br />
einen Musikverein gründeten. Dies war die Geburtsstunde des heutigen Musikvereins<br />
Gechingen e.V.. Noten und einige Instrumente konnten von der alten Kapelle übernommen<br />
werden. Nach verhältnismäßig kurzer Zeit konnten weitere Instrumente angeschafft werden,<br />
obwohl die Beschaffung damals sehr schwer war und ohne größere Opfer jedes einzelnen<br />
Vereinsangehörigen nicht möglich gewesen wäre. Insbesondere verdient hervorgehoben zu<br />
werden, daß Paul Breitling, der ein begeisterter Musiker war, damals seine ganzen Ersparnisse<br />
zur Verfügung gestellt hat, um dem Verein die Anschaffung der fehlenden Instrumente zu<br />
ermöglichen. Bald zählte der Verein 18 Mann und erlebte eine erfreuliche<br />
Aufwärtsentwicklung. Im Jahr 1927 konnte der Verein sein 50-jähriges Jubiläum festlich<br />
begehen.<br />
Mit großem Erfolg hat sich der Verein an Musikwettbewerben beteiligt, so in Stammheim<br />
1927 und in Möhringen a.d.F. 1928, wo der Verein mit der Ouvertüre zu v. Kelers Lustspiel<br />
167
"Bela" einen Ia-Preis errang. Das Programm zum Musikfest 1928 in Gechingen sah<br />
folgendermaßen aus:<br />
Gechingen O.A. Calw<br />
F e s t - P r o g r a m m<br />
zum M u s i k - F e s t<br />
des Musikvereins Gechingen e.V.,<br />
Mitglied des Süddeutschen Musikverbandes, am 10.Juni 1928<br />
Morgens 5 1/2 Uhr: Tagwache<br />
9 Uhr: Ausschuß - Sitzung im Adler<br />
11 Uhr: Massen - Chorprobe<br />
Mittags 1 Uhr: Aufstellung des Festzugs in der Gartenstraße<br />
Nach Ankunft auf dem Festplatz:<br />
1. Begrüßungsmarsch durch die Festkapelle<br />
2. Begrüßungsansprache<br />
a) von Vorstand Riehm<br />
b) von Schultheiß Schmidt, Ehrenvorsitzender<br />
3. Vortrag des Gesangvereins Liederkranz Gechingen<br />
4. Massenchor: Die Himmel rühmen und Marsch: Hoch - Heidecksburg<br />
5. Einzel-Vorträge der Gastkapellen:<br />
a) Musikverein Eintracht Merklingen, Eris-Ouvertüre<br />
b) Musikverein Möhringen, Unbestimmt<br />
c) Musikverein Kuppingen, Der Zukunftsgeist<br />
d) Musikverein Gültlingen, Hochzeitsständchen<br />
e) Musikverein Althengstett, Regina - Ouvertüre<br />
f) Musikverein Hirsau, Ouvertüre Regina<br />
g) Musikverein Gärtringen, Zauberflöte<br />
h) Musikverein Weil der Stadt, Ouvertüre Goldgräber<br />
i) Musikverein Stammheim, Unbestimmt<br />
k) Musikverein Aidlingen, Unbestimmt<br />
6. Schlußmarsch durch die Festkapelle<br />
8 Uhr abends: Festball im "Hirschsaal"<br />
1929 beteiligte sich der Verein am Bezirksmusikfest in Mühlhausen a.d.W. mit der Ouvertüre<br />
"Nebukadnezar" von Verdi und erhielt einen Ia-Preis. Im Jahr 1930 konnte beim<br />
Verbandsmusikfest in Pforzheim in der Mittelstufe die Note "gut" erreicht werden, ebenso<br />
1934 beim 100-jährigen Jubiläum in Calw mit Marschmusik. Beim Bezirksmusikfest 1935 in<br />
Nagold, verbunden mit dem 50-jährigen Jubiläum der Stadtkapelle Nagold, wurde mit der<br />
Militärouvertüre von Zwicker die Note "vorzüglich" errungen. 1936 war der Verein ohne<br />
Dirigenten. Es zeigte sich bald, daß es mit der Leistung rückwärts ging. Kurz darauf übernahm<br />
Kapellmeister Solf aus Hirsau, welcher verschiedene Kapellen der Umgebung dirigierte, die<br />
Leitung. 1937 veranstaltete der Verein einen Musikertag, verbunden mit dem 60-jährigen<br />
Vereinsjubiläum. Das Fest war von nah und fern gut besucht.<br />
Im Laufe des zweiten Weltkrieges mußten fast alle Angehörigen des Vereins einrücken oder<br />
waren dienstverpflichtet. Doch konnte der Verein bis zum Jahr 1943 bei allen Trauerfeiern<br />
den gefallenen Kameraden die letzte Ehre mit Musik erweisen. Schwere Lücken hat der Krieg<br />
in die Reihen des Musikvereins gerissen. Der Verein trauert um 10 aktive und 3 passive<br />
Mitglieder. Nach diesem Verlust galt es, den Verein wieder neu aufzubauen. Im Januar 1946,<br />
als verschiedene Kameraden aus der Gefangenschaft zurückkehrten, trafen sich die Musiker,<br />
um die Vereinstätigkeit wieder auf-zunehmen. Gleichzeitig wurden 11 musikfreudige junge<br />
168
Leute in den Verein aufgenommen, die mit allem Eifer ans Werk gingen. Mit der Leitung des<br />
Vereins wurde Karl Dürr betraut, der aus den jungen Musikern tüchtige Nachwuchsspieler<br />
machte. So konnte 1947 eine Frühjahrsfeier mit gutem Erfolg abgehalten werden. Im Jahr<br />
1948 übernahm Gustav Klier aus Bad Liebenzell die Dirigentenschaft. Vom 24. bis 26. Mai<br />
1952 feierte der Verein sein 75-jähriges Jubiläum, verbunden mit dem Kreismusikfest des<br />
Kreises Calw im Bezirk Schwarzwald-Nord. Durfte auch die Vereinskasse infolge der<br />
schlechten Witterung keinen Erfolg verbuchen, so war es für den Verein selbst doch ein<br />
bedeutendes Fest und Ansporn zu weiterem Schaffen.<br />
In den folgenden Jahren ging es dem Verein gut, sowohl bei den Neuzugängen, als auch bei<br />
der Leistung. Dies zeigt die Verpflichtung zu einem Kurkonzert in Bad Liebenzell, welches<br />
mit einer Stärke von 28 Mann unter Herrn Klier meisterhaft ausgeführt wurde. In der<br />
folgenden Zeit beteiligte sich der Verein regelmäßig an den Bezirks- und Kreismusikfesten<br />
des Bezirks Schwarzwald-Nord. 1955 spielte der Verein bei zwei Kurkonzerten in<br />
Schömberg. Aufgrund der guten Leistung verpflichtete der Liederkranz Schömberg den<br />
Musikverein zu seinem Fest im selben Jahr. Auf diese Art und Weise wurde der Musikverein<br />
Gechingen weit über die Grenzen der Heimat hinaus bekannt und als beliebte Tanz- und<br />
Stimmungskapelle zu Festen jeglicher Art geholt, so auch für drei Tage nach Langenbrand<br />
zum Kreiserntedankfest. 1959 fand ein Frühjahrskonzert in der Festhalle mit sehr guter<br />
Konzertmusik statt. Im Juli des gleichen Jahrs war Kreismusikfest in Wildberg, wo der<br />
Musikverein Gechingen unter den besten fünf von zwanzig Kapellen war. Am 6. Mai 1960<br />
begannen die Aufnahmen zum <strong>Gechinger</strong> Heimatfilm durch den Musikverein. Im Juli nahm<br />
der Verein am Kreismusikfest in Jagsthausen teil. Im Oktober war die erste Vorführung des<br />
Heimatfilms, der dem Verein gehört und auf dem Rathaus aufbewahrt wird.<br />
1962 wurden neue Uniformen angeschafft, um das Bundesmusikfest in Ludwigsburg zu<br />
besuchen, wo der Verein mit 90 Punkten einen enttäuschenden 3. Rang erhielt. Am 16.<br />
September spielte der Verein drei Tage beim Kreiserntedankfest in Deckenpfronn. Neben<br />
Verpflichtungen nach Dachtel, Zainen-Maisenbach, Deufringen und Sindelfingen im Jahr<br />
1963 wurde auch der konzertanten Blasmusik Rechnung getragen und wie alljährlich mit<br />
einem Konzert in der Festhalle aufgewartet.<br />
Um den Verein zu erhalten, war im Jahr 1965 ein Dirigentenwechsel unumgänglich. Hierzu<br />
konnte Gerhard Schmid aus Wildberg gewonnen werden, welcher am 24. April dann den<br />
Taktstock in Gechingen übernahm und bereits am 1. Mai bei einer Frühjahrsfeier sein Können<br />
unter Beweis stellte. 1966 spielte die Jugendkapelle unter Leitung von Alfred Gehring zum<br />
ersten Mal außerhalb Gechingens in Salzstetten Kreis Horb. Neben Verpflichtungen nach<br />
Dätzingen, Sindelfingen, Deufringen, Stuttgart - Botnang und Liebenzell, fand auch der seit<br />
Jahrzehnten zur Tradition gewordene Hahnentanz in der Gemeindehalle statt. Mit dem<br />
Pflichtstück "Dramatischer Epilog" und dem selbstgewählten Stück "Schwarzwaldsuite" in<br />
vier Sätzen von H. Kolditz erhielt der Verein beim Bundesmusikfest in Sindelfingen am 16.<br />
Juni 1968 einen ersten Rang in der Mittelstufe. Im selben Jahr wurden ein Musikfest in<br />
Neuhengstett sowie das Kreismusikfest in Ebhausen besucht.<br />
Ein bedeutendes Jahr für den Musikverein Gechingen wird das Jahr 1971 bleiben. Die<br />
Instrumente waren so überaltert, daß eine Neuanschaffung notwendig wurde. Es entstanden<br />
Kosten in Höhe von etwa DM 40.000. Der Instrumentenbestand im Jahr 1971 betrug zwischen<br />
60 und 70 Stück.<br />
Beim Jugendkritikspiel 1973 in Schönaich errang die Jugendgruppe die Note "gut", die<br />
Jugendkapelle die Note "sehr gut". Vom 22. bis 26. Juni 1973 fanden die "Internationalen<br />
Musiktage Gechingen" statt. Leider hatte der Wettergott bei diesem Fest kein Einsehen, ein<br />
heftiger Sturm und mehrere Gewitter setzten den Festplatz unter Wasser. Neben der<br />
169
Musikgesellschaft Stansstad (Schweiz) wurde dieses Fest über vier Tage von Kapellen und<br />
Vereinen aus den Bezirken Schwarzwald-Nord und Leonberg-Schönbuch besucht und damit<br />
zu einer wahren Demonstration der deutschen Volksmusik.<br />
1974 erhielt die Jugendgruppe beim Kritikspiel die Note "gut". Zum ersten Mal in der<br />
Vereinsgeschichte spielte der Verein in der Oberstufe beim Bundesmusikfest in<br />
Onstmettingen und erzielte einen ersten Rang. 1975 war der Musikverein bereits zum dritten<br />
Male in Kerzers in der Schweiz. Das Jahr 1977 brachte mit dem 100-jährigen Bestehen des<br />
Musikvereins Eintracht einen Höhepunkt im Vereinsleben der Gemeinde. Ganz Gechingen<br />
war auf den Beinen und feierte mit.<br />
Seit Jahren veranstaltet der Verein seine "Hocketse" im Ort. Gastorchester spielen den Gästen<br />
bei Speis und Trank bis in die Nacht auf. Zahlreiche Besucher aus nah und fern feiern mit dem<br />
Musikverein.<br />
Weitere Daten aus der Vereinsgeschichte:<br />
1978: Wertungsspiel in Neuhengstett in der Höchststufe. Wertung: 1.Rang mit Auszeichnung.<br />
1984: Wertungsspiel in Bad Liebenzell in der Höchststufe. Wertung: 1.Rang mit Belobigung.<br />
1990: 25-jähriges Dirigentenjubiläum von Musikdirektor Gerhard Schmid.<br />
1991: Dirigent Gerhard Schmid verstorben.<br />
1992: Neuer Dirigent Anton Hirzle aus Birkendorf im Süd-Schwarzwald.<br />
Seit 1992: Der MVG veranstaltet zwei Konzerte im Jahr. Im Dezember: Festliches<br />
Adventskonzert (Sinfonische und konzertante Blasmusik). Im April: Modern- Music- Show<br />
(Ausschließlich moderne Musik, gespickt mit Licht- und Showeffekten).<br />
1994: 25 jähriges Freundschaftsjubiläum zwischen der Musikgesellschaft Kerzers und dem<br />
Musikverein Gechingen.<br />
1995: Der MVG reist zum dritten Mal nach 1987 und 1991 nach England. Dort wird er beim<br />
Edelweißclub Luton (Vorort von London) dessen traditionelles Oktoberfest musikalisch<br />
umrahmen.<br />
Der Handharmonikaclub<br />
Nachdem sich in den umliegenden Orten Handharmonikaclubs bildeten, faßten am 20. 10.<br />
1936 sieben Musikfreunde den Entschluß, auch einen Verein zu gründen. Vorsitzender wurde<br />
Wiethard Kammerer. Bis zum Kriegsausbruch 1939 trafen sich die Mitglieder regelmäßig alle<br />
vier Wochen zu Proben im Gasthaus Adler. Beim Festzug am 60jährigen Jubiläum des<br />
Musikvereins am 26. 6. 1937 war der Club mit einem eigenen Wagen dabei. Der<br />
Kriegsausbruch brachte das Ende des Clubs.<br />
Der Homöopathische Verein<br />
Daß es einen derartigen Verein gegeben hat, ersehen wir aus einer Zeitungsanzeige im Calwer<br />
Wochenblatt vom März 1914. Der Text lautet: "Am Sonntag den 23 März, nachmittags 4 Uhr<br />
findet im Gasthaus zum "Lamm" ein Vortrag statt, über das Thema: Ist es der Mühe wert,<br />
Homöopath zu sein? Redner Herr Reallehrer Wolf Stuttgart. Freunde der Homöopathie sind<br />
freundlich eingeladen!!" Der Gründer des Vereins war vermutlich Pfarrer Hermann Adam<br />
Beitter, der von 1908 - 1912 in Gechingen tätig war. Er war als Naturheilkundiger bekannt<br />
und übte auch in Gechingen seine Tätigkeit aus. Dies ging nicht ohne Probleme ab, da der<br />
damalige Barbier eine Beeinträchtigung seiner Arbeit und seines Verdienstes in der Gemeinde<br />
befürchtete. Wie lange der Verein noch nach dem Weggang von Pfarrer Beitter existierte, ist<br />
nicht bekannt. Vermutlich endete das Vereinsleben durch den Ausbruch des zweiten<br />
Weltkrieges, denn 1931 fand noch eine Generalversammlung statt, bei der Vorstand Weiß,<br />
Wegemeister, die Mitglieder begrüßte. Es wurden als Ausschußmitglieder August Breitling,<br />
Schmied, und Otto Weiß, Landwirt gewählt.<br />
170
Der Schwarzwaldverein<br />
Die Ortsgruppe Gechingen des Schwarzwaldvereins wurde am 19.11. 1960 von 18 Personen<br />
unter Vorsitz von Frau Ursula Pumbo gegründet. Die Stammheimer Wanderfreunde standen<br />
dem jungen Verein als Paten zur Seite. Seit 1968 stieg die Mitgliederzahl ständig; 1978 waren<br />
es 250, 1984 bereits 363 Mitglieder. 1994 konnte das 500. Mitglied begrüßt werden. Zuerst<br />
lag der Schwerpunkt der Vereinstätigkeit auf dem Ausbau des Wegenetzes. Aber bald<br />
erstreckte sich das Aufgabengebiet auf wichtige Themen wie Umweltschutz, Landschafts- und<br />
Brauchtumspflege und den Kampf gegen das Waldsterben. Längst hat der Schwarzwaldverein<br />
seine Wanderziele erweitert, heute wandert er auch in den Vogesen, in den Bergen der<br />
Schweiz, Österreichs, Südtirols (Dolomiten) und Bayerns. Ehrenmitglied Anton Röser,<br />
Stuttgart, überließ dem Ortsverein Gechingen 1971 seine Jagdhütten, heute "Röserhütten"<br />
genannt, zur kostenlosen Benützung. Wenige Tage vor seinem Tode schenkte er diese Hütten<br />
und den dazugehörenden Wald dem Verein. Die Hütten sind oft das Abschlußziel<br />
heimatlicher Wanderungen. Dort findet auch ein Großteil der geselligen Aktivitäten der<br />
Mitglieder statt. 1989 trat der Arbeitskreis Heimatgeschichte mit ca. 20 Mitgliedern als<br />
selbständige Abteilung dem Schwarzwaldverein bei. Zu seinen selbstgestellten Aufgaben<br />
gehört das Einrichten und Betreiben des Heimatmuseums im "Appeleshof".<br />
Volkshochschule<br />
1975 wurde in Gechingen eine Außenstelle der Volkshochschule Calw gegründet. Das<br />
Programmangebot der VHS Gechingen als Stätte kultureller 0rientierung, kreativer<br />
Freizeitgestaltung und selbstbestimmtem Lernens ist sehr vielfältig. Es umfaßt eine breite<br />
Palette in den Bereichen Sprachen, Werken, Gesundheit, Kochen etc., bis hin zu Einzelveranstaltungen<br />
mit allgemein interessierender und anspruchsvoller Thematik. So fanden<br />
im Jahre 1984 58 Kurse (747 Teilnehmer) und 20 Einzelveranstaltungen (940 Teilnehmer)<br />
statt; auch im Jahre 1985 sah die VHS in Gechingen mit 62 Kursen (730 Teilnehmer) und 15<br />
Einzelveranstaltungen (739 Teilnehmer) dieses erfreuliche Interesse bestätigt. Im Jahre 1994<br />
fanden 151 Kurse mit 1538 Teilnehmern und 16 Einzelveranstaltungen mit 385 Teilnehmern<br />
statt. 1995 blickte die Volkshochschule auf ihr 20-jähriges Bestehen zurück. Die Hauptstelle<br />
in Calw und die Gemeindeverwaltung in Gechingen drückten der Außenstellenleiterin,<br />
Johanna Helbig, für ihren tatkräftigen Einsatz Dank und Anerkennung aus. Die<br />
Volkshochschule in Gechingen wird auch in Zukunft das kulturelle Leben in der Gemeinde<br />
bereichern sowie der persönlichen und beruflichen Weiterbildung mit ihrem Angebot dienen.<br />
Die Sportfreunde Gechingen e.V.<br />
Mit ca. 1 400 Mitgliedern, darunter 600 Jugendlichen, ist der Verein der Sportfreunde die<br />
größte Gemeinschaft am Ort. In zehn Abteilungen werden verschiedene Sportarten betrieben.<br />
Die Abteilungen sind sportlich selbständig und haben eigene Trainingsstätten. Durch die neue<br />
Sporthalle erhalten die Sportfreunde noch bessere Übungsmöglichkeiten. Vorsitzender des<br />
Hauptvereins war viele Jahre Heinz Schwarz.<br />
Die Fußballabteilung<br />
Wir wissen, daß im März 1921 erstmals eine <strong>Gechinger</strong> Fußballmannschaft antrat. Die<br />
Männer der ersten Stunde gründeten die Spielvereinigung Gechingen, wie es in der<br />
Vereinssatzung hieß. Schon damals wurden die Vereinsfarben schwarz/weiß gewählt, denen<br />
der Verein bis heute treugeblieben ist, nur für eine kurze Übergangszeit wurde mit senkrecht<br />
gestreiftem Trikot in schwarz/orange gespielt. Die ersten Spielversuche wurden auf einer<br />
Wiese nahe beim Ort gemacht, bevor die Gemeinde dem jungen Verein ein Gelände auf dem<br />
Vorderen Berg zur Verfügung stellte. In Eigenleistung wurde ein Sportplatz hergerichtet, der<br />
auch heute noch benützt wird. Ein Blick in die Spielliste zeigt, daß schon im Jahr 1921 ein<br />
171
eger Spielbetrieb herrschte. Oft traten an einem Sonntag vier Mannschaften auf vier<br />
verschiedenen Plätzen an. Neben den Freundschaftstreffen gegen Althengstett, Calw,<br />
Ditzingen, Nagold, Stammheim usw. gab es schon bald die gefürchteten 6er-Pokalturniere<br />
nach dem sogenannten ko-System. Pokalsieger wurden damals die <strong>Gechinger</strong> in Mönchberg,<br />
Altburg und Althengstett. Das zweite Jahrzehnt brachte für die Spielvereinigung Gechingen<br />
auch große Erfolge bei turnerischen und leichtathletischen Wettkämpfen. Neben Fußball<br />
wurde schon damals zum Ausgleich Faustball gespielt. Im Jahre 1932 nahm die<br />
Fußballabteilung zum ersten Mal an den Punktspielen der Verbandsrunde in der gemischten<br />
Klasse teil. Die Wintermonate benutzten die Spieler zur Vorbereitung und Aufführung von<br />
Laien-Theaterspielen. Die Weihnachts- und Frühjahrsfeiern des Sportvereins waren und sind<br />
immer Höhepunkte im Vereinsleben der Gemeinde Gechingen. Das erste Kassenbuch, das<br />
vorliegt, beginnt 1930. Hier lesen wir, daß fast jeden Sonntag auf dem Vorderen Berg ein<br />
Fußballspiel stattfand, aber die Platzeinnahmen nur zwischen 2 und 7 Reichsmark, selten über<br />
10 Reichsmark, lagen. Auch wurde für die Spieler in Eigenleistung beim Sportplatz auf dem<br />
Vorderen Berg eine Umkleide- und Unterkunftshütte gebaut. Während des Kriegs führten die<br />
noch nicht eingezogenen Spieler den Sportbetrieb zunächst, so gut es ging weiter und<br />
übernahmen viele Aufgaben dazu. Sie führten eine Winterhilfswerkssammlung durch und<br />
versorgten ihre Kameraden im Feld mit Paketen und Grüßen aus der Heimat. Dann kam die<br />
Vereinstätigkeit aber doch zum Erliegen. Am 1. 3. 1942 ist im Kassenbuch folgendes<br />
eingetragen: "Durch Länge des Krieges und Spielermangel kamen keine Einnahmen mehr<br />
herein, so war ich gezwungen, den Verein abzumelden. Der Kassenbestand beträgt 17,92<br />
Reichsmark. Heinrich Gehring." Mit diesen 17,92 Reichsmark wurde der Verein am 1. 2.<br />
1946 neu ins Leben gerufen. Daß die Wiedergründung durch Leute erfolgte, die die Schrecken<br />
des Krieges, Verwundungen, Kriegsgefangenschaft und ähnliches erlebt haben, ist sicher die<br />
herausragende Leistung in der Vereinsgeschichte. Viele Lücken waren durch den Krieg in die<br />
Spielerreihen gerissen worden und mußten wieder geschlossen werden. Im Jahr darauf fand<br />
die offizielle, von der damaligen französischen Militärregierung amtlich zugelassene<br />
Gründungsversammlung statt. Fritz Rex, der trotz schwerer Kriegsverletzung als aktiver<br />
Spieler dabei war, wurde zum 1. Vorsitzenden gewählt. Sein Nachfolger war Adolf Lutz, der<br />
auch schon in den 30-er Jahren dieses Amt innehatte. Im Jahre 1949 mußten auf Anordnung<br />
der Militärregierung die Namen aller Vereine geändert werden, so wurde die Spielvereinigung<br />
Gechingen in Sport-freunde Gechingen umbenannt.<br />
Durch verschiedene Umgruppierungen spielte die Mannschaft ab 1946 abwechselnd in der A-,<br />
B- oder gemischten Klasse. Sicher einmalig ist auch folgender Vorgang in der<br />
Vereinsgeschichte, den wir im Kassenbuch unter dem Eintrag vom 22.6.1948 nachlesen<br />
können: "Infolge Währungsreform am 20.6.1948 wurde der Kassenbestand an alle aktiven<br />
Mitglieder verteilt. Jeder erhält 25 RM. Mit dem verbleibenden Rest von 2,50 RM wird der<br />
Grundstock für das neue Vereinsvermögen gelegt."<br />
Das folgende Jahrzehnt war sportlich sehr bewegt. 1951 noch in der A-Klasse Nagold<br />
spielend, stieg die Mannschaft 1956 in die C-Klasse ab und erreichte im darauffolgenden Jahr<br />
nur noch den viertletzten Tabellenplatz. 1957/58 wurde dann aber mit der Erringung der C-<br />
Klassen-Meisterschaft eine Aufwärtsentwicklung eingeleitet, die sich in den 60-er Jahren<br />
stetig fortsetzte. Auch feierte der Verein 1951 das 30-jährige Jubiläum mit einem Festbankett<br />
und einem Pokalturnier. Die erste Jugendmannschaft beteiligte sich 1953 an den<br />
Verbandsspielen und griff dann im folgenden Jahr in den Kampf um die Bezirksmeisterschaft<br />
ein. Seitdem verging fast kein Jahr, in dem sich nicht eine oder mehrere Jugendmannschaften<br />
in die Meisterliste der Staffeln oder des Bezirks eintragen konnten. Die Jugendarbeit, mit viel<br />
Geduld, Ausdauer und Idealismus durchgeführt, ist letztlich der Grund für den Aufschwung.<br />
172
Im März 1952 befaßte sich die Vereinsleitung intensiv mit dem Bau eines neuen Sportplatzes.<br />
Im heutigen Ortsteil Angel wurden Grundstücke aufgekauft, die dann allerdings wieder<br />
zurückgegeben wurden, weil die Belastung für Gemeinde und Verein zu hoch erschien. Einen<br />
neuen Anlauf unternahm der Verein einige Jahre später, er erwarb bei der Flurbereinigung<br />
mehrere Grundstücke, die bei der Mühle zusammengelegt wurden.<br />
Wasserschutzbestimmungen ließen aber auch dieses Projekt scheitern.<br />
Die 60-er Jahre waren wohl die erfolgreichsten für die <strong>Gechinger</strong> Fußballer. Der Meisterschaft<br />
in der B-Klasse 1960/61 folgte nach 8 Jahren Zugehörigkeit zur A-Klasse Böblingen/Calw der<br />
Aufstieg in die 2. Amateurliga Württemberg. Als Geschenk zum 40. Jubiläum 1961 brachten<br />
die Fußballer dem Verein den Meisterwimpel der B-Klasse. Das Festspiel gegen die Amateure<br />
des VfB Stuttgart verlor die frischgebackene Meisterelf trotz sehr guter Gesamtleistung. Nur<br />
zweimal in acht Jahren A-Klassen-Zugehörigkeit mußte der Verein um den Klassenerhalt<br />
bangen. Doch verstanden es Trainer und Funktionäre, die Spieler zu überdurchschnittlichen<br />
Leistungen anzuspornen. In der Saison 1964/65 trennte die Spieler nur ein Punkt von der<br />
damaligen Aufsteigermannschaft Nufringen. In den folgenden Jahren belegten die<br />
Sportfreunde gute Mittelplätze. 1968/69 beendeten sie die Vorrunde mit dem 5. Tabellenplatz.<br />
Zu diesem Zeitpunkt dachte wohl niemand an die Meisterschaft. Erst als nach einer<br />
Siegesserie in der Rückrunde im März 1969 die Sportfreunde erstmals auf dem 2. Platz<br />
standen, wurde man auf die <strong>Gechinger</strong> Spieler aufmerksam. Diesen Platz konnten sie bis vor<br />
dem letzten Spieltag behaupten. Nachdem sie gegen Darmsheim gewinnen konnten und<br />
Schönaich nur ein Unentschieden in Mötzingen erreicht hatte, mußte Schönaich die<br />
Sportfreunde Gechingen vorbeiziehen lassen. Der dann folgende Aufstieg in die 2.<br />
Amateurliga Württemberg war sportlicher Höhepunkt, denn jetzt konnten sich die <strong>Gechinger</strong><br />
mit renommierten Mannschaften messen.<br />
Die wohl größte Leistung außerhalb des sportlichen Bereichs erbrachten die Mitglieder mit<br />
dem Bau der Sportanlage. In nahezu 20 000 unentgeltlichen Arbeitsstunden wurde in<br />
vierjähriger Bauzeit ein Sportheim und ein Sportgelände fertiggestellt. Der Platz in der 2.<br />
Amateurliga konnte nicht gehalten werden, wen wundert dies, da in Gechingen eben wirklich<br />
nur Amateure Fußball spielen! Konnte man Anfangs der 70-er Jahre mit guten Plätzen in der<br />
A-Klasse Böblingen/Calw zufrieden sein, waren die folgenden Jahre geprägt von wechselnden<br />
Erfolgen der Fußballabteilung. 1976 mußte ein erneuter Abstieg in die B-Klasse<br />
hingenommen werden, aber bereits 1978 erfolgte der Wiederaufstieg in die Bezirksliga<br />
(ehemals A-Klasse). Nach erneutem Abstieg 1984, konnte man aber aufgrund der guten<br />
Jugendarbeit im Spieljahr 1989/90 wiederum in die Bezirksliga Böblingen/Calw aufsteigen.<br />
Seither haben.die Sportfreunde sich dort behauptet.<br />
1981 feierte der Verein sein 60-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlaß führte die<br />
Fußballabteilung vom 19. bis 20.Juni 1981 ein Pokalturnier durch. Durch Siege über<br />
Walddorf, Unterjettingen, Mötzingen, Neubulach und Sulz gelangte die Mannschaft ins<br />
Endspiel.<br />
1982 begann der Verein, die Voraussetzungen für den Bau eines neuen Rasenplatzes zu<br />
schaffen. In vielen freiwilligen Arbeitsstunden, unterstützt durch Verband und Gemeinde,<br />
konnte 1986 der neue Rasenplatz eingeweiht werden, welcher hoffentlich recht lange allen<br />
Anforderungen genügen wird. Im Jahre 1994 wurde der Mitte der 70-er Jahre erstellte<br />
Hartplatz von der Gemeinde zu einem schönen Rasenplatz umgebaut.<br />
Inzwischen kamen zu den Fußballern noch zahlreiche andere Abteilungen und die<br />
Sportfreunde Gechingen präsentieren sich als ein lebendiger Verein mit schönen Sportanlagen<br />
und einem breiten Sportangebot. 1996 feiert der Verein sein 75. Jubiläum.<br />
Turnabteilung<br />
173
Anfang 1957 wurde durch Sebastian Herm eine Turnabteilung gegründet. Frau Geppert<br />
übernahm die Frauenabteilung. Die folgenden Jahre waren angefüllt mit hartem Training.<br />
Trotzdem hatte es während dieser Zeit bis zum Jahr 1961 gar manches Mal den Anschein, als<br />
ob die gestellten Anforderungen zu hoch wären oder das Interesse nachgelassen hätte. Erst<br />
1965 konnte Herms Nachfolger Klaus Schwarz wieder von einer Interessenzunahme<br />
berichten, was zu Hoffnungen Anlaß gab. 1967 übernahm Manfred Kawlowski die Leitung<br />
der Turnabteilung und nahm sich in der Folgezeit besonders der Jugendarbeit an. Aber auch er<br />
hatte Mühe und Sorge, das Interesse wachzuhalten und den Leistungsstand durch<br />
konsequentes Training zu verbessern. Im Jahre 1970 zählte die Turnabteilung 40 Mädchen<br />
und 40 Jungen. Dank der Mitarbeit weiterer ehrenamtlicher Übungsleiter gewann die<br />
Turnabteilung in an Format. Ein schöner Erfolg war die Teilnahme einer Jungenmannschaft<br />
an den Württ. Meisterschaften 1973. Seither waren <strong>Gechinger</strong> TurnerInnen auch bei den<br />
verschiedensten Turnfesten vertreten, so 1973 in Stuttgart, 1978 in Hannover, 1983 in<br />
Frankfurt oder 1987 in Berlin. In Vorschul-, Kinder- und Jugendgruppen werden zur Zeit ca.<br />
200 Jungen und Mädchen betreut. Seit 1985 bietet der Verein auch Mutter- und Kind-Turnen<br />
an.<br />
Die Faustballabteilung<br />
Die Faustballabteilung besteht seit 1959. Gegründet wurde sie ebenfalls von Sebastian Herm.<br />
Der jungen Abteilung gelang es, mehrmals Meister in verschiedenen Klassen zu werden, 1970<br />
zum Beispiel Gauklassenmeister. Die Mannschaft Männerklasse 2 stieg in die Landesklasse<br />
Nord bei der Hallenrunde auf. Seit 1970 besteht auch eine Jugendabteilung, die getrennt<br />
trainiert. Besonders erfolgreich war in den 80-er Jahren die Damenfaustballmannschaft, sie<br />
errang die Süddeutsche Vizemeisterschaft! Eine kurze Zeit über konnte die Faustballabteilung<br />
auch bei den Kämpfen um die deutsche Meisterschaft teilnehmen, aber durch Überalterung,<br />
Wegzug von Mitgliedern u.ä. fiel die Abteilung wieder in die Landesklasse zurück. Auch das<br />
Fehlen einer geeigneten Trainingsmöglichkeit trug zum Abstieg bei, da die Faustballer auf<br />
ständig wechselnde Hallenplätze angewiesen waren. Mit der Einweihung der neuen Sporthalle<br />
erhielt die Faustballabteilung neuen Auftrieb. 1995 konnte das 35jähriges Jubiläum gefeiert<br />
werden.<br />
Die Schwimmabteilung<br />
Als im Herbst 1975 das <strong>Gechinger</strong> Hallenbad eingeweiht wurde, war es nur noch ein kurzer<br />
Weg zur Gründung einer Schwimmabteilung innerhalb der Sportfreunde Gechingen. 1976<br />
fand dann die Gründungsversammlung statt. Großen Anklang finden bei den <strong>Gechinger</strong><br />
Bürgern und auch bei Bürgern der Nachbarorte die von der Schwimmabteilung angebotenen<br />
Kinderschwimmkurse. Die <strong>Gechinger</strong> SchwimmerInnen nehmen auch an Wettkämpfen teil<br />
und erreichten dort viele gute Plätze.<br />
Die Sportschützenabteilung<br />
Vorläufer der heutigen Sportschützenabteilung innerhalb der Sportfreunde Gechingen war der<br />
1950 gegründete Schützenverein Gechingen. Die Mitglieder dieses Vereins renovierten die<br />
aus dem Jahre 1925 stammende Schießanlage im Bergwald, wo die Kleinkaliberanlage bis zur<br />
Auflösung des Vereins im Jahr 1962 in Betrieb war. 1967 wurde dann die<br />
Sportschützenabteilung der Sportfreunde Gechingen gegründet. Zunächst wurde im Keller des<br />
Sportheimes geschossen. Noch im gleichen Jahr wurde ein Anbau an das Sportheim<br />
genehmigt, in welchem sechs Luft-gewehrbahnen untergebracht sind. Im September 1967<br />
konnte neben den Gewehrschützen eine weitere Disziplin aufgenommen werden, nämlich<br />
Bogenschießen. Trainiert wurde zuerst auf dem Fußball-Rasenplatz. 1981 wurde an der<br />
174
Ostelsheimer Straße ein geeigneter Bogenschießplatz gefunden. Die guten Leistungen der<br />
Bogenschützen sind weitbekannt.<br />
Im Kreis Calw gehört die Sportschützenabteilung Gechingen zu den leistungsstärksten<br />
Vereinen. Bei Bezirks-, Landes - und Deutschen Meisterschaften sind die <strong>Gechinger</strong> Schützen<br />
vertreten. Mit dem Bau der neuen Sporthalle 1990 bekamen auch die Sportschützen eine neue<br />
Schießanlage. Mehr als 7000 freiwillige Arbeitsstunden investierten die Sportschützen in die<br />
Errichtung der modernen Schießanlage für Luftgewehr und Kleinkaliber.<br />
Tennisabteilung<br />
68 Interessenten fanden sich im September 1973 zur Gründung einer Tennisabteilung<br />
zusammen. Die Mitgliederzahl nahm stetig zu, so daß dem Ziel, zwei Tennisplätze mit<br />
Clubhaus zu errichten, nichts mehr im Wege stand und bereits im Frühjahr 1974 mit dem Bau<br />
begonnen wurde. Da die Nachfrage unvermindert anhielt, mußte bereits im nächsten Jahr eine<br />
Platzerweiterung in Angriff genommen werden. Im zehnten Jahr des Bestehens der Abteilung<br />
wurden Außenanlagen und Clubräume grundlegend renoviert. An den Arbeitseinsätzen<br />
beteiligten sich viele der fast 300 Mitglieder. Im Jahr 1985 konnten in Gechingen die<br />
Bezirksmeisterschaften der Jungsenioren stattfinden. Auch bei den Kindern und Jugendlichen<br />
steigt das Interesse am Tennis, deshalb bietet der Verein ein kostenloses "Schnupperjahr" für<br />
Jugendliche an.<br />
Tischtennisabteilung<br />
1967 gründeten rund 20 tischtennisbegeisterte <strong>Gechinger</strong> diese Abteilung innerhalb der<br />
Sportfreunde. 1995 zählte sie ca. 60 Mitglieder und ist damit eine der größten Gruppen im<br />
Bezirk Schwarzwald. Siege in Kreis- und Bezirksklasse waren und sind der Erfolg des großen<br />
Einsatzes der Spieler. Freundschaftsspiele, auch mit ausländischen Mannschaften, fanden<br />
statt. Seit 1975 führt die Abteilung Familienwanderungen, Weihnachtsfeiern und Bergtouren<br />
durch, um das gesellige Leben zu stärken. 1992 feierte die Abteilung ihr 25 jähriges Jubiläum.<br />
Jiu - Jitsu<br />
1985 wurde diese Abteilung der Sportfreunde Gechingen gegründet. Durch Trainerausfall und<br />
andere widrige Umstände ist die Mitgliederzahl leider zurückgegangen, es ist aber auch hier<br />
zu erwarten, daß durch die neue Sporthalle eine Aktivierung stattfindet. Derzeit sind 21<br />
Sportlerinnen und Sportler aktiv in der Abteilung.<br />
Volleyball und Badminton<br />
Im Jahre 1990 konnte dank der neuen Sporthalle das sportliche Angebot in Gechingen noch<br />
erweitert werden. Es kam zur Gründung einer Volleyball- und Badmintonabteilung. Derzeit<br />
spielen etwa 40 Mitglieder Badminton und 60 Mitglieder gehören der Volleyballabteilung an.<br />
Der Reit- und Fahrverein<br />
Das Gründungsjahr des Reit- und Fahrvereins war 1972. Der Verein besitzt vereinseigene<br />
Pferde sowie eine neue Reitanlage mit Reithalle, Sprung- und Dressurplätzen beim Hasenhof.<br />
Er hat eine starke Turniergruppe, die vor allem auf die Military, einem Vielfältigkeitssport,<br />
spezialisiert ist. Erste und zweite Plätze bei Landes- und Kreis-meisterschaften beweisen die<br />
erfolgreiche Arbeit des Reit- und Fahrvereins Gechingen. Mit der Organisation von Turnieren<br />
bis hin zur Landesmeisterschaft wurde der Verein im Land bekannt. Im vereinseigenen<br />
Reiterstüble kommt auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Dem Verein unter seinem<br />
Vorsitzenden Otto Mörk ist die Jugendausbildung ein großes Anliegen, was der Erfolg der<br />
jugendlichen Reiter bei vielen Turnieren beweist.<br />
175
Die Modellsportgruppe<br />
Die Modellsportgruppe Gechingen e.V. feierte im Dezember 1985 das 10-jährige Bestehen.<br />
Der Ursprung des Vereins jedoch geht zurück bis ins Jahr 1971 und entstand aus einer<br />
Interessen-gemeinschaft von zunächst 9 Modellbauenden. Heute besteht der Verein aus 35<br />
Mitgliedern, der Anteil der Jugendlichen beträgt 50 %. Der Umgang mit verschiedenen<br />
Materialien und der Bau von Modellen vermittelt handwerkliche Fertigkeiten und die<br />
Erkenntnis physikalischer Zusammenhänge. So entstanden im Laufe der Jahre viele Segler,<br />
Motorflugmodelle und einige Modellschiffe. Die wiederholten Modellbauausstellungen,<br />
zuletzt im Mai 1989 in der <strong>Gechinger</strong> Gemeindehalle, haben den großen Erfolg aller<br />
Vereinsmitglieder nachhaltig bestätigt. Diese und weitere Aktivitäten, wie zum Beispiel die<br />
wöchentlichen Bastelabende und die Flugunterweisungen auf dem gepachteten Fluggelände<br />
der Modellsportgruppe, dienen der Förderung der Jugendarbeit, der Sicherung des<br />
Nachwuchses und dem Fortbestehen des Vereins.<br />
Die DLRG Ortsgruppe Gechingen<br />
Die Ortsgruppe Gechingen des DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft) wurde 1978<br />
gegründet. Erster Vorsitzender war von 1981 bis 1994 Frank Wentsch. Seit 1995 bekleidet<br />
Klaus Böttinger dieses Amt. Die Hauptaufgabe sehen die Trainer darin, aus Schwimmern<br />
Rettungsschwimmer zu machen. Die Übungsabende, die mittwochs stattfinden, sind sehr gut<br />
besucht. Heute hat der Verein 93 Mitglieder, vor allem Jugendliche. Einige<br />
Rettungsschwimmer teilen sich den Wachdienst an der Erzgrube sowie im Hallenbad<br />
Gechingen. Sehr großen Anklang finden immer die Ausflüge, Freizeiten, Weihnachtsfeiern<br />
und andere gesellige Aktivitäten der Ortsgruppe.<br />
Die Tracht<br />
Vielfach wird angenommen, daß die Tracht der Bauern eine Art Uniform war, die immer<br />
gleich blieb. Das ist falsch, die Kleidung der Bauern und Handwerker war immer einem<br />
gewissen Wandel unterworfen. Vergleicht man das Erscheinungsbild eines Bauern aus dem<br />
gleichen Ort von 1690 mit dem von 1850, so hat man zwei ganz verschiedene Trachten vor<br />
sich. Das hat seine Ursache darin, daß die modischen Entwicklungen und Strömungen in der<br />
Stadt stets auch die Kleidung auf dem Land beeinflußten. Ein großer Unterschied bestand<br />
zwischen Sonntags- und Werktagskleidung. Das, was man gemeinhin als "Tracht" bezeichnet,<br />
ist meistens die Kleidung an Fest- bzw. Sonntagen. Die schlichte Werktagskleidung mußte<br />
vor allem strapazierfähig sein, da die Landbevölkerung viel schwere und schmutzige Arbeit<br />
verrichten mußte. Am besten eignete sich Leder oder grobes Leinen dazu.<br />
Vor 1840 trugen die meisten Männer auch sonntags Lederhosen, später Tuchhosen. Bei den<br />
Frauen auf dem Land prägte sich Ende des 17. Jahrhunderts das wichtigste Stück der<br />
weiblichen Tracht aus: Der weite, faltenreiche, schwere, rechteckig geschnittene Rock. ("Gut<br />
betucht" zu sein, zeugte von großem Wohlstand, war doch das Tuch der teuerste aller zur<br />
Rockherstellung verwendeten Stoffe).<br />
Beim Wams der Männer handelt es sich um eine relativ kurze Jacke, im Gegensatz zum<br />
städtischen Rock. Die Hemden waren Leibwäsche, Männer und Frauen trugen sie auf der<br />
Haut, es gab keine Ober- und Unterhemden. Ein Zeitgenosse, Carl Theodor Griesinger (1809-<br />
1884), beschreibt sehr anschaulich den groben, "reisten" Stoff der Hemden, der die Haut<br />
aufritze.."Reist" oder "Reisten" bedeutet Gewebe aus Flachs oder Hanf. Da auch<br />
Nachthemden und Bettwäsche gewöhnlich aus sehr festem, derbem Stoff waren, wie<br />
verschiedene, erhalten gebliebene Stücke im Heimatmuseum beweisen, scheint die Haut<br />
176
unserer Vorfahren nicht sehr empfindlich gewesen zu sein. Die Hemden waren viel länger, als<br />
wir sie heute haben. Sie gehörten zum Weißzeug wie die Bettwäsche, und wie diese waren sie<br />
ursprünglich aus eigenem Flachsanbau selbst gefertigt und Teil der Aussteuer, die ein Leben<br />
lang halten sollte.<br />
Anhand der "Dokumentation über die ländliche Kleidung in Gechingen von 1820 - 1880" von<br />
Joachim Faitsch kann man sich die <strong>Gechinger</strong> Sonntagskleidung etwa so vorstellen :<br />
Die Männer trugen eine schwarzer Samtkappe oder einen schwarzem Dreispitz, weißes Hemd<br />
mit kleinem Stehkragen, gelbe oder schwarze hirschlederne Kniebundhosen mit Hosenträgern,<br />
die Jüngeren eine rote Weste aus Tuch dazu, die Älteren eine Samtweste. Ein Wams aus<br />
schwarzem Samt mit halbkugelförmigen Metallknöpfen, schwarze, gestrickte Wollstrümpfe<br />
und kniehohe Stiefel oder knöchelhohe Schnürstiefel vervollständigten die Tracht. Für den<br />
Winter hatte man außerdem einen blauem, wadenlangen Mantel aus Tuch.<br />
Die Frauen waren bekleidet mit schwarzer Bändelhaube, schwarzem oder schwarz/violett<br />
kariertem waden- bis knöchellangem Tuchrock mit Stehfalten am Bund, blauer, einfarbiger,<br />
baumwollener Schürze und einem schwarzem Kittel in Bolero-Form mit Schinkenärmeln. Für<br />
werktags war er aus Leinen, aus Tuch für Sonntag. Dazu kam ein meist schwarzes, seidenes<br />
Halstuch in quadratischer Form, das beim Gebrauch zum Dreieck gefaltet wurde, ein Leible<br />
aus Litz (feinem Kattun), rot mit schwarzem Karo und ein weißes Leinenhemd. Die Strümpfe<br />
waren für Jüngere aus weißer Baumwolle gestrickt, die der Älteren waren schwarz, werktags<br />
trugen alle schwarze Strümpfe. Das Schuhwerk bestand aus schwarzen Halbschuhen mit oder<br />
ohne Schnalle, teilweise genagelt, mit niederen Absätzen. Im Heimatmuseum ist eine Tracht<br />
vom Anfang des 19. Jahrhunderts ausgestellt.<br />
In Gechingen wurde die Tracht allerdings schon sehr früh aufgegeben (um ca. 1840). In einer<br />
Übergangszeit wurden nur noch Teile davon aufgetragen.<br />
Aus den Inventuren, den amtlichen Verzeichnissen des Erb- oder Hochzeitsguts, können wir<br />
Rückschlüsse auf die zu der jeweiligen Zeit getragenen Kleidungsstücke ziehen. Nachstehend<br />
Auszüge einer Beibrings-Inventur, die aus einer Zeit stammt, in der die Tracht keine große<br />
Rolle mehr spielte. Sie wurde angelegt bei der Hochzeit Samuel Ludwig Wagners 1849 mit<br />
der Marie Katharina Eisenhardt aus Dachtel.<br />
Vom Bräutigam eingebrachte Mannskleider:<br />
1 Hut<br />
1 alter Hut 1 Sammetkappe<br />
1 tücherne Kappe 1 schwarzseidenes Halstuch<br />
1 blautücherner Überrock 1 manchesternes Wams<br />
1 älteres Wams 2 Westen<br />
1 Paar Lederhosen 3 Paar wollene Strümpfe<br />
5 Paar verschiedene Strümpfe 2 Paar Stiefel<br />
12 neue Hemden 16 alte Hemden<br />
Von der Braut eingebrachte Weibskleider<br />
10 Hauben 6 seidene Halstücher<br />
8 halbseidene Halstücher 1 schwarztücherner Kittel<br />
1 schwarztücherner Rock 1 Paar Schuhe<br />
1 Tibet - Schurz 3 tücherne Kittel<br />
15 verschiedene Röcke 15 verschiedene Schürzen<br />
6 Paar wollene Strümpfe 10 Paar baumwollene Strümpfe<br />
1 schöner Hut 12 neue Hemden<br />
177
Manchester: Kräftiger, gerippter Samt (Cord)<br />
Tibet: wollenes Gewebe in Köperbindung, merinoähnlich. Die Schafrasse, von der die Wolle<br />
ursprünglich stammte, war aus Vorderasien und hatte gekräuseltes, feines Vlies. Später auf<br />
besonders feine, weiche Wolle übertragen.<br />
Der Dialekt<br />
Dialekte gab und gibt es in allen Sprachen lange vor der Schriftsprache. Vor allem bäuerliche<br />
Mundart wurde oft als ein Merkmal der Ungebildeten betrachtet, obwohl gerade in<br />
Württemberg auch in den Städten immer schwäbisch gesprochen wurde. In der Literatur<br />
wurde schwäbisch aber erst ab Ende des 19. Jahrhunderts populär.<br />
Früher war es so, daß beinahe jeder Ort seine eigenen speziellen Ausdrücke hatte. Sagten die<br />
<strong>Gechinger</strong> zum Beispiel zu einem Kuchen "Spickling", hieß es in Dachtel "Bäarta" und in<br />
Deckenpfronn "Steckling". Diese sprachlichen Eigenheiten haben sich im Laufe der letzten<br />
Jahre und Jahrzehnte, bedingt vor allem durch die zunehmende Mobilität und den Einfluß der<br />
Medien, abgeschliffen. Jetzt wird fast überall nur noch ein sogenanntes "Honoratioren-<br />
Schwäbisch" gesprochen, nicht zuletzt auch, um von den vielen Nichtschwaben, die bei uns<br />
leben, verstanden zu werden. Auch verschwanden mit landwirtschaftliche Gerätschaften, die<br />
es heute nicht mehr gibt, die dafür üblichen Bezeichnungen ebenso Begriffe aus dem<br />
bäuerlichen Arbeitsbereich. Es war also höchste Zeit, den <strong>Gechinger</strong> Dialekt aufzuschreiben<br />
und der Nachwelt zu erhalten. Die nachstehenden Ausdrücke von A-Z sollen eine Art<br />
Nachschlagewerk sein, in dem jeder nachsehen kann, wenn er auf ihm nicht geläufige<br />
Ausdrücke oder Worte stößt. Es wird jedoch kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.<br />
Es ist schwierig, schwäbisch zu schreiben. Für die vielen Nasale, die für unsern Dialekt<br />
charakteristisch sind, gibt es keine entsprechenden Buchstaben im Alphabet. Auch bestehen<br />
oft Zweifel, ob ein "e" oder ein "a" angezeigt ist. So wird z. B. die Mehrzahl von "Mädle"<br />
hier "Mädla" geschrieben, weil ein deutlicher Unterschied in der Aussprache besteht, obwohl<br />
dieses "a" eine Art Zwischenlaut ist, ebenso wie in "Muader", "Hoamet", "liaga",<br />
"Earn(d)".<br />
Statt ö wird e, statt ü i gesprochen z.B. in Böden-Beda, Köhler-Kehler, fürchten-firch(t)a,<br />
lügen-liaga. Konsonanten verschwinden oft, so z.B. bei Mann-Maa, Bahnhof-Bahof, wobei<br />
zu beachten ist, daß aus einem "a", dem ursprünglich ein "n" nachfolgte, immer ein nasales<br />
"a" wird, wie im Französischen, entsprechend "davo"-davon mit nasalem "o", ebenso<br />
"omeglich"-unmöglich. Reinfall wird zu Reifall, "Raifall" gesprochen. Zum Unterschied<br />
von "au", gesprochen wie in "Bau", wird hier das breite <strong>Gechinger</strong> "au" mit "ao"<br />
wiedergegeben, was der Sprechweise sehr nahe kommt, wie bei haben-hao, gehen-gao, hochhao,<br />
stehen-stao. "U" wird häufig zu "O", aus "Hund" wird "Hon(d)". E wird Ä bei Lehrer-<br />
Lährer, Seele-Säle.<br />
Statt st wird schd und statt sp schb gesprochen: Schulmeister-Schualmoaschder, Most-<br />
Mooschd, Sparkasse-Schbarkass, Bleistift-Bleischdifd-Bleile.<br />
A<br />
A’aale Liebkosung, beim Kleinkind mit der Wange<br />
aa ab, wie es vor allem als Vorsilbe bei Zeitwörtern vorkommt, wird als langes,<br />
offenes „a“ gesprochen wie in „Aal“.<br />
178
aabauza oder<br />
aabause völlig abernten, leerpflücken<br />
aadriggna abtrocknen<br />
aagholzt abgeholzt<br />
aagschlaa abgeschlagen, listig<br />
aaschlabba rüder Umgangston, abkanzeln<br />
Aasl Achsel<br />
Abdridd Abort, W.C.<br />
afdabärga (afterberga) letztes Obst vom Baum holen, auch erlaubte<br />
Nachlese an fremden Bäumen oder auf Kartoffeläckern (nach der<br />
Kirbe allgemein gestattet)<br />
a Goschvool kleine Menge<br />
aheba endlich, jetzt (kurzes „a“ wie in „a Haus“, Betonung auf der<br />
zweiten Silbe)<br />
Ahna Ahne, Großmutter<br />
ai, ais ehe, ehe es<br />
aibrennt eingeheizt<br />
Airn Flur oder Gang<br />
albacha altbacken, unmodern<br />
Aldjohrobed Silvesterabend<br />
agaddama von „angatten“ - anstiften (Streit), bestellen, zuwege bringen<br />
ag´schirra anschirren, bei Zugtieren das Geschirr anlegen, Korsett anziehen<br />
amalla, auch<br />
eimalla warm anziehen, gut umhüllen<br />
aschmiera anschmieren (Schminke), hereinlegen<br />
Awanna zu „anwanden“ - angrenzen, entweder neutraler Grund zwischen zwei Äckern,<br />
auf dem beiden Angrenzern gestattet ist, mit dem Gespann zu fahren, oder auf<br />
eigenem Acker der Platz, der zum Wenden des Gespanns gebraucht wird<br />
anderdhalb,<br />
auch<br />
anerhalb eineinhalb<br />
Andive Endive<br />
Angerscha Feldrüben (Angersen), zu „Anger“ (Nebenform „Angel“), Wiesen- und<br />
Weideland<br />
annaweg trotzdem<br />
Anka Genick<br />
ao auch, auch Grußwort gebraucht<br />
Aohra Ohren<br />
Aohralabba Ohrenlappen<br />
Aohrawaih Ohrenschmerzen<br />
Aoschdra Ostern<br />
aosga jammern, stöhnen<br />
Appel, auch<br />
Dreck- oder<br />
Hoarappel schmutzige Weibsperson, von „Apollonia“<br />
ausbäffa jemanden nachmachen, karikieren<br />
ausbenna ein Kalb großziehen<br />
ausgeiza Triebe entfernen (Tomaten, Wein)<br />
aushausich verschwenderisch<br />
179
außelaufe abendliches Treffen von Frauen zu gemeinsamem Handarbeiten, vor allem im<br />
Winter (z´Liacht ganga)<br />
auszehra an Lungenkrankheit leiden<br />
Ä<br />
Ähne Ahn, Großvater<br />
ällaweil immer<br />
äll bott,<br />
äll häck,<br />
äll faard immer wieder<br />
älls allemal, seinerzeit („so isch´s älls gwäe“)<br />
älsgmach endlich<br />
Äsche Asche<br />
äschdimiera jemand oder etwas achten, schätzen<br />
B<br />
Baaba Stückchen Brot<br />
baadscha,<br />
Baadschere schwätzen,tratschen, Schwatzweib<br />
Baarn Vorratsraum für Heu (Haibaarn) und Stroh in der Scheune<br />
Babb, Bäbb, Klebstoff, Unsinn<br />
ba(ä)bbich klebrig, „babbich rausschwätza“- übertrieben freundlich reden<br />
babbela aus, fertig (Kindersprache)<br />
Babbr Schlotz, wie Schnuller gebraucht<br />
Babbadeggel Karton<br />
Babeier Papier<br />
bacha backen, ohrfeigen<br />
Bachel Dummkopf, Narr (gesteigert Sau-, Granade-, Allmachdsbachel)<br />
Bachets oder<br />
Bächets das, was zusammen auf einmal gebacken wird<br />
badded,<br />
des had das hat sich gelohnt eigentlich: „das hat hingehauen“ (frz. battre - schlagen)<br />
Baddscher Teppichklopfer<br />
Bagerd uneheliches Kind, Bankert („a“ nasal gesprochen)<br />
Bahr Sarg<br />
bäffa schimpfen<br />
Bähmull empfindliche oder langweilige Frau<br />
Bagasch Gesindel, auch Sippschaft (frz. bagages - Gepäck)<br />
Baschloapf Schneeräumer, Schneepflug (Bahnschleife)<br />
bais böse<br />
baislich schlimm<br />
bal bald<br />
Balla Rausch<br />
Balmerschbira bestimmte Birnenart, gutes Mostobst<br />
Balschdr dumme Frau<br />
bamba Kot ausscheiden bei Kindern<br />
Bäradreck Lakritze<br />
Barched Barchent, grober, starker Stoff<br />
barduu unbedingt (frz. partout)<br />
180
Barga verschnittenes, männliches Schwein<br />
Bas Base, Kusine<br />
(fir) bassleda,<br />
auch basseda zum Zeitvertreib (Frz. „passer le temps“)<br />
Beddl Bettel, alles, Verantwortung (I schmeiß de Beddl na)<br />
Beddlad,<br />
Beddfläsch Bettgestell, -flasche<br />
Beddsoacherle Anemone, Buschwindröschen<br />
(Bedd)-Ziach Deckbettbezug<br />
Beem Bäume<br />
Beggahaus Bäckerhaus, Bachhaus ist das (Gemeinde)-Backhaus<br />
begla bügeln<br />
Behna Bühne, Dachboden<br />
Beidsche-<br />
schdägga geräucherte Landjäger-Würste<br />
Beig Stapel (Holzbeig)<br />
bellfra,<br />
bellfera schimpfen<br />
belzich pelzig, gefühllos?<br />
Belzmäarde Nikolaus, eigentlich „Pelzmartin“<br />
Benna Binde<br />
Bensl Pinsel<br />
biaßa, bossa einbüßen (I hao mein Gluschda bossa - ich mag nicht mehr)<br />
b’häb eng, knapp vorbei, sparsam<br />
Biebela Küken<br />
Biffee Büfett (frz. „buffet“), Betonung auf der ersten Silbe<br />
Biggl Spitzhacke, Pickel<br />
Biir, Biira Birne (auch Glühbirne), Birnen<br />
Biirahoga Birnenhaken<br />
Biismugg Bremse (Insekt)<br />
bidschierd angeschmiert, hereingelegt, auch im Stich gelassen<br />
Bläe Wäscheblau<br />
bläderla über den Durst trinken<br />
Blädds (Blätz),<br />
Bläddsbärbl Flicken, Stoff- Flickenpuppe<br />
Bläddsa Wunde<br />
Blädds a(b)<br />
schemma sehr schämen<br />
blärra, auch<br />
bläädscha weinen, plärren<br />
Blaffoo Zimmerdecke (frz. „plafond“), Betonung auf der ersten Silbe<br />
bloa,<br />
bloalechd blau, bläulich<br />
Bleile Bleistift<br />
Blennschlauch Blindschleiche<br />
bliagd blüht<br />
bladra, Blader Blasen werfen ( es bladerd), Blase<br />
Bloama Blumen<br />
181
Blonza Blutwurst (in der Blase)<br />
blotza lao fallen lassen<br />
bludd nackt<br />
Boaepfel bestimmte Apfelsorte<br />
Boa(n)r Knochen<br />
Bobbel Wollknäuel<br />
boda (-lätz,<br />
guat,-bais) steigernd, „von Grund auf“, sehr (schlimm, gut, böse)<br />
Bodschamber Nachttopf (frz. pot de chambre)<br />
Bodda sicherer Platz (z. B. beim Versteckspiel)<br />
Bolezeideaner Polizist<br />
borfeß barfuß<br />
Boschdler,<br />
Boschdhalder Postbeamter, Posthalter<br />
bosga etwas anstellen<br />
Botzel oder<br />
Butzel Schwein, auch schmutziger Mensch, nicht so grob wie „Sau“<br />
Botzela, auch<br />
Butzela Ferkel, schmutzige Kinder<br />
Bowille Baumwolle<br />
Bräam Stechfliege, Bremse<br />
Bräggez Brezel<br />
Bräschdleng Gartenerdbeeren<br />
b´raffla anreden<br />
(´s) braisch-<br />
deled (es) riecht angebrannt<br />
brach,<br />
Brachquadd unangebaut (brach, nasal), Engerling<br />
Braosamma Brosamen<br />
Braoscht Angst,Sorgen<br />
Bredla Kekse, Plätzchen<br />
Breisle Ärmelbund<br />
bressiera beeilen<br />
britscha schlagen, hauen<br />
Brodhanga Hängeregal für Brot im Keller<br />
Brodloab Brotlaib<br />
Bruadere Bruthenne<br />
bruddla schimpfen<br />
bsoffa betrunken, besoffen<br />
Budda Bütte<br />
Bussaasch Liebschaft (frz. „poussage“)<br />
Burra Beule, Höcker<br />
Butzemaa Butzenmann, Vogelscheuche (vermummte Gestalt)<br />
Butze-<br />
meggerle Nasenpopel, kleiner Finger<br />
Buurschd,<br />
Handwerks- freche Burschen, Handwerksburschen<br />
D<br />
182
dabba, adabba tappen, grob anfassen<br />
Däbberla kleine Schritte, Hausschuhe<br />
dachgähl steil (steil wie ein Dach)<br />
däddscha,<br />
zeemedäddscht,<br />
Däddschkabb flachschlagen, eingedrückt, flache Schildmütze<br />
Dadderich Zittern („der hot da Dadderich“)<br />
Däfr getäfelte Wand aus Holz<br />
dai dein<br />
daiba widerkäuen<br />
Daife Taufe<br />
Daisl Deichsel<br />
daisama,<br />
disamla flüstern (disamla?)<br />
Dalla Delle<br />
dalga,<br />
romdalga kneten (abfällig)<br />
danna dran (sell danna - da dran, aber auch doort danna - dort drüben)<br />
Daodagräbr Totengräber<br />
dapfr schnell, „Lauf dapfr!“<br />
daub dumm, ungeschickt, taub<br />
daubedichd gedankenlos (meist „em daubedicht“)<br />
Daursch auch<br />
Dorschich Krautstrunk<br />
Dazapf Tannenzapfen<br />
deane denen<br />
debara toben, schreien<br />
Debbich Teppich, Wolldecke<br />
Deede, auch<br />
Geddle Pate, dazu: Geddlesbas, die Frau des Paten<br />
deega denken<br />
Deerle kleine Tür<br />
Deggle kleines Mädchen (von „Dogg“ = Puppe)<br />
Denger „Du bisch so a Denger (Dengere)!“ Du bist so einer!<br />
dengla dengeln, Sense schärfen<br />
Dezr Kreisel (Tänzer)<br />
diiba drüben<br />
Diiraschnall Türklinke<br />
Dippl oder<br />
Dubbl ungeschickter Mensch<br />
Dipfele Pünktchen<br />
Ditz, Dittele Zitze<br />
doaba ausruhen<br />
Doag Teig<br />
Doal Teil<br />
doara donnern (s´doarad)<br />
doba droben<br />
Doda, auch<br />
Godda Dote, Patin<br />
183
Dogg, Deggle,<br />
doggelich Puppe, Püppchen, auch<br />
kleines, hübsches Mädchen,<br />
Doggaschduab Puppenstube<br />
nadoggeled schön hergerichtet (von „Docke“ Bündel aus Getreide oder Flachs)<br />
dollaohrich schwerhörig<br />
Domma Daumen<br />
donna drunten<br />
Doorda Torte<br />
dosa dösen, schlummern<br />
Dräächdr,<br />
Driichdr Trichter<br />
dragriaga hereinlegen<br />
Draischdr Treber<br />
i drag, du<br />
draisch, er<br />
draid ich trage, du trägst<br />
Drallewadsch ungeschickter Mensch, Dummkopf<br />
drenna drinnen<br />
drebbla treten (Hai drebbla), aber auch trappeln vor Zorn oder Ungeduld („Ward, dir<br />
will i drebbla!“sagt der Vater zum Kind)<br />
Driebel,<br />
driebla Kurbel<br />
Driableng Tagedieb<br />
driala,<br />
Drialer sabbern, Sabberlatz, langweiliger, langsamer Mensch<br />
dribbliira drängen, nötigen<br />
drinii darüber<br />
droaschga schwer atmen<br />
Droddwar Gehweg (frz. trottoir)<br />
dromm darum, auch kurz für: Jetzt geht mir ein Licht auf!<br />
Droom Traum<br />
drugga trocken<br />
Druggaburzler Purzelbaum<br />
i dua, i hao dao,<br />
i dääd ich tue, ich habe getan, ich täte bzw. ich würde tun. Dazu<br />
„Däätsch mr eikaufa?“ (Würdest Du mir einkaufen?), davon scherzhaft „Mai<br />
Däätschmr“<br />
(sich) dugga,<br />
Dugg (sich) ducken,<br />
Duck, dir gei i an<br />
Dugg! dir werd ich´s zeigen!<br />
durranand durcheinander<br />
durmelich schwindlich<br />
dußa draußen<br />
E<br />
Eahma,<br />
Eahmahaus,<br />
Eahmamaa Bienen ( -haus, Imker)<br />
184
Earn(d) Ernte<br />
ebbes etwas<br />
ebbr jemand<br />
ebig ewig<br />
Eeda Enten<br />
Eedrich Enterich<br />
Eeg Egge<br />
ehnder eher<br />
eidao eingetan, eingebracht (Ernte)<br />
eigschobbd eingeschoben<br />
einegäa Vieh füttern (in die Krippe eingeben), eingeben<br />
emder däät e eher würde ich, eher täte ich<br />
Emoasa Ameisen<br />
en d’ Haihne<br />
gao in die Höhe gehen<br />
Epfelbrei Apfelmus<br />
Erbis Erbsen<br />
Ern Hausflur<br />
Eschbr Kleeart (Esparsette)<br />
eddso,<br />
eddaa so,<br />
auch nedda nicht so<br />
ewicher Klaia Luzerne<br />
F<br />
fäaga fegen, kehren<br />
fäärn vergangenes Jahr<br />
Fäaschdr Fenster<br />
Färschl Ferse<br />
Fätz,<br />
Fätzaberger Lump, Spitzbube, auch Granadefätz (steigernd)<br />
faischdr finster, dunkel<br />
falliera fehlschlagen, versagen<br />
Fasned Fasching, Karneval<br />
(aa)fatza (ab)reißen<br />
Fazaneddle Einstecktuch Ziertaschentuch, (lat.-italien. Fazelet)<br />
Feierdich Feiertag<br />
fenna finden<br />
Fiaderle Kleiderfutter<br />
Fiaß Füße (samt Beinen!)<br />
Fiedle Popo, weibliche Geschlechtsteile<br />
Fille Fohlen, aber Fülle (Geflügel)<br />
fiirsche vorwärts<br />
Fiirwitz Neugierde, Vorwitz<br />
Fissamadenda<br />
macha Unsinn treiben<br />
Flaas Flachs<br />
fladdiira schmeicheln, gut zureden<br />
flagga faul herumliegen<br />
185
Flaoh, Flaih Floh, Flöhe<br />
Flaoz Unsinn,<br />
Flärra Fetzen<br />
Fläscha,<br />
Fläschner Flasche, Flaschner<br />
Flegga, Flecken, Ort, dazu Fleggabeas (Person, die im ganzen Ort herumkommt)<br />
foal feil<br />
fobba, föbbla foppen, necken<br />
fraoh froh<br />
Froo Arbeit für die Gemeinde, Fron (mit nasalem o)<br />
Fruuchd Frucht, Getreide<br />
fuadera füttern<br />
fuaßla schnell laufen, rennen<br />
Fuaßned am Bettende, an den Füßen<br />
fugela ausfindig machen „G`fugelet wurd net!“ -so der empörte Ausruf einer sich<br />
belästigt fühlenden Frau<br />
fuggera handeln, feilschen (geht auf die Handelsfamilie der Fugger zurück)<br />
furza einen Wind fahren lassen<br />
G<br />
Gaarda Garten<br />
gaddich,<br />
ogaddich nett, gutartig - sperrig, ungeschlacht<br />
gäa gegeben<br />
gäal ,<br />
Gäalriaba gelb, gelbe Rüben, Karotten<br />
gäddrich locker<br />
Gäädr Handgelenk und Kniekehle (von Ader)<br />
gäa, i gei,<br />
du geisch,<br />
er geit,<br />
er hat gäa geben, ich gebe, du gibst, er gibt, er hat gegeben<br />
gäga schief halten, in eine schiefe Lage kommen<br />
Gäärschda Gerste<br />
gaga viel reden<br />
Gaggele Ei<br />
galabrisch aufregend, unbändig<br />
gamba schwanken, beim Sitzen mit den Beinen Baumeln<br />
Gas,Gäs,<br />
Gäsgr, Gäs-<br />
Oa Gans (a nasal), Gänse, Ganter, Gansei<br />
Gassavogel Gassenjunge<br />
Gaude Spaß (lat. gaudium)<br />
gao lao gehen lassen<br />
Gaulsdadde Pferdenarr<br />
gautscha schaukeln<br />
gazga stottern, aber auch Hühnergackern<br />
Gelta,<br />
Spialgelta Wassergefäß, Spülschüssel<br />
186
ge Felda<br />
ganga die Felder besichtigen gehen (Sonntagsvergnügen)<br />
gemmalich (mir isch´s) mir ist nicht wohl, zum Rumhängen<br />
G´fix schwierige Sache<br />
g’fonna gefunden<br />
G´fräß ungenießbares Essen, Zeug<br />
G´friere Tiefkühltruhe<br />
g´hairich gehörig, viel<br />
g’heegd aufgehängt<br />
g´heia reuen<br />
giggela spickeln, abgucken<br />
gilfa grillen, laut sein<br />
Gilla Gülle, dazu Gillaschapf (Güllenschöpfer)<br />
Gischbl aufgeregte, nervöse Person<br />
Gläaner Geländer<br />
gladd lustig<br />
Glaif (schlechte) Laufart<br />
Glaosmärgd Weihnachtsmarkt<br />
glebbera klappern, dazu Glebberla (Mohnkapseln)<br />
Gleckleng Holzstämmchen für den Schweinestall<br />
Glegg eine Lage Heu oder Getreidegarben auf dem Erntewagen<br />
glemma zwicken, dazu<br />
Glemmer Waldameisen<br />
Gloabwad Lehmfachwerk (a nasal)<br />
Gloach Kettenglied<br />
Globa Pfeifenkopf, Türangel, Grobian, verstärkt Sauglob<br />
G´loddr Gelottere, loses Zeug<br />
G´lomb Gelumpe<br />
glotza gucken, starren, dazu<br />
Glotzer,<br />
Glotzbebbel (Augen)<br />
Glufa, Gliifla Stecknadel, dazu Glufamichel - kleinlicher Mensch<br />
Gluzgr, auch<br />
Gäzgr Schluckauf<br />
G´mäch (von „Gemäch), Unterbauch,<br />
gnabba knappen, hinken<br />
Gneddle Knöchel<br />
Gneisle Brotanschnitt<br />
Gnui Knie<br />
goafra wichtig tun (eifern)<br />
Goaß Geiße, Ziege dazu<br />
goaße herumrennen, nuffgoaße - hochklettern<br />
Goaßl Peitsche<br />
Goascht Geist<br />
Goddsdank Erwiderung auf Grüß Gott<br />
Goggeler Gockel, Hahn<br />
Goggs Hut<br />
Gosch grob für „Mund“, dazu<br />
goscha schimpfen<br />
187
Goschahobl Mundharmonika<br />
gorgsa würgen<br />
gozich einzig<br />
Grabb Rabe, Krähe<br />
Grabloch ausgehobenes Grab<br />
Gradda, auch<br />
Grätta geflochtener Korb<br />
Graddl Stolz<br />
gräa,<br />
gräelechd grün, grünlich<br />
gräädich schlecht gelaunt, mißmutig<br />
Gräb(e)le Platz in der Mitte der Ehebetten<br />
graoß groß<br />
grausich grausig<br />
grawohla sich anschmeicheln<br />
grebsla klettern, dazu Semsagrebsler - saurer Wein<br />
G`rech oberster Scheunenboden<br />
grepfig steif, ungelenk, „krämpfig“<br />
Grezler Radschuh mit scharfen Zähnen, von gretza - kratzen<br />
Griaba Grieben<br />
Griicht Gericht „No net griichtela!“<br />
Griffl- Finger, Schreibstift für<br />
spitzer Mensch, der alles ganz genau nimmt<br />
Gritzger ungezogenes Kind<br />
groa grau<br />
groable herumtasten, dazu Groabl und groablich (ungelenk)<br />
g´rada geraten, gedeihen<br />
Grodd,<br />
Gröddle Kosenamen für Mädchen<br />
groddabroat,<br />
groddafalsch sehr breit bzw. falsch<br />
Grodda-<br />
giegser scherzhaft für Taschenmesser<br />
Grombira Kartoffeln<br />
gruaba ausruhen, dazu<br />
Gruabbaak (Ruhebank)<br />
grubla (Nase)-bohren, em Dreck romgrubla (bei Kindern)<br />
gruschtla,<br />
Gruschd kramen, Kram, steigernd Lombagruschd<br />
g´säahnich „gesehend“, einsichtig<br />
Gsälz Marmelade<br />
g´schäbberd gescheppert (z. B. Gräusch beim Zerbrechen von Porzellan)<br />
Gschäddr,<br />
gschäddere Getöse, Krach (wenn Metallteile aneinanderschlagen), Krach machen<br />
gschdanna stehen, dazu: gschdannene Milch - Sauermilch<br />
Gscheddich Dreschabfall<br />
g´schegged gescheckt, auch sonderbar „Lach net so g´schegget.“<br />
gscheid gescheit<br />
G´schiiß<br />
188
macha Umstände machen<br />
g´schlaachtd geschmeidig, auch umgänglich, freundlich<br />
G´schmoaß Ungeziefer, Geschmeiß, auch asoziale Menschen<br />
G´schnipf Abfall, Schnipsel von Obst und Gemüse, auch Papier<br />
gschwistrige<br />
Kender Vettern und Basen,<br />
gschwistrige<br />
Kendskender Kinder von Vettern und Basen<br />
Gschwulschd Geschwulst<br />
gsonn gesund<br />
guada Rad? Begrüßungsformel, (Haltet ihr guten Rat?)<br />
guad gschirra gut zusammenarbeiten<br />
Gugg Tüte<br />
gugga gucken, schauen<br />
Guggomer Gurke<br />
Gurgl Gurgel, Hals<br />
gwäa gewesen<br />
H<br />
Haad, Heed Hand, Hände<br />
Haadhebets Griff (Handhabe)<br />
Haadwäagele Handwagen<br />
häal hell<br />
haard fast, doch nicht, z.B. „des wurd haard so sei“<br />
Habr, häbera Hafer, Hafer säen<br />
Häddele magere, zierliche Frau (von „Hättel“ - Geiß oder magere Kuh)<br />
Haga Stier<br />
Häga<br />
Hägamarg Hagebutten, Hagebuttenmarmelade<br />
Häggr<br />
Gätzger Schluckauf<br />
Häle kleines Huhn oder kränkliche Person<br />
Häahraug Hühnerauge<br />
Häahrdärm Unkraut mit dünnen, sehr langen Wurzeln, Sternmiere<br />
Häahrloadr Hühnerleiter, Laufmasche<br />
Häs Kleider, Gewand<br />
Hafa Topf,<br />
Hafa- oder<br />
Schüsslabridd Schüsselbrett vor dem Küchenfenster<br />
Haibed Heuernte<br />
haid heute<br />
Hai-Soachr kurzer Regenguß während der Heuernte<br />
Haile Hacke<br />
Hailiacher Heuhaken<br />
Haihne Höhe<br />
Haipfl Kopfkissen (80 x 100)<br />
hairsch? hörst du .<br />
Hamballe Dummkopf<br />
189
i hao, du hasch,<br />
er hat, mir hent,<br />
i hao g´heet ich habe, du hast, er hat, wir haben, ich habe gehabt<br />
haoh doba hoch droben<br />
haohe Gass hohe Gasse<br />
haud(e)ra,<br />
romhaudera hoppeln, schlecht fahren, herumhängen<br />
Hauzich Hochzeit<br />
Haxa Füße<br />
Haziahger Schuhlöffel<br />
Hearzer Busen<br />
heba (fest)halten<br />
Hebgschirr Hebezeug<br />
Heckabeerla wilde Stachelbeeren<br />
hee, auch<br />
heenich kaputt, tot<br />
Heedschich Handschuh<br />
Hefelhafa Topf für Sauerteig<br />
hehlenga heimlich (verhohlen)<br />
heila heulen, weinen<br />
Heiligsblechle Fluch<br />
Heinza Trockengestelle für Heu<br />
Hemmad Hemd<br />
Hemmad-<br />
glonker Einer der im Hemd dasteht oder den Hemdzipfel raushängt<br />
henderliddich kränklich<br />
hendersche rückwärts, auch umgekehrt<br />
henderschefir verkehrt herum<br />
henna hinten<br />
hert hart<br />
herzuas herwärts<br />
hirchla röcheln<br />
h’m? was möchtest du?<br />
Hoah, Häahr Huhn, Hühner<br />
Hoab Haumesser<br />
Hoadlbeer Heidelbeeren<br />
hoala heilen<br />
hoam,<br />
Hoamwaih heim, Heimweh<br />
hoamzuas heimwärts<br />
hoaß heiß<br />
Hommel junger Stier, Farren<br />
hobba,<br />
hobba lao hüpfen, springen lassen<br />
Hobbr Hüpfer<br />
hogga hocken, sitzen<br />
Hohlziagl Firstziegel<br />
Holder Holunder<br />
Honn Hund<br />
190
Hubbl Erhöhung<br />
Huddl schlampige Frau<br />
hudla eilen, überhasten<br />
Hudel,<br />
Hudlawisch Ofenwischer<br />
Hudsch halbgewachsenes Pferd<br />
Hurgler ungeschickter Mensch<br />
hussa draußen<br />
Hutzel gedörrte Birnen, im ganzen oder Birnenschnitze<br />
I<br />
i moa ich meine<br />
ibelsichtich schlecht aussehen<br />
ibersche obendrüber, höher<br />
iberzwerch überzwerch, falsch<br />
Ipser Gipser<br />
isch ist<br />
i(a)tz la(ß)<br />
mi gau ! Ausruf des Erstaunens (Jetzt laß mich gehen !)<br />
J<br />
Jäschd Aufregung<br />
jesesmäßich ganz arg, sehr viel (i hao me jesesmäßich g´ärgeret!)<br />
jamera jammern<br />
juzga jauchzen<br />
K<br />
Kaarsch Kartoffelhacke<br />
Kabb Kappe, Mütze<br />
Kabbadach Kopf<br />
Kachl Schmortopf, dicke Person<br />
Käehla Hohlweg<br />
Kärn Keller<br />
Käsbäbberla Kletten<br />
Kalch Kalk<br />
Kalender-<br />
machr Mensch, der viel nachdenkt<br />
Kammr Kammer, Schlafzimmer<br />
Kandl Kandel, Rinnstein<br />
Karra,<br />
Karrich Wagen<br />
Karrasalb Wagenschmiere<br />
Kaschda Kasten<br />
Kaschdanazga Kastanien<br />
Kazl Kanzel (nasal gesprochen)<br />
Keche Köchin<br />
Keebedd Kindbett, Wochenbett<br />
kecklich herzhaft<br />
Keddem Kette<br />
Kee Kinn<br />
191
Kehlkraut,<br />
Kehl Wirsing<br />
Kemmich Kümmel<br />
kiddera lachen, kichern<br />
Kiddl Kittel, Jacke<br />
Kiibl Kübel<br />
kiifa nagen, kauen<br />
Kiirscha Kirschen<br />
Kirbe Kirchweih<br />
Kirchhof Friedhof<br />
Klaia,<br />
Klaiesoma Klee, Kleesamen<br />
Kload Kleid<br />
Kloaderhaga Kleiderhaken<br />
Knäachd Knecht<br />
knitz verschlagen, schlau, listig<br />
knubla knien<br />
knudscha knutschen, küssen<br />
koa, koar kein, keine, keiner<br />
Koarn Korn<br />
Koas keines, niemand (koas mag me)<br />
Koaz Schlamm<br />
kobba aufstoßen<br />
Kommed Halsgeschirr für Zugtiere<br />
Kommod Kommode<br />
Kompf Wetzsteinbehälter<br />
Kongel Kunkel<br />
Koor,<br />
Rattekoor (Kinder)-Horde<br />
(am) Kopfnet am Kopfende<br />
Kosl Mutterschwein<br />
kotza erbrechen<br />
Kotzer Husten<br />
Kraibl Misthaken<br />
krageela rumschreien<br />
Kraudstanna Krautfaß<br />
Kreepf Krämpfe<br />
Krischboom Christbaum<br />
Krischdag Christtag (Weihnachtstag)<br />
Kraged Krankheit<br />
kuahl kühl, langsam<br />
Kuchea Küche<br />
Kuche-<br />
kämmerle Speiskammer<br />
Kuddl, Kuttel<br />
Kuddla Eingeweide (i hao a guade Kuttel),<br />
Kuddla Gericht aus dem Magen von Schlachttieren, „saure Kuttla“<br />
Kudder Abfall, Müll, dazu Kudderoamer und -schaufel - Kehrschaufel<br />
Kuglfuhr Spaß, Durcheinander, lärmende Possen<br />
192
Kuahfliagets aufsehenerregendes Ereignis<br />
kuppelig flink, beweglich<br />
L<br />
läan lassen „(Jetzt läan no mi gao!)<br />
Läbdag Lebetage, Aufregung, Umstände machen („no koan Läbdag!“)<br />
Läabara,<br />
Läabre-<br />
schbatza Leber, Leberspätzle<br />
läbbera mit Flüssigkeit spielen<br />
Läädsch Mund, Maul<br />
läabich lebendig<br />
Lällabäbbl dummer Mensch<br />
lätz falsch, verkehrt<br />
Laibezegg Zecke<br />
Laifr Jungschwein oder Läufer<br />
Lainich Leintuch<br />
Laisa Linsen<br />
lais(e)la flüstern<br />
lamelich langsam<br />
Lamberi Fußbodenleiste, Vorhangschiene<br />
langlechd länglich<br />
lao, bleiba lao lassen, bleiben lassen<br />
La(n)gwied die lange Verbindungsstange vom vorderen zum hinteren Wagenteil<br />
Lale langsamer Mensch<br />
ladscha latschen, langsam gehen<br />
laudrich unbefruchtet (bei Eiern)<br />
Lavor,Lafor gesprochen Waschschüssel (frz. lavoir)<br />
Legwied Weidenseil<br />
Leich Beerdigung<br />
Leis Läuse<br />
leitschei schüchtern, scheu, (leutscheu)<br />
Lenna Linde<br />
Lennabliads Lindenblüten<br />
Liachdbutz Nachtfalter<br />
Liachtkarz abendlicher Spinntreff im Winter<br />
I liig, du leisch,<br />
er leit,<br />
mir lieget ich liege, du liegst, er liegt, wir liegen<br />
lipfa, auch<br />
lupfa hoch heben<br />
Loable Weißbrotlaib<br />
Loadr Leiter<br />
Loahma Lehm<br />
Loasl, Leisel Verbindungsstück von Achse zum Leiterbaum beim<br />
Leiterwagen<br />
Loaß ausgefahrene Spur<br />
lodderleer ganz leer<br />
193
loddra lao hängenlassen<br />
Lomb,<br />
Lomba der, die Lumpen<br />
Lombadogg Kosenamen für Mädchen (Lumpenpuppe)<br />
Lonna doppelte Deichsel<br />
loschora lauschen<br />
Luag Lüge, dazu Luagabeidel - Lügner<br />
Luggeleskäs Quark<br />
luggs locker (Kuchen)<br />
Luse freie Zeit<br />
M<br />
Maagsoma Mohn(samen)<br />
Märgd Markt, aber auch Betrieb, Umtrieb (Kendsmärgd)<br />
Märschl Axt mit breitem Haupt<br />
mai mir, aber auch mehr<br />
Mallär Probleme, Unheil (frz. malheur)<br />
Malle Maria<br />
mampfa essen, mit vollen Backen kauen<br />
Mannsleid Männer<br />
Manze närrischer Mensch<br />
Maa Mann<br />
Maale kleiner Mann<br />
marod krank, schlecht<br />
Maschee Maschine<br />
maudrich kränklich<br />
maogelesbrao mittelbraun, von undefinierbarer Farbe<br />
Maul Mund<br />
Meahlbeer Mehlbeeren, Weißdornfrüchte<br />
meechd möchte<br />
Meggele,<br />
Mockele Kalb<br />
Meggl Kopf<br />
meira, Meirer mauern, Maurer<br />
meichala nach Verschimmeltem riechen<br />
Männdle kleiner Junge, auch Drohwort („Männdle, Männdle!“), kleiner Mann<br />
Mensch,<br />
Menscher Mädchen (Einzahl), Mädchen (Mehrzahl), abfällig<br />
metzga metzgen, schlachten<br />
migga, Migge bremsen, Bremse<br />
moaschd? meinst du ?<br />
Moaschdr Meister<br />
Moaßl Meißel<br />
Molge Molkerei<br />
Moo Mond<br />
Mooschd Most<br />
Morna morga Morgen früh<br />
morns abed Morgen abend<br />
muaschd? mußt du ?<br />
194
Mugg Fliege, Mücke<br />
muggr munter, lebhaft<br />
Mulle Katze<br />
Muschget-<br />
nuss Muskatnuss<br />
N<br />
naa nach unten, abwärts<br />
Näächde Nacht (bei Näächde)<br />
näamerd niemand<br />
näanich nirgends<br />
Näschd Bett<br />
naagscherrd verscharrt, beerdigt<br />
nai hinein<br />
naidich,<br />
onaidich nötig, unnötig<br />
naischobba,<br />
verschobba hineinschieben, verstecken<br />
naizuas hinein<br />
nagfloga hingefallen<br />
nare gao beeilen, schnell machen<br />
narred verückt, wütend, auch hastig („no nix Narreds“)<br />
naus hinaus<br />
nauszuas hinweg, hinaus<br />
nemme nicht mehr<br />
nii hinüber<br />
noa nein<br />
Nochdoal Nachteil<br />
noddla rütteln<br />
no mai noch mehr<br />
nomm hin zu<br />
nommzuas in die Richtung, die mit „nomm“ bezeichnet wird<br />
noa wäger von wegen, nein, sicher nicht<br />
nuff nach oben, aufwärts<br />
nui neu<br />
O<br />
Oa Ei<br />
Oacha Eichen<br />
Oachhernle Eichhörnchen<br />
Oages Eigenes<br />
oamal einmal<br />
Oamr Eimer<br />
oane, oar,<br />
auch oaner,<br />
oas eine, einer, eines<br />
oanzeln einzeln<br />
oasmich irgendwo<br />
Oas Furunkel<br />
195
Oasaganzr, auch<br />
Oazächdr Einzelgänger<br />
obacha ungeheuer (steigernd:<br />
„obacha kalt“)<br />
Ölmaga Mohn<br />
Ofaschlupfr Auflaufart (aus alten Wecken und Milch)<br />
ofläedich unausstehlich, unflätig<br />
ogfähr ungefähr<br />
ois egal<br />
Ommegänger Hausierer, Händler<br />
omorgla ändern<br />
Omraag Kurve („Umrank“)<br />
oms kenna beinahe<br />
ondersche,<br />
abersche nach unten, unten durch<br />
Oarnong,<br />
auch Oarneng Ordnung<br />
Orschlichd Schwefelschnitte<br />
osr unser<br />
Oziifr Ungeziefer<br />
P<br />
Padr Halskette (mit Nasal)<br />
Paseela Stiefmütterchen (a nasal, von frz. pensée)<br />
Pederleng Petersilie<br />
Pfannadeggl Pfannkuchen<br />
Pfanna-<br />
beischd In viel Fett gebackene Fladen aus gesalzenem Hefeteig<br />
Pfätscha-<br />
kendle Wickelkind<br />
Pfipfes Zungenkrankheit bei Hühnern<br />
pfiza mit der Peitsche oder einer Weidenrute leicht schlagen<br />
pfloatschaa sich hinflegeln<br />
Pflegl Flegel<br />
Pflomma Pflaumen<br />
pfluadra flattern<br />
Pfropfaziahgr Korkenzieher<br />
pfupfera aufgeregt sein, etwas nicht erwarten können<br />
pfuzga blasen<br />
Pratza Pratze, große Hand<br />
pratzla fallen, mit deutlichem Geräusch, z.B. Obst vom Baum, auch „´S hangt<br />
pratzlet vool!“<br />
pritscha schlagen<br />
R<br />
raa, raawärts runter, abwärts<br />
Räachd,<br />
räachd hao Recht, recht haben<br />
räada durchsieben<br />
196
Raah Rahm (nasal)<br />
rackhee total kaputt<br />
raddabutsch ganz und gar<br />
Rädich Rettich<br />
Rälleng Kater<br />
Rabbl Zorn, „den hod dr Rappl packt“<br />
räbbla Rinde schälen<br />
räs sauer (bei Wein und Most)<br />
raffla, Raffel viel schwätzen, großes Mundwerk<br />
Ragalla laute, sich wichtig machende Frau (Betonung auf der zweiten Silbe)<br />
raig´hagled hereingefallen, merke: raag´haglet - heruntergefallen<br />
raig´-<br />
schmeggd nicht von hier, nicht einheimisch<br />
raisch, auch<br />
reesch knusprig, geröstet<br />
Rambass Rowdy<br />
Ranka Stück Brot<br />
Ranzawaih Bauchweh<br />
Rafd Ranft, Brotrinde, Kuchenrand (nasal)<br />
raod rot<br />
Raohr Rohr, dazu Raohrbronna und Raohrschdiefl Gummistiefel<br />
Rauschkugl Betrunkener<br />
reachta lebhaft erzählen, sich verstreiten<br />
Rebbs Raps<br />
rei herein<br />
Reible junges Rind<br />
reng gering<br />
Riabehafa Kopf<br />
Riassel Rüssel, Kopf<br />
Riibl Stück Brot, Kopf<br />
Riibele Brotendstück<br />
Riggene Weihnachtsgebäck (Ausstecher) aus Brotmehl<br />
rii rüber, komm rii, komm rüber<br />
Riaschdr Schimpfwort, Schlampe<br />
roafla, Roafa rennen, Reifen treiben, Reifen<br />
roma (auf)räumen<br />
Rombloch Aufbau auf Vorderachse<br />
(komm)romm herum, komm rüber, dazu „anders romm“<br />
romm-<br />
wuurschdla herumschaffen<br />
romm on<br />
nomm hin und her<br />
Roßbolla Pferdeäpfel<br />
Roßmugga,<br />
Resama Sommersprossen<br />
ruff herauf<br />
ruffzuas heraufwärts<br />
rugg amol<br />
romm rücke mal da rüber<br />
197
Rugga Rücken<br />
ruugla,<br />
Ruugl rollen, Stück Wurst, Stück Holz (Stämmchen)<br />
S<br />
Säag Säge<br />
Säagaz Sense<br />
Saggduach Taschentuch<br />
i sag,<br />
du saisch<br />
er said,<br />
mir saget ich sage, du sagst, er sagt, wir sagen<br />
Sau Schwein, vorangesetzt steigernd, wie Sauleaba, Saug´fräß, Saulabb,<br />
Saulada, Saukerle, saumäßig<br />
saua sausen, rennen<br />
Sei Schweine<br />
Seiher Sieb<br />
seller, selle,<br />
sell dieser, diese, dieses<br />
Sembl,<br />
Huatsembl Dummkopf (simpler Mensch)<br />
Semmere Maßeinheit, Semmereszoane oder -grädda<br />
sengalad riecht angebrannt<br />
Siach,<br />
grommer<br />
Siach derbes Schimpfwort<br />
siadich hoaß siedend heiß<br />
soacha Wasserlassen<br />
Soafa, Soapf Seife<br />
Soal Seil, dazu Soaler<br />
Soma Samen<br />
Sonnawirbl Löwenzahn<br />
Stanna Steingutbehälter<br />
Sudrai Keller, Untergeschoß (frz. souterrain)<br />
Suf(a)raohr Wadenstiefel<br />
suggla, Suggl nuckeln, saugen, Sauger, junges Lamm, dazu „Mammesuggele“<br />
Sch<br />
Schäaf hinterlistige Person, Schlampe<br />
Schälfez,<br />
Schälfeza Hülse der Erbsen und Bohnen, auch allgemein Gemüse- und<br />
Obsthäute, z.B. Zwiebelschalen<br />
Schäar Maulwurf<br />
Schäädl Schädel, Kopf<br />
Schabbel,<br />
Schäbbele Haube, Kranz als Kopfschmuck, mit frz. chapeau verwandt<br />
Schäbberle kleines Mädchen<br />
schäaged schlecht, schief gehen, „d`Schuah verschäaged“<br />
schäbbera rasseln, scheppern<br />
198
schälda schelten, schimpfen<br />
schälla schellen, läuten<br />
Schäpfle Schöpfkelle, auch kleiner Topf mit Ausguß<br />
Schärdela Unkraut, Wiesenbärenklau<br />
schärra scharren, dazu Schärrede<br />
Schaff-<br />
schuarz Arbeitsschürze<br />
schalda schieben<br />
schalluu aufgeregt (frz. jaloux, hier neidisch)<br />
schandlich,<br />
schandlich doa schlecht, über jemanden herziehen<br />
schao schon<br />
Schbatze-<br />
bridd Spätzlesbrett, für handgeschabte Spätzle<br />
Schbeis<br />
(männlich) Mörtel<br />
Schbial-<br />
schdoa Spülstein, Ausguß<br />
Schbbigg-<br />
leng (Kartoffel)-Kuchen, sonst näher bezeichnet z.B. Zwetschgaschbiggleng<br />
Schboacha Speichen<br />
schberrangel-<br />
weit ganz offen stehen<br />
Schbrengerle Springerle (Weihnachtsgebäck)<br />
Schbrezkaad Gießkanne (a in Kaad nasal)<br />
schbreza gießen<br />
schbugga erbrechen<br />
Schbruier Spreu<br />
Schdacheda Staketen<br />
schdäd langsam<br />
Schdäar(n)a Sterne<br />
Schdäarna-<br />
rägele Wunderkerze (Sternenregen)<br />
Schdaffla,<br />
Schdäffela Staffeln<br />
schdao,<br />
schdao lao stehen, stehen lassen<br />
schdeib(e)ra abstützen<br />
schdemmela<br />
(stehlen) heimlich Frucht vom Boden holen<br />
Schdiag Stiege, Treppe<br />
schdiara etwas suchen, stöbern<br />
Schdoa Stein, dazu schdoahard<br />
Schdogghafa Blumentopf<br />
schdräahla kämmen<br />
schdraiba,<br />
Schdraibe streuen, Einstreu<br />
Schdrubfer,<br />
Schrubber Schrupper<br />
199
schdupfa stechen, stupsen (mit Nadel oder Finger)<br />
Schdraoh Stroh<br />
schdrazza stolz sein, strotzen<br />
Schdrempf Strümpfe<br />
Schdriggez Strickzeug<br />
Schdroafala Unkrautart (Ackerwinde)<br />
Schdubbfla Stoppeln<br />
Schduub Stube<br />
schee schön<br />
Scheegl Schenkel<br />
Schees Kutsche (Chaise)<br />
scheicha scheuchen<br />
Scheißerde Durchfall<br />
schempfela,<br />
romdreckla nicht in die Gänge kommen<br />
scheniera,<br />
schenant sich schämen, lästig sein, sich immer genieren<br />
Schendmärr Schimpfname, Schindermähre<br />
scheps schief<br />
Scheißgaß Schwierigkeiten, „en d’ Scheißgaß komma“<br />
Schesslo Liege (frz. chaiselongue“)<br />
Schiaßr Brotschieber, zum Einschießen von Brot beim Backofen<br />
Schiibele Portion, Schübchen<br />
Schisslabridd Schüsselbrett<br />
Schittschdoa Spüle,Ausguß<br />
Schitz Amtsdiener<br />
schläacht schlecht<br />
Schlabbr-<br />
gosch großes Mundwerk<br />
Schlabbaohra Eselsohren am Buch, große Ohren<br />
Schläbbr Pantoffeln<br />
schläggich wählerisch<br />
Schlaiha Schlehen<br />
Schlaoßa Hagelkörner<br />
schleegera schlenkern<br />
Schleifez Schleifbahn<br />
Schlisselbigs hohler Schlüssel, mit Pulver gefüllt, wird zum Böllerschießen<br />
verwendet<br />
schloapfa schleifen<br />
Schloapf-<br />
droog Hemmschuh<br />
schlotza,<br />
Schlotz(er) schlecken, Lutscher<br />
Schludda Schlampe, dazu schluddelich<br />
schlurga beim Gehen Füße nachziehen<br />
Schmär Fett, Schmer<br />
Schmidde Schmiedewerkstatt<br />
Schmotz Fett<br />
Schmotz-<br />
200
lappagschäfd Vetterleswirtschaft<br />
(Luft)schnabba Atem holen, „er duat sein ledschda Schnabber“<br />
Schnai Schnee<br />
Schnauf,<br />
schnaufa Atem, atmen<br />
Schnauzr Schnauzbart, Hund (Schnauzer)<br />
schnee(ai)-<br />
baucha schwer atmen<br />
Schnellkädder Durchfall<br />
schneiza schneuzen<br />
Schnitzbriah Brühe von gekochtem Dörrobst, zu dünne Brühe, schlechter Kaffee<br />
Schnuderde Schnupfen<br />
Schoada Keil<br />
schoare,<br />
Schoarschaufl umgraben, Spaten<br />
Schobba Saugflasche für Kinder, ½ Liter Glas<br />
Schocha,<br />
schocha Heuhaufen, diesen aufsetzen<br />
Schocha<br />
lacha laut lachen<br />
Schual Schule, dazu Schualmoaschder<br />
Schuahmächr Schuhmacher<br />
Schublatz Schuttabladeplatz<br />
schugga stoßen<br />
Schui(e)r Scheuer<br />
Schuldes Schultheiß<br />
Schuß Aufregung, „em Schuß“ - überhastet, dazu schusselich, Schussel<br />
Schwäh(e)r Schwiegervater<br />
schwätza schwätzen,sprechen<br />
schwanza ausgehen, schwänzen<br />
Schweda-<br />
gnöpfla Grießklöße<br />
Schwen-<br />
suuchd Schwindsucht<br />
Schwiigr Schwiegermutter<br />
schwiddisiera sich herumtreiben<br />
Schwoaß Schweiß<br />
U<br />
uff auf<br />
uff dr Gaard dauernd unterwegs<br />
Uffamärga-<br />
leida Abendglockenläuten<br />
uffbäha aufblähen, aufbacken<br />
uffbäbbla aufpäppeln<br />
uff de Obed am Abend<br />
ufflease (Obst) auflesen, heruntergefallenes Obst einsammeln<br />
Uffgsedsde Weihnachtsgebäck, „Aufgesetzte“<br />
uffhipfich oder<br />
201
hepfich aufgeregt<br />
uffpfiisa aufgeblasen, aufgeschwemmt<br />
uffstao aufstehen<br />
Ureisele Hornisse<br />
V<br />
vagiera umherschweifen<br />
Veigala Veilchen<br />
Veranda Balkon<br />
verbobbra ungeduldig sein<br />
verdao vertan, einen Fehler gemacht<br />
verdloffa davongelaufen<br />
verganda versteigern<br />
vergrada mißraten<br />
verhudla schlecht machen, durcheinander bringen<br />
verhonza verderben<br />
verkiddscha unter Wert verkaufen<br />
verkirnd verschluckt<br />
verkuddla verhandeln<br />
(net) vermugga nicht rühren, ruhig sein, nur in verneinter Form gebraucht<br />
verschißa in Ungnade gefallen, du hast es bei mir verschißen<br />
verschlupft versteckt, dazu Verschlupferles (Versteckspiel)<br />
versoffa ertrunken, auch trunksüchtig<br />
vertlaihna verleihen, auch entlehnen<br />
verwedd(e)red traurig, betrübt, verwettert<br />
verwiisla verwechseln<br />
verzwazzla verzweifeln<br />
Viarleng 125 Gramm, Viertelpfund<br />
vo dr Datz<br />
gao von der Stelle gehen, „der gaht mir net vo dr Datz!“<br />
Voord(e)l Vorteil „der hot de Vordl hussa!“ der arbeitet richtig, überlegt<br />
Voressa Schlachtplatte, Essen vor dem Hochzeitsmahl, vor der Trauung<br />
vuurza einen Wind lassen<br />
W<br />
wawitt?,<br />
wa hasch dao? was willst du? was hast du getan?<br />
wahla (sich) herumwälzen<br />
Waih, Waihle Weh<br />
Waihadag Tunichtgut<br />
Waibeerla wilde Stachelbeeren<br />
waischa wünschen<br />
wanääs krank, angegriffen, verschlissen (Kleid), betont auf der zweiten Silbe<br />
waanig abgerundet, nicht eckig<br />
Wad Wand (nasal)<br />
währle wirklich, wahr,<br />
Wärdich Werktag<br />
Wärgala Schupfnudeln, Buabaschbitzla, von wärgeln, Wargel - wälzen, Rolle<br />
Wäschlomba Waschlappen<br />
202
Wäschsoal Wäscheseil<br />
Waschd Bauch, Körper (nasal gesprochen), Wanst<br />
warba gemähtes Gras verteilen<br />
Weagsoacher kleines Geschwürchen am Auge, auch Anemone<br />
Wecholder Wacholder<br />
Weed Wind<br />
Weedfuchdl Getreidesense<br />
Wefzg,<br />
Wefzga Wespe, Wespen<br />
wega was weswegen<br />
wehle welche<br />
wehler welcher<br />
Weib, Weible Frau, kleine Frau, Mädchen<br />
Weißzeigkasta Wäscheschrank für weiße Wäsche<br />
wella, i will,<br />
mir wellet,<br />
i hao wella wollen, ich will, wir wollen, ich habe gewollt<br />
(aus)wella,<br />
Wellholz ausrollen, Nudelrolle<br />
wenna wenden<br />
Wennreng Gerät zum Stämme drehen<br />
Wetzschdoa Wetzstein<br />
wia da witt wie du willst<br />
wiadich wütend<br />
wiif schlau<br />
Widerschei Schatten<br />
wiifla (Weißzeug) stopfen<br />
wisawi gegenüber, (frz. vis-à-vis)<br />
Wiisboom Spannbalken beim Heuwagen<br />
wischa wischen<br />
Wischbl Baumgipfel oder Reisigbesen<br />
Woad (Vieh)-Weide<br />
Wagscheit Querholz hinten an der Deichsel zum Einhängen der Zugstränge<br />
woasch(t) weißt du ?<br />
Woaza Weizen<br />
Wochadibbl Mumps, Ziegenpeter<br />
wondrfizich neugierig<br />
Wuard’s ball? Wird’s bald ?<br />
wuarschda Wurst machen, metzgen<br />
wuahla schaffen, wühlen<br />
wuselich flink<br />
Wuurscht Wurst<br />
Wuurschd<br />
schao säa Du wirst es schon sehen !<br />
Z<br />
Zäahda Markung, (ursprünglich zehntpflichtiges, angebautes Gebiet außerhalb des<br />
bewohnten Dorfes, später übertragen auf die ganze Markung)<br />
Zäadl Zettel<br />
203
zäpfich Tbc. krank<br />
Zäsamle Fäserchen<br />
zärfa streiten<br />
Zaiha Zehen<br />
Zaigoaßl lange Peitsche<br />
Zais Zins<br />
Zao Zaun<br />
zearschd zuerst<br />
zeega,<br />
zä(n)ga (andere) ärgern<br />
Zelg Gewann<br />
zemma zusammen<br />
zenderla zündeln<br />
Zenga Zinken, Nase<br />
Zengessla Brennesseln, dazu (ver)zengd - an Brennesseln gebrannt<br />
z’ gron gau zu Grunde gehen<br />
Zibärdla Mirabellen<br />
Zibeba Zibeben, Rosinen<br />
Zicherd ein Wurf Schweine<br />
Zidderla Zittergras<br />
Ziefr Viehzeug<br />
Ziorgl Handharmonika<br />
Zirenga Flieder<br />
Zoana Flechtkorb (großer, aus Weide geflochtener Korb ohne Deckel mit zwei<br />
Handhaben, für Grünfutter, Kartoffeln, Holz und drgl.)<br />
Zoarn Zorn<br />
zobbfa pflücken, Hobfa zobbfa<br />
Zondlschdog Zunder<br />
Zong Zunge<br />
Zoom Zaum<br />
Zuber (Wasch)-Wanne<br />
Zuddl schlampige Frau<br />
Zuggerla Bonbons<br />
zwärga mit Gewalt hineinpressen<br />
Zwedr Pullover (engl. Sweater)<br />
Zwehle langes, schmales Handtuch<br />
zwozga zwicken<br />
Zwetschga-<br />
Derre Vorrichtung, um Obst zu dörren, dritter Rang im Theater<br />
Zahlen<br />
oas, zwoa, drui, viir, faif, segs, siiba, achd, nai, zeah, olf, zwelf, dreizeah, viirzeah,<br />
fuffzeah, zwanzg, fuffzg, hondert, daused<br />
Verschiedene „zwei“<br />
Zwee Wäag zwei Wege,<br />
zwua Flascha<br />
Wai zwei Flaschen Wein,<br />
zwoa Kendr zwei Kinder<br />
204
zwoarloa zweierlei<br />
Wochentage<br />
Meedich, Daischdich, Middwoch, Dorschdich, Freidich, Samschdich, Sonndich<br />
Monate<br />
Janner oder Jänner, Febbr, Mäarz, Abril, Mai, Juni, Juli, Auguschd, Sebdembr,<br />
Oggdobr, Novembr, Dezembr<br />
Lenkbefehle für Zugtiere<br />
Hü geh,<br />
hischd, nach links,<br />
hodd nach rechts,<br />
ooha (das „h“ wird gesprochen,<br />
kein Dehnungs-h!),halt<br />
zrugg oder<br />
hauff zurück<br />
Beugung von „sein“<br />
I bee, du bisch, er isch, mir ihr dia sen(d), i be gwäa, du bisch gwäa, u.s.w.<br />
Möglichkeitsform:<br />
i wär, du wärsch, er wär, mir, ihr, dia wäret<br />
Bauernregeln<br />
Die 12 Monate im Bauernspruch<br />
Wächst das Gras im Januar,/ wächst es schlecht das ganze Jahr.<br />
Im Jänner viel Regen und Schnee/ tut Saaten, Wiesen und Bäumen weh.<br />
Lichtmeß im Klee,/ Ostern im Schnee.<br />
Heftige Nordwind im Februar/ vermelden ein fruchtbares Jahr;<br />
wenn der Nordwind aber im Februar nicht will,/ so kommt er sicher im April.<br />
Feuchter, fauler März/ ist des Bauern Schmerz.<br />
Märzenschnee tut Frucht und Weinstock weh,<br />
Märzenregen bringt wenig Segen.<br />
Wenn der April Spektakel macht,/ gibt 's Heu und Korn in großer Pracht.<br />
Je früher im April der Schlehdorn blüht,/desto früher der Schnitter zur Ernte zieht.<br />
Der Maien kühl, der Brachmonat naß,/ füllen uns Scheunen und Faß.<br />
Regen im Mai/ gibt für das ganze Jahr Brot und Heu.<br />
Gibt 's im Juni Donnerwetter,/ wird 's Getreide immer fetter.<br />
Juni trocken mehr als naß,/ füllt mit gutem Wein das Faß.<br />
Was der Juli und August nicht kocht, läßt der September ungebraten.<br />
Wenn die Ameisen ihre Haufen im Juli höher machen, so folgt ein strenger Winter.<br />
205
Wenn 's im August stark tauen tut,/ dann bleibt das Wetter meistens gut.<br />
Der Tau tut im August so not,/ wie jedermann das täglich Brot.<br />
Am Septemberregen/ ist dem Bauern viel gelegen.<br />
Bringt der Oktober viel Frost und Wind,/ werden Januar und Februar gelind.<br />
Warmer Oktober bringt fürwahr/ uns sehr kalten Februar.<br />
Blühen im November die Bäume neu,/ hält der Winter bis zum Mai.<br />
Viel und lange Schnee/ gibt viel Frucht und Klee.<br />
Dezember kalt mit Schnee,/ gibt Korn auf jeder Höh.<br />
Hängt zu Weihnachten Eis in den Weiden,/ kannst du zu Ostern die Palmen schneiden.<br />
Lostage im Bauernjahr und Wetterregeln<br />
6. 1. Nach Dreikönigstag wächst jeder Tag um einen Hahnenschrei.<br />
20. 1. Fabian, Sebastian fängt der rechte Winter an.<br />
2. 2. Lichtmeß, Spinnen vergeß, bei Tag zu Nacht eß.<br />
14. 2. Valentins Eier müssen schnell ans Feuer.<br />
12. 3. Um Gregor kommt die Schwalbe vor.<br />
19. 3. Lein gesät am Marientag, wohl dem Nachtfrost trotzen mag.<br />
3. 4. Christian fängt zu säen an.<br />
16. 4. Daniel zum Erbsensäen wähl.<br />
1. 5. Wer am Maienabend setzt Bohnen, dem wirds lohnen.<br />
24. 5. Lein, gesät an Esther, wächst am allerbesten.<br />
8. 6. Wer auf Medardus baut, kriegt viel Flachs und Kraut.<br />
27. 6. Ist Siebenschläfer ein Regentag, regnets sieben Wochen noch danach.<br />
8. 7. Sankt Kilian stellt Schnitter an.<br />
20. 7. Margarete bringt den Flachs aufs Beete.<br />
10. 8. An Laurentius man pflügen muß.<br />
24. 8. Bartholomai schüttet Äpfel und Birnen ei.<br />
Nach Bartholomai geltet koane Wetterregla mai.<br />
8. 9. Maria Geburt, ziehen die Schwalben furt.<br />
29. 9. Michel steckt das Licht an, das Gesind muß zum Spinnen ran.<br />
15.10. Hedwige gibt Zucker in die Rübe.<br />
21.10. An Ursula muß das Kraut herein, sonst schneit es ein.<br />
10.11. Sankt Martin, macht Feuer im Kamin, dann, o Mädel, greif zum Rädel.<br />
25.11. Sankt Kathrein, stellt den Tanz ein.<br />
13.12. Sankt Luzia, kürzt den Tag, soviel sie ihn kürzen mag.<br />
24.12. Der Tag nimmt an Weihnachten einen Hahnenschrei, Heilige Drei Könige einen Hirschsprung,<br />
Lichtmeß eine ganze Stund zu.<br />
Räanget´s vor dr Glock (sonntags, vor dem Kirchgang), no räanget´s de ganz Woch.<br />
Wia dr Freidich am Schwanz (am Abend), so dr Sonndich ganz.<br />
Sprichwörter und Redensarten<br />
Was a scheener Hafa gwäa isch, siehd mr no a de Scherba.<br />
'S beschd Almosa isch dees, wo oa Beddlr am andere geit.<br />
Wia 's Häahle, so 's Oa.<br />
´S isch koa Amd, wo mr ned ka d' Hell dra verdeana.<br />
Mr ka ned älle Bergela eba macha.<br />
Wenn d' Hos verrissa isch, no flickt mr 's mit dr Weschd.<br />
Bessr äbbes als nix, had der Deifl gsaid on had Rihrmilch mit dr Heigabl gfressa. ("Rihrmilch" - Buttermilch)<br />
Mr moad oft vo oam, er sei fedd, on drbei isch er bloß gschwolla.<br />
Frag me ned, no liag i ned.<br />
Liabr z´ viel essa als z' wenig drenka.<br />
Dees isch besser als a Maul voll Glufa.<br />
206
Wer als Kalb en d' Fremde gahd, kommd als Kuah hoam.<br />
Kender on Narra saged d´Wahred.<br />
Märzeschnai on Jungfrebrachd daured ofd kaum iiber d' Nachd.<br />
Der erschde Honn fangd de Has.<br />
Kloane Häfela laufed bald iiber.<br />
Dees isch ned uff deira Mischde gwasa.<br />
Jedes Häsle fend sei Gräsle.<br />
Der beschd Bauer aggerd amal a gromme Furch.<br />
Wäga ma dirra Aschd haud mr de Boom ned om.<br />
Mer muaß zum Schmied gao on ned zum Schmiedle.<br />
Viel Wässerla gean au an Bach.<br />
Frei de, Girgele, 's kommd a Blatzreaga.<br />
Der Deifl scheißd bloß uff dongde Ägger.<br />
Mid ama "Vergelds Gott" ka mr d' Geil ned fuadera.<br />
'S Aldr isch a Kraged, a dere gahsch z´gron.<br />
Elend gläbd isch emmer no ned gschdorba.<br />
Wenn i morgeds mai Hos azoge hao, hao-n-i schao gnuag gschaffd.<br />
Wenn mr no reich wäred, arm senn mr glei wieder.<br />
Äschdemiersch du mi, na äschdemier i di.<br />
Do hod mei Vaddr gmiggd on da migg i ao on wenn 's dr Buggl nuff gahd!<br />
A alte Kuah schleggd ao no gern Salz.<br />
Alde Schuire brenned am leichdeschda.<br />
Do isch dr Sagg de Bändel ned werd.<br />
O, wenn mai Buggl no mai Bauch wär!<br />
Beißa kennt e 's no, bloß nemme schlugga.<br />
Laß se no schreia, morga wuurd wieder a andre Sau durch d' Gaß trieba!<br />
Heid hao-n-i an schleachda Dag, i muaß ´s Wasser mid dr Gabl essa.<br />
Häd mr 's ned, no däd mr 's ned.<br />
Was nudzd dr Kuah Muskaad, wenn se Haberschdraoh gwehnd isch.<br />
Vo de z' enge Schuah had der sei raode Nas ned.<br />
Mr lärned anander erschd kenna, wenn mr aus oara Schüssel frißd.<br />
Wo koa Gläbbr isch, isch ao koa Gsöff.<br />
A verschroggener Maa isch em Hemmel net sicher.<br />
Essa on Drenka verhäld oan, net 's Schaffa.<br />
´S scheeschd Fedd wurd ao amal ranzich.<br />
En ällem isch Bedruag, bloß en dr Milch isch Wasser.<br />
Kinderreime und -spiele<br />
Heute weiß man wieder, daß schon die kleinsten Kinder "Ansprache" brauchen und sich gerne vorsingen lassen.<br />
Viele Kinderverse und -lieder sind Überlieferungen aus ferner Zeit und gerade sie kommen immer mehr aus der<br />
Mode, ebenso die einst typischen Kinderspiele, für die auch die Voraussetzungen immer mehr verschwinden.<br />
Man braucht "Freiräume" dazu, ob "auf dr Gaß" oder in den Höfen, sowohl zu den Geschicklichkeitsspielen als<br />
auch zu "Fangerles" und "Verschlupferles", zu den Rollenspielen, in denen das Leben der Erwachsenen<br />
nachgeahmt wird, ("Vadderles ond Muaderles"), und zu den Singspielen und Reigen. Auch gab es früher draußen<br />
mehr Spielkamerädla als heute. Viele Spiele sind darauf abgestimmt.<br />
Zu den Geschicklichkeitsspielen gehören der "Deezer" (Tänzer, Kreisel), der mit einer kleinen Peitsche getrieben<br />
wurde, das Reifentreiben, das Kästchenhüpfen, das Stelzenlaufen und verschiedene Ballspiele, bei denen ein<br />
kleiner Ball nach festen Regeln gegen eine Wand geworfen und wieder aufgefangen wurde. Wer einen Fehler<br />
machte, mußte an das nächste Kind abgeben. Als Reigen waren, wie wohl überall "Ist die schwarze Köchin da . ."<br />
- "Hier ist grün, dort ist grün . ." oder "Rote Kirschen eß ich gern . . ." usw. beliebt. Einige Reime, Spiele und<br />
Lieder, aus dem bäuerlichen Milieu stammen, sind hier festgehalten. Sie drohen, für immer verloren zu gehen.<br />
Kinderlieder<br />
Herrgottskäferle, ( auch "Maiakäafer"), fliag,<br />
Dai Vaddr isch em Kriag,<br />
Dai Muadr isch em Bommerland, (Pommerland)<br />
Bommerland isch abgebrannd.<br />
Herrgottskäferle,(Maiakäafer) fliag !<br />
Aus dem Dreißigjährigen Krieg.<br />
207
Fahr mr net iiber mai Äggerle/ Äggerle<br />
Fahr mr net iiber mai Wies<br />
Oder i priigl de wedderlich/ wedderlich<br />
Oder i priigl de gwiiß!<br />
Das Kind soll einem Bedürftigen eine Gabe bringen und plaudert in aller Unschuld den Grund für die<br />
Mildtätigkeit aus:<br />
En scheena Gruaß vo maira Muader<br />
On da hao-n-e a Milch/ on da hao-n-e a Milch,<br />
On mir kenned se net braucha,<br />
Weil a Maus naig´falla isch/ en die Milch!<br />
Eia, popeia, dia Bredla senn guad<br />
Wenn mr brav Budder on Zugger nai duad!<br />
Budder on Zugger on Mandeleskern<br />
Essed dia kloane Kender so gern.<br />
Eia, popeia, dia Bredla senn guad<br />
Wenn mr brav Budder on Zugger nai duad!<br />
Dorle, Dorle danz,<br />
No kauf i dir an Kranz<br />
Mit Silber ond Berleggla dra,<br />
Daß mai Dorle danza ka!<br />
Tanzliedchen. "Berlocken" sind Schmuckanhänger - früher besonders an Uhrenketten.<br />
Reime und Sprüche<br />
Vier ganged, vier hanged,<br />
Zwoa spidziche, zwoa glidzriche,<br />
On oaner zoddled hennadrei.<br />
Rätsel. Lösung: Die Kuh mit vier Füßen, vier Strichen am Euter, zwei Hörnern, zwei Augen und einem Schwanz)<br />
Heil a bissle, lach a bissle<br />
Morga kommt dai Deede<br />
Hat a graoße Wuurschd em Säckle<br />
Ond a zuggrichs Bredle.<br />
Bärbele danz, Bärbele danz<br />
Morga griagsch en Hefakranz!<br />
Herrgottsmoggele fliag uff,<br />
fliag mr en de Hemmel nuff,<br />
breng mr a goldichs Schissele ronder<br />
on a goldichs Wiggele dronter.<br />
Sechzehn Kinder hab ich,<br />
Fünf will ich verkaufen,<br />
Fünf will ich nach Holland schicken,<br />
Fünf will ich ersaufen.<br />
Und das eine, das ich hab,<br />
Macht mir soviel Kummer,<br />
Sperr es in den Kleiderschrank,<br />
laß es dort verhungern.<br />
'´S hangd a Kendle a der Wad,<br />
Hadd a Gaggele en der Had,<br />
Mechd 's gern essa,<br />
Hadd koa Messer.<br />
Fälld a Messer vom Hemmel ra,<br />
Haud em Kendle 's Ärmle a.<br />
Dapfer ens Balbierers Haus,<br />
208
´S isch näamerd drhoam,<br />
Bloß Katz on Maus.<br />
D´Katz fäagd aus,<br />
D´Maus draids naus.<br />
Sidzd a Vegele (Biebele) uff em Dach,<br />
Hadd sich halba z´gropfed g´lacht.<br />
(Hat so gelacht, daß es fast einen Kropf bekommen hätte)<br />
Wenn das Kind ein "Wehwehle" hat:<br />
Heila, heila Sega<br />
Drei Dag Rega<br />
Drei Dag Schnee<br />
Duad maim Kendle nemme weh!<br />
Wenn man annimmt, das Kind mache zuviel Wesens um eine Bagatelle, heißt es wohl auch:<br />
Des vergaht, eb de heiradesch!<br />
Wenn man das Kind auf den Knien reiten läßt<br />
Hodde, hodde, Hääre, so reided d´Fräle,<br />
So reided kloane Kend, die no nia g`ridda sen,<br />
Wenn se greeßer wachsed, reided se nach Sachsa,<br />
Wenn se greeßer werden, reidet se uff Pferden.<br />
Reided dr Bauer iiber de Graba<br />
Wenn er naifälld, muß er's haba.<br />
Fällt er en die Hecka,<br />
Fressed ehn die Schnecka.<br />
Fälld er en da diafa Klai<br />
schreid er laud: O wai,o wai!<br />
Der isch ens Wasser g´falla,<br />
Der hot en rauszoga,<br />
Der hot en hoamtraga,<br />
Der hot en ens Bett neig´legt<br />
On des kloa Butzamäggerle had en wieder uffgweckt.<br />
(Fingerspiel)<br />
Storch, Storch, Schnibel - Schnabel,<br />
mit der langa Heugabel.<br />
Fliag in maira Ahna Haus,<br />
Hol mr a baar Wegga raus.<br />
Mir oan, dir oan<br />
On meiner Muadr au oan.<br />
Eieiei ond auauau<br />
Was hasch du meim Kätzle dao!<br />
D´ Haar rausg´rissa,<br />
D´ Schdiag na g´schmissa,<br />
Dees sodd ja mai Vadder wissa!<br />
Jedz isch`s ganga, sechs hend sieba gfanga!<br />
Wenn dem Kind etwas gelungen ist.<br />
Wenn Kirbe isch, wenn Kirbe isch,<br />
No schtichd mai Vadder an Bock.<br />
No danzd mai Muadr, no danzd mai Vadder,<br />
No waggeld dr Muadr ihr Rock.<br />
Bi- ba- Bäbele,<br />
Kommt der Herr von Schäbele,<br />
Kommt der Herr von Witzemaa,<br />
209
Fang noamal vo voarna a!<br />
Antworten auf Kinderfragen<br />
Auf die Frage: "Wo isch dr Hans?" oder sonst ein Spielkamerad<br />
"En dr Haut bis iiber d´Aohra<br />
On wenn er da net isch, no isch er verlaora!"<br />
Auf die Frage: "Was hasch midbrachd?"<br />
"A Nixle (ein kleines Nichts) en ame Bichsle on a goldichs Wartaweile!"<br />
Auf die Frage: "Was geit´s hait z´essa?"<br />
"Fiirwitz on Frägela ond henderdrei bradene Kellerschdaffla!"<br />
Spiele im Freien.<br />
Gitterle, Gätterle,<br />
Vögele, Fisch,<br />
Büble, du bisch.<br />
(ca. 400 Jahre alter Abzählvers)<br />
Fähnele, Weckele,<br />
Male, Fisch<br />
On du bisch !<br />
(Zwei alte Abzählverse, auf das württembergische Wappen bezogen. Die Hirschhörnle und die Rauten daneben,<br />
der Adler auf der Reichssturmfahne und die Mömpelgarder Fische werden beschrieben, im zweiten Versle auch<br />
die Wecken von Teck)<br />
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben,<br />
Auf der Landschdraß Nummer sieben,<br />
Auf der Landschdraß Nummer acht,<br />
Hat der Storch ein Kind gebracht.<br />
Wie soll´s heißen?<br />
Anna, Emma, Rombeleskaschda,<br />
Wer soll meine Wendla wascha?<br />
Ich oder du<br />
Oder Müllers Kuh<br />
Oder Müllers Esel<br />
Der bisch du!<br />
Abzählvers<br />
Rengel, rengel, raiha,<br />
´S Kätzle gaht en d'Schlaiha,<br />
´S Kätzle gaht en Holderbusch,<br />
Mached älle husch,husch husch.<br />
Ade, Mama, ade, Baba,<br />
Rengele, rengele hopsassa.<br />
Reigen<br />
Frager:Muadr, verkaufsch dai Kend?<br />
"Mutter":Noa, noa, mai Kend verkauf i net!<br />
Liaber will e beddla laufa<br />
Als mai liabs, guads Kend verkaufa!<br />
Beddla laufa mag i net<br />
Ond mai Kend verkauf i net.<br />
(Von einer ungeraden Anzahl Kinder stellen sich die Mitspielenden paarweise im Kreis auf. Bei den Paaren ist<br />
ein Kind die Mutter, das andere das Kind. Wer keinen Gefährten hat, kommt als Frager in die Mitte und richtet<br />
das Wort an eine "Mutter". Während des obigen Dialogs versuchen jeweils zwei "Mütter", ihre Plätze möglichst<br />
unauffällig zu tauschen. Gelingt es dem Frager, während des Tauschs den Platz einer "Mutter" bei einem allein<br />
stehenden Kind einzunehmen, darf er ihn behalten, und die seitherige Mutter muß als Frager in die Mitte)<br />
210
Recha, Recha, Scheifele<br />
Wer lachd, der isch a Deifele<br />
Wer net lacht, isch a Engele<br />
Ond kommt ens goldich Hemmele!<br />
Die Kinder stellen sich in einer Reihe auf. Der Spielführer ruft das erste Kind zu sich und hält ihm einen<br />
Zeigefinger auf den Kopf, wobei das Kind sich langsam dreht. Während der Spielführer den Vers rezitiert,<br />
beobachten alle Kinder gespannt das sich drehende Kind. Wenn es das Lachen nicht verbeißen kann, ist es ein<br />
"Teufele", im andern Fall ein "Engele". Alle Kinder kommen dran, bis sie in Engela und Deifela geschieden sind.<br />
Die Deifela werden verspottet, für die Engela reichen sich zwei einander gegenüberstehende Kinder die Hände,<br />
auf dieser improvisierten Schaukel darf jeweils ein Engele Platz nehmen und wird gegautscht, während das<br />
folgende Versle von allen aufgesagt wird. Zum Schluß geht es mit Schwung "en de Hemmel nei"!<br />
Engela werded draga, Deifela werded g´schlaga, Eins, zwei drei en de Hemmel nai!<br />
Aus Gechingen<br />
Einzelne Persönlichkeiten<br />
Karl Friedrich Essig<br />
Am 13. Dezember 1902 wurde Karl Friedrich Essig in Gechingen als Sohn des Buchhändlers Friedrich Christian<br />
Essig und der Marie Heinerike geb. Maier geboren. Beide stammten aus Gechingen, die Familie lebte aber in<br />
Stuttgart. Im ersten Weltkrieg verlor Karl Friedrich Essig seinen Vater. Die Mutter mußte die Wohnung in<br />
Stuttgart aufgeben und zog wieder nach Gechingen. An den Zukunftsplänen für ihren Sohn - die Eltern hatten<br />
gewünscht, daß er Pfarrer werde - konnte sie nicht länger festhalten. Im Internat in Nagold wurde Karl Friedrich<br />
Essig zum Volksschullehrer ausgebildet. 1930 kam es zu einer Anstellung in Gechingen, 1930 - 1937<br />
unterrichtete er dort. 1932 heiratete er Hedwig Eberhardt aus Stuttgart.<br />
Später baute Essig in Sucha/Ost-Oberschlesien eine deutsche Schule auf und holte seine Familie sowie seine<br />
Mutter.nach. Gegen Ende des Krieges wurde er noch zur Wehrmacht eingezogen und nach amerikanischer<br />
Kriegsgefangenschaft im September 1945 nach Stuttgart entlassen. Seine Familie war inzwischen nach<br />
Württemberg geflüchtet. Zwar war alles Hab und Gut verloren, aber die Familie war wieder vereinigt, und alle<br />
waren am Leben.<br />
Die nächsten Jahre verbrachte die Familie in Hedwig Essigs elterlichem Haus in Stuttgart. 1950 erhielt K. F.<br />
Essig eine Stelle als Lehrer in Dagersheim. Dort wirkte er, zunehmend durch eine schwere Krankheit behindert,<br />
bis zu seinem Tode am 3. August 1956.<br />
Schon seit frühester Jugend notierte sich Karl Friedrich Essig alles Wichtige und Wissenswerte aus seinem<br />
Heimatdorf und über die Menschen, die dort lebten. Je älter er wurde, desto intensiver beschäftigte er sich mit<br />
der Heimat und der Familienkunde Gechingens. Leider gingen bei der Flucht aus Oberschlesien alle schriftlichen<br />
Unterlagen verloren. So war K. F. Essig nach dem Krieg gezwungen, vieles mühsam wieder neu zu erarbeiten.<br />
In Dagersheim entstand eine ausführliche Heimatgeschichte für Gechingen, die aber erst nach seinem Tod in<br />
Buchform herausgegeben werden konnte. In dem 1963 erschienenen Buch "Heimat Gechingen" ist ein Teil seiner<br />
umfangreichen Arbeiten enthalten. Als Dank für sein langjähriges Bemühen für das Leben der Vorväter und die<br />
wechselvolle Geschichte des Dorfes verlieh ihm die Gemeinde an seinem Grabe das Ehrenbürgerrecht.<br />
Dr. Otto Stein<br />
1891 in dem Odenwaldstädtchen Beerfelden geboren, meldete sich der Student der Naturwissenschaften Otto<br />
Stein als Kriegsfreiwilliger im ersten Weltkrieg. 1917 wurde er schwer verwundet. Nach Kriegsende wechselte er<br />
Studienort und Studienfach und schrieb sich als Student der Medizin in Tübingen ein, legte dort sein<br />
Staatsexamen ab und promovierte anschließend. Seine ärztliche Tätigkeit begann in Winzeln bei Schramberg.<br />
Anfang der dreißiger Jahre übernahm er die Leitung des Homöopathischen Krankenhauses in München. Eine<br />
Herzerkrankung zwang ihn, die Tätigkeit als Chefarzt aufzugeben. Er wählte dann Gechingen, die Heimat seiner<br />
Frau Anna, geborene Wurst zum Wohnsitz. Hier konnte Otto Stein für die damals etwa tausend Einwohner eine<br />
kleine Praxis weiterführen. Zu der Bevölkerung entwickelte sich bald eine von gegenseitiger Achtung und<br />
verhaltener Zuneigung geprägte Beziehung, welche es ihm ermöglichte, seinem ärztlichen Auftrag auch dort<br />
211
nachzukommen, wo es die Willkürherrschaft des Dritten Reiches untersagte. So versorgte Dr. Otto Stein eine<br />
schwerkranke Jüdin in Dachtel trotz Verbotes mit Medikamenten.<br />
Als sich 1945 die Franzosen dem Ort näherten, ging er, der geläufig französisch sprach, ihnen mit der weißen<br />
Fahne entgegen und konnte den kommandierenden französischen Offizier davon überzeugen, daß Gechingen<br />
nicht verteidigt würde. Durch sein couragiertes Dazwischentreten blieb Gechingen von Kämpfen verschont.<br />
Dr. Otto Stein malte in seiner freien Zeit nach der Natur. Als Atelier diente das Sprechzimmer mit zwei großen<br />
Fenstern. Blumenbilder entstanden als Ergebnis genauer Betrachtung und Liebe zur Einzelheit. Bei seinen<br />
Landschaftsbildern versuchte er, die Schönheit der Gäulandschaft so wiederzugeben, wie sie sich dem Betrachter<br />
darbot. Bewußt beschönigte er nichts, auf bildnerische Komposition verzichtete er absichtlich. Dr. Otto Stein<br />
starb am 25.1.1969. Eine Gedächtnisausstellung mit seinen Bildern erinnerte 1989 an sein Leben und Wirken.<br />
Adolf Kielwein<br />
wurde geboren am 6.9.1869 in Ulm, aber seine Vorfahren stammen aus Gechingen. Seine Jugend erlebte er in<br />
Tübingen. Wie sein Bruder, der bekannte Maler Ernst Kielwein, wandte er sich der Malerei zu, vor allem schuf<br />
er Landschaften, Ortsbilder und Stilleben.<br />
1897 heiratete Adolf Kielwein die <strong>Gechinger</strong>in Luise Weiß, eine Schwester von Ludwig Weiß (Hohe Gasse).<br />
Das Ehepaar wohnte lange Jahre in Stuttgart, zog 1933 nach Gechingen und kaufte das Haus Lutz im Mühlweg<br />
(heute Engler). Dort arbeitete Adolf Kielwein noch viele Jahre an Bildern unserer Heimat.<br />
Als Kielweins Frau im Jahre 1939 starb, zog seine Schwester, Frau Anni Kraft, zu ihm und führte den Haushalt.<br />
Viele ältere <strong>Gechinger</strong> werden sie noch in Erinnerung haben, wie sie an schönen Sommersonntagen in Kleidung<br />
aus einer längst vergangenen Mode mit korrekten weißen Handschuhen und einem zierlichen Sonnenschirmchen<br />
zur Kirche ging.<br />
Kielwein verließ Gechingen 1961 und zog ins Altersheim in Tübingen. Dort starb er am 20. 12. 1962. Viele<br />
seiner Bilder sowie zahlreiche Gemälde seines Bruders Ernst befinden sich im Besitz der Stadt Tübingen.<br />
1987, 25 Jahre nach dem Tode Adolf Kielweins gedachte die Gemeinde Gechingen mit einer<br />
Gemäldeausstellung, der beiden malenden Brüder.<br />
Willy F. Kübler<br />
wurde am 27. Oktober 1911 in Höfen/Enz geboren. Schon in der Schule erkannten die Lehrer seine künstlerische<br />
Begabung und als in der Inflationszeit nach dem ersten Weltkrieg das Papier knapp wurde, sorgte der Schulrat<br />
persönlich dafür, daß ihm immer welches zur Verfügung stand. Nach der Schulzeit setzte Willy F. Kübler seine<br />
Ausbildung mit einem Fernstudium fort, Lehrgäng und Kurse, so an der "Deutschen Kunstschule" in Berlin,<br />
schlossen sich an. Zahlreiche Ausstellungen, u.a. in Berlin und Stuttgart, die gute Resonanz fanden, machten ihn<br />
bekannt. In Privatkursen gab er Schülern aller Altersklassen Unterricht in Zeichnen und Malen. Einige brachten<br />
es zu beachtlichen Leistungen.<br />
Willy F. Küblers künstlerische Fähigkeiten zeigten sich besonders in Federzeichnungen, Öl- und Aquarellbildern.<br />
Er war auch ein guter Fotograf; sein Hobby brachte ihm Freude und Ausgleich zu seiner schöpferischen Arbeit.<br />
Er hinterließ Hunderte reizvoller Aufnahmen, die die Besonderheiten der Landschaft, des Ortes und seiner<br />
Bewohner zeigen.<br />
Am 3. 6. 1933 heiratete er Emma Wagner aus Gechingen. Im September 1933 zog das junge Paar hierher. Bis zu<br />
seinem Tode im Jahre 1987 lebte und arbeitete Willy F. Kübler in unserem Ort.<br />
0tto Weiß, Fotograf<br />
Am 28. 10. 1876 wurde Otto Weiß in Gechingen geboren und ging 1901 mit 24 Jahren nach Stuttgart. Dort<br />
erlernte er beim Königlichen Hoffotografen Andersen das Fotografieren, wofür er sich daheim durch jahrelanges<br />
Selbststudium die notwendigen Grundkenntnisse angeeignet hatte.<br />
1905 heiratete er Luise Schneider aus Gechingen und richtete im schwiegerelterlichen Haus ein Foto-Atelier mit<br />
einer selbstgebauten Kamera ein. Neben der Landwirtschaft übte er seinen Beruf bis zu seinem Tod am 26. 8.<br />
1957 aus. Wir verdanken ihm zahlreiche Fotos unseres Ortes und seiner Umgebung. Ganze Generationen von<br />
<strong>Gechinger</strong>n, aber auch viele Leute aus den Nachbargemeinden ließen sich von ihm ablichten. Kaum eine andere<br />
Gemeinde besitzt eine so große Anzahl von Fotografien aus aus den Anfängen dieses Jahrhunderts. Im Jahre<br />
1989 erinnerte eine Gedächtnisausstellung an ihn und seine Arbeiten.<br />
Gottlieb Heinrich Schwarzmaier<br />
erblickte am 9. 12. 1843 in Gechingen das Licht der Welt. Er lebte das schlichte Leben des schwäbischen<br />
Kleinbauern. Er hatte keine besondere literarische Schulung und war nur im Besitz eines bescheidenen<br />
Bücherschatzes, doch waren seine Verse voller Poesie sowie in Metrik und Reim sehr genau. Leider sind nur<br />
wenige davon erhalten geblieben; er wußte sie alle auswendig und hat kaum einen aufgeschrieben. Heinrich<br />
212
Schwarzmaier, eines seiner acht Kinder, hatte die dichterische Neigung vom Vater geerbt, aber leider auch nichts<br />
Schriftliches hinterlassen. Gottlieb Heinrich Schwarzmaier starb 1917 im Alter von 73 Jahren.<br />
Karl Friedrich Brackenhammer<br />
war der zweite Sohn des <strong>Gechinger</strong> Müllers Johann Jakob Brackenhammer und wurde am 13. 1. 1810 geboren.<br />
Der damalige Ortspfarrer, Christoph Heinrich Klinger, machte die Eltern auf die Begabung ihres Sohnes<br />
aufmerksam. Nach dem Besuch der Lateinschule in Herrenberg und des Stuttgarter 0bergymnasiums bestand er<br />
die Aufnahmeprüfung zum Theologischen Stift Tübingen. 1832 legte er dort die Kandidatenprüfung ab und<br />
bereitete sich dann in Aich bei Nürtingen auf das Pfarramt vor. Seine erste Pfarrstelle trat er 1838 in Sulz am<br />
Neckar an und verheiratete sich in dieser Zeit mit Rosine Katharina Hennenhofer aus Tübingen. Ab 1844 wirkte<br />
er in Nürtingen, ab 1853 als Stadtpfarrer in Brackenheim und von 1866-1871 war er Dekan in Schorndorf.<br />
Während seiner Amtszeit in Schorndorf wurde er zum Abgeordneten der ersten Landessynode gewählt.<br />
Nacheinander wurden ihm das Dekanat in Tübingen und die Prälatur in Ulm angeboten, er mußte aber aus<br />
gesundheitlichen Gründen ablehnen. Trotzdem bat das Consistorium (zuständiger Ausschuß für Kirchenfragen<br />
bei der Königlichen Regierung) den König, ihn zum Prälaten von Heilbronn zu ernennen. Brackenhammers<br />
Gesundheitszustand hatte sich inzwischen stabilisiert, so trat er dieses Amt 1871 an, mit dem ihm ein großes<br />
Arbeitsgebiet anvertraut wurde. Für seine verdienstvolle Tätigkeit erhielt er am 17. 9. 1873 vom König das<br />
Ritterkreuz I. Klasse des Ordens der Württembergischen Krone verbunden mit dem persönlichen Adel.<br />
Als Prälat trat Karl Friedrich Brackenhammer entschieden für die Selbständigkeit des kirchlichen<br />
Gemeindelebens ein, auch zeigte er sich immer als Mann des Friedens und der Versöhnung. Er war Mitglied der<br />
kirchenrechtlichen Kommission und 1874 Abgeordneter der 2. Landessynode. Kurz vor seiner Pensionierung<br />
erhielt er den Orden "Komenthur II. Klasse des Fr. Ordens".<br />
Im Jahr 1880 setzte Prälat Brackenhammer sich zur Ruhe und zog nach Tübingen, wo er am 29. 10. 1889<br />
verstarb. Die Gemeinde Gechingen ehrte ihn 1990 mit einer großen Gedächtnisausstellung<br />
Otto Weiß, Bürgermeister<br />
Otto Weiß wurde als viertes Kind des Landwirts und Fotografen Otto Weiß am 27. 1. 1916 in Gechingen<br />
geboren. Er besuchte die Volksschule und anschließend das Progymnasium in Calw. Nach einer kaufmännischen<br />
Lehre hatte er eine Stelle als Kontorist und Vertreter in Sulzbach an der Murr inne, bis er 1937, erst zum<br />
Arbeitsdienst, dann zur Wehrmacht eingezogen wurde. Nach Kriegsende kehrte er nach Gechingen zurück. Für<br />
Otto Weiß völlig überraschend bat ihn der im September 1945 neugewählte Gemeinderat, das Amt des<br />
Bürgermeisters zu übernehmen. Nach einer Bedenkzeit entschloß er sich, das Amt anzunehmen. Bei der Wahl am<br />
15. 9. 1946 erhielt Otto Weiß die Mehrheit der abgegebenen Stimmen und zog als Dreißigjähriger ohne<br />
Erfahrung in der Kommunalpolitik als Bürgermeister in das <strong>Gechinger</strong> Rathaus ein. In den Jahren 1948, 1954<br />
und zuletzt 1966 wurde Otto Weiß mit jeweils großer Zustimmung der Bevölkerung wiedergewählt. Am 12. 9.<br />
1953 heiratete er Lotte Gehring.<br />
Während seiner Amtszeit stieg die Einwohnerzahl unseres Ortes von 926 auf fast 3.000 Personen an. Viele<br />
kommunale Einrichtungen wurden in diesem Zeitraum geschaffen (Siehe "Nachkriegszeit bis heute" unter<br />
"Gechingen in geschichtlicher Zeit"). Besonders hervor-zuheben ist, wie sparsam Otto Weiß wirtschaftete,<br />
Gechingen hatte 1978 eine Pro-Kopf-Verschuldung von nur 52.- DM.<br />
Am 8. 12. 1978 wurde er im Rahmen einer großen Feier in den Ruhestand verabschiedet. Aus der Hand des<br />
damaligen Landrats Pfeiffer erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Wegen seiner Verdienste um die Gemeinde<br />
Gechingen ernannte ihn der Gemeinderat zum Ehrenbürger.<br />
Otto Weiß sang auch aktiv im Liederkranz, war lange Jahre Vorstandsvorsitzender der <strong>Gechinger</strong> Bank und<br />
Mitglied des Kreistages.<br />
Emma Wuchter<br />
wurde geboren am 15. 6. 1885 in Gechingen. Sie besuchte in den Jahren 1924/25 die Hebammenschule in<br />
Stuttgart und war dann in Gechingen und Umgebung bis zum Jahre 1952 als Hebamme tätig. Während dieser Zeit<br />
half sie ca. 400 Kindern auf die Welt. Unter welch beschwerlichen Umständen der Hebammenberuf früher<br />
ausgeübt wurde, ist heute kaum vorstellbar. Meist war Emma Wuchter zu Fuß unterwegs. Manchmal wurde sie<br />
auch mit dem Fahrrad abgeholt, auf die Lenkstange oder den Gepäckträger gesetzt und zur Wöchnerin gebracht.<br />
Dort sprang sie dann oft bei Haus- und Stallarbeiten ein, besonders, wenn schon einige Kinder da waren. Sie<br />
kochte, versah den Haushalt und scheute sich nicht, das Vieh zu füttern und die Kühe zu melken. Um ihr<br />
kärgliches Gehalt aufzubessern, bewirtschaftete sie noch ein paar Felder und hielt zwei, drei Geißen und ein<br />
Schwein. Für die <strong>Gechinger</strong> Bevölkerung war Emma Wuchter nicht nur "d'Hebamm", in vielen Familien war sie<br />
"d'Tante Emma". Sie verstand auch viel von Krankenpflege, weshalb ihr Rat im Krankheitsfall stets geschätzt<br />
war.<br />
213
Auch im Ruhestand versorgte Emma Wuchter weiterhin ihre kleine Landwirtschaft. Ihren 80. Geburtstag feierte<br />
sie noch bei relativ guter Gesundheit mit vielen Freunden und Bekannten in der Festhalle. Sie starb am 11.<br />
12.1966.<br />
Tillie Jäger<br />
Die wohl bekannteste Heimatdichterin unseres Ortes wurde am 2. 10. 1898 als Tochter des Heinrich Jäger und<br />
der Ottilie geb. Böttinger, aus Gechingen, geboren. Als ihr Vater 1912 starb, zogen Mutter und Tochter hierher.<br />
Die literarischen Neigungen Tillie Jägers traten sehr bald hervor. Schon 1918 beschrieb sie die Trauer um die<br />
Gefallenen und machte sich Gedanken über die Zukunft unseres Landes. Sie hat zahlreiche handschriftliche<br />
Gedichtbände verfaßt und zwei ihrer großen Heimatspiele "Furchtlos und treu" und "Der letzte seines Stammes"<br />
sind in Gechingen aufgeführt worden. Zu erwähnen sind auch ihre Forschungen über verschiedene <strong>Gechinger</strong><br />
Familien und die Geschichte Gechingens. Verschiedene Zeitungen veröffentlichten ihre Artikel und Gedichte.<br />
Auch Klavierunterricht erteilte sie jahrzehntelang..<br />
Am 4. 10. 1976 verstarb Tillie Jäger in Hirsau.<br />
Johannes Böttinger<br />
wurde am 27. 5. 1874 in Gechingen geboren und arbeitete nach seiner Schulzeit in der väterlichen<br />
Landwirtschaft. Als er sich mit 21 Jahren beim Militärdienst eine Verletzung zuzog und ins Lazarett mußte, fing<br />
er an, Gedichte zu schreiben. Im Jahr 1900 kehrte er nach Gechingen zurück, denn sein Vater war inzwischen<br />
gestorben und er betrieb mit seiner Mutter die Landwirtschaft weiter. 1902 heiratete er Luise Friederike Gehring<br />
aus Gechingen.<br />
Johannes Böttinger schrieb zahlreiche Gedichte, die er in einem handgeschriebenen Buch mit dem Titel<br />
"Knospen und Blüten" sammelte. Trotz fehlender literarischer Schulung sind seine Verse poetisch und klangvoll.<br />
Er stand auch in Verbindung mit dem bekannten Bauern- und Heimatdichter Christian Wagner aus Warmbronn.<br />
Leider verstarb er schon am 5. 11. 1921 mit 47 Jahren.<br />
Rudolf Unger,<br />
Mit Rudolf Unger erblickte 1884 ein weiterer zukünftiger Ehrenbürger der Gemeinde Gechingen das Licht der<br />
Welt. Sein Vater Ernst betrieb hier einen Gemischtwarenhandel. Rudolf Unger wurde Lehrer und später Rektor<br />
an einer Stuttgarter Schule. Jahrelang leitete er als Chormeister den Liederkranz Gechingen, der in dieser Periode<br />
durch seine unermüdlichen Bemühungen besonders gute Leistungen vollbrachte. Seine Arbeit wirkt bis heute<br />
weiter.<br />
In seiner Freizeit erinnerte er sich in Gedichten seiner in Gechingen verbrachten Jugend. Am 25. 5. 1951 wurde<br />
er wegen seiner Verdienste um die Gemeinde Gechingen zum Ehrenbürger ernannt. Rudolf Unger starb im Jahre<br />
1956.<br />
Anekdoten<br />
Wahre und gut erfundene Geschichten.<br />
Ein Bauernoriginal aus Gechingen, der "Hasensemme", war im ganzen Gäu bekannt. Die vier folgenden<br />
Geschichten über ihn sind frei nach Karl Friedrich Essig erzählt.<br />
Der Hasensemme, ein gehöriger Schalk und Spitzbube oben heraus, war in vielen Dörfern eine wohlbekannte<br />
Erscheinung. Er traf er den Nagel immer auf den Kopf. Schon als junger Kerle war er für Späße zu haben.<br />
Einmal fuhr er mit der Eisenbahn nach Ulm, um seine Schwester zu besuchen, die dort bei einem Hauptmann in<br />
Dienst stand und immer schrieb, sie wäre so froh, wenn ihr jemand über die Mutter, den Vater und die neuesten<br />
Dorfereignisse berichtete. So langte der Vater eines Abends ein Goldstücklein aus der Kommode und sagte zu<br />
Hasensemme: "Also, baß uff! Du fährsch moarn nach Ulm on bsuachsch dei Schweschter. Verschtanda! Do<br />
hosch a Goldschdiggle, kasch dr zwoa schene Däg macha!" Hasensemme kniff die knitzen Äuglein zusammen<br />
und sagte: "Vaddr, des mach i, do wurd d´Marie a Fraid hao."<br />
In Stuttgart stieg der Hasensemme, obwohl er eine Fahrkarte der vierten Klasse gelöst hatte, in einen<br />
Polsterwagen der zweiten Klasse des nach Ulm fahrenden Zuges. Er hatte die Brille seiner Ahne dabei, setzte sie<br />
auf und sah mit ihr, wie er es bezweckt hatte, einem Verrückten sehr ähnlich.<br />
Im Abteil setzte er sich gleich breitspurig zwischen zwei junge Damen, schnitt ein paar Grimassen, musterte die<br />
Frauen von Kopf bis Fuß, langte die mit zwei Rehen bemalte Tabakspfeife und den "Knastersack" aus der<br />
Manteltasche und stopfte in aller Seelenruhe den großen Porzellankopf bis an den Rand. Dann blies er den<br />
beiden dicke Rauchwolken vor die Nasen und führte sich auf, als sei er allein im Abteil. Als er Hunger verspürte,<br />
holte er sein Vesper, ein großes Stück Brot und ein Stück Schwarzwälder Speck, aus der Manteltasche hervor,<br />
214
und legte diese Dinge, mir nichts, dir nichts, auf den gegenüberliegenden leeren Polstersitz. Dann begann er zu<br />
essen und schmatzte gehörig dazu. Plötzlich erhob sich eine der beiden Frauen, huschte mit wutverzerrtem<br />
Gesicht den Gang entlang und holte den Schaffner herbei. Während sie dem Schaffner Hasensemmes<br />
ungebührliches Betragen darlegte, spielte der den Verrückten. Er verzerrte das Gesicht, schnitt unglaubliche<br />
Grimassen, schlug wild um sich und rannte auf das offene Abteilfenster zu, als wolle er sich hinausstürzen. Mit<br />
Mühe und Not konnten die beiden Frauen und der Schaffner den "Irrsinnigen" nach einer geraumen Zeit<br />
beschwichtigen. Sie legten ihn auf die Polster und deckten ihn mit dem Mantel zu. Dann nahmen die Damen<br />
schleunigst ihre Koffer und suchten sich unter dem Schutze des Schaffners im nächsten Wagen zwei freie Plätze.<br />
Der Schaffner kehrte zu Hasensemme zurück, fragte ihn nach der Fahrkarte und sagte: "Kerle, wenn du en Ulm<br />
bischt, ben i froh ! Was duasch iberhaubt en dr zwoate Klass mit daira Vierte-Klass-Fahrkart? Schdrafa ka mr ja<br />
so an Depp net. Jetz bleibsch liega, bis i de hol !"<br />
Hasensemme schmunzelte bei den Worten des Schaffners in sich hinein. Nun hatte er erreicht, was er erreichen<br />
wollte. Er fuhr um billiges Geld in der zweiten Klasse. Als ihn der Schaffner in Ulm an die Bahnsteigsperre<br />
geleitete, begegneten ihnen die beiden Frauen. Da lachte Hasensemme, steckte die Brille in die Tasche und rief<br />
laut: "So, ihr drei, jetzt ben e wieder reacht!"<br />
Einmal saß der Witzbold im "Lamm" und führte das große Wort. Unter den wenigen auswärtigen Gästen befand<br />
sich ein Metzgermeister, dem er ein Schnippchen schlagen wollte. Als der biedere Metzgermeister den<br />
Anwesenden erzählte, daß er für den kommenden Schlachttag zwei Schweine brauche, drückte der Hasensemme<br />
ein wenig die Äuglein zu, rückte an den Sprecher heran und sagte: "Metzger, i hao zwua Sei, dia kasch hao."<br />
Da der fremde Metzgermeister den ganzen Nachmittag über erfolglos bei einigen Bauern der zwei Schweine<br />
wegen vorgesprochen hatte, war ihm eine günstige Kaufgelegenheit recht, auch weil er wußte, daß der<br />
Hasensemme ein tüchtiger Schweinezüchter war. Hasensemme fuhr fort: "Du kriagsch meine zwua Sei om<br />
billichs Geld, i hao se jetzt anderthalb Johr, se senn allerdengs no net arg g´rata; manchmol moan e, se seied<br />
gleich blieba. Aber, wia gsait, billich senn se."<br />
Da der Metzgermeister wegen des unglaublich niederen Preises der Schweine, über den die Anwesenden nicht<br />
schlecht staunten, auf den Handel sehr erpicht war, ging er ohne weiteres darauf ein. Weil er Angst hatte,<br />
Hasensemme könne den Verkauf rückgängig machen, griff er sofort, nachdem das Abholen vereinbart war, nach<br />
der Geldtasche und zahlte die geforderten Silberstücke auf den Tisch. Da jedoch Hasensemme keinerlei Miene<br />
machte, sie einzustecken, sagte der Metzgermeister: "Wia! Lang doch zua!" Nun konnte der Semme seine<br />
Spitzbüberei nicht mehr länger für sich behalten. Er, gab die Silberstücke dem verdutzt dreinschauenden<br />
Metzgermeister zurück, kniff die verschmitzten Äuglein ein wenig zusammen und sagte: "B´hald dei Geld! I ka<br />
dr koane Sei gäa. I hao gar koane. Dia zwua, wo i moa, des senn zwua ausgschniddene aus em Kalender. Dia<br />
wuurschd om dees Geld net wella!" Der hereingefallene Metzgermeister sei fortan, auf den Hasensemme böse<br />
gewesen und habe sich auf keine Unterhaltung mehr mit ihm eingelassen.<br />
Einmal wollte Hasensemme einen Ballen Zwillich auf dem Calwer Markt verkaufen. Obwohl die Leute sich<br />
haufenweise um seinen Stand scharten, um seinen Späßen zuzuhören, wurde er seine Ware nicht los. So machte<br />
Hasensemme nach einiger Zeit den "Laden" dicht und schickte die zahlreichen Zuschauer nach Hause. Dann<br />
nahm er den Ballen Zwillich unter den Arm, trug ihn ins "Rößle" und genehmigte sich trotz des Mißerfolges ein<br />
paar Schoppen und ein kräftiges Vesper. Zum Schluß wollte er noch einen Rundgang durch die vielen<br />
Kramstände und Schaubuden auf dem Marktplatz machen und deponierte seinen Stoff im "Rößle". Er schlenderte<br />
müßig herum, blieb dabei da und dort vor den Buden stehen und gab seine Meinung über die angepriesenen<br />
Waren in launigen Worten kund.<br />
Der Bauer B. von G., der den Markt ebenfalls mit einem Ballen Zwillich besucht und den gleichen Mißerfolg<br />
beim Verkauf aufzuweisen hatte, fragte den Hasensemme, als er ihn so frohgestimmt daherkommen sah, ob er<br />
seinen Zwillich schon verkauft habe. Weil Hasensemme schon lange danach trachtete, dem B., den er nicht leiden<br />
konnte, einen Bären aufzubinden, dachte er, die Gelegenheit dazu sei jetzt günstig. Er trat ganz nahe an den<br />
Bauern heran und flüsterte ihm leise ins Ohr: "Was i dir jetzt sag, derfscht näamerd saga, verschtanda! Em<br />
Calwer Rathaus droba, em Zemmer Nommer 8, kaufet se Zwillich zua Soldadasäggle. Deane hao i mein ao<br />
verkauft. I hao`s onder dr Hand erfahra. Wenn de schnell machschd, kaschd dein no laoskriaga." Über das Antlitz<br />
von B. huschte bei diesen Worten ein freudiges Lächeln. Er nahm den Zwillichballen möglichst unauffällig unter<br />
den Arm und ging weg, in Gedanken bereits im Besitz klingender Silberstücke. Während der Hasensemme sich<br />
auf und davon machte, suchte der Bauer im Rathaus das Zimmer Nummer 8. Nachdem der Ratschreiber und<br />
seine Gehilfen sich am Ansinnen des Bauern ausgiebig ergötzt hatten, soll, wie der Ratschreiber nachher erzählte,<br />
B. heimlich durch eine Hintertür aus dem Rathaus entwichen sein.<br />
An einem Sonntagnachmittag saß der Hasensemme im "Hirsch", kniff die verschmitzten Äuglein zusammen,<br />
lobte den Wein über die Maßen und unterhielt die vielen auswärtigen Gäste, die das schöne Wetter zu einem<br />
Spaziergang nach Gechingen genutzt hatten, auf das vortrefflichste. Nachdem verschiedene Dinge ausgiebig und<br />
215
eifrig besprochen worden waren, lenkte Hasensemme, weil er ein leidenschaftlicher Jäger war, das Gespräch auf<br />
die Jagd und sagte, prächtigere Hasen als hier könne es weit und breit nicht geben. Die fremden Bauern<br />
widersprachen energisch. Da sich der Hasensemme jedoch auf seine Meinung versteifte und sich sogar zu der<br />
kühnen Behauptung verstieg, die Hasen seiner Heimatgemeinde seien so liebe Tiere, daß er jedes von ihnen auf<br />
dem Wägele führen könne, kannte die Heiterkeit der Anwesenden keine Grenzen, ja, einige Bauern glaubten, der<br />
Wein habe seine Sinne so verwirrt, daß er, wie man im Volksmund sagt, geistweise daherredete. Dies war, weil<br />
Hasensemme erst zwei Viertele getrunken hatte, durchaus nicht der Fall.<br />
"Was i sag, isch wahr, i mach a Wett, en de nächste Däg setz i an Has uff mai Baurawägele nuff on zeig uich de<br />
Kerle. Was gilt´s? I wett a Goldstückle", rief der Hasensemme, als sich das Gelächter über die lose Behauptung<br />
einigermaßen gelegt hatte. Mit der Wette und ihrer Höhe waren die Fremden einverstanden, weil sie der festen<br />
Überzeugung waren, der Prahlhans, wie sie Hasensemme nannten, müsse verlieren. Nachdem die Wette sogleich<br />
schriftlich niedergelegt und vor sämtlichen anwesenden Bauern unterzeichnet worden war, tischte Hasensemme<br />
ein paar Witze auf, bezahlte seine Zeche und ging bedächtigen Schrittes nach Hause.<br />
An einem der darauf folgenden Tage hängte sich der Hasensemme das Jagdgewehr um und schoß einen alten<br />
Feldhasen. Er bettete ihn auf ein Bündel Stroh, band ihm einen rosaroten Bändel um den Hals, legte ihn in das<br />
Bernerwägele, spannte den Hans ein und zeigte den Hasen reihum bei den Wetteilnehmern. Da in dem schriftlich<br />
niedergelegten "Vertrag" nicht zu lesen war, daß der Witzbold die Wette mit einem toten Hasen verliere, mußten<br />
die auswärtigen Bauern, zehn an der Zahl, mit den Goldstücken herausrücken.<br />
'S Rickele erzählt aus ihrer Jugendzeit:<br />
"Als ich noch in die Schule ging - ich war ein bildsauberes Mädle - liefen mir einige Klassenkameraden immer<br />
hinterher. Einer davon hatte mich besonders gern und wollte mir eine Tafel Schokolade schenken. Das war<br />
damals etwas ganz Besonderes und Wertvolles. Da er nicht den Mut hatte, mir die Schokolade direkt in die Hand<br />
zu geben, steckte er sie in meinen Schulranzen. Als ich sie dort fand, gab ich sie ihm wieder zurück, weil ich so<br />
ein teures Geschenk nicht annehmen konnte. Mein Schulkamerad nahm die Schokolade zwar wieder an, aber auf<br />
dem Heimweg bekam ich von ihm aus lauter Enttäuschung über die Zurückweisung eine Tracht Prügel.<br />
Meine Ahne ist einmal nach Calw auf den Markt gegangen, um Eier zu verkaufen, natürlich zu Fuß, denn<br />
Postomnibusse fuhren damals noch nicht. Als sie den Heimweg antrat, verspürte sie ein menschliches Bedürfnis.<br />
"I bronz net en Calw, sondern uf mein Acker z' Gechenga", sagte sie zu sich selber. Der Drang wurde aber immer<br />
stärker, trotzdem schaffte sie es noch bis zur Markungsgrenze. Dann aber pressierte es arg und sie verschaffte<br />
sich Erleichterung. Wie groß war ihre Enttäuschung, als sie später feststellte, daß sie in der Eile nicht den<br />
eigenen, sondern den Nachbaracker bedacht hatte!<br />
Zum Polterabend hatten meine Schulkameraden ein großes, verpacktes Geschenk mitgebracht. Nach dem<br />
Auspacken stellten wir fest, daß es ein schöner Nachttopf mit roten Würsten und Senf gefüllt war. Es hat aber<br />
allen geschmeckt, als wir den Topf später zusammen geleert haben.<br />
Meine Freundin kam nach der Schule als Dienstmädchen nach Stuttgart, wo sie auch ihren späteren Mann<br />
kennenlernte. Als sie wieder auf Besuch nach Gechingen kam, erzählte sie voll Stolz: "I heirad koan vo<br />
Deitschland, sondern vo Hoalohe!" Kaum hatte ich mich von meinem Staunen erholt, erzählte sie schon weiter:<br />
"Der isch koa Gwöhnlicher, der had europäische Schuah a !" Erst nach längerer Befragung wurde mir klar, daß<br />
meine Freundin "orthopädische Schuhe" gemeint hatte.<br />
Meine Urahne erzählte mir folgende Geschichte:<br />
Am Tag nach ihrer Hochzeit gingen sie und ihr Mann zum Mähen auf den Acker. Mittags lief sie schnell nach<br />
Hause, um das Essen zu kochen. Es war das erste Mal, daß sie für ihren Mann kochte und sie wußte vor lauter<br />
Aufregung nicht, was sie ihm Gutes machen sollte. Da fiel ihr etwas ein, das sie selber gerne aß:<br />
Schwedenknöpfle (Siehe: "Kochen und Backen"). Voll Freude kehrte sie zu ihrem Christian auf das Feld zurück<br />
und stellte ihm die Schwedenknöpfle zum Essen hin. Christian nahm den Topfdeckel ab, schaute hinein und sagte<br />
zu seiner jungen Frau: "Siehsch, Rickele, so schmeißd der Maurer de Schbeis (Mörtel) an d' Wad !" Mit<br />
Schwung landeten die liebevoll zubereiteten Schwedenknöpfle auf dem Acker. Da wäre sie am liebsten gleich<br />
wieder zu ihrer Mutter nach Dachtel zurückgelaufen.<br />
Der Nachbar hatte wegen einer Kleinigkeit mit seinem Sohn Streit bekommen, und sie sprachen an diesem Tag<br />
kein Wort mehr miteinander. Weil aber Gülle geführt werden mußte richtete der Vater das Faß und der Sohn<br />
spannte vier Kühe an.. Als sie endlich mit viel "Hü" und "Hott" auf dem Acker angelangt waren und den Hahn<br />
am Güllefaß aufdrehten, merkten sie, daß das Faß leer war. Jeder hatte vom anderen gedacht, er hätte die Gülle<br />
eingefüllt.<br />
216
Der Salomo war ein witziger, heller Kopf und verblüffte die Lehrer und den Pfarrer oft mit seinen Bemerkungen.<br />
Der Pfarrer wollte es nun genau wissen, wo der Salomo seine Gescheitheit her habe und fragte ihn, ob er auch<br />
fleißig lese. "O ja", nickte der alte Salomo. Der Pfarrer forschte nach: "Ja, was leset Ihr denn ?" - "Erbsen und<br />
Linsen, Herr Pfarrer !" war die lachende Antwort des Alten.<br />
Schultheiß und Pfarrer waren an einem Sonntag mit der Kutsche auf dem Weg nach Deckenpfronn, als sie an<br />
einem Acker vorbeikamen, auf dem der Maier-Adam arbeitete. Der Pfarrer ließ die Kutsche anhalten und rief<br />
ihm zu: "Du sollst den Feiertag heiligen!" Der Maier-Adam, bekannt durch seine Schlagfertigkeit, schrie zurück:<br />
"En dr Bibel schdaht ao: Gehet hin in alle Welt! - on net "Fahret on versaufet ´s Geld!"<br />
Der Frieder war einem guten Schluck nicht abgeneigt und auch der Herr Pfarrer war kein Kostverächter. Einmal<br />
gingen sie zusammen nachts nach Hause und vor seinem Haus sagte der Frieder recht laut: "Also, gut Nacht, Herr<br />
Pfarrer!". Das hörte das Mariele, Frieders Frau, und sie getraute sich nicht mehr, mit dem Frieder zu schelten,<br />
weil doch der Herr Pfarrer auch so spät heimging. Der Frieder merkte sich dies natürlich für die Zukunft und<br />
sagte von da ab jedes Mal, wenn es wieder spät geworden war, vor der Haustür recht laut: "Also, gut Nacht, Herr<br />
Pfarrer!"<br />
Als der Jakoble und seine Lisbeth einmal in der Erntezeit auf dem Feld waren, hörten sie die Nachbarn von<br />
einem andern Feld rufen: "Es brennt, es brennt !" Darauf sagte Lisbeth ängstlich zu ihrem Mann: "Hotz, des wurd<br />
doch net oser Heisle sai !" Der Jakoble beruhigte sie: "Schwätz doch koan Babb, bei os ka 's net brenna, i hao ja<br />
de Schlissel em Sack!"<br />
Als mein Vetter Karle zum ersten Mal bei den Eltern seiner Braut war, fragte ich ihn nachher, wie es denn<br />
gewesen sei. "O," sagte der Karle, "i be scho ganz oaga mit meim Schwäher (Schwiegervater). Wia mr an da<br />
Tisch naghoggd senn, had er gsaid, "Friß, du Daggel!"<br />
Die neu eingeheiratete Schwiegertochter meiner Nachbarin kochte zum ersten Mal das Essen und brachte die<br />
Suppe in einer schönen, blauen Schüssel auf den Tisch. Die am Tisch Sitzenden schauten sie mit großen Augen<br />
an. Sie merkte, daß etwas nicht in 0rdnung war und fragte: "Was isch, hao i nix Reachds kocht ?" "Doch, des<br />
schao, aber en dere Schüssel wäschd d' Ahna emmer ihre Fiaß !"<br />
Die alte Ahne war schon nicht mehr ganz richtig im Kopf, versorgte aber ihren kleinen Haushalt noch selber.<br />
Unter der Kellertreppe hatte sie ihren Milchtopf stehen, und als sie eines Morgen nach der gestandenen Milch<br />
sah, schwamm eine Maus darin. Sie nahm sie heraus und sagte streng: "Aagschleckt wursch, on wenn d´ no so<br />
zappelsch!"<br />
Der Ludwig war bekanntlich ein ruhiger, schweigsamer Mensch. Als es ans Heiraten ging, machte er sich auf den<br />
Weg zu seinem zukünftigen Schwiegervater, um alles zu besprechen. In der Stube setzten sich die beiden<br />
zusammen, und der Brautvater wartete, was der Ludwig zu sagen habe. Doch der schwieg und schwieg und um<br />
ihm zu helfen, sagte endlich der Vater: "Ihr werdet heirade wella? " "Jo", lautete die knappe Antwort. Es folgte<br />
wieder langes Schweigen. Der Vater unterbrach die Stille mit den Worten: "Ihr werdet miassa !" - "Jo", sagte der<br />
Ludwig erleichtert und verschwand.<br />
Als 1922 das Kriegerdenkmal, das auf einem Sockel einen sterbenden Hirsch zeigt, aufgestellt und eingeweiht<br />
wurde, fragte der Pfarrer ein altes Weible, das dabeistand, ob sie wohl wisse, was denn das Denkmal bedeuten<br />
solle. "Hei jo, Herr Pfarrer, weil osre Soldate gschbronga senn wia d' Hirsch", lautete die Antwort.<br />
Der Karle war im ersten Weltkrieg als Soldat in Frankreich. Eines Tages ging er in ein Haus und wollte von der<br />
Bäuerin Käse haben. "Käs, Käs!" rief der Karle immer wieder. Aber die Bäuerin verstand ihn nicht, so daß er in<br />
Zorn geriet und schrie: "Leck me em Arsch!" Da glitt ein Lächeln des Verstehens über das Gesicht der Französin:<br />
"Ah, Fromage", sagte sie und gab ihm den gewünschten Käse.<br />
Auch in Gechingen zog um die Jahrhundertwende das technische Zeitalter herauf. Anfangs hatten die Bewohner<br />
einige Probleme mit den Neuerungen. Als zum Beispiel 1906 in unserer Gemeinde die Wasserleitung verlegt<br />
wurde, wollte der Frieder, der auf dem Hohen Angel wohnte, nicht glauben, daß das Wasser "de Berg nuff gao<br />
ka". So ließ er den Wasserhahn in der Küche offen. Eine Überschwemmung in Küche und Wohnstube war die<br />
Folge. Nicht viel besser erging es seiner Nachbarin. In der Nacht bekam diese Durst, drehte in der Küche den<br />
Wasserhahn auf und brachte ihn dann nicht mehr zu. Der Heimatdichter Johannes Böttinger berichtete in Versen<br />
über diese Begebenheit: "Se schreit on lärmt;/ aus seiner Ruah/ muaß se ihrn arma Maa no brenga,/ em Hemmed<br />
däan äll zwoa romschbrenga . . "<br />
217
Daß die Gänse einst Roms Kapitol durch ihr Geschrei gerettet haben, ist allgemein bekannt, daß sie auch den<br />
Sonntagsgottesdienst stören können, erlebten die <strong>Gechinger</strong> im Dezember 1894. Damals gab es als großartige<br />
technische Errungenschaft ein batteriebetriebenes Telefon zwischen dem Rathaus und dem Schultheißenhaus<br />
sowie ein Läutwerk am Rathaus. Dieses elektrische Läutwerk ertönte plötzlich während des<br />
Vormittagsgottesdienstes, als fast das ganze Dorf in der Kirche war. Eine Anzahl Gänse hatte sich in die Luft<br />
erhoben und wollte mit raschem Flügelschlag an Kirche, Rathaus und Schulhaus vorbei, um zum Ursprung der<br />
Irm zu fliegen. Doch zwischen diesen Gebäuden waren sechs Drähte für Läutwerk und Telefon sowie die Kette<br />
der Straßenlaterne gespannt. Diese Hindernisse suchten nun die Gänse im kühnen Schwung zu nehmen, aber das<br />
Drahtgewirr kam dabei in heftige Schwingungen und zwei Drähte verschlangen sich so, daß das Läutwerk im<br />
Rathaus nicht mehr aufhörte, zu läuten. Der Pfarrer mußte seine Predigt unterbrechen und mit ein paar beherzten<br />
Männern die Drähte entwirren, damit der Gottesdienst weitergehen konnte. Den Gänsen ist außer einigen<br />
ausgerupften Federn nichts geschehen.<br />
Als es im Jahr 1910 auch bei uns in Gechingen elektrischen Strom geben sollte, beriet der Gemeinderat das Für<br />
und Wider dieser Neueinrichtung. Zuletzt wurden sich dann alle einig, nur, wo sollte der Transformator<br />
hinkommen ? Da meldete sich der Ludwig und meinte: "I hao no a Bedd frei, der ka bei mir loschiera!"<br />
Auf dem Rathaus war ein junger Schreiber eingestellt worden, der immer geschniegelt und gebügelt daherkam<br />
und bald zum Schwarm der jungen Mädchen wurde. Das war Anlaß für unseren Heimatdichter Böttinger, einige<br />
Verse zu verfassen, in denen er sich weidlich über den Schönling und die Mädchen, die sich so leicht von ihm<br />
betören ließen, lustig machte. Aber die Herrlichkeit dauerte nicht lange, denn um seine Liebesabenteuer zu<br />
finanzieren, borgte sich der Schreiber da und dort Geld aus. Als ihm keiner mehr was leihen wollte, nahm er die<br />
Gemeindekasse und versteckte sich im Stroh einer Scheuer auf dem Geißbiegel. Dort wollte er die Nacht<br />
abwarten und dann verschwinden. Zufällig sollte ein Junge aus dieser Scheuer Stroh holen. Als er ein Büschel<br />
herauszog, streckte sich ihm ein Paar Männerfüße entgegen. Er erschrak nicht schlecht und schrie, worauf alle<br />
Leute vom Geißbiegel herbeirannten. Sie verfolgten den davoneilenden Schreiber. Der aber konnte den Wald<br />
erreichen und entkommen. Später hat ihn dann die Polizei festgenommen. Für die verlassenen Mädchen hatte der<br />
Dichter auch gleich einen Spottvers bereit: "Ist doch heut der Herr Schreiber fort, /ganz unerwartet schnelle,/<br />
ohne nur ein Abschiedswort/ seinen Liebchen zu bestellen./ Wie wird da weinen manches Mädchen klein . . "/<br />
Mein Schwiegervater, der Frieder, war ein gutmütiger Mann, der mit einer eifrigen und schaffigen Frau<br />
verheiratet war. Auch die Töchter schlugen ihrer Mutter nach. In der Erntezeit beim Beladen des Garbenwagens<br />
war der Frieder oben und setzte die Garben reihenweise auf. Die Frauen deckten ihn so ein, daß er nicht mehr<br />
nachkam und sich kaum mehr zu helfen wußte. Er sprang vom Wagen herunter und auf die Frage seiner Frau<br />
"Was isch, wo willsch denn na ?" sagte er nur: "Ao no gabla !"<br />
Als er älter wurde und seine Enkel ins heiratsfähige Alter kamen, war der Alte über die zukünftigen Frauen der<br />
Enkel sehr enttäuscht. Er meinte: "Dia brenged Menscher mit, dia fressed bloß Banana on Schogglad !"<br />
Auch vom Gottlob läßt sich so manches Schwänklein berichten. Er liebte den Most sehr und trank öfters mal<br />
einen über den Durst. Seine Frau versuchte das mit allen Mitteln zu verhindern und versteckte deshalb oft den<br />
Kellerschlüssel. Doch der Gottlob wußte Rat. Heimlich füllte er die Bettflasche jeden Abend mit Most, so hatte<br />
er seinen Trank immer griffbereit.<br />
Als er den Geometern beim Marksteinsetzen helfen mußte, kam er auf eine Idee, um sich das nötige Kleingeld<br />
zum Trinken zu beschaffen. Nach Fertigstellung der Arbeiten meldete er sich in Calw beim Amt und sagte: "Ein<br />
Geometer hat meine Schippe mitgenommen und die kostet 5 Mark." Der Amtsvorstand glaubte ihm, bezahlte,<br />
und Gottlob machte sich wieder auf den Heimweg. Sein erster Weg führte in die Molkerei, wo er sich auf seine<br />
Milchlieferung weitere 5 Mark Vorschuß geben ließ. Dann ging er in den Laden, kaufte sich eine neue Schippe<br />
und sagte zum Verkäufer: "Schreib 's uff, mei Alte zahlt 's!" Diese war auch eine große Schafferin, sie war sehr<br />
fleißig und trieb ihren Mann oft an, er solle dies und das noch machen. Eines Tages wurde es dem Gottlob zu<br />
bunt, und er sagte zu ihr: "Ja, bei Nacht soll e siebezich und bei Tag dreißich sei!"<br />
Der Gottlob fuhr mit dem vollgeladenen Mistwagen die Schafgasse hoch. Plötzlich blieb eine seiner Kühe stehen,<br />
und bald darauf natürlich auch die zweite. Der Gottlob schimpfte, schrie "Hü" und "Hott", doch die Kühe rührten<br />
sich nicht. Er nahm die Peitsche und traf zufällig die eine Kuh leicht am Auge, worauf diese damit zuckte. "Du<br />
brauchsch dr andre gar net zuablenzla, daß se au ned ziaga soll !" schrie da der Gottlob aufgebracht.<br />
Der Gottlob saß im "Hirsch" beim wohlverdienten Vesper, Schwartenmagen und eine große Portion Senf.<br />
Zufällig kam ein Ehepaar aus Hannover in die Gaststube. Die beiden schauten neugierig auf Gottlobs Vesper und<br />
schließlich fragte der Mann: "Guter Mann, was essen Sie denn da?"-"Schwaartamaga on Senf", gab Gottlob<br />
freundlich Auskunft. Das Ehepaar konnte damit nichts anfangen, der Mann fragte trotz dem weiter: "Ja, schmeckt<br />
218
denn das?"-"Dees isch besser als an Arsch voll Schpreißa!" war die Antwort. "Ja, wir sind Preußen", erwiderte<br />
die Frau, die kein Wort verstanden hatte.<br />
Der Maurer Ferdinand war ein flinker und fleißiger Arbeiter, bekannt waren auch seine turnerischen Fähigkeiten,<br />
wenn er auf dem Dach arbeitete. Hatte er zum Beispiel einen Kamin von außen zu verputzen, bastelte er sich<br />
schnell mit zwei Balken und einem Brett ein sogenanntes "Fluggerüst", auf dem er dann unbesorgt seiner Arbeit<br />
nachging.<br />
Eines Tages ging der Herr Pfarrer an dem Haus vorüber, auf dem der "Ferde" mit seinem Fluggerüst bei der<br />
Arbeit war. "Paß Er auf, daß Ihm nicht schwindelig wird!" rief der besorgte Pfarrer hinauf. "O Herr Pfarrer, i be<br />
no nia a Schwendler gwäa!" gab der Ferde lachend zurück.<br />
Nach der Heuernte sagte der Nachbar zu einem Bauern: "Dei Hai hot aber koa scheene Farb, dees isch jo ganz<br />
gäa!l" - "Was du net saisch! Wäga dr Farb henn meine Kiah no nia gschria, bloß nach no mai."<br />
Früher, als es noch nicht in jedem Haus ein Bad gab, war es üblich, in der Bäckerei Rex an der Hauptstraße zu<br />
baden. Der Bäcker hatte extra ein Badezimmer eingerichtet und durch den großen Backofen stand meistens<br />
genügend heißes Wasser zur Verfügung. Als eines Tages spät am Abend noch zwei Männer kamen, um zu baden,<br />
reichte das Wasser aber nur noch für einen. Die beiden fingen an zu streiten, wer nun baden dürfe. Das Nanele,<br />
das am warmen Ofen saß, hörte sich den Streit eine Weile mit an, dann sagte sie: "I woaß gar net, was ihr hent!<br />
Jetz ben i schao siebezich Jahr alt on hao no nia badet on leb emmer no."<br />
Eine gut erfundene Geschichte erzählt man sich über einen Ochsenbauern aus unserem Ort. Der pflügte eines<br />
schönen Tages mit seinen beiden Ochsen. Nachmittags um vier Uhr blieb einer der Ochsen plötzlich stehen und<br />
war auch durch Schreien und Peitschenhiebe nicht mehr zum Weitermachen zu bewegen Zuletzt schrie der<br />
Bauer: "I mecht bloß wissa, was mit dem los isch"! - "Ha",sagte da der Ochse, "i be en dr Gwerkschaft on jetz<br />
isch Feierobed." Dem Bauern blieb nichts anderes übrig, als den Ochsen auszuspannen und mit dem anderen<br />
allein weiter zu pflügen, während der erste nach Hause trottete und im Stall sein Heu fraß. Als es dunkel wurde,<br />
zogen Bauer und Ochse auch nach Hause und als der zweite Ochse in den Stall kam, fragte der erste: "Was hot er<br />
jetz da drzua gsaid?" - "Nix," kam die Antwort, "aber uff em Hoamweag isch er beim Metzger vorbei".<br />
Von unserer Hebamme Emma Wurster, kursieren auch viele Geschichten. Als sie einmal nach Althengstett<br />
gerufen wurde, kaufte sie anschließend bei einem Bauern ein Ferkel. Aber wie sollte sie das Tier nach Gechingen<br />
bringen? Kurzentschlossen entlehnte sie bei einer Bekannten den Kinderwagen, packte das Ferkel hinein und<br />
deckte es zu. Dann machte sie sich auf den Heimweg. Unterwegs traf sie ein altes Weiblein, das unbedingt das<br />
"Kendle" sehen wollte. Sie nahm an, es sei das letzte Neugeborene aus Hengstett. "Dees sieht aber ganz seim<br />
Vadder gleich", lobte die Alte. Unsere Hebamme machte keinen Versuch, den Irrtum aufzuklären und schob den<br />
Kinderwagen weiter.<br />
Zusammen mit ihrer Schwester hielt sie ein paar Geißen. Da es im Laufe der Zeit in unserem Ort keinen Bock<br />
mehr gab, führte sie ihre Geiß in einem alten Kinderwagen nach Althengstett, später auch nach Stammheim oder<br />
Aidlingen zum Bock. Doch auch dort verschwanden mit der Geißenhaltung die Böcke, nur in Dagersheim war<br />
noch einer zu finden. Unsere Hebamme packte resolut zu gegebener Zeit die Geiß in den Seitenwagen des<br />
Motorrades eines freundlichen Helfers, setzte sich auf den Rücksitz, und los ging die Fahrt!<br />
Schon in ihrer Jugendzeit hatten Emma und ihr Bruder eine, wie man in Gechingen sagt, "süße Gosch", das heißt,<br />
beide waren auf Süßigkeiten versessen. In der Frühe tranken sie ihren Kaffee getrennt, damit der andere nicht<br />
sehen sollte, wieviel Zucker jedes nahm. Um zu verhindern, daß eines von ihnen zuviel Zucker nehme, drohten<br />
sie sich gegenseitig: "Wenn des dr Vaddr sieht, wieviel du nemmsch, no geit´s Krach!"<br />
Später, als ihr Bruder einen eigenen Hausstand gründete, hatte dessen Frau ihre liebe Not damit, die Ausstecherle<br />
und Gutsle zu verstecken, sonst hätte er alle vor Weihnachten aufgegessen. Meistens fand er die Brötle, aber<br />
einmal hatte seine Frau sie so gut versteckt, daß er sie trotz eifrigen Suchens nicht finden konnte. Als seine Frau<br />
nicht zu Hause war, nahm er sich Zeit und durchstöberte das ganze Haus, wobei er das Gesuchte dann auch<br />
tatsächlich fand. Voller Grimm, daß er solange hatte suchen müssen, verschlang er Brötle um Brötle, bis er nicht<br />
mehr konnte, den Rest warf er den Kühen in den Trog! Als seine Frau zu Weihnachten die versteckten Brötle<br />
holen wollte, gab es lange Gesichter.<br />
1945 - 46 führten die Franzosen beim "doppelten Wald" große Holzeinschläge, die sogenannten<br />
"Franzosenschläge" durch. Dabei wurde das Holz über Frieders Acker abgefahren, der dementsprechend aussah.<br />
Der Frieder beschwerte sich deshalb beim elsässischen Kommandanten. Der sagte zu ihm: "Du kannst dir dafür<br />
einen Festmeter Holz im Wald aufladen." Das ließ sich der Frieder nicht zweimal sagen, lief so schnell er konnte<br />
zu seinem Nachbarn, der ein Holzfuhrwerk besaß und fuhr mit diesem gleich los. Zusammen beluden sie das<br />
219
Fuhrwerk mit Stämmen von 15-20 Meter Länge, aber so, daß der Querschnitt aller Stämme zusammen nicht mehr<br />
als ein Meter im Quadrat betrug. Zufällig kam der Kommandant dazu und fragte verwundert, was das solle, das<br />
sei doch kein Festmeter. "Doch," sagte der Frieder verschmitzt, "das ist ein deutscher Festmeter". Ob dieser<br />
Frechheit verschlug es dem Kommandanten die Sprache, und er ließ den Frieder mit seinem voll beladenen<br />
Fuhrwerk abziehen.<br />
Etwa in der gleichen Zeit wollte der Frieder ein nicht gemeldetes Schwein "schwarz" schlachten. Das mußte<br />
natürlich heimlich geschehen, am besten in der Scheuer bei geschlossener Tür, dachte der Frieder. Er band das<br />
Schwein mit dem Fuß an der Putzmühle fest und holte die große Axt, um der Sau aufs Hirn zu schlagen. Die aber<br />
zuckte zurück und versteckte sich hinter der Putzmühle. "Gahsch her, du Luader!" schrie der Frieder voll Wut<br />
und zerrte das Schwein am Strick wieder vor. Dann holte er mächtig aus und traf mit einem gewaltigen Hieb die<br />
Putzmühle, die mit lautem Krachen in sich zusammensank. Die Sau aber rannte befreit davon. Mit dem<br />
heimlichen Schlachten war es an diesem Tage aus.<br />
Bei einem Jahrgangstreffen der älteren Generation sollten sich alle zu einem Foto aufstellen. Es gab ein kleines<br />
Gedränge, denn keines wollte sich in die erste Reihe stellen. Da sagte der Ludwig zu einer Schulkameradin, die<br />
aus der Stadt gekommen war: "Gang du no vorna na, du schtellsch am meischta vor, mir andere säahn älle so<br />
aa´gschossa aus."<br />
Der als Totengräber tätige Fritz hatte viel Humor. Im "Adler", seinem Stammlokal, spöttelte ein Ostelsheimer:<br />
"Mi kasch du amol net vergraba, i laß me verbrenna." - "Ha," sagte der Fritz, "des macht nix, no brengsch halt<br />
dei Äscha rii".<br />
Als er eine Kuh auf Kredit kaufen wollte, fragte der Verkäufer nach Sicherheiten. "Hano, dees isch koa Problem,<br />
i han fir daused Mark alte Leit em Ort."<br />
Einen Fehler hatte der Fritz, er machte die Gräber immer zu klein. Bei einem korpulenten Verstorbenen sah er<br />
den Sarg und bemerkte: "Herrgott, brenget dia wieder a Saukischt!" Er wuselte während des Gottesdienstes mit<br />
dem Meterstab in der Hand herum, um Länge und Breite des Sarges auszumessen. Obwohl er an der Grube<br />
nachbesserte, verkeilte sich der Sarg beim Hinablassen und die Lage ließ sich nur dadurch retten, daß der Fritz<br />
beherzt auf den Sarg sprang.<br />
Als ein Mitglied des Stammtisches starb, erwiesen die Kameraden ihm die letzte Ehre. Einer nahm ein Stück<br />
Leberkäs mit und warf es statt Blumen ins Grab. Sein Freund, der Blumen dabei hatte, fragte ihn nachher:<br />
"Worom hasch dees dao? Der ka doch nix mai essa!" - "Ha, deine Bluma ka er ao nemme en a Vas neido!"<br />
Unsere Gretl verkaufte in ihrem Lädle alles mögliche, unter anderem auch Sterbehemden. "Dees da koschd<br />
feifazwanzich Mark on dees fuffzich."-"Jo, wo isch denn do dr Onderschied?" will die Kundin wissen. "Dees om<br />
fuffzich Mark isch biglfrei".<br />
Zu verstehen ist auch die Klage einer Frau, die zum ersten Mal bei einer Urnenbestattung dabei war. Zu Hause<br />
meinte sie entäuscht: "So schnell kasch gar net heila, wia da vergraba wuurscht!".<br />
Als der Karle seine Frau wegen eines Schlaganfalls ins Krankenhaus hatte einliefern müssen, erkundigte sich die<br />
Nachbarin nach deren Befinden. "Wie gaht`s denn deiner Frau?" Der Karle antwortete: "Noamal so, on se legt d´<br />
Aohra nom."<br />
Das Haus Maier in der Gartenstraße hatte als erstes Haus in Gechingen einen Balkon, der natürlich Aufsehen<br />
erregte. Der Besitzer hieß deshalb "Veranda-Maier". Eines Tages ging eine Mutter mit ihrem Jüngsten dort<br />
vorbei. Der fragte: "Du, Muadr, worom hen mir net ao so a graoß Hafabritt?"<br />
Des Annameile had en Suddakruag (Sutte(r)krug = langer, enghalsiger, irdener Krug) ghet, so oan, wo mr friher<br />
de Mooschd mid uffs Feld g´nomma hot. Se hot en aber fir an andra Zweck brauchd. Bei dr Naachd, wenn se älls<br />
hat miassa, no hat se en sella Kruag neibronzt, ohne daß oa Tropfa daneba ganga isch, so guad hot se ziela kenna.<br />
Da isch se ao obache schdolz druff gwäa!<br />
Bei einer Hochzeit im "Adler" durfte auch der kleine Karle mit. Schon bald wollte er eine Bratwurst haben, aber<br />
seine Mutter vertröstete ihn auf später. Das ging so eine ganze Weile hin und her, bis dem Karle der<br />
Geduldsfaden riß und er schrie: "Wenn de jetz koa Bradwuurschd kaufsch, no scheiß e grad en d' Hos"!<br />
Der Lammwirt hatte einen Knecht eingestellt, der von auswärts kam und dadurch einige Schwierigkeiten mit dem<br />
Schwäbischen hatte. Umgekehrt verstanden auch die Pferde des Wirts die Zurufe des Knechtes nicht und so kam<br />
220
es zu mancherlei Mißverständnissen. Das regte den Lammwirt auf. Er wollte seinen Knecht ganz schnell<br />
aufklären und schrie: "Narr, hischt isch hott on lenks isch reachts!"<br />
Im "Adler" brüstet sich der Christian: "I rauch emmer em Stall mai Pfeif, des laß i mir net vom Landjäger<br />
verbiata!" Der aber sitzt still in einer Ecke und denkt sich: "Den werd i scho kriaga!" Als der Christian heimgeht,<br />
folgt ihm der Landjäger verstohlen. Christian geht mit der brennenden Pfeife tatsächlich nochmal in den Stall, um<br />
nach dem Rechten zu sehen. Er hat aber seinen Verfolger bemerkt und will ihm eins auswischen, macht seine<br />
Pfeife schnell aus und schiebt sie in den Hosensack. Dann nimmt er eine andere Pfeife, füllt sie mit Gülle und<br />
stellt sie auf die Fensterbank. "Hab i di verwischt", stellt der Landjäger den Christian. "Was denn, i rauch doch<br />
gar net, dort liegt mai Pfeif!" Der Beamte greift schnell nach ihr. Über das Ende will ich nicht berichten!<br />
Der Gottfried, ein Mann wie ein Baum und nicht eben redselig, hatte von einer alten Frau einen Acker gekauft.<br />
Als der Handel perfekt war, sagte die Frau zum Gottfried, er müsse aufpassen, der Anrainer an diesen Acker sei<br />
ein Fetz - statt zum Abernten mit einem Rad auf seinem und mit dem andern Rad auf ihrem Acker anzufahren,<br />
wie es unter Nachbarn der Brauch sei, nehme er gern den Weg nur über ihren Acker. Der Gottfried antwortete<br />
lakonisch: "Er duats nemme. I hao-n-em de Ranza verschla."<br />
Der Galoppschuahmächer war einer, der immer pressant war und schnell fertig werden wollte. Einmal wollte er<br />
abends die Säue füttern und hatte in der Küche, wo das Säufutter fertiggemacht wurde, zwei Eimer gefüllt sowie<br />
ein hölzernes Kübele. Er hatte einen Eimer in jeder Hand, das Kübele auf dem Kopf und die Stallaterne zwischen<br />
den Zähnen, als er die Stiege in den Stall hinuntereilte. Auf einmal brach der Boden vom Kübele raus und der<br />
Außenmantel vom Kübele rutschte ihm über den Kopf, so daß er nichts mehr sah, und das Säufutter bekleckerte<br />
ihn von oben bis unten. Er stellte die Eimer ab, drehte um und während er nach der Laterne grabschte und sein<br />
Gesicht freizukriegen versuchte, stob er zurück in die Küche, wo seine Frau gerade die Kinder wusch vor dem<br />
Zubettgehen. Da gackste er unter dem Kübele und dem Säufutter vor: "Weib, mi z'erschta, Weib, mi z'erschta!"<br />
Ein andermal mistete er gerade den Hühnerstall, als der Schütz schellte. Im Stall war ein kleines Schiebetürchen,<br />
durch das die Hennen raus- und reinkonnten. Wie nun der Galoppschuahmächer den Schütz hörte, nahm er sich<br />
nicht die Zeit, nach draußen zu gehen, sondern fuhr hastig mit dem Kopf durch das Hühnertürchen, um ja nichts<br />
zu verpassen. Im gleichen Augenblick kam das Schiebetürchen herunter und klemmte ihn ein. Der Kopf war<br />
draußen und das Türle saß ihm im Genick, so daß er sich nicht mehr befreien konnte. Es dauerte eine ganze Zeit,<br />
bis ihn einer hörte und losmachte.<br />
Einmal ließ er den Boden in seinem Stall neu betonieren. Als der Maurer damit fertig war, riet er ihm, die Stalltür<br />
offen zu lassen, damit der Zement schneller trockne. Er solle aber aufpassen, daß keine Hühner reinkämen,<br />
solange der Boden noch weich sei, es gäbe sonst "Dapper". Also stellte sich der Galoppschuahmächer mit der<br />
Peitsche unter die offene Stalltüre und scheuchte damit die Hühner. Wenn ein Huhn in die Nähe kam, fuchtelte<br />
mit seiner Peitsche und schrie: "Hopp, Alte, gang ane em Schatte!" oder: "Dir will e helfe!" Nach einiger Zeit<br />
bekam er von dieser anstrengenden Arbeit Hunger und Durst und ging zum Vespern. Er nahm an, daß die<br />
Hennen inzwischen auch vor der Peitsche allein Respekt hätten und lehnte sie neben die offene Stalltür. Als er<br />
sich gestärkt hatte und zurückkam, tummelten sich drei Hühner auf dem neuen Betonboden! Da langte er nach<br />
der Peitsche, stürzte hinein in den Stall und vertrieb das unbotmäßige Viehzeug! Etwas weniger eilig wird er<br />
dann nochmal zum Maurer gegangen sein.<br />
Von Paul Maier stammt folgendes Gedicht: "Em Adler dren, am ronda Disch - do sitzt a Haufa Manna. Se<br />
schwätzat iber des on sell - on sonscht no ällerhand. Bloß, wenn se na älls drenga deant - no isch a Weile Ruah -<br />
sonscht aber gaht's em Adler dren - wia uff em Jahrmärkt zua. Mer schwätzt vom Weddr, iber d'Leit - on vo dr<br />
Bolidig - on z'letschta kommed d´Gmeindräd dra, - a jeder Schtick fir Schtick! Bis oaner zu de Baura sait, se<br />
kenned zfrieda sai - mit deam, was des Jahr gwasa sei: - D' Grombira seiat riesagraoß - fascht gar wia<br />
Kenderkepf, - on wenn en des net langa dä - no seied s´ arme Trepf! Do schreit dr Schorsch - mr kennt en ja:<br />
"Dees isch dia Lomberei - graoße, des geid´s haufaweis - bloß kloine net fir d ´Sei!"<br />
Fritzle schaut mit seiner Oma den Festzug an. Nebenbei sieht er auf dem Misthaufen einen Hahn, der gerade eine<br />
Henne besteigt. "Oma, worum sitzt denn der Gockeler uff dui Henna nuff?"-"Hano, daß er da Feschtzug besser<br />
sieht!"<br />
Als es keinen fest angestellten Bleicher mehr gab, legten die Frauen in der Frühe ihre Tücher selbst aus und<br />
holten sie abends wieder ab. Dabei passierte folgende Geschichte: Als Frau Schwarz sich nach einem langen<br />
Arbeitstag abends müde ins Bett legen wollte, fiel ihr voll Schrecken ein, daß das Tuch noch zum Bleichen<br />
auslag. Sie weckte ihre bereits schlafende Tochter: "Schnell, Emma, schdand uff!" Beide liefen in ihren<br />
221
Nachthemden in stockdunkler Nacht den Rumpelweg hoch zum Festplatz und packten ihr Tuch zusammen. Mit<br />
den Bündeln auf dem Kopf machten sie sich auf den Heimweg. Plötzlich hörten sie Schritte und trauten sich<br />
nimmer weiter. Doch auch der nächtliche Wanderer war wie erstarrt stehengeblieben. Dann rannten alle in<br />
gegenseitiger Furcht davon. Einige Tage später konnte man am Stammtisch die Geschichte von zwei Gespenstern<br />
hören. Die beiden Frauen, die es besser wußten, behielten ihr Wissen aber hübsch für sich.<br />
Eine ältere Frau von hier versorgte sich mit den verschiedensten Arzneien und verkaufte sie den Leuten bei<br />
Bedarf. Fehlende Medikamente holte sie zu Fuß aus der Apotheke in Weil der Stadt. Sie unterhielt, was nicht<br />
zulässig war, eine kleine Apotheke und versteckte die Arzneimittel vor den verschiedenen Kontrollen in einem<br />
alten Klavier. So blieb diese "Apotheke" unentdeckt und lange Zeit ein Geheimnis unter den Dorfbewohnern.<br />
Um die Jahrhundertwende wurde zum letztenmal von den <strong>Gechinger</strong> Frauen der "Rosinentag" am 11. März, dem<br />
Namenstag der Rosine, gefeiert. Das "Calwer Wochenblatt" berichtet: "Laut letztwilliger Verfügung einer Rosine<br />
Weller aus dem Jahr 1692 hat ein hiesiger Hausbesitzer jährlich einen Gulden an die Gemeindekasse zu<br />
bezahlen. Sobald die Summe genügend groß, soll jede verheiratete Frau und Wittfrau einen Schoppen Wein<br />
trinken zum Andenken an die Stifterin. Da jetzt aber mehr Frauen am Ort sind als vor 200 Jahren und der Wein<br />
auch viel teurer ist als damals, so erlebt manche Frau dieses seltsame Fest gar nicht, denn volle zweiunddreißig<br />
Jahre hat es gedauert, bis etwas zu verteilen war und dennoch fielen auf jede Frau nur 36 Pfennig."<br />
Backen und Kochen<br />
Wie überall auf dem Lande verwendete man in der Küche möglichst selbst erzeugte Lebensmittel. Traditionell<br />
brachte man hauptsächlich Mehlspeisen auf den Tisch, vor allem Spätzla oder Knöpfla. Gemüse und Salat kamen<br />
im Sommer aus dem Garten, im Winter gab´s vor allem das selbst eingemachte Sauerkraut, auch Wurzelgemüse<br />
und Hülsenfrüchte. Milch, Eier, Schmalz und Rahm rundeten das Nahrungsangebot ab, Fleisch und Wurst gab es<br />
selten. Sonntags vor allem kam ein Stück Fleisch oder Rauchfleisch ins Sauerkraut. Nur wenn frisch geschlachtet<br />
worden war, verzehrte man Fleisch und Wurst in Unmengen. Die Brühe, in der die Würste gekocht worden<br />
waren, die "Metzelsupp", wurde in der Freundschaft ausgetragen, zusammen mit reichlich bemessenen Portionen<br />
von Fleisch, Wurst und Kraut.<br />
Zuerst kannte man nur das Haltbarmachen von Fleisch und Wurst durch Räuchern, später wurden vor allem die<br />
Würste auch durch Eindosen konserviert.<br />
Was früher auf den Tisch kam (ohne Anspruch auf Vollständigkeit!):<br />
Suppen, als Vorsuppen oder Hauptgericht, vor allem abends: Riebelessupp, G´schmälzte Brotsupp, Brennte<br />
Supp, Milchsupp, Nudelsupp, Flädlessupp, Habersupp, Grießsupp, Brennte Grießsupp, Kartoffelsupp,<br />
Einlaufsupp.<br />
Suppeneinlagen: Eierstich, gebackene Suppenklößchen, Grieß- und Markklößchen, Suppennudeln.<br />
Hauptgerichte und Eintöpfe: Kartoffeln und Gemüse, Gestandene Milch mit Kartoffeln aus der Hand oder<br />
eingebrocktem Brot, Sauerkraut mit Spätzla, Eierhaber, Flädla, Maultaschen, Saure Kutteln mit gerösteten<br />
Kartoffeln, Saure Nierla und Spätzla, Wergela (Buabaspitzla) mit Sauerkraut oder auch in der Pfanne mit Ei<br />
abgeröstet, Kartoffelschnitz und Spätzla (Gaisburger Marsch), Linsen mit Spätzla, Saure Kartoffelrädla,<br />
Luckeleskäs (Quark) mit gerösteten Kartoffeln, Ofenschlupfer, Waffeln, Apfelküchla, Pfitzauf. Zu den süßen<br />
Gerichten gab es Kompott, je nach Jahreszeit von frischem Obst oder Dörrobst. Spätzla oder Knöpfla ließen sich<br />
vielseitig abwandeln: Bratwurstknöpfla waren handgeschabte Spätzla mit feingeschnittener, gerauchter Bratwurst<br />
im Teig, entsprechend bereitete man Wurst- und Leberspätzla zu. Auch Kässpätzla waren beliebt. Hefeteig war<br />
die Grundlage für eine ganze Reihe von Gerichten, süß oder gesalzen, die es zum Mittagessen gab, wie<br />
Dampfnudeln (aufgezogen oder im Backofen gebacken) oder Hafeknöpfla (Müllerspeck - Hefeteig über<br />
Sauerkraut als großer Kloß im Dampf gegart). In schwimmendem Fett gebacken wurden Fasnetsküchla und<br />
Pfannabäuschd. Bei letzteren wurde die Teigportionen der Größe der Pfanne entsprechend mit den Händen<br />
ausgezogen. Pfannabäuschd paßten zu Gemüse und auch zu Kompott. Öfters gab es auch Schwedenklöße oder -<br />
knöpfla, für die das Rezept folgen soll: Man bringt 1 l Milch zum Kochen, gibt unter Rühren vier in dünne<br />
Scheiben geschnittene Wecken hinein und soviel Grieß, daß ein sehr fester Brei entsteht, der sich von der Pfanne<br />
löst. Man kann entweder Klöße davon abstechen, abschmälzen und mit Kompott zu Tisch geben oder die etwas<br />
abgekühlte Masse zu einer Rolle formen, in Scheiben schneiden und in einer Kasserole auf beiden Seiten backen.<br />
Dann kommt eine Soße aus mit Rahm verquirlten Eiern darüber, die man noch kurz mitziehen läßt.<br />
Kuchen und Gebäck: Natürlich wurde in den bäuerlichen Haushalten das Brot selber gebacken. Als Backtrieb<br />
diente Sauerteig (Hefel). Brotmehl war früher ausschließlich Dinkelmehl. Zusätzlich wurden manchmal weiße<br />
Laible, Hefenkranz oder Gugelhopf (Guglopf), als Kleingebäck vielleicht auch mal Flachswickel, mitgebacken,<br />
immer aber machte man Spickleng (Kartoffelspickleng, das traditionelle Essen am Backtag). Jede Familie hatte<br />
da ihre eigenen Vorschrift, die sich nach dem persönlichen Geschmack richtete. Auch nahm man mehr oder<br />
222
weniger Rahm, je nachdem, welche Menge verfügbar war. Eventuell wurde dem Belag durch Zufügen von etwas<br />
Milch die gewünschte, noch gut streichbare Konsistenz gegeben. Das Grundrezept sei hier angefügt: Zu einem<br />
Kuchenboden von 1/2 Pfund Mehl (Hefeteig) braucht man 1 Pfund durchgedrückte Kartoffeln vom Tag vorher.<br />
Feiner. wird die Masse, wenn man die Kartoffeln reibt. Man kann auch etwas weniger Kartoffeln nehmen und<br />
dann zwei Eßlöffel Mehl zugeben. Kartoffelmasse und evtll. Mehl werden mit 1 1/2 - 2 Bechern saurem Rahm<br />
(es kann auch zur Hälfte süßer und saurer Rahm sein) und 2-3 Eiern gut verrührt und mit Salz und Pfeffer<br />
abgeschmeckt, evtll. mit Butterflöckchen belegt und gebacken.<br />
Als weitere Zutaten für den Belag eignen sich feingeschnittene Zwiebeln, würfelig geschnittenes Rauchfleisch,<br />
Kümmel und Schnittlauch.<br />
Zu allen Festen gehörten und gehören viele selbstgebackene Kuchen. Ottilie Steimle schildert 1980 die Auswahl<br />
an Kirbekuchen so:<br />
" . . Zwetschga-, Epfel - Zuckerspickleng,<br />
Schneckanudla, Hefareng,<br />
Ziegerspickleng mit Zibeba,<br />
Ond sogar ao no Pasteta,<br />
Zwiebelspickleng mit Kemmich ond Speck,<br />
Älles draid mr na zom Bäck. . . "<br />
"Ziegerspickleng" ist ein Kuchen mit Hefeboden und einem Quarkbelag, also eine Art Käskuchen.<br />
Zu Weihnachten gab´s Hutzelbrot und Breedla, wie Ausstecherla, "Riggene" (aus Brotteig), Zimtsterne,<br />
Springerla, Anisbreedla usw.<br />
Eine Inventurliste<br />
Die Inventuren sind Listen, die bei Hochzeiten (Beibringsinventarien), Sterbefällen (Nachlaßinventarien) und<br />
Teilungen zwingend vorgeschrieben waren, und in denen alles aufgeführt wurde, was zum Haushalt, zu Haus-<br />
und Grundbesitz und zur Landwirtschaft des Betreffenden gehörte. Im <strong>Gechinger</strong> Rathaus lagern Hunderte<br />
solcher Dokumente. Sie können uns einen guten Einblick in die damalige Zeit verschaffen. Hier sei eine als<br />
Beispiel abgedruckt:<br />
„Inventarium und Eventualteilung vom 22. 8. 1763 von Michael Ziegerer *1.1.1717 +März 1763, Taglöhner und<br />
Kuhhirt oo am 3.11.1744 mit Brigitte Dreichler *1712 +5.4.1782<br />
Die Erben: Ehefrau, Tochter Magdalena *15.1.1744, Tochter Brigitte *13.2.1746<br />
Aufstellung: Der 4.Teil einer Behausung, der 8. Teil der Hofraite, Äcker: 16 Ruten in der Riederleshalde und 12<br />
eben dort<br />
Krautländer: 14 1/2 Ruten in Birklin, 7 3/4 in der unteren Gasse<br />
Bücher: 1 Gesangbuch.<br />
Mannskleider: 1 alter blauer Camisol (Sonntagsrock), 1 rotes Brusttuch, 1 Paar Strümpfe, 1 Mantel.<br />
Weibskleider: 1 schwarzer Rock, 2 Wiflingröcke (Wifling ist ein grobes Gewebe aus leinenem Zettel und<br />
wollenem Einschlag, meist schwarz. Es wurde zu dieser Zeit von den Bauern selbst hergestellt), 2 schwarze<br />
Schürzen, 1 Schal, 1 Schleier, 2 Hauben, 1 Brusttuch, 1 Goller (Mieder oder Leibchen), 4 Hemden, 1 Paar<br />
Ärmel, 3 Paar Strümpfe, 1 Paar Schuhe.<br />
Bettgewand: 2 Oberbetten, 2 Unterbetten, 2 Haipfel, 3 Kissen, 1 Strohsack.<br />
Leinwand: 20 verschiedene Leintücher und Ziechen.<br />
Eisengeschirr: 2 Pfannen, 1 Schmalzpfanne zweifüßig, 1 Schaumlöffel, 1 Schöpflöffel, 1 Backgabel, 1<br />
Ofengabel.<br />
Blechgeschirr: 1 Ampel.<br />
Holzgeschirr: 2 Wasserzuber, 3 Wasserkübel, 1 kleiner Zuber, 4 Kuchenschüsseln, 2 Rührlöffel.<br />
Schreinerwerk: 2 Betten, 1 Tisch, 1 Stuhl, 2 Truhen, 1 Kopfhaus (kleiner Kasten oder Schrank in der Küche oder<br />
neben dem Bett), 1 kleiner Trog, 1 Backmulde, 1 Krautstande, 1 Fäßchen.<br />
Werkzeug: 1 Holzhape, 1 Holzmesser, 1 Schälmesser, 2 Sicheln, 1 Sense, 1 Dunggabel, 2 Rechen, 2<br />
Haberrechen, 1 Wetzstein, 3 Siebe, 2 Flegel, 1 Grastuch, 1 Schaufel, 2 Körbe, 2 Wannen, 4 Säcke, 1 Schere, 1<br />
Hammer, 1 Beißzange.<br />
Vieh: 2 Geißen, 1 Bock, 2 Gänse, 1 Henne.<br />
Vorrat: 3 Scheffel Dinkel, 20 Büschel Stroh, 4 Wannen Heu, 1 Karren voll Dung, 1 Stapel Holz.<br />
All das hat einen Wert von 230 Gulden, Verpflichtungen 52 Gulden, Rest 178 Gulden.“<br />
Man sieht, daß auch die persönliche Habe der Frau erfaßt wurde. Nichts deutet darauf hin, daß die Töchter<br />
Michael Ziegerers im Hause lebten, als er starb, sie dürften beide "in Stellung" gewesen sein. Es gibt nur zwei<br />
Betten samt Bettzeug, auch die Ausstattung mit Mobiliar spricht nicht dafür, daß hier vier Personen hausten.<br />
223
Etwas Haus- und Grundbesitz war da. Die Maßeinheit Rute, entspricht 2,86 m, gemeint sind hier Quadratruten.<br />
Das Ackerland betrug also ca. 2,3 a, das Krautland ca. 1,8 a . Das reichte auch bei sorgsamster Bewirtschaftung<br />
für den Unterhalt einer Familie nicht aus. Aber, wie auch in der Oberamtsbeschreibung von 1860 ausgeführt, nur<br />
die Allerwenigsten waren ganz ohne Grundbesitz.<br />
Gerätschaften für den Anbau von Getreide waren vorhanden, ebenso Dreschflegel. Säcke, sowie ein Vorrat an<br />
Getreide (1 Scheffel = 177.l) und Stroh fehlten nicht. Es gab aber keine Zugtiere und auch keine größeren<br />
Ackergeräte, wie Egge und Pflug. Vielleicht bestand ein Teil der Entlohnung Michael Ziegerers als Taglöhner in<br />
der Mitbenutzung von Gespann, Fuhrwerk und Ackergeräten.<br />
Wiesen- und Weideland ist im Grundbesitz nicht ausgewiesen, die Familie besaß aber zwei Ziegen und einen<br />
Bock sowie einen Vorrat an Heu, auch war ein Grastuch vorhanden, in dem die Frauen Grünfutter für die Tiere<br />
auf dem Kopf heimtrugen. Auch eine Sense findet sich unter den Gerätschaften. Sie diente zu dieser Zeit<br />
ausschließlich zum Grasmähen, für Getreide benutzte man die Sichel. Es wäre denkbar, daß Waldgras wenigstens<br />
zum Teil als Futter für die Tiere diente, auch mag ein Teil der Besoldung Michael Ziegerers als Kuhhirt der<br />
Gemeinde im Nießnutz von Grasland bestanden haben.<br />
Bei dem Huhn könnte es sich um eine "Leibhenne" handeln, die die Frau als Abgabe zu leisten schuldig war, die<br />
Gänse hielt man möglicherweise vor allem der Federn wegen für die Aussteuern der Töchter.<br />
Da das hierzu nötige Handwerkszeug vorhanden war ist es möglich, daß Michael Ziegerer nebenbei auch Körbe<br />
flocht oder Besen band, wenn auch nur für den Hausgebrauch.<br />
Die Kleidung war dürftig, aber mit 20 Leintüchern und Ziechen (Bettbezügen) war ausreichend Weißzeug da. In<br />
diesem Zusammenhang fällt auf, daß weder Spinnrad noch Kunkel im Hausrat angeführt sind. Das ist eigentlich<br />
ungewöhnlich, zumal in Gechingen, wo Spinnen und Weben eine große Tradition hat und außerdem zwei<br />
Töchter da waren.<br />
Brigitte Ziegerer hat sicherlich auf offenem Feuer gekocht. In dem Schmälzpfännle wurde Fett, eventuell mit<br />
Zwiebeln oder Brosamen, gebräunt und die Suppe oder das Mus damit abgeschmälzt. Eiserne Pfannen mit langen<br />
Stielen waren beim Kochen auf offenem Feuer vielseitig zu verwenden. Von irgendwelchem Geschirr oder<br />
Besteck ist nicht die Rede, aber Eß- und Trinknäpfe, Milchhäfen und vielleicht auch einen irdenen Hafen zum<br />
Kochen und zumindest hölzerne Löffel muß es gegeben haben, diese Dinge galten wohl als von zu geringem<br />
Wert für das offizielle Inventar. Gerätschaften zum Teigbereiten waren da, aber ganz offensichtlich hat Brigitte<br />
Ziegerer daheim weder gebacken noch Wäsche gewaschen, es fehlen alle hierfür nötigen Utensilien. Sie hat<br />
sicher, wie vorgeschrieben, das Back- bzw. Waschhaus benutzt. Die vielen Wasserkübel und -zuber waren nötig,<br />
weil alles Wasser vom Brunnen geholt werden mußte.<br />
Eine interessante Ergänzung zu diesem Inventarium liefert das Ortssippenbuch. Von Tochter Brigitta wissen wir<br />
nichts über ihr ferneres Schicksal, aber Tochter Magdalena hat 1782, mit 38 Jahren, einen um acht Jahre jüngeren<br />
Mann geheiratet, unmittelbar nach dem Tod der Mutter. Ihr Mann war Leineweber, zusammen hatten sie wohl<br />
gerade ihr Auskommen.<br />
Es ließe sich noch vieles aus diesen Inventarien erschließen, was aber Arbeit über einen sehr langen Zeitraum<br />
bedeutet und künftigen Forschungen vorbehalten bleiben soll!<br />
Anhang<br />
Familiensiegel oder Petschaften<br />
Das Siegel ist der reliefartige Abdruck eines Stempels in einer weichen, leicht erhärtenden Masse, seit dem 16.<br />
Jahrhundert wird im allgemeinen der rote Siegellack dazu verwendet. Siegel dienten zur Beglaubigung einer<br />
Urkunde oder zum Verschluß eines Schriftstückes oder eines Behältnisses (versiegeln). Sie bestehen meistens aus<br />
einem Siegelbild und der Umschrift, die den Namen des Sieglers angibt. Bei unseren <strong>Gechinger</strong> Bauern und<br />
deren Familiensiegeln handelt es sich um Siegel, die teilweise auch als Hauszeichen benützt wurden. Man findet<br />
diese Siegel auf Urkunden im Staatsarchiv oder auch auf Briefen und Umschlägen im Gemeindearchiv. Leider<br />
sind fast alle im Lauf der Zeit brüchig geworden, so daß sie oft schlecht zu deuten sind. Außer den<br />
Familiensiegeln wurden als Ersatz auch Gemeindesiegel verwendet. Es kam auch vor, daß Siegel von anderen<br />
Familien entlehnt wurden, sei es, weil es kein eigenes gab oder weil es im Moment nicht greifbar war. Karl<br />
Friedrich Essig, der Autor des ersten <strong>Gechinger</strong> Heimatbuches, hat 1949 eine Zusammenstellung der Siegel<br />
vorgenommen, die, mit verschiedenen Ergänzungen, in alphabetischer Reihenfolge hier aufgelistet sind.<br />
Fam. Brackenhammer<br />
Johann Jakob Brackenhammer, geb. 3. 12. 1719, gest. 10. 6. 1796, war Bäcker, Lammwirt und Schultheiß (1768<br />
- 1796). Er führte in seinem Siegel (Bild 1) einen Doppelweck mit Brezel unter der fünfzackigen Volkskrone. Es<br />
findet sich auf der Vermögungsübergabe von Jakob Röckle, Bürger und Barbier vom 1. 11. 1770 sowie auf dem<br />
224
Testament der Barbara Bock, ledige Bürgertochter, vom 9. 1. 1782. Auch auf dem Testament der Dorothea<br />
Döttinger geb. Wagner, Ehefrau des Andreas Döttinger, vom 22. 1. 1783 und dem Testament der Margareta<br />
Breitling, Ehefrau des Zeugmachers Jakob Breitling, vom 8. 1. 1788 und auf dem Testament der Margareta<br />
Grimm, Ehefrau des Leonhardt Grimm, Schuhmacher, ist dieses Siegel zu sehen.<br />
Der Sohn Johann Jakob Brackenhammer, geb. 17. 11. 1743, gest. 17. 11. 1820 war Müller auf der <strong>Gechinger</strong><br />
Mühle und siegelte auf dem letztgenannten Testament, um sich von seinem Vater zu unterscheiden, mit dem<br />
Steuersiegel der Gemeinde. (Bild 2) Dieses zeigt einen Schild mit drei Hirschgeweihen und der Umschrift<br />
"Gemeinde Accise" ("Accise" oder "Akzise" war eine Bezeichnung für steuerliche Abgaben).<br />
Fam. Böttinger<br />
Mit dem gleichen Steuerstempel versah Johann Jakob Böttinger, geb. 7. 4. 1738, gest. 11. 6. 1811, Bäcker und<br />
Gemeinderat, seine Unterschrift.<br />
Fam. Breitling<br />
Als erster Breitling erscheint Johannes Breitling, geb. 26. 6. 1717, gest. 13. 7. 1769, Zeugmacher, Waisenrichter<br />
und Bürgermeister auf dem Testament von Ulrich Johann Kotz vom 12. 12. 1763. Er siegelte (Bild 3) mit einem<br />
Weberschiffchen, umgeben von einem Kranz, der oben mit einem Stern abschließt und den Buchstaben J. B.<br />
Der nächste Breitling, Hans Martin Breitling, geb. 5. 2. 1719, gest. 28. 12. 1793, Bauer und Zeugmacher, siegelte<br />
auf dem Testament der Margareta Breitling, Ehefrau des Zeugmachers Jakob Breitling vom 8. 1. 1788 (Bild 4)<br />
mit zwei gekreuzten Reffen mit den Spitzen nach oben und den Buchstaben M. B. Sein Siegel erscheint auch auf<br />
dem Testament des Johann Georg Gehring vom 2. 8. 1788.<br />
Es folgt Johann Melchior Breitling, geb. 12. 2. 1742, gest. 9. 2. 1818, Bauer. Er siegelte (Bild 5) mit einer Kugel<br />
am Stiel und 2 Ähren und den Buchstaben H. B. K. auf dem Testament der Margareta Grimm, Ehefrau des<br />
Leonhardt Grimm, Schuhmacher, vom 20. 5. 1796.<br />
Fam. Gräber<br />
Christoph Albrecht Gräber, geb. 22. 7. 1709, gest. 14. 12. 1784, Zeugmacher und Gemeinderat, siegelte das<br />
Testament der Maria Kunigunde Gehring, Witwe des Hans Leonhardt Gehring, Zeugmacher, vom 4. 3. 1762 und<br />
das Testament des Ulrich Johann Kotz vom 12. 12. 1763 (Bild 6) mit zwei gekreuzten Reffen, Zinken nach oben,<br />
Weberschiffchen und zwei Sternen und den Buchstaben C G. Außerdem finden wir sein Siegel auf dem<br />
Testament der Maria Eva Ederle, Witwe des Jerg Ederle, Wagner, vom 1. 6. 1764 und dem Testament von Hans<br />
Jerg Roller, Bauer, und seiner Ehefrau Anna Barbara geb. Wagner vom 3. 7. 1761 sowie auf der<br />
Vermögungsübergabe des Jakob Röckle, Barbier, vom 1. 11. 1770, des weiteren auf dem Testament der<br />
Dorothea Döttinger geb. Wagner, Ehefrau des Andreas Döttinger, vom 11. 4. 1812.<br />
Sein Sohn Johann Georg Gräber, geb. 2. 9. 1748, gest. 11. 4. 1812, Zeugmacher und Gemeinderat, siegelte auf<br />
dem Testament der Margareta Breitling, Ehefrau des Jakob Breitling Zeugmacher, vom 8. 1. 1788, mit dem<br />
gleichen Zeichen wie sein Vater.<br />
Fam. Hartmann<br />
Der Schulmeister Karl Gotthilf August Hartmann, geb. 18. 12. 1800, gest. 4. 4. 1838, der in Gechingen um 1830<br />
lebte, setzte sein Siegel, eine nicht genau zu bestimmende Figurengruppe, auf das Testament der Agnes Christina<br />
Wochele, Ehefrau des Georg Achatius Wochele, Hirschwirt, von 1831.<br />
Fam. Kappis<br />
Johann Friedrich Kappis, Zeugmacher und Heiligenpfleger, geb. 2. 11. 1738, gest. 5. 3. 1815, siegelte 1781 (Bild<br />
7) mit dem Umgeldstempel (Umgeld = Biersteuer) der Gemeinde, der drei Hirschgeweihe im Schild zeigt. Das<br />
Testament der Dorothea Döttinger geb. Wagner vom 22. 1. 1783 und das Testament der Margareta Breitling vom<br />
8. 1. 1788, (Bild 8) siegelte er mit Pflugschar und zwei gekreuzten Pfeilen und den Buchstaben H F K.<br />
Fam. Krafft<br />
Der Vater, Johann Georg Krafft, Küfer und Gemeinderat, geb. 21. 2. 1717, gest. 11. 9. 1783, verwendete seine<br />
Petschaft für das Testament der Maria Eva Ederle vom 1. 6. 1764. Es zeigt (Bild 9) eine große offene Zange, ein<br />
Fäßchen und einen Hammer sowie die Buchstaben H J K.<br />
Der Sohn Johann Georg Krafft, Küfer, geb. 22. 5. 1744, gest. 28. 3. 1818, siegelte mit dem gleichen Zeichen das<br />
Testament der Brigitte Blum, Witwe des Christian Blum, Zimmermann, vom 10. 11. 1801.<br />
Fam. Kühnle<br />
225
(Bild 10) Zwei gekreuzte Reffen, die Zinken nach oben, Weberschiffchen mit Umrandung und den Buchstaben J<br />
F N waren das Siegel des Bäckers, Waldmeister und Gemeinderates Johann Georg Kühnle, geb. 6. 1. 1736, gest.<br />
23. 1. 1818. Er verwendete es beim Testament der Barbara Bock, ledige Bürgerstochter, vom 9. 1. 1782.<br />
Sein Sohn Johannes Kühnle, Maurer, geb. 1. 10. 1760, gest. 8. 11. 1820, hatte in seiner Petschaft (Bild 11) einen<br />
Doppelweck unter einer Brezel, zwei Sterne und die Buchstaben J G K. Es befindet sich unter dem Testament der<br />
Brigitte Blum vom 10. 11. 1801.<br />
Fam. Quinzler<br />
Johann Georg Quinzler, Schultheiß von 1748 - 1768, geb. 13. 4. 1707, gest. 6. 5. 1778, setzte sein Siegel unter<br />
das Testament der Maria Kunigunde Gehring vom 4. 3. 1762. Es zeigt (Bild 12) eine Pflugschar mit zwei<br />
Pfeilspitzen und den Buchstaben H Q.<br />
Sein Enkel, Johann Georg Quinzler, Bier- und Lammwirt, Schultheiß von 1832 - 1841, geb. 17. 7. 1778, gest. 5.<br />
8. 1848, machte sein Zeichen (Bild 13) ein Schaf mit einer Fahne und den Buchstaben J G Q unter das Testament<br />
der Katharina Vellnagel geb. Wagner, Witwe des Johann Vellnagel, Bauer, vom 28. 1. 1820.<br />
Fam. Riehm<br />
Hier sind zwei verschiedene Siegel bekannt, das eine zeigt einen Steinhammer, das andere ein Weberschiffchen.<br />
Auf welchen Dokumenten sie im einzelnen zu finden sind, muß noch untersucht werden. Ein Johann Georg<br />
Riehm, Wagner, geb. 19. 10. 1783, gest. 30. 8. 1842, siegelte das Testament der Agnes Christina Wochele von<br />
1831, mit einem entlehnten Siegel. Es zeigt einen Wappenschild, 5 Sterne, Helm und zwei Hörner.<br />
Fam. Röckle<br />
Der Barbier und Chirurgus Johann Jakob Röckle, geb. 20. 7. 1704 , gest. 9. 12. 1770, drückte seine Petschaft,<br />
(Bild 14) ein dreifach durchbohrtes Herz und die Buchstaben J R, unter seine Vermögungsübergabe vom 1. 11.<br />
1770.<br />
Fam. Rüffle<br />
Auf dem Testament von Ulrich Johann Kotz vom 12. 12. 1763 erscheint die Petschaft von Johann Michael<br />
Rüffle, Metzger, geb. 10. 10. 1722, gestorben in Westpreußen. Auf dem Siegel (Bild 15) ist ein Ochsenkopf mit<br />
Doppelbeil und den Buchstaben J M R zu sehen.<br />
Fam. Schneider<br />
Diese Familie hat mit vier verschiedenen Zeichen gesiegelt. Beginnen wir mit Johann Michael Schneider,<br />
Zeugmacher, geb. 25. 1. 1709, gest. 1. 1. 1771. Er siegelte (Bild 16) mit zwei gekreuzten Reffen, Spitzen nach<br />
unten, Weberschiffchen, Stern und den Buchstaben M S, das Testament der Maria Kunigunda Gehring vom 4. 3.<br />
1762 und das Testament der Maria Eva Ederle vom 1. 6. 1764.<br />
Johann Michael Schneider, Chirurgus und Schultheiß von 1796 - 1828, geb. 11. 3. 1757, gest. 31. 7. 1836, führte<br />
(Bild 17) einen Pelikan, der seine Jungen mit seinem Blute füttert, darüber eine männliche Figur, in seinem<br />
Siegel. Er drückte es unter das Testament der Margareta Grimm vom 20. 5. 1796. Hier könnte es sich auch um<br />
ein Gemeindesiegel handeln, wenigstens wurde einmal ein solches verwendet. Auch unter dem Testament der<br />
Brigitte Blum vom 10. 11. 1801 ist dieses Zeichen zu sehen.<br />
Der nächste ist Johann Michael Schneider, Zeugmacher, geb. 20. 10. 1782, gest. 25. 12. 1862. Er hatte im Siegel<br />
(Bild 18) einen Wappenschild mit drei Hirschstangen und Umschrift, wie auf dem Testament der Katharina<br />
Vellnagel vom 28. 1. 1829 zu erkennen ist.<br />
Der letzte in der Reihe, Johann Michael Schneider, von Beruf Schneider, geb. 14. 2. 1782, gest. 16. 12. 1848,<br />
hatte sich schon ein etwas moderneres Siegel zugelegt (Bild 19). Unter einer Krone sind die verschlungenen<br />
Buchstaben J M S auf dem Testament der Agnes Christina Wochele zu sehen.<br />
Fam. Schraishahn<br />
Der Hirschwirt und Ratschreiber Christian Friedrich Schraishahn geb. 3. 4. 1810 in Calw, gest. 17. 12. 1839,<br />
leistete seine Unterschrift mit Siegel auf dem Testament des Georg Achatius Wochele vom 25. 3. 1833 (Bild 20).<br />
Es zeigt zwei unbestimmbare Tiere auf einem Sockel.<br />
Fam. Schwarzmaier<br />
Bernhardt Schwarzmaier, Zimmermann, siegelte 1792 einen Brief an den Amtmann in Merklingen, in dem er um<br />
Genehmigung zum Bau einer Öl-, Reib- und Schleifmühle bittet (Bild 26). Das Siegel zeigt in ovaler Form eine<br />
Gestalt mit Lanze und Schild. 1803 erhält Schwarzmaier die Genehmigung, gegen den Widerstand der Gemeinde<br />
und der Anlieger.<br />
226
Das Schreiben an den Schultheißen von Gechingen war mit dem Oberamtssiegel des Amtmanns von Merklingen<br />
versehen (Bild 27). Man sieht unter der Herzogskrone die drei Hirschstangen von Württemberg.<br />
Fam. Spöhr<br />
Georg Adam Spöhr, Maurer, Steinhauer und Gemeinderat, geb. 5. 9. 1724, gest. 21. 7. 1814, führte (Bild 21)<br />
gekreuzte Handwerkszeuge und die Buchstaben G A S in seinem Zeichen, das unter dem Testament der Barbara<br />
Bock vom 9. 1. 1782 steht. Außerdem finden wir es unter dem Testament der Dorothea Döttinger vom 22. 1.<br />
1783 und dem letzten Willen der Margareta Breitling vom 8. 1. 1788, sowie bei Johann Georg Gehring vom 2. 8.<br />
1788 und bei der Brigitte Blum vom 10. 11. 1801.<br />
Sein Enkel Georg Adam Spöhr, Bauer, geb. 13. 5. 1772, gest. 24. 2. 1857, hatte die Petschaft (Bild 22) mit einem<br />
Weberschiffchen, das von zwei Zweigen eingefaßt ist, und den Buchstaben A S. Er siegelte damit das Testament<br />
der Katharina Vellnagel vom 28. 1. 1820, das der Agnes Christina Wochele von 1831 und von Georg Achatius<br />
Wochele vom 25. 3. 1833.<br />
Fam. Wochele<br />
Der Hirschwirt, Metzger und badische Unterschaffner (Verwalter) Johann Georg Wochele, geb. 30. 10. 1720,<br />
gest. 22. 3. 1798, unterschrieb und siegelte das Testament von Ulrich Johann Kotz vom 12. 12. 1763 und den<br />
letzten Willen der Maria Eva Ederle vom 1. 6. 1764, außerdem die Vermögungsübergabe von Jakob Röckle vom<br />
1. 11. 1770 und die Testamente der Barbara Bock vom 9. 1. 1782, der Dorothea Döttinger vom 22. 1. 1783 und<br />
der Margareta Grimm vom 20. 5. 1796. Das Siegel (Bild 23) zeigt einen Ochsenkopf mit Schlächterbeil und die<br />
Buchstaben J G W.<br />
Sein Sohn Georg Achatius Wochele, Hirschwirt, geb. 27. 4. 1750, gest. 1. 4. 1833, siegelte (Bild 24) mit einem<br />
nach links springenden Hirsch und den Buchstaben G A W auf dem Testamentsnachtrag der Agnes Christina<br />
Wochele vom 19. 5. 1824.<br />
Fam. Ziegler<br />
Friedrich Christoph Ziegler, Hirschwirt und Schultheiß von 1831 - 1832, hatte in seiner Petschaft (Bild 25) einen<br />
Helm mit zwei Hörnern und Zierat. Sie ist auf dem Testament der Katharina Vellnagel vom 28. 1. 1820 zu sehen.<br />
Leider ist von den Siegelstempeln oder Siegelringen keiner erhalten geblieben. Sie sind im Laufe der Zeit in<br />
Vergessenheit geraten oder verloren gegangen.<br />
(Zeichnungen:Walter Jung)<br />
Zeugnisse der Vergangenheit<br />
Frühe urkundliche Hinweise auf den Ort Gechingen<br />
Bei der Suche nach den ältesten Hinweisen auf den Ort Gechingen führt eine Spur zum Kloster Reichenau. Das<br />
Kloster wurde im Jahre 724 gegründet und erhielt durch namhafte Förderer schnell eine besondere Bedeutung<br />
unter den frühen Klöstern. Der Mönch Gallus Öhem berichtet in seiner um das Jahr 1500 gefertigten Reichenauer<br />
<strong>Chronik</strong>, der alte Dokumente zugrunde lagen, von umfangreichen alten Schenkungen. Als Stifter zählt er Kaiser,<br />
Könige und Fürsten auf und die Orte, die von diesen dem Kloster geschenkt wurden. In dieser Aufzählung finden<br />
wir folgende Eintragung:<br />
Nottingus:<br />
Hirsowe - ains tails Almusdingen<br />
Stameheim Ysingen<br />
Frumare Oberstatt<br />
Gaichingen Nortstettin<br />
Metelingen Witingen<br />
Nettingen Grezzingen<br />
Singen Diefurt<br />
Theotelenhusen Wingarten<br />
227
Der Ort "Gaichingen" = Gechingen ist also von dem Stifter "Noting", zusammen mit 15 weiteren Orten, an das<br />
Kloster Reichenau gestiftet worden. Leider hat der Chronist kein Datum zu der Schenkung mitgeliefert. Das war<br />
für diese Zeit zweitrangig. Die Stifter waren damals bekannte Persönlichkeiten, man wußte, wer Noting war und<br />
wann er lebte.<br />
Wer war nun Noting? Aus Hirsauer Urkunden geht hervor, dass Noting ein Sohn des Grafen Erlafried von Calw<br />
war und das Amt des Bischofs von Vercelli (Oberitalien) inne hatte. Andere Quellen berichten, dass dieser<br />
Noting von Vercelli im Jahre 830 die Gebeine des Hl. Aurelius von Mailand nach Hirsau brachte. Es ist heute<br />
nicht mehr umstritten, daß Bischof Noting von Vercelli aus dem Calwer Grafen-Geschlecht stammt.<br />
Wann hat Noting seine Stiftung getätigt? Dies ist die zentrale Frage für das Datum der ersten historischen<br />
Nennung Gechingens. Wir wissen, dass Noting von Kaiser Ludwig dem Frommen (Regierungszeit 814 - 840) auf<br />
den Bischofssitz in Vercelli berufen wurde. Nachrichten über die Zeit Notings in Vercelli gibt es ab 830. Ab<br />
dem Jahre 840 amtete Noting bereits als Bischof in Verona. Der Stiftungszeitraum verengt sich also bereits auf<br />
die Zeit zwischen 830 und 840. Wir wissen, daß der Reichenauer Mönch Walahfried (Strabo) in der Zeit von 829<br />
bis 838 als Erzieher am Aachener Hof des Kaisers Ludwig d.Fr. tätig war und dort seinen großen Einfluss zu<br />
Gunsten Reichenaus (und Notings?) nutzen konnte. Schliesslich findet sich im Reichenauer Gedenkbuch ein<br />
Eintrag über Bischof Noting, der auf die Zeit "um 830" datiert wird. Für im Gedenkbuch (auch<br />
Verbrüderungsbuch genannt) eingetragene Personen wurde bei den täglichen Konvents-Gottesdiensten gebetet.<br />
Aus diesen Informationen kann gefolgert werden::<br />
- "Um das Jahr 830" wurde der Calwer Noting zum Reichsbischof von Vercelli ernannt.<br />
- In solchen Fällen reisten Familienangehörige meist an den neuen Wohnsitz mit, so daß Noting<br />
vermutlich bereits "um 830" auf seinen Calwer Erbteil verzichtete und diese 16 Ortschaften an das<br />
Kloster Reichenau stiftete.<br />
- Als Dank des Klosters erfolgte "um 830" seine Eintragung im Reichenauer Gedenkbuch.<br />
Ein genaues Datum der Noting-Stiftung wird sich nicht mehr feststellen lassen, aber man kann sagen:<br />
- die erste urkundliche Nennung Gechingens erfolgte "um das Jahr 830"!<br />
Karl-Heinz Schorpp, Gechingen<br />
Weitere Urkunden und Inschriften<br />
Die wichtigsten Urkunden und Nachweise für das historische Gerüst des Buches sind hier verzeichnet. Vielleicht<br />
mag doch das eine oder andere einer Einzelheit weiter nachgehen oder selbst Einblick nehmen wollen in die<br />
faszinierende Welt der schriftlichen Überlieferung aus sehr ferner Zeit.<br />
Die Urkunden und Unterlagen, die unter "Kirche und Pfarrer" angeführt sind, liegen, soweit nicht anders<br />
angegeben, im Landeskirchlichen Archiv in Stuttgart.<br />
Codex Hirsaugiensis ca 1100-1200, Ss. 29, Nr 30b: "Marquardus de Gechingen duas hubas in eodem loco<br />
dedit. . .." (Marquardt von Gechingen schenkt dem Kloster Hirsau 2 Huben. Hube = altes Feldmaß, 12-14 ha)<br />
Codex Hirsaugiensis um 1145, Ss. 41, Nr 47a: "Sigibolt dedit hubam unam in Gechingen." (Sigibolt schenkt eine<br />
Hube in Gechingen.)<br />
Heimatbuch Gechingen, Aufzeichnungen K.F. Eßig: 1263 stirbt mit Graf Gottfried von Calw das Geschlecht<br />
aus. Gechingen kommt an seinen Schwiegersohn, den Pfalzgrafen von Tübingen. Auch Waldeck hatte oder<br />
erwarb Rechte, ihre Aufteilung ist ungeklärt.<br />
L. Schmid um 1853, Geschichte der Pfalzgrafen von Tübingen, Ss. 308: Gottfried v. Tübingen verschreibt<br />
seiner Frau Elisabeth 1295 im Tausch gegen Möhringen Gechingen und Schönaich. Möhringen verkauft er.<br />
Württbg. Urkundenbuch Nr. 4952: Die Brüder Heinrich und Otto, Grafen von Zweibrücken, verkaufen 1297<br />
Merklingen an das Kloster Herrenalb. Merklingen wurde später Sitz des für Gechingen zuständigen<br />
Klosteramts.<br />
228
Württbg. Urkundenbuch Ss. 114, Nr. 101 und L. Schmid um 1853, Geschichte der Pfalzgrafen zu Tübingen<br />
Ss. 316: Graf Gottfried von Tübingen verkauft am 1.1.1303 das Dorf Gechingen um 800 Pfund Heller an<br />
den Schultheißen Konrad Roth von Weilderstadt.<br />
Mone, Zeitung für Geschichte des Oberrheins Bd. 5, Ss. 332-333: Abdruck der Verkaufsurkunde von<br />
Gottfried von Tübingen an das Kloster Herrenalb vom 1.1.1303. Seine Frau Elisabeth verweist er auf die<br />
Dörfer Dagersheim und Darmsheim. Die Urkunde ist, bis auf die Käufer, gleichlautend wie die<br />
Weilderstädter und gleichen Datums.<br />
Bei dieser Lage der Dinge muß es Auseinandersetzungen gegeben haben, die nach Mone, Zeitung für<br />
Geschichte des Oberrheins Bd. 5 Ss. 339 im Jahr 1308, am 4. Dez., dadurch beendet wurden, daß einige<br />
Bürger genau beschriebene Anteile an Gechingen an Herrenalb verkaufen. Lt. Mone Bd 5. Ss. 342-43<br />
verkauft Gottfried von Tübingen am 30. April 1309 alle Rechte, die ihm in Gechingen noch geblieben<br />
waren, an das Kloster Herrenalb<br />
In Repertorien (Verzeichnissen) des Klosters Herrenalb wird Gechingen zwischen 1315 und 1323 noch<br />
zweimal erwähnt, das Kloster erwirbt noch kleinere Besitztümer in Gechingen dazu.<br />
Alberti, Otto von, Adels- und Wappenbuch: Württbg Ss. 217: Judela, Hartwigs von Gechingen<br />
Tochter zu Weilderstadt, schenkte 1326 all ihr Gut in Gechingen an das Kloster Bebenhausen.<br />
Immer wieder werden kleinere Besitztümer in Gechingen veräußert, verschenkt, gestiftet, so an die Klöster<br />
Hirsau und Bebenhausen, auch an das Chorherrenstift Sindelfingen. Mühlenanteile wechseln mehrmals den<br />
Besitzer.<br />
L. Schmid, Geschichte der Grafen von Zollern-Hohenberg, Ss. 297: Am 23.8.1401 siegelte Graf Hugo v.<br />
Hohenberg eine Urkunde, in der Werner von Döffingen eine Gült an Hugo von Gechingen verkauft. 1423<br />
wird Hugo von Gechingen im Urkundenbuch des Staatsarchivs (Vaihingen, Ss. 571, Nr. 14266) noch einmal<br />
erwähnt, als er von Benzlin Rübsam von Sersheim eine Wiese erwirbt.<br />
Mack, Christa-Maria 1975, Die Geschichte des Klosters Lichtenstern Ss. 79/ 152 und <strong>Gechinger</strong> Heimatbuch Ss.<br />
40: Ein Teil des Zehnten von Gechingen kommt 1460 an das Kloster Lichtenstern durch die Klosterfrau Agnes<br />
von Gültlingen (Vergleiche unter "Pfarrer" Balthasar Wagner 1562-1566).<br />
1473 verkauft Kloster Lichtenstern seine Zehntenanteile in Gechingen an das Kloster Hirsau um 300 Gulden.<br />
Rathausarchiv in Gechingen Heiligen Lagerbuch von 1701: Hier ist die Abschrift einer Kaufurkunde aus dem<br />
Jahr 1497 zu finden. Damals kaufte die Gemeinde Gechingen das "Gefälle des Heiligen Martin" (die Abgaben,<br />
die der Kirche zustanden, um ihren Unterhalt zu sichern) vom Schwarzen Predigerorden in Pforzheim.<br />
Rathausarchiv Gechingen: Schäferstreit, Pergamenturkunde 1498<br />
<strong>Gechinger</strong> Heimatbuch Ss. 40, Aufzeichnungen K. F. Eßig: 1535 werden die Klöster Herrenalb, Hirsau,<br />
Sindelfingen und Bebenhausen säkularisiert, ihre Rechte und Besitztümer gehen an die Württemberger.<br />
Herrenalb wird gewaltsam reformiert.<br />
Karte von Georg Gadner 1592: Ortsbezeichnung Geching.<br />
Rathausarchiv Gechingen: Kaufbrief vom 12.3.1652 über Rückkauf von Fischwasser und Schafweide (zuvor<br />
wegen Finanzlasten aufgrund des 30-jährigen Kriegs veräußert) von den Herren von Buwinghausen.<br />
Karte von Johann Majer 1710: Ortsbezeichnung Gechingen<br />
Rathausarchiv Gechingen: Lagerbuch von 1547 und 1559, Zinsbuch von 1603, 1701, 1729, 1746 und 1759<br />
Pfarrarchiv Gechingen: Eheregister von 1566, Taufregister von 1574, Totenregister von 1577<br />
Die Inschriften in der Kirche sind im wesentlichen aus dem Buch "Die Inschriften des Landkreises Calw" (Aus<br />
der Reihe "Die deutschen Inschriften", Band 30) von Renate Neumüllers-Klauser übernommen worden, bis auf<br />
ihre Deutung der lateinischen Inschrift am Turm der Martinskirche. Bei Neumüllers-Klauser ist die Inschrift (Ss.<br />
123) folgendermaßen wiedergegeben: "A(nn)o 1561 mense apri(lis) turris hec fulmine col/lit(a) delapso tacta et<br />
usque ad imum scissa est/ et tandem 1568 a(nn)o reaedificari cepta eode(m)q(ue) absoluta". Sie gibt ferner an,<br />
229
daß bei "col/lit(a)" eine us-Kürzung statt einer "a"Kürzung verwendet worden sei, und daß die zweimal<br />
verschiedenartig ausgeführte "OL" Verbindung ungewöhnlich sei.<br />
Das ist falsch gelesen worden. Das Wort collita ist im Lateinischen nicht vorhanden. Es handelt sich um das in<br />
diesem Zusammenhang sehr übliche "coelitus" - vom Himmel (die us-Kürzung hat Neumüllers-Klauser richtig<br />
erkannt) und eine O-E Ligatur (die sich natürlich deshalb von der O-L Ligatur unterscheidet, worüber<br />
Neumüllers-Klauser sich wundert). Anstelle von "collita" müßte richtig "coelitus" stehen. Deshalb ist in diesem<br />
Buch die Inschrift wie folgt übersetzt: "Im Jahre 1561 im Monat April wurde dieser Turm durch einen Blitz vom<br />
Himmel getroffen, bis unten hin gespalten; und schließlich im Jahre 1568 begann man, ihn wieder aufzubauen;<br />
im selben Jahr wurde man damit fertig." (Nach Renate Vogeler). Diese Übersetzung entspricht auch der von<br />
Pfarrer Andler im Heimatbuch von K.F.Essig Ss. 23.<br />
Steine und Gebäude<br />
Ruhbänke<br />
Auf den Höhen oder an Kreuzungen stehen sogenannte "Ruhbänke". Das waren früher Abstellplätze für<br />
Rückenkörbe und Körbe, die auf dem Kopf getragen wurden. Von den vier einst vorhandenen Ruhbänken auf<br />
unserer Markung sind noch drei erhalten. Die eine steht an der Straße nach Dachtel, kurz vor der<br />
Bergwaldsiedlung rechts, die zweite oben auf dem Zimmerplatz am Wegekreuz Wochenendhäuser, Röserhütten<br />
und Masenwald. Die dritte finden wir rechts des Weges zum Wasserturm. Die abgegangene vierte Ruhebank<br />
stand an der Straße nach Calw, beim Steinbruch (Hirschgehege). Die Ruhebänke stehen wie alle Steinzeugen<br />
unter Denkmalschutz. Sie wurden 1845 aufgestellt.<br />
Gedenksteine<br />
Gedenkstein Graskunz:<br />
Am 6. Juli 1827 verunglückte ein Mann namens Graskunz aus Gechingen im Wald beim Hülsental. Er war mit<br />
anderen beim Tannenfällen. Plötzlich löste sich ein großer dürrer Ast und erschlug den Dreißigjährigen. Zum<br />
Andenken setzte sein Vater ihm an der Unglücksstelle einen Stein. Auf ihm heißt es: "Hier büßte Jakob Friedrich<br />
Graskunz sein Leben ein durch Herabstürzung eines Astes von einer Tanne auf sein Haupt und ist plötzlich tot<br />
gewesen. Den 6. Juli 1827, seines Alters 30 Jahre. Diesen Stein hat ihm sein Vater, Jakob Graskunz, zum<br />
Andenken hierhergebracht, daß sich ein jeder erinnern kann und diese Worte ihm zurufen: Gedenke, wie kurz<br />
mein Leben ist !" Der Verunglückte hinterließ eine fünfjährige Tochter, seine Frau war Margarete geb. Heim.<br />
Gedenkstein Johann Michael Gehring auf dem Friedhof:<br />
Auf dem Friedhof erinnert ein großer Gedenkstein an den jähen Tod des Johann Michael Gehring 1827. Der<br />
Stein ist unter "Friedhof" genau beschrieben, siehe dort.<br />
Gedenkstein Richard Gehring:<br />
Dieser Gedenkstein steht an der steinigen Planie im Masenwald. Dort kam Paul Richard Gehring ums Leben. Er<br />
holte mit seinem Schwager, Christian Vetter, Baumholz aus dem noch winterlichen Wald. Der steile Abfuhrweg<br />
war teilweise vereist. Richard Gehring führte die Pferde vorne am Zügel, sein Schwager Christian Vetter<br />
betätigte die Bremse. Obwohl zusätzlich ein Radschuh eingelegt war, konnten die Pferde den Wagen auf dem<br />
glatten und abschüssigen Weg nicht mehr halten. Der hintere Wagenteil stellte sich schräg, Richard Gehring<br />
rutschte aus und kam unter den Wagen. Die Nabe der hinteren Wagenachse brach ihm das Genick, er war sofort<br />
tot. Der Text auf dem Gedenkstein lautet: "Richard Gehring ist hier am 15. März 1924 im Alter von 22 Jahren<br />
mit seinem Fuhrwerk tödlich verunglückt. 0, Mensch, gedenk bei diesem Stein, wie schnell Du kannst des Todes<br />
sein. Gewidmet von seinen Eltern."<br />
Gedenkstein Breitling:<br />
Am 24. Februar 1936 starb der 32jährige Landwirt Ferdinand Breitling. Er war zum Tannenzapfensammeln für<br />
eine Nagolder Firma unterwegs. Waghalsig und gewandt wußte Ferdinand Breitling sich in den höchsten Wipfeln<br />
der Tannen herumzuschwingen. Doch an diesem Tage fand ihn seine Braut, die ihm nach getaner Arbeit beim<br />
Zapfensammeln helfen wollte, regungslos unter einer mächtigen Tanne liegen, an der noch die Leiter lehnte. Von<br />
einem vorbeifahrenden Auto wurde Breitling noch ins Calwer Krankenhaus gebracht, starb aber, ohne nochmals<br />
das Bewußtsein erlangt zu haben, am gleichen Abend.<br />
Zum Andenken wurde ihm im doppelten Wald an der Unglücksstelle ein Denkstein gesetzt. Der Haken, den<br />
Breitling dabei hatte, blieb bis 1970, als die Tanne gefällt wurde, im Geäst des Baumes in 25 m Höhe hängen.<br />
Folgender Text steht auf dem Gedenkstein: "Ferdinand Breitling aus Gechingen, geboren 1903, tödlich<br />
verunglückt am 24. 2. 1936 durch Absturz von einer 32m hohen Tanne. Rasch tritt der Tod den Menschen an, es<br />
ist ihm keine Frist gegeben."<br />
230
Gedenkstein Zech:<br />
An einer leichten Linkskurve am Rand der Straße nach Deufringen steht dieser Gedenkstein. Am 10. 6. 1959<br />
verunglückte hier der 25-jährige Eberhard Zech tödlich. Er war mit seinem Motorrad morgens nach Sindelfingen<br />
zur Arbeit unterwegs und wich einem die Straße überquerenden Reh aus. Dabei stürzte er und prallte so schwer<br />
auf der Straße auf, daß er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Er hinterließ eine Frau und zwei<br />
kleine Kinder. Die Eltern des Verunglückten ließen den Gedenkstein aufstellen.<br />
Gedenkstein Marienlinde:<br />
Im Jahr 1881 zerstörte ein verheerender Brand den halben Ort. Zum 100. Jahrestag dieses Unglücks setzte die<br />
Gemeinde 1981 einen Gedenkstein bei der Marienlinde. Ehrenbürger Otto Weiß verlas bei der Einweihung ein<br />
Protokoll jener Schreckensnacht, in der hoher Sachschaden, zum Glück aber kein Menschenleben, zu beklagen<br />
war. Die Marienlinde wurde zum Andenken an die Prinzessin Marie von Neipperg gepflanzt, die die damals<br />
Geschädigten großzügig mit Geld unterstützte.<br />
Kriegerdenkmal bei der Kirche:<br />
Im Herbst 1920 faßte der Gemeinderat den Beschluß, für die Gefallenen des I. Weltkriegs ein Ehrenmal zu<br />
erstellen. Kunstbildhauer Karl Gläser bekam den Auftrag dafür. Zunächst war ein Standort bei der Marienlinde<br />
vorgesehen, dann wurde aber ein Platz bei der Kirche gewählt. Am 2. Juli 1922 konnte das Ehrenmal eingeweiht<br />
werden. Schüler, Musikverein, Gemeinderat, Kirchengemeinderat, Familienangehörige der Gefallenen,<br />
Veteranenverein, Liederkranz und die Feuerwehr zogen in einem Festzug zum Ehrenmal. Lange Zeit stand das<br />
Denkmal an seinem angestammten Platz. Vor einigen Jahren wurde es um ein paar Meter in Richtung Kirche<br />
versetzt, um mehr Platz im Kirchhof zu gewinnen.<br />
Marksteine<br />
Mit Marksteinen wurde und wird die Markungsgrenze einer Gemeinde, Stadt oder die Grenze eines Landes<br />
angezeigt. Des weiteren finden wir Marksteine zur Begrenzung von privaten Flächen. Die Steine werden auch<br />
Zehentsteine oder Zehntsteine genannt, wegen ihrer früherer Bedeutung beim Abliefern des Zehnten an die<br />
jeweilige Herrschaft, sei es die weltlicher oder die geistliche Obrigkeit. In der Regel ist und war der Markstein<br />
ein viereckig zugehauener Block mit rechteckigem Grundriß, oben teils abgerundet oder gradlinig abgeschlossen.<br />
Früher wurden in unserer Gegend Sand- und Kalksteine verwendet, heute sind sie aus Granit. Man unterscheidet<br />
zwischen größeren Hauptsteinen und den sogenannten Läufern, die zwischen zwei Hauptsteinen stehen. Oben ist<br />
meist eine Steinrille gezogen, die in der Richtung der Grenze verläuft. Wenn die Grenze einen Winkel bildet, ist<br />
dementsprechend auch die Steinrinne abgewinkelt.<br />
Als Wahrzeichen lagen unter den Marksteinen die sogenannten Zeugen, bestimmte Gegenstände oder Zeichen,<br />
die in jeder Gemeinde verschieden waren. So wurden Münzen, Kieselsteine, Glasscherben, Kohlen oder<br />
Tonscheiben mit Wappen verlegt. In Gechingen geschah dies bis in die Fünfziger Jahre dieses Jahrhunderts mit<br />
Tonscheiben oder spitz zulaufenden Tonkegeln, die mit einem "G "versahen waren. Verschwiegene Männer, die<br />
sogenannten Untergänger, überwachten die Marksteine (Siehe: "Der Untergänger", unter "Berufe"). Hohe Strafen<br />
wurden über die verhängt, die sie absichtlich versetzten.<br />
1986 - 1993 führte der Verfasser gemeinsam mit anderen Mitgliedern des Arbeitskreises Heimatgeschichte<br />
Gechingen eine Markungsumwanderung durch mit dem Ziel, Marksteine zu suchen, evtl. zu zählen und in Fotos<br />
festzuhalten. Es war schwierig, an Hand der vorliegenden Berichte zurechtzukommen, da im Laufe der Zeit<br />
verschiedene Steine verschwunden waren, zum Teil waren sie auch versetzt oder umgefahren worden. Die noch<br />
vorhandenen Steine wurden in einer Auflistung erfaßt und eingehend beschrieben. Diese Dokumentation ist das<br />
Ergebnis siebenjähriger, zeitraubender Forschung und hält die Zahl und den Zustand der Marksteine nach über<br />
300 Jahren fest. Einige Marksteine waren so gefährdet, daß sich die Gemeindeverwaltung entschloß, sie<br />
sicherzustellen und im Heimatmuseum unterzubringen.<br />
Häuser<br />
In der Gesetzessammlung "Lex Alamannorum", entstanden zwischen 720 und 730 n. Christus, wird das<br />
alamannische Bauerngehöft als vielgliederige Anlage beschrieben. Um das Wohnhaus als Mittelpunkt gruppiert<br />
sich eine Vielzahl von Gebäuden mit eigenen Funktionen. Das Wohnhaus ist ein Einraum mit offenen Dachstuhl,<br />
daneben befindet sich die Scheuer mit Stall, ein freistehender Speicher, eine Fruchtschütte sowie der Schaf- und<br />
Schweinestall. Die Umwandlung zum "Eindachhof" geschah in den letzten vier Jahrhunderten des Mittelalters.<br />
Wie Gechingen früher ausgesehen hat ist nur in etwa nachzuvollziehen. Von den Gebäuden hat sich allein die<br />
Kirche weitgehend erhalten. Wie stark die Kirche zur Zeit ihrer Erbauung das Dorfbild beherrscht hat, läßt sich<br />
aus der ersten württembergischen Landesverordnung von 1495 erahnen. Dort wurde vorgeschrieben, daß nur<br />
Pfarrhäuser und Wirtshäuser zwei Stockwerke haben durften, alle anderen Gebäude waren einstöckig. Als die<br />
Bevölkerungszahl wuchs, ohne daß das Dorf sich nach außen hin vergrößerte, mußten neue Hausformen<br />
gefunden werden. In unserer Heimat entstand das sogenannte "gestelzte Einhaus" oder "gestelzte<br />
231
Wohnstallhaus". Die Wohnräume lagen zum größten Teil im ersten Stock. Im Erdgeschoß war der Viehstall, der<br />
gleichzeitig eine Art Fußbodenheizung war. Besonders verbreitet war das Dreiseitengehöft, das einen zur Straße<br />
offenen Hof auf drei Seiten umschloß, wobei das Wohngebäude mit dem Giebel zur Straße stand. Beim<br />
Hakengehöft stand das Wohnhaus auch mit dem Giebel zur Straße, die Scheuer war rechtwinkelig angebaut,<br />
wodurch ein Hof entstand, in dem die von der Straße kommenden Heu- und Fruchtwagen entladen werden<br />
konnten. Manchmal war die Scheuer größer als das Wohnhaus und gehörte, wie der Hofraum, zwei Nachbarn<br />
zusammen. Im Wohnstallhaus waren Wohnung, Stall und Scheuer unter einem Dach vereint, teilweise standen sie<br />
mit mit der Traufe zur Straße.<br />
Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Mehrheit aller Häuser als Skelettbauten in Fachwerk<br />
errichtet, bei dem alle tragenden Teile aus Holz waren. Das Wandgefüge bestand aus senkrecht stehenden<br />
Kanthölzern oder Pfosten, die unten auf der waagerechten Schwelle aufsaßen und oben durch den waagerechten<br />
Rahmen zusammengeschlossen wurden. Rechtecke aus Ständern, Schwelle und Rahmen bildeten das Grundraster<br />
des Fachwerkbaus, durch waagerechte Riegel und schräge Streben wurden sie ausgesteift. Die enstehenden<br />
Gefache wurden mit Flechtwerk ausgefüllt und mit Lehm beworfen, später auch mit Feldsteinen vermauert. Ganz<br />
typisch waren die Geschoßvorkragungen, jedes Stockwerk sprang etwa 20 cm über das darunterliegende vor. In<br />
engen Gassen konnte so mehr Raum gewonnen werden.<br />
Das nachweisbar älteste Haus in unserer Gemeinde ist das sogenannte "Schulzenhaus" in der Kirchstraße, erbaut<br />
von Eberlin und Martin Weiß im Jahre 1620. Im Kellerhals unter der Scheuer steht die Jahreszahl 1573, die<br />
älteste Zahl, die bisher, außer in der Kirche, im Ort gefunden wurde. Das Baujahr des alten Hauses, das vorher<br />
dort stand, ist unbekannt, aber es bestand schon zur Zeit des ältesten namentlich bekannten Schultheißen Konrad<br />
Schneider um 1475 - 1505.<br />
An der Hauptstraße steht das "Sameels"/Haus der Familie Wagner/ Schwarz. Es wurde 1799 erbaut und 1985<br />
renoviert. Auf einem senkrechten Balken steht: "Vor Pest, Krieg, Feuer und aller Not bewahr dies Haus, o treuer<br />
Gott. Dieses Haus wurde gebaut von Bernhard Kappis und seiner Ehefrau Barbara geb. Breitling und dem<br />
Zimmermann Schwarzmaier 1799." Benannt wurde das Haus nach Samuel Wagner (1823-1908). Er hat das Haus<br />
geerbt, die Erbauer waren seine Großeltern mütterlicherseits.<br />
1750 ist das Baujahr des Hauses Bühler gegenüber dem alten Rathaus. Hier ist folgende Inschrift erhalten: "1750<br />
erbaut und 1842 renoviert. Jakob Martin Gehring und seine Hausfrau Christina Katharina. Ach Gott, bewahre<br />
dieses Haus und alle, die gehn ein und aus." Darunter kann man ein Pflugscharsymbol erkennen.<br />
Aus dem Jahr 1788 stammt das Haus von Anneliese Gehring in der Brunnenstraße, das von Michael Aichele<br />
erbaut wurde. Die heute leider nicht mehr vorhandene Inschrift lautete: "Ich achte meine Hasser gleich dem<br />
Regenwasser. Johann Michael Aichele. Wie man liest in der Bibel, so steht mein Haus im Giebel."<br />
An der Scheuer der Familie Breitling in der Dachteler Straße steht folgendes "Johann Georg Kühnle,<br />
Waldmeister, und seine Ehefrau Elisabetha Breitling." Die beiden heirateten im Jahr 1837, das dürfte wohl auch<br />
das Baujahr der Scheuer sein.<br />
An der Scheuer von Georg Kappis, heute Haus Wittel, Kirchstraße, war ein schön verzierter Balken angebracht<br />
mit der Inschrift: "Georg Ludwig Kappis und seine Hausfrau Katharina 1756". (Der Balken befindet sich jetzt im<br />
Heimatmuseum).<br />
An dem früheren Gemeindegebäude Calwer Straße 22, lesen wir die Jahreszahl 1846. Um diese Zeit erbaute der<br />
königliche Notar, Wilhelm Pregizer, dieses Haus. Von 1844 - 1848 war er Schultheiß von Gechingen. 1866<br />
verkauften seine Erben das Haus an die Gemeinde. Damals wurde an der <strong>Gechinger</strong> Schule ein Mittelschulzug<br />
gegründet und der erste Mittelschullehrer, Büttner, zog in das Haus ein. Im Laufe der Jahre wurde es um- und<br />
ausgebaut. Lehrer, Förster, Postschaffner und eine Ärztin wechselten als Mieter oder Bewohner ab. Als Anfang<br />
der 60er Jahre das Haus Zuber/Vetter in der Kunzengasse (heute Fleckenparkplatz) abgebrochen wurde, erhielt<br />
die Familie Zuber dieses Gebäude als Ersatz. Die heutigen Besitzer, Familie Kühnle, haben das alte Haus wieder<br />
instandgesetzt.<br />
Das Haus Hauptstr. 13 („Kathrins Haus“) hatte ein im Giebel sichtbares Fachwerk aus der Zeit um 1500. Nach<br />
Aussage des Denkmalamtes gibt es im Kreis Calw nur noch wenige solcher Häuser. Man erkennt diese Art des<br />
Fachwerks an der Verplattung, d.h. die Balken sind eingeschnitten und laufen deshalb übereinander. Aus<br />
bautechnischen Gründen wurde die Verplattung später verboten. Das Haus wurde leider beim Bau des Supermarktes<br />
abgerissen.<br />
An der abgebrochenen Scheuer von Kaufmann Schwarz Dachtlerstr. befand sich ein Torbalken mit der Inschrift:<br />
“alt Johann Görg und jung Johann Görg Quintzler und Christoph Schneider.1770.”<br />
Ein Ziegel auf dem Dach trug die Inschrift: “Michel Johann Schwarz (oder ähnlich) 1738.“<br />
Dahinter stand die abgebrochene Scheuer Böttinger/Krauss mit einem Torbalken, auf dem stand:<br />
“Johann Georg Quintzler, Schultheiß und seine Hausfrau Agathe. 1753.“<br />
Unter dem Verputz alter Häuser schlummert noch mancher Fachwerkbau.<br />
232
Der Schloßberg<br />
Wie schon an anderer Stelle erwähnt, geht der Ursprung der <strong>Gechinger</strong> Burg wohl auf eine keltische Fliehburg<br />
zurück. Im 11. oder 12. Jahrhundert wurde an der alten Stelle wieder eine Burg erbaut, die aber schon nach 100<br />
bis 200 Jahren zerstört wurde. Der in der Burg wohnende Ortsadel von Gechingen könnte im 14. Jahrhundert<br />
nach der Reichstadt Weil gezogen sein.Verschiedene urkundliche Belege deuten darauf hin. So wird Judela von<br />
Gechingen 1326 und 1357 als Bürgerin Weilderstadts genannt (Siehe auch: Weitere Urkunden und Inschriften).<br />
Nachdem sie schon 1326 ihre Habe in Gechingen dem Kloster Bebenhausen gestiftet hat, hinterlließ sie ihm auch<br />
ihr restliches Vermögen.<br />
1929 machte ein <strong>Gechinger</strong> - er fiel später in Rußland - den Burgenforscher K. A. Koch auf unsere Burg<br />
aufmerksam. Koch hat daraufhin die Burg genau beschrieben, wie im Heimatbuch von 1963 nachzulesen ist (Ss.<br />
18-20). In der Oberamtsbeschreibung von 1860 wird von Ausgrabungen am Schloßberg berichtet, wobei ein<br />
viereckiger Torturm mit 5 Schuh starken Mauern, jede Seite 15 Schuh lang, zum Vorschein kam.<br />
Von diesem Torturm war schon zu Kochs Zeiten nichts mehr zu sehen. Seine Ausgrabungen förderten die Reste<br />
eines Rundturms mit 10 m Durchmesser und 2,70 m starken Mauern zutage. Seither hält sich auch die Legende<br />
von den geheimen Gängen, die vom Schloß Deufringen zur Burg führen sollen. Noch in den 50er Jahren wurde<br />
von Deufringen her ein Vorstoß unternommen, wobei man tatsächlich einen unterirdischen Gang fand, der aber<br />
zusammengestürzt war. Ein Problem wäre sicher die Unterführung des Bachlaufes gewesen.<br />
Wenn man den Weg von der Burg aus über die obere Riedhalde nimmt, kommt man zu einer Mauer von roh<br />
behauenen Steinen. Es ist anzunehmen, daß hier einige Wirtschaftsgebäude standen, die zur Unterbringung von<br />
Pferden und Vorräten dienten, welche nur im Falle einer Belagerung in den engen Raum der Burg genommen<br />
wurden.<br />
1925 machte unsere Heimatdichterin Tillie Jäger den <strong>Gechinger</strong> Schloßberg zum Schauplatz ihres Spieles "Der<br />
Letzte seines Stammes."<br />
Mitglieder des Arbeitskreises Heimatgeschichte haben auf Anregung des Denkmalamtes 1993 den Turmschaft<br />
zuschütten lassen, um weitere Verwitterungen und Zerstörungen zu verhindern. Sie errichteten an dieser Stelle<br />
einen ca. 50 cm hohen Steinring , der dem Durchmesser des Turmes entspricht.<br />
Schriftliche und mündliche Quellen, Literaturverzeichnis<br />
Will man ein Heimatbuch über ein Dorf wie Gechingen schreiben, ist man auf mündliche Berichte angewiesen,<br />
die die bäuerliche Vergangenheit des Dorfes anschaulich machen, so daß den nachfolgenden Generationen das<br />
Leben ihrer Vorfahren verständlich bleibt - schon heute können sich viele junge Leute nicht mehr vorstellen, wie<br />
ihre Großeltern gelebt haben. Viele, vor allem alte und ältere Mitbürger, nicht nur aus dem Arbeitskreis<br />
Heimatgeschichte, haben durch Hinweise, Berichte, und Geschichten wertvolle Beiträge geleistet. Sie können<br />
nicht alle aufgezählt werden, haben aber mitgeholfen, daß das Heimatbuch nicht nur ein Buch für die <strong>Gechinger</strong>,<br />
sondern auch von den <strong>Gechinger</strong>n geworden ist. Ihnen und allen Genannten und Ungenannten, die uns mit Rat<br />
und Hilfe beistanden, sei hier noch einmal herzlich Dank gesagt!<br />
Albert, Dieter, Rutesheim, Quellenforschung im Staatsarchiv und Landesbibliothek Stgt.<br />
Beck, Alfred, Darmsheimer Heimatbuch<br />
Böttinger, Johannes, Heimatdichter<br />
Bunz, Christian Gottlob Erhard, Der Franzosenfeiertag, Reutlingen, 1891<br />
Christlein, Rainer, Theiss Verlag 1979 Die Alamannen<br />
Dannemann, Rainer, Jahresberichte<br />
Der Kreis Calw, Konrad Theiss Verlag 1979<br />
Deutsche Feuerwehrzeitung 1874 - 80<br />
Die <strong>Gechinger</strong> Schultheißen und ihre Zeit, Dokumentation der Ausstellung des AKH 1994<br />
Eisenhardt, Martha, Gechingen, Beratung bei Dialekt, Leben der Frauen, Landwirtschaft<br />
Ernst, Gottlob, Deckenpfronn 1956<br />
Essig, Christa, Gechingen, Kirchengeschichte<br />
Essig, Karl Friedrich, <strong>Gechinger</strong> Heimatbuch 1963, Aufzeichnungen<br />
Essig, Willy, Gechingen, Mr nemmt´s wia´s kommt, 1994, mündliche Berichte<br />
Faitsch, Joachim, Trachten in Gechingen<br />
Fischer, Hermann, Schwäbisches Wörterbuch, Tübingen 1904<br />
Frommer Max, Vom Leben auf dem Lande, Theiss Verlag 1983<br />
Geschichtsverein Schönbuch und Gäu<br />
233
Geschichte des Bäckerhandwerks<br />
Griesinger, Carl Theodor, Schwäbische Arche Noah, M. Blümcke, Theiss Verlag 1979<br />
Grube Prof., Ludwigsburg<br />
Heimberger, Fritz, Kreisarchivar Böblingen<br />
Heinrich, Ingrid, Leben der E. Wuchter<br />
Jäger, Tillie, Heimatdichterin<br />
Jahrbuch Kreis Calw, l985 und folgende<br />
Jourdan, Eugen, Neuhengstett<br />
Kataloge und Begleitbücher des Hohenloher Freilandmuseums Schwb. Hall-Wackershofen, insbesondere:<br />
Tiere und Pflanzen im alten Dorf 1988<br />
Ländliche Bauten aus dem fränkischen Württemberg 1991<br />
So war´s im Winter 1994<br />
Fast alle Tage Kraut 1995<br />
Frauen im Dorf 1996<br />
Kreisnachrichten Calw<br />
Kurz, Gabriele, Gräber u. Siedlungen beim Viesenhäuser Hof, Amtsblatt Juni 1995<br />
Lämmle, August, Die Reise ins Schwabenland, Stuttgart 1937<br />
Löffler J., Forstdirektor<br />
Mitteilungsblatt Gechingen<br />
Mönch, Wilhelm, Heimatkunde O.A. Calw<br />
Neumüllers-Klauser, Renate, Die Inschriften des Landkreises Calw, Reichert Verlag 1992<br />
Ortssippenbuch Gechingen 1994<br />
Sabean, David Warren, Property, production, and family in Neckarhausen, 1700-1870<br />
Sattler, Topographische Geschichte des Herzogtums Württemberg, Stuttgart 1784<br />
Schlehengäuschule Gechingen<br />
Schmid, Hermann, Tagebuch<br />
Schmidt Dr., Ebhausen<br />
Schorpp, Karl Heinz, Gechingen, Frühe urkundliche Nennung des Ortes Gechingen, 1989<br />
Schul - und Kirchenblatt Württemberg<br />
Schwarz, Tilmann, Kirchengeschichte<br />
Schwarzwälder Bote<br />
Stein, Otto, Dr., Lebenslauf<br />
Steimle, 0ttilie, Heimatdichterin<br />
Seytter, Wilhelm, Unser Stuttgart<br />
Strzempek, Josef, Gechingen, Frühgeschichte<br />
Unger, Ernst, Chorleiter u. Dichter<br />
Vereinsberichte<br />
Vogeler, Renate, Fachkundige historische Beratung und Unterstützung<br />
Weiß, 0tto, Altbürgermeister<br />
Weller, Karl und Arnold, Württembergische Geschichte im südwestdeutschen Raum, Theiss Verlag, 1972<br />
Die Archive des Rathauses, des Pfarrhauses und der "Heimatstuben"<br />
Fotos: Weiß, 0tto, Fotograf<br />
Heinrich, Chris, Rektor<br />
Rathaus Bilderarchiv<br />
"Heimatstuben" Bilderarchiv<br />
Mörk, Karl Friedrich, Reporter<br />
Privat<br />
234
Bilder zum Buch<br />
235