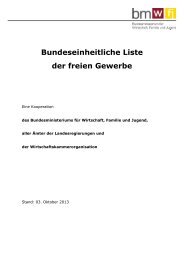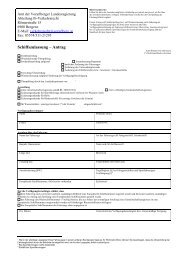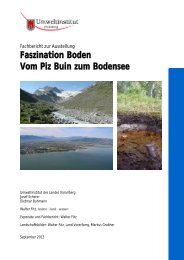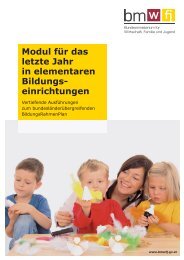Wildfütterung-im-Umbruch (3.2 MB ) - Vorarlberg
Wildfütterung-im-Umbruch (3.2 MB ) - Vorarlberg
Wildfütterung-im-Umbruch (3.2 MB ) - Vorarlberg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Wildfütterung</strong> <strong>im</strong> <strong>Umbruch</strong><br />
Hubert Schatz<br />
Die Fütterung von Rot- und<br />
Rehwild steht derzeit wieder<br />
einmal stark in Diskussion.<br />
Die Kritiker wissen in den<br />
Fütterungen den Grund für<br />
zu hohe Wildbestände, zu<br />
geringe Abschussquoten und<br />
untragbare Wildschäden <strong>im</strong><br />
Wald. Außerdem werden seit<br />
der Wiederkehr von Tuberkulose<br />
bei Rindern Rotwildfutterstellen<br />
als Nährboden<br />
für diese Krankheit gesehen.<br />
Folgt man den saloppen<br />
Aussagen mancher Fütterungsgegner,<br />
so könnte man<br />
meinen, dass sich all diese<br />
Probleme und Behauptungen<br />
mit dem Verbot von <strong>Wildfütterung</strong>en<br />
<strong>im</strong> Nichts auflösen<br />
würden. Dass ein radikal<br />
verändertes Überwinterungsmanagement<br />
be<strong>im</strong> Rotwild in<br />
unserer ausgeprägten Kulturlandschaft<br />
aber mit Sicherheit<br />
wieder zu vielen altbekannten<br />
Schwierigkeiten führen<br />
würde, wird dabei völlig negiert<br />
oder bewusst verschwiegen.<br />
Von der Almosen- zur<br />
Sättigungsfütterung<br />
Obwohl die <strong>Wildfütterung</strong><br />
vereinzelt bereits aus dem<br />
Mittelalter bekannt ist, wurde<br />
sie <strong>im</strong> Alpenraum mit<br />
wenigen Ausnahmen erst<br />
nach dem Zweiten Weltkrieg<br />
entwickelt. Die älteste<br />
bekannte Rotwildfütterung<br />
<strong>Vorarlberg</strong>s befindet sich in<br />
St. Anton <strong>im</strong> Montafon und<br />
stammt aus dem Ende des 19.<br />
Jahrhunderts. Entstanden ist<br />
die Fütterung ursprünglich<br />
aus Tierschutzgründen. Um<br />
das Wild vor dem Hungertod<br />
zu bewahren, wurde den<br />
Tieren, in der Regel Rotwild,<br />
in unmittelbarer Nähe von<br />
Häusern und Höfen meist<br />
nur eine spärliche Gabe an<br />
qualitativ geringwertigem<br />
Heu vorgelegt. Rasch erkannte<br />
jedoch die Jagd die Vorteile<br />
der Fütterung. Nachdem in<br />
den armen Nachkriegsjahren<br />
die Inhaber von Jagdrevieren,<br />
insbesondere auch zahlreiche<br />
Jagdgenossenschaften in den<br />
strukturschwachen Tälern,<br />
an einer Aufhege eines guten<br />
Rotwildbestandes sehr interessiert<br />
waren, um reiche Jäger<br />
aus dem In- und Ausland als<br />
Jagdpächter und somit auch<br />
als finanzielle Unterstützer<br />
für verschiedene Anliegen<br />
der Gemeinde zu gewinnen,<br />
wurden damals <strong>Wildfütterung</strong>en<br />
auch von vielen<br />
Grundeigentümervertretern<br />
gefordert und gefördert. Fütterungen<br />
dienten somit nicht<br />
nur als Lenkinstrument für<br />
Wildtiere, sondern auch als<br />
Lockmittel für Jagdpächter.<br />
Anhand der Abschussstatistik<br />
sowie aus zahlreichen<br />
Erzählungen von Zeitzeugen<br />
ist zu entnehmen, dass<br />
in <strong>Vorarlberg</strong> das Rotwild<br />
bereits in den 1960er Jahren<br />
großflächig vorgekommen<br />
ist. Neben den meist tiefer<br />
gelegenen Gebieten der heutigen<br />
Rand- und Freizonen<br />
hat das Rotwild aber bereits<br />
damals in den Bergregionen<br />
vieler Talschaften, meistens<br />
in Unterstützung von extensiven,<br />
d.h. nur unregelmäßig<br />
betreuten und mengenmäßig<br />
gering beschickten Heufütterungen<br />
überwintert. Trotz<br />
dieser „Diätfütterung“ sind<br />
die Rotwildbestände in den<br />
1960er und 1970er Jahren rasant<br />
angestiegen. Mit zunehmendem<br />
Wohlstand und Fokus<br />
der Jagd auf die Trophäe<br />
wurde das Heu <strong>im</strong> Laufe der<br />
Zeit vieler Orts durch Getreidemischungen,<br />
Ackerfrüchte,<br />
etc. ergänzt bzw. ersetzt, was<br />
logischerweise zu einem starken<br />
Anstieg der Wildschäden<br />
führte.<br />
Spätestens ab diesem Zeitpunkt<br />
wurde klar, dass der<br />
Winterfütterung viel mehr die<br />
Aufgabe der Wildschadensvermeidung<br />
als der Wildhege<br />
zukommen muss. Neben<br />
Fachleuten aus Revier und<br />
Praxis wurde dazu auch die<br />
Wissenschaft zu Hilfe gerufen,<br />
um entsprechende Fütterungs-<br />
und Überwinterungskonzepte<br />
zum Schutze des<br />
Waldes zu entwickeln. Als<br />
Ergebnis entstand die heute<br />
übliche, in der Regel täglich<br />
4 <strong>Vorarlberg</strong>er Jagd WILDBIOLOGIE
etreute „Sättigungsfütterung“<br />
mit dem Ziel, das Wild<br />
während der Wintermonate<br />
und des Vegetationsbeginnes<br />
möglichst kleinflächig an das<br />
Fütterungseinstandsgebiet zu<br />
binden und ausreichend mit<br />
Futter zu versorgen.<br />
Bewirtschaftungssystem<br />
baut auf<br />
Winterfütterung auf<br />
Nachdem ein durchdachtes,<br />
umfassendes Rotwildmanagement<br />
untrennbar mit<br />
der vorherrschenden Lebensraumsituation<br />
und Waldstruktur<br />
zusammenhängt,<br />
wurde in <strong>Vorarlberg</strong> vor<br />
knapp 30 Jahren die Wildökologische<br />
Raumplanung<br />
entwickelt, für deren Ziele<br />
und Aufgaben die Fütterung<br />
des Rotwildes in der Kernzone<br />
ein wesentliches und unverzichtbares<br />
Managementinstrument<br />
darstellt. Um die<br />
vom Rotwild häufig verursachten<br />
Winterschäden flächenmäßig<br />
einzugrenzen,<br />
wurden die zahlreich verteilten<br />
Fütterungsstellen zu<br />
Zentralfütterungen zusammengezogen<br />
und seither von<br />
den Hegegemeinschaften betrieben.<br />
Die Forderung nach<br />
einer klaren räumlichen Begrenzung<br />
von Wildschäden<br />
<strong>im</strong> Wald gipfelte in der Errichtung<br />
von Wintergattern,<br />
deren sieben an der Zahl seither<br />
in <strong>Vorarlberg</strong> <strong>im</strong> Einsatz<br />
sind.<br />
Die gegenwärtige Winterverteilung<br />
des Rotwildes<br />
bestätigt die Funktionstüchtigkeit<br />
des vorherrschenden<br />
Rotwildüberwinterungsmanagements,<br />
denn seit Umsetzung<br />
der Wildökologischen<br />
Raumplanung sind rotwildbedingte<br />
Winterschäden fast<br />
ausschließlich auf die Fütterungseinstandsgebiete<br />
reduziert.<br />
Dass sich die Schäden<br />
in diesen vergleichsweise eng<br />
gehaltenen Arealen <strong>im</strong> Laufe<br />
der Jahre auf ein hohes Maß<br />
angesammelt haben, liegt in<br />
der Natur der Sache. Dass dafür<br />
aber ein Großteil des <strong>Vorarlberg</strong>er<br />
Waldes während<br />
Heu muss das Grundnahrungsmittel jeder <strong>Wildfütterung</strong> sein<br />
der Wintermonate vom Rotwild<br />
nicht genutzt und von<br />
dieser Wildart somit auch<br />
keinen Schaden erleidet, wird<br />
von den kritischen Betrachtern<br />
gerne übersehen.<br />
Keine Rotwildfütterungen<br />
– wenig Wild<br />
– wenig Schäden<br />
So in etwa könnte man die<br />
Wunschvorstellungen der<br />
Fütterungskritiker beschreiben.<br />
Fütterungen haben unbestritten<br />
einen Einfluss auf<br />
die Bestandesdynamik, was<br />
aber nicht nur die Bestandesdichte,<br />
sondern vielmehr die<br />
räumliche Verteilung des<br />
Wildes betrifft. Ob sich beispielsweise<br />
300 Stück Rotwild<br />
<strong>im</strong> Winter auf einem tausende<br />
Hektar großen Lebensraum<br />
beliebig verteilen dürfen oder<br />
sich auf zwei 50 ha große<br />
Fütterungseinstandsgebiete<br />
konzentrieren müssen, bedeutet<br />
einen gewaltigen Dichteunterschied<br />
pro Flächeneinheit.<br />
Während dieselbe Stückzahl<br />
auf großem Raum kaum<br />
in Erscheinung tritt, erwirken<br />
150 Stück am Futterplatz<br />
bzw. <strong>im</strong> Tageseinstand eine<br />
Massenansammlung. Es stellt<br />
sich dabei aber die Frage, ob<br />
es sich mit den Wildschäden<br />
gleich verhält. Nur zu einem<br />
geringen Teil, denn selbst<br />
unter freier bzw. natürlicher<br />
Überwinterung des Rotwildes<br />
gibt es wildart- und lebensraumbedingt<br />
sehr wohl<br />
bevorzugte Aufenthaltsorte<br />
mit ausgeprägten Konzentrationen<br />
von Wildschäden,<br />
als auch weit verstreute Verbiss-<br />
und Schälschäden. Dies<br />
ist letztendlich auch der ausschlaggebende<br />
Grund, warum<br />
der Mensch bereits seit<br />
Jahrzehnten in die Überwinterungsstrategie<br />
des Rotwildes<br />
hineinpfuscht und mit<br />
Hilfe unterschiedlicher Konzepte<br />
und Fütterungsempfehlungen<br />
bemüht ist, diese<br />
Wildart in unsere Kulturlandschaft<br />
möglichst tragbar zu<br />
integrieren.<br />
Bewirkt die Auflassung<br />
von Rotwildfütterungen<br />
automatisch<br />
wenig(er) Wild<br />
Für hochgelegene sowie für<br />
sehr schneereiche Regionen<br />
würde dies zumindest<br />
während der Wintermonate<br />
zutreffen, für viele andere<br />
Landesteile hingegen mit<br />
Sicherheit nicht. Der Grund<br />
dafür liegt in der ausgesprochen<br />
hohen biotischen Lebensraumkapazität<br />
unserer<br />
bäuerlichen Kulturlandschaft<br />
für Rotwild. Neben den außergewöhnlich<br />
ertragreichen<br />
Sommerlebensräumen bieten<br />
ein Großteil der Rand- und<br />
Freizonen sowie ein nicht<br />
zu unterschätzender Anteil<br />
der bestehenden Kernzonenfläche<br />
hervorragend geeignete<br />
natürliche Rotwild-<br />
Überwinterungsgebiete. Das<br />
Rotwild braucht daher mit<br />
Sicherheit keine Fütterung,<br />
um zu überleben, sich zu<br />
vermehren und sich somit zu<br />
erhalten. Die Beispiele Graubünden,<br />
St. Gallen, Südtirol,<br />
etc. sowie wenige Gebiete<br />
WILDBIOLOGIE Januar/Februar 2014 5
<strong>im</strong> eigenen Land bestätigen<br />
dies eindrucksvoll. Trotz fütterungsloser<br />
Überwinterung<br />
befinden sich auch die Rotwildbestände<br />
in diesen Ländern<br />
auf einem hohen Dichteniveau<br />
mit teilweise stark<br />
ansteigenden Beständen.<br />
Besonders interessant ist dafür<br />
das Beispiel Liechtenstein, wo<br />
vor knapp 10 Jahren von einer<br />
Intensivfütterung auf ein<br />
Notfütterungskonzept umgestellt<br />
wurde. Obwohl sich die<br />
Abschusshöhe seither kaum<br />
verändert hat, befindet sich<br />
der jährliche Fallwildanteil auf<br />
einer absolut vernachlässigbaren<br />
Größe, was den Schluss<br />
zulässt, dass in Liechtenstein<br />
die Beendigung der regelmäßigen<br />
Rotwildwinterfütterung<br />
kaum einen Einfluss auf die<br />
Bestandesdynamik, insbesondere<br />
die Zuwachsrate, genommen<br />
hat. Bei uns würde dies<br />
mit großer Wahrscheinlichkeit<br />
ähnlich zutreffen, zumindest<br />
würden die Rotwildpopulationen<br />
in den jeweiligen Rotwildräumen<br />
keinen populationsgefährdenden<br />
Schaden<br />
erleiden, sofern man dem<br />
Wild wirklich und ehrlich seinen<br />
freien Lauf mit beliebiger<br />
Raumwahl gäbe.<br />
Problematisch ist aber, dass in<br />
vielen Fällen nach Auflassung<br />
von Fütterungen das Rotwild<br />
auch ohne Futtervorlage eine<br />
Zeitlang hartnäckig in seinen<br />
seit Jahrzehnten vertrauten<br />
Wintereinstandsgebieten verbleiben<br />
würde, nach einer gewissen<br />
Zeit sukzessive seinen<br />
Aktionsradius ausweiten und<br />
sich erst <strong>im</strong> Laufe von Jahren<br />
räumlich völlig neu verteilen<br />
würde. Ob für solche waghalsige<br />
Exper<strong>im</strong>ente <strong>im</strong> Land<br />
tatsächlich Platz ist, ist mehr<br />
als nur zu bezweifeln. Denn<br />
wer übern<strong>im</strong>mt die damit<br />
verbundenen hohen Risiken<br />
von Wildschäden <strong>im</strong> Wald<br />
und wo gibt es die Toleranz,<br />
um das Rotwild in den heutigen<br />
Rand- und Freizonen<br />
oder sonnig exponierten<br />
Hang- und Schutzwaldlagen<br />
überwintern zu lassen<br />
Wer glaubt, diese Fragen mit<br />
einer extremen Absenkung<br />
der Rotwilddichte zu beantworten,<br />
ist ein Fantast oder<br />
ein Realitätsverweigerer.<br />
Denn wenn man sieht, wie<br />
gering die Toleranz gegenüber<br />
dem natürlich überwinternden<br />
Gams- und teilweise<br />
Rehwild in Schutzwaldgebieten<br />
ist, so erübrigt sich die<br />
Diskussion über die natürliche<br />
Überwinterung des Rotwildes<br />
in diesen Lagen vollkommen.<br />
Natur wollen, aber<br />
keine Natur zulassen, kann<br />
eben nicht funktionieren!<br />
Modetrends können<br />
gefährlich sein<br />
Obwohl sich die Lebensraumansprüche<br />
der Tiere kaum<br />
ändern, sind die Jagd und<br />
das Wildtiermanagement<br />
ausgeprägten Modetrends<br />
unterworfen. Unter dem<br />
Motto „Zurück zur Natur“,<br />
ist derzeit auch in der Jagd<br />
ein deutlicher Trend zu mehr<br />
„freiem Wild“, d.h. zu weniger<br />
gelenkten oder von Fütterungen<br />
beeinflusstes Rotwild<br />
festzustellen. Mit diesen<br />
Vorschlägen kommt man in<br />
öffentlichen Diskussionen<br />
sowie bei vielen verwandten<br />
Interessensvertretungen gut<br />
an, natürlich <strong>im</strong> Glauben,<br />
dass damit eine wesentliche<br />
Schadensentlastung <strong>im</strong> Wald<br />
verknüpft wäre. Außerdem<br />
erwartet man sich beispielsweise<br />
durch die Umstellung<br />
auf reine Heufütterungen<br />
eine flächigere Verteilung<br />
des Rotwildes und somit eine<br />
leichtere Bejagung unter Partizipation<br />
aller sich in einer<br />
Wildregion befindlichen Revieren.<br />
Diese Überlegungen sind<br />
teilweise zwar Theorie, dem<br />
Grunde nach aber zu begrüßen<br />
und, wo sinnvoll, auch zu<br />
unterstützen. Doch es muss<br />
dringend davor gewarnt<br />
werden, den Menschen mit<br />
solchen Vorhaben Sand in die<br />
Augen zu streuen und damit<br />
auch ein bisher mehr oder<br />
weniger bewährtes Bewirtschaftungskonzept<br />
ins Wanken<br />
zu bringen. Was in der<br />
einen Region oder Talschaft<br />
biotopbedingt funktionieren<br />
kann, muss nicht überall<br />
passen. Derzeit wird der für<br />
den Wald positive Lenkungsund<br />
räumliche Bindungseffekt<br />
von attraktiv gestalteten<br />
Rotwildfütterungen gerne<br />
oder bewusst übersehen. Reine<br />
Heufütterungen sind vor<br />
allem in kl<strong>im</strong>atisch milderen<br />
Regionen mit Sicherheit nicht<br />
in der Lage, das Rotwild<br />
während des Winters und<br />
vor allem des Vegetationsbeginns<br />
an das Fütterungseinstandsgebiet<br />
zu binden und<br />
somit Schäden außerhalb<br />
dieser Fläche zu vermeiden.<br />
All das hat man vor mehr<br />
als 30 Jahren ja schon erlebt<br />
und daher eine Änderung<br />
<strong>im</strong> Fütterungsmanagement<br />
entwickelt. Die Umstellung<br />
auf qualitativ und quantitativ<br />
gute Heufütterungen reduziert<br />
mit Sicherheit nicht die<br />
jährliche Zuwachsrate be<strong>im</strong><br />
Rotwild und stellt daher keine<br />
Ersatzmaßnahme für ein<br />
allfälliges Regulierungs- bzw.<br />
Abschussdefizit dar. Aus diesem<br />
Grund muss man sehr<br />
aufpassen, dass heute nicht<br />
aus reinem Populismus oder<br />
Opportunismus wieder dieselben<br />
Probleme geschaffen<br />
werden, wie sie vor 30 Jahren<br />
flächig vorhanden waren.<br />
Das Ziel, dem Rotwild wieder<br />
mehr Raum und Natur<br />
zu bieten, ist vollumfänglich<br />
zu begrüßen und wo geht<br />
auch zu unterstützen. Dies<br />
verlangt jedoch einige Änderungen<br />
<strong>im</strong> Forst- und Jagdgesetz,<br />
vor allem aber auch<br />
eine andere Denkweise und<br />
Einstellung von Fachleuten<br />
und Interessensgruppen <strong>im</strong><br />
Beziehungsgefüge Wald –<br />
Rotwild.<br />
Mehr Raum für das Rotwild<br />
setzt mehr Toleranz gegenüber<br />
dieser Wildart voraus.<br />
Ist diese gegenwärtig tatsächlich<br />
schon gegeben In zahlreichen<br />
Fällen hat man eher<br />
den gegenteiligen Eindruck.<br />
Aus diesem Grund sollten<br />
Veränderungen sehr bedacht<br />
und überlegt vorgenommen<br />
werden, damit bei solchen<br />
Vorhaben bzw. Umstellungen<br />
das Kind nicht mit dem<br />
Bade ausgeschüttet wird.<br />
Außerdem müssen bei solchen<br />
Ansinnen alle betroffenen<br />
Interessensgruppen<br />
ihren Beitrag leisten und das<br />
Vorhaben <strong>im</strong> Sinne der Sache,<br />
nämlich dem Rotwild<br />
wieder mehr Platz und Freiheit<br />
zu gewähren, positiv<br />
unterstützen, denn einseitige<br />
Änderungen sind mit<br />
Sicherheit zum Scheitern<br />
verurteilt.<br />
6 <strong>Vorarlberg</strong>er Jagd WILDBIOLOGIE