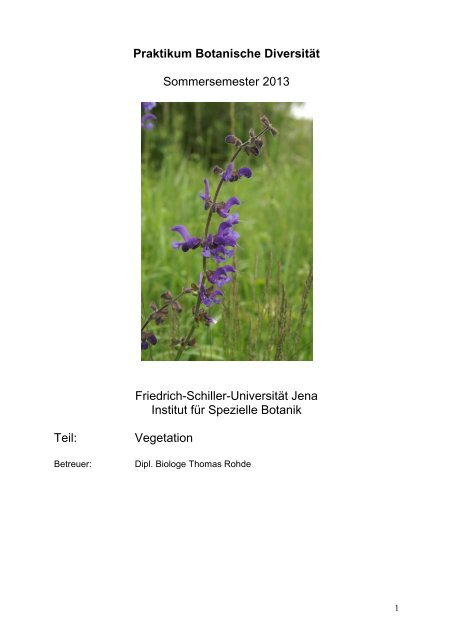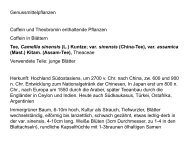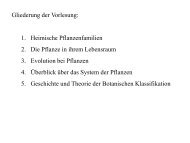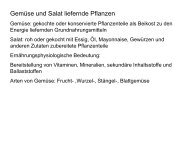Skript Vegetation - Botanischer Garten Jena - Friedrich-Schiller ...
Skript Vegetation - Botanischer Garten Jena - Friedrich-Schiller ...
Skript Vegetation - Botanischer Garten Jena - Friedrich-Schiller ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Praktikum Botanische Diversität<br />
Sommersemester 2013<br />
<strong>Friedrich</strong>-<strong>Schiller</strong>-Universität <strong>Jena</strong><br />
Institut für Spezielle Botanik<br />
Teil:<br />
Betreuer:<br />
<strong>Vegetation</strong><br />
Dipl. Biologe Thomas Rohde<br />
1
<strong>Vegetation</strong><br />
(Außenkurs)<br />
In diesem Kursteil sollen grundlegende Inhalte und Arbeitstechniken der botanischökologischen<br />
Geländearbeit und <strong>Vegetation</strong>skunde vermittelt werden. Hierbei soll auch auf<br />
den Zusammenhang von Landnutzungssystemen und pflanzlicher Biodiversität sowie<br />
historische Aspekte der Pflanzenverbreitung und <strong>Vegetation</strong>sbeeinflussung eingegangen<br />
werden.<br />
* Voraussetzungen:<br />
Vorbereitung:<br />
Es wird vorausgesetzt, dass folgende Inhalte und Begrifflichkeiten aus den<br />
Vorlesungsabschnitten „Geobotanik“ und „<strong>Vegetation</strong>skunde“ (WS 2009/10)<br />
bekannt sind oder durch Selbststudium erschlossen wurden (siehe auch<br />
Literaturempfehlungen):<br />
Hauptrichtungen der <strong>Vegetation</strong>skunde, physiognomische und<br />
pflanzensoziologische <strong>Vegetation</strong>sbeschreibung; Pflanzensoziologie;<br />
pflanzensoziologische <strong>Vegetation</strong>saufnahme; Mindestaufnahmefläche<br />
(„Minimumareal“); ökologische Zeigerwerte; Grundbegriffe der Geologie,<br />
Geomorphologie und Pedologie; Standortbeschreibung und Bodenprofil;<br />
Naturraum, Florenregion, pflanzengeografischer Bezirk, Landschaftseinheit,<br />
Niederschlagsgebiet; Lokalklima.<br />
Darüber hinaus sollten Kenntnisse zur Charakterisierung des<br />
Untersuchungsgebiets vorliegen (Mittleres Saaletal, Pennickental).<br />
Arbeitsmittel:<br />
- ROTHMALER, Exkursionsflora von Deutschland, Bd. 4 (Kritischer Band, 2005)<br />
- ROTHMALER, Exkursionsflora von Deutschland, Bd. 3 (Atlas, 2000)<br />
- SCHUBERT, HILBIG, KLOTZ (2001): Bestimmungsbuch der<br />
Pflanzengesellschaften Deutschlands<br />
- BARTELS, H. (1995): Merkmale mitteleuropäischer Pflanzenfamilien<br />
- Kladde / Schreibunterlage im Format A4<br />
- Einschlaglupe<br />
- Digitalkamera<br />
* Inhalt / Lern- und Qualifikationsziele<br />
(Vortrag/Demonstration: V und Übung: Ü):<br />
Bachelor (Dauer: 4 Stunden):<br />
V: Beschreiben Sie die umgebende Landschaft! Welche Pflanzenformationen<br />
und/oder Biotoptypen können Sie erkennen Nach welchen Kriterien grenzen Sie<br />
2
die unterschiedenen Flächen voneinander ab Welche Pflanzenarten sind jeweils<br />
in besonderer Weise prägend<br />
V: Betrachten Sie frischere Wirtschaftswiesen und Halbtrockenrasen! Wie<br />
unterscheiden sich diese bei Betrachtung aus größerer Entfernung<br />
V: Betrachten Sie die Lage (links- oder rechtsseits der Saale, innerhalb oder<br />
oberhalb der Aue, an einem der Saale zufließenden Bach oder an der Saale) und<br />
Form des Dorfes (mit oder ohne Anger, Friedhof inner- oder außerhalb des<br />
Dorfkerns) sowie die Form und Größe der Höfe! Welches dorftypische Getränk<br />
wird hier heute noch gezapft Welche Schlüsse können Sie aus den betrachteten<br />
Fakten auf die Besiedlung sowie auf die frühere Landnutzung schließen<br />
Vergleichen Sie mit der heutigen Nutzung: entsprechen die für frühere Zeit<br />
erwarteten Landnutzungen mit der heutigen <strong>Vegetation</strong> überein<br />
Ü: Beschreiben Sie die abiotischen Standortverhältnisse! Welche Rückschlüsse<br />
lassen diese auf die zu erwartenden Pflanzenarten zu<br />
V: Wählen Sie eine Fläche mit homogenen Erscheinungsbild für eine<br />
<strong>Vegetation</strong>saufnahme aus! Ermitteln Sie zunächst die Mindestgröße für die<br />
pflanzensoziologische <strong>Vegetation</strong>saufnahme (Mindestaufnahmefläche)!<br />
Ü: Fertigen Sie eine pflanzensoziologische Aufnahme von einer <strong>Vegetation</strong>seinheit<br />
inkl. Standortbeschreibung an! Dokumentieren Sie die Fläche und Umgebung vor<br />
Ausführung (Fotos)! (Gruppenarbeit; 3 Gruppen)<br />
Ü: Graben Sie ein Bodenprofil Ihrer Aufnahmefläche, dokumentieren Sie dies (Foto)<br />
und beschreiben Sie den Bodenaufbau! (Gruppenarbeit)<br />
V: Vergleichen Sie die Aufnahmeflächen und Bodenprofile der einzelnen Gruppen!<br />
BioGeo (Dauer: 5 Stunden):<br />
V: Beschreiben Sie die umgebende Landschaft! Welche Pflanzenformationen<br />
und/oder Biotoptypen können Sie erkennen Nach welchen Kriterien grenzen Sie<br />
die unterschiedenen Flächen voneinander ab Welche Pflanzenarten sind jeweils<br />
in besonderer Weise prägend<br />
V: Betrachten Sie frischere Wirtschaftswiesen und Halbtrockenrasen! Wie<br />
unterscheiden sich diese bei Betrachtung aus größerer Entfernung<br />
V: Betrachten Sie die Lage (links- oder rechtsseits der Saale, innerhalb oder<br />
oberhalb der Aue, an einem der Saale zufließenden Bach oder an der Saale) und<br />
Form des Dorfes (mit oder ohne Anger, Friedhof inner- oder außerhalb des<br />
Dorfkerns) sowie die Form und Größe der Höfe! Welches dorftypische Getränk<br />
wird hier heute noch gezapft Welche Schlüsse können Sie aus den betrachteten<br />
Fakten auf die Besiedlung sowie auf die frühere Landnutzung schließen<br />
Vergleichen Sie mit der heutigen Nutzung: entsprechen die für frühere Zeit<br />
erwarteten Landnutzungen mit der heutigen <strong>Vegetation</strong> überein<br />
3
Ü: Beschreiben Sie die abiotischen Standortverhältnisse! Welche Rückschlüsse<br />
lassen diese auf die zu erwartenden Pflanzenarten zu<br />
Ü: Wählen Sie eine Fläche mit homogenen Erscheinungsbild für eine<br />
<strong>Vegetation</strong>saufnahme aus! Ermitteln Sie zunächst die Mindestflächengröße für<br />
die nachfolgende pflanzensoziologische <strong>Vegetation</strong>saufnahme<br />
(Mindestaufnahmefläche)!<br />
Ü: Überlegen Sie sich, wie Sie bei der pflanzensoziologischen <strong>Vegetation</strong>saufnahme<br />
vorgehen wollen! Wie kann die Aufnahmefläche sinnvoll (gedanklich) unterteilt<br />
werden Überlegen Sie, ob Sie zunächst die häufigsten oder die auffälligsten<br />
oder die Ihnen am nächsten wachsenden Pflanzenarten ermitteln wollen und wie<br />
Sie die <strong>Vegetation</strong> dabei am längsten schonen können! Überlegen Sie sich, wie<br />
Sie mit schwer bestimmbaren Pflanzenarten verfahren wollen: bestimmen Sie<br />
diese sofort oder stellen Sie die Bestimmung zeitlich zurück Wie dokumentieren<br />
Sie diese Arten<br />
Ü: Fertigen Sie von 2 unterschiedlichen Flächen jeweils eine pflanzensoziologische<br />
Aufnahme inkl. Standortbeschreibung an! Dokumentieren Sie die Flächen und die<br />
Umgebung vor Ausführung (Fotos)! (Gruppenarbeit; 3 Gruppen)<br />
Ü: Graben Sie jeweils ein Bodenprofil Ihrer Aufnahmefläche, dokumentieren Sie dies<br />
(Foto) und beschreiben Sie den Bodenaufbau! (Gruppenarbeit)<br />
Ü: Stellen Sie jeweils den anderen Gruppen Ihre Aufnahmefläche und Bodenprofil<br />
vor und vergleichen Sie die Unterschiede!<br />
* Berichtspflicht:<br />
Protokoll inkl.:<br />
- Protokoll-Inhalte siehe unten<br />
- 3 <strong>Vegetation</strong>saufnahmen (jeweils Standortbeschreibung und Artenliste mit<br />
Häufigkeit/ Deckungsgrad)<br />
- Auswertung der ökologischen Zeigerwerte für Stickstoff und Wasser für eine<br />
Aufnahmefläche<br />
- 1 geordnete <strong>Vegetation</strong>stabelle aller 3 Aufnahmeflächen mit Auswertung<br />
* Abgabe des Protokolls:<br />
3 Wochen nach dem Außentermin<br />
Treffpunkt: Leutra/Autobahnbrücke, Am Gleisberg<br />
4
Literatur<br />
ELLENBERG, H. (1996): <strong>Vegetation</strong> Mitteleuropas (insbes. S. 19-34, 38-73, 111-116, 141-<br />
143, 665-717)<br />
DIERSCHKE, H. (1994): Pflanzensoziologie: Grundlagen und Methoden<br />
POTT, R. (1995): Die Pflanzengesellschaften Deutschlands<br />
SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL (2002, 2008): Lehrbuch der Bodenkunde (inbes. S. 1-7,<br />
439-459, 473-504)<br />
SCHUBERT, HILBIG, KLOTZ (2001): Bestimmungsbuch der Pflanzengesellschaften<br />
Deutschlands (insbes. S. 1-23)<br />
WAGENBRETH & STEINER (1990): Geologische Streifzüge (Thüringen - S. 76-134, <strong>Jena</strong> -<br />
S. 97 f.)<br />
WILMANNS, O (1998, 2002): Ökologische Pflanzensoziologie<br />
Bestimmungsliteratur, alternativ:<br />
- SCHMEIL-FITSCHEN (2009): Flora von Deutschland und angrenzender Länder<br />
- OBERDORFER, E. (2001): Pflanzensoziologische Exkursionsflora<br />
Bestimmungsliteratur, Ergänzungen:<br />
- CONERT, HJ. (2000): Pareys Gräserbuch: Die Gräser Deutschlands erkennen und<br />
bestimmen<br />
- DÜLL & KUTZELNIGG (2005): Taschenlexikon der Pflanzen Deutschlands. Botanischökologisches<br />
Exkursionstaschenbuch<br />
- FITSCHEN, J. (2006): Gehölzflora.<br />
5
Liebe Studierende,<br />
für das Biodiversitäts-Außenpraktikum im Leutratal ist der Treffpunkt "Leutra / Autobahnbrücke" angegeben.<br />
Die Ortsbezeichnung "Leutra" bezieht sich auf die geschlossene Ortslage.<br />
Somit ist folgender Treffpunkt vorgesehen:<br />
http://maps.google.de/mapsq=50.870751,11.570786&hl=de&ll=50.869678,11.569591&spn=0.006798,0.0211<br />
36&sll=50.870805,11.57105&sspn=0.001699,0.005284&t=m&z=16<br />
Für die Anfahrt mit eigenem Fahrzeug bestehen folgende Alternativen:<br />
1) über die Baustellenauffahrt an der Autobahnauffahrt Göschwitz in Richtung Frankfurt/Main (kurz VOR der<br />
eigentlichen Auffahrt SCHARF<br />
RECHTS) bis zum Parkplatz am Tunnel-Informationszentrum, dann weiter zu Fuß (ca. + 15 min)<br />
2) über die Ortslage Göschwitz (rechts der Hauptstraße) an der Kirche vorbei bis zum Parkplatz am Tunnel-<br />
Informationszentrum, dann weiter zu Fuß (ca. + 15 min),<br />
3) bis zur Ortslage Leutra, dann weiter zu Fuß (ca. + 3 min)<br />
Für die Anfahrt mit Fahrrad sind die vorstehenden Alternativen 2) und<br />
3) geeignet.<br />
Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist z.B. mit Bus (418, Umsteig in Maua auf 488 oder aber 415<br />
ohne Umstieg) möglich. Darüber hinaus stellt auch die Anfahrt bis Bhf. <strong>Jena</strong>-Göschwitz, dann weiter zu Fuß<br />
oder mit Bus, eine Möglichkeit dar.<br />
Bitte leiten Sie diese Informationen auch an Ihre Kommilitonen weiter.<br />
Günstig wäre es, wenn Sie untereinander Ihre Handy-Nummern austauschen würden, um eventuelle<br />
Rückfragen bei der Anfahrt schnell klären zu können.<br />
Mit freundlichen Grüßen,<br />
Thomas Rohde<br />
Dipl.-Biol. Thomas Rohde<br />
<strong>Friedrich</strong>-<strong>Schiller</strong>-Universitaet <strong>Jena</strong><br />
Institut fuer Spezielle Botanik<br />
Philosophenweg 16<br />
D-07743 <strong>Jena</strong><br />
Phone: 0(049)-3641-949-254 (Mi-Fr 09:30-15:00)<br />
GSM: 0(049)-176-96358158<br />
6