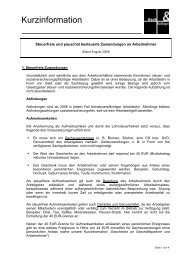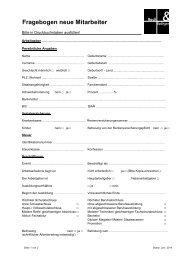Kinder im Steuerrecht - Von der Geburt bis zur Volljährigkeit
Kinder im Steuerrecht - Von der Geburt bis zur Volljährigkeit
Kinder im Steuerrecht - Von der Geburt bis zur Volljährigkeit
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
INTERESSANTES<br />
Foto: © PeJo/fotolia.com<br />
<strong>Kin<strong>der</strong></strong> <strong>im</strong><br />
<strong>Steuerrecht</strong><br />
Teil I: <strong>Von</strong> <strong>der</strong> <strong>Geburt</strong> <strong>bis</strong> <strong>zur</strong> Volljährigkeit<br />
Ausgangslage<br />
Die Kosten, die bei <strong>der</strong> Erziehung<br />
eines Kindes entstehen, sind bekanntlich<br />
enorm. Auch wenn eine<br />
Vielzahl dieser Aufwendungen, wie<br />
zum Beispiel Schulbücher und Ausbildungskosten,<br />
bereits grundsätzlich<br />
durch das <strong>Kin<strong>der</strong></strong>geld abgegolten<br />
sind, hält <strong>der</strong> Gesetzgeber einige<br />
Entlastungen bereit. Dieser Teil unserer<br />
zweiteiligen Serie beschäftigt<br />
sich mit <strong>Kin<strong>der</strong></strong>n <strong>bis</strong> <strong>zur</strong> Vollendung<br />
des 18. Lebensjahres. Der zweite Teil<br />
wird die steuerliche Berücksichtigung<br />
von volljährigen <strong>Kin<strong>der</strong></strong>n darstellen.<br />
Alle genannten Beträge spiegeln<br />
den Rechtsstand 2011 wi<strong>der</strong>.<br />
Kindschaftsverhältnis<br />
Grundvoraussetzung <strong>zur</strong> Erlangung <strong>der</strong><br />
<strong>Kin<strong>der</strong></strong>vergünstigungen ist, dass es sich<br />
um ein leibliches Kind des Zahnarztes<br />
handelt. Dabei ist es unbedeutend, ob<br />
das Kind ein eheliches o<strong>der</strong> nichteheliches<br />
Kind ist. Es wird <strong>im</strong>mer ab dem Zeitpunkt<br />
<strong>der</strong> <strong>Geburt</strong> <strong>bis</strong> <strong>zur</strong> Vollendung des<br />
18. Lebensjahres berücksichtigt.<br />
Ein Adoptivkind wird dem leiblichen Kind<br />
gleichgestellt. Das Kindschaftsverhältnis<br />
wird durch die Zustellung des Beschlusses<br />
des Familiengerichts begründet.<br />
Ein Pflegekind hingegen wird <strong>im</strong> steuerlichen<br />
Sinne nur dann als Kind berücksichtigt,<br />
wenn es <strong>im</strong> Haushalt des Zahnarztes<br />
aufgenommen wurde und eine familienähnliche,<br />
auf längere Dauer angelegte<br />
Beziehung (in <strong>der</strong> Regel mindestens zwei<br />
Jahre) wie zu einem eigenen Kind besteht.<br />
Darüber hinaus darf das Obhut- und<br />
Pflegeverhältnis zu den leiblichen Eltern<br />
nicht mehr bestehen, d. h. die familiären<br />
Bindungen zu diesen müssen auf Dauer<br />
aufgegeben sein.<br />
Die Berücksichtigung als Kind kommt<br />
nicht in Betracht, wenn das Kind von vornherein<br />
nur für eine begrenzte Zeit <strong>im</strong><br />
Haushalt des Zahnarztes aufgenommen<br />
wird. Dieser darf ferner mit <strong>der</strong> Haushaltsaufnahme<br />
keine Einkünfteerzielungsabsicht<br />
verfolgen, d. h. <strong>Kin<strong>der</strong></strong> nur aufnehmen,<br />
um für die Unterbringung und Betreuung<br />
entlohnt zu werden (sogenannte<br />
Kostkin<strong>der</strong>).<br />
<strong>Kin<strong>der</strong></strong>geld<br />
Wird ein Kindschaftsverhältnis <strong>im</strong> vorgenannten<br />
Sinne begründet, besteht grundsätzlich<br />
ein Anspruch auf <strong>Kin<strong>der</strong></strong>geld. Das<br />
<strong>Kin<strong>der</strong></strong>geld beträgt für das 1. und 2. Kind<br />
jeweils 184 EUR, für das 3. Kind 190 EUR<br />
und für das 4. sowie jedes weitere Kind<br />
215 EUR monatlich. Entfallen für ein Kind<br />
die <strong>Kin<strong>der</strong></strong>geldvoraussetzungen, rücken<br />
die übrigen <strong>Kin<strong>der</strong></strong> in <strong>der</strong> Reihenfolge einen<br />
Platz nach vorne.<br />
Beispiel:<br />
Der Zahnarzt hat zusammen mit seiner<br />
Ehefrau vier <strong>Kin<strong>der</strong></strong>. Er erhält monatlich<br />
<strong>Kin<strong>der</strong></strong>geld in Höhe von 773 EUR (2 x<br />
184 EUR + 190 EUR + 215 EUR). Im<br />
März entfallen für das 1. Kind die <strong>Kin<strong>der</strong></strong>geldvoraussetzungen.<br />
Ab dem Monat<br />
April erhalten die Eheleute nur<br />
noch 558 EUR <strong>Kin<strong>der</strong></strong>geld (2 x 184<br />
EUR + 190 EUR).<br />
Das <strong>Kin<strong>der</strong></strong>geld ist steuerfrei und wird<br />
auch nicht bei <strong>der</strong> Bemessung des Steuersatzes<br />
über den sogenannten Progressionsvorbehalt<br />
berücksichtigt.<br />
<strong>Kin<strong>der</strong></strong>freibetrag<br />
Die Freibeträge für <strong>Kin<strong>der</strong></strong> sind <strong>im</strong> Grunde<br />
an dieselben Voraussetzungen wie das<br />
<strong>Kin<strong>der</strong></strong>geld geknüpft und werden nur<br />
dann gewährt, wenn die Steuerersparnis<br />
durch sie günstiger ist, als <strong>der</strong> Anspruch<br />
auf <strong>Kin<strong>der</strong></strong>geld. Die Berechnung, welches<br />
Instrument von beiden vorteilhafter ist<br />
(sogenannte Günstigerprüfung), führt das<br />
Finanzamt von Amts wegen durch. Bei<br />
Besserverdienenden werden die <strong>Kin<strong>der</strong></strong>freibeträge<br />
aufgrund des höheren Steuersatzes<br />
regelmäßig zu einem günstigeren<br />
Ergebnis führen.<br />
Ist die Steuerersparnis durch die <strong>Kin<strong>der</strong></strong>freibeträge<br />
vorteilhafter, muss <strong>der</strong> Zahnarzt<br />
das ihm zustehende <strong>Kin<strong>der</strong></strong>geld <strong>zur</strong>ückzahlen.<br />
Die Abwicklung <strong>der</strong> Rückzahlung<br />
erfolgt <strong>im</strong> Rahmen <strong>der</strong> Einkommensteuerveranlagung.<br />
Hat <strong>der</strong> Zahnarzt – aus welchen<br />
Gründen auch <strong>im</strong>mer – kein <strong>Kin<strong>der</strong></strong>geld<br />
erhalten, obwohl ein Anspruch darauf<br />
bestand, muss er nachträglich einen <strong>Kin<strong>der</strong></strong>geldantrag<br />
stellen. Denn die Rückzahlung<br />
des <strong>Kin<strong>der</strong></strong>geldes richtet sich nach<br />
dem Anspruch und nicht danach, in welcher<br />
Höhe das <strong>Kin<strong>der</strong></strong>geld tatsächlich vereinnahmt<br />
wurde. Es kann danach vorkommen,<br />
dass <strong>der</strong> Zahnarzt Beträge <strong>zur</strong>ückzahlt,<br />
die er niemals erhalten hat. Das<br />
<strong>Kin<strong>der</strong></strong>geld kann grundsätzlich rückwirkend<br />
für die letzten vier Jahre beantragt werden.<br />
Der Freibetrag setzt sich aus zwei<br />
Komponenten zusammen:<br />
<strong>Kin<strong>der</strong></strong>freibetrag in Höhe von 2.184<br />
EUR.<br />
Freibetrag für den Betreuungs-, Erziehungs-<br />
und Ausbildungsbedarf in Höhe<br />
von 1.320 EUR.<br />
Diese Freibeträge stehen jedem Elternteil<br />
für jedes Kind zu, d. h. bei verheirateten<br />
Eltern werden die Beträge zusammenge-<br />
36<br />
NZB 3/2011
INTERESSANTES<br />
fasst (4.368 EUR und 2.640 EUR).<br />
Ein Elternteil erhält die doppelten Freibeträge,<br />
wenn <strong>der</strong> an<strong>der</strong>e Elternteil verstorben<br />
ist o<strong>der</strong> dauernd <strong>im</strong> Ausland lebt.<br />
Übertragung <strong>der</strong> <strong>Kin<strong>der</strong></strong>freibeträge<br />
Nicht verheiratete, geschiedene o<strong>der</strong> dauernd<br />
getrennt lebende Eltern können beantragen,<br />
dass die Freibeträge des an<strong>der</strong>en<br />
Elternteils auf sich selbst übertragen<br />
werden. Jedoch ist die Übertragung <strong>der</strong><br />
beiden Freibeträge an unterschiedliche<br />
Voraussetzungen geknüpft.<br />
Der <strong>Kin<strong>der</strong></strong>freibetrag kann nur dann übertragen<br />
werden, wenn <strong>der</strong> an<strong>der</strong>e Elternteil<br />
Foto: Meermeyer<br />
seiner Unterhaltsverpflichtung <strong>im</strong> Wesentlichen<br />
nicht nachkommt (mindestens zu<br />
75 %). Die Unterhaltspflicht besteht aus<br />
dem Betreuungs- und Barunterhalt. Der<br />
Betreuungsunterhalt wird durch die Erziehung<br />
und die tatsächliche Betreuung des<br />
Kindes erbracht. Der Barunterhalt umfasst<br />
die für die Erziehung und Betreuung erfor<strong>der</strong>lichen<br />
Geldmittel. Der Elternteil, in dessen<br />
Obhut sich das Kind befindet, leistet<br />
seinen Unterhalt zu 100 % durch Betreuung,<br />
so dass nur eine Übertragung vom<br />
Barunterhaltsverpflichteten in Frage kommen<br />
kann. Stehen jedoch dem Barunterhaltsverpflichteten<br />
aufgrund seines geringen<br />
Einkommens keine Mittel <strong>zur</strong> Verfügung<br />
und kann er aus diesem Grund keinen<br />
Unterhalt leisten, scheidet eine Übertragung<br />
des <strong>Kin<strong>der</strong></strong>freibetrags wie<strong>der</strong>um<br />
aus. Eine einvernehmliche Übertragung<br />
ohne Verletzung <strong>der</strong> Unterhaltspflicht ist<br />
nicht möglich.<br />
Der Freibetrag für den Betreuungs-, Erziehungs-<br />
und Ausbildungsbedarf kann auf<br />
den Elternteil übertragen werden, in dessen<br />
Wohnung das Kind gemeldet ist. Die Übertragung<br />
ist jedoch nur möglich, solange das<br />
Kind min<strong>der</strong>jährig ist. Auf eine Verletzung<br />
<strong>der</strong> Unterhaltspflicht kommt es nicht an.<br />
Auch die Übertragung <strong>der</strong> Freibeträge auf<br />
einen Stief- o<strong>der</strong> Großelternteil ist möglich,<br />
wenn das Kind in <strong>der</strong>en Haushalt<br />
aufgenommen wird.<br />
Entlastungsbetrag für<br />
Alleinerziehende<br />
Alleinerziehende, die einen Haushalt nur<br />
mit ihren <strong>Kin<strong>der</strong></strong>n führen, haben typischerweise<br />
höhere Lebensführungskosten als<br />
zusammenlebende Elternteile. Diesem<br />
Umstand trägt <strong>der</strong> Entlastungsbetrag für<br />
Alleinerziehende Rechnung. Er wird, auch<br />
bei mehreren <strong>Kin<strong>der</strong></strong>n, jährlich nur einmal<br />
in Höhe von 1.308 EUR gewährt.<br />
Voraussetzung ist, dass das Kind zum<br />
Haushalt gehört. Zudem darf <strong>der</strong> allein<br />
Erziehende nicht verheiratet bzw. muss<br />
dauernd von seinem Ehegatten getrennt<br />
sein. Er darf nicht mit einer an<strong>der</strong>en volljährigen<br />
Person zusammen leben. Vor allem<br />
eheähnliche Lebensgemeinschaften<br />
und eingetragene Lebenspartnerschaften<br />
sollen den Entlastungsbetrag nicht erhalten.<br />
Liegen diese Voraussetzungen nur in<br />
einem Teil des Jahres vor, wird <strong>der</strong> Betrag<br />
anteilig gekürzt.<br />
– Anzeige –<br />
NZB 3/2011 37
INTERESSANTES<br />
<strong>Kin<strong>der</strong></strong>betreuungskosten<br />
Die Berücksichtigung von <strong>Kin<strong>der</strong></strong>betreuungskosten<br />
soll die Vereinbarkeit von Kind<br />
und Beruf erleichtern und für mehr Beschäftigung<br />
sorgen. So können Aufwendungen<br />
abgesetzt werden, die für die<br />
Betreuung des Kindes entstehen, wie beispielsweise<br />
durch eine Betreuungseinrichtung<br />
(<strong>Kin<strong>der</strong></strong>garten, Hort und Ähnliches)<br />
bzw. eine Tagesmutter. Abziehbar sind die<br />
Kosten für die entsprechenden betreuenden<br />
Dienstleistungen, nicht jedoch für<br />
Sachleistungen (wie z. B. Verpflegung)<br />
des Kindes. Außerdem sind folgende Kosten<br />
nicht abziehbar:<br />
für Unterricht (z. B. Schulgeld, Nachhilfe-<br />
o<strong>der</strong> Fremdsprachenunterricht),<br />
für die Vermittlung beson<strong>der</strong>er Fähigkeiten<br />
(z. B. Musikunterricht, Computerkurs),<br />
für sportliche und an<strong>der</strong>e Freizeitbeschäftigungen<br />
(z. B. Sportverein, Reito<strong>der</strong><br />
Tanzunterricht).<br />
<strong>Von</strong> den Betreuungskosten können 2/3,<br />
jedoch max<strong>im</strong>al 4.000 EUR je Kind <strong>im</strong><br />
Kalen<strong>der</strong>jahr abgezogen werden. Es müssen<br />
die folgenden Voraussetzungen vorliegen:<br />
das Kind hat das 14. Lebensjahr noch<br />
nicht vollendet,<br />
die Eltern sind erwerbstätig, in Ausbildung,<br />
körperlich, geistig bzw. seelisch<br />
behin<strong>der</strong>t o<strong>der</strong> krank,<br />
die Eltern haben für die Aufwendungen<br />
eine Rechnung erhalten und<br />
die Zahlung erfolgte auf das Konto des<br />
Leistungserbringers.<br />
Erwachsen die Aufwendungen wegen<br />
Krankheit, muss diese innerhalb eines zusammenhängenden<br />
Zeitraums von mindestens<br />
drei Monaten bestanden haben,<br />
es sei denn, <strong>der</strong> Krankheitsfall tritt unmittelbar<br />
<strong>im</strong> Anschluss an eine Erwerbstätigkeit<br />
o<strong>der</strong> Ausbildung ein.<br />
Erfüllen die Eltern die persönlichen Voraussetzungen<br />
nicht, können <strong>Kin<strong>der</strong></strong>betreuungskosten<br />
nur dann geltend gemacht<br />
werden, wenn das Kind zwischen 3 und<br />
6 Jahren alt ist (<strong>Kin<strong>der</strong></strong>gartenkin<strong>der</strong>).<br />
Zuschuss zum Arbeitslohn<br />
Zahnärzte können ihren Mitarbeitern und<br />
Mitarbeiterinnen einen steuerfreien Zuschuss<br />
<strong>zur</strong> Unterbringung, Betreuung und<br />
Verpflegung von nicht schulpflichtigen <strong>Kin<strong>der</strong></strong>n<br />
in einem <strong>Kin<strong>der</strong></strong>garten o<strong>der</strong> einer<br />
vergleichbaren Einrichtung leisten. Hervorzuheben<br />
ist, dass <strong>im</strong> Gegensatz zu den<br />
<strong>Kin<strong>der</strong></strong>betreuungskosten auch die Verpflegung<br />
begünstigt ist. Unabdingbare Voraussetzung<br />
ist, dass <strong>der</strong> Zuschuss zusätzlich<br />
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn<br />
erbracht wird.<br />
Schulgeld<br />
Das Schulgeld für den Besuch einer<br />
Schule in freier Trägerschaft o<strong>der</strong> einer<br />
überwiegend privat finanzierten Schule<br />
kann in Höhe von 30 %, jedoch max<strong>im</strong>al<br />
5.000 EUR <strong>im</strong> Kalen<strong>der</strong>jahr je Kind geltend<br />
gemacht werden. Zu beachten ist,<br />
dass lediglich <strong>der</strong> reine Anteil für den Unterricht,<br />
nicht aber für Unterkunft und Verpflegung<br />
begünstigt ist. Voraussetzung ist,<br />
dass die Schule in einem Mitgliedstaat <strong>der</strong><br />
EU o<strong>der</strong> in einem EWR-Staat (Europäischer<br />
Wirtschaftsraum) belegen ist und<br />
diese auf einen anerkannten deutschen<br />
bzw. diesem gleichgestellten Schulabschluss<br />
ordnungsgemäß vorbereitet.<br />
Elterngeld<br />
Foto: © ChristArt/fotolia.com<br />
Für <strong>Geburt</strong>en nach dem 01.01.2007<br />
wurde das <strong>bis</strong>herige Bundeserziehungsgeld<br />
durch das Elterngeld ersetzt. Die<br />
Höhe des Elterngeldes richtet sich nach<br />
dem durchschnittlichen Nettolohn des erziehenden<br />
Elternteils in den letzten zwölf<br />
Monaten vor <strong>der</strong> <strong>Geburt</strong> und beträgt<br />
grundsätzlich 67 % davon, höchstens jedoch<br />
1.800 EUR. Bei selbstständig Tätigen<br />
ist auf das Einkommen <strong>im</strong> letzten abgeschlossenen<br />
Veranlagungszeitraum abzustellen.<br />
Bei einem Nettoeinkommen von<br />
unter 1.000 EUR bzw. über 1.200 EUR<br />
erhöht bzw. verringert sich dieser Prozentsatz.<br />
Hinsichtlich <strong>der</strong> Höhe des Elterngeldes<br />
gelten für das zweite und dritte Kind<br />
bzw. bei Mehrlingsgeburten Beson<strong>der</strong>heiten.<br />
Für Eltern, die vor <strong>der</strong> <strong>Geburt</strong> kein<br />
Einkommen erzielt haben, beträgt <strong>der</strong><br />
Mindestelterngeldanspruch 300 EUR monatlich.<br />
Das Elterngeld wird in <strong>der</strong> Regel<br />
zwölf Monate lang gezahlt. Es verlängert<br />
sich um zwei Monate, wenn <strong>der</strong> an<strong>der</strong>e<br />
Elternteil in dieser Zeit die Betreuung des<br />
Kindes übern<strong>im</strong>mt. Alleinerziehende können<br />
aufgrund des fehlenden Partners die<br />
vollen 14 Monate Elterngeld in Anspruch<br />
nehmen.<br />
Die Steigerung bzw. Opt<strong>im</strong>ierung des Elterngeldes<br />
lässt sich erreichen, indem<br />
rechtzeitig vor <strong>der</strong> <strong>Geburt</strong> die Steuerklassen<br />
so gewählt werden, dass <strong>der</strong>jenige, <strong>der</strong> das<br />
Kind betreuen wird, in die günstigere Steuerklasse<br />
III wechselt und damit ein höheres<br />
Nettoeinkommen erhält. Allerdings sollte<br />
dabei auch beachtet werden, dass <strong>der</strong> an<strong>der</strong>e<br />
Ehegatte, welcher dann <strong>der</strong> Steuerklasse<br />
V zugeordnet wird, weniger Anspruch<br />
auf Kranken- o<strong>der</strong> Arbeitslosengeld<br />
hat, da <strong>der</strong> Nettoarbeitslohn für diese Lohnersatzleistungen<br />
maßgebend ist.<br />
Das Elterngeld ist steuerfrei, erhöht aber<br />
nach Ansicht <strong>der</strong> Finanzverwaltung den<br />
persönlichen Steuersatz (sogenannter<br />
Progressionsvorbehalt). Be<strong>im</strong> Bundesverfassungsgericht<br />
ist <strong>der</strong>zeit ein Verfahren<br />
anhängig, in dem es darum geht, dass <strong>der</strong><br />
Mindestelterngeldanspruch nicht dem<br />
Progressionsvorbehalt unterliegen darf.<br />
Die Entscheidung steht noch aus. Entsprechende<br />
Einkommensteuerbescheide sollten<br />
daher offen gehalten werden.<br />
Fazit<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> <strong>Kin<strong>der</strong></strong>erziehung entstehen<br />
den Eltern erhebliche Aufwendungen,<br />
für die <strong>der</strong> Gesetzgeber nur teilweise steuerliche<br />
Entlastungen geschaffen hat. Gerade<br />
aus diesem Grund sollte darauf geachtet<br />
werden, die bestehenden Möglichkeiten<br />
auszuschöpfen und kein Geld zu<br />
verschenken. Vor allem <strong>im</strong> Bereich <strong>der</strong><br />
<strong>Kin<strong>der</strong></strong>betreuungskosten sollte darauf geachtet<br />
werden, dass die Voraussetzungen<br />
hinsichtlich <strong>der</strong> Zahlungsweise eingehalten<br />
werden, da bei Barzahlung ein Abzug<br />
<strong>der</strong> Aufwendungen nicht möglich ist.<br />
Tino Koch, Steuerberater<br />
Geschäftsführer <strong>der</strong> Koch & Kollegen<br />
Steuerberatung GmbH, Hannover<br />
38<br />
NZB 3/2011