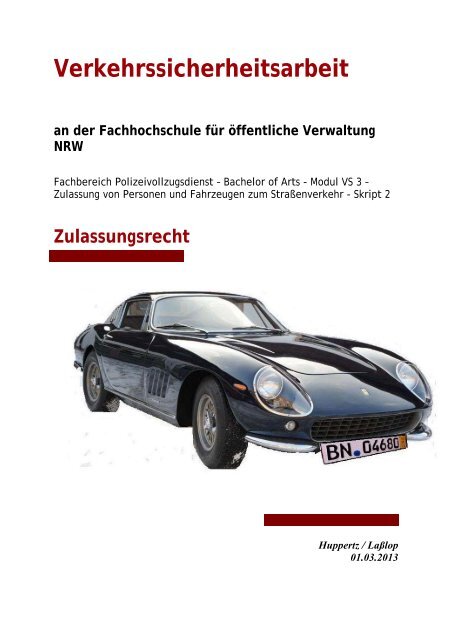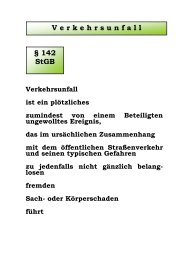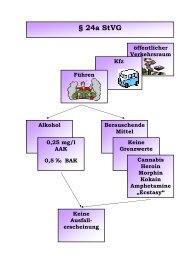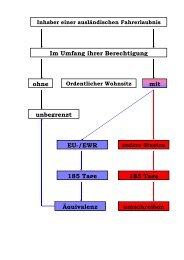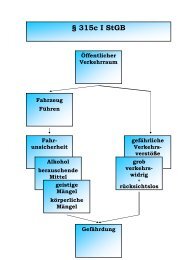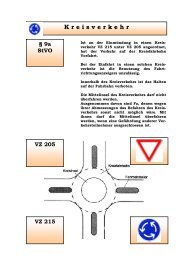Verkehrssicherheitsarbeit - Bernd Huppertz
Verkehrssicherheitsarbeit - Bernd Huppertz
Verkehrssicherheitsarbeit - Bernd Huppertz
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Verkehrssicherheitsarbeit</strong><br />
an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung<br />
NRW<br />
Fachbereich Polizeivollzugsdienst – Bachelor of Arts - Modul VS 3 –<br />
Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr - Skript 2<br />
Zulassungsrecht<br />
<strong>Huppertz</strong> / Laßlop<br />
01.03.2013
Vorwort<br />
Vorwort<br />
Die nachfolgenden Informationen sind eine Zusammenstellung der Lehrinhalte des<br />
Studienabschnitts VS 3 „Zulassung von Fahrzeugen“, die wir an Sie weitergeben. Sie<br />
ersetzen auf keinen Fall die Teilnahme an den Vorlesungen, sondern sind als zusätzliche<br />
Arbeitsgrundlage gedacht.<br />
Weiterführende Literatur können Sie dem Literaturverzeichnis entnehmen. Vielfach<br />
ist diese auch in der Bücherei unserer Fachhochschule präsent.<br />
Als Info-Quelle ist auch das Internet nicht zu vernachlässigen. Einige interessante<br />
Links finden Sie ebenfalls im Literaturverzeichnis.<br />
Die Autoren sind für Anregungen dankbar und über die Arbeitsplattform ILIAS sowie<br />
die nachfolgend genannten Adressen zu erreichen:<br />
udo.lasslop@fhoev.nrw.de<br />
bernd.huppertz@fhoev.nrw.de<br />
Wir wünschen Ihnen ein angenehmes und erfolgreiches Studium und uns allen eine<br />
gute Zusammenarbeit.<br />
Udo Laßlop - <strong>Bernd</strong> <strong>Huppertz</strong><br />
- I -
Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Literaturverzeichnis<br />
III<br />
Zulassungspflichtige Kfz und Anhänger 1<br />
Zulassungsfreie Kfz und Anhänger 9<br />
Betriebserlaubnis für Fahrzeuge 21<br />
Erlöschen der Betriebserlaubnis 23<br />
Kennzeichen (allgemein) 39<br />
Zeitweilige Teilnahme am Straßenverkehr 45<br />
Saisonkennzeichen 53<br />
Oldtimer - Kennzeichen 54<br />
Ausfuhrkennzeichen 56<br />
Abschleppen<br />
Versicherungskennzeichen<br />
58<br />
64<br />
Versicherungspflicht 67<br />
Verschuldens- und Gefährdungshaftung 71<br />
Kraftfahrzeugsteuerpflicht 74<br />
Kennzeichenmissbrauch 77<br />
Teilnahme ausländischer Fahrzeuge am Straßenverkehr 80<br />
Prüfungsschema für zulassungsrechtliche Sachverhalte (allgemein) 83<br />
- Sachverhalt: Das nicht zugelassene Fahrzeug 92<br />
- Sachverhalt: Die Fahrt mit entstempelten Kennzeichen 96<br />
- Sachverhalt: Der Bagger 101<br />
- Sachverhalt: Der Pferdeanhänger 106<br />
Definitionen 111<br />
Modulbeschreibung 118<br />
-II -
Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr<br />
1 Zulassungspflichtige Kfz und Anhänger<br />
§ 1 StVG, § 1 und § 3 FZV<br />
1.1 Einführung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 1<br />
Gründe für die Einführung der FZV:<br />
Im Jahre 2007 wurde die StVZO 70 Jahre (!) alt. Allein das ist schon ein wichtiger<br />
Grund, da im Laufe der Jahre immer wieder neue Vorschriften in die StVZO aufgenommen<br />
wurden und die Verordnung immer unübersichtlicher wurde; bestes Beispiel<br />
sind die unübersichtlichen Regelungen des § 18 II StVZO-alt.<br />
Weitere Gründe:<br />
Durch die Zusammenfassung verschiedener Vorschriften in eine Verordnung<br />
wird das Zulassungsrecht übersichtlicher.<br />
Das Zulassungsverfahren wird vereinfacht, beschleunigt, kostengünstiger und<br />
entlastet die Zulassungsbehörden.<br />
Es wird die elektronische Kommunikation zwischen den beteiligten Behörden<br />
und der Versicherer mit den Behörden ermöglicht.<br />
Gliederung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung<br />
1. Allgemeine Regelungen<br />
2. Zulassungsverfahren<br />
3. Zeitweilige Teilnahme am Straßenverkehr<br />
4. Teilnahme ausländischer Fahrzeuge am Straßenverkehr<br />
5. Überwachung des Versicherungsschutzes<br />
6. Fahrzeugregister<br />
7. Durchführungs- und Schlussvorschriften und 12 Anlagen<br />
1<br />
Vom 25.04.2006 (BGBl. I, 988). In Kraft getreten 01.03.2007. Neubekanntmachung vom 03.02.2011<br />
(BGBl. I S. 139).<br />
- 1 -
Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr<br />
Übersicht:<br />
Fahrerlaubnis-<br />
Verordnung (FeV)<br />
ab 01.01.1999<br />
StVZO<br />
Führerscheinrecht<br />
Zulassung von Fahrzeugen<br />
Betriebserlaubnis,<br />
Bau- und Betriebsvorschriften<br />
Bis Ende 1998 enthielt die StVZO unter anderem die Bereiche Zulassung von Personen,<br />
Zulassung von Fahrzeugen und Betriebserlaubnis/Bau- und Betriebsvorschriften.<br />
Hinzugefügt wurden im Laufe der Jahrzehnte zahlreiche Ausnahmeverordnungen.<br />
Seit dem 01.01.1999 wird die Zulassung von Personen in der Fahrerlaubnisverordnung<br />
(FeV) geregelt und die entsprechenden §§ 1 bis 15 StVZO traten außer Kraft.<br />
Später wurde der § 5 StVZO durch Verlautbarung des BMV wieder offiziell in Kraft<br />
gesetzt (s. dazu § 6 VI FeV – Fahrerlaubnisklassen, die vor dem 01.01.1999 erteilt<br />
wurden, bleiben im Umfang des alten Rechts weiterhin gültig). Gleichzeitig wurden<br />
in der FeV die Bestimmungen über die EU-/EWR-Führerscheininhaber mit Wohnsitz<br />
im Inland aufgenommen.<br />
Am 01.10.05 lösten die Zulassungsbescheinigungen Teil I und II für Fahrzeuge die<br />
alten Fahrzeugscheine und –briefe ab, die aber weiter gültig bleiben, bis sie aufgrund<br />
von Besitz-, Wohnsitzwechsel oder Außerbetriebsetzung durch die Zulassungsbehörde<br />
umgetauscht werden.<br />
Am 01.03.2007 trat die Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) in Kraft. In ihr wird<br />
das Zulassungsverfahren aus § 18 StVZO und die unter die VInt fallenden Fahrzeu-<br />
Fahrzeug-<br />
Zulassungsverordnung<br />
(FZV)<br />
ab 01.03.2007<br />
VInt (außer Kraft)<br />
Zulassung von Fahrzeugen:<br />
Ausländische Fahrzeuge<br />
Zulassung von Personen:<br />
EU/EWR Wohnsitz<br />
„Drittstaaten“<br />
Fahrzeugregister-Verordnung<br />
Mietwagenüberwachungs-Verordnung<br />
Erläuterung<br />
- 2 -
Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr<br />
ge aufgenommen. Die entsprechenden Bereiche in der StVZO und VInt traten außer<br />
Kraft. Die Bau- und Betriebsvorschriften und die Bestimmungen über die Betriebserlaubnis<br />
bleiben aber erhalten. Sie werden zurzeit vom BMV modifiziert. In die FZV<br />
aufgenommen wurden auch die Register- und Mietwagenüberwachungsverordnung<br />
sowie einige Ausnahmeverordnungen der StVZO, die dadurch ebenfalls außer Kraft<br />
traten.<br />
1.2 Was heißt eigentlich „Zulassung“<br />
Derjenige, der ein Kraftfahrzeug oder einen Anhänger im öffentlichen Verkehrsraum<br />
betreiben will, muss bei seinem zuständigen Straßenverkehrsamt (Zulassungsstelle)<br />
eine Zulassung für sein Fahrzeug beantragen (§ 1 I StVG).<br />
Im Sinne der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) erfolgt die Zulassung durch<br />
Zuteilung eines Kennzeichens und der Ausfertigung einer Zulassungsbescheinigung<br />
(§ 3 I letzter Satz FZV). Somit erfolgt die Zulassung nicht mehr<br />
durch Zuteilung des amtlichen Kennzeichens und der Erteilung einer Betriebserlaubnis<br />
oder EG-Typgenehmigung 2 .<br />
Gemäß § 6 FZV ist die Zulassung bei der nach Landesrecht zuständigen Zulassungsbehörde,<br />
in deren Bezirk der Antragsteller seinen Wohnsitz oder Sitz hat (§ 46<br />
FZV), zu beantragen.<br />
Das bedeutet, dass er zunächst bei seiner Zulassungsstelle<br />
seinen Personalausweis bzw. Nachweis des Gewerbes o. ä.<br />
die Zulassungsbescheinigung II des Fahrzeuges (= Fahrzeugbrief - bei Neufahrzeugen<br />
reicht dieser Nachweis aus; bei älteren Fahrzeugen müssen zur Zulassungsbescheinigung<br />
II Bescheinigungen gemäß §§ 29 (HU), 47a (AU) StVZO<br />
beigefügt werden) und<br />
den Versicherungsnachweis für dieses Fahrzeug vorlegen muss. Dieser Versicherungsnachweis<br />
besteht seit dem 01.03.08 nur noch aus einer Versicherungsbestätigungsnummer<br />
(VB-Nummer), die aus sieben Zahlen und Buchstaben besteht;<br />
der Halter muss bei der Zulassungsstelle nur noch diese Nummer nennen;<br />
die Zulassungsstelle kann sich damit in einer zentralen Datenbank von der bestehenden<br />
Versicherung überzeugen.<br />
2<br />
BLFA-StVO/StVOWi I/07 am 27./28.06.07 in Erfurt, Protokoll Seiten 22 und 23.<br />
- 3 -
Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr<br />
Nach Identifizierung (§ 6 VIII FZV) und weiteren Prüfungen (z. B., ob der Antragsteller<br />
noch Kfz-Steuerschulden hat) wird ihm dann ein amtliches Kennzeichen mit<br />
Dienstsiegel und Terminplaketten zugeteilt und die Zulassungsbescheinigung I<br />
(Fahrzeugschein) wird ausgehändigt.<br />
Die in der Vergangenheit in § 18 I StVZO-alt enthaltende Regelung über die Zulassung<br />
der Fahrzeuge (zulassungspflichtige Fahrzeuge) wurde in § 3 I FZV überführt.<br />
Zugleich wurde die Definition für den Begriff „Zulassung“ geändert. Die Zulassung<br />
erfolgt nunmehr durch Zuteilung eines Kennzeichens und Ausfertigung einer Zulassungsbescheinigung<br />
(§ 3 I Satz 3 FZV) 3 .<br />
Durch die Zulassungsstelle erfolgt dann die Mitteilung<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
an die eigene Karteiführung,<br />
an das KBA in Flensburg,<br />
an die Versicherung und<br />
an das Finanzamt.<br />
Zulassungsfreiheit eines Fahrzeugs bzw. bedingte Zulassungsfreiheit bedeutet also<br />
immer, dass in dem zuvor geschilderten Verfahren irgendeine Ausnahme (zum Vorteil<br />
des Fahrzeug-Halters) enthalten ist!<br />
1.3 Erläuterungen zum Grundsatz der Zulassungspflicht<br />
1. Sinn und Zweck der Zulassung ist die Prüfung der Bauart eines jeden Fahrzeugs<br />
auf Verkehrstüchtigkeit.<br />
2. Ausgangspunkt der allgemein rechtlichen Beurteilung ist § 1 StVG. Auch wenn<br />
diese Bestimmung nur Kfz der Zulassungspflicht unterwirft, so gilt sie auch für<br />
Anhänger, weil diese beim Mitführen hinter Kraftfahrzeugen eine verkehrsrechtliche<br />
Einheit mit dem Zugfahrzeug bilden.<br />
3. In Betrieb setzen bedeutet die bestimmungsmäßige Verwendung des Fahrzeugs<br />
als Fortbewegungsmittel, also das Fahren. Ein bloßes Abstellen im öffentlichen<br />
Verkehrsraum begründet daher keine Zulassungspflicht, jedoch<br />
würde die verkehrsübliche Grenze des Gemeingebrauchs überschritten, was<br />
zur erlaubnispflichtigen Sondernutzung führt. Liegt die Genehmigung nicht vor,<br />
wäre § 29 StVO (Übermäßige Straßenbenutzung) und / oder § 32 StVO (Verkehrshindernis)<br />
zu prüfen.<br />
4. Ausführungsvorschrift zu § 1 StVG ist der § 16 StVZO. Im Gegensatz zu § 1<br />
StVG wird in dieser Vorschrift der übergeordnete Begriff des Fahrzeugs verwendet.<br />
Diese sind legaldefiniert durch § 2 Nr. 3 FZV und umfassen Kfz und<br />
3<br />
BLFA-StVO/StVOWi I/07 am 27./28.06.07 in Erfurt, Protokoll Seite 24.<br />
- 4 -
Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr<br />
ihre Anhänger. In Abgrenzung dazu, enthält § 16 II StVZO Aufzählungen von<br />
Gegenständen, die keine Fahrzeuge sind.<br />
5. Vorschriftsmäßig ist ein Fahrzeug, wenn es verkehrs- und betriebssicher ist<br />
und den jeweiligen Bau- und Ausrüstungsvorschriften entspricht. Diese Voraussetzungen<br />
ergeben sich aus den §§ 21, 22 StVO und §§ 30 bis 67 StVZO.<br />
Entspricht ein Fahrzeug nicht diesen Vorschriften, so befindet es sich in einem<br />
unvorschriftsmäßigen Zustand und kann von der Verwaltungsbehörde aus<br />
dem Verkehr gezogen werden.<br />
6. § 16 StVZO ist nicht Bußgeld bewehrt, d. h. Verstöße können nur nach den<br />
Vorschriften geahndet werden, gegen die speziell verstoßen wurde.<br />
7. Neben der generellen Forderung auf Vorschriftsmäßigkeit gemäß § 16 StVZO<br />
ist für Kraftfahrzeuge mit einer BbH von mehr als 6 km/h und von ihnen mitgeführte<br />
Anhänger gemäß § 1 FZV die Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)<br />
anzuwenden. Das bedeutet für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger, dass diese<br />
Fahrzeuge, auch wenn sie vorschriftsmäßig sind, nur im öffentlichen Verkehrsraum<br />
in Betrieb gesetzt werden dürfen, wenn sie gemäß § 3 I FZV zugelassen<br />
sind.<br />
8. Gemäß § 5 I FZV hat die Zulassungsbehörde die Möglichkeit, den Betrieb<br />
eines Fahrzeugs zu verbieten oder einzuschränken, wenn sich das Fahrzeug<br />
in einem unvorschriftsmäßigen Zustand befindet. Von diesen Maßnahmen<br />
können sowohl zulassungspflichtige als auch zulassungsfreie Fahrzeuge erfasst<br />
werden. Die Unvorschriftsmäßigkeit von Fahrzeugen wird in aller Regel<br />
durch die Polizei im Rahmen der Verkehrsüberwachung bzw. bei Verkehrskontrollen<br />
festgestellt. In diesen Fällen wird die Verwaltungsbehörde über<br />
die Kontrollberichte von der Unvorschriftsmäßigkeit in Kenntnis gesetzt. Nur<br />
bei schwerwiegenden Mängeln, die die Verkehrssicherheit unmittelbar erheblich<br />
gefährden, kann die Polizei die Weiterfahrt eines Fahrzeugs untersagen (§<br />
8 PolG NRW).<br />
9. Eine Einschränkung der Grundregel der Verkehrsfreiheit für alle deutschen<br />
Fahrzeuge enthält § 3 I FZV. Er schreibt vor, dass Kfz mit einer BbH von mehr<br />
als 6 km/h und deren Anhänger einer behördlichen Zulassung bedürfen, wenn<br />
sie auf öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt werden.<br />
10. Die Zulassung wird auf Antrag erteilt, wenn das Fahrzeug einem genehmigten<br />
Typ entspricht oder eine Einzelgenehmigung erteilt ist und eine dem Pflichtversicherungsgesetz<br />
entsprechende Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung besteht.<br />
11. Die Zulassung erfolgt durch Zuteilung eines Kennzeichens<br />
- 5 -
Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr<br />
und Ausfertigung einer Zulassungsbescheinigung [ZB I (Fahrzeugschein)]:<br />
11.1 Im Rahmen der Zulassung erhält das Kfz und/oder der Anhänger auf den<br />
Kennzeichen eine<br />
Zulassungsplakette<br />
der ausstellenden Behörde<br />
gültige Prüfplakette<br />
nach § 29 StVZO (TÜV)<br />
Auf die Anbringung einer gültigen<br />
Plakette nach § 47a StVZO<br />
[Abgasuntersuchung (AU)] wurde<br />
zwischenzeitlich verzichtet<br />
11.2 Das zugelassene Kfz wird durch die Verwaltungsbehörde zur Kfz-Steuer angemeldet<br />
(§ 1 KraftStG), sofern nicht die Ausnahmen aus § 3 KraftStG zutreffen.<br />
- 6 -
Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr<br />
11.3 Die Zulassung ist nicht vor der Abstempelung des Kennzeichens (§ 8 FZV)<br />
wirksam. Das Abstempeln ist somit keine „Formalie“, sondern es kommt ihr eine<br />
rechtsbegründende Bedeutung zu, da das zugeteilte Kennzeichen zusammen<br />
mit dem Kfz/Anhänger, an dem es dann befestigt wird, eine zusammengesetzte<br />
Urkunde i. S. d. § 267 StGB darstellt.<br />
12. Die Zulassung muss bei der örtlich zuständigen Zulassungsbehörde beantragt<br />
werden. Das ist die Zulassungsbehörde, in der das Fahrzeug seinen regelmäßigen<br />
Standort hat.<br />
Bei Standortwechsel (zumeist verbunden mit einem Wohnsitzwechsel) erhält<br />
das Fahrzeug von der „neuen“ Zulassungsbehörde auch ein neues Kennzeichen.<br />
Seit langem wird unter Hinweis auf die Möglichkeiten moderner Datenverarbeitung<br />
versucht, diese Regelung aufzuheben. Hierzu hat das Land Nordrhein-Westfalen<br />
nunmehr folgende (hier auszugsweise wiedergegebene) Ausnahmegenehmigung<br />
4 erlassen:<br />
- Mit Wirkung vom 01.07.2012 entfällt das Erfordernis der Neuzuteilung eines<br />
Kennzeichens bei Wechsel des Zulassungsbezirks eines Fahrzeugs<br />
innerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen, soweit damit kein Halterwechsel<br />
verbunden ist und es sich um ein Kennzeichen aus dem Bereich des<br />
Landes Nordrhein-Westfalen handelt.<br />
4<br />
Erlass MIK NRW vom 29.05.2012, Az.: VII B 2-21-13/405.<br />
- 7 -
Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr<br />
1.4. Übersicht<br />
§ 1 StVG Zulassung<br />
(1) Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger, die auf öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt werden sollen,<br />
müssen von der zuständigen Behörde (Zulassungsbehörde) zum Verkehr zugelassen sein.<br />
§ 16 StVZO Grundregel der Zulassung<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Verkehr auf öffentlichen Straßen<br />
alle Fahrzeuge zugelassen<br />
wenn sie den Vorschriften der StVZO und der StVO entsprechen<br />
soweit nicht für die Zulassung einzelner Fahrzeugarten ein Erlaubnisverfahren vorgeschrieben<br />
ist<br />
§ 1 FZV Anwendungsbereich<br />
- Anwendung auf die Zulassung von Kraftfahrzeugen<br />
- mit einer Bauart bedingten Höchstgeschwindigkeit von<br />
mehr als 6 km/h und<br />
- die Zulassung ihrer Anhänger.<br />
§ 3 FZV Notwendigkeit einer Zulassung<br />
(1)<br />
- Fahrzeuge<br />
- öffentlichen Straßen<br />
- in Betrieb setzten nur<br />
wenn sie zum Verkehr zugelassen sind.<br />
- Zulassung wird auf Antrag erteilt, wenn<br />
* genehmigten Typ oder Einzelgenehmigung<br />
und<br />
* eine Kfz-Haftpflichtversicherung besteht.<br />
- Zulassung erfolgt durch<br />
* Zuteilung eines Kennzeichens und<br />
* Ausfertigung einer Zulassungsbescheinigung.<br />
Keine Ausnahmen!<br />
Sonstiges:<br />
§ 11 FZV Zulassungsbescheinigung Teil I (Fzg-Schein)<br />
- ist vom Fahrer des Kfz mitzuführen und<br />
zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung<br />
auszuhändigen.<br />
§ 12 FZV Zulassungsbescheinigung Teil II (Fzg-Brief)<br />
Kennzeichen<br />
§ 8 FZV Zuteilung<br />
§ 9 FZV Besondere Kennzeichen<br />
§ 10 FZV Ausgestaltung und Anbringung der<br />
amtlichen Kennzeichen<br />
§ 23 StVO “Lesbarkeit”<br />
- 8 -
Zulassungsfreie Fahrzeuge<br />
2 Zulassungsfreie Kfz und Anhänger (§ 3 II FZV)<br />
Ausnahmen vom Zulassungsverfahren gemäß FZV<br />
§ 3 II FZV „Notwendigkeit einer Zulassung“<br />
Ausgenommen von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren sind:<br />
1 Folgende Kraftfahrzeugarten: 1<br />
1a) Selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Stapler 2<br />
Definition<br />
Definition<br />
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Kfz, die nach ihrer Bauart und<br />
ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen<br />
zur Verrichtung von Arbeiten, jedoch nicht zur Beförderung von Personen<br />
oder Gütern bestimmt und geeignet sind (Legaldefinition § 2 Nr. 17<br />
FZV).<br />
Stapler: Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart für das Aufnehmen, Heben,<br />
Bewegen und Positionieren von Lasten bestimmt und geeignet sind<br />
(Legaldefinition § 2 Nr. 18 FZV).<br />
Über 20 km/h BbH:<br />
§ 4 II S. 2 Zulassungsbescheinigung Teil 1<br />
§ 11 V Zulassungsbescheinigung Teil 1 mitführen / aushändigen<br />
§ 4 II Kennzeichen nach § 8 FZV, § 9 II FZV „grünes Kennzeichen“<br />
§ 1 I PflichtVG Versicherungspflicht<br />
§ 58 StVZO Geschwindigkeitsschild bis BbH 60 km/h<br />
Bis 20 km/h BbH:<br />
§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />
§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung mitführen / aushändigen<br />
§ 4 IV Namensschild linke Fahrzeugseite bis 20 km/h BbH<br />
§ 58 StVZO Geschwindigkeitsschild bis BbH 60 km/h<br />
§ 2 I 6 b. PflichtVG keine Versicherungspflicht bis 20 km/ BbH<br />
1<br />
2<br />
Alle in § 3 II FZV aufgeführten Fahrzeuge sind gemäß § 3 I KraftStG von der Steuer befreit.<br />
Gemäß § 1 I Nr. 6 b PflichtVG sind SAM und Stapler bis max. 20 km/h von der Versicherungspflicht<br />
ausgenommen.<br />
- 9 -
Zulassungsfreie Fahrzeuge<br />
1b) Einachsige Zugmaschinen, wenn sie nur für land- oder forstwirtschaftliche<br />
Zwecke verwendet werden,<br />
Definition<br />
Land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen sind Kfz, deren Funktion<br />
im Wesentlichen in der Erzeugung einer Zugkraft besteht und die besonders<br />
zum Ziehen, Schieben, Tragen und zum Antrieb von auswechselbaren<br />
Geräten für land- oder forstwirtschaftliche Arbeiten oder zum<br />
Ziehen von Anhängern in land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben bestimmt<br />
und geeignet sind, auch wenn sie zum Transport von Lasten im<br />
Zusammenhang mit land- oder forstwirtschaftlichen Arbeiten eingerichtet<br />
oder mit Beifahrersitzen ausgestattet sind (Legaldefinition § 2 Nr. 16<br />
FZV).<br />
Über 20 km h BbH:<br />
§ 4 II Zulassungsbescheinigung Teil I<br />
§ 11 V Zulassungsbescheinigung Teil I mitführen / aushändigen<br />
§ 4 II Kennzeichen nach § 8 FZV, § 9 II FZV „grünes Kennzeichen“<br />
§ 10 V Kennzeichen nur vorne<br />
§ 1 I PflichtVG Versicherungspflicht<br />
§ 58 StVZO ab 32 km/h BbH, Geschwindigkeitsschild bis BbH 60 km/h<br />
Bis 20 km/h BbH:<br />
§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />
§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung aufbewahren /aushändigen<br />
§ 4 IV Namensschild linke Fahrzeugseite bis 20 km/h BbH<br />
§ 1 I PflichtVG Versicherungspflicht<br />
§ 58 StVZO Geschwindigkeitsschild bis BbH 60 km/h<br />
- 10 -
Zulassungsfreie Fahrzeuge<br />
1c) Leichtkrafträder<br />
Definition<br />
Leichtkrafträder sind Krafträder mit einer Nennleistung von nicht mehr<br />
als 11 kW und im Falle von Verbrennungsmotoren mit einem Hubraum<br />
von mehr als 50 cm³, aber nicht mehr als 125 cm³.<br />
§ 4 II S. 2 Zulassungsbescheinigung Teil I,<br />
§ 11 V Zulassungsbescheinigung Teil I mitführen / aushändigen<br />
§ 4 II Kennzeichen nach § 8 FZV, § 10 V FZV nur an der Rückseite,<br />
Anlage 4 zu § 10 II FZV kleines amtliches Kennzeichen<br />
1d) Zwei- oder dreirädrige Kleinkrafträder<br />
Definition<br />
Kleinkrafträder: zweirädrige oder dreirädrige Kfz mit einer Bauart bedingten<br />
Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und folgenden<br />
Eigenschaften:<br />
a) zweirädrige Kleinkrafträder: mit Verbrennungsmotor, dessen Hubraum<br />
nicht mehr als 50 cm³ beträgt, oder mit Elektromotor, dessen maximale<br />
Nenndauerleistung nicht mehr als 4 kW beträgt;<br />
b) dreirädrige Kleinkrafträder: mit Fremdzündungsmotor, dessen Hubraum<br />
nicht mehr als 50 cm³ beträgt, mit einem anderen Verbrennungsmotor,<br />
dessen maximale Nutzleistung nicht mehr als 4 kW beträgt, oder<br />
mit einem Elektromotor, dessen maximale Nenndauerleistung nicht<br />
mehr als 4 kW beträgt<br />
(Legaldefinition § 2 Nr. 11 FZV)<br />
§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />
§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung mitführen / aushändigen<br />
§ 4 III Versicherungs- Kennzeichen nach § 26 FZV<br />
§ 26 I Versicherungsbescheinigung mitführen / aushändigen<br />
- 11 -
Zulassungsfreie Fahrzeuge<br />
Varianten:<br />
1. Zweirädrige Kleinkrafträder<br />
2. Zweirädrige Kleinkrafträder als<br />
Mofa<br />
Besonderheit: § 4 I Nr. 1 FeV<br />
„auch ohne Tretkurbeln …“, z.B.:<br />
Roller<br />
3. Zweirädrige Kleinkrafträder als<br />
Leichtmofa<br />
4. Zweirädrige Kleinkrafträder als<br />
FmH<br />
5. Zweirädrige Kleinkrafträder als<br />
eScooter<br />
6. Dreirädrige Kleinkrafträder<br />
- Geschwindigkeitsschild<br />
nach § 58 StVZO<br />
1e) Motorisierte Krankenfahrstühle 3<br />
Definition<br />
Motorisierte Krankenfahrstühle sind einsitzige, nach der Bauart zum<br />
Gebrauch durch körperlich behinderte Personen bestimmte Kraftfahrzeuge<br />
mit Elektroantrieb, einer Leermasse von nicht mehr als 300 kg<br />
einschließlich Batterien jedoch ohne Fahrer, einer zulässigen Gesamtmasse<br />
von nicht mehr als 500 kg, einer Bauart bedingten Höchstgeschwindigkeit<br />
von nicht mehr als 15 km/h und einer Breite über alles von<br />
maximal 110 cm (Legaldefinition § 2 Nr. 13 FZV)<br />
§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />
§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung mitführen / aushändigen<br />
§ 4 III Versicherungskennzeichen nach § 26 FZV<br />
3<br />
Benutzung auch durch Nicht-Behinderte zulässig; Gehwegbenutzung nach § 24 II StVO mit Schrittgeschwindigkeit<br />
möglich.<br />
- 12 -
Zulassungsfreie Fahrzeuge<br />
§ 4 IV Kennzeichnungstafel 4 gemäß ECE-Regelung 69 oben an der Fahrzeugrückseite<br />
§ 26 I Versicherungsbescheinigung mitführen / aushändigen<br />
§ 58 StVZO Geschwindigkeitsschild bis BbH 60 km/h<br />
f) Vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge<br />
Definition Vierrädrige Kraftfahrzeuge mit einer Leermasse von nicht mehr als 350<br />
kg, ohne Masse der Batterien bei Elektrofahrzeugen, mit einer Bauart<br />
bedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h, mit<br />
Fremdzündungsmotor, dessen Hubraum nicht mehr als 50 cm³ beträgt<br />
oder mit einem anderen Verbrennungsmotor, dessen maximale Nennleistung<br />
nicht mehr als 4 kW beträgt oder mit einem Elektromotor, dessen<br />
maximale Nennleistung nicht mehr als 4 kW beträgt (Legaldefinition<br />
§ 2 Nr. 12 FZV)<br />
§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />
§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung mitführen / aushändigen<br />
§ 4 III Versicherungs- Kennzeichen nach § 26 FZV<br />
§ 26 I Versicherungsbescheinigung mitführen / aushändigen<br />
§ 58 StVZO Geschwindigkeitsschild bis BbH 60 km/h<br />
Varianten:<br />
1. Vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge<br />
als Pkw<br />
2. Vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge<br />
als Quad<br />
3. Vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge<br />
zur Güterbeförderung<br />
4<br />
Dreieck mit reflektierender roter Innenfläche und retroreflektierenden roten Rändern, Verstoß möglich<br />
nach § 48 Nr. 4 FZV.<br />
- 13 -
Zulassungsfreie Fahrzeuge<br />
g) Elektronische Mobilitätshilfe<br />
Definition<br />
Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit<br />
von nicht mehr als 20 km/h, die (u.a.) folgende Merkmale<br />
aufweisen:<br />
1. Zweispuriges Kfz mit zwei parallel angeordneten Rädern<br />
2. Eine Gesamtbreite von nicht mehr als 70 cm<br />
3. Eine Plattform als Standfläche für einen Fahrer<br />
4. Eine lenkerähnliche Haltestange (…)<br />
Die weiteren zulassungsbefreienden Bestimmungen ergeben sich aus der Verordnung<br />
über die Teilnahme elektronischer Mobilitätshilfen am Verkehr (Mobilitätshilfenverordnung),<br />
die allerdings keine Ausnahmeverordnung gegenüber der FZV darstellt.<br />
Vielmehr verfügt sie über eigene Ordnungswidrigkeitentatbestände (§ 8 MobHV), so<br />
z.B. bei Inbetriebnahme eines Segway ohne entsprechende Typgenehmigung.<br />
§ 2 I Nr. 1 MobHV Typ-/Einzelgenehmigung,<br />
§ 2 I Nr. 2 MobHV gültiges Versicherungskennzeichen<br />
§ 2 III MobHV Typ-/Einzelgenehmigung mitführen / aushändigen<br />
Varianten:<br />
1. Segway<br />
- 14 -
Zulassungsfreie Fahrzeuge<br />
2. Folgende Arten von Anhängern: 5<br />
b) Anhänger in lof-Betrieben, wenn die Anhänger nur für lof-Zwecke<br />
verwendet und mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25<br />
km/h hinter Zugmaschinen oder selbstfahrenden Arbeitsmaschinen<br />
mitgeführt werden<br />
§ 3 II S. 2: 25 km-Schild gemäß § 58 StVZO,<br />
§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />
§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung aufbewahren /aushändigen<br />
§ 10 VIII „Wiederholungskennzeichen“ eines Zugfahrzeuges des Halters<br />
b) Wohnwagen und Packwagen im Schaustellergewerbe, die von<br />
Zugmaschinen mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25<br />
km/h mitgeführt werden<br />
Definition<br />
Definition<br />
Wohnwagen sind Anhänger, die nach Bauart und Einrichtung dazu bestimmt<br />
und geeignet sind, dem Schausteller und seiner Familie während<br />
der Ausübung seines Gewerbes als Wohnung zu dienen; dazu gehören<br />
auch die modernen Campinganhänger beim Transport ist gemäß § 21 I<br />
StVO der Aufenthalt von Personen nur in zweiachsigen Wohnwagen<br />
gestattet (Quelle: BMVBS)<br />
Packwagen (Gepäckwagen) sind Wagen zur Beförderung der zur Gewerbeausübung<br />
benötigten Gegenstände<br />
§ 3 II S. 2: 25 km-Schild gemäß § 58 StVZO<br />
§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />
§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung mitführen / aushändigen<br />
§ 10 VIII „Wiederholungskennzeichen“ eines Zugfahrzeuges des Halters<br />
5<br />
§ 2 I Nr. 6 c PflichtVG: keine Versicherungspflicht für alle Anhänger, die nicht dem Zulassungsverfahren<br />
unterliegen.<br />
- 15 -
Zulassungsfreie Fahrzeuge<br />
c) Fahrbare Baubuden, die von Kfz mit einer Geschwindigkeit von<br />
nicht mehr als 25 km/h mitgeführt werden,<br />
Definition<br />
Fahrbare Baubuden sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart dazu bestimmt<br />
und geeignet sind, auf Baustellen als Lagerraum für Geräteund<br />
Materialien oder als Aufenthaltsraum für das Personal der Baustellen zu<br />
dienen; dies soll auch dann gelten, wenn der Bauführer oder Schachtmeister<br />
in der Baubude schriftliche Arbeiten erledigt, sie also als „Büro“<br />
nutzt (Quelle BMV)<br />
§ 3 II S. 2: 25 km-Schild gemäß § 58 StVZO<br />
§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />
§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung aufbewahren /aushändigen<br />
§ 10 VIII „Wiederholungskennzeichen“ eines Zugfahrzeuges des Halters<br />
d) Arbeitsmaschinen,<br />
1. über 25 km h BbH /kein 25 km-Schild gemäß § 58 StVZO:<br />
§ 4 II S. 2 Zulassungsbescheinigung Teil I,<br />
§ 11 V Zulassungsbescheinigung Teil I mitführen / aushändigen<br />
§ 4 II Kennzeichen nach § 8 FZV<br />
§ 9 II „grünes Kennzeichen“<br />
§ 58 III Nr. 2 StVZO Geschwindigkeits-Schild bis BbH 100 km/h<br />
2. bis 25 km/h BbH / 25 km-Schild gem. § 58 StVZO:<br />
kein eigenes Kennzeichen<br />
§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />
§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung aufbewahren /aushändigen<br />
§ 10 VIII „Wiederholungskennzeichen“ eine Zugfahrzeuges des Halters<br />
- 16 -
Zulassungsfreie Fahrzeuge<br />
Varianten:<br />
1. Arbeitsmaschinen, z.B. Möbellift<br />
2. Arbeitsmaschinen für den<br />
Straßenbau (hier: Kompressor)<br />
3. Arbeitsmaschinen für die<br />
Straßenreinigung<br />
4. etc.<br />
e) Spezialanhänger zur Beförderung von Sportgeräten oder Tieren<br />
für Sportzwecke, wenn die Anhänger ausschließlich für solche Beförderungen<br />
verwendet werden,<br />
Beschreibung (aus der Zeitschrift „Sportwissenschaft“, 1980):<br />
Ein wesentliches Befreiungsmerkmal ist der Einsatz zum „Sport“ (Sportgeräte bzw.<br />
Sportzwecke); der Begriff „Sport“ kann nicht verbindlich definiert werden; einige<br />
Merkmale für diesen Begriff können z. B. sein:<br />
motorische Aktivität,<br />
Bedeutungsinhalt (spezifische Eigenart sportlicher Handlung),<br />
Leistung,<br />
Sportorganisation,<br />
Sportregeln,<br />
Ethische Werte und<br />
Erlebnisformen<br />
- 17 -
Zulassungsfreie Fahrzeuge<br />
1. Über 25 km/h BbH /kein 25 km-Schild gemäß § 58 StVZO:<br />
§ 4 II S. 2 Zulassungsbescheinigung Teil I,<br />
§ 11 V Zulassungsbescheinigung Teil I mitführen / aushändigen<br />
§ 4 II Kennzeichen nach § 8 FZV<br />
§ 9 II „grünes Kennzeichen“<br />
§58 III Nr. 2 StVZO Geschwindigkeitsschild bis BbH 100 km/h<br />
2. Bis 25 km/h BbH / 25 km-Schild gemäß § 58 StVZO:<br />
kein eigenes Kennzeichen<br />
§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />
§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung mitführen / aushändigen<br />
§ 10 VIII „Wiederholungskennzeichen“ eine Zugfahrzeuges des Halters<br />
f) Einachsige Anhänger hinter Krafträdern, Kleinkrafträdern und motorisierten<br />
Krankenfahrstühlen, 6<br />
§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />
§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung mitführen / aushändigen<br />
§ 10 VIII „Wiederholungskennzeichen“ eine Zugfahrzeuges des Halters<br />
oder<br />
§ 27 IV „Wiederholungs-Versicherungskennzeichen“<br />
§ 58 StVZO Geschwindigkeitsschild bis BbH 100 km/h<br />
weggefallen: § 18 III Nr. 3 StVZO-alt: Keine Betriebserlaubnis hinter Mofa 25<br />
g) Anhänger für Feuerlöschzwecke<br />
§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />
§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung aufbewahren /aushändigen<br />
§ 10 VIII „Wiederholungskennzeichen“ eine Zugfahrzeuges des Halters<br />
6<br />
§ 32 I Nr. 3 StVZO maximale Breite: 1 m und § 18 V Nr. 2 StVO auf BAB zHG 60 km/h.<br />
- 18 -
Zulassungsfreie Fahrzeuge<br />
§ 58 StVZO Geschwindigkeitsschild bis BbH 100 km/h<br />
h) land- oder forstwirtschaftliche Arbeitsgeräte<br />
Definition<br />
land- oder forstwirtschaftliche Arbeitsgeräte sind Geräte zum Einsatz in<br />
der Land- und Forstwirtschaft, die dazu bestimmt sind, von einer Zugmaschine<br />
gezogen zu werden und die die Funktion der Zugmaschine<br />
verändern oder erweitern; sie können auch mit einer Ladeplattform ausgestattet<br />
sein, die für die Aufnahme der zur Ausführung der Arbeiten<br />
erforderlichen Geräte und Vorrichtungen oder die für die zeitweilige Lagerung<br />
der bei der Arbeit erzeugten und benötigten Materialien konstruiert<br />
und gebaut ist; unter den Begriff fallen auch Fahrzeuge, die dazu<br />
bestimmt sind von einer Zugmaschine gezogen zu werden und dauerhaft<br />
mit einem Gerät ausgerüstet oder für die Bearbeitung von Materialien<br />
ausgelegt sind, wenn das Verhältnis zwischen der technisch zulässigen<br />
Gesamtmasse und der Leermasse dieses Fahrzeugs weniger als<br />
3,0 beträgt (Legaldefinition § 2 Nr. 20 FZV)<br />
§ 58 IV Nr. 3 StVZO keine Geschwindigkeits-Schilder<br />
§ 10 VIII kein „Wiederholungskennzeichen“<br />
1. Über 3 t zGM:<br />
§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />
§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung aufbewahren /aushändigen<br />
2. Bis 3 t zGM:<br />
§ 4 I bis 3 t zGM keine Typ-/Einzelgenehmigung erforderlich<br />
- 19 -
Zulassungsfreie Fahrzeuge<br />
i) hinter land- oder forstwirtschaftlichen einachsigen Zug- oder Arbeitsmaschinen<br />
mitgeführte Sitzkarren.<br />
Definition<br />
Sitzkarren: einachsige Anhänger, die nach ihrer Bauart nur bestimmt<br />
und geeignet sind, einer Person das Führen einer einachsigen Zug- o-<br />
der Arbeitsmaschine von einem Sitz aus zu ermöglichen (Legaldefinition<br />
§ 2 Nr. 21 FZV)<br />
§ 4 I keine Typ-/Einzelgenehmigung erforderlich<br />
§ 58 StVZO Geschwindigkeitsschild bis BbH 60 km/h<br />
- 20 -
Betriebserlaubnis<br />
3 Betriebserlaubnis für Fahrzeuge<br />
§§ 19 – 22 StVZO, § 2 FZV<br />
Typgenehmigung:<br />
Zulassungsvoraussetzung für das jeweilige Fahrzeug ist das Vorliegen einer<br />
- EG – Typgenehmigung,<br />
- nationalen Typgenehmigung (= Allgemeine Betriebserlaubnis) 1 oder<br />
- Einzelgenehmigung [(Einzel-)Betriebserlaubnis].<br />
Bei der EG-Typgenehmigung handelt es sich nach der Definition des § 2 Nr. 4 FZV<br />
um die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union in Anwendung einschlägiger<br />
Richtlinien erteilte Bestätigung, dass der zur Prüfung vorgestellte Typ eines Fahrzeugs,<br />
eines Systems, eines Bauteils oder einer selbstständigen technischen Einheit<br />
die einschlägigen Vorschriften und technischen Anforderungen erfüllt.<br />
Dabei erlangt die EG – Typgenehmigung zunehmende Bedeutung. Mit der EG –<br />
Typgenehmigung für Kfz und ihre Anhänger wurde ein bedeutsames Element der<br />
Fahrzeugzulassung harmonisiert. Die eigentliche Zulassung der Fahrzeuge ist noch<br />
nicht harmonisiert und wird weiterhin durch nationale Vorschriften geregelt.<br />
Einzelne Richtlinien wurden durch die EG-FGV in nationales Recht übernommen.<br />
Das hat zur Folge, dass die nationalen Typgenehmigungen immer mehr an Bedeutung<br />
verlieren zugunsten der EG-Richtlinien. Die StVZO stellt in diesem Bereich nur<br />
noch ein Torso dar und soll bis 2014 „runderneuert“ werden.<br />
Betriebserlaubnis<br />
Die Betriebserlaubnis ist eine Säule des Zulassungsrechts, sie ist Voraussetzung für<br />
eine Zulassung oder Inbetriebnahme i. S. d. FZV.<br />
Nach § 19 StVZO ist die Betriebserlaubnis zu erteilen, wenn das Fahrzeug<br />
- den Vorschriften der StVZO<br />
- den zu ihrer Ausführung erlassenen Anweisungen des BMV und<br />
- den Vorschriften der VO EWG Nr. 3821/85 über das Kontrollgerät im Straßenverkehr<br />
entspricht.<br />
Unterscheidung von 3 Arten der Betriebserlaubnis:<br />
1. Allgemeine Betriebserlaubnis für Typen (Typen-BE): § 20 StVZO<br />
2. Betriebserlaubnis für Einzelfahrzeuge § 21 StVZO<br />
1<br />
Liebermann, NZV 2006, 357 (358): „An die Stelle des Begriffs Allgemeine Betriebserlaubnis soll künftig<br />
der bereits in den neueren EG-Richtlinien verwandte Begriff der nationalen Typgenehmigung treten“.<br />
- 21 -
Betriebserlaubnis<br />
3. Betriebserlaubnis für Fahrzeugteile § 22 StVZO<br />
Definition<br />
Nationale Typgenehmigung<br />
… die behördliche Bestätigung, dass der zur Prüfung vorgestellte Typ<br />
eines Fahrzeugs, eines Systems, eines Bauteils oder einer selbständigen<br />
technischen Einheit den geltenden Bauvorschriften entspricht; sie<br />
ist eine Betriebserlaubnis i.S.d. StVG und eine Allgemeine Betriebserlaubnis<br />
i.S.d. StVZO (Legaldefinition § 2 Nr. 5 FZV)<br />
Definition<br />
Einzelgenehmigung<br />
… die behördliche Bestätigung, dass das betreffende Fahrzeug, System,<br />
Bauteil oder die selbständige technische Einheit den geltenden<br />
Bauvorschriften entspricht; sie ist eine Betriebserlaubnis i.S.d. StVG und<br />
eine Einzelbetriebserlaubnis i.S.d. StVZO (Legaldefinition § 2 Nr. 6 FZV)<br />
Definition<br />
Übereinstimmungsbescheinigung<br />
… die vom Hersteller ausgestellte Bescheinigung, dass ein Fahrzeug,<br />
ein System, ein Bauteil oder eine selbständige technische Einheit zum<br />
Zeitpunkt seiner/ihrer Herstellung einem nach der jeweiligen EG-Typgenehmigungsrichtlinie<br />
genehmigten Typ entspricht (Legaldefinition § 2<br />
Nr. 7 FZV)<br />
Definition<br />
Datenbestätigung<br />
… die vom Inhaber einer nationalen Typgenehmigung für Fahrzeuge<br />
ausgestellte Bescheinigung, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt seiner<br />
Herstellung dem genehmigten Typ und den ausgewiesenen Angaben<br />
über die Beschaffenheit entspricht (Legaldefinition § 2 Nr. 8 FZV)<br />
- 22 -
Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />
4 Erlöschen der Betriebserlaubnis (19 StVZO)<br />
Bis zum Inkrafttreten der FZV 1 bestand die Zulassung gemäß § 18 I StVZO-alt in der<br />
Erteilung einer Betriebserlaubnis unter gleichzeitiger Zuteilung des amtlichen<br />
Kennzeichens. 2<br />
Nach der nunmehr geltenden Regelung des § 3 I FZV dürfen Fahrzeuge auf<br />
öffentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt werden, wenn sie zum öffentlichen<br />
Straßenverkehr zugelassen sind. Voraussetzung für die Zulassung ist, dass das<br />
Fahrzeug einem genehmigten Typ entspricht oder eine Einzelgenehmigung erteilt ist<br />
und eine entsprechende Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung nach dem<br />
Pflichtversicherungsgesetz besteht. Die Erteilung der Betriebserlaubnis ist nicht<br />
(mehr) Bestandteil der Zulassung, sondern Voraussetzung hierfür. 3 Deshalb erfolgt<br />
die Erteilung der Betriebserlaubnis auch nicht mehr durch die Aushändigung der<br />
Zulassungsbescheinigung, sondern sie muss bereits vorher erteilt sein.<br />
§ 19 II Satz 2 StVZO regelt die Fälle des Erlöschens der Betriebserlaubnis. Danach<br />
erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs, wenn Änderungen vorgenommen<br />
werden, durch die<br />
1. die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart geändert wird,<br />
2. eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist,<br />
3. das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert wird.<br />
Änderung<br />
Das Erlöschen der Betriebserlaubnis kann nur durch willentlich auf Änderung<br />
gerichtetes Tun erreicht werden, also durch Änderung, Austausch, Hinzufügen oder<br />
Entfernen von Fahrzeugteilen. 4<br />
Fahrzeugteile<br />
Dabei muss sich die Änderung auf Fahrzeugteile (alle diejenigen Teile, die im<br />
Betriebserlaubnisverfahren mitgeprüft worden sind), nicht auf Zubehörteile beziehen.<br />
Beispielkatalog<br />
Der Beispielkatalog 5 enthält Hinweise des BMV zur Beurteilung von Änderungen an<br />
Fahrzeugen. Der Beispielkatalog hat aber keinen Verordnungscharakter und ist<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
In Kraft seit 01.03.2007.<br />
Albrecht/Janker SVR 11/2007, 401.<br />
Amtl. Begr. zu § 3 FZV, VkBl. 2006, 603; BLFA-StVO/StVOWi I/2007, S. 24; Liebermann NZV 2006, 357<br />
(358); Rebler VD 2007, 59 (60); Verfasser PVT 2007, 146 (147); ders. DAR 3/2008, 172.<br />
Aufzählung nach der amtl. Begr. zur Neufassung des Beispielkataloges, VkBl. 1999, 451 (452);<br />
Hentschel/König/Dauer, Rn. 6 zu § 19 StVZO; Jagow, Rn. 3 zu § 19 StVZO.<br />
VkBl. 1999, 451.<br />
- 23 -
Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />
weder erschöpfend noch verbindlich. Er dient vielmehr nur der Auslegung des § 19 II<br />
StVZO. 6<br />
Änderung der Fahrzeugart<br />
Die Betriebserlaubnis erlischt (§ 19 II Nr. 1 StVZO), wenn die Fahrzeugart geändert<br />
wird, z.B.:<br />
- Änderung eines Pkw in einen Lkw<br />
- Änderung eines Pkw in einen Werkstattwagen 7<br />
- Umbau eines Pkw in ein Wohnmobil<br />
- Änderung eines Lkw in eine SAM<br />
- Ausbau der gesamten Wohnausstattung eines Wohnmobils und dessen<br />
Benutzung als Stückguttransporter 8<br />
- Erhöhung des Hubraums eines Leichtkraftrades auf über 125 ccm führt zur<br />
Einstufung als Kraftrad<br />
- Hubraumvergrößerung bei einem Mofa auf über 50 ccm führt zur<br />
Einstufung als Leichtkraftrad / Krad 9<br />
- Ritzeltuning o.ä. bei einem Mofa zur Erhöhung der bbH auf über 45 km/h<br />
führt zur Einstufung als Krad 10<br />
- Durch die Entfernung des Schalldämpfers eines Mofas und dadurch<br />
bewirkte Erhöhung der bbH auf über 45 km/h wird das Mofa zum Krad 11<br />
Gefährdung<br />
Die Betriebserlaubnis erlischt ebenfalls, wenn nach entsprechenden Änderungen<br />
eine Gefährdung zu erwarten ist. Dabei ist die bloße Möglichkeit der Gefährdung zu<br />
weitgehend, die Gefährdung muss schon etwas konkreter zu erwarten sein. 12<br />
Erforderlich ist also, dass durch die nachträgliche Änderung mit einem gewissen<br />
Grad an Wahrscheinlichkeit eine Gefährdung für Verkehrsteilnehmer geschaffen<br />
wird 13 . Auch wenn dies keineswegs die Feststellung einer konkreten Gefährdung<br />
voraussetzt 14 , so ist es doch notwendig, dass Behörden und Gerichte jeweils für den<br />
konkreten Einzelfall ermitteln, ob die betreffende Veränderung eine Gefährdung von<br />
Verkehrsteilnehmern nicht nur möglich erscheinen, sondern erwarten lässt. 15<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
Hentschel/König/Dauer, Rn. 12 zu § 19 StVZO.<br />
AG Stuttgart DAR 2008, 162 und 275 (Anm. Verfasser).<br />
KG VRS 85, 226.<br />
<strong>Huppertz</strong> DAR 5/2012, 290.<br />
Ebd.<br />
Ebd.<br />
Amtl. Begr. zur 16. ÄndVO straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 16.12.1993 [BGBl. I, 2106 (= VkBl.<br />
1994, 143 (149, 150)].<br />
OLG Köln NZV 1997, 283 (= DAR 1998, 27; VRS 93, 222); OLG Düsseldorf NZV 1995, 329 (= DAR 1995,<br />
336; VD 1995, 282; VRS 89, 382; VM 1996, 73); OLG Düsseldorf NZV 1996, 40 (= VRS 90, 195; VM 1996,<br />
87); OLG Düsseldorf NZV 1996, 249 (= VRS 91, 210; ZfS 1996, 235); OLG Koblenz NZV 2004, 199 (= DAR<br />
2004, 147; NJW-RR 2004, 344); Braun/Konitzer, Rn. 33 zu § 19 StVZO; a.A. Kreutel/Schmitt , Anm. OLG<br />
Düsseldorf NZV 1996, 41.<br />
OLG Düsseldorf NZV 1996, 249 (= VRS 91, 210; ZfS 1996, 235).<br />
OLG Köln NZV 1997, 283, 284 (= DAR 1998, 27; VRS 93, 222.<br />
- 24 -
Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />
Änderungen, durch die eine Gefährdung zu erwarten ist, liegen vor, wenn durch den<br />
Ein- oder Anbau oder die andere Gestaltung von Teilen oder deren Kombination<br />
negative Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit zu erwarten sind. Kann die<br />
Erwartung der Gefährdung nicht durch eine Teilegenehmigung oder ein<br />
Teilegutachten, ggf. in Verbindung mit einer Änderungsabnahme durch einen<br />
Gutachter entkräftet werden, erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. 16<br />
Es wird darauf verwiesen, dass eine Gefährdung sowohl durch den unsachgemäßen<br />
Anbau eines unbedenklichen Teils als auch durch den sachgemäßen Anbau eines<br />
unsachgemäß gestalteten Teils auftreten kann. 17<br />
Beispiele:<br />
- Fahrwerk (Räder, Spoiler)<br />
- Lenkung (Sportlenkrad)<br />
- Verringerung des Lenkeinschlags<br />
durch Karosseriekontakt<br />
- Verwendung von Pedalauflagen<br />
aus Aluminium, die entgegen der<br />
Vorgaben aus dem Teilegutachten<br />
und ohne weitere Prüfung falsch<br />
angebracht werden, so dass ein<br />
gleichzeitiges Betätigen von zwei<br />
Pedalen nicht ausgeschlossen<br />
werden kann.<br />
16<br />
17<br />
Amtl. Begr. zur Neufassung des Beispielkataloges, VkBl. 1999, 451 (452).<br />
Amtl. Begr. zur 16. ÄndVO straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 16.12.1993 [BGBl. I, 2106 (= VkBl.<br />
1994, 143 (150)].<br />
- 25 -
Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />
- Lackieren von Schlussleuchten,<br />
wodurch die Lichtdurchlässigkeit<br />
gefährlich verschlechtert wird<br />
Weitere Beispiele:<br />
- Bremsen (Bremsscheiben)<br />
- Motor / Getriebe<br />
- Anbau einer Anhängerkupplung<br />
- Entfernen des Geschwindigkeitsreglers<br />
- Erhebliche Unterschreitung der Geschwindigkeitskategorie der Reifen<br />
- Einbau von Xenon Scheinwerfern oder Sockel (Glühbirnen)<br />
- Unterbodenbeleuchtung<br />
Verschlechterung des Abgas- und Geräuschverhaltens<br />
Die Betriebserlaubnis erlischt ebenfalls, wenn eine Beeinflussung des Abgas- und<br />
Geräuschverhaltens eintritt.<br />
Eine unzulässige Verschlechterung liegt vor, wenn die bisher vom Fahrzeug<br />
eingehaltenen Vorschriften nicht mehr erfüllt werden, d.h. die Grenzwerte der bei der<br />
Erteilung der Betriebserlaubnis zugrunde gelegten Abgasvorschrift oder die<br />
entsprechenden Grenzwerte nach § 47 StVZO überschritten werden.<br />
Beispiele:<br />
- Motorelektronik (Chiptuning)<br />
- Lenkung (Sportlenkrad)<br />
- Luftfilteranlage<br />
- Auspuffanlage<br />
- 26 -
Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />
§ 19 III StVZO<br />
Abweichend von § 19 II StVZO erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs jedoch<br />
nicht, wenn bei Änderungen durch Ein- oder Anbau von Teilen für eben diese Teile<br />
eine Betriebserlaubnis (i.S.d. § 2 Nr. 4 bis 8 FZV) erteilt und der nachträgliche Einoder<br />
Anbau genehmigt worden ist sowie eventuelle Einschränkungen oder Einbauanweisungen<br />
beachtet worden sind.<br />
§ 19 III StVZO enthält eigenständige Tatbestände, so dass in den dort aufgeführten<br />
Alternativen im Zutreffensfalle die Betriebserlaubnis erlischt. 18<br />
1. Erlöschen der Betriebserlaubnis bei<br />
o nicht durchgeführter vorgeschriebener Ein- oder Anbauabnahme<br />
o Nichterfüllen der mit der Bauartgenehmigung / Betriebserlaubnis für<br />
Fahrzeugteile verbundenen Auflagen oder An- / Einbauanweisungen<br />
(vgl.: § 19 III letzter Satz)<br />
2. Unverzügliche Abnahmeverpflichtung<br />
o bereits vor Durchführung der Änderung Abnahmetermin vereinbaren<br />
o Bereits die erste Fahrt auf öffentlichen Straßen muss zur Abnahme<br />
erfolgen.<br />
3. Kurzbeispiele:<br />
o Verwendung sog. „Treser-Rückleuchten“, ohne der darin enthaltenen<br />
Auflage der zusätzlichen Anbauerfordernis von Rückstrahlern<br />
nachzukommen.<br />
o Einbau eines Sonnendaches in einem anderen als dem in der<br />
Bauartgenehmigung ausgeführten Bereich des Fahrzeugdaches.<br />
o Nichtabnahme der ansonsten fachgerecht angebauten<br />
Anhängerkupplung.<br />
Rechtsfolgen<br />
Ist die Betriebserlaubnis eines Fahrzeugs nach § 19 II Satz 2 StVZO oder nach § 19<br />
III Satz 2 StVZO erloschen, so kommen Verstöße gegen die nachfolgend genannten<br />
Bestimmungen in Frage:<br />
- § 19 V StVZO<br />
- § 30 I StVZO<br />
- § 3 I FZV<br />
- § 4 I FZV<br />
18<br />
Kullik PVT 2003, 19; ders. PVT 2003, 84.<br />
- 27 -
Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />
§ 19 V StVZO<br />
Ist die Betriebserlaubnis nach § 19 II Satz 2 StVZO oder nach § 19 III Satz 2 StVZO<br />
erloschen, so darf das Fahrzeug gemäß § 19 V StVZO nicht auf öffentlichen Straßen<br />
in Betrieb genommen werden oder dessen Inbetriebnahme durch den Halter<br />
angeordnet oder zugelassen werden. Ausnahmen sind nur zulässig für Fahrten, die<br />
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erlangung einer neuen Betriebserlaubnis<br />
stehen.<br />
Eine weitere Verwendung des Fahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr stellt dann<br />
also einen Verstoß gegen § 19 V StVZO dar. Dieser Verstoß ist ordnungswidrig i.S.d.<br />
§ 69 II Nr. 1a StVZO i.V.m. § 24 StVG.<br />
Im Rahmen einer verkehrsrechtlichen Prüfung nicht zu bewerten –aber für die<br />
polizeiliche Praxis nicht minder wichtig- ist die Frage, ob diese Ordnungswidrigkeit<br />
auch bußgeldbewehrt ist Nach Nr. 189a bzw. Nr. 214a BKatV beträgt das Bußgeld<br />
mindestens 135,- €uro für den Halter und mindestens 90,- €uro für den Fahrer. Das<br />
gilt allerdings nur dann, wenn durch die vorgenommenen Änderungen die<br />
Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt wird. Für diesen Fall ist der Verstoß<br />
gegen § 19 V StVZO und somit die Ordnungswidrigkeit nach § 69a II Nr. 1a StVZO<br />
auch bußgeldbewehrt.<br />
Kann eine wesentliche Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit infolge der<br />
durchgeführten Änderungen allerdings nicht nachgewiesen werden, so liegt zwar ein<br />
Verstoß gegen § 19 V StVZO vor. Auch ist eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 69a II Nr.<br />
1a StVZO gegeben. Sie ist aber aufgrund der entgegenstehenden Vorschrift der Nr.<br />
189a bzw. 214a BKatV dann nicht bußgeldbewehrt.<br />
Fehlt das Merkmal der wesentlichen Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit können<br />
auch keine anderen vergleichbaren Bußgeldnormen herangezogen werden. Dann<br />
nämlich würde ein vom Gesetz nicht geregelter oder vom Gesetzeswortlaut nicht<br />
erfasster Fall bußgebewehrt (gemacht). 19 Mag auch die Regelung unbefriedigend<br />
sein, der gesetzgeberische Wille ist jedenfalls eindeutig formuliert.<br />
Die Frage, ob durch die vorgenommenen Änderungen die Verkehrssicherheit<br />
wesentlich beeinträchtigt ist, bleibt Tatfrage. Bei technischen Mängeln hängt es<br />
davon ab, ob das Fahrzeug in Gefahrensituationen auf Grund der Mängel mit<br />
Sicherheit noch beherrschbar bleibt und innerhalb der gesetzlich vorgegebenen<br />
Mindestanforderungen z.B. abgebremst oder gelenkt werden kann. Unterstützend<br />
kann die sog. HU-Richtlinie 20 herangezogen werden. 21<br />
§ 30 StVZO<br />
Fraglich ist, ob ggf. (auch) ein Verstoß gegen § 30 I StVZO vorliegt. Nach dieser<br />
Vorschrift müssen Fahrzeuge so gebaut und ausgerüstet sein, dass ihr<br />
19<br />
20<br />
21<br />
Entgegen OLG Hamm DAR 2007, 340 (= NZV 2007, 428; VRS 112, 285). Vgl. zum Analogieverbot BVerfGE<br />
82, 6.<br />
Richtlinie für die Durchführung von Hauptuntersuchungen und die Beurteilung der dabei festgestellten<br />
Mängel an Fahrzeugen nach § 29 StVZO vom 09.03.2006 (VkBl. 2006, 293).<br />
Köhler/Müller, Gefahrentatbestände in Bußgeldanzeigen, in. VD 2006, 283.<br />
- 28 -
Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />
verkehrsüblicher Betrieb niemanden schädigt oder mehr als unvermeidbar gefährdet,<br />
behindert oder belästigt. Das ist Tatfrage.<br />
Die Zuwiderhandlung stellt eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 69a III oder IV Nr. 1<br />
StVZO dar und ist bußgeldbewehrt [TBNR: 330000 (25,- €uro), 330600 (90,- €uro)],<br />
wenn – vergleiche die Erläuterungen zu § 19 V StVZO - die Verkehrssicherheit<br />
wesentlich beeinträchtigt wird.<br />
Ergibt die Sachverhaltsprüfung tatsächlich eine wesentliche Beeinträchtigung der<br />
Verkehrssicherheit liegt eine Gesetzeskonkurrenz vor, da der Betroffene nunmehr<br />
sowohl gegen § 19 V StVZO als auch gegen § 30 StVZO verstößt.<br />
Verstoß gegen zulassungsrechtliche Bestimmungen<br />
Die Erteilung der Zulassung stellt einen begünstigenden Verwaltungsakt i.S.d. § 35<br />
VwVerfG dar. Das Vorhandensein einer Betriebserlaubnis ist jedoch keine<br />
Bedingung im verwaltungsrechtlichen Sinne sondern eine Tatbestandsvoraussetzung.<br />
Fällt diese durch das Erlöschen der Betriebserlaubnis weg, führt dies<br />
zwar zur Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes, nicht aber auch zu dessen<br />
Unwirksamkeit.<br />
Mithin liegt grundsätzlich kein Verstoß gegen zulassungsrechtliche Bestimmungen<br />
vor. 22<br />
Allerdings ist aufgrund der unterschiedlichen Tatbestandsvoraussetzungen zwischen<br />
zulassungspflichtigen und zulassungsfreien Fahrzeugen zu unterscheiden.<br />
- Erlischt die Betriebserlaubnis eines zulassungspflichtigen Fahrzeugs, liegt aus<br />
den wie vor genannten Gründen grundsätzlich keine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 3<br />
I FZV vor.<br />
- Etwas anderes gilt allerdings für die Fälle, in denen das Erlöschen der<br />
Betriebserlaubnis dazu führt, dass ein zulassungsfreies Fahrzeugs nunmehr<br />
zulassungspflichtig ist. Die genannten Fahrzeuge werden sodann ohne die<br />
verkehrsrechtlich geforderte Zulassung in Betrieb gesetzt mit der Folge, dass<br />
nunmehr ein Verstoß gegen § 3 I FZV vorliegt. Dieser ist ordnungswidrig i.S.d. §<br />
48 Nr. 1a FZV und mit einem Bußgeld bedroht.<br />
- Gemäß § 4 I FZV dürfen die von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren<br />
ausgenommenen Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen nur in Betrieb genommen<br />
werden, wenn sie einem genehmigten Typ entsprechen oder eine<br />
Einzelgenehmigung erteilt ist, d.h.: zulassungsfreie Fahrzeuge dürfen nur mit<br />
Betriebserlaubnis eingesetzt werden. Damit liegt im Gegensatz zu der für<br />
zulassungspflichtige Fahrzeuge geltenden Regelung ein zulassungsrechtlicher<br />
Verstoß vor: Nach Erlöschen der Betriebserlaubnis eingesetzte zulassungsfreie<br />
Fahrzeuge erfüllen den Tatbestand des „Inbetriebsetzen ohne die erforderliche<br />
Betriebserlaubnis“ i.S.d. § 4 I FZV. 23 Dies stellt eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. §<br />
48 Nr. 1a FZV dar und ist mit Bußgeld bedroht.<br />
22<br />
23<br />
BLFA-StVO/StVOWiG I/2007, 25; Verfasser PVT 2007, 146; Hentschel/König/Dauer, Rn. 14 zu § 19 StVZO;<br />
OLG Jena DAR 2009, 406; OLG Jena 2010, 415 (Anm. Verfasser NZV 2011, 172).<br />
BLFA-StVO/StVOWi I/2007, S. 25.<br />
- 29 -
Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />
Maßnahmen der Polizei<br />
1.<br />
Je nach Gefährdungspotential der Veränderungen:<br />
- Untersagung der Weiterfahrt / Entfernen des Kfz aus dem öffentlichen<br />
Verkehrsraum (Rechtsgrundlage: PolG)<br />
- je nach Fallgestaltung kommt aus Gründen der Verhältnismäßigkeit eine<br />
Anordnung über eine Betriebsbeschränkung in Betracht. (Sichtverhältnisse,<br />
Wetter und Gefährdungsgrad)<br />
2.<br />
Beweissicherung durch Fotos, Abgas- oder Schallpegelmessung, Erstellung eines<br />
Gutachtens z.B. bei TÜV oder DEKRA, Verfahrensverwertbare Vernehmung des<br />
Betroffenen vor Ort.<br />
3.<br />
Eine Betriebsuntersagung durch die Polizei gem. § 5 FZV (bisher: § 17 StVZO) ist<br />
nicht zulässig. In Frage kommt die Unterrichtung des StVA (Kontrollbericht).<br />
4.<br />
Die Sicherstellung des Kennzeichens als psychologische Schranke zur Verhinderung<br />
einer weiteren Inbetriebnahme ist ebenso wie die Sicherstellung des Kfz als Ganzes<br />
bei entsprechender Gefährdung und (uneinsichtigem) Verhalten des Betroffenen<br />
zulässig.<br />
Auf den Fahrzeughalter können im Einzelfall folgende Kosten zukommen:<br />
1 Sicherstellungskosten (Abschleppen) 150,- bis 200,- €<br />
2 Gutachten > 600,- €<br />
3 Bußgeld 135,- bis 270,- €<br />
4 Verwaltungsgebühren 20,- €<br />
5 Kosten für den Rückbau je nach Sachverhalt<br />
6 Wiedervorführung 45,- €<br />
7 Rechtsanwaltskosten<br />
Gerichtskosten<br />
7 4 Punkte im VZR<br />
8 Inhaber eines Probeführerschein:<br />
- Aufbauseminar<br />
- Verlängerung der Probezeit<br />
- 30 -
Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />
Prüfungsschema: „Erlöschen der Betriebserlaubnis“<br />
1. § 1 StVG, Zulassungspflicht für Kfz / Anhänger<br />
- Kfz / Anhänger<br />
- öffentlicher Verkehrsraum<br />
- „in Betrieb setzen“ = führen<br />
2. § 16 I StVZO<br />
- „besonderes Zulassungsverfahren“ gemäß § 3 ff FZV<br />
3. § 1 FZV Anwendungsbereich der FZV<br />
- BbH von mehr als 6 km/h<br />
4. § 3 FZV<br />
- Typ-/Einzelgenehmigung vorhanden<br />
- Haftpflichtversicherung<br />
- Zuteilung eines Kennzeichens<br />
- Ausfertigung der Zulassungsbescheinigung<br />
5. § 8 FZV Kennzeichen<br />
- Vorhanden und angebracht<br />
6. § 11 V FZV<br />
- Zulassungsbescheinigung Teil I wird mitgeführt und ausgehändigt<br />
7. § 19 II oder III StVZO<br />
- Vorsätzliche, aktive Veränderung<br />
- Liegt eine BE, Bauartgenehmigung vor<br />
- Art- /Typvariante<br />
- Gefährdungsvariante<br />
- Umweltvariante<br />
8. Fahrt zum TÜV, DEKRA, StVA [§ 19 V StVZO (§ 10 IV FZV)]<br />
9. Ergebnis: Keine ABE oder Eintrag in Zulassungsbescheinigung - BE erloschen<br />
10. Konsequenz: Das Fahrzeug darf auf öffentlichen Straßen nicht (mehr) in<br />
Betrieb genommen werden.<br />
11. Ergebnis: Begründung des Verstoßes gegen § 19 V StVZO<br />
12. Verstoß ist OWi gemäß §§ 19 V, 69a II Nr. 1a StVZO i. V. m. § 24 StVG<br />
- 31 -
Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />
Prüfungsschema: „Verstoß gegen § 30 I StVZO“<br />
1. § 1 StVG, Zulassungspflicht für Kfz / Anhänger<br />
- Kfz / Anhänger<br />
- öffentlicher Verkehrsraum<br />
- „in Betrieb setzen“ = führen<br />
2. § 16 I StVZO<br />
- „besonderes Zulassungsverfahren“ gemäß § 3 ff FZV<br />
3. § 1 FZV Anwendungsbereich der FZV<br />
- BbH von mehr als 6 km/h<br />
4. § 3 FZV<br />
- Typ-/Einzelgenehmigung vorhanden<br />
- Haftpflichtversicherung<br />
- Zuteilung eines Kennzeichens<br />
- Ausfertigung der Zulassungsbescheinigung<br />
5. § 8 FZV Kennzeichen<br />
- Vorhanden und angebracht<br />
6. § 11 V FZV<br />
- Zulassungsbescheinigung Teil I wird mitgeführt und ausgehändigt<br />
7. § 30 I StVZO<br />
- Teilnahme am Straßenverkehr<br />
- Schädigung, Gefährdung, Behinderung, Belästigung<br />
- § 30 I StVZO setzt keine konkrete Gefahr usw. voraus<br />
8. Ergebnis: Begründung des Verstoßes gegen § 30 I StVZO<br />
9. Verstoß ist OWi gemäß §§ 30 I, 69a III oder IV Nr. 1 StVZO i. V. m. § 24 StVG<br />
- 32 -
Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />
Prüfungsschema: Erlöschen der Betriebserlaubnis bei einem zulassungsfreien<br />
Fahrzeug<br />
Sachverhalt:<br />
Die Polizei stellt im Rahmen der Kontrolle eines Mofas Veränderungen fest, die eine<br />
Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h ermöglichen.<br />
Hinweis:<br />
Im vorliegenden Fall führten die Veränderungen (der Fahrzeugart) zum Erlöschen<br />
der Betriebserlaubnis. Damit liegt ein Verstoß gegen § 19 V StVZO vor. Das gilt es<br />
anhand des Prüfungsschemas zu prüfen.<br />
Darüber hinaus kann (die Frage der Gesetzeskonkurrenz einmal ausgeklammert)<br />
auch ein Verstoß gegen § 30 I StVZO vorliegen. Auch dies gilt es zu prüfen.<br />
Schließlich liegt auch ein Verstoß gegen zulassungsrechtliche Bestimmungen vor.<br />
1. § 1 StVG, Zulassungspflicht für Kfz / Anhänger<br />
- Kfz / Anhänger<br />
- öffentlicher Verkehrsraum<br />
- „in Betrieb setzen“ = führen<br />
2. § 16 I StVZO<br />
- „besonderes Zulassungsverfahren“ gemäß § 3 ff FZV<br />
3. § 1 FZV Anwendungsbereich der FZV<br />
- BbH mehr als 6 km/h<br />
4. § 3 FZV<br />
- Typ-/Einzelgenehmigung vorhanden<br />
- Haftpflichtversicherung<br />
- Zuteilung eines Kennzeichens<br />
- Ausfertigung der Zulassungsbescheinigung<br />
5. Ausnahme von Zulassungsverfahren:<br />
- § 3 II Nr. 1 d FZV Mofa:<br />
o Definition § 2 Nr. 11 a FZV (KKR) und § 4 I Nr. 1 FeV: Einspurige,<br />
einsitziges Fahrrad mit Hilfsmotor – auch ohne Tretkurbel, BbH max. 25<br />
km/h<br />
- § 4 I FZV Typ-/Einzelgenehmigung<br />
- § 1 I PflichtVG Versicherungspflicht<br />
- §§ 4 III, 26, 27 III FZV: Versicherungskennzeichen nur an der Rückseite<br />
- § 26 I FZV Versicherungsbescheinigung mitführen/aushändigen<br />
- 33 -
Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />
6. § 4 V FZV Typ-/Einzel-Genehmigung<br />
- mitführen/aushändigen<br />
7. Veränderungen am KFZ (Welches Kfz liegt jetzt vor)<br />
7.1 Prüfung der Ordnungswidrigkeit nach § 19 V StVZO<br />
7.2 Unter Verweis auf die vorgenannten Punkte 1 bis 6 Prüfung der<br />
Ordnungswidrigkeit nach § 30 I StVZO<br />
7.3 Unter Verweis auf die vorgenannten Punkte 1 bis 6 Prüfung der<br />
zulassungsrechtlichen Bestimmungen<br />
7.3.1 Alternative:<br />
An dem Mofa wurde der Hubraum über 50 ccm bis max. 125 ccm verändert, dann<br />
wird daraus ein Leichtkraftrad welches ebenfalls gem. § 3 II FZV vom<br />
Zulassungsverfahren ausgenommen ist, allerdings ohne die erforderliche Typ-<br />
/Einzelgenehmigung gem. § 4 I FZV in Betrieb gesetzt wird.<br />
Tatbestand BKat TBNR €uro<br />
Sie setzten das zulassungsfreie Fahrzeug<br />
ohne die dafür erforderliche<br />
Typgenehmigung/Einzelgenehmigung in<br />
Betrieb. § 4 I, § 48 FZV; § 24 StVG; B 3<br />
175 804600 50,-<br />
Der Verstoß stellt eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 4 I i.V.m. § 48 FZV i.V.m. § 24<br />
StVG dar.<br />
7.3.2 Alternative:<br />
Das Mofa wurde ohne Manipulation des Hubraumes verändert, also hat es weiterhin<br />
nicht mehr als 50 cm³ aber eine Geschwindigkeit von 125 km/h. Damit ist es unter die<br />
Definition des Kraftrades in § 2 Nr. 9 FZV einzuordnen. Das Kfz ist somit keine<br />
Ausnahme vom Zulassungsverfahren gemäß § 3 II FZV und es entsteht<br />
Zulassungspflicht nach § 3 I FZV.<br />
Tatbestand BKat TBNR €uro<br />
Sie setzten das Fahrzeug in Betrieb, obwohl<br />
es nicht zum Verkehr zugelassen war.<br />
§ 3 I, § 48 FZV; § 24 StVG; B 3<br />
175 803600 50,-<br />
Der Verstoß stellt eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 3 I i.V.m. § 48 FZV i.V.m. § 24<br />
StVG dar.<br />
- 34 -
Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />
Eine Straftat gemäß § 370 AO oder eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 378 AO liegt<br />
regelmäßig aufgrund der entgegenstehenden Vorschrift des § 3 I DV-KraftStG nicht<br />
vor. Die in solchen Fällen einschlägige widerrechtliche Benutzung ist dort nämlich<br />
nicht als meldepflichtiger Tatbestand aufgeführt. Übrig bleibt die Steuerschuld und<br />
die Mitteilungspflicht der Polizei darüber gegenüber den Finanzbehörden aufgrund §<br />
116 AO.<br />
§§ 1, 6 PflichtVG sind nicht anwendbar, wenn das versicherte Fahrzeug verändert<br />
wird, weil ein gültiger Versicherungsvertrag besteht.<br />
Fragen aus der Praxis zum Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />
Beantwortet von Immanuel Noske, LAFP NRW:<br />
Sachverhalt 1:<br />
Jemand hat im Fachhandel eine Sportauspuffanlage für seinen VW Golf 5 gekauft.<br />
Dafür hat er vom Händler eine EG-Genehmigung (also eine Betriebserlaubnis im<br />
Sinne § 19 III Nr. 2 StVZO) ausgehändigt bekommen.<br />
Diese Anlage baut er nun an seinen VW Golf 5. Da für europäische Erlaubnisse und<br />
Genehmigungen keine Einbauabnahme besteht, musste er den VW Golf 5 mit der<br />
neuen Anlage auch nicht irgendwo vorführen.<br />
Frage:<br />
Wie kann der Kollege bei der Verkehrskontrolle nun erkennen, ob mit der<br />
Auspuffanlage alles in Ordnung ist. Reicht es, wenn der Kfz-Führer ihm die vom<br />
Fachhändler ausgehändigte EG-Genehmigung überreicht (Mitführpflicht gemäß § 19<br />
IV StVZO) oder gibt es für die Zulässigkeit dieser Veränderung (die ja die<br />
Umweltvariante aus § 19 II StVZO betrifft) weitere Erfordernisse<br />
Antwort:<br />
Zunächst existiert für die beschriebene EG-Genehmigung keine Mitführpflicht. § 19<br />
IV StVZO spricht lediglich die Fälle des § 19 III Nr. 1 und 3 StVZO an. Die EG-<br />
Genehmigung ist allerdings in Nr. 2 beschrieben. Dieser Umstand ist in der Praxis<br />
jedoch kaum bekannt, so dass man bei der überwiegenden Anzahl der Kontrollen<br />
auch EG-Genehmigungen ausgehändigt bekommt.<br />
Die Überprüfung der Vorschriftsmäßigkeit gestaltet sich jedoch schwierig, da die<br />
Genehmigungen nicht zwingend in Deutsch verfasst sein müssen.<br />
Für die Praxis bedeutet dies, dass der einzige Weg über die Genehmigungsnummer<br />
des Bauteils zum KBA führt. Dort ist man in der Lage, Auflagen oder<br />
Einschränkungen mitzuteilen. Zu den Geschäftszeiten kann dies sicher telefonisch<br />
erfolgen - außerhalb der Geschäftszeiten wird es problematisch.<br />
- 35 -
Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />
Inzwischen können übrigens sogar einige Anhängerkupplungen an Pkw "selbst"<br />
angebaut werden, OHNE dass eine weitere Überprüfung stattfinden muss (auch<br />
diese haben dann eine EG-Genehmigung).<br />
Sachverhalt 2:<br />
Seitdem die Zulassungsstellen nur noch die Zulassungsbescheinigungen Teil 1<br />
aushändigen, werden nachträgliche Veränderungen am Kfz dort nicht mehr<br />
eingetragen, sondern nur noch in einer Kartei der Zulassungsstelle "verwaltet".<br />
Frage:<br />
Welche Veränderungen müssen überhaupt bei der Zulassungsstelle angezeigt<br />
werden. Reicht es nicht aus, wenn man, wie oben im Auspuffbeispiel, eine ABE oder<br />
EG-Genehmigung vorlegen kann<br />
Antwort:<br />
Die wahlweisen Rad-Reifen-Kombinationen, die der Fahrzeughersteller serienmäßig<br />
für ein bestimmtes Fahrzeug freigibt, sind nicht mehr alle in die<br />
Zulassungsbescheinigung eingetragen. Es wird nur noch eine Kombination<br />
aufgenommen (das muss nicht der tatsächlich montierten entsprechen). Aufschluss<br />
kann nur der Fahrzeughersteller geben (über die FIN).<br />
Bei Teilen für die ein Teilegutachten existiert muss eine Anbauabnahme im Sinne<br />
des § 19 III StVZO erfolgen. Das Textfeld 22 der Zulassungsbescheinigung wird<br />
dann auf der Anbauabnahme fortgeführt. Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist<br />
erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle erforderlich. Fahrzeugteile mit<br />
einer Teile-Betriebserlaubnis (z. B. dunkel eingefärbte Schlussleuchten) unterliegen<br />
in der Regel nicht der Abnahme und somit auch nicht dem Eintrag. Jedoch: Die ABE<br />
unterliegt der Mitführpflicht (19 III StVZO) und es müssen alle Auflagen eingehalten<br />
werden (im o. a. Beispiel ist dies in der Regel das zusätzliche Anbringen von<br />
Rückstrahlern).<br />
Sämtliche Sonderabnahmen, die über die Begutachtung nach 19 III StVZO<br />
hinausgehen (z. B. sog. Einzelabnahmen) müssen in die Zulassungsbescheinigung<br />
eingetragen werden.<br />
Sachverhalt 3:<br />
Jemand kauft sich für seinen Audi A3 im Fachhandel eine neue Fahrzeugfront, also<br />
mit Spoilerlippe und verändertem Kühlergrill. In der ausgehändigten ABE steht, dass<br />
der Einbau von einem Sachverständigen abgenommen werden muss.<br />
- 36 -
Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />
Frage:<br />
Wie sieht das in der Praxis aus. Fahre ich also mit meiner neuen A3 Front zur<br />
DEKRA, lasse das Teil begutachten und bekomme dann ein Zertifikat Muss ich mit<br />
diesem Zertifikat dann noch zur Zulassungsstelle, um das ganze "eintragen", also in<br />
die dortige Kartei aufnehmen zu lassen<br />
Früher wurden diese Veränderungen in den Fahrzeugschein "eingetragen". Das wird<br />
ja heute nicht mehr gemacht. Woher weiß ich aber bei der Kontrolle, ob der Kfz-<br />
Führer die Veränderung seines A3 tatsächlich (wenn er denn überhaupt dazu<br />
verpflichtet ist) auch bei der Zulassungsstelle angezeigt hat Oder reicht es, wenn er<br />
bei der Kontrolle das Einbaugutachten der DEKRA präsentieren kann<br />
Antwort:<br />
Letzteres reicht völlig aus! Das Textfeld des Fahrzeugscheines wird in der<br />
Anbauabnahme fortgeführt (es ist quasi wie eingetragen mit dem Unterschied, dass<br />
der Halter nicht für jede Veränderung eine neue Zulassungsbescheinigung benötigt.<br />
Bei der nächsten Befassung (z. B. Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk) ist<br />
eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente erforderlich (da ja dann ohnehin eine<br />
neue<br />
Zulassungsbescheinigung erstellt werden muss).<br />
Wichtig: Die Anbauabnahme ist UNVERZÜGLICH durchzuführen. D. h. nach Einbau<br />
auf DIREKTEM Weg, ansonsten wäre die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs<br />
erloschen!<br />
Sachverhalt 4:<br />
Es gibt Kfz-Felgen (AZEV, Borbet etc.), die man sich im Nachhinein an seinen Pkw<br />
anbauen kann. Beim Kauf bekommt man für diese ebenfalls eine ABE und muss den<br />
Anbau (so wie es in der ABE dann eben steht) begutachten lassen oder nicht.<br />
Frage:<br />
Was ist mit Felgen, die z.B. für einen Golf 5 beim VW-Händler gekauft werden, z.B.<br />
vom VW-Haustuner ABT Ist es so, dass bei der Prüfung des Kfz-Prototyps nach §<br />
20 StVZO häufig auch eine ganze Reihe von Felgen, Spoilern, Scheinwerfertunings<br />
etc. mitgeprüft werden und dann auch mit unter die Allgemeine Betriebserlaubnis für<br />
Typen gem. § 20 StVZO fallen Bekomme man für diese Teile dann keine ABE<br />
mehr, die bei einer Kontrolle vorgewiesen werden kann Woher weiß dann aber der<br />
Kollege, ob dieser Fahrzeugfront von ABT oder die Felgen von Projekt ZWO schon<br />
im Rahmen der Prototypprüfung gemäß § 20 StVZO mitgeprüft und für tauglich<br />
befunden wurden<br />
Antwort:<br />
Projekt ZWO und ABT sind Fahrzeugtuner, die sich in der Regel nicht mit den<br />
Größen einer vom Hersteller freigegebenen Rad-Reifen-Kombination zufrieden<br />
geben. Daher werden wir insbesondere für Felgen dieser Hersteller regelmäßig eine<br />
ABE bekommen müssen. Den Auflagen dieser ABE kann dann entnommen werden,<br />
- 37 -
Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />
ob z. B. eine Anbauabnahme erforderlich ist oder z. B. nur bestimmte Reifengrößen<br />
gefahren werden dürfen.<br />
Zu diesem Thema – Hinweis auf die Seite www.tune-it-safe.de.<br />
Sachverhalt 5:<br />
Im Sommer führen viele Kräder sog. Sportauspuffs. Für diese Sportauspuffanlagen<br />
wird eine Betriebserlaubnis nach § 22 StVZO ausgehändigt.<br />
Frage:<br />
Wie kann ich herausfinden, ob nicht im Nachhinein noch selbständig am<br />
Sportauspuff "herumgebastelt" wurde, um ihn noch sportlicher, also noch lauter zu<br />
machen (sog. "Brülltüte") Gibt es da für die Kollegen irgendwelche Tipps, woran sie<br />
schnell und einfach erkennen können, ob der Auspuff "leergeräumt" wurde bzw. ob<br />
tatsächlich im Nachhinein eigenmächtig daran manipuliert wurde und somit trotz<br />
vorliegender Betriebserlaubnis nach § 22 StVZO die Umweltvariante aus § 19 III<br />
StVZO zutrifft<br />
Antwort:<br />
Gibt es! Bei sehr vielen Anlagen wird einfach das sog. Prallblech entfernt (erkennt<br />
man häufig durch einen Blick in die Abgasanlage). Ferner werden momentan<br />
manipulierte Anlagen (bei ebay) angeboten, die man mechanisch oder elektrisch<br />
während der Fahrt lauter oder leiser regeln kann. Das funktioniert in dem das<br />
Prallblech beweglich ist und man es einfach im Auspuff verdreht (mechanisch oder<br />
mit Elektromotor) Somit während der Fahrt laut und bei der Kontrolle wieder leise<br />
schaltet. Daneben gibt es zahlreiche Möglichkeiten der Manipulation.<br />
- 37a -
Maßnahmen § 5 FZV<br />
Verbot der<br />
Weiterfahrt<br />
Verkehrsüberwachung<br />
§ 19 III StVZO<br />
EG-Typgenehmigung<br />
Änderungen<br />
nationale<br />
Typgenehmigung<br />
Abgas- und<br />
Geräuschverhalten<br />
§ 19 II StVZO<br />
Betriebserlaubnis<br />
Voraussetzung<br />
für die<br />
Zulassung<br />
Gefährdung<br />
Einzelgenehmigung<br />
Fahrzeugart<br />
COC<br />
§ 19 V StVZO<br />
§ 30 I StVZO<br />
§ 4 I FZV<br />
zulassungspflichtige<br />
Fahrzeuge<br />
Voraussetzung<br />
Zulassung<br />
Versicherung<br />
Steuer<br />
AKB<br />
Vertrag<br />
widerrechtliche<br />
Benutzung<br />
§ 30 I StVZO<br />
§ 19 V StVZO<br />
zulassungsfreie<br />
Fahrzeuge<br />
Rechtsfolgen<br />
§ 3 I FZV<br />
4 Erlöschen BE MindMap.pdf - 17.05.2012 - The Mindjet Team
Kennzeichen<br />
5 Kennzeichen<br />
5.1 Zuteilung von Kennzeichen<br />
§ 8 I FZV Die Zulassungsbehörde teilt dem Fahrzeug ein Kennzeichen zu. Es besteht<br />
aus einem Unterscheidungszeichen für den Verwaltungsbezirk (im<br />
gezeigten Beispiel: HH) und einer Erkennungsnummer (im gezeigten<br />
Beispiel: EU 194). Die Unterscheidungszeichen sind nach Maßgabe der<br />
Anlage 1 zu vergeben bzw. werden im Bundesanzeiger bekannt gemacht.<br />
Das Eurokennzeichen ist ab dem 01.11.2000 zu verwenden. Kennzeichen,<br />
die vor dem 01.11.2000 zugeteilt worden sind, gelten jedoch weiter.<br />
5.2 Besondere Kennzeichen<br />
§ 9 II FZV Grünes Kennzeichen<br />
Bei Fahrzeugen, deren Halter von der Kraftfahrzeugsteuer befreit ist, ist<br />
abweichend von § 10 I FZV ein Kennzeichen mit grüner Beschriftung auf<br />
weißem Grund zuzuteilen.<br />
Ausgenommen hiervon sind z.B.:<br />
1. Fahrzeuge von Behörden<br />
2. Leichtkrafträder<br />
3. Kleinkrafträder<br />
Die Zuteilung ist in der Zulassungsbescheinigung Teil I zu vermerken.<br />
- 39 -
Kennzeichen<br />
§ 8 I Satz 3<br />
FZV<br />
Behördenkennzeichen<br />
Fahrzeuge der Bundes- oder Landesorgane, des Diplomatischen Corps<br />
und berechtigter Internationaler Organisationen erhalten besondere<br />
Kennzeichen nach Anlage 3; die Erkennungsnummern dieser Fahrzeuge<br />
bestehen nur aus Zahlen. Die Zahlen dürfen nicht mehr als 6 Stellen haben.<br />
Anlage 4<br />
Kraftradkennzeichen<br />
Durch die 1. Verordnung zur Änderung der FZV vom 04.04.2011 (BGBl. I,<br />
549) wird der Forderung Rechnung getragen, Kennzeichen bis zu einer<br />
Minimalgröße von 18x20 cm zuzulassen.<br />
Mit der Änderung wird auch die geänderte Gestaltung der Kraftradkennzeichen<br />
in den Ausführungen als allgemeines Kennzeichen, Oldtimerkennzeichen<br />
und Saisonkennzeichen eingeführt.<br />
Vergleich:<br />
Altes Kennzeichen (rechts)<br />
Neues Kraftradkennzeichen (links)<br />
Quelle: BMVBS<br />
- 40 -
Kennzeichen<br />
§ 8 Ia<br />
FZV<br />
Wechselkennzeichen 1<br />
Bei der Zulassung von zwei Fahrzeugen auf den gleichen Halter oder der<br />
Zuteilung des Kennzeichens für zwei zulassungsfreie kennzeichenpflichtige<br />
Fahrzeuge des gleichen Halters wird auf dessen Antrag für diese Fahrzeuge<br />
ein Wechselkennzeichen zugeteilt, sofern die Fahrzeuge in die gleiche<br />
Fahrzeugklasse M1, L oder O1 fallen und Kennzeichenschilder gleicher Anzahl<br />
und Abmessungen an den Fahrzeugen verwendet werden können.<br />
Das Wechselkennzeichen besteht aus einem den Fahrzeugen gemeinsamen<br />
Kennzeichenteil (Eurokennzeichen) und dem jeweiligen fahrzeugbezogenen<br />
[kleinen (Ziffern-)] Teil.<br />
- Den gemeinsamen Kennzeichenteil bilden dass Unterscheidungszeichen<br />
und der bis auf die letzte Ziffer gleiche Teil der Erkennungsnummer<br />
- Den jeweiligen fahrzeugbezogenen Teil bildet die letzte Ziffer der Erkennungsnummer<br />
Quelle: ADAC<br />
Der fahrzeugbezogene Teil ist ständig am betreffenden Fahrzeug anzubringen.<br />
Auf diesem Teil ist unter der Ziffer auch die Beschriftung des gemeinsamen<br />
Teils aufgeführt, sodass das vollständige Kennzeichen des Fahrzeugs<br />
ersichtlich ist. Der gemeinsame Kennzeichenteil ist an dem Fahrzeug<br />
anzubringen, das gerade im öffentlichen Straßenverkehr betrieben oder abgestellt<br />
wird. Für zwei Pkw werden somit zwei Schilder mit dem gemeinsamen<br />
Kennzeichenteil und vier Schilder (für jedes Fahrzeuge zwei) mit dem<br />
fahrzeugbezogenen Teil ausgefertigt. 2<br />
Anders ausgedrückt: Das Wechselkennzeichen besteht aus den für beide<br />
Fahrzeuge gleichen Kennzeichenteilen (z.B. K – XX 33), auf denen die Zulassungsplakette<br />
in Form des Landeswappens aufgebracht ist und die am jeweils<br />
genutzten Fahrzeug vorn und hinten montiert werden. Sie entsprechen den<br />
"normalen" Kennzeichenschildern, haben allerdings keine HU-Plakette. Diese<br />
befindet sich auf den fahrzeugbezogenen Kennzeichenteilen, die an beiden<br />
Fahrzeugen ständig vorn und hinten befestigt bleiben. Sie sind viel kleiner und<br />
tragen nur die Ziffern 1 oder 2 sowie unten kleinformatig das gemeinsame<br />
Kennzeichen, damit stets die gesamte Autonummer erkennbar ist.<br />
1<br />
2<br />
Die Regelung tritt zum 01.07.2012 in Kraft.<br />
Liebermann VD 2012, 39.<br />
- 41 -
Kennzeichen<br />
Ein Wechselkennzeichen darf zur selben Zeit nur an einem der Fahrzeuge<br />
geführt werden. Ein Fahrzeug, für das ein Wechselkennzeichen zugeteilt ist,<br />
darf auf öffentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt oder abgestellt werden,<br />
wenn an ihm das Wechselkennzeichen vollständig mit dem gemeinsamen<br />
Kennzeichenteil und seinem fahrzeugbezogenen Teil angebracht ist.<br />
Zum Schutz unbeteiligter Dritter wurde seitens des Bundeskriminalamtes<br />
angeregt, kein Wechselkennzeichen zuzuteilen, dessen gemeinsamer Teil<br />
bereits einer ausgegebenen Erkennungsnummer eines „regulären“ Kennzeichens<br />
entspricht bzw. kein „reguläres“ Kennzeichen auszugeben, dessen<br />
Erkennungsnummer bereits als gemeinsamer Teil eines Wechselkennzeichens<br />
zugeteilt worden ist.<br />
Zur Vermeidung von Missbrauch gestohlener gemeinsamer Kennzeichenteile<br />
sind diese durch die Angabe „W“ gekennzeichnet. Dadurch können die<br />
Kontrollbehörden feststellen, dass es sich um einen Teil eines Wechselkennzeichens<br />
handelt, der nur in Verbindung mit dem fahrzeugbezogenen<br />
Teil geführt werden darf. Die Ergänzung der Beschriftung des fahrzeugbezogenen<br />
Kennzeichens ist erforderlich, um Fälschungsmöglichkeiten zu erschweren.<br />
Der zusätzliche Buchstabe „W“ ist nicht Bestandteil des Kennzeichens.<br />
Er kennzeichnet nur das Schild als Teil eines Wechselkennzeichens.<br />
Ergänzend kündigte das BMVBS bereits im Juni 2012 3 mit, „zur eindeutigen<br />
Identifizierung des Wechselkennzeichens die Aufprägung des „W“ zwischen<br />
dem Unterscheidungszeichen und den Buchstaben der Erkennungsnummern<br />
auf dem gemeinsamen Kennzeichenteil vorzuschreiben. Wie auf dem<br />
102. BLFA-Fz abgestimmt, bestehen von hier aus keine Bedenken, im Interesse<br />
eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Wechselkennzeichen im<br />
Vorgriff auf die zu erwartende Verordnungsänderung bereits ab dem<br />
01.07.2012 den gemeinsamen Kennzeichenteil entsprechend auszugestalten.“<br />
Hierzu liegen bereits entsprechende Erlasse der Länder vor. 4 Zum<br />
01.11.2012 wurde die entsprechende Änderungsverordnung in Kraft gesetzt.<br />
5<br />
Die Bußgeldsätze für das Führen (50 €uro) oder Abstellen (40 €uro) des<br />
Fahrzeugs ohne oder mit unvollständigem Wechselkennzeichen entsprechen<br />
den Sätzen für Fahrzeuge mit Saisonkennzeichen.<br />
3<br />
4<br />
5<br />
Schreiben BMVBS, Az.: LA23/7362.2/3-01<br />
Erlass MBWSV NRW vom 21.06.2012 – VII B 2-21-13/409.<br />
1. Verordnung zur Änderung der FZV (…) vom 19.10.2012 (BGBl. I S. 2232).<br />
- 42 -
Kennzeichen<br />
5.3 Ausgestaltung und Anbringung der Kennzeichen<br />
§ 10 I FZV Unterscheidungszeichen und Erkennungsnummern sind mit schwarzer<br />
Beschriftung auf weißem schwarz gerandetem Grund auf ein Kennzeichenschild<br />
aufzubringen....<br />
§ 10 II FZV Kennzeichenschilder dürfen nicht spiegeln, verdeckt oder verschmutzt<br />
sein; sie dürfen nicht zusätzlich mit Glas, Folien oder ähnlichen Abdeckungen<br />
versehen sein, es sei denn, die Abdeckung ist Gegenstand der<br />
Genehmigung nach den in Absatz 6 genannten Vorschriften.....<br />
§ 10 III FZV Das Kennzeichenschild mit zugeteiltem Kennzeichen muss der Zulassungsbehörde<br />
zur Abstempelung durch eine Stempelplakette vorgelegt<br />
werden. Die Stempelplakette enthält das farbige Wappen des Landes,<br />
dem die Zulassungsbehörde angehört, sowie die Bezeichnung des<br />
Landes und der Zulassungsbehörde. Die Stempelplakette muss so<br />
beschaffen sein und so befestigt werden, dass sie bei einem Entfernen<br />
zerstört wird.<br />
§ 10 IV<br />
FZV<br />
Fahrten, die im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren stehen,<br />
insbesondere Fahrten zur Anbringung der Stempelplakette sowie Fahrten<br />
zur Durchführung einer Hauptuntersuchung oder einer Sicherheitsprüfung<br />
dürfen innerhalb des Zulassungsbezirks und eines angrenzenden<br />
Bezirks mit ungestempelten Kennzeichen durchgeführt werden,<br />
wenn die Zulassungsbehörde vorab ein solches zugeteilt hat und die<br />
Fahrten von der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung erfasst sind.<br />
Rückfahrten nach Entfernung der Stempelplakette dürfen mit dem bisher<br />
zugeteilten Kennzeichen bis zum Ablauf des Tages der Außerbetriebsetzung<br />
des Fahrzeugs durchgeführt werden, wenn sie von der Kfz-<br />
Haftpflichtversicherung erfasst sind.<br />
- Allerdings fehlt hier im Gegensatz zu der bis zum 01.11.2012 geltenden<br />
Regelung der Hinweis auf die regionale Beschränkung,<br />
sodass Fahrten im gesamten Bundesgebiet zulässig sind, solange<br />
sie bis zum Ablauf des Tages der Außerbetriebsetzung erfolgen.<br />
§ 10 V FZV Kennzeichen müssen an der Vorder- und Rückseite des Kraftfahrzeugs<br />
vorhanden und fest angebracht sein. Bei einachsigen Zugmaschinen<br />
genügt die Anbringung an der Vorderseite, bei Anhängern und bei Krafträdern<br />
die Anbringung an deren Rückseite.<br />
- 43 -
Kennzeichen<br />
§ 10 VI FZV Die Anbringung und Sichtbarkeit des hinteren Kennzeichens muss entsprechen:<br />
(Hintere Kennzeichen müssen eine Beleuchtungseinrichtung<br />
haben, .....die das ganze Kennzeichen auf 20 m lesbar macht. Die Beleuchtungseinrichtung<br />
darf kein Licht unmittelbar nach hinten austreten<br />
lassen).<br />
§ 10 VIII FZV Anhänger nach § 3 II Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a bis c, f und g sowie Anhänger<br />
nach § 3 II Satz 1 Nr. 2 Buchstabe d und e, die ein eigenes<br />
Kennzeichen nach § 4 nicht führen müssen, haben an der Rückseite ein<br />
Kennzeichen zu führen, das der Halter des Zugfahrzeugs für eines seiner<br />
Zugfahrzeuge verwenden darf; eine Abstempelung ist nicht erforderlich.<br />
(Wiederholungskennzeichen)<br />
§ 10 IX FZV Wird das hintere Kennzeichen durch einen Ladungsträger oder mitgeführte<br />
Ladung teilweise oder vollständig verdeckt, so muss am Fahrzeug<br />
oder am Ladungsträger das Kennzeichen wiederholt werden. Eine Abstempelung<br />
ist nicht erforderlich.<br />
§ 10 X FZV Außer dem Kennzeichen darf nur das Unterscheidungszeichen für den<br />
Zulassungsstaat.......am Fahrzeug angebracht werden. Für die Bundesrepublik<br />
Deutschland ist dies der Großbuchstabe "D".<br />
§ 10 XI FZV Zeichen und Einrichtungen aller Art, die zu Verwechslungen mit Kennzeichen<br />
oder dem Unterscheidungszeichen nach Absatz 10 führen oder<br />
deren Wirkung beeinträchtigen können, dürfen an Fahrzeugen nicht angebracht<br />
werden. ...... Die Berechtigung zur Führung der Zeichen "CD"<br />
und "CC" ist in die Zulassungsbescheinigung Teil I einzutragen.<br />
<br />
§ 10 XII FZV Unbeschadet des Absatzes 4 dürfen Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen<br />
nur in Betrieb gesetzt werden, wenn das zugeteilte Kennzeichen auf<br />
einem Kennzeichenschild nach Absatz 1, 2 Satz 1, 2 und 3 Halbsatz 1,<br />
Absatz 5 Satz 1 sowie Absatz 6 bis 8 und 9 Satz 1<br />
ausgestaltet,<br />
angebracht und<br />
beleuchtet ist und<br />
die Stempelplakette nach Absatz 3 Satz 1 und 2 vorhanden<br />
ist und<br />
keine verwechslungsfähigen oder beeinträchtigenden<br />
Zeichen und Einrichtungen nach Absatz 11 Satz 1 am<br />
Fahrzeug angebracht sind.<br />
Der Halter darf die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs nicht anordnen o-<br />
der zulassen, wenn die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht vorliegen.<br />
- 44 -
Kennzeichen<br />
§ 10 XIII FZV Abweichend von Absatz 2 Satz 1 und Absatz 6 Satz 2 bis 4 dürfen nach<br />
§ 22a Absatz1 Nr. 21 StVZO bauartgenehmigte<br />
Beleuchtungseinrichtungen für hintere transparente Kennzeichen oder<br />
Beleuchtungseinrichtungen, die mit dem Kennzeichen eine Einheit<br />
bilden oder bei der sich das Kennzeichen hinter einer durchsichtigen,<br />
lichtleitenden Abschlussscheibe befindet,<br />
1. weißes Licht nach hinten abstrahlen<br />
2. mit einer Abschlussscheibe vor dem Kennzeichen versehen sein.<br />
§ 23 I Satz 3<br />
StVO<br />
Der Fahrzeugführer muss auch dafür sorgen, dass die vorgeschriebenen<br />
Kennzeichen stets gut lesbar sind.<br />
5.4 Verstöße aus dem BKat-OWi:<br />
Ausgestaltung und Anbringung der Kennzeichen - § 10 FZV<br />
Tatbestand BKat TBNR €uro<br />
Sie setzten das Fahrzeug in Betrieb, dessen<br />
hinteres amtliches Kennzeichen nicht den<br />
Vorschriften entsprach.<br />
§§ 10 I, 6, 12, § 48 FZV; § 24 StVG<br />
Sie setzten das Fahrzeug in Betrieb, dessen<br />
vorderes amtliches Kennzeichen nicht den<br />
Vorschriften entsprach.<br />
§§ 10 I, VII, XII, § 48 FZV; § 24 StVG<br />
Sie setzten das Fahrzeug in Betrieb, obwohl sich<br />
die an dem Fahrzeug angebrachten<br />
Kennzeichenschilder in keinem<br />
ordnungsgemäßen Zustand *) befanden.<br />
§§ 10 II, XII § 48 FZV; § 24 StVG<br />
Sie nahmen das Fahrzeug in Betrieb, dessen<br />
Kennzeichenbeleuchtung nicht den Vorschriften<br />
entsprach.<br />
§§ 10 VI, XII § 48 FZV; § 24 StVG<br />
Sie nahmen das Fahrzeug in Betrieb, dessen<br />
vorgeschriebenes amtliches Kennzeichen fehlte.<br />
§§ 10 V, XII § 48 FZV; § 24 StVG<br />
Sie führten an der Rückseite des letzten<br />
zulassungsfreien Anhängers kein<br />
vorgeschriebenes Kennzeichen.<br />
§§ 10 V, XII § 48 FZV; § 24 StVG<br />
179 810100 10,-<br />
179 810106 10,-<br />
179 810112 10,-<br />
179 810118 10,-<br />
179a 810600 40,-<br />
179a 810612 40,-<br />
- 44a -
Kennzeichen<br />
Sie nahmen das Fahrzeug in Betrieb, dessen<br />
amtliches Kennzeichen mit Glas, Folie oder<br />
ähnlichen Abdeckungen versehen war.<br />
§§ 10 II, XII § 48 FZV; § 24 StVG<br />
Sie führten das Fahrzeug, obwohl die<br />
vorgeschriebenen Kennzeichen schlecht lesbar<br />
waren<br />
§§ 23 I, § 49 StVO; § 24 StVG<br />
179b 810618 50,-<br />
107.3 123130 5,-<br />
- 44b -
Prüfungs-, Probe- und Überführungsfahrten<br />
6 Zeitweilige Teilnahme am Straßenverkehr<br />
Prüfungsfahrten, Probefahrten, Überführungsfahrten<br />
§ 16 I FZV Fahrzeuge dürfen, wenn sie nicht zugelassen sind, auch ohne eine EG-<br />
Typgenehmigung, nationale Typgenehmigung oder Einzelgenehmigung,<br />
zu Prüfungs-, Probe- oder Überführungsfahrten in Betrieb gesetzt werden,<br />
wenn sie ein Kurzzeitkennzeichen oder ein Kennzeichen mit roter<br />
Beschriftung auf weißem rot gerandetem Grund (rotes Kennzeichen)<br />
führen. § 31 II der StVZO bleibt unberührt.<br />
Definition<br />
Probefahrt<br />
… die Fahrt zur Feststellung und zum Nachweis der Gebrauchsfähigkeit<br />
des Fahrzeugs (Legaldefinition § 2 Nr. 23 FZV)<br />
Definition<br />
Prüfungsfahrt<br />
… die Fahrt zur Durchführung der Prüfung des Fahrzeugs durch einen<br />
amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr<br />
oder Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation<br />
einschließlich der Fahrt des Fahrzeugs zum Prüfungsort<br />
und zurück (Legaldefinition § 2 Nr. 24 FZV)<br />
Definition<br />
Überführungsfahrt<br />
… die Fahrt zur Überführung des Fahrzeugs an einen anderen Ort (Legaldefinition<br />
§ 2 Nr. 25 FZV)<br />
- 45 -
Prüfungs-, Probe- und Überführungsfahrten<br />
6.2 Rote Kennzeichen<br />
§ 16 III Satz 1<br />
FZV<br />
Rote Kennzeichen und besondere Fahrzeugscheinhefte für Fahrzeuge<br />
mit roten Kennzeichen können zugeteilt werden<br />
- durch die örtlich zuständige Zulassungsbehörde<br />
- an zuverlässige Kraftfahrzeughersteller, -teilehersteller, -werkstätten<br />
und –händler<br />
- befristet oder widerruflich<br />
- zur wiederkehrenden betrieblichen Verwendung, auch an unterschiedlichen<br />
Fahrzeugen<br />
§ 16 III Satz 2<br />
FZV<br />
Ein rotes Kennzeichen besteht aus<br />
- einem Unterscheidungszeichen<br />
- einer Erkennungsnummer nur aus Ziffern beginnend mit „06“<br />
§ 16 III FZV Für jedes Fahrzeug ist eine gesonderte Seite des Fahrzeugscheinheftes<br />
zu dessen Beschreibung zu verwenden; die Angaben zum Fahrzeug<br />
sind vollständig und in dauerhafter Schrift vor Antritt der ersten Fahrt<br />
einzutragen.<br />
Das Fahrzeugscheinheft ist bei jeder Fahrt mitzuführen und zuständigen<br />
Personen auf Verlangen auszuhändigen.<br />
Über jede Prüfungs-, Probe oder Überführungsfahrt sind fortlaufende<br />
Aufzeichnungen zu führen, aus denen das verwendete Kennzeichen,<br />
das Datum der Fahrt, deren Beginn und Ende, der Fahrzeugführer mit<br />
dessen Anschrift, die Fahrzeugklasse und der Hersteller des Fahrzeugs,<br />
die Fahrzeug-Identifizierungsnummer und die Fahrtstrecke ersichtlich<br />
sind.<br />
Die Aufzeichnungen sind ein Jahr lang aufzubewahren; sie sind zuständigen<br />
Personen auf Verlangen jederzeit zur Prüfung auszuhändigen.<br />
Nach Ablauf der Frist, für die das Kennzeichen zugeteilt worden ist, ist<br />
das Kennzeichen mit dem dazugehörigen Fahrzeugscheinheft der Zulassungsbehörde<br />
unverzüglich zurückzugeben.<br />
§ 16 IIIa FZV Rote Kennzeichen können auch Technischen Prüfstellen sowie anerkannten<br />
Überwachungsorganisationen für die Durchführung von Prüffahrten<br />
im Rahmen der HU, Sicherheitsprüfungen, Begutachtungen<br />
nach § 23 StVZO und Untersuchungen und Begutachtungen im Rahmen<br />
des § 5 FZV (…) zugeteilt werden. Das rote Kennzeichen (…) beginnt<br />
mit „05“.<br />
- 46 -
Prüfungs-, Probe- und Überführungsfahrten<br />
Häufig nehmen Inhaber von Kennzeichen zur wiederkehrenden Verwendung ihre<br />
Pflichten nicht so genau.<br />
Die Bestimmung des § 16 III FZV verlangt aber eindeutig die Zuverlässigkeit der privilegierten<br />
Personen.<br />
Die Zuverlässigkeit ist aber dann in Frage zu stellen ist, wenn der Betreffende<br />
<br />
<br />
<br />
entweder gegen die einschlägigen Vorschriften im Umgang mit dem roten Kennzeichen<br />
verstoßen hat,<br />
oder Verstöße gegen Verkehrsvorschriften bzw. Strafvorschriften begangen hat,<br />
die ihrerseits eine missbräuchliche Verwendung von roten Kennzeichen zur wiederkehrenden<br />
Verwendung vermuten lassen<br />
oder wenn hinsichtlich der erforderlichen ordnungsgemäßen Führung seines<br />
Gewerbebetriebes sonstige Auffälligkeiten und Unregelmäßigkeiten zutage treten,<br />
die eine derartige Vermutung begründen.<br />
Kennzeichenbestimmungen<br />
§ 16 V FZV Kurzzeitkennzeichen und rote Kennzeichen sind nach § 10 Anlage 4<br />
FZV anzubringen. Sie brauchen jedoch nicht fest angebracht zu sein.<br />
§ 10 XII FZV Fahrzeuge dürfen auf öffentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt werden,<br />
wenn das zugeteilte (rote) Kennzeichen auf einem Kennzeichenschild<br />
… ausgestaltet, angebracht und beleuchtet ist und die Stempelplakette<br />
vorhanden ist und keine verwechslungsfähigen oder beeinträchtigenden<br />
Zeichen und Einrichtungen am Fahrzeug angebracht<br />
sind.<br />
- 47 -
Prüfungs-, Probe- und Überführungsfahrten<br />
6.3 Rote Versicherungskennzeichen<br />
Fahrten im Sinne des § 16 I FZV<br />
- Prüfungsfahrten<br />
- Probefahrten<br />
- Überführungsfahrten<br />
dürfen mit roten Versicherungskennzeichen unternommen werden<br />
- mit Kfz i.S.d. § 4 III Satz 1 FZV<br />
d) zwei- oder dreirädrige Kleinkrafträder<br />
e) motorisierte Krankenfahrstühle<br />
f) vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge<br />
Der Buchstabenbereich der Erkennungsnummer beginnt mit dem Buchstaben Z. Das<br />
Kennzeichen selbst ist nach § 27 FZV anzubringen. Es braucht am Kfz nicht fest angebracht<br />
zu sein. Das entspricht der Regelung über die roten Kennzeichen.<br />
- 48 -
Prüfungs-, Probe- und Überführungsfahrten<br />
6.4 Kurzzeitkennzeichen<br />
Die Vorschrift des § 16 FZV regelt die zeitweilige Teilnahme am Straßenverkehr in<br />
den Fällen der Prüfungsfahrten, Probefahrten und Überführungsfahrten.<br />
Die Zulassungsbehörde erteilt auf Antrag<br />
- ein Kurzzeitkennzeichen<br />
o Das Kurzzeitkennzeichen besteht aus:<br />
• Unterscheidungszeichen<br />
• einer Erkennungsnummer<br />
• beginnend mit „03“ oder „04“<br />
• Ablaufdatum (fünf Tage ab Zuteilung)<br />
• Verwendung nur an einem Fahrzeug<br />
- einen Fahrzeugschein für Fahrzeuge mit Kurzzeitkennzeichen<br />
o Die Angaben zum Fahrzeug sind vor Antritt der ersten Fahrt vollständig<br />
und in dauerhafter Schrift in den Fahrzeugschein einzutragen<br />
o Der Fahrzeugschein ist bei jeder Fahrt mitzuführen und zuständigen<br />
Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen<br />
- 49 -
Prüfungs-, Probe- und Überführungsfahrten<br />
Rechtsfolgen<br />
Ein Zulassungsverstoß (§ 3 I FZV) liegt nur vor bei<br />
- zweckentfremdeter Benutzung<br />
- Anbringung an einem anderen Fahrzeug<br />
Ein Verstoß gegen § 16 II Satz 6 FZV liegt vor bei Anbringung der Kurzzeitkennzeichen<br />
an zwei Fahrzeugen gleichzeitig.<br />
Tatbestand BKat TBNR €uro<br />
Sie verwendeten das Kurzzeitkennzeichen verbotswidrig<br />
an mehr als einem Fahrzeug<br />
§ 16 II; § 48 FZV; § 24 StVG<br />
182 816606 50,-<br />
Nach Ablauf der Gültigkeit des Kurzzeitkennzeichens darf das Fahrzeug auf öffentlichen<br />
Straßen nicht mehr in Betrieb gesetzt werden.<br />
Tatbestand BKat TBNR €uro<br />
Sie setzten das Fahrzeug mit Kurzzeitkennzeichen<br />
in Betrieb, obwohl das auf dem Kennzeichen<br />
angegebene Ablaufdatum überschritten<br />
war.<br />
§ 16 II; § 48 FZV; § 24 StVG<br />
175 816600 50,-<br />
Ein Verstoß gegen § 10 XII FZV i.V.m. § 16 V FZV liegt vor, wenn das<br />
- Kennzeichen nicht wie vorgeschrieben ausgestaltet oder angebracht ist<br />
- Das Kennzeichen mit Folie (…) versehen ist<br />
Tatbestand BKat TBNR €uro<br />
Sie nahmen das Fahrzeug bei einer Prüfungsfahrt,<br />
Probefahrt oder Überführungsfahrt ohne<br />
Kurzzeitkennzeichen in Betrieb<br />
§ 16 V; § 48 FZV; § 24 StVG<br />
179a 816612 40,-<br />
Die weiteren Verstöße siehe Kapitel 1.<br />
Ein Verstoß gegen § 16 II, III FZV liegt vor, wenn<br />
- der Fahrzeugschein nicht mitgeführt oder ausgehändigt wird<br />
- Eintragungen nicht vorgenommen wurden<br />
Tatbestand BKat TBNR €uro<br />
Sie setzten das Fahrzeug in Betrieb, dessen hinteres<br />
amtliches Kennzeichen nicht den Vorschriften<br />
entsprach<br />
§ 10 XII, 16 II; § 48 FZV; § 24 StVG<br />
174 804100 10,-<br />
- 50 -
Prüfungs-, Probe- und Überführungsfahrten<br />
Sie setzten das Fahrzeug in Betrieb, dessen vorderes<br />
amtliches Kennzeichen nicht den Vorschriften<br />
entsprach<br />
§ 10 XII, 16 II; § 48 FZV; § 24 StVG<br />
Sie füllten den besonderen Fahrzeugschein nicht<br />
ordnungsgemäß aus<br />
§ 16 III, § 48 FZV, § 24 StVG<br />
174 804106 10,-<br />
181 816106 10,-<br />
Der Halter darf im Falle des Satzes 7 die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs nicht anordnen<br />
oder zulassen.<br />
Das Heidelberger Modell<br />
In letzter Zeit konnten auffallend viele Pkw mit Kurzzeitkennzeichen gesichtet werden,<br />
die in Kurzzeitkennzeichen der Stadt Heidelberg trugen. Gleichzeitig war zu beobachten,<br />
wie immer mehr gewerbliche Zulassungsbetriebe das Internet bewerben.<br />
Hier hatte sich ein Markt etabliert, der es dem Kunden ermöglichte auf sehr bequeme<br />
Art und Weise an Kurzzeitkennzeichen zu gelangen.<br />
Das war nur deshalb möglich, weil der Antragsteller die Kurzzeitkennzeichen bei einer<br />
beliebigen Zulassungsbehörde beantragen kann. Das folgte aus dem Wortlaut<br />
des § 16 II Satz 1 FZV-alt „auf Antrag hat eine Zulassungsbehörde bei Bedarf …“ ein<br />
Kurzzeitkennzeichen zuzuteilen.<br />
In der Praxis zeigte sich folgende typische Fallgestaltung: ein gewerblicher „Zulassungsservice“<br />
erwarb bei einer Versicherungsagentur eine ausreichende Anzahl Versicherungsdoppelkarten.<br />
Bei einer (nicht unbedingt der örtlich zuständigen) Zulassungshörde<br />
wurden sodann Kurzzeitkennzeichen in großer Zahl beantragt und ausgegeben.<br />
Eine Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen fand in aller Regel nicht<br />
statt. Diese Kurzzeitkennzeichen wurden dann an Dritte weiter verkauft.<br />
Die gezeigte Vorgehensweise beinhaltete nicht nur einen zulassungsrechtlichen Verstoß<br />
gegen § 3 I FZV i.V.m. § 48 Nr. 1a FZV, sondern auch einen Verstoß gegen §<br />
22a I Nr. 1 StVG (missbräuchliches Herstellen, Vertreiben oder Ausgeben von Kennzeichen)<br />
1 : -<br />
- „Vor dem Hintergrund der Verhinderung von Kennzeichenmissbrauch im Zusammenhang<br />
mit Straftaten und zum Schutz des staatlichen Zulassungswesens<br />
belegt § 22a Abs. 1 Nr. 1 StVG jede Abgabe von Fahrzeugkennzeichen<br />
an Dritte ohne vorherige Anzeige an die zuständige Zulassungsstelle gemäß §<br />
6b StVG mit Strafe. § 22a StVG erfasst auch die Kurzzeitkennzeichen nach §<br />
16 Abs. 2 FZV“.<br />
1<br />
OLG München NZV 2011, 263 (= DAR 2011, 151; ZfS 2011, 171).<br />
- 51 -
Prüfungs-, Probe- und Überführungsfahrten<br />
Das Urteil wird jedoch mit starker Kritik überzogen: Die Strafvorschrift bezieht sich<br />
nämlich nicht auf amtlich zugeteilte Kennzeichen, sondern lediglich auf Kennzeichenschilder,<br />
die noch keinen „amtlichen Segen“ haben. 2 Verhindert werden soll<br />
nach der amtlichen Begründung unkorrektes Verhalten im Zusammenhang mit dem<br />
Herstellen, Vertreiben und Ausgeben von Kennzeichenschildern. Herstellen bedeutet<br />
dabei die Fertigung des Endproduktes. 3 Die Serviceanbieter jedoch vertreiben gesiegelte<br />
und daher amtliche Kennzeichen.<br />
Nach den allgemeinen Grundsätzen der Zulassung bewirkt erst die Zuteilung eines<br />
amtlichen Kennzeichens die Zulassung des Fahrzeugs. Von einem amtlichen Kennzeichen<br />
kann nur gesprochen werden, wenn das Kennzeichenschild amtlich gesiegelt<br />
ist. 4 Dabei ergibt sich nach Anlage 4 Abschnitt 6 Nr. 4b FZV die Besonderheit,<br />
dass die Zulassungsbehörde dem Halter oder Antragsteller gestatten kann, die Plaketten<br />
an den Kurzzeitkennzeichen des Fahrzeugs selbst anzubringen.<br />
Damit aber wird die Regelung unterlaufen mit der Folge, dass amtlicherseits nicht<br />
mehr nachvollziehbar ist, welches Fahrzeug mit dem Kurzzeitkennzeichen tatsächlich<br />
unterwegs ist. Diese Regelung wurde durch die Neufassung der FZV daher inzwischen<br />
aufgehoben.<br />
Eine weitere Änderung 5 bewirkte inzwischen, dass nur noch die örtlich zuständige<br />
Zulassungsbehörde Kurzzeitkennzeichen zuzuteilen und einen auf den Antragsteller<br />
ausgestellten Fahrzeugschein auszugeben hat. Der Antragsteller hat die geforderten<br />
Angaben zum Fahrzeug unverzüglich vollständig und in dauerhafter Schrift in den<br />
Fahrzeugschein einzutragen. Der Antragsteller darf das Kurzzeitkennzeichen nur für<br />
die Durchführung von (Probe-, Prüfungs- und Überführungsfahrten) verwenden und<br />
keiner anderen Person zur Nutzung an einem anderen Fahrzeug überlassen.<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
Dauer NZV 2011,264 Anm. zu OLG München NZV 2011, 263 (= DAR 2011, 151; ZfS 2011, 171).<br />
BT-Drucks. 8/971.<br />
Dauer NZV 2011, 263 (265) Anm. zu OLG München NZV 2011, 263 (= DAR 2011, 151; ZfS 2011, 171).<br />
1. Verordnung zur Änderung der FZV (…) vom 19.10.2012 (BGBl. I S. 2232).<br />
- 52 -
Saisonkennzeichen<br />
7 Saisonkennzeichen § 9 III FZV<br />
<br />
<br />
Auf Antrag<br />
wird ein Saisonkennzeichen zugeteilt<br />
für einen nach vollen Monaten bemessenen Zeitraum<br />
Betriebszeitraum muss mindestens zwei Monate und darf höchstens elf Monate<br />
umfassen<br />
Der Betriebszeitraum ist in der Zulassungsbescheinigung Teil I in Klammern hinter<br />
dem Kennzeichen<br />
in Betrieb setzen oder abstellen auf öffentlichen Straßen nur während des angegebenen<br />
Zeitraums<br />
Saisonkennzeichen gelten außerhalb des Betriebszeitraums bei Fahrten zur Abmeldung<br />
und bei Rückfahrten nach Abstempelung des Kennzeichens als ungestempelte<br />
Kennzeichen im Sinne des § 10 IV FZV<br />
Tatbestand BKat TBNR €uro<br />
Sie setzten das Fahrzeug mit Saisonkennzeichen<br />
außerhalb des auf dem Kennzeichen angegebenen<br />
Betriebszeitraums in Betrieb<br />
(§ 9 III; § 48 FZV; § 24 StVG)<br />
Sie stellten das Fahrzeug mit Saisonkennzeichen<br />
außerhalb des auf dem Kennzeichen angegebenen<br />
Betriebszeitraums auf einer öffentlichen Straße<br />
ab.<br />
(§ 9 III, § 48 FZV; § 24 StVG)<br />
175 809600 50,-<br />
177 809606 50,-<br />
- 53 -
Oldtimer Kennzeichen<br />
8 Oldtimer-Kennzeichen<br />
8.1 Definition<br />
Definition<br />
Fahrzeuge, die vor mindestens 30 Jahren erstmals in Verkehr gekommen<br />
sind, weitestgehend dem Originalzustand entsprechen, in einem<br />
guten Erhaltungszustand sind und zur Pflege des kraftfahrzeugtechnischen<br />
Kulturgutes dienen (Legaldefinition § 2 Nr. 22 FZV)<br />
8.2 Besondere Kennzeichen<br />
§ 9 I FZV Auf Antrag wird für ein Fahrzeug, für das ein Gutachten nach § 23<br />
StVZO vorliegt, ein Oldtimerkennzeichen zugeteilt. Dieses Kennzeichen<br />
besteht aus einem Unterscheidungszeichen und einer Erkennungsnummer<br />
nach § 8 I FZV. Es wird als Oldtimerkennzeichen durch den<br />
Kennbuchstaben "H" hinter der Erkennungsnummer ausgewiesen.<br />
günstige Pauschal-Steuer: 191,- €/Jahr (Pkw), 46,- €/Jahr (Krad)<br />
keine Einschränkungen der Verwendung wie beim roten Oldtimer<br />
Begutachtung nach § 23 StVZO<br />
durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen, Prüfer oder Prüfungsingenieur<br />
Begutachtung ist nach einer Richtlinie (Verkehrsblatt der obersten Landesbehörde)<br />
durchzuführen<br />
Gutachten muss nach einem in der Richtlinie festgelegten Muster angefertigt<br />
werden<br />
es ist eine Untersuchung im Rahmen einer Hauptuntersuchung nach § 29<br />
StVZO durchzuführen<br />
es sei denn, dass mit der Begutachtung gleichzeitig ein Gutachten nach § 21<br />
StVZO erstellt wird<br />
§ 21 StVZO Betriebserlaubnis für Einzelfahrzeuge<br />
wenn für das Fahrzeug keine Betriebserlaubnis vorliegt, so muss diese bei der<br />
Zulassungsbehörde beantragt werden<br />
- 54 -
Oldtimer Kennzeichen<br />
zu dem Antrag auf Erteilung der Betriebserlaubnis muss ein Gutachten von einem<br />
amtlich anerkannten Prüfer, der Zulassungsbehörde vorgelegt werden<br />
in dem Gutachten wird bescheinigt, dass das Fahrzeug richtig beschrieben<br />
und vorschriftsmäßig ist<br />
8.3 Fahrten zur Teilnahme an Veranstaltungen für Oldtimer<br />
§ 17 I FZV<br />
Oldtimer<br />
die an Veranstaltungen teilnehmen,<br />
die der Darstellung von Oldtimer-Fahrzeugen und der Pflege des<br />
kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes dienen,<br />
benötigen hierfür sowie für Anfahrten zu und Abfahrten von solchen<br />
Veranstaltungen keine Betriebserlaubnis und keine Zulassung,<br />
wenn sie ein rotes Oldtimerkennzeichen führen.<br />
auch für Probefahrten und Überführungsfahrten<br />
sowie für Fahrten zum Zwecke der Reparatur oder Wartung § 31<br />
II StVZO bleibt unberührt.<br />
§ 17 II FZV Für die Zuteilung und Verwendung der roten Oldtimerkennzeichen findet<br />
§ 16 III bis V FZV entsprechend mit der Maßgabe Anwendung, dass das<br />
Kennzeichen nur an den Fahrzeugen verwendet werden darf, für die es<br />
ausgegeben worden ist.<br />
Die Vorschriften über die Führung des Fahrzeugscheinheftes gelten<br />
entsprechend.<br />
- 55 -
Ausfuhrkennzeichen<br />
9 Ausfuhrkennzeichen<br />
Fahrten zur dauerhaften Verbringung eines Fahrzeugs in das Ausland<br />
§ 19 I FZV Soll ein<br />
zulassungspflichtiges nicht zugelassenes Kraftfahrzeug oder<br />
ein zulassungsfreies und kennzeichenpflichtiges Kraftfahrzeug, dem<br />
kein Kennzeichen zugeteilt ist,<br />
mit eigener Triebkraft oder<br />
ein Anhänger hinter einem Kraftfahrzeug<br />
dauerhaft in einen anderen Staat verbracht werden,<br />
ist anzuwenden:<br />
1. Haftpflichtversicherung<br />
2. Der nächste Termin zur Durchführung der Untersuchung nach §<br />
29 StVZO nach dem Ablauf der Zulassung gemäß Nummer 2<br />
liegt; ansonsten ist eine solche Untersuchung durchzuführen.<br />
3. Die Zulassung ist längstens auf ein Jahr zu befristen.<br />
4. An die Stelle des Kennzeichens tritt das Ausfuhrkennzeichen. Es<br />
besteht aus dem Unterscheidungszeichen, einer Erkennungsnummer<br />
und dem Ablaufdatum. Die Erkennungsnummer besteht<br />
aus einer ein- bis vierstelligen Zahl und einem nachfolgenden<br />
Buchstaben.<br />
5. Die Zulassungsbescheinigung Teil I ist auf die Ausfuhr des Fahrzeugs<br />
zu beschränken und mit dem Datum des Ablaufs der Gültigkeitsdauer<br />
der Zulassung zu versehen.<br />
6. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der Zulassung darf das Fahrzeug<br />
auf öffentlichen Straßen nicht mehr in Betrieb gesetzt werden.<br />
- 56 -
Ausfuhrkennzeichen<br />
19 III FZV Der Führer eines Kraftfahrzeugs hat die Zulassungsbescheinigung Teil I<br />
nach § 19 I Nr. 4 FZV mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen<br />
zur Prüfung auszuhändigen.<br />
§ 3 Nr. 12 KraftStG<br />
Die bis 2010 geltende Steuerbefreiung wurde aufgehoben. Die Kennzeichen unterliegen<br />
der Steuerpflicht.<br />
Rechtsfolgen<br />
Tatbestand BKat TBNR €uro<br />
Sie setzten das Fahrzeug in Betrieb, obwohl das<br />
Ausfuhrkennzeichen nicht den Vorschriften entsprach<br />
§ 19 I FZV; § 48 FZV; § 24 StVG<br />
Sie setzten das Fahrzeug in Betrieb, obwohl auf<br />
dem Ausuhrkennzeichen die Gültigkeitsdauer der<br />
Zulassung abgelaufen war<br />
§ 19 I FZV; § 48 FZV; § 24 StVG<br />
179 819100 10,-<br />
175 819600 50,-<br />
Der Halter darf nach Ablauf der Gültigkeitsdauer die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs<br />
nicht anordnen oder zulassen.<br />
- 57 -
Abschleppen<br />
10 Abschleppen/Schleppen<br />
10.1 Abschleppen<br />
Abschleppen ist das Verbringen eines betriebsunfähigen 1 oder zumindest in seiner<br />
Betriebssicherheit beeinträchtigten 2 Fahrzeugs zu einem möglichst nahe gelegenen<br />
Bestimmungsort. Dabei spielt es keine Rolle, ob das abgeschleppte Fahrzeug mit<br />
allen Achsen (Rädern) auf der Fahrbahn läuft oder nur mit einer, wie das der Fall<br />
sein kann, wenn das abzuschleppende Kfz mit einer Achse an einer Hebevorrichtung,<br />
besonderer Befestigungsvorrichtung, auf einer Schleppachse oder auf der Ladefläche<br />
angehangen bzw. aufgelegt wird. 3<br />
- Abschleppachsen sind Achsen, die dazu bestimmt sind, bei einem abzuschleppenden<br />
mehrachsigen Fahrzeug eine – i.d.R. noch am Fahrzeug befindliche<br />
– Achse in deren Funktion zu ersetzen. Abschleppachsen sind keine<br />
Anhänger. Die Vorschriften für Anhänger gelten daher nicht für Abschleppachsen.<br />
4<br />
Nach anderer Definition sind nach ihrer Bestimmung nur solche Achsen als<br />
Abschleppachsen zu verstehen, die unter den vorderen oder hinteren Teil eines<br />
Kfz geschoben werden, wenn die Vorder- oder Hinterachse des Fahrzeugs<br />
ausfällt und es mittels der Abschleppachse abgeschleppt werden soll. 5<br />
Hinweis:<br />
Das Mitführen eines Pkw hinter z.B. einem Wohnmobil mittels Abschlepp- oder<br />
Schleppachse ist nicht zulässig (siehe unter 10.7).<br />
- Eine Dolly-Achse (engl.: Rollwagen, auch: Untersetzachse, Rangierachse) ist<br />
ein kurzer ein- bis dreiachsiger Anhänger mit einer Sattelkupplung zur Aufnahme<br />
eines Sattelaufliegers an Kfz, die nicht über eine eigene Sattelkupplung<br />
verfügen.<br />
- Die Hubbrille ist eine am Heck eines Abschleppfahrzeuges angebrachte Vorrichtung,<br />
die hydraulisch aus- und eingefahren, gehoben und gesenkt werden<br />
kann, um einen Pkw oder einen Anhänger mit einer Achse mittels Seilwinde in<br />
die Brille zu ziehen und anschließend von der Fahrbahn zu heben.<br />
1 Hentschel/König/Dauer, Rn. 8 zu § 33 StVZO; Jagow, Rn. 12 zu § 18 StVZO-alt; Mindorf, Kap. 3.3.1, S.<br />
112; OLG Celle NZV 1994, 242 (= VRS 87, 156; ZfS 1994, 345; VD 1994, 114 Anm. Verfasser); OLG<br />
Frankfurt NStZ-RR 1997, 93; OLG Hamm VRS 57, 456 (= StVE Nr. 4 zu § 18 StVZO-alt); OLG Koblenz<br />
NStZ-RR 1997, 249.<br />
2 OLG Düsseldorf VRS 54, 369 (= VM 1977, 93); BayObLG DAR 1992, 362; BayObLGSt 1993, 198 (=<br />
NZV 1994, 163; JMBlBY 1994, 32; VRS 86, 374; VersR 1994, 447; ZfS 1994, 307).<br />
3 Meyer, Kap. S12c.<br />
4 Meyer, Kap. S12i.<br />
5 Braun/Konitzer, Rn. 7 zu § 2 FZV.<br />
- 58 -
Abschleppen<br />
10.2 Anschleppen<br />
liegt vor, wenn ein Kfz von einem anderen Kfz gezogen wird, um seinen Motor zum<br />
Anspringen zu bringen.<br />
In diesem Falle ist das anhängende Kfz rechtlich bereits als solches in Betrieb (es<br />
wird geführt!)<br />
Fahrzeug muss zugelassen sein, Fahrerlaubnis erforderlich.<br />
10.3 Betriebsunfähigkeit<br />
Ein Fahrzeug ist betriebsunfähig, wenn es wegen technischer Mängel mit eigener<br />
Motorkraft nicht bestimmungsgemäß verwendet oder nur mit wesentlich beeinträchtigter<br />
Betriebssicherheit gefahren werden kann. 6<br />
Betriebsunfähigkeit liegt nicht vor:<br />
- bei Treibstoffmangel oder Fehlen von Kühlwasser (strittig)<br />
- bei fabrikneuen, noch nicht betriebsfertig gemachten Fahrzeug<br />
- wenn das Fahrzeug vom Halter oder Fahrer absichtlich in einen betriebsunfähigen<br />
Zustand gebracht worden ist<br />
Aber: Wird das ziehende Fahrzeug einer Fahrzeugkombination betriebsunfähig, so<br />
gilt auch der Anhänger als betriebsunfähig - beide Fahrzeuge können gemeinsam<br />
abgeschleppt werden<br />
Ausgangspunkt des Abschleppens kann sowohl im öffentlichen Verkehrsraum wie<br />
auch in privatem Gelände (Garage, Hofplatz o. ä.) liegen<br />
Zweck kann sein:<br />
- Reparatur<br />
- Verschrottung<br />
- Entscheidungssuche<br />
Ziel des Abschleppens kann sein<br />
- die nächste geeignete Reparaturwerkstatt,<br />
- der nächste geeignete Verschrottungsbetrieb (wenn eine Instandsetzung nicht<br />
erfolgen soll),<br />
- der nächste Verladebahnhof,<br />
- der Unterstellraum oder Abstellplatz der zust. Polizeibehörde (im Falle der Sicherstellung<br />
oder Beschlagnahme des Fahrzeugs)<br />
- die Garage des Halters bzw. ein anderer privater Abstellplatz, es sei denn, die<br />
Strecke dorthin ist wesentlich größer, als die Entfernung zu der weitest gelegenen<br />
z.B. Reparaturwerkstatt<br />
- Ein abgeschlepptes Fahrzeug gilt rechtlich weder als Anhänger noch als Kfz<br />
- Allgemein soll die Strecke nicht länger als 45 km sein 7<br />
6 Meyer, S 12d; BayObLG NZV 1994, 163; BayObLG DAR 1992, 361 (362); BayObLG NZV 1994, 163.<br />
- 59 -
Abschleppen<br />
10.4 Fahrerlaubnis<br />
Führer des<br />
- ziehenden Fahrzeugs entsprechend der Klasse des Fahrzeugs<br />
- abgeschleppten Fahrzeugs braucht keine Fahrerlaubnis – er muss aber geeignet<br />
sein, i. d. R. also eine Fahrerlaubnis besitzen<br />
Aber laut BGH:<br />
Im Falle der Trunkenheit verstößt er als Fahrzeug-Führer (nicht Kfz-Führer) gegen §<br />
316 StGB (1,1 Promille Grenzwert)<br />
Das abgeschleppte Fahrzeug musste bislang nicht<br />
- zugelassen<br />
- versteuert<br />
- versichert<br />
sein. Eine Kennzeichnung war ebenfalls nicht vorgeschrieben<br />
§ 18 StVZO-alt (Zulassungspflicht)<br />
(1) Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit<br />
von mehr als 6 km/h und ihre Anhänger (hinter Kraftfahrzeugen mitgeführte<br />
Fahrzeuge<br />
mit Ausnahme von betriebsunfähigen Fahrzeugen, die abgeschleppt werden,<br />
und von Abschleppachsen) dürfen auf öffentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt<br />
werden, wenn sie durch Erteilung einer Betriebserlaubnis oder einer EG-<br />
Typgenehmigung und durch Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens für Kraftfahrzeuge<br />
oder Anhänger von der Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde)<br />
zum Verkehr zugelassen sind.<br />
Diese Formulierung ist in der FZV nicht mehr zu finden.<br />
Laut Auskunft BMV sind abgeschleppte Fahrzeuge und Abschleppachsen bewusst<br />
in der FZV nicht mehr aufgeführt.<br />
Daraus ergibt sich in der Konsequenz, dass zwar der Nothilfe-Gedanke immer noch<br />
Anwendung finden kann, allerdings dürfen nur noch zugelassene Fahrzeuge abgeschleppt<br />
werden.<br />
10.5 § 15 a StVO Abschleppen von Fahrzeugen<br />
(1) BAB bei der nächsten Ausfahrt verlassen<br />
(2) nicht in die BAB eingefahren<br />
(3) beide Fahrzeuge haben Warnblinklicht einzuschalten<br />
(4) Krafträder dürfen nicht abgeschleppt werden<br />
7 NZV 1994, 242 (= VRS 87, 156; ZfS 1994, 345; VD 1994, 114 Anm. Verfasser).<br />
- 60 -
Abschleppen<br />
10.6 § 33 StVZO Schleppen von Fahrzeugen<br />
„Schleppen“:<br />
Mitführen eines zum Betrieb als Kfz gebauten Fahrzeugs hinter einem Kfz sofern<br />
weder Anschleppen oder Abschleppen vorliegen<br />
(1) Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart zum Betrieb als Kfz bestimmt sind, dürfen<br />
nicht als Anhänger betrieben werden.<br />
Die Verwaltungsbehörde kann in Einzelfällen Ausnahmen genehmigen (z.B.<br />
dauerhafte Schleppgenehmigung für Lkw Abschleppdienste)<br />
(2) Dann gelten folgende Sondervorschriften:<br />
Es darf jeweils nur ein Fahrzeug mitgeführt werden<br />
Der Führer muss erforderliche Fahrerlaubnis besitzen (Ausnahme Lenkeinrichtung)<br />
(Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 69 a III Nr. 3 StVZO und<br />
kein Verstoß gegen § 21 StVG)<br />
Keine Zulassung<br />
Kein Zug im Sinne des § 32 StVZO<br />
Bezüglich der §§ 41, 53, 54, 55 und 56 gilt das geschleppte Fahrzeug als Kfz<br />
§ 43 ist nicht anzuwenden<br />
zGG mehr als 4 t: Abschleppstange<br />
lichttechnische Einrichtungen wie beim Kfz<br />
10.7 Die Nutzung von Schleppkupplungen in Deutschland<br />
In der letzten Zeit wurden in Deutschland Fälle bekannt, bei denen Kfz mit Schleppkupplungen<br />
hinter einem anderen Kfz gezogen wurden.<br />
Bei den hier bekannten Fällen handelte es sich überwiegend um in den Niederlanden<br />
zugelassene Kfz, die mittels einer Schleppkupplung als Fahrzeugkombination angetroffen<br />
wurden.<br />
Offensichtlich sind diese Schleppkupplungen in den Niederlanden zugelassen, da die<br />
niederländischen Führer dieser Fahrzeugkombinationen regelmäßig eine gültige<br />
COC-Bescheinigung vorweisen konnten.<br />
- 61 -
Abschleppen<br />
Die Kupplungen können in den Niederlanden käuflich erworben werden<br />
www.caratow.nl. Auch in Großbritannien und in den USA sollen derartig genutzte<br />
Schleppkupplungen zum Straßenbild gehören.<br />
Fraglich ist, ob die Nutzung von Schleppkupplungen in Deutschland zugelassen ist.<br />
Zulassungsrechtlich sind gem. § 2 Nr. 2 FZV Anhänger „zum Anhängen an ein Kfz<br />
bestimmte und geeignete Fahrzeuge“. Die Kfz, die mittels Schleppkupplung hinter<br />
einem anderen Kfz gezogen werden, sind regelmäßig auch als Kfz zugelassen und<br />
werden somit nicht durch den Betrieb mit einer Schleppkupplung i.S.d. Zulassungsrechts<br />
zum Anhänger.<br />
Gem. § 33 Abs. 1 Satz 1 StVZO dürfen Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart zum Betrieb<br />
als Kfz bestimmt sind, nicht als Anhänger betrieben werden. Ausnahmen von dieser<br />
Regelung können gem. § 33 II StVZO unter den dort genannten Voraussetzungen<br />
von den Straßenverkehrsbehörden erteilt werden. Eine Nachfrage bei der Straßenverkehrsbehörde<br />
Bonn ergab, dass für diese Fälle keine Ausnahmegenehmigungen<br />
gem. § 33 II StVZO erteilt werden.<br />
Demnach kann als Ergebnis festgehalten werden, dass hinter einem in Deutschland<br />
zugelassenen Kfz kein anderes Kfz geschleppt werden darf (TBNR 333100 – Verwarnungsgeld<br />
25 €).<br />
Fraglich ist allerdings, ob die Vorschrift des § 33 I StVZO auch auf Fahrzeugkombinationen<br />
mit Schleppkupplung anzuwenden ist, die im Ausland zugelassen sind.<br />
Die vorübergehende Teilnahme am Straßenverkehr ausländischer Fahrzeuge im Inland<br />
ist in § 20 FZV geregelt. Danach dürfen die im Ausland zugelassenen Fahrzeuge<br />
grundsätzlich am Straßenverkehr teilnehmen, wenn sie nur vorübergehend in<br />
Deutschland betrieben werden.<br />
In § 31 d StVZO sind hinsichtlich der Bau- und Ausrüstungsvorschriften Regelungen<br />
genannt, die auch für ausländische Fahrzeuge gelten. Der § 33 StVZO ist dort nicht<br />
aufgeführt. Grundsätzlich gelten die anderen Regelungen der StVZO somit nicht für<br />
im Ausland zugelassene Fahrzeuge. Mit Schreiben vom 09.07.1985, Az. StV<br />
12/36.42.15a/9 M 85 II, hat das BMV allerdings klargestellt, dass es sich beim<br />
Schleppen von Fahrzeugen um einen unter Erlaubnisvorbehalt stehenden Verkehrsvorgang<br />
handelt. Da der § 31d StVZO ausländische Fahrzeuge mit Ausnahme der §§<br />
32, 34 StVZO nur von weiteren Bau- und Ausrüstungsvorschriften befreit, ist § 33<br />
StVZO auf diese Fahrzeuge anzuwenden.<br />
Demnach ist auch das Führen von ausländischen Fahrzeugkombinationen mittels<br />
Schleppkupplung unzulässig.<br />
- 62 -
fahrerlaubnisfrei<br />
Klasse des<br />
ziehenden<br />
Kfz<br />
Fahrerlaubnis<br />
Versicherung<br />
§ 10a III<br />
AKB<br />
1,1 Pomille<br />
versicherungsfrei<br />
in FZV nicht<br />
erwähnt<br />
Betriebsunfähigkeit<br />
Nothilfegedanke<br />
Zulassung<br />
Definition<br />
Entfernung<br />
zulassungspflichtige<br />
Fahrzeuge<br />
Anschleppen<br />
Rechtsfolgen<br />
Autobahnverbot<br />
Unerlaubtes<br />
Schleppen<br />
Schleppen<br />
StVO<br />
Krafträder<br />
Beleuchtung<br />
Geschwindigkeit<br />
Kenntlichmachung<br />
steuerfrei<br />
Schleppen<br />
Fahrzeuglänge<br />
StVZO<br />
Steuer<br />
widerrechtliche<br />
Benutzung<br />
Anhängelast<br />
<strong>Bernd</strong> <strong>Huppertz</strong>
Versicherungskennzeichen<br />
11 Versicherungskennzeichen<br />
11.1 Das Versicherungskennzeichen<br />
4 III Satz 1<br />
i.V.m.<br />
§ 3 II Nr. 1<br />
d-f<br />
FZV<br />
§ 27 I<br />
Anlage 12<br />
FZV<br />
§§ 26, 27<br />
FZV<br />
Die Vorschrift regelt die Ausgabe von Versicherungskennzeichen an<br />
Halter, deren Fahrzeuge nach näherer Maßgabe des § 3 II FZV i.V.m. §<br />
4 III FZV von der Zulassungspflicht befreit und nach § 1 PflVG der Kfz-<br />
Haftpflichtversicherung unterworfen sind.<br />
Bei den Versicherungskennzeichen handelt es sich um solche entsprechend<br />
§ 27 I FZV Anlage 12. Das Versicherungskennzeichen enthält<br />
eine Erkennungsnummer bestehend aus drei Ziffern und das Zeichen<br />
des zuständigen Verbandes des Kraftfahrversicherers bestehend aus 3<br />
Buchstaben.<br />
Die Ausgestaltung der Versicherungskennzeichen regelt sich nach §§<br />
26, 27 FZV Anlage 12.<br />
Die Gültigkeit der Versicherungskennzeichen ist zeitlich auf das Verkehrsjahr<br />
(01.03. – Ende Februar des Folgejahres) begrenzt. Die Beschriftung<br />
des Versicherungskennzeichens ist je nach Verkehrsjahr farblich<br />
unterschiedlich. Die Farben wiederholen sich in den folgenden Verkehrsjahren:<br />
2010: grün 2013: grün<br />
2011: schwarz 2014: schwarz<br />
2012: blau 2015: blau<br />
11.2 Versicherungskennzeichenpflichtige Fahrzeuge<br />
§ 3 II Nr. 1 d-f<br />
FZV<br />
Liste der Fahrzeuge:<br />
- Zwei- oder dreirädrige Kleinkrafträder (einschl. Mofa, FmH,<br />
Leichtmofa)<br />
- Motorisierte Krankenfahrstühle<br />
- Vierrädrige LeichtKfz (u.a. Quads)<br />
- Elektronische Mobilitätshilfen (Segway)<br />
- 64 -
Versicherungskennzeichen<br />
11.3 Versicherungsbestätigung<br />
§ 26 I FZV Der Fahrzeugführer hat die Bestätigung über das Versicherungskennzeichen<br />
mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung<br />
auszuhändigen.<br />
11.4 Rechtsfolgen<br />
Zulassungsrechtliche Auswirkungen hat nur der Tatbestand der Inbetriebnahme eines<br />
Fahrzeugs ohne vorherige Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens und ohne<br />
Auftragen der Stempelplakette.<br />
Kfz, die nach § 4 III Satz 1 FZV i.V.m. § 27 VII FZV ein Versicherungskennzeichen<br />
führen müssen, dürfen auf öffentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt werden, wenn<br />
das Versicherungskennzeichen entsprechend § 27 I bis III FZV ausgestaltet und angebracht<br />
ist. Eine Zuwiderhandlung stellt eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 27 VII<br />
i.V.m. § 48 Nr. 1 lit. c) FZV dar.<br />
- 65 -
Versicherungskennzeichen<br />
Tatbestand BKat TBNR €uro<br />
Sie nahmen das Fahrzeug in Betrieb, dessen Versicherungskennzeichen<br />
nicht den Vorschriften<br />
entsprach<br />
184 827100 10,-<br />
Wird das Kleinkraftrad [einschließlich (Leicht-)Mofa und FmH], der motorisierte Krankenfahrstuhl,<br />
das vierrädrige Leichtkraftfahrzeug oder die elektronische Mobilitätshilfe<br />
im März, also nach Ablauf des alten Versicherungsjahres und –vertrages weiter im<br />
öffentlichen Straßenverkehr in Betrieb gesetzt, ohne das zur Tatzeit ein neuer Vertrag<br />
für das laufende Versicherungsjahr abgeschlossen worden ist, liegt ein Vergehen<br />
nach § 6 PflVG vor. 1<br />
Das Versicherungskennzeichen ist kein amtliches Kennzeichen, auch nicht i.S.d. §<br />
22 StVG. Kennzeichenmissbrauch ist daher nicht einschlägig. 2<br />
Durch Hochbiegen des Kennzeichenschildes kommt eine Urkundenfälschung (§ 267<br />
StGB) nicht in Betracht 3 , wohl aber die Urkundenunterdrückung nach § 274 StGB.<br />
Allerdings soll nach h.M. das Tatbestandmerkmal der beabsichtigten Nachteilszufügung<br />
gegenüber einem anderen dann nicht verwirklicht werden, wenn es dem Täter,<br />
z.B. bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung, nur darum geht mit dem Hochbiegen<br />
des Kennzeichenschildes den staatlichen Strafanspruch zu vereiteln oder zu erschweren.<br />
4 So bleibt es letztlich bei einer OWi i.S.d. § § 27 VII i.V.m. § 48 Nr. 1 lit. c)<br />
FZV.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Heinzlmeier NZV 2006, 225 (230).<br />
Grohmann VD 2004, 211.<br />
Grohmann VD 2004, 211.<br />
Bay0bLG NZV 1989 S. 81, OLG Düsseldorf NZV 1989 S. 477.<br />
- 66 -
Versicherung<br />
12 Versicherungspflicht<br />
Versicherungspflicht für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger<br />
1. Gemäß § 7 I StVG ist der Halter verpflichtet, einen durch den Betrieb eines Kfz<br />
entstandenen Schaden zu ersetzen.<br />
2. Gemäß § 1 Pflichtversicherungs-Gesetz (PflVG) muss der Halter eines Kraftfahrzeugs<br />
oder eines Anhängers mit regelmäßigem Standort im Inland für sich,<br />
den Eigentümer und den Fahrer eine Haftpflichtversicherung zur Deckung der<br />
durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursachten Personen-, Sach- und sonstigen<br />
Vermögensschadens abschließen und aufrechterhalten, wenn das Fahrzeug<br />
auf öffentlichen Wegen und Plätzen verwendet wird.<br />
3. Die Versicherungsbedingungen sind in „Allgemeine Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung“<br />
(AKB 2008) festgelegt. Diese haben den Charakter eines privatrechtlichen<br />
Vertragsrechts, das von den Versicherungsparteien ausdrücklich<br />
oder stillschweigend zum Vertragsinhalt gemacht wird. Aus diesen Bestimmungen<br />
ergeben sich aber z. B. die Pflichten eines Versicherungsnehmers nach einem<br />
Verkehrsunfall.<br />
4. Begrifflich entspricht ein Kfz i. S. d. PflVG der Definition aus § 1 II StVG; der<br />
Umfang der Haftpflichtversicherung ergibt sich aus der AKB.<br />
5. Danach (AKB, Nr. A.1.1.5) erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf mit<br />
dem versicherten Kfz verbundene Anhänger und Auflieger. Der Versicherungsschutz<br />
umfasst auch Fahrzeuge,<br />
- die mit dem versicherten Kraftfahrzeug abgeschleppt oder geschleppt werden,<br />
wenn<br />
- für diese kein eigener Haftpflichtversicherungsschutz besteht.<br />
Dies gilt auch, wenn sich der Anhänger oder Auflieger oder das abgeschleppte<br />
oder geschleppte Fahrzeug während des Gebrauchs von dem versicherten Kraftfahrzeug<br />
löst und sich noch in Bewegung befindet (wichtig für die Beurteilung zulassungsfreier<br />
Anhänger, die nur deshalb zulassungspflichtig werden, da sie mit<br />
einer Geschwindigkeit von mehr als 25 km/h gezogen werden – Kein Verstoß gegen<br />
das PflVG!).<br />
- 67 -
Versicherung<br />
6. Aus § 2 PflVG ergeben sich die Ausnahmen der Versicherungspflicht, z. B.<br />
Fahrzeuge der Polizei<br />
Kfz bis 6 km/h BbH<br />
SAM, Stapler deren BbH 20 km/h nicht übersteigt<br />
Zulassungsfreie Anhänger.<br />
In diesen Fällen haftet der Halter des Fahrzeugs wie ein Kfz-Haftpflichtversicherer<br />
(§ 2 II PflVG).<br />
Diese Kfz erhalten z. B. folgende amtliche (Behörden-) Kennzeichen:<br />
(= THW) (=THW – altes Kennzeichen)<br />
7. § 6 PflVG enthält die Strafvorschrift bei fehlendem Versicherungsschutz. Demnach<br />
begeht ein Vergehen, der ein versicherungspflichtiges Fahrzeug auf öffentlichen<br />
Wegen oder Plätzen gebraucht oder den Gebrauch gestattet, obwohl<br />
für das Fahrzeug der erforderliche Haftpflichtversicherungsvertrag nicht oder<br />
nicht mehr besteht (fahrlässige Begehungsweise reicht aus).<br />
8. Bei der Beurteilung von verkehrsrechtlichen Sachverhalten muss berücksichtigt<br />
werden, dass, wenn ein Fahrzeug nur vorübergehend aus dem Verkehr gezogen<br />
wird, der gültige Versicherungsvertrag dadurch nicht berührt wird.<br />
Im Einzelfall ist also zu prüfen, ob der Vertrag von einem Partner gekündigt wurde.<br />
Somit ist bei einem Kfz mit Saisonkennzeichen, das außerhalb des auf dem<br />
Kennzeichen angegebenen Zeitraumes geführt wird, kein Verstoß gegen das<br />
PflVG möglich, da der Versicherungsvertrag besteht. In diesen Fällen ruht die<br />
Versicherung; der Versicherer ist allerdings von Leistungen im Schadensfalle frei<br />
(Einzelfallprüfung – Obliegenheitspflichtverletzung des Versicherungsnehmers).<br />
9. Wird der Versicherungsvertrag gekündigt oder endet er durch Zeitablauf, besteht<br />
gemäß § 117 VVG eine Nachversicherung für den folgenden Monat; tritt in dieser<br />
Monatsfrist ein Schaden ein, haftet die Versicherung gegenüber Dritten,<br />
kann aber einen Rückgriff auf den Halter des Fahrzeugs vornehmen.<br />
- 68 -
Versicherung<br />
10. Durch die Veränderung an einem Fahrzeug (z. B. KKR wird durch Veränderungen<br />
erheblich schneller) wird der Versicherungsvertrag nicht hinfällig oder gegenstandslos;<br />
es tritt lediglich eine Gefahrenerhöhung ein, die den Versicherer<br />
berechtigt, den Vertrag zu kündigen.<br />
11. Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz (Rechtsfolge; §§ 1,6 PflVG) liegen<br />
somit in aller Regel nur dann vor, wenn ein gültiger Versicherungsvertrag<br />
nicht oder nicht mehr existiert und keine Ausnahme nach § 2 PflVG vorliegt!<br />
Beispiel:<br />
o nicht angemeldetes Kfz oder Anhänger wird im öffentlichen Verkehrsraum<br />
geführt.<br />
o Zulassungsfreies und versicherungsfreies Fahrzeug wird widerrechtlich<br />
benutzt und dadurch zulassungspflichtig im Sinne des § 3 I FZV.<br />
o Das Versicherungsjahr ist abgelaufen (Beispiel: Mofa wird mit dem „falschen“<br />
Versicherungskennzeichen gefahren).<br />
o Kurzzeitkennzeichen werden über das Ablaufdatum hinaus verwendet.<br />
Hier ist jedoch zu prüfen, ob der Versicherungsvertrag das gleiche Ablaufdatum<br />
hat.<br />
12. Zulassungsfreie Anhänger<br />
Nach § 3 II Nr. 2 FZV zulassungsfreie Anhänger unterliegen gemäß § 2 I Nr.<br />
6c PflVG nicht der Versicherungspflicht. Sie werden von der Versicherung des<br />
ziehenden Kfz mit umfasst. Da sich in diesen Fällen die Haftpflichtversicherung<br />
des ziehenden Kfz auch auf den angekoppelten Anhänger erstreckt und<br />
daher ein Haftungsrückgriff möglich ist, ist eine eigene Versicherung des Anhängers<br />
nicht erforderlich.<br />
Versicherungsfreie Anhänger werden jedoch versicherungspflichtig, wenn sie<br />
nicht mehr die Voraussetzungen für die Versicherungsfreiheit erfüllen. 1<br />
Eine Strafbarkeit soll entgegen 6 PflVG aber nicht gegeben sein, wenn die<br />
Versicherung des Zugfahrzeugs gemäß § 3 VVG, § 3 I KfzPflVV für etwaige<br />
durch den Anhänger verursachte Schäden aufkommt (die Fahrzeugkombination<br />
muss im Vertrag erfasst sein). 2<br />
Gemäß § 7 I StVG ist der Halter des Fahrzeugs verpflichtet, dem Verletzten<br />
den aus einem Verkehrsunfall entstandenen Schaden zu ersetzen. In der bis<br />
zum 31.07.2002 geltenden Fassung bezog sich die genannte Vorschrift lediglich<br />
auf Schäden, die durch den Betrieb eines Kfz entstanden sind. In der Neufassung<br />
3 werden auch Schäden, die durch den Betrieb eines Anhängers entstehen,<br />
ausdrücklich erwähnt. In der amtlichen Begründung 4 wird darauf abgestellt,<br />
dass „mit der Verwendung von Anhängern häufig eine Erhöhung der<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Heinzlmeier NZV 2006, 225; Ternig, Fehlendes 25km-Schild, demnächst in NZV.<br />
Heinzlmeier NZV 2006, 225; Hentschel/König/Dauer, Rn. 16 Vor § 23 FZV.<br />
Vom 19.07.2002 (BGBl. I, 2674).<br />
BT-Drucks. 14/7752, S. 29.<br />
- 69 -
Versicherung<br />
von dem Kfz ausgehenden Betriebsgefahr verbunden ist“. Das kann z.B. bei<br />
Überschreitung der geforderten Betriebsgeschwindigkeit durchaus unterstellt<br />
werden.<br />
Für die Annahme 5 , bei fehlendem eigenem Versicherungsvertrag bezüglich<br />
des Anhängers läge auch eine Straftat i.S.d. § 6 PflVG vor, finden sich jedoch<br />
in Literatur und Rechtsprechung keine Anhaltspunkte: weder ist § 6 PflVG<br />
noch § 3 I KfzPflVV geändert worden. 6 Auch die später novellierte AKB-2008<br />
weist immer noch darauf hin, dass Anhänger über das Zugfahrzeug versichert<br />
sind.<br />
5<br />
6<br />
Ternig, Fehlendes 25km-Schild, demnächst in NZV.<br />
Feyock/Jacobsen/Lemor, Rn. 1 zu § 6 PflVG.<br />
- 70 -
Haftung<br />
13 Verschuldens- und Gefährdungshaftung<br />
Verschuldenshaftung<br />
§ 823 I BGB Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit,<br />
die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich<br />
verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden<br />
Schadens verpflichtet.<br />
Grundsatz des Schuldrechts, wonach der Schuldner für einen Schaden nur haftet,<br />
wenn er diesen durch ein vorwerfbares Verhalten verursacht oder mit verursacht hat.<br />
Ein Verschulden liegt vor, wenn der Schädiger das Schaden begründende Ereignis<br />
vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt hat und das Verhalten rechtswidrig war.<br />
In solchen Fällen ist allerdings der Geschädigte beweispflichtig.<br />
Von dem Grundsatz der Verschuldenshaftung werden zahlreiche Ausnahmen gemacht.<br />
Gefährdungshaftung<br />
Ein besonderer Fall der schuldunabhängigen Haftung ist die Gefährdungshaftung.<br />
§ 7 I StVG Wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs oder eines Anhängers, der<br />
dazu bestimmt ist, von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden, ein<br />
Mensch getötet, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt<br />
oder eine Sache beschädigt, so ist der Halter verpflichtet, dem Verletzten<br />
den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.<br />
§ 7 II StVG Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn der Unfall durch höhere Gewalt<br />
verursacht wird.<br />
Viele Unfälle sind nicht auf das Verschulden einer Person zurückzuführen. Dennoch<br />
haben Verletzte und Geschädigte in vielen Fällen Anspruch auf Entschädigung in<br />
Form eines Schmerzensgeldes. Der Grund: die so genannte Gefährdungshaftung.<br />
Der Gefährdungshaftung liegt die Annahme zugrunde, dass von bestimmten Maschinen,<br />
beispielsweise einem Auto, grundsätzlich schon bei normalem Betrieb gewisse<br />
Gefahren ausgehen. So kann es passieren, dass ein Auto- oder auch Motorradfahrer<br />
- auch wenn er die Regeln der Straßenverkehrsordnung einhält, vorsichtig und den<br />
Verkehrsverhältnissen angemessen fährt - bei einem Unfall trotzdem für den Schaden<br />
aufkommen muss. Beispiel: Es kommt zum Unfall, weil die Bremsen des Autos<br />
versagen oder ein Reifen platzt.<br />
Es gibt aber auch Fälle, bei denen der Fahrzeughalter von der Gefährdungshaftung<br />
befreit ist: wenn der Unfall durch ein unabwendbares Ereignis oder durch höhere<br />
Gewalt ausgelöst wird.<br />
- 71 -
Haftung<br />
Seit dem 1. August 2002 gilt das neue Schadenersatzrecht und bringt Klarheit in<br />
einigen bisher unbefriedigend geregelten Fällen, es erhöht die Haftungsgrenzen für<br />
bestimmte Schäden.<br />
Die Einzelheiten:<br />
Kinder haften seit dem 1. August nur dann für von ihnen verursachte Schäden, wenn<br />
sie das zehnte Lebensjahr vollendet haben. Bisher lag diese Grenze bei sieben Jahren.<br />
Und auch ältere Kinder haften nicht automatisch: Die Gerichte haben in jedem<br />
Einzelfall die Aufgabe zu prüfen, ob ein Kind von seinem Entwicklungsstand her reif<br />
genug war, sein Verhalten und dessen Folgen einzuschätzen. Fährt z.B. ein neunjähriges<br />
Kind mit dem Fahrrad aus einer Hofeinfahrt ohne Beachtung des fließenden<br />
Verkehrs auf die Fahrbahn und kommt es zu einem Unfall mit einem Auto, so muss<br />
die Haftpflichtversicherung des Kraftfahrzeuges haften.<br />
Mutwillige Beschädigungen von Autos:<br />
Diese Besserstellung von Kindern gilt aber nicht, wenn Kinder vorsätzlich Schäden<br />
verursachen, z.B. ein Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand zerkratzen. Hier haften<br />
Kinder nach wie vor ab der Vollendung des siebenten Lebensjahres an für Schäden,<br />
die Sie verursachen.<br />
§ 828 I BGB Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden,<br />
den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich.<br />
§ 828 II BGB Wer das siebente, aber nicht das zehnte Lebensjahr vollendet hat, ist für<br />
den Schaden, den er bei einem Unfall mit einem Kraftfahrzeug, einer<br />
Schienenbahn oder einer Schwebebahn einem anderen zufügt, nicht<br />
verantwortlich. Dies gilt nicht, wenn er die Verletzung vorsätzlich herbeigeführt<br />
hat<br />
Unfallopfer erhalten künftig grundsätzlich auch aus der so genannten Gefährdungshaftung<br />
(Unfall ohne feststellbares Verschulden) heraus neben Schadenersatz auch<br />
Schmerzensgeld. Einem Unfallverursacher muss deshalb kein schuldhaftes Verhalten<br />
nachgewiesen werden. Auch Mitfahrer im Pkw oder auf dem Motorrad, die bisher<br />
nach Unfällen häufig leer ausgingen, bekommen künftig also Geld.<br />
Bei sog. fiktiven Abrechnungen von Unfallschäden am Auto (Regulierung auf Gutachtenbasis)<br />
zahlen die Versicherer künftig nur noch dann die im Gutachten genannte<br />
Mehrwertsteuer, wenn das Fahrzeug tatsächlich in einer Werkstatt repariert wird.<br />
„Selbermacher“ können die im Preis von Ersatzteilen enthaltene Mehrwertsteuer weiterhin<br />
geltend machen. Sie müssen dafür allerdings die Quittungen vorlegen.<br />
Nach neuem Schadenersatzrecht haften Sachverständige auch dann für vorsätzlich<br />
oder grob fahrlässig falsche Gutachten, wenn sie nicht vereidigt worden sind. Bisher<br />
war eine Haftung des unvereidigten Sachverständigen für falsche Gutachten nur<br />
schwer durchsetzbar.<br />
Bei Schäden, die durch Anhänger entstehen, haftet künftig auch der Halter des Anhängers<br />
– und nicht mehr der Fahrer beziehungsweise Halter des Zugfahrzeuges<br />
- 72 -
Haftung<br />
allein (beziehungsweise dessen Versicherung). Damit können sich Speditionen künftig<br />
nicht mehr damit herausreden, sie wüssten nicht, welches Fahrzeug mit einem<br />
fraglichen Anhänger zu einem bestimmten Zeitpunkt unterwegs war.<br />
Aufsichtspflicht der Eltern<br />
Die Anhebung des Haftungsalters hat aber keine direkten Auswirkungen auf die elterliche<br />
Aufsichtspflicht. Nach wie vor hängt die Stärke der elterlichen Aufsichtspflicht<br />
vom Kindesalter, der kindlichen Entwicklung und den örtlichen Gegebenheiten ab.<br />
Wenn z. B. ein Vorschulkind alleine am innerstädtischen Großstadtverkehr teilnimmt<br />
und einen Unfall verursacht, kann durchaus eine Verletzung der Aufsichtspflicht vorliegen.<br />
Anders wäre es zu beurteilen, wenn ein Grundschulkind alleine in einem<br />
Wohnviertel unterwegs ist und ein Unfall geschieht. Hier kann dann nicht erwartet<br />
werden, dass regelmäßig eine Verletzung der Aufsichtspflicht vorliegt.<br />
Gleiches gilt bei mutwilligen Beschädigungen durch Kinder. Auch hier kommt es auf<br />
die kindliche Entwicklung und insbesondere darauf an, ob das Kind bereits einmal<br />
Schäden verursacht hat und die Eltern so mit möglichen neuen vom Kind verursachten<br />
Schäden rechnen mussten.<br />
- 73 -
Steuer<br />
14 Kraftfahrzeugsteuerpflicht<br />
Steuerpflicht für Kraftfahrzeuge und Anhänger<br />
Im Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG) ist geregelt, was der Steuerpflicht i. S. d.<br />
Gesetzes unterliegt:<br />
§ 1 I Nr. 1<br />
KraftStG<br />
§ 2 I<br />
KraftStG<br />
§ 2 II<br />
KraftStG<br />
§ 2 III<br />
KraftStG<br />
§ 7 Nr.1<br />
KraftStG<br />
Der Kraftfahrzeugsteuer unterliegt<br />
1. das Halten von inländischen Fahrzeugen zum Verkehr auf öffentlichen<br />
Straßen<br />
Unter den Begriff Fahrzeuge i.S.d. Gesetzes fallen Kfz und Kraftfahrzeuganhänger.<br />
Die in diesem Gesetz verwendeten Begriffe des Verkehrsrechts richten<br />
sich nach den jeweils geltenden verkehrsrechtlichen Vorschriften.<br />
Ein Fahrzeug ist ein inländisches Fahrzeug, wenn es unter die im Inland<br />
maßgebenden Vorschriften über das Zulassungsverfahren fällt.<br />
Steuerschuldner ist bei einem inländischen Fahrzeug die Person, für die<br />
das Fahrzeug zum Verkehr zugelassen ist.<br />
Die Steuerpflicht beginnt für das Halten inländischer Fahrzeuge mit der Zulassung<br />
des Fahrzeugs zum Verkehr (vgl. § 5 I Nr.1 KraftStG). Der Begriff „Halten von...“ ist<br />
allerdings nicht mit dem Begriff des „Halters“ aus dem StVG identisch; „Halten“ im<br />
steuerrechtlichen Sinne bedeutet die Möglichkeit der Benutzung im öffentlichen Verkehrsraum;<br />
ob davon Gebrauch gemacht wird, ist unerheblich. Steuerschuldner ist<br />
dabei der Inhaber der amtlichen Zulassung. Dieser Begriff ist zumeist gleichzusetzen<br />
mit dem des Halters.<br />
Ausländische Fahrzeuge<br />
§ 1 Nr. 2<br />
KraftStG<br />
§ 2 IV<br />
KraftStG<br />
§ 7 Nr. 2<br />
KraftStG<br />
Der Kraftfahrzeugsteuer unterliegt<br />
2. das Halten von ausländischen Fahrzeugen zum Verkehr auf öffentlichen<br />
Straßen, solange die Fahrzeuge sich im Inland befinden.<br />
Ein Fahrzeug ist ein ausländisches Fahrzeug, wenn es im Zulassungsverfahren<br />
eines anderen Staates zugelassen ist.<br />
Steuerschuldner ist bei einem ausländischen Fahrzeug die Person, die<br />
das Fahrzeug im Geltungsbereich dieses Gesetzes benutzt.<br />
- 74 -
Steuer<br />
Widerrechtliche Benutzung<br />
§ 1 I Nr. 3<br />
KraftStG<br />
§ 2 V<br />
KraftStG<br />
Der Kraftfahrzeugsteuer unterliegt<br />
3. die widerrechtliche Benutzung von Fahrzeugen.<br />
Eine widerrechtliche Benutzung i.S.d. Gesetzes liegt vor, wenn ein<br />
Fahrzeug auf öffentlichen Straßen im Inland ohne die verkehrsrechtlich<br />
vorgeschriebene Zulassung benutzt wird.<br />
Eine Besteuerung wegen widerrechtlicher Benutzung entfällt, wenn das<br />
Halten des Fahrzeugs von der Steuer befreit sein würde oder die Besteuerung<br />
bereits nach § 1 I Nr. 1 oder 2 vorgenommen worden ist.<br />
Eine widerrechtliche Benutzung liegt z.B. vor, wenn ein betriebsbereites und zugelassenes<br />
Kfz abgeschleppt wird. Somit entsteht Zulassungspflicht als Anhänger, aber<br />
kein Verstoß gegen KraftStG, da das Kfz bereits im „normalen“ Zulassungsverfahren<br />
versteuert wurde – Verbot der Doppelbesteuerung! Der Nachweis der Besteuerung<br />
bedeutet, die „von Steuerrechts wegen“ erfolgte Freigabe der Benutzung des Fahrzeugs<br />
für eine bestimmte Person und eine bestimmte Zeit (wichtig bei Saisonkennzeichen!).<br />
Oldtimer<br />
§ 1 I Nr. 4<br />
KraftStG<br />
Der Kraftfahrzeugsteuer unterliegt<br />
4. die Zuteilung von Oldtimer-Kennzeichen sowie die Zuteilung von<br />
roten Kennzeichen, die von einer Zulassungsbehörde im Inland<br />
zur wiederkehrenden Verwendung ausgegeben werden. Dies gilt<br />
nicht für die Zuteilung von roten Kennzeichen für Prüfungsfahrten.<br />
Steuerfreiheit<br />
§ 3<br />
KraftStG<br />
Von der Steuer befreit ist u.a. das Halten von<br />
1 Fahrzeugen, die von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren<br />
ausgenommen sind<br />
2 Fahrzeuge der Hoheitsträger (z.B.: Polizei, Bundeswehr, Zoll)<br />
3 Fahrzeuge mit einer bestimmten Zweckbestimmung (z.B.: Feuerwehr,<br />
Katstrophenschutz, lof-Fahrzeuge, Container-Auflieger)<br />
4 Fahrzeuge diplomatischer Vertretungen<br />
5 Fahrzeuge mit Ausfuhrkennzeichen<br />
- 75 -
Steuer<br />
Sind die bestimmten Befreiungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt, beginnt die Steuerpflicht.<br />
Grünes Kennzeichen<br />
§ 9 II FZV Bei Fahrzeugen, deren Halter von der Kraftfahrzeugsteuer befreit ist, ist<br />
ein grünes Kennzeichen zuzuteilen, ausgenommen hiervon sind:<br />
1 Fahrzeuge von Behörden<br />
2 Fahrzeuge diplomatischer Vertretungen<br />
3 KOM und Pkw mit acht Sitzen (…)<br />
4 Leichtkrafträder und Kleinkrafträder<br />
5 Fahrzeuge von schwerbehinderten Personen<br />
6 Besonders emissionsreduzierte Kfz (…)<br />
7 Fahrzeuge mit einem Ausfuhrkennzeichen<br />
- 76 -
Kennzeichenmissbrauch<br />
15 Kennzeichenmissbrauch<br />
Kennzeichenmissbrauch<br />
§ 22 I StVG Wer in rechtswidriger Absicht<br />
1. ein Kraftfahrzeug oder einen Kraftfahrzeuganhänger, für die ein<br />
amtliches Kennzeichen nicht ausgegeben oder zugelassen worden<br />
ist, mit einem Zeichen versieht, das geeignet ist, den Anschein<br />
amtlicher Kennzeichnung hervorzurufen,<br />
2. ein Kraftfahrzeug oder einen Kraftfahrzeuganhänger mit einer<br />
anderen als der amtlich für das Fahrzeug ausgegebenen oder<br />
zugelassenen Kennzeichnung versieht,<br />
3. das an einem Kraftfahrzeug oder einem Kraftfahrzeuganhänger<br />
angebrachte amtliche Kennzeichen verändert, beseitigt, verdeckt<br />
oder sonst in seiner Erkennbarkeit beeinträchtigt,<br />
wird, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe<br />
bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe<br />
bestraft.<br />
§ 22 II StVG Die gleiche Strafe trifft Personen, welche auf öffentlichen Wegen oder<br />
Plätzen von einem Kraftfahrzeug oder einem Kraftfahrzeuganhänger<br />
Gebrauch machen, von denen sie wissen, dass die Kennzeichnung in<br />
der in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Art gefälscht, verfälscht oder<br />
unterdrückt worden ist.<br />
zu Absicht<br />
Der Täter muss durch sein Handeln entweder den Anschein erwecken wollen, ein<br />
nicht zugelassenes Kfz sei ordnungsgemäß zugelassen, oder er muss den Zweck<br />
der amtl. Kennzeichnung, die nachträgliche Feststellbarkeit des Fahrzeugs zu ermöglichen<br />
bzw. zu erleichtern, vereiteln wollen. Bloßes vorsätzliches Handeln oder<br />
Fahrlässigkeit erfüllen den Tatbestand nicht.<br />
zu Amtliche Kennzeichen<br />
Dazu zählen die Kennzeichen nach §§ 8, 9 FZV einschl. der Kurzzeitkennzeichen<br />
und roten Kennzeichen 1 nach § 16, 17 FZV die ausländischen Kennzeichen,<br />
die Ausfuhrkennzeichen nach § 19 FZV und die Nationalitätszeichen.<br />
1<br />
Hat der Empfänger eines Roten Kennzeichens zur wiederkehrenden Verwendung das zu benutzende<br />
Fahrzeug nicht durch Eintrag in das Fahrzeugscheinheft bestimmt und wird das Kennzeichen zeitgleich<br />
an 2 unterschiedlichen Fahrzeugen benutzt, indem jeweils nur ein Kennzeichen(-schild) angebracht ist,<br />
liegt ein Verstoß gegen § 22 I Nr. 1 StVG „Anschein einer amtlichen Kennzeichnung“ vor. (BayObLG<br />
NZV 1993, 404)<br />
- 77 -
Kennzeichenmissbrauch<br />
<br />
Versicherungskennzeichen sind keine amtlichen Kennzeichen, Veränderungen<br />
am Fahrzeug kann aber Urkundenfälschung i. S. d. § 267 StGB sein.<br />
Zur Subsidiarität der Vorschrift<br />
§ 22 StVG tritt zurück, wenn eine Vorschrift des StGB eine höhere Strafe androht.<br />
Das kann insbesondere sein § 267 StGB (Urkundenfälschung).<br />
Zu Absatz 1 Nr. 3<br />
Beispiele:<br />
- Besprühen mit z.B. einem farblosen Speziallack (BGH v. 21. 9. 1999)<br />
- Verändern der Ziffern / Buchstaben Kombination durch z.B. Bekleben<br />
- Verhängen mit einer Decke<br />
- Abschalten der Beleuchtung<br />
- Um- oder Abknicken (Motorrad)<br />
Zur Vollendung der Tat wird nicht verlangt, dass das Fahrzeug im öffentlichen Verkehr<br />
geführt wird<br />
Missbräuchliches Herstellen, Vertreiben oder Ausgeben von Kennzeichen<br />
§ 22a I StVG Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft,<br />
wer<br />
1. Kennzeichen ohne vorherige Anzeige bei der zuständigen Behörde<br />
herstellt, vertreibt oder ausgibt, oder<br />
2. (aufgehoben)<br />
3. Kennzeichen in der Absicht nachmacht, dass sie als amtlich zugelassene<br />
Kennzeichen verwendet oder in Verkehr gebracht<br />
werden oder dass ein solches Verwenden oder Inverkehrbringen<br />
ermöglicht werde, oder Kennzeichen in dieser Absicht so verfälscht,<br />
dass der Anschein der Echtheit hervorgerufen wird, oder<br />
4. nachgemachte oder verfälschte Kennzeichen feilhält oder in den<br />
Verkehr bringt.<br />
§ 22a II StVG Nachgemachte oder verfälschte Kennzeichen, auf die sich eine Straftat<br />
nach Absatz 1 bezieht, können eingezogen werden. § 74a StGB ist anzuwenden.<br />
Sachverhalt: Heidelberger Kurzzeitkennzeichen<br />
Insbesondere das Straßenverkehrsamt Heidelberg teilt massenhaft Kurzzeitkennzeichen<br />
an sog. „Schilder- und Anmelde-Service“ – Unternehmen zu. Im Fahrzeugschein<br />
wird der Name dieser Service-Unternehmen eingetragen. Die Firma wiederum<br />
verkauft die ihr zugeteilten Kurzzeitkennzeichen bundesweit an Interessenten.<br />
- 78 -
Kennzeichenmissbrauch<br />
Vor dem Hintergrund der Verhinderung von Kennzeichenmißbrauch im Zusammenhang<br />
mit Straftaten und zum Schutz des staatlichen Zulassungswesens belegt<br />
§ 22a I Nr. 1 StVG jede Abgabe von Fahrzeugkennzeichen an Dritte ohne vorherige<br />
Anzeige an die zuständige Zulassungsstelle mit Strafe. § 22a StVG erfasst auch<br />
die Kurzzeitkennzeichen 2 .<br />
Missbrauch von Wegstreckenzählern und Geschwindigkeitsbegrenzern<br />
§ 22b I StVG Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft,<br />
wer<br />
1. die Messung eines Wegstreckenzählers, mit dem ein Kraftfahrzeug<br />
ausgerüstet ist, dadurch verfälscht, dass er durch Einwirkung<br />
auf das Gerät oder den Messvorgang das Ergebnis der<br />
Messung beeinflusst,<br />
2. die bestimmungsgemäße Funktion eines Geschwindigkeitsbegrenzers,<br />
mit dem ein Kraftfahrzeug ausgerüstet ist, durch Einwirkung<br />
auf diese Einrichtung aufhebt oder beeinträchtigt oder<br />
3. eine Straftat nach Nummer 1 oder 2 vorbereitet, indem er Computerprogramme,<br />
deren Zweck die Begehung einer solchen Tat<br />
ist, herstellt, sich oder einem anderen verschafft, feilhält oder einem<br />
anderen überlässt.<br />
§ 22b II StVG In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 gilt § 149 II und III StGB entsprechend.<br />
§ 22b III StVG Gegenstände, auf die sich die Straftat nach Absatz 1 bezieht, können<br />
eingezogen werden. § 74a StGB ist anzuwenden<br />
Damit hat die straflose Manipulation an Tachos („Zurückdrehen“) ein Ende.<br />
2<br />
OLG München StRR 2011, 42.<br />
- 79 -
Ausländische Fahrzeuge<br />
16 Teilnahme ausländischer Fahrzeuge am Straßenverkehr<br />
§ 20 Vorübergehende Teilnahme am Straßenverkehr im Inland<br />
(1)<br />
zugelassene Fahrzeuge<br />
aus EU oder EWR<br />
dürfen vorübergehend am Verkehr im Inland teilnehmen, wenn<br />
1. gültige Zulassungsbescheinigung in EU oder EWR ausgestellt<br />
2. im Inland kein regelmäßiger Standort begründet ist<br />
(2)<br />
zugelassene Fahrzeuge<br />
aus einem Drittstaat<br />
dürfen vorübergehend am Verkehr im Inland teilnehmen, wenn<br />
1. gültige Zulassungsbescheinigung oder ein Internationaler Zulassungsschein<br />
2. im Inland kein regelmäßiger Standort begründet ist<br />
(3)<br />
Ausländische Fahrzeuge dürfen vorübergehend am Verkehr im Inland nur teilnehmen,<br />
wenn sie betriebs- und verkehrssicher sind.<br />
(4)<br />
Bei Nicht-EU-/EWR-Staaten oder Vertragsstaaten 1 ist eine Übersetzung erforderlich.<br />
(5)<br />
Die Übersetzung oder den Internationalen Zulassungsschein ist mitzuführen und zuständigen<br />
Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.<br />
(6)<br />
Als vorübergehend im Sinne des Absatzes 1 gilt ein Zeitraum bis zu einem Jahr.<br />
Die Frist beginnt<br />
1. bei Zulassungsbescheinigungen mit dem Tag des Grenzübertritts und<br />
2. bei internationalen Zulassungsscheinen.....mit dem Ausstellungstag.<br />
1<br />
Übereinkommen über den Straßenverkehr (Wiener Übereinkommen") vom 8. 11. 1968<br />
Vertragsstaaten: Bahrein, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Brasilien, Bundesrepublik Deutschland, Dänemark<br />
ohne Färöer und Grönland, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guayana,<br />
Iran, Israel, Jugoslawien, Kasachstan, Kongo, Kroatien, Kuba, Lettland, Litauen, Luxemburg, Marokko,<br />
Mazedonien, Moldau, Monaco, Niger, Norwegen, Österreich, Pakistan, Philippinen, Rumänien, San Marino,<br />
Schweiz, Senegal, Seychellen, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Tadschikistan, Tschechische<br />
Republik, Turkmenistan, Uruguay, Weißrußland, Zentralafrikanische Republik.<br />
- 80 -
Ausländische Fahrzeuge<br />
§ 21 Kennzeichen und Unterscheidungszeichen<br />
(1)<br />
einem anderen Staat zugelassene Kraftfahrzeuge<br />
heimische Kennzeichen<br />
an der Vorder- und Rückseite<br />
Krafträder und Anhänger nur an der Rückseite<br />
Anhänger ohne eigenes Kennzeichen führen eine Wiederholungskennzeichen<br />
(2)<br />
In einem anderen Staat zugelassene Fahrzeuge<br />
Benötigen ein Unterscheidungszeichen des Zulassungsstaates 2<br />
Außer Euro-Kennzeichen<br />
§ 22 Beschränkung und Untersagung des Betriebs ausländischer Fahrzeuge<br />
Erweist sich ein ausländisches Fahrzeug als nicht vorschriftsmäßig, ist § 5 FZV 3 anzuwenden.<br />
Hinweis:<br />
§ 5 FZV ist keine Rechtsgrundlage für die Polizei. Es kann aber auf der Grundlage<br />
des Polizeigesetzes die Weiterfahrt untersagt werden.<br />
Auch ein Verstoß gegen § 20 III FZV ist nicht ordnungswidrig. Daher bleibt nur der<br />
Rückgriff auf die Vorschriften der StVZO.<br />
§ 31d StVZO<br />
Jedoch sind nur die in § 31d StVZO enumerativ aufgelisteten Vorschriften der StVZO<br />
auch von ausländischen Fahrzeugen einzuhalten:<br />
- Ausländische Kfz und ihre Anhänger müssen in Gewicht und Abmessungen<br />
den §§ 32 und 34 StVZO entsprechen<br />
2<br />
3<br />
www.Kennzeichen.flaggenwelt.de/europa.html<br />
§ 5 Beschränkung und Untersagung des Betriebs von Fahrzeugen<br />
(1) Erweist sich ein Fahrzeug als nicht vorschriftsmäßig nach dieser Verordnung oder der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung,<br />
kann die Zulassungsbehörde dem Eigentümer oder Halter eine angemessene<br />
Frist zur Beseitigung der Mängel setzen oder den Betrieb des Fahrzeugs auf öffentlichen Straßen<br />
beschränken oder untersagen.<br />
- 81 -
Ausländische Fahrzeuge<br />
- Ausländische Kfz müssen an Sitzen, für die das Recht des Zulassungsstaates<br />
Sicherheitsgurte vorschreibt, über diese Sicherheitsgurte verfügen.<br />
Nur für Fahrzeuge aus EU-/EWR-Mitgliedstaaten gelten ferner folgende Vorschriften:<br />
- Ausländische Kfz aus EU-/EWR-Mitgliedstaaten, die in der Richtlinie<br />
92/6/EWG 4 genannt sind, müssen mit Geschwindigkeitsbegrenzern ausgestattet<br />
sein. Die Geschwindigkeitsbegrenzer müssen benutzt werden.<br />
- Die Luftreifen ausländischer Kfz und Anhänger aus EU-/EWR-Mitgliedstaaten,<br />
die in der Richtlinie 89/459/EWG 5 genannt sind, müssen beim Hauptprofil der<br />
Lauffläche eine Profiltiefe von mindestens 1,6 Millimeter aufweisen; als<br />
Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche,<br />
der etwa drei Viertel der Laufflächenbreite einnimmt.<br />
Im Übrigen gelten für im Ausland zugelassene Fahrzeuge bei der vorübergehenden<br />
Teilnahme am Straßenverkehr im Inland die Vorschriften der StVZO nicht. 6 Zu dem<br />
Problem der Verwendung von Abschlepp-/Schleppachsen zum Transport von Pkw<br />
hinter z.B. Wohnmobilen siehe Kapitel 10.7.<br />
Ausländerpflichtversicherungsgesetz<br />
Für Kfz, die im Inland keinen regelmäßigen Standort haben muss eine Haftpflichtversicherung<br />
bestehen. Fehlt die Versicherung bei der Einreise so müssen die Grenzzollstellen<br />
zurückweisen. Der Nachweis der Versicherung ist mitzuführen und auszuhändigen.<br />
Ausgenommen sind gemäß der Verordnung „Wegfall der grünen Versicherungskarte“<br />
(8-26-1) im wesentlichen EU- und EWR-Staaten.<br />
4<br />
5<br />
6<br />
Richtlinie 92/6/EWG des Rates vom 10.02.1992 über Einbau und Benutzung von Geschwindigkeitsbegrenzern für<br />
bestimmte Kraftfahrzeugklassen in der Gemeinschaft (ABl. EG Nr. L 57, 27) i.d.F. der Richtlinie 2002/85/EG vom<br />
05.11.2002 (ABl. EG vom 04.12.2002, Nr. L 327, 8).<br />
Richtlinie 89/459/EWG des Rates vom 18.07.1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten<br />
über die Profiltiefe der Reifen an bestimmten Klassen von Kfz und deren Anhängern (ABl. EG Nr. L 226, 4).<br />
Hentschel/König/Dauer, Rn. 14 zu § 20 FZV.<br />
- 82 -
Prüfungsschema<br />
17 Prüfungsschema für zulassungsrechtliche Sachverhalte<br />
Die methodische Lösung von zulassungsrechtlichen Sachverhalten sollte mit nachfolgender<br />
Begründung nach folgendem Schema zu erfolgen:<br />
17.1<br />
Das Verkehrsstrafrecht nimmt innerhalb des Strafrechts einen besonders breiten<br />
Raum ein.<br />
Die für den Straßenverkehr relevanten strafrechtlichen Vorschriften befinden sich im<br />
allgemeinen Strafgesetzbuch. Hier bilden die das Fehlverhalten im Straßenverkehr<br />
betreffenden Strafvorschriften des § 142 StGB (Unfallflucht), § 315b (Gefährlicher<br />
Eingriff in den Straßenverkehr), § 315c StGB (Gefährdung des Straßenverkehrs), §<br />
316 StGB (Trunkenheit im Straßenverkehr) den eigentlichen Kern des Verkehrsstrafrechts.<br />
Dies alles wird in erheblichem Maße durch Straftatbestände des StVG [hier insbesondere<br />
§ 21 StVG (Fahren ohne Fahrerlaubnis)], PflichtVersG und den Steuergesetzen<br />
ergänzt.<br />
Aus alledem folgt, dass das Verkehrsstrafrecht im heutigen Rechtssystem kein Nebenstrafrecht<br />
mehr ist, sondern eine überragende zentrale Bedeutung hat.<br />
Das bedeutet aber auch, dass verkehrsstrafrechtliche Sachverhalte im Einklang mit<br />
der Ihnen vertrauten juristischen Methodik einer Lösung zugeführt werden müssen.<br />
Das Aufbauschema ist gleich.<br />
Dennoch gibt es gute Gründe, insbesondere im Zusammenhang mit der Lösung zulassungsrechtlicher<br />
Sachverhalte von dem Aufbauschema abzuweichen:<br />
In der Mehrheit der Fälle wird das Vorhandensein der erforderlichen Zulassung im<br />
Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle oder der Verfolgung beispielsweise<br />
einer Verkehrsordnungswidrigkeit nach der StVO überprüft. Ihrem Wesen nach erfolgt<br />
die allgemeine Verkehrskontrolle verdachtsfrei. Aber auch bei der Verfolgung<br />
einer Verkehrsordnungswidrigkeit liegt nicht auch gleichzeitig der Verdacht Zulassungsverstoßes<br />
vor.<br />
Mit Blick auf die polizeiliche Verkehrsüberwachungspraxis wird man also zu einer<br />
anderen Prüfungsabfolge kommen müssen: am Beginn einer Kontrolle steht regelmäßig<br />
die Überprüfung der erforderlichen Zulassung, ohne dass zu diesem Zeitpunkt<br />
ein Anfangsverdacht etwa im Hinblick auf das Vorliegen eines Zulassungsverstoßes<br />
bestünde. Erst, wenn sich bei dieser Prüfung herausstellt, dass das Fahrzeug nicht<br />
ordnungsgemäß zugelassen oder in Betrieb gesetzt ist, ergibt sich gleichzeitig der<br />
Verdacht auf das Vorliegen zumindest einer Ordnungswidrigkeit i.S.d. Zulassungsrechts.<br />
Die Aufgabenstellung beinhaltet bei strafrechtlichen Sachverhalten gemeinhin die<br />
Frage nach der Strafbarkeit der handelnden Personen. Demgegenüber wird bei der<br />
Lösung der hier in Rede stehenden Sachverhalte eine Beurteilung aus zulassungsrechtlicher<br />
Sicht gefordert zunächst ohne Rücksicht darauf, ob sich er Kraftfahrzeugführer<br />
strafbar gemacht hat oder nicht. Diese Vorgehensweise ist der Praxis ge-<br />
- 83 -
Prüfungsschema<br />
schuldet, denn hier wie dort stellt sich ganz überwiegend heraus, dass das kontrollierte<br />
Fahrzeug sehr wohl ordnungsgemäß in Betrieb genommen wurde. Dies zu begründen<br />
aber ist auch Prüfungsleistung.<br />
In den nachfolgend dargestellten Sachverhalten wird dementsprechend auf das zuvor<br />
genannte Prüfungsschema abgestellt.<br />
17.2<br />
Ergibt sich aus dem Sachverhalt jedoch eindeutig, dass ein zulassungsrechtlicher<br />
Verstoß vorliegt, springt also die Strafbarkeit des Kraftfahrzeugführers sozusagen ins<br />
Auge, so kann der Bearbeiter weiterhin entsprechend dem ihm bekannten strafrechtlichen<br />
Prüfungsschema vorgehen.<br />
17.3<br />
Die Prüfung des subjektiven Tatbestands (Vorsatz / Fahrlässigkeit) sowie der<br />
Rechtswidrigkeit und der Schuld des Betroffenen kann bei Ordnungswidrigkeiten ggf.<br />
auch unterbleiben. Sie ist deshalb hier nicht aufgeführt.<br />
Hinweis<br />
Im Falle zulassungsrechtlicher Ordnungswidrigkeiten genügt regelmäßig<br />
bereits die fahrlässige Tatbestandsverwirklichung.<br />
Rechtfertigungs- und Schuldausschließungsgründe liegen im Sachverhalt<br />
regelmäßig nicht vor.<br />
- 84 -
Prüfungsschema<br />
1 Vorprüfung<br />
Die Überschrift kann meist knapp gehalten werden:<br />
Beispiele<br />
„Fraglich ist, ob das in Rede stehende Fahrzeug / Kfz ordnungsgemäß<br />
zugelassen / in Betrieb gesetzt wurde“<br />
„Fraglich ist, ob das Fahrzeug / Kfz des (A) i.S.d. zulassungsrechtlichen<br />
Vorschriften ordnungsgemäß in Betrieb gesetzt wurde.“<br />
2 Grundsatz der Zulassungspflicht<br />
Gemäß § 1 I StVG müssen Kfz und ihre Anhänger, die auf öffentlichen Straßen in<br />
Betrieb gesetzt werden sollen, von der zuständigen Behörde (Zulassungsbehörde)<br />
zum Verkehr zugelassen sein.<br />
Hier muss jetzt die Sachverhalts bezogene Prüfung erfolgen<br />
- des öffentlichen Verkehrsraumes (2.1) ,<br />
- des Kraftfahrzeuges / Anhängers (2.2) und<br />
- ob das Kfz in Betrieb gesetzt (2.3) wird<br />
2.1 Öffentlicher Verkehrsraum<br />
Definition<br />
Öffentlich i.S.d. Straßenverkehrsrechts sind zum einen alle nach dem<br />
Wegerecht des Bundes und der Länder dem allgemeinen Verkehr gewidmeten<br />
Straßen, Wege und Plätze (= öffentlich-rechtlicher Verkehrsraum);<br />
zum anderen gehören auch die Verkehrsflächen dazu, auf denen<br />
ohne Rücksicht auf eine verwaltungsrechtliche Widmung oder auf die<br />
Eigentumsverhältnisse (Privatgrundstück) auf Grund ausdrücklicher o-<br />
der stillschweigender Duldung des Verfügungsberechtigten die Benutzung<br />
durch einen unbestimmten Personenkreis zugelassen ist [= tatsächlich-öffentlicher<br />
Verkehrsraum (BGH VRS 22, 185; BGH NZV 1998,<br />
418)].<br />
Öffentlicher Verkehrsraum ist gegeben, wenn die Benutzung der in Rede<br />
stehenden Fläche zu Verkehrszwecken für jedermann oder einer<br />
allgemein bestimmten Personengruppe dauernd oder zeitweise möglich<br />
ist und auch tatsächlich und nicht nur gelegentlich von jedermann oder<br />
einer allgemein bestimmten Personengruppe benutzt wird.<br />
2.2 Kraftfahrzeug<br />
Definition<br />
Als Kfz gelten Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden,<br />
ohne an Bahngleise gebunden zu sein (Legaldefinition § 1 II<br />
StVG).<br />
- 85 -
Prüfungsschema<br />
Anhänger<br />
Definition<br />
Als Anhänger bezeichnet man Fahrzeuge, die zum Anhängen an ein<br />
Kfz bestimmt und geeignet sind (Legaldefinition § 2 Nr. 2 FZV).<br />
2.3 In Betrieb setzen<br />
Definition<br />
In Betrieb setzen bedeutet die bestimmungsgemäße Verwendung des<br />
Fahrzeugs als Fortbewegungsmittel. Danach ist ein Kfz in Betrieb, solange<br />
der Motor das Kfz oder eine seiner Betriebseinrichtungen bewegt.<br />
Sachverhaltsannahme<br />
Es ist durchaus zulässig, vom in Betrieb setzen eines Fahrzeugs auf<br />
das Führen und umgekehrt zu schließen.<br />
2.4 Grundregel der Zulassung<br />
Zum Verkehr auf öffentlichen Straßen sind gemäß § 16 I StVZO alle Fahrzeuge zugelassen,<br />
die den Vorschriften der StVZO und der StVO entsprechen, sofern nicht für<br />
die Zulassung einzelner Fahrzeugarten ein Erlaubnisverfahren vorgeschrieben ist.<br />
Dieser Grundsatz der allgemeinen Verkehrsfreiheit wird jedoch durch die Vorschriften<br />
der FZV eingeschränkt.<br />
2.5 Erlaubnis- und Ausweispflicht<br />
Inwieweit zur Inbetriebsetzung eines Fahrzeugs eine Zulassung erforderlich ist, ergibt<br />
sich aus § 1 I StVG und den ihn ausführenden Vorschriften der §§ 1, 3, 4 FZV.<br />
Wer ein Kfz ohne die erforderliche Zulassung in Betrieb setzt, führt es entgegen den<br />
Bestimmungen des § 3 oder § 4 FZV.<br />
3 Ausnahmen von der Zulassungspflicht<br />
Hier erfolgt die Prüfung, ob eine Ausnahme von der Zulassungspflicht vorliegt.<br />
Ausnahmetatbestand<br />
§ 1 FZV<br />
Gemäß § 1 FZV ist diese Verordnung auf Kfz mit einer BbH ≤ 6 km/h<br />
und ihre Anhänger nicht anzuwenden. Lediglich „schnellere“ Fahrzeuge<br />
unterliegen nach näherer Maßgabe der §§ 3 und 4 FZV dem Zulassungsverfahren.<br />
Ausnahmetatbestand<br />
§ 3 II FZV<br />
Die Ausnahmen sind in § 3 II FZV abschließend geregelt.<br />
Liegt keine Ausnahme vor, kann dieser Punkt knapp abgehandelt werden.<br />
- 86 -
Prüfungsschema<br />
Beispiel<br />
„Im vorliegenden Fall ist die FZV aufgrund der entgegenstehenden<br />
Vorschrift des § 1 FZV nicht anwendbar.“<br />
„Im vorliegenden Fall liegt jedoch ersichtlich kein Ausnahmetatbestand<br />
des § 3 II FZV vor.“<br />
3.1 Das sog. 6 km/h – Fahrzeug<br />
Gemäß § 1 FZV ist die gesamte Verordnung auf Kfz mit einer BbH ≤ 6 km/h und ihre<br />
Anhänger nicht anzuwenden.<br />
3.2 § 3 II FZV<br />
3.2.1 § 3 II Nr. 1 FZV<br />
Ausgenommen von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren sind folgende<br />
Kraftfahrzeugarten:<br />
a) SAM und Stapler<br />
b) Einachsige Zugmaschinen (…)<br />
c) Leichtkrafträder<br />
d) Zwei- oder dreirädrige Kleinkrafträder<br />
e) Motorisierte Krankenfahrstühle<br />
f) Vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge<br />
3.2.2 § 3 II Nr. 2 FZV<br />
Ausgenommen von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren sind folgende<br />
Arten von Anhängern:<br />
a) lof – Anhänger<br />
b) Wohn- und Packwagen im Schaustellergewerbe<br />
c) fahrbare Baubuden<br />
d) Arbeitsmaschinen<br />
e) Sportanhänger<br />
f) einachsige Anhänger hinter Krafträdern, Kleinkrafträdern und motorisierten<br />
Krankenfahrstühlen<br />
g) Anhänger für Feuerlöschzwecke<br />
h) lof – Arbeitsgeräte<br />
i) Sitzkarren<br />
4 Zulassungsrechtliche Bestimmung<br />
Danach ist festzustellen, aus welcher Bestimmung sich die Zulassungspflicht bzw.<br />
die Zulassungsfreiheit für das in Rede stehende Fahrzeug ergibt. Hierzu ist folgendes<br />
festzustellen:<br />
- 87 -
Prüfungsschema<br />
- Welches Fahrzeug wird im Sachverhalt in Betrieb gesetzt<br />
- Beschreibung der technischen Eckdaten und Definition des<br />
Fahrzeuges<br />
- Ist dafür eine Zulassung erforderlich<br />
- Siehe § 3 I FZV<br />
- Ist das Fahrzeug von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren<br />
ausgenommen<br />
- Siehe § 3 II FZV<br />
- Liegt für das Fahrzeug eine Zulassung vor bzw. sind die Voraussetzungen<br />
für eine Inbetriebsetzung zulassungsfreier Fahrzeuge erfüllt<br />
- Ausweislich der der Klausur beigefügten Fahrzeugpapiere<br />
5 Mitführ- und Aushändigungspflicht der Zulasungsbescheinigung<br />
Die Zulassung ist gemäß § 11 V FZV durch eine amtliche Bescheinigung (Zulassungsbescheinigung)<br />
nachzuweisen.<br />
Die Zulassungsbescheinigung ist beim Führen von Fahrzeugen mitzuführen und zuständigen<br />
Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.<br />
Hinweis<br />
Wird die Zulassungsbescheinigung nicht mitgeführt oder zuständigen<br />
Personen auf Verlangen nicht zur Prüfung ausgehändigt, begeht der<br />
Kraftfahrzeugführer lediglich eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 11 V FZV<br />
i.V.m. § 48 Nr. 5 i.V.m. § 24 StVG (BKat Nr. 74; TBNR 811100 bzw.<br />
811106; VG 10,- €); die Zulassung selbst bleibt unangetastet.<br />
5.1 Zulassung<br />
Definition<br />
Die Zulassung ist der rechtstechnische Ausdruck für die behördlich erteilte<br />
Ermächtigung (= begünstigender Verwaltungsakt) zum Betrieb<br />
eines Fahrzeugs.<br />
5.2 Zulassungsbescheinigung<br />
Definition<br />
Die Zulassungsbescheinigung ist das amtliche Dokument, das die Zulassung<br />
zum Zeitpunkt der Erteilung bescheinigt.<br />
6 Besonderheiten (nur prüfen wenn relevant)<br />
6.1 Brauchtumsveranstaltung<br />
6.2 Rote Kennzeichen<br />
- 88 -
Prüfungsschema<br />
6.3 Kurzzeitkennzeichen<br />
6.4 Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen<br />
6.5 Ausländische Fahrzeuge<br />
7 Zwischenergebnis<br />
Hier erfolgt die Feststellung, ob das Fahrzeug ordnungsgemäß zugelassen ist bzw.<br />
die Voraussetzungen für eine Inbetriebsetzung zulassungsfreier Fahrzeuge vorliegt.<br />
Ist dies nachgewiesen, ist die Prüfung beendet.<br />
Beispiel<br />
„(A) ist somit – nicht - im Besitz der erforderlichen Zulassung / Voraussetzungen.“<br />
Hat er die erforderliche(n) Zulassung / Voraussetzungen nicht nachgewiesen, erfolgt<br />
die Feststellung, dass der Betroffene nicht über die erforderliche(n) Zulassung / Voraussetzungen<br />
verfügt.<br />
Beispiel<br />
„(A) ist somit nicht im Besitz der erforderlichen Zulassung / Voraussetzungen.“<br />
8 Ordnungswidriges Verhalten des (A)<br />
8.1 Obersatz<br />
Der Obersatz besteht aus einer präskriptiven Aussage des Inhalts, dass bei Vorliegen<br />
bestimmter Voraussetzungen eine bestimmte Rechtsfolge eintreten soll: „Die<br />
Rechtsfolge tritt ein, wenn die im Tatbestand beschriebenen Voraussetzungen vorliegen“.<br />
Der Obersatz muss folgende vier Elemente enthalten:<br />
-Täter<br />
-Handlung<br />
-Delikt<br />
Insbesondere bei mehreren Beteiligten muss die Person genau bezeichnet<br />
werden.<br />
Welches Verhalten (Tun oder Unterlassen) wird strafrechtlich geprüft<br />
Genaue Bezeichnung des Delikts (z.B.: Inbetriebsetzung eines Fahrzeugs<br />
ohne die erforderliche Zulassung).<br />
-Strafnorm Welche Strafnorm wird geprüft. Dazu ist das Gesetz zu benennen (z.B.:<br />
§ 3 I FZV).<br />
- 89 -
Prüfungsschema<br />
Hier ist also klarzustellen, welches konkrete Verhalten welcher Person auf welche<br />
Tatbestandsverwirklichung hin geprüft werden soll. Formuliert wird im Konjunktiv, da<br />
das Ergebnis ja noch nicht feststeht.<br />
Beispiele<br />
„Indem (A) mit seinem Kfz … fuhr, ohne die erforderliche Zulassung zu<br />
besitzen, könnte er sich der Inbetriebsetzung eines Fahrzeugs gemäß §<br />
3 I FZV schuldig gemacht haben.“<br />
„Indem (A) mit seinem Kfz … fuhr, ohne die erforderliche Zulassung zu<br />
besitzen, könnte er sich der Inbetriebsetzung eines Fahrzeugs gemäß §<br />
3 I FZV ordnungswidrig verhalten haben.“<br />
„(A) könnte durch die Inbetriebsetzung des Kfz (…) gegen § 3 I FZV<br />
verstoßen haben.“<br />
„Die Inbetriebsetzung des in Rede stehenden Fahrzeugs kann eine<br />
Ordnungswidrigkeit des (A) nach § 3 I FZV begründen.“<br />
„(A) kann durch die Inbetriebsetzung seines Lkw ohne die erforderliche<br />
Zulassung den Tatbestand des § 3 I FZV verwirklicht haben.“<br />
„Möglicherweise hat (A) eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 3 I FZV begangen,<br />
als er seinen Lkw in Betrieb setzte.“<br />
8.2 Objektiver Tatbestand<br />
Ordnungswidrig handelt, wer fahrlässig oder vorsätzlich entgegen § 3 I Satz 1 FZV<br />
im öffentlichen Straßenverkehr ein Fahrzeug ohne die erforderliche Zulassung in Betrieb<br />
setzt.<br />
Die einschlägigen Tatbestandsmerkmale wurden bereits sämtlich mit folgendem Ergebnis<br />
geprüft: (A) hat gegen § 3 I FZV verstoßen.<br />
8.3 Schlusssatz (Ergebnis)<br />
Beispiele<br />
„(A) hat sich durch die Inbetriebsetzung eines Fahrzeugs gemäß § 3 I<br />
FZV schuldig gemacht.“<br />
„Indem (A) mit seinem Kfz … fuhr, ohne die erforderliche Zulassung zu<br />
besitzen, hat er sich gemäß § 3 I FZV ordnungswidrig verhalten.“<br />
„(A) hat durch die Inbetriebsetzung des Kfz (…) gegen § 3 I FZV verstoßen.“<br />
„Die Inbetriebsetzung des in Rede stehenden Fahrzeugs hat eine Ordnungswidrigkeit<br />
des (A) nach § 3 I FZV begründet.“<br />
„(A) hat durch die Inbetriebsetzung seines Lkw ohne die erforderliche<br />
Zulassung den Tatbestand des § 3 I FZV verwirklicht.“<br />
- 90 -
Prüfungsschema<br />
„(A) hat eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 3 I FZV begangen, als er seinen<br />
Lkw in Betrieb setzte.“<br />
- 91 -
Prüfungsschema<br />
18 Prüfungsschema für zulassungsrechtliche Sachverhalte<br />
Das nicht zugelassene Kfz<br />
(L) wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit seinem Pkw im Rahmen einer<br />
allgemeinen Verkehrskontrolle auf der B 55 angehalten und überprüft. Dabei wird<br />
folgendes festgestellt:<br />
- Der Pkw ist nicht mit den vorgeschriebenen amtlichen Kennzeichen ausgeschildert.<br />
- Die beiden Kennzeichenschilder liegen jeweils hinter der Windschutz- bzw.<br />
Heckscheibe; die Kennzeichen sind zudem entstempelt.<br />
- (L) händigt den Polizeibeamten die Zulassungsbescheinigung II aus:<br />
- Im Verlauf der Verkehrskontrolle gibt (L) auf entsprechende Nachfrage an,<br />
er habe das Fahrzeug abgemeldet, da er umfangreiche Umbauten daran<br />
vornehmen wollte. Dazu sei es jedoch noch nicht gekommen. Deshalb habe<br />
er den Wagen auch noch nicht wieder angemeldet. Er habe jedoch den<br />
Wagen dringend für einen Discobesuch gebraucht.<br />
Aufgabe:<br />
Beurteilen Sie den Sachverhalt aus zulassungsrechtlicher Sicht.<br />
1. Vorprüfung<br />
Fraglich ist, ob das in Rede stehende Kfz ordnungsgemäß in Betrieb gesetzt wurde.<br />
2. Grundsatz der Zulassungspflicht<br />
Gemäß § 1 I StVG müssen Kfz und ihre Anhänger (2.2) , die auf öffentlichen Straßen (2.1)<br />
in Betrieb gesetzt (2.3) werden sollen, von der zuständigen Behörde (Zulassungsbehörde)<br />
zum Verkehr zugelassen sein.<br />
2.1 Öffentlicher Verkehrsraum<br />
Definition<br />
Öffentlich i.S.d. Straßenverkehrsrechts sind zum einen alle nach dem<br />
Wegerecht des Bundes und der Länder dem allgemeinen Verkehr gewidmeten<br />
Straßen, Wege und Plätze (= öffentlich-rechtlicher Verkehrsraum);<br />
zum anderen gehören auch die Verkehrsflächen dazu, auf denen<br />
ohne Rücksicht auf eine verwaltungsrechtliche Widmung oder auf die<br />
- 92 -
Prüfungsschema<br />
Eigentumsverhältnisse (Privatgrundstück) auf Grund ausdrücklicher o-<br />
der stillschweigender Duldung des Verfügungsberechtigten die Benutzung<br />
durch einen unbestimmten Personenkreis zugelassen ist [= tatsächlich-öffentlicher<br />
Verkehrsraum.<br />
Öffentlicher Verkehrsraum ist gegeben, wenn die Benutzung der in Rede<br />
stehenden Fläche zu Verkehrszwecken für jedermann oder einer<br />
allgemein bestimmten Personengruppe dauernd oder zeitweise möglich<br />
ist und auch tatsächlich und nicht nur gelegentlich von jedermann oder<br />
einer allgemein bestimmten Personengruppe benutzt wird.<br />
(L) wird im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der B 55 angehalten<br />
und überprüft. Aufgrund dieser Formulierung ist die Annahme öffentlichen Verkehrsraums<br />
hinreichend gerechtfertigt.<br />
2.2 Kraftfahrzeug<br />
Definition<br />
Als Kfz gelten Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden,<br />
ohne an Bahngleise gebunden zu sein (Legaldefinition § 1 II<br />
StVG).<br />
Bei dem in Rede stehenden Pkw handelt es sich zweifelsohne um ein Kfz.<br />
2.3 In Betrieb setzen<br />
Definition<br />
In Betrieb setzen bedeutet die bestimmungsgemäße Verwendung des<br />
Fahrzeugs als Fortbewegungsmittel. Danach ist ein Kfz in Betrieb, solange<br />
der Motor das Kfz oder eine seiner Betriebseinrichtungen bewegt.<br />
Im vorliegenden Sachverhalt lenkt (L) den Pkw unter bestimmungsgemäßer Anwendung<br />
der Antriebskräfte dieses Fahrzeugs (= in Betrieb setzen).<br />
2.4 Grundregel der Zulassung<br />
Zum Verkehr auf öffentlichen Straßen sind gemäß § 16 I StVZO alle Fahrzeuge zugelassen,<br />
die den Vorschriften der StVZO und der StVO entsprechen, sofern nicht für<br />
die Zulassung einzelner Fahrzeugarten ein Erlaubnisverfahren vorgeschrieben ist.<br />
Dieser Grundsatz der allgemeinen Verkehrsfreiheit wird jedoch durch die Vorschriften<br />
der FZV eingeschränkt.<br />
- 93 -
Prüfungsschema<br />
2.5 Erlaubnis- und Ausweispflicht<br />
Inwieweit zur Inbetriebsetzung eines Fahrzeugs eine Zulassung erforderlich ist, ergibt<br />
sich aus § 1 I StVG und den ihn ausführenden Vorschriften der §§ 1, 3, 4 FZV.<br />
Wer ein Kfz ohne die erforderliche Zulassung in Betrieb setzt, führt es entgegen den<br />
Bestimmungen des § 3 I Satz 1 FZV.<br />
3. Ausnahmen von der Zulassungspflicht<br />
Gemäß § 1 FZV ist diese Verordnung auf Kfz mit einer BbH ≤ 6 km/h und ihre Anhänger<br />
nicht anzuwenden. Lediglich „schnellere“ Fahrzeuge unterliegen nach näherer<br />
Maßgabe der §§ 3 und 4 FZV dem Zulassungsverfahren. Der hier in Rede stehende<br />
Pkw allerdings unterliegt dem Zulassungsverfahren.<br />
Im vorliegenden Fall liegt ersichtlich auch kein Ausnahmetatbestand des § 3 II FZV<br />
vor.<br />
4. Zulassungsrechtliche Bestimmung<br />
Die Zulassungspflicht folgt aus § 3 I Satz 1 FZV.<br />
5. Mitführ- und Aushändigungspflicht der Zulassungsbescheinigung<br />
Die Zulassung ist gemäß § 11 V FZV durch eine amtliche Bescheinigung (Zulassungsbescheinigung)<br />
nachzuweisen.<br />
Die Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) ist vom jeweiligen Fahrer des<br />
Kfz mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.<br />
Hinweis<br />
Wird die Zulassungsbescheinigung nicht mitgeführt oder zuständigen<br />
Personen auf Verlangen nicht zur Prüfung ausgehändigt, begeht der<br />
Kraftfahrzeugführer lediglich eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 11 V FZV<br />
i.V.m. § 48 Nr. 5 i.V.m. § 24 StVG (BKat Nr. 74; TBNR 811100 bzw.<br />
811106; VG 10,- €); die Zulassung selbst bleibt unangetastet.<br />
Dieser Verpflichtung ist (L) nicht nachgekommen. Stattdessen händigt er die Zulassungsbescheinigung<br />
II (Fahrzeugbrief) aus. Daraus geht jedoch hervor, dass das<br />
Fahrzeug außer Betrieb gesetzt wurde.<br />
- 94 -
Prüfungsschema<br />
6. Besonderheiten<br />
entfällt<br />
7. Zwischenergebnis<br />
(A) ist somit nicht im Besitz der erforderlichen Zulassung.<br />
8. Ordnungswidriges Verhalten des (A) nach § 3 I FZV<br />
8.1 Obersatz<br />
Aus der Vorprüfung ergibt sich, dass (A) im Verdacht steht, durch die Inbetriebsetzung<br />
des Pkw ohne die erforderliche Zulassung gegen § 3 I FZV verstoßen zu haben.<br />
8.2 Objektiver Tatbestand<br />
Danach handelt ordnungswidrig, wer fahrlässig oder vorsätzlich entgegen § 3 I Satz<br />
1 FZV im öffentlichen Straßenverkehr ein Fahrzeug ohne die erforderliche Zulassung<br />
in Betrieb setzt.<br />
Die einschlägigen Tatbestandsmerkmale wurden bereits sämtlich mit folgendem Ergebnis<br />
geprüft:<br />
(A) hat gegen § 3 I FZV verstoßen.<br />
8.3 Schlusssatz (Ergebnis)<br />
Somit hat (A) eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 3 I FZV i.V.m. § 48 Nr. 1a FZV i.V.m. §<br />
24 StVG begangen.<br />
- 95 -
Prüfungsschema<br />
19 Prüfungsschema für zulassungsrechtliche Sachverhalte<br />
Die Fahrt mit entstempelten Kennzeichen<br />
(E) wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit seinem Pkw im Rahmen einer<br />
allgemeinen Verkehrskontrolle im Vergnügungsviertel von Köln angehalten und überprüft.<br />
Dabei wird folgendes festgestellt:<br />
- Der Pkw ist mit entstempelten Kennzeichen GL – L … ausgeschildert.<br />
- (E) händigt den Polizeibeamten die Zulassungsbescheinigung II und eine<br />
vorläufige Deckungszusage seiner Versicherung über den Versicherungsschutz<br />
auch für Fahrten im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren<br />
aus:<br />
- Im Verlauf der Verkehrskontrolle gibt (E) auf entsprechende Nachfrage an,<br />
er habe das Fahrzeug abgemeldet, da er umfangreiche Umbauten daran<br />
vornehmen wollte. Dazu sei es jedoch noch nicht gekommen. Immerhin<br />
habe er heute Nachmittag in einer Mietwerkstatt die Reifen gewechselt und<br />
die Beleuchtungseinrichtungen repariert. Er sei nur nicht direkt nach Hause<br />
zurück gefahren, sondern habe die räumliche Nähe für einen Discobesuch<br />
genutzt.<br />
Aufgabe:<br />
Beurteilen Sie den Sachverhalt aus zulassungsrechtlicher Sicht.<br />
1. Vorprüfung<br />
Fraglich ist, ob das in Rede stehende Kfz ordnungsgemäß in Betrieb gesetzt wurde.<br />
2. Grundsatz der Zulassungspflicht<br />
Gemäß § 1 I StVG müssen Kfz und ihre Anhänger (2.2) , die auf öffentlichen Straßen (2.1)<br />
in Betrieb gesetzt (2.3) werden sollen, von der zuständigen Behörde (Zulassungsbehörde)<br />
zum Verkehr zugelassen sein.<br />
2.1 Öffentlicher Verkehrsraum<br />
Definition<br />
Öffentlich i.S.d. Straßenverkehrsrechts sind zum einen alle nach dem<br />
Wegerecht des Bundes und der Länder dem allgemeinen Verkehr gewidmeten<br />
Straßen, Wege und Plätze (= öffentlich-rechtlicher Verkehrsraum);<br />
zum anderen gehören auch die Verkehrsflächen dazu, auf denen<br />
- 96 -
Prüfungsschema<br />
ohne Rücksicht auf eine verwaltungsrechtliche Widmung oder auf die<br />
Eigentumsverhältnisse (Privatgrundstück) auf Grund ausdrücklicher o-<br />
der stillschweigender Duldung des Verfügungsberechtigten die Benutzung<br />
durch einen unbestimmten Personenkreis zugelassen ist [= tatsächlich-öffentlicher<br />
Verkehrsraum.<br />
Öffentlicher Verkehrsraum ist gegeben, wenn die Benutzung der in Rede<br />
stehenden Fläche zu Verkehrszwecken für jedermann oder einer<br />
allgemein bestimmten Personengruppe dauernd oder zeitweise möglich<br />
ist und auch tatsächlich und nicht nur gelegentlich von jedermann oder<br />
einer allgemein bestimmten Personengruppe benutzt wird.<br />
(E) wird im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Köln angehalten und<br />
überprüft. Aufgrund dieser Formulierung ist die Annahme öffentlichen Verkehrsraums<br />
hinreichend gerechtfertigt.<br />
2.2 Kraftfahrzeug<br />
Definition<br />
Als Kfz gelten Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden,<br />
ohne an Bahngleise gebunden zu sein (Legaldefinition § 1 II<br />
StVG).<br />
Bei dem in Rede stehenden Pkw handelt es sich zweifelsohne um ein Kfz.<br />
2.3 In Betrieb setzen<br />
Definition<br />
In Betrieb setzen bedeutet die bestimmungsgemäße Verwendung des<br />
Fahrzeugs als Fortbewegungsmittel. Danach ist ein Kfz in Betrieb, solange<br />
der Motor das Kfz oder eine seiner Betriebseinrichtungen bewegt.<br />
Im vorliegenden Sachverhalt lenkt (E) den Pkw unter bestimmungsgemäßer Anwendung<br />
der Antriebskräfte dieses Fahrzeugs (= in Betrieb setzen).<br />
2.4 Grundregel der Zulassung<br />
Zum Verkehr auf öffentlichen Straßen sind gemäß § 16 I StVZO alle Fahrzeuge zugelassen,<br />
die den Vorschriften der StVZO und der StVO entsprechen, sofern nicht für<br />
die Zulassung einzelner Fahrzeugarten ein Erlaubnisverfahren vorgeschrieben ist.<br />
Dieser Grundsatz der allgemeinen Verkehrsfreiheit wird jedoch durch die Vorschriften<br />
der FZV eingeschränkt.<br />
- 97 -
Prüfungsschema<br />
2.5 Erlaubnis- und Ausweispflicht<br />
Inwieweit zur Inbetriebsetzung eines Fahrzeugs eine Zulassung erforderlich ist, ergibt<br />
sich aus § 1 I StVG und den ihn ausführenden Vorschriften der §§ 1, 3, 4 FZV.<br />
Wer ein Kfz ohne die erforderliche Zulassung in Betrieb setzt, führt es entgegen den<br />
Bestimmungen des § 3 I Satz 1 FZV.<br />
3. Ausnahmen von der Zulassungspflicht<br />
Gemäß § 1 FZV ist diese Verordnung auf Kfz mit einer BbH ≤ 6 km/h und ihre Anhänger<br />
nicht anzuwenden. Lediglich „schnellere“ Fahrzeuge unterliegen nach näherer<br />
Maßgabe der §§ 3 und 4 FZV dem Zulassungsverfahren. Der hier in Rede stehende<br />
Pkw allerdings unterliegt dem Zulassungsverfahren.<br />
Im vorliegenden Fall liegt ersichtlich auch kein Ausnahmetatbestand des § 3 II FZV<br />
vor.<br />
4. Zulassungsrechtliche Bestimmung<br />
Die Zulassungspflicht folgt aus § 3 I Satz 1 FZV.<br />
5. Mitführ- und Aushändigungspflicht der Zulassungsbescheinigung<br />
Die Zulassung ist gemäß § 11 V FZV durch eine amtliche Bescheinigung (Zulassungsbescheinigung)<br />
nachzuweisen.<br />
Die Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) ist vom jeweiligen Fahrer des<br />
Kfz mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.<br />
Hinweis<br />
Wird die Zulassungsbescheinigung nicht mitgeführt oder zuständigen Personen auf Verlangen<br />
nicht zur Prüfung ausgehändigt, begeht der Kraftfahrzeugführer lediglich eine Ordnungswidrigkeit<br />
i.S.d. § 11 V FZV i.V.m. § 48 Nr. 5 i.V.m. § 24 StVG (BKat Nr. 74; TBNR 811100 bzw.<br />
811106; VG 10,- €); die Zulassung selbst bleibt unangetastet.<br />
Dieser Verpflichtung ist (E) nicht nachgekommen. Stattdessen händigt er die Zulassungsbescheinigung<br />
II (Fahrzeugbrief) aus. Daraus geht jedoch hervor, dass das<br />
Fahrzeug außer Betrieb gesetzt wurde.<br />
- 98 -
Prüfungsschema<br />
6. Besonderheiten<br />
Fraglich ist, ob sich (E) im vorliegenden Fall auf die Vorschrift des § 10 IV FZV berufen<br />
kann.<br />
Gemäß § 10 IV dürfen Fahrten, die im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren<br />
stehen innerhalb des Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Bezirks mit ungestempelten<br />
Kennzeichen durchgeführt werden, wenn die Zulassungsbehörde vorab<br />
ein solches zugeteilt hat und die Fahrten von der Kraftfahrzeug - Haftpflichtversicherung<br />
erfasst sind.<br />
Die Zulassung eines Fahrzeugs wird letztlich durch Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens<br />
und Stempelung bewirkt. Daraus folgt, dass das Fahrzeug vor der Stempelung<br />
des Kennzeichens grundsätzlich nicht in den Verkehr gebracht werden darf.<br />
Allerdings lässt § 10 IV FZV zu, dass auch Fahrzeuge mit ungestempelten Kennzeichen<br />
unter bestimmten Voraussetzungen durchgeführt werden können.<br />
Als häufigster Anwendungsfall kommt hierbei die Wiederzulassung (vorübergehend)<br />
außer Betrieb gesetzter Fahrzeuge in Betracht. Das ist ausweislich der Einlassung<br />
des (E) vorliegend der Fall.<br />
Die Fahrten müssen sich dann auf das Gebiet des Zulassungsbezirks (hier: Rheinisch<br />
Bergischer Kreis) und eines angrenzenden Zulassungsbezirks (hier: Köln) beschränken.<br />
Auch das ist vorliegend gegeben.<br />
Darüber hinaus müssen die Fahrten von der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung<br />
erfasst sein. Nach der den Polizeibeamten ausgehändigten Versicherungsbescheinigung<br />
ist das der Fall.<br />
Des Weiteren müssen die Fahrten auf kürzestem Wege durchgeführt werden. Die<br />
Rechtsprechung 1 lässt dabei aber auch Umwegfahrten zu, wenn die Fahrt allein zum<br />
Zwecke der Zulassung angetreten wurde. Unter diesem Aspekt kann es noch vertretbar<br />
sein, eine Fahrt zur Tankstelle, zur Reparaturwerkstatt oder einen geeigneten<br />
Ort zur Eigenreparatur durchzuführen.<br />
Im vorliegenden Fall kann durchaus unterstellt werden, dass (E) die Fahrt zweckveranlasst<br />
auf die erneute Zulassung durchgeführt hat. Auch die Tatsache, dass er das<br />
Auto in einer Mietwerkstatt selbst repariert hat, hindert nicht.<br />
Probleme bereitet indes, dass er sein Fahrzeug nachmittags repariert, aber nicht auf<br />
kürzestem Wege wieder aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernt hat, sondern<br />
Stunden später den Pkw einsetzt, um Discothekenbesuche durchzuführen.<br />
Zwar sind Umwegfahrten grundsätzlich durch § 10 IV FZV gedeckt, eine großzügige<br />
Auslegung erscheint nach Sinn und Zweck dieser Norm allerdings nicht vertretbar.<br />
(E) kann sich nicht auf die Bestimmung des § 10 IV FZV berufen.<br />
Hinweis<br />
Eine andere Ansicht ist auch mit entsprechender Begründung kaum vertretbar. Eine umfassendere<br />
Diskussion z.B. unter Hinweis auf Abgrenzungsbeispiele 2 verdient aber positive Bewertung.<br />
1 BayObLG VM 1976,6; OLG Frankfurt VRS 44, 376; OLG Hamburg VR 1971, 925.<br />
2 Heinrich, Polizeispiegel 2000, 269 (274).<br />
- 99 -
Prüfungsschema<br />
7. Zwischenergebnis<br />
(E) ist somit nicht im Besitz der erforderlichen Zulassung.<br />
8. Ordnungswidriges Verhalten des (A) nach § 3 I FZV<br />
8.1 Obersatz<br />
Aus der Vorprüfung ergibt sich, dass (A) im Verdacht steht, durch die Inbetriebsetzung<br />
des Pkw ohne die erforderliche Zulassung gegen § 3 I FZV verstoßen zu haben.<br />
8.2 Objektiver Tatbestand<br />
Danach handelt ordnungswidrig, wer fahrlässig oder vorsätzlich entgegen § 3 I Satz<br />
1 FZV im öffentlichen Straßenverkehr ein Fahrzeug ohne die erforderliche Zulassung<br />
in Betrieb setzt.<br />
Die einschlägigen Tatbestandsmerkmale wurden bereits sämtlich mit folgendem Ergebnis<br />
geprüft:<br />
( E ) hat gegen § 3 I FZV verstoßen.<br />
8.3 Schlusssatz (Ergebnis)<br />
Somit hat (E) eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 3 I FZV i.V.m. § 48 Nr. 1a FZV i.V.m. §<br />
24 StVG begangen.<br />
- 100 -
Prüfungsschema<br />
20 Prüfungsschema für zulassungsrechtliche Sachverhalte<br />
Der Bagger<br />
(B) wird mit seinem Bagger im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der<br />
B 55 angehalten und überprüft. Dabei wird folgendes festgestellt:<br />
- Der Bagger ist nicht mit Kennzeichen ausgeschildert. An der Fahrzeugseite<br />
wird mittels eines Aufklebers für die Eigentümerfirma geworben.<br />
- (B) händigt den Polizeibeamten die Betriebserlaubnis aus.<br />
- In der Baggerschaufel befinden sich neben einem Presslufthammer noch<br />
weitere Gegenstände: zwei Bierkästen, zwei Aktentaschen und 5 Campingstühle.<br />
- Im Verlauf der Verkehrskontrolle gibt (B) auf entsprechende Nachfrage<br />
wahrheitsgemäß an, er habe den Auftrag, den Bagger mit samt den Gegenständen<br />
in der Schaufel zur Firma zurück zu bringen. Die Baustelle sei<br />
heute Nachmittag fertig geworden. Bis auf den Preßlufthammer gehören<br />
die einzelnen Gegenstände verschiedenen Kollegen. Diese hätten jedoch<br />
keinen Platz gehabt, die Dinge zu transportieren.<br />
Aufgabe:<br />
Beurteilen Sie den Sachverhalt aus zulassungsrechtlicher Sicht.<br />
1. Vorprüfung<br />
Fraglich ist, ob das in Rede stehende Kfz ordnungsgemäß in Betrieb gesetzt wurde.<br />
2. Grundsatz der Zulassungspflicht<br />
Gemäß § 1 I StVG müssen Kfz und ihre Anhänger (2.2) , die auf öffentlichen Straßen (2.1)<br />
in Betrieb gesetzt (2.3) werden sollen, von der zuständigen Behörde (Zulassungsbehörde)<br />
zum Verkehr zugelassen sein.<br />
2.1 Öffentlicher Verkehrsraum<br />
Definition<br />
Öffentlich i.S.d. Straßenverkehrsrechts sind zum einen alle nach dem<br />
Wegerecht des Bundes und der Länder dem allgemeinen Verkehr gewidmeten<br />
Straßen, Wege und Plätze (= öffentlich-rechtlicher Verkehrsraum);<br />
zum anderen gehören auch die Verkehrsflächen dazu, auf denen<br />
- 101 -
Prüfungsschema<br />
ohne Rücksicht auf eine verwaltungsrechtliche Widmung oder auf die<br />
Eigentumsverhältnisse (Privatgrundstück) auf Grund ausdrücklicher o-<br />
der stillschweigender Duldung des Verfügungsberechtigten die Benutzung<br />
durch einen unbestimmten Personenkreis zugelassen ist [= tatsächlich-öffentlicher<br />
Verkehrsraum.<br />
Öffentlicher Verkehrsraum ist gegeben, wenn die Benutzung der in Rede<br />
stehenden Fläche zu Verkehrszwecken für jedermann oder einer<br />
allgemein bestimmten Personengruppe dauernd oder zeitweise möglich<br />
ist und auch tatsächlich und nicht nur gelegentlich von jedermann oder<br />
einer allgemein bestimmten Personengruppe benutzt wird.<br />
(B) wird im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der B 55 angehalten<br />
und überprüft. Aufgrund dieser Formulierung ist die Annahme öffentlichen Verkehrsraums<br />
hinreichend gerechtfertigt.<br />
2.2 Kraftfahrzeug<br />
Definition<br />
Als Kfz gelten Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden,<br />
ohne an Bahngleise gebunden zu sein (Legaldefinition § 1 II<br />
StVG).<br />
Bei dem in Rede stehenden Pkw handelt es sich zweifelsohne um ein Kfz.<br />
2.3 In Betrieb setzen<br />
Definition<br />
In Betrieb setzen bedeutet die bestimmungsgemäße Verwendung des<br />
Fahrzeugs als Fortbewegungsmittel. Danach ist ein Kfz in Betrieb, solange<br />
der Motor das Kfz oder eine seiner Betriebseinrichtungen bewegt.<br />
Im vorliegenden Sachverhalt lenkt (B) den Bagger unter bestimmungsgemäßer Anwendung<br />
der Antriebskräfte dieses Fahrzeugs (= in Betrieb setzen).<br />
2.4 Grundregel der Zulassung<br />
Zum Verkehr auf öffentlichen Straßen sind gemäß § 16 I StVZO alle Fahrzeuge zugelassen,<br />
die den Vorschriften der StVZO und der StVO entsprechen, sofern nicht für<br />
die Zulassung einzelner Fahrzeugarten ein Erlaubnisverfahren vorgeschrieben ist.<br />
Dieser Grundsatz der allgemeinen Verkehrsfreiheit wird jedoch durch die Vorschriften<br />
der FZV eingeschränkt.<br />
- 102 -
Prüfungsschema<br />
2.5 Erlaubnis- und Ausweispflicht<br />
Inwieweit zur Inbetriebsetzung eines Fahrzeugs eine Zulassung erforderlich ist, ergibt<br />
sich aus § 1 I StVG und den ihn ausführenden Vorschriften der §§ 1, 3, 4 FZV.<br />
Wer ein Kfz ohne die erforderliche Zulassung in Betrieb setzt, führt es entgegen den<br />
Bestimmungen des § 3 I Satz 1 FZV. Wer ein zulassungsfreies Fahrzeug ohne Einhaltung<br />
der jeweiligen Bedingungen in Betrieb setzt, führt es entgegen § 4 I FZV.<br />
3. Ausnahmen von der Zulassungspflicht<br />
Gemäß § 1 FZV ist diese Verordnung auf Kfz mit einer BbH ≤ 6 km/h und ihre Anhänger<br />
nicht anzuwenden. Lediglich „schnellere“ Fahrzeuge unterliegen nach näherer<br />
Maßgabe der §§ 3 und 4 FZV dem Zulassungsverfahren. Der hier in Rede stehende<br />
Bagger allerdings unterliegt grundsätzlich dem Zulassungsverfahren.<br />
4. Zulassungsrechtliche Bestimmung<br />
Im vorliegenden Fall könnte jedoch der Ausnahmetatbestand des § 3 II Nr. 1 lit. a)<br />
FZV gegeben sein.<br />
Dazu müsste es sich bei dem Bagger um eine selbstfahrende Arbeitsmaschine handeln.<br />
Nach der Legaldefinition des § 2 Nr. 17 FZV sind das Kfz, die nach ihrer Bauart und<br />
ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen zur Verrichtung<br />
von Arbeiten, nicht jedoch zur Beförderung von Personen oder Gütern bestimmt<br />
und geeignet sind.<br />
Nach der – allerdings heute nicht mehr fortgeführten - Dienstanweisung des BMV zu<br />
§ 18 II StVZO-alt (= Liste der anerkannten SAM) sind Bagger als SAM anerkannt 1 .<br />
Dazu zählt auch der hier verwendete Schaufellader.<br />
SAM auf Räder zum Laden und Transportieren von Gütern über kurze Strecken.<br />
Frontseitig ist ein Anbaugerät an einem beweglichen Arm angebracht, welches für<br />
das Schaufelladen oder Ausgraben durch eine Vorwärtsbewegung der Maschine<br />
konstruiert wurde.<br />
5. Mitführ- und Aushändigungspflicht der Zulassungsbescheinigung<br />
Entsprechend den Bestimmungen des § 4 V FZV ist beim Einsatz zulassungsfreier<br />
selbstfahrender Arbeitsmaschinen die Bescheinigung über die Einzelgenehmigung<br />
mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen. Bei dieser<br />
Einzelgenehmigung handelt es sich um eine Betriebserlaubnis (§ 2 Nr. 6 FZV).<br />
1 Nr. 4 der genannten Liste (VkBl. 1986, 40); abgedr. bei Braun/Konitzer/Wehrmeister, a.a.O.,<br />
DA zu § 18 II StVZO-alt.<br />
- 103 -
Prüfungsschema<br />
Hinweis<br />
Wird die Betriebserlaubnis nicht mitgeführt oder zuständigen Personen<br />
auf Verlangen nicht zur Prüfung ausgehändigt, begeht der Kraftfahrzeugführer<br />
lediglich eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 4 V FZV i.V.m. §<br />
48 Nr. 5 i.V.m. § 24 StVG (BKat Nr. 174; TBNR 804100 bzw. 804106;<br />
VG 10,- €); die Zulassung bzw. Zulassungsfreiheit selbst bleibt unangetastet.<br />
Dieser Verpflichtung ist (B) nachgekommen.<br />
6. Besonderheiten<br />
Fraglich ist jedoch, ob der Bagger auch tatsächlich zweckentsprechend als SAM eingesetzt<br />
wurde.<br />
Mit der Eigenschaft als SAM ist vereinbar, dass die zur Verrichtung der Arbeit erforderlichen<br />
Begleitpersonen und Arbeitsgeräte sowie Hilfsmittel für die SAM mitgeführt<br />
werden 2 . Jedoch muss der Arbeits- und nicht der Transportzweck im Vordergrund<br />
stehen. Erfolgt jedoch eine Beförderung von Gütern, ist die Zulassungsfreiheit verwirkt.<br />
Die SAM wird dann begrifflich zur Zugmaschine 3 .<br />
So verhält es sich im vorliegenden Fall. Mindestens die mitgeführten Bierkästen, Aktentaschen<br />
und Campingstühle sind nicht zur Verrichtung der Arbeit erforderlich.<br />
Damit aber ist der Bagger nicht mehr länger als SAM anzusehen. Damit einher geht<br />
der Verlust der Zulassungsfreiheit.<br />
7. Zwischenergebnis<br />
(B) ist somit nicht im Besitz der erforderlichen Zulassung.<br />
8. Ordnungswidriges Verhalten des (B) nach § 3 I FZV<br />
8.1 Obersatz<br />
Aus der Vorprüfung ergibt sich, dass (B) im Verdacht steht, durch die zweckentfremdete<br />
Inbetriebsetzung des Baggers ohne die erforderliche Zulassung gegen § 3 I<br />
FZV verstoßen zu haben.<br />
2<br />
3<br />
JAGOW, Rn. 10 zu § 2 FZV.<br />
MINDORF, Kap. 6.2, S. 35.<br />
- 104 -
Prüfungsschema<br />
8.2 Objektiver Tatbestand<br />
Danach handelt ordnungswidrig, wer fahrlässig oder vorsätzlich entgegen § 3 I Satz<br />
1 FZV im öffentlichen Straßenverkehr ein Fahrzeug ohne die erforderliche Zulassung<br />
in Betrieb setzt.<br />
Die einschlägigen Tatbestandsmerkmale wurden bereits sämtlich mit folgendem Ergebnis<br />
geprüft:<br />
(B) hat gegen § 3 I FZV verstoßen.<br />
8.3 Schlusssatz (Ergebnis)<br />
Somit hat (B) eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 3 I FZV i.V.m. § 48 Nr. 1a FZV i.V.m. §<br />
24 StVG begangen.<br />
- 105 -
Prüfungsschema<br />
21 Prüfungsschema für zulassungsrechtliche Sachverhalte<br />
Sachverhalt: Der Pferdeanhänger<br />
Die T ist Eigentümerin eines Pferdetransportanhängers, der als solcher<br />
zulassungsfrei ist. Am heutigen Tag hatte sie Möbel zu transportieren. Weil nicht alle<br />
Möbel in einen LKW passten, ließ T eine Couch in den Pferdetransporter laden,<br />
hängte diesen an ihren Pkw Mercedes und fuhr die Fahrzeugkombination nach<br />
Hause 1 .<br />
T händigt den einschreitenden Polizeibeamten die in der Anlage beigefügten<br />
„Papiere“ aus.<br />
1. Vorprüfung<br />
Fraglich ist, ob die in Rede stehende Fahrzeugkombination ordnungsgemäß in<br />
Betrieb gesetzt wurde.<br />
2. Grundsatz der Zulassungspflicht<br />
Gemäß § 1 I StVG müssen Kfz und ihre Anhänger (2.2) , die auf öffentlichen Straßen (2.1)<br />
in Betrieb gesetzt (2.3) werden sollen, von der zuständigen Behörde<br />
(Zulassungsbehörde) zum Verkehr zugelassen sein.<br />
1<br />
Der Sachverhalt ist der Entscheidung des OLG Stuttgart VRS 75, 368 (= NZV 1988, 190)<br />
nachempfunden.<br />
- 106 -
Prüfungsschema<br />
2.1 Öffentlicher Verkehrsraum<br />
Definition<br />
Öffentlich i.S.d. Straßenverkehrsrechts sind zum einen alle nach dem<br />
Wegerecht des Bundes und der Länder dem allgemeinen Verkehr<br />
gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (= öffentlich-rechtlicher<br />
Verkehrsraum); zum anderen gehören auch die Verkehrsflächen dazu,<br />
auf denen ohne Rücksicht auf eine verwaltungsrechtliche Widmung oder<br />
auf die Eigentumsverhältnisse (Privatgrundstück) auf Grund ausdrücklicher<br />
oder stillschweigender Duldung des Verfügungsberechtigten<br />
die Benutzung durch einen unbestimmten Personenkreis zugelassen ist<br />
[= tatsächlich-öffentlicher Verkehrsraum.<br />
Öffentlicher Verkehrsraum ist gegeben, wenn die Benutzung der in<br />
Rede stehenden Fläche zu Verkehrszwecken für jedermann oder einer<br />
allgemein bestimmten Personengruppe dauernd oder zeitweise möglich<br />
ist und auch tatsächlich und nicht nur gelegentlich von jedermann oder<br />
einer allgemein bestimmten Personengruppe benutzt wird.<br />
(T) wird im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der B 55 angehalten<br />
und überprüft. Aufgrund dieser Formulierung ist die Annahme öffentlichen<br />
Verkehrsraums hinreichend gerechtfertigt.<br />
2.2 Kraftfahrzeug<br />
Definition<br />
Als Kfz gelten Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt<br />
werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein (Legaldefinition § 1 II<br />
StVG).<br />
Bei dem in Rede stehenden Pkw handelt es sich zweifelsohne um ein Kfz.<br />
Definition<br />
Als Anhänger gelten Landfahrzeuge, die zum Anhängen an ein Kfz<br />
bestimmt und geeignet sind (Legaldefinition § 2 Nr. 2 FZV).<br />
Bei dem in Rede stehenden Pferdeanhänger handelt es sich zweifelsohne um einen<br />
Anhänger.<br />
2.3 In Betrieb setzen<br />
Definition<br />
In Betrieb setzen bedeutet die bestimmungsgemäße Verwendung des<br />
Fahrzeugs als Fortbewegungsmittel. Danach ist ein Kfz in Betrieb,<br />
solange der Motor das Kfz oder eine seiner Betriebseinrichtungen<br />
bewegt.<br />
Im vorliegenden Sachverhalt lenkt (T) die Fahrzeugkombination unter<br />
bestimmungsgemäßer Anwendung der Antriebskräfte des Pkw (= in Betrieb setzen).<br />
- 107 -
Prüfungsschema<br />
2.4 Grundregel der Zulassung<br />
Zum Verkehr auf öffentlichen Straßen sind gemäß § 16 I StVZO alle Fahrzeuge<br />
zugelassen, die den Vorschriften der StVZO und der StVO entsprechen, sofern nicht<br />
für die Zulassung einzelner Fahrzeugarten ein Erlaubnisverfahren vorgeschrieben ist.<br />
Dieser Grundsatz der allgemeinen Verkehrsfreiheit wird jedoch durch die Vorschriften<br />
der FZV eingeschränkt.<br />
2.5 Erlaubnis- und Ausweispflicht<br />
Inwieweit zur Inbetriebsetzung eines Fahrzeugs eine Zulassung erforderlich ist, ergibt<br />
sich aus § 1 I StVG und den ihn ausführenden Vorschriften der §§ 1, 3, 4 FZV.<br />
Wer ein Kfz ohne die erforderliche Zulassung in Betrieb setzt, führt es entgegen den<br />
Bestimmungen des § 3 I Satz 1 FZV.<br />
3. Ausnahmen von der Zulassungspflicht<br />
Gemäß § 1 FZV ist diese Verordnung auf Kfz mit einer BbH ≤ 6 km/h und ihre<br />
Anhänger nicht anzuwenden. Lediglich „schnellere“ Fahrzeuge unterliegen nach<br />
näherer Maßgabe der §§ 3 und 4 FZV dem Zulassungsverfahren. Der hier in Rede<br />
stehende Pkw und auch der mitgeführte Anhänger allerdings unterliegen<br />
grundsätzlich dem Zulassungsverfahren.<br />
Dazu ist zunächst festzustellen, dass der Pkw ausweislich der mitgeführten<br />
Zulassungsbescheinigung ordnungsgemäß zugelassen ist.<br />
Der mitgeführte Pferdeanhänger ist allerdings zulassungsfrei. Das gilt auch, obwohl<br />
er über ein amtliches Kennzeichen verfügt und eine Zulassungsbescheinigung<br />
ausgestellt wurde. Aus dieser geht jedoch hervor, dass es sich um einen<br />
zulassungsfreien Spezialanhänger zur Beförderung von Tieren für Sportzwecken<br />
handelt.<br />
4. Zulassungsrechtliche Bestimmung<br />
Im vorliegenden Fall könnte also der Ausnahmetatbestand des § 3 II Nr. 1 lit. e) FZV<br />
gegeben sein.<br />
- 108 -
Prüfungsschema<br />
5. Mitführ- und Aushändigungspflicht der Zulassungsbescheinigung<br />
Entsprechend den Bestimmungen des § 4 I FZV ist beim Einsatz zulassungsfreier<br />
Sportanhänger die Bescheinigung über die Typgenehmigung bzw. die<br />
Einzelgenehmigung mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen<br />
auszuhändigen. Das wird im Falle der Sportanhänger durch die<br />
Zulassungsbescheinigung bewirkt.<br />
Hinweis<br />
Wird die Zulassungsbescheinigung nicht mitgeführt oder zuständigen<br />
Personen auf Verlangen nicht zur Prüfung ausgehändigt, begeht der<br />
Kraftfahrzeugführer lediglich eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 11 V FZV<br />
i.V.m. § 48 Nr. 5 i.V.m. § 24 StVG (BKat Nr. 174; TBNR 804100 bzw.<br />
804106; VG 10,- €); die Zulassung bzw. Zulassungsfreiheit selbst bleibt<br />
unangetastet.<br />
Dieser Verpflichtung ist (T) nachgekommen.<br />
6. Besonderheiten<br />
Fraglich ist jedoch, ob der Sportanhänger auch tatsächlich zweckentsprechend<br />
eingesetzt wurde. Gemäß § 3 II Nr. 2 lit. e) FZV sind die Spezialanhänger zur<br />
Beförderung von Tieren für Sportzwecke nämlich nur dann vom Zulassungsverfahren<br />
ausgenommen, wenn die Anhänger ausschließlich für solche Beförderungen<br />
verwendet werden.<br />
Nach der im Ausgangsfall zitierten nunmehr überholten Entscheidung des OLG<br />
Stuttgart 2 über die Verwendung zulassungsfreier Sportanhänger wurde der Text des<br />
damaligen § 18 II Nr. 6 lit. m) StVZO-alt geändert. In seiner Begründung 3 weist der<br />
Verordnungsgeber ausdrücklich darauf hin, dass eine missbräuchliche Verwendung<br />
der Spezialanhänger nicht ausgeschlossen werden kann. Eine Ausnahme vom<br />
Zulassungsverfahren sei jedoch nur gerechtfertigt, wenn die Spezialanhänger<br />
ausschließlich für ihren eigentlichen Zweck eingesetzt werden.<br />
Daraus folgt, dass Beförderungsgut und Zweckbindung immer zusammen betrachtet<br />
werden müssen (vulgo: sie hätte wenigstens in Pferd transportieren müssen).<br />
So liegt der Fall auch hier: in dem Sportanhänger wurden Möbel für einen Umzug<br />
transportiert. Diese Art der Verwendung des Anhängers steht jedoch der<br />
Zweckbindung der hier privilegierten Beförderung entgegen.<br />
7. Zwischenergebnis<br />
(T) ist somit nicht im Besitz der erforderlichen Zulassung.<br />
2<br />
3<br />
VRS 75, 368 (= NZV 1988, 190).<br />
VkBl. 1989, 589.<br />
- 109 -
Prüfungsschema<br />
8. Ordnungswidriges Verhalten der (T) nach § 3 I FZV<br />
8.1 Obersatz<br />
Aus der Vorprüfung ergibt sich, dass (T) im Verdacht steht, durch die<br />
zweckentfremdete Inbetriebsetzung des Sportanhängers ohne die erforderliche<br />
Zulassung gegen § 3 I FZV verstoßen zu haben.<br />
8.2 Objektiver Tatbestand<br />
Danach handelt ordnungswidrig, wer fahrlässig oder vorsätzlich entgegen § 3 I Satz<br />
1 FZV im öffentlichen Straßenverkehr ein Fahrzeug ohne die erforderliche Zulassung<br />
in Betrieb setzt.<br />
Die einschlägigen Tatbestandsmerkmale wurden bereits sämtlich mit folgendem<br />
Ergebnis geprüft:<br />
(T) hat gegen § 3 I FZV verstoßen.<br />
8.3 Schlusssatz (Ergebnis)<br />
Somit hat (T) eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 3 I FZV i.V.m. § 48 Nr. 1a FZV i.V.m. §<br />
24 StVG begangen.<br />
- 110 -
Definitionen<br />
22 Definitionen für Zulassungsrecht<br />
Begriff 1 Abkürzung 2 Definition<br />
Abschleppen<br />
Anhänger<br />
Anschleppen<br />
Arbeitsgeräte, lof*<br />
Bauart bestimmte<br />
Höchstgeschwindigkeit<br />
BbH<br />
Ist das Verbringen eines betriebsunfähigen oder<br />
zumindest in seiner Betriebssicherheit beeinträchtigten<br />
Fahrzeug zu einem möglichst nahe gelegenen<br />
Bestimmungsort (alte Regelung nach der<br />
StVZO!)<br />
Zum Anhängen an ein Kfz bestimmte und geeignete<br />
Fahrzeuge (Legaldefinition des § 2 Nr. 2 FZV)<br />
Ist eine besondere Art des Abschleppens, wobei<br />
der nicht anspringende Motor die Betriebsunfähigkeit<br />
verursacht hat; das Ziehen des Kfz dem Zweck<br />
dient, dieses wieder betriebsfähig zu machen; aus<br />
diesem Grund ist das angehängte Kfz rechtlich<br />
bereits als solches in Betrieb (es wird geführt); Zulassung<br />
und Fahrerlaubnis erforderlich (alte Regelung<br />
nach der StVZO)<br />
Geräte zum Einsatz in der Land- oder Forstwirtschaft,<br />
die dazu bestimmt sind, von einer Zugmaschine<br />
gezogen zu werden und die die Funktion<br />
der Zugmaschine verändern oder erweitern …<br />
(Legaldefinition § 2 Nr. 20 FZV)<br />
Ist die Geschwindigkeit, die von einem Kfz nach<br />
seiner Bauart auf ebener Bahn bei bestimmungsgemäßer<br />
Benutzung nicht überschritten werden<br />
kann (Legaldefinition des § 30a I StVZO)<br />
Betriebserlaubnis BE Ist die behördliche Bestätigung, dass das betreffende<br />
Fahrzeug den geltenden Bauvorschriften<br />
entspricht<br />
(vgl. nationale Typgenehmigung)<br />
Certificate of COC Übereinstimmungserklärung (= technische Datenbasis<br />
Confirmity * der harmonisierten Zulassungsdokumente)<br />
Datenbestätigung*<br />
Die vom Inhaber einer nationalen Typgenehmigung<br />
für Fahrzeuge ausgestellte Bescheinigung,<br />
1<br />
2<br />
Hier sind alle im Definitionskalender aufgeführten fahrerlaubnisrechtlichen Definitionen wieder gegeben.<br />
Weitere dort nicht enthaltene Definitionen sind mit (*) gekennzeichnet.<br />
In z.B. Klausuren oder Hausarbeiten ist lediglich die Verwendung der hier wieder gegebenen Abkürzungen<br />
zulässig.<br />
- 111 -
Definitionen<br />
dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt seiner Herstellung<br />
dem genehmigten Typ und den ausgewiesenen<br />
Angaben über die Beschaffenheit entspricht<br />
(Legaldefinition § 2 Nr. 8 FZV)<br />
EG - Typgenehmigung<br />
Ist die von einem Mitgliedstaat erteilte Bestätigung,<br />
dass der zur Prüfung vorgestellte Typ eines Fahrzeugs<br />
die einschlägigen Vorschriften und technischen<br />
Anforderungen erfüllt<br />
Einzelgenehmigung* EBE Die behördliche Bestätigung, dass der zur Prüfung<br />
vorgestellte Typ eines Fahrzeugs, eines Systems,<br />
eines Bauteils oder einer selbständigen technischen<br />
Einheit den geltenden Bauvorschriften entspricht;<br />
sie ist eine Betriebserlaubnis i.S.d. StVZO<br />
(Legaldefinition § 2 Nr. 6 FZV)<br />
Fahrrad<br />
Fahrrad mit Hilfsmotor<br />
FmH<br />
Fahrzeug mit mindestens zwei Rädern, die durch<br />
die Muskelkraft des Fahrers oder der Fahrer mit<br />
Hilfe von Pedalen oder Handkurbeln angetrieben<br />
werden<br />
Krafträder (= Zweiräder; auch mit Beiwagen) mit<br />
einer bbH von nicht mehr als 45 km/h und einer<br />
elektrischen Antriebsmaschine oder einem Verbrennungsmotor<br />
mit einem Hubraum von nicht<br />
mehr als 50 ccm, die zusätzlich hinsichtlich der<br />
Gebrauchsfähigkeit die Merkmale von Fahrrädern<br />
aufweisen (Legaldefinitionen § 6 FeV)<br />
Fahrzeug Fzg Kfz und ihre Anhänger (Legaldefinition aus § 2 Nr.<br />
3 FZV)<br />
Jedes Landfahrgerät, das der Fortbewegung auf<br />
dem Boden dient, außer den in § 24 StVO genannten<br />
besonderen Fortbewegungsmitteln.<br />
Fahrzeughalter<br />
Fahrzeugkombination<br />
Flurförderzeuge<br />
Derjenige, der die tatsächliche Verfügungsgewalt<br />
über das Fahrzeug hat, es für eigene Rechnung<br />
gebraucht und für die Unterhaltskosten aufkommt<br />
Kfz mit Anhänger<br />
Sind nach einschlägigen Richtlinien und Unfallverhütungsvorschriften<br />
der Industrie Fördermittel, die<br />
nach ihrer Bauart dadurch gekennzeichnet sind,<br />
dass sie mit Rädern auf Flur laufen und frei lenkbar,<br />
zum Befördern, Ziehen oder Schieben von<br />
Lasten eingerichtet und zur innerbetrieblichen<br />
Verwendung bestimmt sind. Bei Flurförderzeugen<br />
- 112 -
Definitionen<br />
handelt es sich um Drei- oder Vierradfahrzeuge mit<br />
Hand- oder Motorbetrieb; Antrieb durch Elektro-,<br />
Diesel- oder Ottomotor. Flurfördermittel gibt es für<br />
Fahrerbegleitung oder mit Fahrerstand oder –sitz,<br />
mittels Kabel und / oder als Schaltsteuerung von<br />
Flur aus. Damit ist klargestellt, dass auch Geh-<br />
Hubwagen mit Motorbetrieb Flurförderzeuge darstellen<br />
(= Mitgänger – Flurförderzeuge).<br />
Fortbewegungsmittel<br />
Gespann<br />
Giga - Liner<br />
Schiebe- und Greifreifenrollstühle, Rodelschlitten,<br />
Kinderwagen, Roller, Kinderfahrräder und ähnliche<br />
nicht motorisierte Fortbewegungsmittel sind nicht<br />
Fahrzeuge i. S. d. StVO; dazu zählen auch Inline-<br />
Skates, Skateboards, Kickboards und Rollschuhe<br />
(§ 24 I StVO; § 16 StVZO)<br />
Bespanntes Fuhrwerk<br />
Lkw mit Anhänger bis zu einer Länge von 25,25 m<br />
und einer zulässigen Zuladung von 44 t.<br />
Kleinkraftrad KKR Kleinkrafträder KKR, auch Mokick genannt, sind<br />
Krafträder (= Zweiräder; auch mit Beiwagen) mit<br />
einer BbH von nicht mehr als 45 km/h und einer<br />
elektrischen Antriebsmaschine oder einem Verbrennungsmotor<br />
mit einem Hubraum von nicht<br />
mehr als 50 ccm (Legaldefinitionen § 6 FeV; § 2<br />
Nr. 11 a FZV); Dreirädrige Kleinkrafträder sind<br />
dreirädrige Kfz mit einer BbH von nicht mehr als 45<br />
km/h und einer elektrischen Antriebsmaschine o-<br />
der einem Verbrennungsmotor mit einem Hubraum<br />
von nicht mehr als 50 ccm (§ 2 Nr. 11 b FZV).<br />
Kraftfahrzeug Kfz (§ 1 Abs. 2 StVG) Kfz ist ein Landfahrzeug, das<br />
durch Maschinenkraft angetrieben wird ohne an<br />
Schienen gebunden zu sein. – Nicht dauerhaft<br />
spurgeführte Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft<br />
bewegt werden (§ 2 Nr.1 FZV).<br />
Kraftomnibus KOM Unter einem KOM versteht man Kfz mit mindestens<br />
vier Rädern, die zur Beförderung von Personen<br />
ausgelegt und gebaut sind, mit mehr als 8<br />
Sitzplätzen außer dem Fahrersitz (§ 2 Nr. 12 FZV).<br />
Kraftrad<br />
Krankenfahrstuhl<br />
Zweirädrige Kfz, auch mit Beiwagen, mit einem<br />
Hubraum von mehr als 50 cm³ im Falle von Verbrennungsmotoren<br />
oder mit einer bbH von mehr<br />
als 45 km/h (§ 2 Nr. 9 FZV).<br />
einsitzige, nach der Bauart zum Gebrauch durch<br />
körperlich behinderte Personen bestimmte Kfz mit<br />
- 113 -
Definitionen<br />
Elektroantrieb, einer Leermasse von nicht mehr als<br />
300 kg einschließlich Batterien aber ohne Fahrer,<br />
einer zGM von nicht mehr als 500 kg, einer bbH<br />
von nicht mehr als 15 km/h, einer Breite über alles<br />
von maximal 110 cm (Legaldefinition § 2 Nr. 13<br />
FZV)<br />
Lastkraftwagen Lkw Unter einem Lkw versteht man einen Kraftwagen,<br />
der unabhängig vom zulässigen Gesamtgewicht<br />
und der Anzahl der Räder nach Bauart und Einrichtung<br />
zur Güterbeförderung bestimmt ist<br />
Leichtkraftrad LKR … sind Krafträder (= Zweiräder; auch mit Beiwagen)<br />
mit einer elektrischen Antriebsmaschine mit<br />
einer Nennleistung von nicht mehr als 11 kW oder<br />
einem Verbrennungsmotor mit einer Nennleistung<br />
von nicht mehr als 11 kW und einem Hubraum von<br />
nicht mehr als 125 ccm, 26 – 28 Zoll Räder (Legaldefinitionen<br />
§ 6 I FeV); als technische Voraussetzung<br />
i. S. d. FZV haben sie mehr als 50 ccm,<br />
aber nicht mehr als 125 ccm (§ 2 Nr. 10 FZV).<br />
Leichtmofa<br />
Land- oder Forstwirtschaft<br />
Mofa<br />
Lof<br />
Kfz, das einerseits die Merkmale eines Fahrrades,<br />
andererseits diejenigen eines Mofas (= einspurig,<br />
einsitzig) aufweist; die wesentlichen technischen<br />
Merkmale sind: Leermasse max. 30 kg, Hubraum<br />
max. 30 ccm Leistung max. 0,5 kW und BbH max.<br />
20 km/h ( § 1 Leichtmofa-AusnahmeVO); Führer<br />
muss keinen Helm tragen, aber Versicherungspflicht<br />
über die land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften<br />
entnommen Ein Kfz, insbesondere<br />
Zugmaschine, ist nur dann für lof – Zwecke Bauart<br />
bestimmt, wenn es technisch erkennbar für den<br />
besonderen lof – Zweck ausgerüstet ist. Das können<br />
Vorrichtungen sein, die zusätzlich zur Zugmaschine<br />
besondere lof – Arbeitsfunktionen ermöglichen,<br />
z. B.: Anbaumöglichkeit für Frontlader und<br />
Arbeitsgeräte, Seilwinden, Hydraulikheber, Zapfwellen;<br />
die Kriterien für die Beschreibung der lof -<br />
Zwecke sind im wesentlichen den Bestimmungen<br />
worden; was unter lof - Zweck zu verstehen ist, ist<br />
in § 6 V FeV abschließend geregelt (siehe dort).<br />
Sind einspurige, einsitzige FmH – auch mit Tretkurbel<br />
– oder KKR , wenn ihre Bauart Gewähr dafür<br />
bietet, dass die Höchstgeschwindigkeit auf<br />
ebener Bahn nicht mehr als 25 km/h beträgt (Legaldefinition<br />
des § 4 I Satz 2 Nr. 1 FeV).<br />
- 114 -
Definitionen<br />
Oldtimer<br />
Öffentlicher Straßenverkehr<br />
Fahrzeuge, die vor 30 Jahren oder eher erstmals<br />
in Verkehr gekommen sind und vornehmlich zur<br />
Pflege des kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes<br />
eingesetzt werden (§ 2 Nr. 22 FZV).<br />
Öffentlich i. S. d. Straßenverkehrsrechts sind zum<br />
einen alle nach dem Wegerecht des Bundes und<br />
der Länder dem allgemeinen Verkehr gewidmeten<br />
Straßen, Wege und Plätze (= öffentlich-rechtlicher<br />
Verkehrsraum); zum anderen gehören auch die<br />
Verkehrsflächen dazu, auf denen ohne Rücksicht<br />
auf eine verwaltungsrechtliche Widmung oder auf<br />
die Eigentumsverhältnisse (Privatgrundstück) auf<br />
Grund ausdrücklicher oder stillschweigender Duldung<br />
des Verfügungsberechtigten die Benutzung<br />
durch einen unbestimmten Personenkreis zugelassen<br />
ist (= tatsächlich-öffentlicher Verkehrsraum)<br />
und auch tatsächlich genutzt wird.<br />
Personenkraftwagen Pkw … sind Kraftfahrzeuge mit mindestens vier Rädern,<br />
die zur Personenbeförderung ausgelegt und gebaut<br />
sind, mit nicht mehr als 8 Sitzplätzen ohne<br />
Fahrersitz.<br />
Probefahrt<br />
Prüfungsfahrt<br />
Quads<br />
Sattelkraftfahrzeug<br />
Die Fahrt zur Feststellung und zum Nachweis der<br />
Gebrauchsfähigkeit des Fahrzeuges (§ 2 Nr. 23<br />
FZV)<br />
Die Fahrt zur Prüfung des Fahrzeuges durch einen<br />
amtlich anerkannten Sachverständigen, Prüfer für<br />
den Kraftfahrzeugverkehr oder Prüfingenieur sowie<br />
die Verbringung des Fahrzeug zum Prüfungsort<br />
und zurück (§ 2 Nr. 24 FZV).<br />
Sind kraftradähnliche Vierradfahrzeuge, also offene<br />
Kfz mit zweispuriger Vorder- und Hinterachse<br />
Sind Fahrzeugkombinationen bestehend aus einer<br />
Zugmaschine und einem Anhänger. Beide Komponenten<br />
müssen getrennt voneinander zugelassen<br />
sein<br />
Sattelzugmaschine Zugmaschinen für Sattelanhänger (§ 2 Nr. 15<br />
FZV).<br />
Sattelanhänger<br />
Schleppen<br />
Anhänger, die so mit einem Kfz verbunden sind,<br />
dass sie teilweise auf diesem aufliegen und ein<br />
wesentlicher Teil ihres Gewichts oder ihrer Ladung<br />
vom Zugfahrzeug getragen wird (§ 2 Nr. 19 FZV).<br />
Ist das Betreiben eines Fahrzeugs mit den bauli-<br />
- 115 -
Definitionen<br />
Selbstfahrende Arbeitsmaschine<br />
Sitzkarren*<br />
Stapler<br />
Typgenehmigung,<br />
nationale*<br />
Übereinstimmungsbescheinigung*<br />
Überführungsfahrt<br />
VB-Nummer<br />
Vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge<br />
SAM<br />
chen Merkmalen eines Kfz hinter einem Kfz als<br />
Anhänger, wobei entweder das mitgeführte Fahrzeug<br />
betriebsfähig ist oder über den Rahmen des<br />
Notbehelfs hinaus mitgeführt wird (vgl. § 33<br />
StVZO).<br />
SAM sind Kfz, die nach ihrer Bauart und ihren besonderen,<br />
mit dem Fahrzeug fest verbundenen<br />
Einrichtungen zur Verrichtung von Arbeiten, jedoch<br />
nicht zur Beförderung von Personen und Gütern<br />
bestimmt und geeignet sind (§ 2 Nr. 17 FZV)<br />
Einachsige Anhänger, die nach ihrer Bauart nur<br />
bestimmt und geeignet sind, einer Person das Führen<br />
einer einachsigen Zug- oder Arbeitsmaschine<br />
von einem Sitz aus zu ermöglichen (Legaldefinition<br />
§ 2 Nr. 21 FZV)<br />
Kfz, die nach ihrer Bauart für das Aufnehmen, Heben,<br />
Bewegen und Positionieren von Lasten bestimmte<br />
und geeignet sind (§ 2 Nr. 18 FZV).<br />
Die behördliche Bestätigung, dass der zur Prüfung<br />
vorgestellte Typ eines Fahrzeugs, eines Systems,<br />
eines Bauteils oder einer selbständigen technischen<br />
Einheit den geltenden Bauvorschriften entspricht;<br />
sie ist eine Betriebserlaubnis i.S.d. StVZO<br />
(Legaldefinition § 2 Nr. 5 FZV)<br />
Die vom Hersteller ausgestellte Bescheinigung,<br />
dass ein Fahrzeug, ein System, ein Bauteil oder<br />
eine selbständige technische Einheit zum Zeitpunkt<br />
seiner/ihrer Herstellung einem nach der jeweiligen<br />
EG-Typgenehmigungsrichtlinie genehmigten<br />
Typ entspricht (Legaldefinition § 2 Nr. 7 FZV)<br />
Die Fahrt zur Überführung des Fahrzeuges an einen<br />
anderen Ort (§ 2 Nr. 25 FZV).<br />
Versicherungsbestätigungs-Nummer – diese wird<br />
seit dem 01.03.2008 einem Kunden mitgeteilt,<br />
wenn er ein Fahrzeug bei der Zulassungsstelle anoder<br />
ummelden möchte; sie ersetzt die Versicherungsbestätigung<br />
bzw. die frühere Versicherungsdoppelkarte;<br />
sie besteht aus sieben Zahlen und<br />
Buchstaben<br />
Vierrädrige Kfz mit einer Leermasse bis zu 350 kg,<br />
ohne Masse der Batterien im Falle von Elektrofahrzeugen,<br />
mit einer bbH von bis zu 45 km/h und<br />
einem Hubraum für Fremdzündungsmotoren von<br />
- 116 -
Definitionen<br />
bis zu 50 cm³, bzw. einer maximalen Nennleistung<br />
von bis zu 4 kW für andere Motortypen (§ 2 Nr. 12<br />
FZV)<br />
Wohnmobile<br />
Sind Kfz mit Einrichtungen für Wohnzwecke; der<br />
Wohnteil muss mit seinen Einrichtungen dazu geeignet<br />
sein, einer oder mehreren Personen einen<br />
Wohnaufenthalt zu ermöglichen; statt des Begriffs<br />
Wohnmobil werden von den Fahrzeugherstellern<br />
auch andere Bezeichnungen verwendet, wie: Motorcaravan,<br />
Campingbus, Reisemobil u. a.; sie<br />
werden im Fahrzeugschein als SonderKfz Wohnmobil<br />
ausgewiesen<br />
Zugmaschinen ZM Kfz, die überwiegend zum Ziehen von Anhängern<br />
bestimmt und geeignet sind (§ 2 Nr.14 FZV)<br />
Zugmaschinen (einachsig)<br />
Zugmaschine, lof*<br />
Zulassungsbescheinigung<br />
Sind Kfz, die die Gebrauchsmerkmale von Zugmaschinen<br />
aufweisen; die in der Land- und Forstwirtschaft<br />
gebräuchlichen einachsigen Universalgeräte,<br />
die sowohl dazu bestimmt sind, Anhänger<br />
( Sitzkarren, Arbeitsgeräte, lof – Anhänger zur Güterbeförderung<br />
) zu ziehen, wie auch den Anbau<br />
von Arbeitsgeräten wie z. B. Mähbalken, Eggen,<br />
Pflüge, Kartoffelroder zu ermöglichen, gelten als<br />
Zugmaschinen, denn sie sind nicht ausschließlich<br />
zur Leistung von Arbeit bestimmt<br />
Kfz, deren Funktion im Wesentlichen in der Erzeugung<br />
einer Zugkraft besteht und die besonders<br />
zum Ziehen, Schieben, Tragen und zum Antrieb<br />
von auswechselbaren Geräten für lof-Arbeiten oder<br />
zum Ziehen von Anhängern in lof-Betrieben bestimmt<br />
und geeignet sind, auch wenn sie zum<br />
Transport von Lasten im Zusammenhang mit lof-<br />
Arbeiten eingerichtet oder mit Beifahrersitzen ausgestattet<br />
sind (Legaldefinition § 2 Nr. 16 FZV)<br />
Dokument, mit dem die Zulassung eines Fahrzeuges<br />
behördlich bescheinigt wird; die deutsche Zulassungsbescheinigung<br />
besteht aus zwei Teilen:<br />
Zulassungsbescheinigung Teil I – ZB I (Fahrzeugschein)<br />
und Zulassungsbescheinigung Teil II – ZB<br />
II (Fahrzeugbrief)<br />
- 117 -
Modulbeschreibung<br />
23 Modulbeschreibung<br />
Modulgruppe FM 3 <strong>Verkehrssicherheitsarbeit</strong> (VSA)<br />
Modul VS 3<br />
Modulkoordination<br />
Herr <strong>Bernd</strong> <strong>Huppertz</strong><br />
Teilnahme von Personen und Fahrzeugen am Straßenverkehr<br />
Kategorie Pflichtmodul Credits 11<br />
Voraussetzungen für das<br />
Modul<br />
Das Modul VS 2 – Verkehrsunfallaufnahme – wurde erfolgreich absolviert<br />
zugehöriges<br />
Teilmodul<br />
VS 3.3<br />
Zulassung von Fahrzeugen<br />
Kompetenzziele<br />
Die Studierenden<br />
- verstehen die Rechtsvorschriften zur Teilnahme am Straßenverkehr<br />
mit Fahrzeugen,<br />
- kennen die Betriebs- und Ausrüstungsvorschriften<br />
- lösen auch schwierige zulassungsrechtliche Sachverhalte<br />
Lehr-/ Lerninhalte<br />
- Zulassungspflichtige Kfz und Anhänger<br />
- Zulassungsfreie Kfz und Anhänger<br />
- Vorübergehende Teilnahme am Straßenverkehr<br />
- Betriebserlaubnis für Fahrzeuge und -teile/Bauartgenehmigungen für<br />
Fahrzeugteile<br />
- Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />
- Pflichtversicherung und Kraftfahrzeugsteuer<br />
- Betriebs- und Ausrüstungsvorschriften<br />
Methodik des Präsenzstudiums<br />
- Mediengestützte Vorlesung<br />
- Betreute Partner- und Gruppenarbeit<br />
- Ergebnispräsentation durch die Studierenden<br />
- Fallbearbeitungen / Übungen<br />
Formen des<br />
Selbststudiums<br />
- angeleitete Internetrecherche<br />
- Literaturrecherche / -studium<br />
- Bearbeitung von Fallbeispielen<br />
- betreutes eLearning<br />
Workload 48 LVS 24<br />
18<br />
= Zeitstunden<br />
Selbststudium<br />
30<br />
- 118 -
Modulbeschreibung<br />
zugehöriges<br />
Teilmodul<br />
VS 3 T Training<br />
Kompetenzziele<br />
Die Studierenden<br />
- kontrollieren Kraftfahrzeugführer und überprüfen,<br />
ob sie im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis<br />
sind und berücksichtigen dabei Auflagen und besondere<br />
Berechtigungen zum Führen von Kfz<br />
- stellen Führerscheine sicher<br />
- sprechen Verkehrsteilnehmer in englischer Sprache<br />
an<br />
- überprüfen die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern<br />
durch die Handhabung von Atemalkoholtestgeräten,<br />
Drogenvortests und die Anordnung von Blutproben<br />
- kontrollieren Fahrzeuge und stellen zulassungsrechtliche<br />
und technische Mängel fest<br />
- grenzen bei verhaltensrechtlichen Verstößen ordnungswidriges<br />
zu strafrechtlichem Verhalten im<br />
Straßenverkehr ab<br />
- erstellen Vorgänge zu festgestellten Verkehrsstraftaten<br />
Lehr-/ Lerninhalte<br />
- Überprüfung von Führerscheinen (Fahrerlaubnisrecht)<br />
- Feststellung von Verkehrsunsicherheiten bei Verkehrsteilnehmern<br />
(z. B. vorübergehende und dauerhafte<br />
Mängel, verkehrsschwache Personen)<br />
- Feststellung von alkohol-/drogenbedingten Ausfallerscheinungen<br />
bei Verkehrsteilnehmern<br />
- Anwendung von Atemalkoholtestgeräten und Drogenvortests,<br />
Anordnung von Blutproben<br />
- Überprüfung von Fahrzeugdokumenten und Kennzeichen<br />
(Zulassungsrecht)<br />
- Feststellung von Mängeln an Fahrzeugen<br />
- Beobachtung von Verkehrsverstößen zur Differenzierung<br />
Verkehrsstraftat /Ordnungswidrigkeit<br />
- Sicherstellung von Führerscheinen<br />
- Kommunikation mit Verkehrsteilnehmern in Zusammenhang<br />
mit Verkehrsstraftaten teilweise in englischer<br />
Sprache<br />
- Fertigung von Vorgängen zur Verfolgung von Verkehrsstraftaten<br />
unter Nutzung der IT-Technik und<br />
der vorgeschriebenen Formulare<br />
Methodik des Präsenzstudiums<br />
- Rollenspiele (Sequenzen)<br />
- ganzheitliche Übungen (Vorbereitung, Aktion, Nachbereitung)<br />
- systematisches Feedback in Nachbesprechungen<br />
Formen des<br />
Selbststudiums<br />
--<br />
Workload 60 Präsenzstunden 60<br />
Umfang des<br />
Selbststudiums<br />
--<br />
- 119 -
Modulbeschreibung<br />
Zugehöriges<br />
Teilmodul<br />
VS 3 P Praxis<br />
Kompetenzziele<br />
Die Studierenden<br />
- wenden ihre in Theorie und Training erworbenen<br />
Kenntnisse und Fähigkeiten im Zusammenwirken mit<br />
einem Tutor/einer Tutorin an<br />
- bewerten bei Verkehrsüberwachungen oder leichten<br />
Verkehrsunfällen im Dialog mit dem Tutor/ der Tutorin<br />
die Zulassung von Personen oder Fahrzeugen<br />
i.S.d. Teilmodule VS 3.1 bis VS 3.4<br />
Lehr-/ Lerninhalte<br />
- Kontrolle von Personen im Straßenverkehr zur Feststellung<br />
erforderlicher Fahrerlaubnisse und Verkehrstüchtigkeiten<br />
- Kontrolle von Fahrzeugen zur zulassungsrechtlichen<br />
Einordnung und Feststellung von Mängeln<br />
- Feststellung strafrechtlich relevanter Verhaltensweisen<br />
im Straßenverkehr<br />
- Fertigung schriftlicher Vorgänge wie Verkehrsvergehensanzeigen,<br />
Formulare zur Blutprobenentnahme, Sicherstellung<br />
/ Beschlagnahme von Führerscheinen und<br />
Fahrzeugen<br />
Methodik des Präsenzstudiums<br />
Praktikum<br />
Formen des<br />
Selbststudiums<br />
--<br />
Workload 90 Präsenzstunden 90<br />
Umfang des<br />
Selbststudiums<br />
--<br />
VS 3.1-VS 3.4: Klausur 50 %<br />
Art und Umfang des VS 3 T: Leistungsschein (Prozessbewertung) 20 %<br />
Leistungsnachweises VS 3 P: Leistungsschein (Prozessbewertung) 30 %<br />
Gesamtmodulnote 100 %<br />
- 120 -