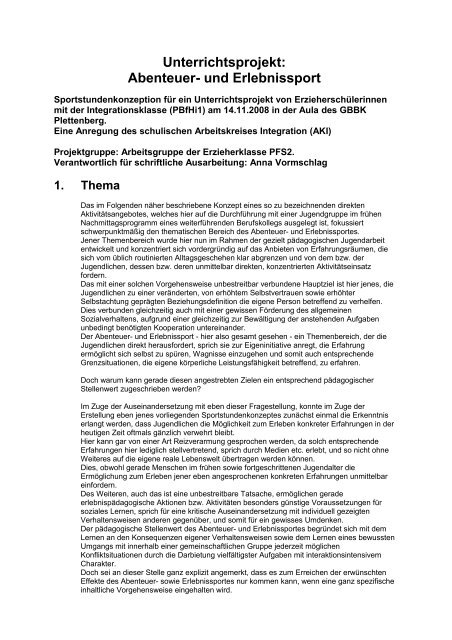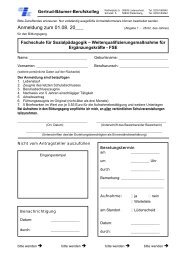Abenteuer- und Erlebnissport - Gertrud-Bäumer-Berufskolleg
Abenteuer- und Erlebnissport - Gertrud-Bäumer-Berufskolleg
Abenteuer- und Erlebnissport - Gertrud-Bäumer-Berufskolleg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Unterrichtsprojekt:<br />
<strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong> <strong>Erlebnissport</strong><br />
Sportst<strong>und</strong>enkonzeption für ein Unterrichtsprojekt von Erzieherschülerinnen<br />
mit der Integrationsklasse (PBfHi1) am 14.11.2008 in der Aula des GBBK<br />
Plettenberg.<br />
Eine Anregung des schulischen Arbeitskreises Integration (AKI)<br />
Projektgruppe: Arbeitsgruppe der Erzieherklasse PFS2.<br />
Verantwortlich für schriftliche Ausarbeitung: Anna Vormschlag<br />
1. Thema<br />
Das im Folgenden näher beschriebene Konzept eines so zu bezeichnenden direkten<br />
Aktivitätsangebotes, welches hier auf die Durchführung mit einer Jugendgruppe im frühen<br />
Nachmittagsprogramm eines weiterführenden <strong>Berufskolleg</strong>s ausgelegt ist, fokussiert<br />
schwerpunktmäßig den thematischen Bereich des <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong> <strong>Erlebnissport</strong>es.<br />
Jener Themenbereich wurde hier nun im Rahmen der gezielt pädagogischen Jugendarbeit<br />
entwickelt <strong>und</strong> konzentriert sich vordergründig auf das Anbieten von Erfahrungsräumen, die<br />
sich vom üblich routinierten Alltagsgeschehen klar abgrenzen <strong>und</strong> von dem bzw. der<br />
Jugendlichen, dessen bzw. deren unmittelbar direkten, konzentrierten Aktivitätseinsatz<br />
fordern.<br />
Das mit einer solchen Vorgehensweise unbestreitbar verb<strong>und</strong>ene Hauptziel ist hier jenes, die<br />
Jugendlichen zu einer veränderten, von erhöhtem Selbstvertrauen sowie erhöhter<br />
Selbstachtung geprägten Beziehungsdefinition die eigene Person betreffend zu verhelfen.<br />
Dies verb<strong>und</strong>en gleichzeitig auch mit einer gewissen Förderung des allgemeinen<br />
Sozialverhaltens, aufgr<strong>und</strong> einer gleichzeitig zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben<br />
unbedingt benötigten Kooperation untereinander.<br />
Der <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong> <strong>Erlebnissport</strong> - hier also gesamt gesehen - ein Themenbereich, der die<br />
Jugendlichen direkt herausfordert, sprich sie zur Eigeninitiative anregt, die Erfahrung<br />
ermöglicht sich selbst zu spüren, Wagnisse einzugehen <strong>und</strong> somit auch entsprechende<br />
Grenzsituationen, die eigene körperliche Leistungsfähigkeit betreffend, zu erfahren.<br />
Doch warum kann gerade diesen angestrebten Zielen ein entsprechend pädagogischer<br />
Stellenwert zugeschrieben werden<br />
Im Zuge der Auseinandersetzung mit eben dieser Fragestellung, konnte im Zuge der<br />
Erstellung eben jenes vorliegenden Sportst<strong>und</strong>enkonzeptes zunächst einmal die Erkenntnis<br />
erlangt werden, dass Jugendlichen die Möglichkeit zum Erleben konkreter Erfahrungen in der<br />
heutigen Zeit oftmals gänzlich verwehrt bleibt.<br />
Hier kann gar von einer Art Reizverarmung gesprochen werden, da solch entsprechende<br />
Erfahrungen hier lediglich stellvertretend, sprich durch Medien etc. erlebt, <strong>und</strong> so nicht ohne<br />
Weiteres auf die eigene reale Lebenswelt übertragen werden können.<br />
Dies, obwohl gerade Menschen im frühen sowie fortgeschrittenen Jugendalter die<br />
Ermöglichung zum Erleben jener eben angesprochenen konkreten Erfahrungen unmittelbar<br />
einfordern.<br />
Des Weiteren, auch das ist eine unbestreitbare Tatsache, ermöglichen gerade<br />
erlebnispädagogische Aktionen bzw. Aktivitäten besonders günstige Voraussetzungen für<br />
soziales Lernen, sprich für eine kritische Auseinandersetzung mit individuell gezeigten<br />
Verhaltensweisen anderen gegenüber, <strong>und</strong> somit für ein gewisses Umdenken.<br />
Der pädagogische Stellenwert des <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong> <strong>Erlebnissport</strong>es begründet sich mit dem<br />
Lernen an den Konsequenzen eigener Verhaltensweisen sowie dem Lernen eines bewussten<br />
Umgangs mit innerhalb einer gemeinschaftlichen Gruppe jederzeit möglichen<br />
Konfliktsituationen durch die Darbietung vielfältigster Aufgaben mit interaktionsintensivem<br />
Charakter.<br />
Doch sei an dieser Stelle ganz explizit angemerkt, dass es zum Erreichen der erwünschten<br />
Effekte des <strong>Abenteuer</strong>- sowie <strong>Erlebnissport</strong>es nur kommen kann, wenn eine ganz spezifische<br />
inhaltliche Vorgehensweise eingehalten wird.
Der Aufbau einer Sportst<strong>und</strong>e zu eben diesem thematischen Bereich darf somit keinesfalls<br />
einer so genannten Beliebigkeit unterliegen, sprich ist nicht wie andere sportliche<br />
Themenbereiche im Aufbau entsprechend flexibel oder gar großartig variabel.<br />
All jene somit konsequent zu beachtenden Richtlinien bezüglich der Planung sowie<br />
Durchführung einer <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong> <strong>Erlebnissport</strong>einheit sind zu einem verbesserten<br />
Nachvollzug hier nun den nachfolgenden Ausführungen einmal etwas detaillierter zu<br />
entnehmen.<br />
Methodische Vorgehensweise des <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong> <strong>Erlebnissport</strong>es<br />
Phase 1<br />
Die erste <strong>und</strong> zum Gelingen des Gesamtvorhabens sicherlich bedeutsamste Phase ist hier<br />
wohl die einer ersten Eingewöhnung bzw. Annäherung.<br />
Dies, da die Auseinandersetzung mit der vorzufindenden Situation bei den Jugendlichen, da<br />
bisher unbekannt, zunächst sicherlich auf Unsicherheit <strong>und</strong> Skepsis stoßen wird, <strong>und</strong> somit<br />
die Einführung sowie Motivation einer anleitenden Persönlichkeit bedarf.<br />
Jene gewünscht hervorzubringende Motivation, hier das Kriterium, mit dem die Erreichung der<br />
angestrebten Effekte stets steigt oder fällt, kann nun vor allen Dingen durch die Schaffung<br />
einer gewissen gr<strong>und</strong>legenden Vertrauensbasis aller Teilhabenden untereinander geschehen.<br />
Ein Sich-Gegenseitiges-Kennen-Lernen ist also das gr<strong>und</strong>legende F<strong>und</strong>ament einer<br />
erfolgreichen <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong> <strong>Erlebnissport</strong>einheit <strong>und</strong> somit auch das Kernstück dieser ersten<br />
Phase des so wichtigen methodischen Vorgehens.<br />
Erreicht werden kann eine solch angestrebte gr<strong>und</strong>legende Vertrauensbasis durch erste<br />
angebrachte kleinere Aufgaben, die ein sich gegenseitiges Annähern in Form des Erbringens<br />
gegenseitiger kleinerer Hilfestellungen erfordern.<br />
Dieses Zulassen einer gewissen Nähe gegenüber den anderen teilhabenden<br />
Gruppenmitgliedern sollte stets nach dem so genannten Prinzip der Freiwilligkeit geschehen.<br />
Das bedeutet im Klartext, dass die Teilnehmer keineswegs dazu gezwungen werden dürfen,<br />
sich mit der ihnen angebotenen Atmosphäre <strong>und</strong> den ihnen somit dargebotenen Aktivitäten<br />
bzw. Aktionen auseinander zu setzen, da die gewünschten Effekte (Verhelfen zu einer von<br />
erhöhtem Selbstvertrauen sowie erhöhter Selbstachtung geprägten neuen<br />
Beziehungsdefinition / Schulung bzw. Förderung des Sozialverhaltens etc.) ohnehin nur Erfolg<br />
verzeichnen können, wenn eine gewisse Bereitschaft der Beteiligten hierzu vorliegt.<br />
Die gr<strong>und</strong>legende Orientierung an dem so genannten Prinzip der Freiwilligkeit schließt hier,<br />
<strong>und</strong> das sei an dieser Stelle ebenfalls besonders betont, motivierende Maßnahmen zwecks<br />
eines Sich-Darauf-Einlassens jedoch keineswegs gänzlich aus.<br />
Sollten jedoch hier bei den jeweilig Beteiligten auch nach einer ersten Eingewöhnungsphase<br />
generell keinerlei Interessen vorliegen, so sollte auch eine solche Haltung entsprechend<br />
akzeptiert werden.<br />
Phase 2<br />
Die sich an die Phase einer ersten Eingewöhnung bzw. Annäherung der vorgef<strong>und</strong>enen<br />
Situation gegenüber unmittelbar anschließende zweite Phase stellt hier im Großen <strong>und</strong><br />
Ganzen eine weiterreichende Vertiefung der ersten Phase dar <strong>und</strong> setzt den Schwerpunkt<br />
ganz konkret auf die Wahrnehmung.<br />
Sich selbst, die anderen teilhabenden Gruppenmitglieder aber auch die die eigene Person<br />
unmittelbar umgebende Umwelt wahrnehmen stellt demnach eine erste größere<br />
Herausforderung für alle Beteiligten dar.<br />
Der Fokus sollte bzw. muss hier also auf die Darbietung von Aktionen <strong>und</strong> Aktivitäten gerichtet<br />
werden, die zum einen ein gewisses direktes Sich-Selbst-Einbringen zur Entwicklung eines<br />
bewussteren eigenen Körpergefühls erfordern, zu deren Bewältigung andererseits aber auch<br />
ein entsprechendes Sich-Gegenseitiges-Helfen <strong>und</strong> somit Unterstützen benötigt werden.<br />
Grenzsituationen die eigene Person betreffend kennen lernen sowie die Bereitschaft,<br />
Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere teilhabende<br />
Gruppenmitglieder zu übernehmen bilden den Schwerpunkt der zweiten Phase, welche hier<br />
an sich nun zumeist auch das eigentliche Kernstück einer gesamten <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong><br />
<strong>Erlebnissport</strong>einheit darstellt.
Auch das Gesamtgeschehen diese Phase sollte sich an dem Prinzip der Freiwilligkeit<br />
orientieren.<br />
So darf gerade hier nun kein Teilnehmer dazu gezwungen werden, sich auf die vorgef<strong>und</strong>ene<br />
Situation im Ganzen einzulassen.<br />
Gerade in dieser Phase wird es immer wieder dazu kommen, dass einige teilhabende<br />
Gruppenmitglieder die direkte Teilnahme an bzw. die direkte Auseinandersetzung mit einigen<br />
der dargebotenen Aktionen sowie Aktivitäten verweigern.<br />
Das Erkennen eigener Grenzen sollte, nein, muss an dieser Stelle als Stärke <strong>und</strong> keineswegs<br />
als Schwäche oder gar Feigheit ausgelegt <strong>und</strong> so auch vor den anderen Teilnehmern von der<br />
das Gesamtgeschehen anleitenden Person entsprechend verdeutlicht werden.<br />
Zudem, auch das sieht das Gr<strong>und</strong>prinzip des <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong> <strong>Erlebnissport</strong>es vor, muss <strong>und</strong><br />
darf, wenn ein Teilnehmer eine Grenzsituation erfährt, in welcher er sich nicht weiter<br />
vorwagen möchte, dessen Teilnahme am Geschehen nicht gänzlich beendet sein.<br />
Hier ist die gesamte Gruppe nun angehalten, nach Kompromissen zu suchen <strong>und</strong> mit der<br />
anleitenden Persönlichkeit neue, gegebenenfalls vom ursprünglichen Plan abweichende<br />
Regeln <strong>und</strong> Richtlinien zu verhandeln, die dem Selbstvertrauen des Teilnehmers, welcher<br />
gerade eine persönliche Grenzsituation erfahren hat, entsprechend gerecht werden, damit<br />
dieser jene Grenzen nach Möglichkeit auch entsprechend überschreiten kann.<br />
Hier ist eine Kooperation von der Gesamtgruppe gefordert, welche nicht nur die permanente<br />
Sicherstellung der Teilnahme jedes einzelnen Gruppenmitgliedes <strong>und</strong> somit das<br />
Selbstvertrauen sowie das Selbstbewusstsein dieser im Einzelnen schult, sondern welche hier<br />
vor allen Dingen zu einer Stärkung des Gruppenbewusstseins <strong>und</strong> somit des so wichtigen<br />
Gruppenzugehörigkeitsgefühles in einem nicht unerheblichen Maße beiträgt.<br />
Phase 3<br />
Eine sich nun an die so zu bezeichnende Wahrnehmungsphase angliedernde weitere Phase<br />
dient hier im Speziellen einer permanent gefragten kreativen Interaktion der einzelnen<br />
Gruppenmitglieder untereinander.<br />
So werden diese von der das Gesamtgeschehen anleitenden Person vor Aufgaben gestellt,<br />
welche keinen weiteren Vorgaben unterliegen <strong>und</strong> zu deren Bewältigung somit eigenständige<br />
Lösungsvorschläge entwickelt werden müssen.<br />
Den Teilnehmern wird hier also ein größtmöglicher Freiraum zur Auseinandersetzung mit der<br />
vorzufindenden Situation zugesprochen, innerhalb dessen jedoch wichtige zu beachtende<br />
Sicherheitsmaßnahmen - hier abhängig von der jeweiligen Aktivität <strong>und</strong> somit nicht im<br />
Allgemeinen festzulegen - keineswegs unbeachtet bleiben dürfen.<br />
Hier muss die die Sporteinheit anleitende Person die Gruppe im Vorfeld über eben diese<br />
informieren <strong>und</strong> zudem betonen, dass an der Lösung <strong>und</strong> somit Bewältigung der<br />
zugesprochenen Aufgabe alle Gruppenmitglieder entsprechend beteiligt werden müssen,<br />
sprich dass also auch hier keiner ausgeschlossen werden darf.<br />
Gegenseitige Rücksichtnahme sowie Akzeptanz sind also einige weitere zu beachtende<br />
Aspekte.<br />
Da es auch hier unbedingt erforderlich ist, gegenseitige Absprachen zu treffen, sich<br />
gegenseitige Hilfestellungen zukommen zu lassen sowie untereinander gemeinsame Regeln<br />
<strong>und</strong> Richtlinien festzulegen, wird hier nun ersichtlich, dass auch die dritte Phase auf der<br />
unmittelbar zuvor durchlaufenen aufbaut.<br />
Da all jene Kriterien auch in der vorangegangenen Phase entsprechend Beachtung gef<strong>und</strong>en<br />
haben, werden sie hier noch einmal entsprechend intensiviert.<br />
So beispielsweise das hier unmittelbar im Vordergr<strong>und</strong> stehende Aufeinander-Angewiesen-<br />
Sein, welches in dieser Phase noch einmal eine erhebliche Steigerung erfährt.<br />
Phase 4<br />
Die letzte <strong>und</strong> somit die dem Abschluss dienende Phase konzentriert sich hier gänzlich auf die<br />
Durchführung einer gemeinsamen Gesamtreflexion.<br />
So sollen die Teilnehmer hier einmal ausreichend Gelegenheit dazu bekommen, ihre Gefühle<br />
bezüglich der gerade durchlaufenen <strong>und</strong> zumeist gänzlich neuen Situation entsprechend<br />
äußern zu können.<br />
Hier kann nun auch der Anleiter des Gesamtgeschehens Fragestellungen anbringen, wie<br />
etwa:
• Wie haben Sie sich bei der Auseinandersetzung mit den einzelnen Aktivitäten <strong>und</strong><br />
Aktionen gefühlt<br />
• Gab es vielleicht eine Aktivität, die Sie im ganz Besonderen angesprochen hat <strong>und</strong> wenn<br />
ja warum<br />
• Gab es Situationen, in denen Sie ganz klar gespürt haben, persönliche Grenzen erreicht<br />
zu haben <strong>und</strong> war es Ihnen dann möglich, einige dieser vielleicht zu überschreiten<br />
• Wie haben Sie die Kooperation <strong>und</strong> das Miteinander der einzelnen Gruppenmitglieder<br />
wahrgenommen<br />
Fühlten Sie sich in Grenzsituationen von diesen ausreichend unterstützt<br />
• Mit was für einem Gefühl verlassen Sie die heutige <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong> <strong>Erlebnissport</strong>einheit<br />
• Wären Sie bereit, sich in der Zukunft noch einmal auf ein ähnliches <strong>Abenteuer</strong><br />
einzulassen<br />
Die Durchführung eines solchen Gesamtreflexionsgespräches unmittelbar im Anschluss an<br />
die entsprechende <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong> <strong>Erlebnissport</strong>einheit anzusiedeln, ist hier so wichtig, da<br />
den Teilnehmern zu diesem Zeitpunkt die gemachten Erlebnisse <strong>und</strong> Erfahrungen sowie<br />
ebenso die unmittelbar damit in Verbindung stehenden Gefühlslagen noch unmittelbar präsent<br />
sind.<br />
Die Wahl eines späteren Zeitpunktes zur Durchführung einer solchen Reflexion könnte hier<br />
nun das eigentliche Ziel einer ausführlichen <strong>und</strong> vor allen Dingen realen Rückmeldung aller<br />
Beteiligten gewissermaßen gefährden.<br />
Zudem, auch dem sei an dieser Stelle Beachtung geschenkt, kommen solch angebrachte<br />
Reflexionen sowohl den einzelnen Teilnehmern als auch dem entsprechenden Anleiter des<br />
Gesamtgeschehens entsprechend zu gute.<br />
Den Teilnehmern zum Einen, da diese sich im Gespräch noch einmal ganz konkret über die<br />
mit der durchlaufenen Situation in Verbindung zu bringenden eigenen Empfindungen bewusst<br />
werden <strong>und</strong> diese entsprechend mit denen der anderen Gruppenmitglieder vergleichen<br />
können.<br />
Zum Anderen, da diesen noch einmal ganz klar vor Augen geführt werden kann, was sie als<br />
Gruppe denn da nun eigentlich alles erreichen konnten.<br />
Parallel dazu hat die für das Gesamtgeschehen verantwortliche Person hier nun die<br />
Möglichkeit zu überprüfen, ob die im Vorfeld angestrebten Ziele erreicht werden konnten <strong>und</strong><br />
damit verb<strong>und</strong>en die Gelegenheit, Rückschlüsse auf das eigene Handeln zu ziehen.<br />
Alle hier nun in Bezug auf die methodische Vorgehensweise des <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong><br />
<strong>Erlebnissport</strong>es unbedingt zu beachtenden Phasen sollen <strong>und</strong> werden auch im Zuge des<br />
nachfolgend expliziter dargestellten Angebotes diese Thematik betreffend, welche zur<br />
Durchführung mit einer Jugendgruppe an einem weiterführenden <strong>Berufskolleg</strong> ausgelegt ist,<br />
entsprechend aufgegriffen <strong>und</strong> realisiert.<br />
2. Angaben zur Gruppe<br />
2.1 Gruppenstruktur<br />
Die Durchführung der im Nachfolgenden detailliert beschriebenen <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong><br />
<strong>Erlebnissport</strong>einheit soll hier, wie im Vorfeld schon angekündigt, mit einer Jugendgruppe im<br />
Nachmittagbereich eines weiterführenden <strong>Berufskolleg</strong>s erfolgen.<br />
Das Angebot jener spezifischen Sporteinheit geht hier von fünf angehenden Erzieherinnen im<br />
zweiten Ausbildungsjahr aus, welche für die Durchführung sowohl ihre eigenen
Mitauszubildenden, im Speziellen hier aber vor allen Dingen die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen der<br />
sich am <strong>Berufskolleg</strong> befindlichen Integrationsklasse vorgesehen haben.<br />
Jene eben genannte Integrationsklasse setzt sich nun aus sechzehn türkeistämmigen<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern zusammen, welche am <strong>Berufskolleg</strong> die Möglichkeit erhalten,<br />
einen entsprechend qualifizierten Schulabschluss zu erwerben <strong>und</strong> so ihre späteren<br />
Arbeitsmarktchancen erheblich zu verbessern.<br />
Die Wahl, die Durchführung der entsprechenden <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong> <strong>Erlebnissport</strong>einheit nun<br />
gerade auf jenen Klassenverband auszurichten, ergab sich hier nun mitunter daraus, dass ein<br />
Schwerpunkt des im Vorfeld genannten <strong>Berufskolleg</strong>s darauf ausgerichtet ist, gerade<br />
türkeistämmigen Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern stets Anreize <strong>und</strong> Möglichkeiten zur näheren<br />
Kontaktaufnahme mit Mitschülern <strong>und</strong> Mitschülerinnen der Mehrheitsgesellschaft darzubieten<br />
<strong>und</strong> ihnen hier vor allen Dingen die Offenheit zu einer entsprechenden Kontaktpflege klar vor<br />
Augen zu führen.<br />
An dieser Stelle konnte also der Gedanke an eine gewisse Integrationsförderung durch die<br />
gemeinsame Auseinandersetzung mit vielfältigsten sportlichen Aufgaben<br />
interaktionsintensiven Charakters angebracht werden.<br />
Zudem, dies ist jedoch eher weniger dem Gedanken an die eben genannte<br />
Integrationsförderung zuzuschreiben, konnte beobachtet werden, dass die Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schüler jenes Klassenverbandes einen doch recht hohen Bewegungsdrang vorweisen -<br />
spontane Tanzeinlagen in den einzelnen Unterrichtseinheiten sind nach Aussagen der<br />
pädagogischen Fachkräfte des <strong>Berufskolleg</strong>s nichts Ungewöhnliches -, zu dessen<br />
Befriedigung das <strong>Berufskolleg</strong> derzeit nicht in der Lage ist, da ein entsprechender<br />
Sportunterricht hier erst für das nachfolgende Schulhalbjahr vorgesehen ist.<br />
Die Feststellung eben jener Tatsache sprach sich an dieser Stelle natürlich noch einmal<br />
zusätzlich für die Wahl gerade jener Integrationsklasse zur Durchführung der bevorstehenden<br />
<strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong> <strong>Erlebnissport</strong>einheit aus, so dass das entsprechende Vorhaben umgehend in<br />
die Tat umgesetzt werden konnte.<br />
3. Methode<br />
3.1 Organisation<br />
3.1.1 Zeitfaktor<br />
Der zeitliche Rahmen der an diesem Frühnachmittag durchzuführenden <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong><br />
<strong>Erlebnissport</strong>einheit wird je nach Interesse, Aufmerksamkeit, Motivation sowie Arbeitstempo<br />
der an der Aktion teilnehmenden Jugendlichen in etwa 120 bis 135 Minuten umfassen.<br />
Die Aktivität wird hier gegen 11.30 Uhr ihren Anfang finden <strong>und</strong> in etwa zwischen 13.30 Uhr<br />
<strong>und</strong> 13.45 Uhr enden.<br />
3.1.2 Raumfaktor<br />
Unter den zum <strong>Gertrud</strong>-Bäumer-<strong>Berufskolleg</strong> (GBBK) gehörenden Räumlichkeiten befindet<br />
sich hier auch ein entsprechender Bewegungsraum, welcher zur Durchführung<br />
verschiedenster schulsportlicher Aktionen <strong>und</strong> Aktivitäten genutzt wird <strong>und</strong> somit auch der<br />
Durchführung dieser spezifischen <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong> <strong>Erlebnissport</strong>einheit dienlich ist.<br />
3.2 Vorbereitung<br />
3.2.1 zu Hause<br />
Da es sich bei dem <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong> <strong>Erlebnissport</strong> um einen besonders breitbandigen<br />
Themenbereich handelt, galt es hier zunächst einmal aus der Unmenge an anzubringenden<br />
Aktionen <strong>und</strong> Aktivitäten einige spezifische herauszufiltern.<br />
Die Auswahl der innerhalb dieser spezifischen <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong> <strong>Erlebnissport</strong>einheit<br />
dargebotenen Aufgabenstellungen orientierte sich hier sowohl an der Fragestellung danach,<br />
welche dieser ein besonderes hohes Maß an Interesse sowie Motivation bei den Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schülern der Integrationsklasse hervorrufen könnte (hier sehr schwierig, da keine
erweiterten Kenntnisse über eben jene Jugendlichen vorlagen), orientierte sich aber<br />
vordergründig auch an den vorhandenen <strong>und</strong> somit nutzbaren materiellen Ressourcen.<br />
Nachdem dieser Prozess, die Suche nach pädagogisch sinnvollen Aktionen <strong>und</strong> Aktivitäten<br />
(hier stets an Anlehnung der Gr<strong>und</strong>richtlinien des <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong> <strong>Erlebnissport</strong>es)<br />
abgeschlossen war, wurde sich im Weiteren ein Gesamtüberblick über alle für die<br />
Durchführung benötigten Mittel <strong>und</strong> Materialien <strong>und</strong> deren Besorgung bzw. Aufbringung<br />
verschafft.<br />
(Da die für die Durchführung der ausgewählten Aktivitäten bzw. Aktionen benötigten Mittel <strong>und</strong><br />
Materialien den nachfolgenden Aktivitätsbeschreibungen zu entnehmen sind, wird auf die<br />
Aufzählung dieser an jener Stelle entsprechend verzichtet.)<br />
3.2.2 in der Einrichtung<br />
Die Vorbereitung zur Durchführung dieser speziellen <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong> <strong>Erlebnissport</strong>einheit<br />
innerhalb der Einrichtung (GBBK) setzte sich hier lediglich aus dem Zusammentragen aller<br />
benötigten Mittel <strong>und</strong> Materialien zusammen sowie aus dem vorgeschalteten Eigenerproben<br />
einiger der anzubringenden Aktionen <strong>und</strong> Aktivitäten.<br />
4. Lernziele der geplanten Aktivitätsdurchführung<br />
Folgende Lernzielbereiche werden in die hier vorliegende Konzeption zur Durchführung einer<br />
<strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong> <strong>Erlebnissport</strong>einheit einbezogen:<br />
1. Der kognitive Bereich (Die Wissenserweiterung)<br />
• Das Hauptlernziel des kognitiven Bereiches ist die Herausforderung der kognitiven<br />
Leistungsfähigkeit der Jugendlichen im Allgemeinen.<br />
Dies, indem diese sich des Öfteren mittels konkreter Überlegungen - meist auch in<br />
Verbindung mit einem eigenständigen Handeln, sprich hier also großteils durch die<br />
Einnahme der Rolle eines Aktiv-Handelnden - eigenständig Lösungsmöglichkeiten, die<br />
ganz unterschiedlich dargebotenen Aufgabenstellungen betreffend, entsprechend<br />
erschließen.<br />
(Lernziel Nr. 1)<br />
2. Der soziale Bereich (Die Zwischenmenschlichkeit)<br />
• Eines der Hauptziele des sozialen Bereiches ist, das Selbstvertrauen bzw. das<br />
Selbstbewusstsein sowie das Selbstwertgefühl eines jeden Jugendlichen der an der<br />
<strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong> <strong>Erlebnissport</strong>einheit teilhabenden Gesamtgruppe zu fördern, sprich<br />
zu stärken bzw. zu intensivieren.<br />
Dies insbesondere durch die Sicherstellung einer permanenten Teilhabe der<br />
einzelnen Jugendlichen am Gesamtgeschehen, welches zuweilen das Erfahren<br />
eigener individueller Grenzen mit sich bringen kann, zu deren gegebenenfalls von<br />
den Jugendlichen gewünschten Überschreitung jederzeit entsprechend ausreichend<br />
„Raum“ zur Verfügung steht.<br />
(Lernziel Nr. 2)<br />
• Ein weiteres sehr wichtiges Ziel diesen Bereich betreffend ist ebenso die Förderung<br />
eines gewissen Gruppenbewusstseins bzw. eines entsprechenden<br />
Gruppenzugehörigkeitsgefühls.<br />
Dies vor allen Dingen durch die zur Bewältigung der dargebotenen Aufgaben<br />
unbedingt benötigte permanente sowie teils äußerst intensive Kooperation der<br />
einzelnen Gesamtgruppenmitglieder untereinander.<br />
Gemeinsame Überlegungen bzw. Beratungen sowie das Zukommen-Lassen<br />
gegenseitiger Hilfestellungen sind in diesem Zusammenhang permanent gefordert.<br />
(Lernziel Nr. 3)<br />
3. Der psychomotorische Bereich (Der handelnde Mensch)
• Als Lernziel den psychomotorischen Bereich betreffend kann hier unter anderem die<br />
Schulung bzw. Förderung oder auch Intensivierung der sicheren grob- <strong>und</strong><br />
feinmotorischen Bewegungsabläufe der an der Gesamtaktion teilhabenden<br />
Jugendlichen angebracht werden, welche hier gerade durch die Darbietung von<br />
Aufgabenstellungen ganz unterschiedlichen Charakters sichergestellt wird.<br />
(Lernziel Nr. 4)<br />
• Ein weiteres Lernziel des psychomotorischen Bereiches ist hier zudem die<br />
Erweiterung des individuellen Wahrnehmungsprozesses der an der Aktion<br />
teilhabenden Jugendlichen.<br />
Und hier sowohl die Wahrnehmungsprozesse die eigene Person betreffend als auch<br />
die der anderen am Gesamtgeschehen beteiligten Gruppenmitglieder <strong>und</strong> die der die<br />
eigene Person unmittelbar umgebende Umwelt.<br />
Dies wird vor allen Dingen sichergestellt durch den in die <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong><br />
<strong>Erlebnissport</strong>einheit integrierten Partnerblindparcours.<br />
(Lernziel Nr. 5)<br />
• Eng in Verbindung mit dem zuvor genannten Lernziel kann hier auch das der<br />
Förderung bzw. Intensivierung eines gewissen Verantwortungsbewusstseins der<br />
einzelnen Jugendlichen angebracht werden, <strong>und</strong> zwar nicht nur gegenüber sich<br />
selbst, sondern ebenso <strong>und</strong> gleichwertig auch gegenüber allen andern<br />
Gruppenmitgliedern.<br />
(Lernziel Nr. 6)<br />
4. Der emotionale Bereich<br />
• Bezüglich des Hauptlernzieles des emotionalen Bereiches kann hier auf die Ziele den<br />
sozialen Bereich betreffend verwiesen werden, da die Jugendlichen hier die<br />
Wichtigkeit, sprich also die Bedeutung, ja das äußerst positive Gefühl gegenseitiger<br />
Hilfestellung <strong>und</strong> Unterstützung erfahren sollen.<br />
(Lernziel Nr. 7)<br />
5. Darstellung des Inhaltes/ Geplanter Aktivitätsverlauf<br />
Phase / Inhalt / Handlungsweise<br />
Begründung<br />
Phase 1<br />
Zunächst einmal werden die an der<br />
Gesamtaktion teilhabenden Jugendlichen zum<br />
Eingangsbereich der entsprechend für die<br />
Durchführung der <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong><br />
<strong>Erlebnissport</strong>einheit auserwählten Räumlichkeit -<br />
die Turnhalle des <strong>Berufskolleg</strong>s - gebeten.<br />
Nachdem sich diese dort eingef<strong>und</strong>en haben,<br />
wird die Gruppe gemeinsam den Raum betreten<br />
<strong>und</strong> sich in Form eines etwas größeren<br />
Sitzkreises in die Mitte der Turnhalle auf den<br />
Boden setzen.<br />
Im Anschluss hieran werden die Jugendlichen<br />
dann einsteigend von den fünf angehenden<br />
Erzieherinnen gr<strong>und</strong>legend über den Ablauf der<br />
vorgesehenen <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong> <strong>Erlebnissport</strong>einheit<br />
aufgeklärt werden.<br />
(Dies mit dem gleichzeitigen Verweis darauf,<br />
dass für die erfolgreiche Durchführung hier nun<br />
der Einsatz aller entscheidend ist <strong>und</strong> dieser<br />
zudem von der gesamten Gruppe ein<br />
Höchstmaß an Aufmerksamkeit <strong>und</strong><br />
Konzentration verlangt.)<br />
Jene Phase dient hier zunächst einmal dazu, die<br />
an der Aktion teilhabenden Jugendlichen<br />
gr<strong>und</strong>legend zu motivieren, sprich zunächst<br />
einmal deren Interesse sowie deren Neugierde<br />
wecken zu können.<br />
Dies einerseits allein schon einmal durch das<br />
Aussprechen der Dankbarkeit darüber, dass sie<br />
sich auf das unmittelbar bevorstehende<br />
<strong>Abenteuer</strong> überhaupt gr<strong>und</strong>legend eingelassen<br />
haben, andererseits aber auch durch die<br />
Betonung dessen, dass jedes einzelne<br />
Gruppenmitglied für den Erfolg der <strong>Abenteuer</strong><strong>und</strong><br />
<strong>Erlebnissport</strong>einheit unentbehrlich ist.<br />
Dies kann zudem schon an jener Stelle zur<br />
Förderung des Selbstvertrauens sowie des<br />
Selbstwertgefühles eines jeden einzelnen<br />
Teilnehmers beitragen.<br />
(Lernziel Nr. 2)<br />
Gleichzeitig soll den Jugendlichen hier zudem<br />
Klarheit über Handlungsziele/ -bedingungen<br />
sowie / -strukturen verschafft werden.<br />
Dies, durch die entsprechend gr<strong>und</strong>legend
Auch wird hier allen Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern -<br />
insbesondere denen der Integrationsklasse - ein<br />
entsprechend herzlicher Dank dafür<br />
ausgesprochen werden, dass sie gr<strong>und</strong>legend<br />
bereit sind, sich auf das bevorstehende<br />
<strong>Abenteuer</strong> einzulassen.<br />
Ist jene gr<strong>und</strong>legende, einer gewissen<br />
Orientierung dienende Einführung<br />
abgeschlossen, werden die Jugendlichen im<br />
Weiteren gebeten, sich in einem größeren<br />
Stehkreis zu versammeln, um nun mit einigen<br />
ersten Kennenlernspielen beginnen zu können,<br />
die da wären:<br />
• Namenrufen<br />
• Entwischen<br />
• Alligator<br />
Für die Durchführung all jener hier genannten<br />
Spiele - dies sei hier schon einmal angemerkt -<br />
wird ein etwas größerer Fallschirm benötigt.<br />
(Da die genauen Spielbeschreibungen hier nun<br />
ein wenig umfangreicher sind, werden diese an<br />
jener Stelle nicht näher benannt, sondern dem<br />
hier aufgeführten geplanten Aktivitätsverlauf<br />
entsprechend angefügt.)<br />
übersichtliche Darstellung der bevorstehenden<br />
<strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong> <strong>Erlebnissport</strong>einheit.<br />
Den Beginn der Gesamtaktivität hier zunächst<br />
auf die Durchführung so zu bezeichnender<br />
Kennenlernspiele auszurichten, hat hier<br />
verschiedenste pädagogische Hintergründe.<br />
So sind gerade die von den fünf angehenden<br />
Erzieherinnen ausgewählten Kennenlernspiele<br />
ideal in Form eines etwas größeren Stehkreises<br />
durchzuführen.<br />
Hier besonders hervorzuheben, da der Kreis<br />
stets ein Symbol für Geborgenheit <strong>und</strong> Vertrauen<br />
darstellt <strong>und</strong> so allen Gruppenmitgliedern<br />
Rückhalt <strong>und</strong> Schutz bietet.<br />
Auf dieses Art <strong>und</strong> Weise fällt es so oftmals auch<br />
ansonsten eher ruhigen Teilnehmern leichter,<br />
sich innerhalb des schutzbietenden Kreises<br />
entsprechend zu entfalten.<br />
Zudem kann aufgr<strong>und</strong> der getroffenen Spielwahl<br />
- nähere Erläuterungen siehe unten - die<br />
Teilnahme aller Gruppenmitglieder wie<br />
gewünscht gesichert werden.<br />
Da diese hier sogar teils schon miteinander<br />
kooperieren müssen, kommt es hier zudem zu<br />
einer ersten Annäherung aller am Geschehen<br />
Beteiligten untereinander, was hier der Schaffung<br />
einer gewissen gr<strong>und</strong>legenden Vertrauensbasis<br />
dienlich ist <strong>und</strong> somit auch der Entwicklung eines<br />
damit stets verb<strong>und</strong>enen Gruppenbewusstseins<br />
bzw. eines Gruppenzugehörigkeitsgefühls.<br />
Hier insbesondere der türkeistämmigen <strong>und</strong><br />
deutschen <strong>und</strong> anderen Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schülern untereinander.<br />
(Lernziele Nr. 3 <strong>und</strong> Nr. 7)<br />
Phase 2<br />
Im Anschluss an die Durchführung jener<br />
gr<strong>und</strong>legenden Kennenlernspiele werden nun<br />
zwei weitere Spiele durchgeführt, welche hier<br />
schon einen etwas größeren<br />
interaktionsintensiven Charakter aufweisen.<br />
Bei jenen beiden vorgesehenen Spielen handelt<br />
es sich hier nun um folgende:<br />
• Zehnerfangen<br />
• Banksortieren<br />
Im Anschluss an die Durchführung jener<br />
sportlichen Aktivitäten wird dann auch schon zu<br />
einem der Höhepunkte, wenn nicht sogar zu dem<br />
Höhepunkt der <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong><br />
<strong>Erlebnissport</strong>einheit überhaupt, übergeleitet<br />
werden, nämlich zu der Durchführung eines so<br />
genannten Partnerblindparcours.<br />
(Auch die genauen Aktivitätsbeschreibungen all<br />
jene Spiele betreffend würden an dieser Stelle<br />
einen höchst umfangreichen Rahmen<br />
einnehmen, so dass auch sie somit dem hier<br />
Jene Phase dient hier vor allen Dingen, wie auch<br />
in den vorgeschalteten allgemeinen thematischen<br />
Ausführungen schon einmal angemerkt, im<br />
Besonderen der Wahrnehmung.<br />
Und zwar sowohl der Wahrnehmung der eigenen<br />
Person als auch der Wahrnehmung der anderen<br />
am Gesamtgeschehen beteiligten<br />
Gruppenmitglieder <strong>und</strong> der die eigene Person<br />
unmittelbar umgebende Umwelt.<br />
(Lernziel Nr. 5)<br />
Jener Aspekt findet wird hier im besonderen<br />
Maße bei der Durchführung des<br />
Partnerblindparcours Beachtung, welcher hier ein<br />
Höchstmaß an Konzentration <strong>und</strong><br />
Aufmerksamkeit verlangt, sowie ein ganz<br />
bewusstes Verantwortungsbewusstsein nicht nur<br />
gegenüber sich selbst, sondern ebenso<br />
gegenüber dem jeweiligen Partner.<br />
(Lernziel Nr. 6)<br />
Auch hier insbesondere eine Möglichkeit zur<br />
Stärkung des Selbstvertrauens sowie des<br />
Selbstwertgefühles jedes einzelnen<br />
Gruppenmitgliedes, vor allen Dingen durch das
aufgeführten geplanten Aktivitätsverlauf<br />
entsprechend angefügt werden.)<br />
Erfahren eigener, individueller Grenzsituationen.<br />
(Lernziel Nr. 2)<br />
Auch eine gewisse Kooperation der Teilnehmer<br />
untereinander kann hier wie gewünscht<br />
sichergestellt werden.<br />
(Lernziele Nr. 3 <strong>und</strong> Nr. 7)<br />
Hier allerdings auch schon mittels der beiden<br />
dem Partnerblindparcours unmittelbar<br />
vorgeschalteten sportlichen Aktivitäten, welche<br />
ebenfalls einen stark interaktionsintensiven<br />
Charakter besitzen <strong>und</strong> zu einem<br />
entsprechenden Gelingen ein Höchstmaß an<br />
Konzentration <strong>und</strong> Aufmerksamkeit der einzelnen<br />
Teammitglieder untereinander einfordern.<br />
So kann beispielsweise die dargebotene Aktivität<br />
des Banksortierens nur den gewünschten Erfolg<br />
verzeichnen, wenn die Gruppe gemeinsam über<br />
einen möglichen Lösungsweg nachsinnt.<br />
(Lernziel Nr. 1)<br />
Phase 3<br />
Ist die Durchführung der für die vorgeschaltete<br />
Phase vorgesehenen sportlichen Aktivitäten<br />
entsprechend erfolgt, wird nun ein Spiel<br />
durchgeführt, welches von allen<br />
Gruppenmitgliedern eine im höchsten Maße<br />
kreative Interaktion einfordert.<br />
Bei eben gerade jenem Spiel handelt es sich um<br />
den so genannten „Gordischen Knoten“.<br />
(Auch die genaue Aktivitätsbeschreibung dieses<br />
Spieles ist, wie alle anderen zuvor auch, dem<br />
hier aufgeführten geplanten Aktivitätsverlauf<br />
entsprechend angefügt.)<br />
Dieser hier nun angebrachten, von einem stark<br />
kreativen sowie interaktionsintensivem Charakter<br />
geprägten Aktivität, werden im Folgenden noch<br />
zwei weitere Spiele nachfolgen, welche einen<br />
gr<strong>und</strong>legend ähnlichen Charakter aufweisen,<br />
jedoch zusätzlich einen höchst intensiven<br />
körperlichen Einsatz erfordern.<br />
Bei jenen beiden vorgesehenen Spielen handelt<br />
es sich hier nun um folgende:<br />
Die Durchführung des Spieles mit dem Titel<br />
„Gordischer Knoten“ dient - wie auch im Vorfeld<br />
schon bereits angemerkt - einer kreativen<br />
Kooperation der einzelnen Teilnehmer<br />
untereinander.<br />
Dies, indem diese gemeinsam einen<br />
entsprechenden Lösungsweg zur Bewältigung<br />
der angebrachten Aufgabe ausklamüsern<br />
müssen.<br />
(Lernziel Nr. 1)<br />
Gestärkt wird auch an dieser Stelle - <strong>und</strong> zwar<br />
bezüglich aller innerhalb dieser Phase<br />
angebrachten Aktivitäten - sowohl das<br />
Selbstvertrauen sowie das Selbstbewusstsein<br />
jedes einzelnen Teilnehmers als auch das<br />
entsprechende Gruppenbewusstsein bzw. das<br />
entsprechende Gruppenzugehörigkeitsgefühl.<br />
(Lernziele Nr. 2, Nr. 3 <strong>und</strong> Nr. 7)<br />
• Balltreiben<br />
• Möhrenziehen<br />
(Da auch die genauen Spielbeschreibungen der<br />
hier angebrachten beiden Aktivitäten nun ein<br />
wenig umfangreicher sind, werden diese an jener<br />
Stelle nicht näher benannt, sondern dem hier<br />
aufgeführten geplanten Aktivitätsverlauf ebenfalls<br />
entsprechend angefügt.)<br />
Phase 4<br />
Im Anschluss an das Durchlaufen der zuvor<br />
Die Durchführung einer solch abschließenden
aufgeführten Phasen wird es nun noch zu einer<br />
entsprechend gemeinsamen Gesamtreflexion<br />
kommen, welche sich an den schon bereits in<br />
den vorgeschalteten allgemeinen Ausführungen<br />
zur Durchführung einer <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong><br />
<strong>Erlebnissport</strong>einheit erwähnten Kriterien<br />
orientieren wird.<br />
Gesamtreflexion dient hier nun dazu, allen<br />
Teilnehmern noch einmal ganz explizit die<br />
Gelegenheit darzubieten, ihren Gefühlen<br />
bezüglich der gerade durchlaufenen doch<br />
zumeist gänzlich neuen Situation entsprechend<br />
Ausdruck verleihen zu können.<br />
Auch kann ebenso allen Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schülern an dieser Stelle noch einmal ganz klar<br />
vor Augen geführt werden, was sie als Gruppe<br />
denn da nun eigentlich alles erreichen konnten.<br />
Das Selbstvertrauen jedes einzelnen<br />
Gruppenmitgliedes, aber auch ein<br />
entsprechendes Gruppenbewusstsein bzw. ein<br />
entsprechendes Gruppenzugehörigkeitsgefühl<br />
kann so noch einmal einer gewissen Förderung<br />
unterzogen werden.<br />
(Lernziele Nr. 2, Nr. 3 <strong>und</strong> Nr. 7)<br />
6. Aktivitätsbeschreibungen<br />
Zunächst einmal sei an dieser Stelle festgehalten, dass zur Durchführung aller der im<br />
Nachfolgenden entsprechend detailliert aufgeführten Aktivitäten sowohl eine gegenseitige<br />
Rücksichtnahme als auch eine entsprechend gegenseitige Akzeptanz Gr<strong>und</strong>voraussetzung<br />
<strong>und</strong> somit von unmittelbarer Bedeutung sind.<br />
Zudem erfolgt die Teilnahme an jedweden Aktivitäten hier nach dem Prinzip der schon in den<br />
vorangegangenen allgemeinen Ausführungen entsprechend erwähnten Freiwilligkeit.<br />
Kein Gruppenmitglied wird somit zur Teilnahme gezwungen, sondern lediglich zu dieser<br />
entsprechend motiviert.<br />
Dies, da ein Ziel der dargebotenen <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong> <strong>Erlebnissport</strong>einheit hier ja unter anderem<br />
die freiwillige Überschreitung eigens wahrgenommener Grenzsituationen umfasst.<br />
Des Weiteren - auch das sei an dieser Stelle nicht außen vor gelassen - kann <strong>und</strong> sollte die<br />
die Gesamtaktion anleitende Person (Spielleiter) nach Möglichkeit an allen Aktivitäten<br />
teilhaben, hier allerdings ebenso einen konsequenten Überblick permanent sicherstellen<br />
können.<br />
6.1 Aktivitäten der Phase 1<br />
Namenrufen<br />
Benötigte Mittel <strong>und</strong> Materialien<br />
• einen etwas größeren (nach Möglichkeit bunten) Fallschirm<br />
• eine Rolle klebendes Kreppband<br />
• einige etwas dickere Faserstifte (beispielsweise Eddings)<br />
Spielart<br />
Kooperationsförderndes (Kennenlern-) Spiel<br />
Spielablauf<br />
Alle Mitspieler versammeln sich zunächst einmal in einem etwas größeren Sitzkreis um den<br />
(nach Möglichkeit bunten) Fallschirm herum.<br />
(Dies, da gerade der Kreis stets ein Symbol für Geborgenheit <strong>und</strong> Vertrauen darstellt <strong>und</strong> so<br />
allen Gruppenmitgliedern Rückhalt <strong>und</strong> Schutz bietet.<br />
Auf dieses Art <strong>und</strong> Weise fällt es so oftmals auch ansonsten eher ruhigen Teilnehmern<br />
leichter, sich innerhalb des schutzbietenden Kreises entsprechend zu entfalten.)
Ist dies geschehen, erhält jeder Teilnehmer im Weiteren einen in etwa sieben Zentimeter<br />
langen Streifen des klebenden Kreppbandes sowie einen der vorhandenen etwas dickeren<br />
Faserstifte, mit welchem er nun seinen Namen auf den erhaltenen Kreppbandstreifen schreibt.<br />
Haben alle Mitspieler nun mit diesem Prozedere abgeschlossen, stehen diese im Weiteren<br />
auf, fassen den Fallschirm an einer eigens ausgesuchten Stelle mit beiden Händen an <strong>und</strong><br />
achten darauf, dass dieser voll ausgebreitet wird.<br />
Ist dieses geschehen, fordert der zuvor gemeinsam ausgesuchte Spielleiter alle Teilnehmer<br />
auf, den Fallschirm gleichmäßig aber in einem etwas schnelleren Tempo leicht anzuheben<br />
<strong>und</strong> wieder auf Bauchhöhe absinken zu lassen.<br />
Dann ruft er zwei Mitspieler beim Namen, welchen nun die Aufgabe zukommt sich gegenseitig<br />
auszumachen <strong>und</strong> den Platz zu tauschen, sprich den Fallschirm loszulassen, unter diesem<br />
herzulaufen <strong>und</strong> sich an den Platz des entsprechenden Mitspielers zu begeben.<br />
Jene Vorgehensweise kann hier so lange fortgeführt werden, bis alle Teilnehmer einmal an<br />
der Reihe waren, kann aber je nach Interesse auch beliebig verlängert werden.<br />
Hier kann beispielsweise auch die Rolle des Spielleiters in regelmäßigen Abständen<br />
wechseln.<br />
Entwischen<br />
Benötigte Mittel <strong>und</strong> Materialien<br />
• einen etwas größeren (nach Möglichkeit bunten) Fallschirm<br />
• ein bis zwei Softbälle<br />
Spielart<br />
Kooperationsförderndes (Kennenlern-) Spiel<br />
Spielablauf<br />
In etwa die Hälfte aller am Spiel teilnehmenden Gruppenmitglieder positioniert sich unmittelbar<br />
direkt unter dem (nach Möglichkeit bunten) Fallschirm.<br />
Alle anderen Mitspieler verteilen sich außen um den Fallschirm herum <strong>und</strong> halten diesen mit<br />
den Händen in etwa auf Taillenhöhe fest.<br />
Diesen sich außen um den Fallschirm verteilten Spielern kommt nun die Aufgabe zu, mit den<br />
zuvor erhaltenen beiden Softbällen, die sich unter dem Fallschirm befindenden Mitspieler - die<br />
natürlich versuchen, den nahenden Bällen auszuweichen, den Bereich des Fallschirmes dabei<br />
aber nicht verlassen dürfen - entsprechend abzuwerfen.<br />
Gelingt es einem Mitspieler, einen anderen mit Hilfe einer der beiden Softbälle entsprechend<br />
abzuwerfen, kommt beiden nun unmittelbar die Rolle des jeweils anderen zu.<br />
Auch dieses Fallschirmspiel kann je nach Motivation <strong>und</strong> Interesse beliebig lange gespielt<br />
werden<br />
Alligator<br />
Benötigte Mittel <strong>und</strong> Materialien<br />
• einen etwas größeren (nach Möglichkeit bunten) Fallschirm<br />
Spielart<br />
Kooperationsförderndes (Kennenlern-) Spiel<br />
Spielablauf<br />
Alle Mitspieler positionieren sich außen um den Fallschirm herum, legen sich auf den Rücken,<br />
greifen den Fallschirm mit beiden Händen <strong>und</strong> ziehen diesen in etwa bis auf Brusthöhe hinauf.<br />
Dann wird gemeinsam ein Mitspieler ausgesucht, welcher den Alligator verkörpern darf.
Diesem kommt nun die Aufgabe zu, sich kriechend unter den Fallschirm zu bewegen, ein<br />
beliebiges Opfer (einen anderen Mitspieler) ausfindig zu machen <strong>und</strong> diesen mit ganzer Kraft<br />
unter den Fallschirm zu ziehen.<br />
Der unter den Fallschirm gezogene Mitspieler wurde hier nun gewissermaßen von dem<br />
hungrigen Alligator gefressen <strong>und</strong> darf nun selbst einen solchen verkörpern.<br />
Das Spiel ist beendet, sobald alle Mitspieler einen Alligator verkörpern <strong>und</strong> somit im<br />
Umkehrschluss kein Mitspieler mehr zum Fressen da ist.<br />
Anmerkungen:<br />
Alle der hier nun aufgeführten so zu bezeichnenden Fallschirmspiele eignen sich besonders<br />
gut zum Einstieg in eine <strong>Abenteuer</strong>- <strong>Erlebnissport</strong>einheit, sprich fungieren hier ganz<br />
hervorragend als Kennenlernspiele.<br />
Dies zum einen, da alle dieser Aktivitäten in Kreisform durchzuführen sind - dessen<br />
Stellenwert im Vorangegangenen schon mehrfach erläutert wurde -, zum anderen aber auch,<br />
da das kontinuierliche Mitwirken aller Teilnehmer am Gesamtgeschehen entsprechend<br />
sichergestellt werden kann <strong>und</strong> diese untereinander teils auch schon einmal kooperieren<br />
müssen.<br />
Die Schaffung einer gr<strong>und</strong>legenden Vertrauensbasis aller Gruppenmitglieder untereinander<br />
<strong>und</strong> somit eine erste Stärkung des Gruppenbewusstseins bzw. des Gruppenzugehörigkeitsgefühls<br />
dürfte durch das Anbringen eben dieser Spiele hier somit entsprechend sichergestellt<br />
werden können.<br />
6.2 Aktivitäten der Phase 2<br />
Zehnerfangen<br />
Benötigte Mittel <strong>und</strong> Materialien<br />
• einen etwas größeren weicheren Ball (beispielsweise einen aufblasbaren Wasserball)<br />
• Stoffbänder (Anzahl hier abhängig von der der jeweiligen Teilnehmer) in zwei<br />
unterschiedlichen Farbrichtungen<br />
Spielart<br />
Bewegungsspiel mit einem interaktionsintensiven Charakter<br />
Spielablauf<br />
Die teilhabenden Mitspieler werden hier von der die Gesamtaktion anleitenden Person in zwei<br />
gleichgroße (nach Möglichkeit ebenso gleichstarke) Gruppen aufgeteilt.<br />
Jene Aufteilung kann hier nun beispielsweise an Hand ganz bestimmter Merkmale erfolgen,<br />
die einige der anwesenden Mitspieler gemeinsam haben.<br />
So könnten sich beispielsweise alle Teilnehmer zusammenfinden, welche dunkle Sporthosen<br />
oder auch helle Sportshirts tragen.<br />
Einer solchen Vorgehensweise kommt an dieser Stelle ein entsprechend pädagogischer<br />
Stellenwert zu, da - würde die Wahl von den Mitspielern selbst vorgenommen - gerade<br />
Jugendliche, aber auch Menschen im Allgemeinen, eher nach dem Kriterium der<br />
gegenseitigen Sympathie auswählen würden.<br />
Dieses könnte hier zur Folge haben, dass bei den Letztgewählten so schon an dieser Stelle<br />
der Eindruck eines gewissen „Ich gehöre ja doch nicht richtig dazu – Gefühles“ aufkommt,<br />
was hier natürlich gr<strong>und</strong>sätzlich gegen einen der wichtigen Gr<strong>und</strong>gedanken des <strong>Abenteuer</strong><strong>und</strong><br />
<strong>Erlebnissport</strong>es - nämlich dem der Förderung einer gegenseitigen Kooperation - arbeiten<br />
würde.<br />
Ist also die Aufteilung der Gruppen unter Anleitung des entsprechenden Spielleiters nach<br />
einem der oben genannten Kriterien erfolgt, bekommen alle Gruppenmitglieder hier nun noch<br />
eines der bereitgelegten farbigen Stoffbänder ausgehändigt.
Jene dienen hier nun dazu, den beiden Gruppen einen besseren Überblick über die jeweiligen<br />
Teammitglieder zu ermöglichen <strong>und</strong> werden somit gut sichtbar (beispielsweise am<br />
Handgelenk) entsprechend befestigt.<br />
Ist auch dieses erfolgt, werden die Mitspieler vom Spielleiter aufgefordert, sich unabhängig<br />
von den anderen Teammitgliedern der eigenen Gruppe im Raum zu verteilen.<br />
Der Spielleiter nimmt nun im Weiteren den etwas größeren weicheren Ball (beispielsweise<br />
einen aufblasbaren Wasserball) zur Hand, dreht sich mit dem Rücken zu den Teilnehmern<br />
des Spieles <strong>und</strong> wirft den Ball in die Menge.<br />
Der Spieler, welcher zuerst den vom Spielleiter geworfenen Ball fängt, versucht unmittelbar<br />
ein Mitglied seines Teams auszumachen <strong>und</strong> diesem den Ball zuzuwerfen.<br />
Sollte jener den Ball entsprechend gefangen haben, setzt er das Spiel nach dem gleichen<br />
Muster fort.<br />
Schafft es eine Mannschaft, sich den Ball gegenseitig zehn Mal hintereinander zuzuwerfen -<br />
der Ball darf zwischenzeitlich den Boden nicht berühren - erhält diese einen Punkt.<br />
Die Mitglieder des Teams, welches gerade nicht in Ballbesitz ist, versuchen natürlich dem<br />
jeweils anderen Team den Ball abzunehmen, um entsprechend eigene Punkte sammeln zu<br />
können.<br />
Der Ball darf also beim Zuspielen innerhalb des gleichen Teams nicht nur den Boden nicht<br />
berühren, sondern die Kette darf hier - zum Punkterhalt - auch nicht durch ein Mitglied des<br />
generischen Teams unterbrochen werden.<br />
Das Spiel kann entweder beendet werden, wenn eine der Mannschaften eine zuvor<br />
gemeinsam festgelegte Punktzahl erreicht hat, kann sich aber auch an dem beobachtbaren<br />
Interesse sowie an der beobachtbaren Motivation der Mitspieler orientieren.<br />
Banksortieren<br />
Benötigte Mittel <strong>und</strong> Materialien<br />
• eine etwas größere „Turnhallen“-Bank<br />
Spielart<br />
Kooperationsförderndes Spiel mit stark interaktionsintensivem Charakter<br />
Spielablauf<br />
Alle Teilnehmer des Spieles werden hier von der die Gesamtaktion anleitenden Person<br />
gebeten, sich auf einer zuvor entsprechend bereitgestellten etwas größeren „Turnhallen“-Bank<br />
beliebig aufzustellen.<br />
Ist dieses geschehen, erhalten die Mitspieler von dem entsprechenden Spielleiter nun die<br />
Aufgabe, sich nach ganz bestimmten Kriterien (beispielsweise Größe, Alter oder Ähnlichem)<br />
auf der Bank zu sortieren, <strong>und</strong> zwar ohne dass hierbei nun der Raumboden berührt werden<br />
darf; denn sobald dieses geschieht, erfolgt ein unmittelbarer Neubeginn der Aktivität.<br />
Wie die Spieler die gestellte Aufgabe angehen, liegt nun ganz bei ihnen, so dass an dieser<br />
Stelle demnach eine sehr hochkonzentrierte Kooperation der Teilnehmer untereinander<br />
bezüglich der Findung einer kreativen Lösungsmöglichkeit gefragt ist.<br />
Der Spielleiter gibt hier nämlich zunächst lediglich die eben benannte Regel des „verbotenen<br />
Berührens des Raumbodens“ als einzuhaltende Vorgabe.<br />
Das Spiel bzw. die Aktivität ist dann beendet, wenn es der jeweiligen Gruppenkonstellation<br />
gelungen ist, die ihnen gestellte Aufgabe - auf welche kreative Art <strong>und</strong> Weise auch immer -<br />
unter Berücksichtigung des oben genannten Kriteriums entsprechend zu erfüllen.<br />
Sollten die Spielmitglieder auch nach reichlicher Überlegung zu keiner realisierbaren Lösung<br />
gekommen sein, liegt es natürlich in der Hand des jeweiligen Spielleiters, diesen<br />
weiterreichende Impulse zur Bewältigung der Situation darzubieten, sprich sich<br />
gegebenenfalls in die Überlegungen der Gruppe einzuklinken.<br />
Partnerblindparcours<br />
Benötigte Mittel <strong>und</strong> Materialien
Die für die Durchführung eines solch entsprechenden Partnerblindparcours benötigten Mittel<br />
<strong>und</strong> Materialien können hier nach eigenem Ermessen ausgewählt werden <strong>und</strong> sind hier<br />
selbstverständlich stets den gegebenen Ressourcen anzupassen.
Spielart<br />
Spiel zur Förderung der Selbstwahrnehmung die eigene Person betreffend sowie zusätzliche<br />
Kooperation der jeweiligen Teampartner untereinander, da auch hier ein äußerst stark<br />
ausgeprägter interaktionsintensiver Spiel-/ Aktivitätscharakter vorliegt.<br />
Spielablauf<br />
Vor Beginn der eigentlichen Durchführung eines solch eben genannten Partnerblindparcours<br />
muss der Spielleiter zunächst einmal einen solchen errichten <strong>und</strong> zwar ohne dass die<br />
Teilnehmer die Möglichkeit erhalten, jenen schon bereits zu diesem Zeitpunkt in Augenschein<br />
nehmen zu können.<br />
Die Vorbereitung muss demnach im Vorfeld innerhalb einer klar von den anderen Aktionen<br />
abgegrenzten Räumlichkeit erfolgen, oder aber durch sich zuvor zur Verfügung gestellte<br />
Helferinnen <strong>und</strong> Helfer vorgenommen werden, <strong>und</strong> zwar innerhalb des Zeitraumes, in<br />
welchem der Spielleiter mit der Gruppe die jeweilige Räumlichkeit verlässt, um jene in die<br />
unmittelbar bevorstehende Aktivität gr<strong>und</strong>legend einzuführen.<br />
Zusätzlich sei an dieser Stelle zu beachten, dass der errichtete Partnerblindparcours keine<br />
ernsthaft „gefährlichen“ Anbringungen, sprich also beispielsweise Gerätschaften mit einem<br />
möglicherweise doch recht hohen Verletzungsrisiko, enthalten sollte.<br />
Solche Sicherheitsmaßnahmen schließen hier jedoch nicht aus, die Teammitglieder teils auch<br />
vor etwas kniffeligere Aufgaben <strong>und</strong> Situationen zu stellen (stets altersangemessen!), sprich<br />
jene auch schon einmal in einem etwas intensiveren Maße herauszufordern.<br />
Sind all jene Aspekte <strong>und</strong> Kriterien in die jeweilige Errichtung eines solchen<br />
Partnerblindparcours eingeflossen <strong>und</strong> die gr<strong>und</strong>legenden Vorbereitungen demnach<br />
abgeschlossen, werden nun alle Mitspieler bzw. Teilnehmer des Partnerblindparcours<br />
zunächst einmal von der die Gesamtaktion anleitenden Person gebeten, sich an einer zuvor<br />
von dieser speziell ausgesuchten Örtlichkeit zu versammeln.<br />
Bevor nun die eigentliche Aufgabe vom Spielleiter an die Gruppe gestellt werden kann, liegt<br />
es zunächst an diesem, die Teilnehmer äußerst gründlich auf die bevorstehende Situation<br />
vorzubereiten, da ein Einlassen dieser auf sowie eine erfolgreiche Durchführung dieser<br />
Aktivität an sich nur mittels eben einer solchen Vorbereitung auch entsprechend realisierbar<br />
ist.<br />
Hier kann <strong>und</strong> sollte der Spielleiter somit zunächst einmal auf die Wichtigkeit einer<br />
hochintensiven Konzentration <strong>und</strong> Aufmerksamkeit der einzelnen Teilnehmer verweisen,<br />
welche zur Erreichung des gewünschten Zieles - Bewältigung der gestellten Aufgabe - von<br />
unerlässlicher Bedeutung ist.<br />
Ist das Interesse sowie die gr<strong>und</strong>legende Neugier aller Beteiligten durch eben einen solchen<br />
zweckdienlichen Spannungsaufbau erfolgt, werden die Aktivitätsmitglieder im Weiteren<br />
gr<strong>und</strong>legend über die unmittelbar bevorstehende, zu meisternde Situation aufgeklärt.<br />
Jene sieht hier nun nämlich so aus, dass sich im Folgenden immer zwei Gruppenmitglieder zu<br />
einem Paar zusammenfinden, einem dieser Paarmitglieder jeweils mit einem der zuvor vom<br />
Spielleiter bereitgelegten größeren Stofftücher (oder aber auch Schals) die Augen verb<strong>und</strong>en<br />
werden <strong>und</strong> dem jeweils anderen Paarmitglied die Aufgabe zugeschrieben wird, den<br />
jeweiligen Partner durch den zu betretenden Blindparcours hindurchzuführen.<br />
Gerade an dieser Stelle ist es noch einmal von äußerster Wichtigkeit, dass der Spielleiter<br />
ausdrücklich an das Verantwortungsbewusstsein der gesamten Gruppe appelliert, was hier<br />
wohl eines der vordergründigsten <strong>und</strong> bedeutsamsten Kriterien ausmacht.<br />
Ist es den jeweiligen Paaren gelungen, denn Blindparcours zu passieren, kann im Folgenden<br />
ein Wechsel, sprich ein entsprechender Rollentausch der jeweiligen Paarmitglieder<br />
untereinander erfolgen.<br />
Die Paare sollten <strong>und</strong> müssen hier zudem frei entscheiden können, an welcher Stelle des<br />
Blindparcours sie beginnen <strong>und</strong> ebenso auf welche der dargebotenen Situationen sie sich<br />
entsprechend einlassen möchten.<br />
Auch hier findet somit selbstverständlich das schon oben näher erläuterte Prinzip der<br />
Freiwilligkeit Anwendung.<br />
Hat jedes Gruppenmitglied beide Rollen - die eines „Blinden“ sowie die eines „Blindenführers“<br />
- eingenommen, kann die Aktivität hier nun gr<strong>und</strong>legend abgeschlossen werden.<br />
Sinnvoll ist es hier jedoch gerade im Anschluss an eine solche <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong><br />
<strong>Erlebnissport</strong>aktivität eine gemeinsame Reflexion unter Beisein aller Beteiligten
durchzuführen, innerhalb derer ähnliche Fragestellungen wie die in den zuvor aufgeführten<br />
allgemeinen Aufzeichnungen bereits erwähnten angebracht werden können.<br />
Schon an dieser Stelle eine erste kleinere Reflexion durchzuführen ist deshalb pädagogisch<br />
sinnvoll, da den Teilnehmern zu diesem Zeitpunkt die gemachten Erlebnisse <strong>und</strong> Erfahrungen<br />
sowie ebenso die unmittelbar damit in Verbindung stehenden Gefühlslagen noch unmittelbar<br />
präsent sind.<br />
Die Wahl eines späteren Zeitpunktes zur Durchführung einer solchen Reflexion könnte hier<br />
nun das eigentliche Ziel einer ausführlichen <strong>und</strong> vor allen Dingen realen Rückmeldung aller<br />
Beteiligten bezüglich jenes Kernstückes der vorliegend konzeptionierten <strong>Abenteuer</strong>- <strong>und</strong><br />
<strong>Erlebnissport</strong>einheit so gewissermaßen gefährden.<br />
6.3 Aktivitäten der Phase 3<br />
Gordischer Knoten<br />
Benötigte Mittel <strong>und</strong> Materialien<br />
• einige Springseilchen (nach Möglichkeit in unterschiedlichen Farbrichtungen), deren<br />
Anzahl auf die der jeweiligen Teilnehmer abgestimmt werden muss<br />
Spielart<br />
Kooperationsförderndes Spiel mit stark interaktionsintensivem Charakter<br />
Spielablauf<br />
Zunächst einmal versammeln sich alle am Spiel Teilhabenden in einem großen Kreis.<br />
Sobald dieses geschehen ist, erhält jeder Spieler im Weiteren von der die Gesamtaktion<br />
anleitenden Person zwei der zuvor entsprechend bereitgelegten Springseilchen, welche vom<br />
jeweiligen Empfänger an je einer Seite festgehalten werden.<br />
Die andere Seite des jeweiligen Springseilchens wird hier vom jeweiligen Spielnachbar<br />
ergriffen, so dass letztendlich ein entsprechend geschlossener Kreis entsteht.<br />
Der Spielleiter wird die Teilnehmer nun in einem weiteren Schritt dazu auffordern, aufeinander<br />
zuzugehen <strong>und</strong> kreuz <strong>und</strong> quer über die eigenen oder aber auch über die Springseilchen der<br />
jeweils anderen Mitspieler herüber zu steigen, so dass ein regelrechter Knoten entsteht (siehe<br />
Titel des Spieles).<br />
Nun ist es an der gesamten am Spiel teilhabenden Gruppe, den entstandenen Knoten wieder<br />
aufzulösen <strong>und</strong> zwar ohne, dass einer der Spieler die beiden in den Händen gehaltenen<br />
Seilenden loslässt.<br />
Beendet ist die Aktion, wenn der Gruppe unter gemeinsamer Überlegung <strong>und</strong> somit mittels<br />
einer entsprechenden Kooperation untereinander eben die Bewältigung dieser<br />
Aufgabenstellung erfolgreich geglückt ist.<br />
Balltreiben<br />
Benötigte Mittel <strong>und</strong> Materialien<br />
• einen Medizinball<br />
• einige mittelgroße etwas härtere Bälle<br />
Spielart<br />
Bewegungsspiel mit einem interaktionsintensiven Charakter<br />
Spielablauf<br />
Die teilhabenden Mitspieler werden hier - wie bei der zuvor erwähnten Aktivität mit dem Titel<br />
„Zehnerfangen“ auch - von der die Gesamtaktion anleitenden Person in zwei gleichgroße<br />
(nach Möglichkeit ebenso gleichstarke) Gruppen aufgeteilt.
Jene Aufteilung kann hier nun beispielsweise an Hand ganz bestimmter Merkmale erfolgen,<br />
die einige der anwesenden Mitspieler gemeinsam haben.<br />
So könnten sich beispielsweise alle Teilnehmer zusammenfinden, welche dunkle Sporthosen<br />
oder auch helle Sportshirts tragen.<br />
Einer solchen Vorgehensweise kommt an dieser Stelle ein entsprechend pädagogischer<br />
Stellenwert zu, da - würde die Wahl von den Mitspielern selbst vorgenommen - gerade<br />
Jugendliche, aber auch Menschen im Allgemeinen, eher nach dem Kriterium der<br />
gegenseitigen Sympathie auswählen würden.<br />
Dieses könnte hier zur Folge haben, dass bei den Letztgewählten so schon an dieser Stelle<br />
der Eindruck eines gewissen „Ich gehöre ja doch nicht richtig dazu – Gefühles“ aufkommt,<br />
was hier natürlich gr<strong>und</strong>sätzlich gegen einen der wichtigen Gr<strong>und</strong>gedanken des <strong>Abenteuer</strong><strong>und</strong><br />
<strong>Erlebnissport</strong>es - nämlich dem der Förderung einer gegenseitigen Kooperation - arbeiten<br />
würde.<br />
Ist also die Aufteilung der Gruppen unter Anleitung des entsprechenden Spielleiters nach<br />
einem der oben genannten Kriterien erfolgt, werden diese nun in einem nachfolgenden Schritt<br />
gebeten, sich jeweils an den hinteren äußeren Rand der beiden Turnhallenseiten zu begeben.<br />
Dort angekommen, verteilt der Spielleiter nun einige der mittelgroßen etwas härteren Bälle in<br />
unmittelbarer Nähe zu den jeweiligen Gruppenmitgliedern <strong>und</strong> legt zudem den schweren<br />
Medizinball exakt in die Mitte auf den Hallenboden.<br />
Beide Teams versuchen nun auf das Startzeichen des Spielleiters hin, jenen schweren<br />
Medizinball mit den zuvor verteilten mittelgroßen etwas schwereren Bällen so zu treffen, dass<br />
jener immer weiter in das Gebiet des Gegenteams eindringt <strong>und</strong> letztendlich bei dem<br />
entsprechenden Team ankommt.<br />
VORSICHT!!!<br />
Denn hierbei darf das eigentliche Spielfeld keinesfalls betreten werden!<br />
Gelingt es einer Mannschaft nun den Medizinball unmittelbar vor die Füße der<br />
Gegenmannschaft zu treiben, erhält diese einen entsprechenden Spielpunkt.<br />
Der Spielleiter positioniert den Medizinball nun erneut an dessen ursprünglichen<br />
Ausgangsposition, so dass das Spiel weitergehen kann.<br />
Bei dem Balltreiben der beiden Mannschaften dürfen <strong>und</strong> sollen hier nun alle Mitglieder des<br />
jeweiligen Teams parallel agieren.<br />
Auch die Hallenseiten können hier, nach vorheriger gemeinsamer Absprache mittig unterteilt<br />
werden <strong>und</strong> dürfen dementsprechend ebenfalls einer Nutzung unterzogen werden.<br />
Beendet werden kann das Spiel entweder, wenn eine der Mannschaften eine zuvor<br />
gemeinsam festgelegte Punktzahl erreicht hat, kann sich aber auch an dem beobachtbaren<br />
Interesse sowie an der beobachtbaren Motivation der Mitspieler orientieren.<br />
Möhrenziehen<br />
Spielart<br />
Kooperationsförderndes Spiel mit interaktionsintensivem Charakter<br />
Spielverlauf<br />
Zunächst einmal werden alle Teilnehmer der Aktion vom Anleiter gebeten, sich in der Turn-/<br />
Sporthallenmitte zusammenzufinden <strong>und</strong> auf dem Bauch liegend einen etwas größeren Kreis<br />
zu bilden.<br />
Ist dieses geschehen, motiviert der Spielleiter einen Teilnehmer dazu, ihm die seinige Rolle<br />
abzunehmen, sprich zunächst einmal den Kreis zu verlassen.<br />
Alle anderen Gruppenmitglieder werden hingegen gebeten, eng zusammen zu rücken <strong>und</strong><br />
sich gegenseitig fest an die Hände bzw. an die Handgelenke zu fassen.<br />
VORSICHT!!!<br />
Ein gegenseitiges Einhaken der Arme ist hier aufgr<strong>und</strong> einer doch recht großen<br />
Verletzungsgefahr strengstens untersagt!
Der Spielteilnehmer, welcher nun zuvor den Kreis verlassen hat, wird nun gebeten, eine der<br />
im Kreis liegenden Personen auszuwählen, die Beine dieser zu fassen <strong>und</strong> fest an diesen zu<br />
ziehen, so dass dieser es nach Möglichkeit nicht schafft, dem Ruck standzuhalten, sprich sich<br />
an den neben ihn liegenden Nachbarn festzuklammern.<br />
Lässt der gezogene Mitspieler los, schließen die verbleibenden Teilnehmer die entstandene<br />
Lücke durch Aufschließen umgehend <strong>und</strong> das Spiel geht weiter.<br />
All die Teilnehmer, welche im Verlaufe der Aktion „gezogen“ werden, dürfen hier im Übrigen<br />
dem anfänglichen „Zieher“ bei dessen Arbeit helfen, sprich diesen durch aktives Tun<br />
entsprechend unterstützen.<br />
Beendet ist das Spiel, sobald nur noch zwei Partner sich gegenseitig an den Händen halten.<br />
Diese sind nun die entsprechenden Sieger des Spieles.