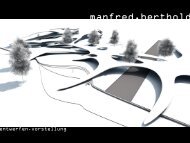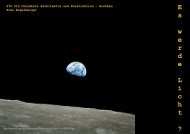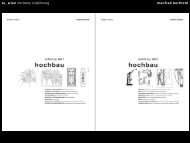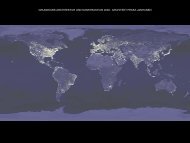Baudurchführung + AVA Vo. 270.103 PRÃFUNGSFRAGEN 2011.12 ...
Baudurchführung + AVA Vo. 270.103 PRÃFUNGSFRAGEN 2011.12 ...
Baudurchführung + AVA Vo. 270.103 PRÃFUNGSFRAGEN 2011.12 ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Baudurchführung + <strong>AVA</strong> <strong>Vo</strong>. <strong>270.103</strong> PRÜFUNGSFRAGEN <strong>2011.12</strong><br />
Beschreiben Sie …. / Definieren Sie …. / Was ist / sind ….<br />
1. PROJEKTORGANISATION<br />
1.01 die Projektbeteiligten eines Planungs- und Bauvorhabens: vom Projektanstoß bis zur Förmlichen Übernahme (ÖN B<br />
2110).<br />
1.02 die Projektphasen vom Projektanstoß bis zur Rechtskraft des Baubescheides.<br />
1.03 die Projektphasen von der Ausschreibung der Bauleistungen bis zur Auftragserteilung an die Baufirmen.<br />
1.04 die Projektphasen von der Auftragserteilung an die Baufirmen bis zur Förmlichen Übernahme.<br />
1.05 die Aufgaben der Projektbeteiligten: a) Auftraggeber, b) Architekt, c) Bauführer (lt. BO. f. Wien).<br />
1.06 die Teilleistungen der Architektur-Planung gem. den Leistungs- und Honorarordnungen der Architekten und Ingenieure.<br />
1.07 die Planungs- / Dienstleistungen gem. der HOAI für Architekten und Ingenieure.<br />
1.08 die <strong>Vo</strong>r- / Nachteile für den Bauherrn (AG) bei der Beauftragung a) von Einzelplanern, b) eines Generalplaners.<br />
1.09 die <strong>Vo</strong>r- / Nachteile für den AG bei der Beauftragung der Baufirmen: a) Einzelunternehmer, b) Teil-<br />
Generalunternehmer (Teil-GU), c) Generalunternehmer (GU), d) Generalübernehmen (Totalunternehmer).<br />
1.10 die Projektphasen der Planung und Objekterrichtung.<br />
1.11 den Projektablauf für die Architektur-Planung und Objekterrichtung aus Sicht des Auftraggebers: vom Projektanstoß<br />
bis zur Nutzung des Bauwerks.<br />
1.12 den Projektablauf für die und Objekterrichtung aus Sicht des Auftraggebers: von der Angebotslegung bis zur Übergabe<br />
des Bauwerks an den Bauherrn.<br />
2. VERGABEVERFAHREN: AUSSCHREIBUNG · ANGEBOT · ZUSCHLAG gem. BVergG 2006<br />
2.01 die drei Stufen des Vergabeverfahrens mit einer Kurzbeschreibung der wesentlichen Inhalte der drei Phasen.<br />
2.02 die wesentlichsten Inhalte der Begriffe: a) „Ausschreibung“, b) „Angebot“, c) „Zuschlag“.<br />
2.03 die Verfahrensgrundsätze gem. BVergG 2006 bzw. ÖN A 2050 für die Vergabe von Bau- und Dienstleistungen.<br />
2.04 die (9) Arten des Vergabeverfahrens gem. BVergG 2006.<br />
2.05 die Bestandteile einer Ausschreibung für die Vergabe von Bauleistungen.<br />
2.06 vorformulierte Vertragsbestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen.<br />
2.07 die Einreichung der Angebote (gem. BVergG 2006 bzw. ÖN A 2050).<br />
2.08 die Öffnung der Angebote (gem. BVergG 2006 bzw. ÖN A 2050).<br />
2.09 den Inhalt einer Niederschrift zur Angebotsöffnung (gem. BVergG 2006 bzw. ÖN A 2050).<br />
2.10 Was ist und wie erfolgt der „Zuschlag“ zu einem Angebot (gem. BVergG 2006 bzw. ÖN A 2050).<br />
Begriffe zum Vergabeverfahren gem. Bundesvergabegesetz (BVergG) 2006:<br />
2.11 die Inhalte des a) Preisangebotsverfahrens, b) Preisaufschlags- und Nachlassverfahrens.<br />
2.12 die Begriffe „Festpreise“ und „Veränderliche Preise“.<br />
2.13 die „Stillhaltefrist“ gem. BVergG. Wie lange dauert sie bei Vergabeverfahren a) im Oberschwellenbereich, b) im<br />
Unterschwellenbereich<br />
2.14 die Begriffe a) Alternativangebot, b) Abänderungsangebot,<br />
2.15 die Begriffe zu „Sicherstellungen“: a) Vadium, b) Kaution, c) Deckungsrücklass, d) Haftrücklass.<br />
2.16 die Begriffe a) Bietergemeinschaft, b) Subunternehmer.<br />
3. KOSTENBERECHNUNGSGRUNDLAGEN: VERTRAGSBESTIMMUNGEN · LEISTUNGSBESCHREIBUNG<br />
3.01 Regelwerke für vorformulierte Vertragsbestimmungen und wesentliche bezugnehmende Gesetze für die Vergabe<br />
von Bau- / Liefer- / Dienstleistungen gem. BVergG 2006.<br />
3.02 technische Spezifikationen in Ausschreibungen für die Vergabe von Bauleistungen.<br />
3.03 die Grundsätze des internationalen, europäischen und nationalen Normungswesen.<br />
3.04 die Rangfolge europäischer technischer Spezifikationen.<br />
3.05 die „CE-Kennzeichung“ von Bauprodukten.<br />
3.06 die Begriffe: a) Regeln der Technik, b) Stand der Technik, c) Stand der Wissenschaft und Technik.<br />
3.07 die Reihenfolge der Vertragsbestandteile einer Ausschreibung für Bauleistungen.<br />
3.08 die Grundsätze einer „neutralen Leistungsbeschreibung“ für Bauleistungen.<br />
3.09 die alphanumerische Gliederung einer Position eines Leistungsverzeichnisses (LV).<br />
3.10 die zwei Arten der Leistungsbeschreibung (LB) für Bauleistungen.<br />
3.11 die „baumstrukturartige Gliederung“ einer Position gem. ÖN A 2063.<br />
3.12 die Namen und Inhalte der Positionskennzeichen „HG“, „OG“, „E“, „W“, „R“, „Z“ und „w“ gem. ÖN A 2063.<br />
3.13 die Mindestinhalte eines Positionslangtextes.<br />
3.14 die Ziele einer präzisen Leistungsbeschreibung.<br />
3.15 ein Beispiel einer a) „konstruktiven Leistungsbeschreibung“, b) „funktionalen Leistungsbeschreibung“ einer Bauleistung<br />
(Position).<br />
3.16 die Arten und Funktionen der „Positions- / Textlücken“ in einem Leistungsverzeichnis.<br />
3.17 Welche Fragen müssen Sie bei der vollständigen Formulierung einer (Leistungs-) Position für Bauleistungen beantworten<br />
3.18 eine „Gipskarton-Ständerwand“ (R’w ≥ 55 dB, H 3,2 m) als a) konstruktive LB, b) funktionale LB.<br />
4. VERGABEVERFAHREN gem. BVergG 2006: EIGNUNGS-, AUSWAHL- und ZUSCHLAGSKRITERIEN<br />
4.01 die Bewerber- / Bieter- / Angebotsbewertungen gem. BVergG 2006 im a) 2-stufigen VG-Verfahren, b) einstufigen<br />
VG-Verfahren.<br />
Was sind (gem. BVergG 2006)<br />
4.02 Eignungskriterien<br />
4.03 Auswahlkriterien<br />
4.04 Zuschlagskriterien<br />
4.05 Was ist gem. BVergG 2006 bei der Eignungsprüfung eines Bewerbers / Bieters zu prüfen<br />
4.06 Wie wird bei 2-stufigen VG-Verfahren das a) „Auswahlverfahren“ und b) „Zuschlagsverfahren“ durchgeführt<br />
4.07 Was sind mögliche „Auswahlkriterien“ für die Vergabe einer komplexen Bauleistung<br />
4.08 die zwei Arten des Zuschlagsverfahrens gem. BVergG 2006.<br />
1<br />
Baudurchführung + <strong>AVA</strong> <strong>Vo</strong>. <strong>270.103</strong> PRÜFUNGSFRAGEN <strong>2011.12</strong><br />
4.09 Methoden zur Ermittlung des „Technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebotes“ gem. BVergG 2006: („Bestbieterprinzip“).<br />
Bsp.e: Formulieren und gewichten Sie die Zuschlagskriterien und Berechnungsmodi für die Auslobung von den n. a. Bauleistungen<br />
nach dem „Bestbieterprinzip“ für<br />
4.10 1.000 Stück „kindergerechte“ Sessel und Tische für eine <strong>Vo</strong>lksschule,<br />
4.11 ein automatisiertes Transportsystem mit geringen Betriebskosten und einer kurzen Reaktionszeit.<br />
5. <strong>AVA</strong>-SOFTWARE<br />
5.01 die Module und Inhalte von <strong>AVA</strong>-Programmen.<br />
5.02 Wie erfolgt der Datenaustausch gem. ÖN A 2063 zw. dem AG und den Bietern<br />
5.03 die Verfahrensmodi für „“elektronische Angebote“.<br />
5.04 den Begriff „e-Procurement“.<br />
5.05 Skizzieren und beschreiben Sie die Phasen des Vergabeverfahrens – von der Massenermittlung und LV-Erstellung<br />
bis zur Beauftragung einer Bauleistung.<br />
6. ANGEBOTSPRÜFUNG · VERTIEFTE ANGEBOTSPRÜFUNG<br />
6.01 In welcher Form und bis zu welchem Zeitpunkt müssen Angebote beim Auftraggeber (Auslober) einlangen<br />
6.02 Wie sind Angebote gem. BVergG 2006 entgegenzunehmen und bis zur Angebotsöffnung zu verwahren<br />
6.03 Wie erfolgt die Angebotsöffnung bei einem „Offenen Verfahren“ gem. BVergG 2006<br />
6.04 Was ist bei der Angebotsöffnung gem. BVergG 2006 a) zu überprüfen, b) zu verlesen, c) zu protokollieren<br />
6.05 Was ist a) ein Variantenangebot, b) eine Abänderungsangebot zu einem (Haupt-) Angebot gem. BVergG 2006<br />
6.06 Was ist bei Angeboten für Bauleistungen gem. BVergG 2006 zu prüfen<br />
6.07 Wie muss der Auftraggeber gem. BVergG 2006 bei a) behebbaren Angebotsmängeln, b) unbehebbaren Angebotsmängeln<br />
vorgehen<br />
6.08 Über welche Inhalte darf bei Angebotsaufklärungsgesprächen gem. BVergG 2006 gesprochen werden<br />
6.09 Rechnerische Angebotsprüfung: Korrigieren Sie die<br />
Position 75.01.01.A Lo. 9,00 € / m²<br />
So. 9,00 € / m²<br />
200,00 m² EHP 27,00 € / m² PP 5.400,00 €<br />
Position 75.01.01.B Lo. 18,90 € / m²<br />
So. 8,10 € / m²<br />
200,00 m² EHP 27,00 € / m² PP 5.000,00 €<br />
Position 75.01.01.C Lo. 18,00 € / m²<br />
So. 5,00 € / m²<br />
200,00 m² EHP 27,00 € / m² PP 5.000,00 €<br />
6.10 Wie sind die Preisanteile „Lohn“ und „Sonstiges“ umzurechnen, wenn die Addition der Preisanteile nicht den angegebenen<br />
Einheitspreis ergibt<br />
6.11 Was ist bei der „vertieften Angebotsprüfung „ zu prüfen<br />
6.12 die Hilfsmittel und Ziele der „vertieften Angebotsprüfung“.<br />
6.13 Was ist ein „Bietersturz“<br />
6.14 Was ist a) der „Gesamtpreis“ eines Angebotes, b) der „zivilrechtliche Preis“<br />
6.15 Wie kann der AG ein Vergabeverfahren gem. BVergG 2006 beenden, wenn a) kein Angebot eingelangt ist, b) nur<br />
ein Angebot eingelangt ist<br />
6.16 Wie muss der AG (Auslober) bei nicht plausiblen Einheitspreisen eines Angebotes (gem. BVergG 2006) vorgehen<br />
6.17 Was sind a) „behebbare Mängel“, b) „unbehebbare Mängel“ eines Angebotes (gem. BVergG 2006).<br />
6.18 Vertiefte Angebotsprüfung einer „wesentlichen Position“ („w“):<br />
Wie wird die Angemessenheit der „Einheitspreise“ und der Preisanteile „Lohn“ und „Sonstiges“ für die Position einer<br />
Bauleistung geprüft Welche Hilfsmittel verwenden wir dabei<br />
6.19 Vertiefte Angebotsprüfung der Position<br />
07.03.01D Beton Decke / Kragplatte H 3,2 m C 30 / 37 bis 25 cm<br />
„w“<br />
Decken und Kragplatten aus Beton mit ebener Untersicht, einschließlich Deckenroste, wenn diese<br />
in einem Arbeitsgang mitbetoniert werden können. Gesamtunterstellungshöhe H bis 3,2 m.<br />
Lo. € 18,00<br />
So. € 36,00<br />
450,00 m³ EHP € 54,00 € 24.300,00<br />
Sind der Einheitspreis und die Preisanteile plausibel Wenn nicht, wie müssen Sie bei der Angebotsprüfung vorgehen<br />
6.20 Welche Hilfsmittel für die Analyse von Angebotspreisen verwenden wir<br />
6.21 Wie sind Bieteraufklärungsgespräche bei VG-Verfahren gem. BVergG 2006 zu führen und zu protokollieren<br />
6. ZUSCHLAG · RECHTSMITTEL gem. BVergG 2006<br />
6.22 Was ist den Bietern gem. BVergG 2006 in der Bekanntgabe der Zuschlagsentscheidung bekannt zu geben<br />
6.23 Was ist die „Zuschlagsfrist“ gem. BVergG 2006<br />
6.24 Was ist die „Stillhaltefrist“ gem. BVergG 2006 Wie lange dauert sie a) im Oberschwellenbereich, b) im Unterschwellenbereich<br />
6.25 Was sind „Schwellenwerte“ gem. BVergG 2006 Wie werden sie vom AG berechnet<br />
6.26 Was ist a) der Schlussbrief, b) der Gegenschlussbrief<br />
6.27 die Folgen eines Rücktritts eines Bieters während der Zuschlagsfrist.<br />
6.28 Wie erfolgt der Widerruf eines Vergabeverfahrens gem. BVergG 2006 vor Ablauf der Angebotsfrist<br />
6.29 Gründe für den Widerruf eines Vergabeverfahrens gem. BVergG 2006 vor Ablauf der Angebotsfrist.<br />
6.30 die Rechtsinstanzen gem. BVergG 2006: Rechtschutz für Bieter.<br />
6.31 die Aufgabe / Funktion des Bundesvergabeamtes (BVA) gem. BVergG 2006.<br />
7. TERMINPLANUNG<br />
7.01 die Methoden der Terminplanung und deren graphische Darstellungsmethoden.<br />
2
Baudurchführung + <strong>AVA</strong> <strong>Vo</strong>. <strong>270.103</strong> PRÜFUNGSFRAGEN <strong>2011.12</strong><br />
Baudurchführung + <strong>AVA</strong> <strong>Vo</strong>. <strong>270.103</strong> PRÜFUNGSFRAGEN <strong>2011.12</strong><br />
7.02 die Funktion und wesentlichen Inhalte eines a) Rahmenterminplans, b) Phasenterminplans und c) Detailtermin- /<br />
Bauzeitplans.<br />
7.03 die Methodik, <strong>Vo</strong>r- und Nachteile der „Netzplantechnik“.<br />
7.04 die Netzplantypen und deren graphische Darstellung.<br />
7.05 die (fünf) Fragen, die für jeden <strong>Vo</strong>rgang eines Netzplans beantwortet werden müssen.<br />
7.06 Was sind „Anordnungsbeziehungen“ in der Netzplantechnik<br />
7.07 die Arten und Berechnung der „Pufferzeiten“ in der Netzplantechnik.<br />
7.08 Was ist der „Kritische Weg“ in einem Netzplan<br />
7.09 Zeichnen Sie einen Rahmenterminplan für die Bauphase: vom Baubeginn bis zur Förmlichen Übernahme für ein<br />
freistehendes Bürogebäude mit 1 Keller, Erd- und 3 Obergeschoßen. Die BGF je Geschoß beträgt 900 m², die Gesamt-BGF<br />
beträgt 900 m² x 5 Geschoße = 4.500 m².<br />
7.10 Zeichnen Sie einen Bauphasen- und Bauzeitplan für den Umbau einer Wohnung mit ca. 80 m² Nutzfläche. Abbruch:<br />
50 m² Zwischenwände 14 cm ÖF, verputzt, Abbruch Bad und WC, 50 m² neue Trockenbauwände, neues Bad und<br />
WC, neue Elektroinstallationen in allen Räumen, Innenputz, Putzbeschichtung (Malerei), schwimmende Estriche im<br />
Bad und WC, neue Verfliesung und 50 m² Parkettböden sanieren, schleifen und versiegeln.<br />
7.11 die <strong>Vo</strong>rteile der Netzplantechnik bei der Terminkontrolle und -steuerung.<br />
7.12 Zeichnen und beschreiben Sie ein „Zeit-Weg-Diagramm“ für eine „Linienbaustelle“, z. B. für 1.900 m erdverlegte<br />
Kanal-Grundleitungen mit Putzschächten; die Kanalsohle liegt 1,4 bis 4,5 m unter dem Geländeniveau; Leistungen:<br />
1. Aushub + Pölzung, 2. Rohverlegung, 3. Hinterfüllen + Abbruch der Pölzung.<br />
8. KOSTENPLANUNG / -ERMITTLUNG gem. ÖN B 1801.1<br />
8.01 die „Kostengruppierung“ gem. ÖN B 1801.1: die a) Bauwerkskosten, b) Baukosten, c) Errichtungskosten und d)<br />
Gesamtkosten.<br />
8.02 die Begriffe: a) Kostenrahmen, b) Kostenschätzung, c) Kostenberechnung, d) Kostenanschlag, e) Kostenfeststellung.<br />
8.03 die Modi und wesentlichen Inhalte einer Kostenschätzung für einen Hochbau nach „Kennwerten“.<br />
8.04 die Modi und wesentlichen Inhalte der „Kostenberechnung mit Elementen“.<br />
8.05 die Kostengenauigkeiten in den Planungsphasen = %-Abweichungen „plus / minus“ in der Projektphase: a) Grundlagenermittlung<br />
(Raum- und Funktionsprogramm), b) <strong>Vo</strong>rentwurfsplanung / <strong>Vo</strong>rplanung, c) Entwurfsplanung, d) Ausführungsplanung<br />
/ Einleitung des Vergabeverfahrens.<br />
8.06 die 10 Kostenbereiche lt. ÖN B 1801.1.<br />
8.07 Grob-Kostenschätzung:<br />
Ermitteln Sie die „Baukosten“ gem. ÖN B 1801.1 für ein freistehendes Bürogebäude (Keller, Erd- und 3 Obergeschoße)<br />
mit ca. 5.000 m² BGFa am Stadtrand Wiens; KGR 1 Aufschließung = 0,5 Mio. €, KGR 5 Ausstattung = 0,5<br />
Mio. €.<br />
8.08 Ermitteln Sie die Elementkosten gem. ÖN B 1801.1 für 950 m² punktgelagerter Stahlbetondecken (ü. d. EG, O1 und<br />
O2), Betongüte C 30 / 37, 7,5 / 7,5 m Spannweite, punktgelagert (Pilzdecke), 135 kg BST 550 / m³ Beton, Unter- und<br />
Deckenstirnseiten aus Holz-Sicht-Schalung (glatt).<br />
8.09 Ermitteln Sie die Elementkosten gem. ÖN B 1801.1 für 950 m² Fußbodenkonstruktionen (im O1, O2 und O3), bestehend<br />
aus: 5 cm EPS-Beschüttung, 3 cm Mineralwolle-TDPT 30 / 30, PE- Folie 50 my, 6 cm CT-Unterlagsestrich<br />
C 30.<br />
9. ÖRTLICHE BAUAUFSICHT: AUSFÜHRUNSGSÜBERWACHUNG · PRÜF- und WARNPFLICHT<br />
9.01 den Leistungsinhalt / das Leistungsbild der Örtlichen Bauaufsicht (ÖBA) gem. HOAI.<br />
9.02 die Aufgaben der ÖBA vom Baubeginn bis zur Förmlichen Übernahme.<br />
9.03 die „Zahlungsfreigabe“ einer a) Abschlagsrechnung, b) Schlussrechnung.<br />
9.04 die Höhe des a) Deckungsrücklasses und b) des Haftrücklasses lt. ÖN B 2110.<br />
Wie muss der AG / die ÖBA gem. ÖN B 2110 vorgehen / Was ist von der ÖBA zu veranlassen:<br />
9.05 bei erkennbarer Überschreitung der Leistungsfrist<br />
9.06 bei der Behinderung eines Nachunternehmers, wenn die <strong>Vo</strong>rleistung mangelhaft o. unvollständig ist<br />
9.07 bei „Gefahr in Verzug“<br />
9.08 die Dokumentationspflichten gem. ÖN B 2110: a) der ÖBA und b) der Baufirmen während der Bauführung.<br />
9.09 die erforderlichen Eintragungen der Baufirmen in das Bautagebuch.<br />
9.10 Was ist a) der Deckungsrücklass und b) der Haftrücklass Wie werden sie berechnet<br />
9.11 die Aufgaben und Pflichten des Bauführers gem. BO. f. Wien.<br />
9.12 die erforderlichen Überprüfungen während der Bauausführung gem. BO. f. Wien.<br />
9.13 die Fertigstellungsanzeige gem. BO. f. Wien.<br />
9.14 die Begriffe a) Leistungsplanung und b) Leistungskontrolle.<br />
9.15 die Mitteilungspflicht des AG bei einer „Leistungsänderung“ (gem. ÖN B 2110).<br />
9.16 die „Besondere Haftung mehrerer Auftragnehmer“<br />
9.17 die Begriffe a) Verzug, b) Vertragsstrafe bei Verzug (gem. ÖN B 2110).<br />
9.18 Skizzieren Sie ein Organigramm für den Datenaustausch zw. Auftraggeber, Generalplaner (GP), ÖBA, Einzel- und<br />
Teil-GU-Auftragnehmern für ein komplexes Bauvorhaben (mit Herstellungskosten von ca. 19 Mio. €).<br />
10. FÖRMLICHE ÜBERNAHME · GEWÄHRLEISTUNG<br />
10.01 Wann erfolgt der Gefahrenübergang (aus einem Werkvertrag) vom AN an den AG<br />
10.02 Was ist bei der Förmlichen Übernahme gem. ÖN B 2110 zu protokollieren<br />
10.03 Wann beginnt / endet die Gewährleistungsfrist<br />
10.04 die Dauer der Gewährleistung a) für unbewegliche, b) für bewegliche Sachen.<br />
10.05 Was ist und wie erfolgt die „Schlussfeststellung“ gem. ÖN B 2110<br />
10.06 Formulieren Sie eine Mängelrüge innerhalb der Gewährleistungsfrist für eine „schadhafte bituminöse Dachabdichtung<br />
und Durchnässung der obersten Decke eines Wohnhauses“.<br />
Beschreiben Sie Maßnahmen des AG / der ÖBA<br />
10.07 bei einem drohenden Bauverzug = erkennbarer Überschreitung der Ausführungsfrist.<br />
10.08 bei der Feststellung von Qualitätsmängeln der Bauausführung.<br />
3<br />
10.09 bei Erkennen einer vertragswidrigen Leistung.<br />
10.10 Wann kann der AG die Übernahme einer Bauleistung verweigern<br />
10.11 Was sind „Allgemeine Bauschäden“<br />
10.12 die Inhalte der Prüf- und Warnpflicht der ÖBA.<br />
10.13 die Inhalte der Prüf- und Warnpflicht der Baufirmen.<br />
10.14 Wann liegt ein „Verzug“ eines Vertragspartners aus einem Werkvertrag gem. ÖN B 2110 vor<br />
10.15 Was ist eine „Vertragsstrafe“ („Pönale“) Wie wird sie berechnet<br />
10.16 Definieren Sie Begriffe: a) Mangel, b) Mangelschaden, c) Mangelfolgeschaden.<br />
11. SICHERHEIT AUF BAUSTELLEN: BauKG: SiGe-Planung und Baustellenkoordination<br />
11.01 die Ziele des BauKG und die Grundsätze der Gefahrenverhütung auf Baustellen.<br />
11.02 die dem Bauherrn übertragenen Pflichten aus dem BauKG.<br />
11.03 die Aufgaben und Instrumente des a) Planungskoordinators, b) Baukoordinators.<br />
11.04 die „<strong>Vo</strong>rankündigung“ gem. BauKG: Was ist die <strong>Vo</strong>rankündigung <strong>Vo</strong>m wem kommt sie und an wen ist die <strong>Vo</strong>rankündigung<br />
zu richten<br />
11.05 den Inhalt einer „<strong>Vo</strong>rankündigung“ gem. BauKG.<br />
11.06 den Inhalt eines SiGe-Plans.<br />
11.07 die Grundsätze der Gefahrenverhütung auf Baustellen.<br />
11.08 die Dokumentation für „spätere Arbeiten“ (gem. BauKG).<br />
12. GRUNDLAGEN der KALKULATION gem. ÖN B 2061· PREISUMRECHNUNG gem. ÖN B 2111<br />
12.01 die Arten der Kalkulation gem. ÖN B 2061.<br />
12.02 die Kostenarten gem. ÖN B 2061.<br />
12.03 die Einzelkosten zur Ermittlung des Gesamtpreises: Einheits- / Pauschalpreis einer Bauleistung.<br />
12.04 die Umrechnung „veränderlicher Preise“ gem. ÖN B 2111.<br />
12.05 die Inhalte der K-Blätter K3, K4, K6 und K7.<br />
12.06 die Grundsätze der Umrechnung der Einheitspreise und der Preisanteile „Lohn“ und „Sonstiges“.<br />
12.07 die Indizes zur Umrechnung von Preisen.<br />
12.08 die Arten der Kalkulation der Baufirmen.<br />
12.09 den Aufbau der Kostenermittlung gem. ÖN B 2061.<br />
12.10 die Preisumrechnung gem. ÖN B 2111.<br />
13. CLAIM MANAGEMENT · NKV-PRÜFUNG … [Zu 13.04 bis 13.09 siehe ibs. 7.3 der ÖN B 2110.]<br />
13.01 Was sind Claims<br />
13.02 die Ursachen für Claims.<br />
13.03 Strategien zur Vermeidung von Claims.<br />
13.04 eine „Leistungsabweichung“ und ihre Folgen.<br />
13.05 den Prozess der Nachtragsprüfung.<br />
13.06 Maßnahmen zur Verhinderung von Nachträgen der Bau- / Handwerksfirmen.<br />
13.07 die Pflichten des AG bei einer „Leistungsänderung“ gem. ÖN B 2110.<br />
13.08 die Pflichten des AN und des AG bei einer „Störung der Leistungserbringung“ gem. ÖN B 2110.<br />
13.09 Wie muss der AG bei einem mangelhaften Nachtragsangebot (NKV) einer Baufirma vorgehen<br />
13.10 Methoden der Streitbeilegung zw. AG (Bauherr) und AN (Baufirmen).<br />
13.11 den Ablauf der Nachtragsprüfung und Freigabe (Beauftragung) einer „Leistungsänderung“ gem. ÖN B 2110.<br />
13.12 Methoden der außergerichtlichen Streitbeilegung zw. AG und AN.<br />
14. RISIKEN · VERSICHERUNGEN · MUSTERBRIEFE<br />
14.01 die Risiken der Projektbeteiligten: a) des Bauherrn, b) der Planer, c) der Baufirmen.<br />
14.02 die mehrstufige Methodik / die Strategie der Risikobewältigung.<br />
14.03 die Methodik der Risikoidentifikation und -analyse.<br />
14.04 die Versicherungen: a) des Bauherrn, b) der Planer, c) der Baufirmen.<br />
14.05 die Inhalte der a) Bauherrnhaftpflichtversicherung, b) Berufshaftpflichtversicherung der Planer, c) Bauwesenversicherung,<br />
c) Betriebshaftpflichtversicherung der Baufirmen.<br />
15. MUSTERBRIEFE: Formulieren Sie als VertreterIn des AG<br />
15.01 eine „Leistungsänderung“: zusätzliche Leistung, die im Vertrag mit dem AN nicht vereinbart ist und zur Erfüllung des<br />
Leistungszieles erforderlich ist.<br />
15.02 eine Mitteilung an mehrere AN zu festgestellten Beschädigungen, deren Verursacher unbekannt sind: Allgemeine<br />
Bauschäden.<br />
15.03 die Aufforderung an den AN zur Mängelbehebung.<br />
15.04 die Zurückweisung einer mangelhaften Rechnung und die Nachforderung fehlender Unterlagen.<br />
15.05 ein „Mängelrüge“ für einen mangelhaften CT-Estrich; Mängel: Ebenheitsabweichungen gem. ÖN DIN 18202, tw.<br />
absandende Oberfläche, Konstruktionsrisse.<br />
15.06 die Aufforderung an eine Bieter, behebbare Angebotsmängel nachzureichen.<br />
16. PRÜFUNGSMODI und -TERMINE<br />
Die Prüfungsmodi und Beispiele werden in der letzten <strong>Vo</strong>rlesung des Wintersemesters besprochen.<br />
Prüfungstermine und Orte: Siehe im TISS der TU Wien.<br />
Die Inhalte der 189 Prüfungsfragen werden in den <strong>Vo</strong>rlesungen besprochen und sind im Skriptum beschrieben.<br />
Für Fragen stehe ich Ihnen in den <strong>Vo</strong>rlesungen und Sprechstunden zur Verfügung.<br />
HP<br />
Wien, 02.01.2012<br />
4