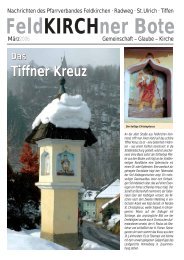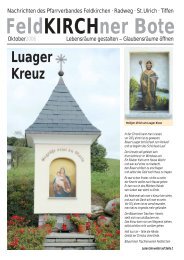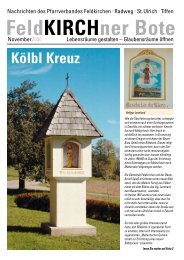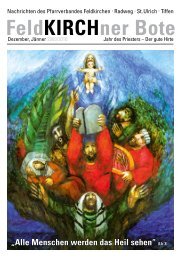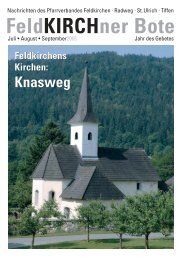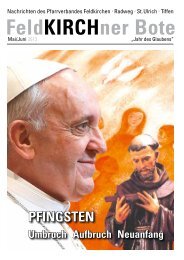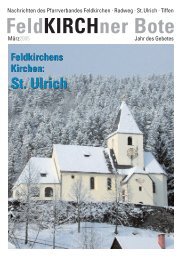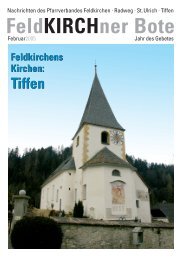Pfarrblatt April 2005 - Pfarre Feldkirchen
Pfarrblatt April 2005 - Pfarre Feldkirchen
Pfarrblatt April 2005 - Pfarre Feldkirchen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2<br />
FeldKIRCHner Bote<br />
Filialkirche Rottendorf<br />
Die Filialkirche Hl. Wolfgang und Hl. Magdalena in Rottendorf liegt, vom gesamten Stadtbereich aus sichtbar,<br />
am steilen Nordhang der Pollenitzen.<br />
Im Jahre 1461, also knapp vor den Türkeneinfällen<br />
(1473 bis 1480), erlaubte Kaiser Friedrich<br />
III. „ain Hültzlein Pethaus an der Polantzen bei<br />
Veldkirchen, Saltzburger Bistumb, dartzu nun<br />
die kristenmenschen begirlich komen und in<br />
andacht verpringen.“ Schon 1495 wird eine<br />
neue, eben die heutige steinerne Kirche, erwähnt.<br />
Der massive Turm ist von Schießscharten und<br />
Schallfenstern durchbrochen und mit einem<br />
hohen Pyramidenhelm gekrönt. Die im Renaissancestil<br />
gehaltene Glocke wurde 1644 in der<br />
Villacher Werkstätte des David Polster gegossen.<br />
Chor und Langhaus werden durch kräftige,<br />
im stufigen Rhythmus ansteigende Pfeilervorlagen<br />
gestützt. Die zweiteiligen Spitzbogenfenster<br />
kommen mit ihrem gotischen Steinmaßwerk<br />
aus Fischblasen- und Dreipassmustern<br />
von innen noch besser zur Geltung.<br />
Die Westfassade zeigt den groben und trutzigen<br />
Charakter einer Wehrkirche. In diese<br />
Frontmauer sind drei Schießscharten und ein in<br />
Kärnten einzigartiger Gusserker eingebaut. Er<br />
diente dazu, heißes Wasser oder heißes Harz<br />
auf die Angreifer hinunterzuschütten. Die rundbogige,<br />
von außen zugängliche Turmtür ist als<br />
Leitereinstieg ziemlich hoch angesetzt. Zu den<br />
Wehrkammern gelangt man über einen hoch<br />
Hochaltar der Kirche Rottendorf<br />
über der Sakristei gelegenen rundbogigen Einstieg.<br />
Das Steinportal ist mit Rillen und einem<br />
Mittelwulst profiliert. Zwischen seinem Segmentbogen<br />
und Rahmen bilden die Achselstücke<br />
eine skulptorisch interessante Übergangslösung.<br />
Das spitzbogige Tonnengewölbe des weiträumigen<br />
Langhauses leitet den Blick über das<br />
ostseitige Fenster und die eingezogenen Stichkappen<br />
zum gotischen Triumphbogen hin. Dahinter<br />
erstreckt sich auf erhöhtem Niveau über<br />
drei Joche der gotische Chor. Vom Boden weg<br />
laufen halbrunde, in der Sockelzone verstärkte<br />
steinerne Dienste, die sich über den Kapitellen<br />
in ein stark profiliertes Kreuzrippengewölbe<br />
verzweigen. An zehn über den ganzen Chorraum<br />
verstreuten Stellen lassen sich in Augenhöhe<br />
die farbig markierten Steinmetzzeichen<br />
acht verschiedener Steinmetzmeister entdecken.<br />
Die Sakristeitür ist mit Eisenbändern<br />
beschlagen, von denen je eines in eine Spirale<br />
und einen Anker ausläuft.<br />
Der Hochaltar aus 1633, <strong>Feldkirchen</strong>s einziger<br />
Renaissancealtar, entspricht dem Typus eines<br />
einfachen Brettaltars. Am Unterbau irritiert ein<br />
stark verwittertes, mit der Stifterlegende umschriebenes<br />
Tafelgemälde. Vielleicht stellte es<br />
die Anbetung des Jesuskindes dar. Rechts und<br />
links dieses Mittelteiles sind die Bilder des<br />
Evangelisten Markus und des hl. Leonhard gemalt<br />
Zwei leicht vorgestellte Säulen stellen das<br />
dazwischen stehende Altarbild in eine gewisse<br />
räumliche Tiefe.<br />
Die erwähnte Legende bezeugt als Stifter<br />
„Hieronymus Foregger Ratsbürger und Handelsmann<br />
zu Veldtchürchen sambt seiner geliebten<br />
Hausfrauen Eva“. Hieronymus Foregger<br />
sen. war (ab 1618) der erste seiner Familie, die<br />
ein Jahrhundert lang dem Bamberger Fürstbischof<br />
die <strong>Feldkirchen</strong>er Amtleute stellte. 1618<br />
verlieh der Bamberger Bischof seinem Amtmann<br />
„Hieronimus Foregger den Thurn zu<br />
Veldtkhirchen, so jetzt der Ambthoff genandt<br />
würdet“. 1629 wurde Hieronymus geadelt und<br />
führte seitdem das Adelsprädikat „von Greifenthurn“.<br />
Die Foreggers amtierten bis 1756.<br />
Standbild Hl. Maria Magdalena mit<br />
Salbölgefäß<br />
Das Altarbild zeigt die Gestalten der Heiligen<br />
Wolfgang, des Kirchenpatorns (mit Bischofsstab),<br />
Clemens (mit Tiara und Papstkreuz), Antonius<br />
(mit Buch und Schwein) und Magdalena,<br />
der Kirchenpatronin (mit dem Ölgefäß). Das<br />
groß gemalte Schwein ist ein Sinnbild der unreinen<br />
Sinnlichkeit, die Antonius der Einsiedler<br />
in der arabischen Wüste durch Fasten und Beten<br />
überwand.<br />
Von der Nordwand grüßt eine gotische, von der<br />
Augsburger Holzschnitzerschule beeinflusste<br />
Konsolfigur der Kirchenpatronin Magdalena<br />
mit dem Salbölgefäß. Ihr nach oben gewendetes<br />
Gesicht ist von besonderem Liebreiz geprägt.<br />
Der hl. Wolfgang wurde 972 zum Bischof von<br />
Regensburg ernannt. In der dortigen Kirche St.<br />
Emmeram ist er begraben. Sein Heiligenattribut<br />
ist das Zimmermannsbeil, das auf seine Klostergründungen<br />
hinweist. Sein Patrozinium<br />
wird am 31. Oktober gefeiert. Maria Magdalena<br />
ist die reuige Sünderin, die ihre Tränen auf<br />
Christi Füße vergoss.<br />
Dr. Hans Neuhold<br />
Fotos: © H. G. Kalian