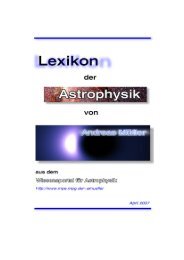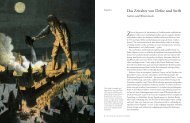Mittelalter - Spektrum der Wissenschaft
Mittelalter - Spektrum der Wissenschaft
Mittelalter - Spektrum der Wissenschaft
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
501–1450<br />
<strong>Mittelalter</strong><br />
Die Schließung des letzten großen Zentrums <strong>der</strong> antiken <strong>Wissenschaft</strong>en und Gelehrsamkeit, <strong>der</strong><br />
Akademie in Athen, im Jahre 529 und die Eroberung Konstantinopels durch die Türken 1453 sowie<br />
die damit verbundene Flucht zahlreicher Gelehrter nach Europa können die formalen Randpunkte<br />
des <strong>Mittelalter</strong>s markieren. Die Abgrenzung des <strong>Mittelalter</strong>s ist unter Historikern sehr umstritten, die<br />
obige Datierung orientiert sich vorrangig an <strong>der</strong> europäischen <strong>Wissenschaft</strong>sentwicklung.<br />
Mit den Völkerwan<strong>der</strong>ungen des 4. bis 6. Jahrhun<strong>der</strong>ts und dem Nie<strong>der</strong>gang des weströmischen<br />
Reiches war einer kontinuierlichen Fortsetzung <strong>der</strong> römisch-antiken Kultur und <strong>Wissenschaft</strong> in<br />
Süd- und Mitteleuropa zunächst die wirtschaftlich-soziale Basis entzogen worden. In den folgenden<br />
Jahrhun<strong>der</strong>ten bildeten sich neue soziale und politische Verhältnisse heraus und es kam allmählich zu<br />
einem Rückgriff auf Kenntnisse und Erfahrungswissen <strong>der</strong> Antike bzw. zu <strong>der</strong>en Wie<strong>der</strong>entdeckung.<br />
Neue Erfindungen för<strong>der</strong>ten ab dem 9. Jahrhun<strong>der</strong>t die Entfaltung <strong>der</strong> Landwirtschaft, gleichzeitig<br />
trennte sich die gewerblich handwerkliche Produktion von <strong>der</strong> Landwirtschaft ab und die Städte wuchsen<br />
seit dem 11. Jahrhun<strong>der</strong>t zunehmend zu Zentren <strong>der</strong> sich entfaltenden Handwerksproduktion und<br />
des Handels heran. Das Zivilisationsgefälle war jedoch in Europa beträchtlich, es verlief von Süden<br />
und Westen nach Norden und Osten. Das Leben war geprägt durch deutliche rechtsständische und<br />
soziale Unterschiede sowie eine nahezu permanente Unsicherheit, u. a. verursacht durch Kriege,<br />
insbeson<strong>der</strong>e viele regionale Konflikte, und Epidemien.<br />
Für die Kultur des <strong>Mittelalter</strong>s bildeten religiöse Vorstellungen die entscheidende Basis. Christentum<br />
und Islam, sowie mit einigen Einschränkungen Buddhismus und Hinduismus, entwickelten sich zu<br />
Weltreligionen. Gleichzeitig erlebte Europa eine wachsende politische Macht kirchlicher Einrichtungen,<br />
die selbst Eigentümer an Grund und Boden wurden.<br />
Dies gipfelte in einem universalen Kaiser- und Papsttum, das aber im Hoch- und Spätmittelalter durch<br />
innerkirchliche Reformbewegungen und aufkommende nationalstaatliche Interessen wie<strong>der</strong> zerfiel.<br />
Die Etablierung des Christentums bedingte zugleich eine Auseinan<strong>der</strong>setzung mit den Ideen und<br />
Lehren <strong>der</strong> antiken griechisch-römisch-hellenistischen Philosophie und an<strong>der</strong>en <strong>Wissenschaft</strong>en,<br />
die im staatlich fester gefügten oströmischen Reich (Byzanz) de facto mit weniger Brüchen und<br />
Konfrontationen verbunden war als in dem sich im völligen Umbruch befindlichen Süd-West-Europa.<br />
Während im byzantinischen Reich durch Bewahrung und Kommentierung antiken Wissens das<br />
erreichte Kultur- und Bildungsniveau erhalten werden konnte, schwand es im ehemaligen weströmischen<br />
Herrschaftsgebiet bis auf wenige Relikte dahin. Lediglich in den Klöstern erfolgte eine Pflege<br />
des antiken Wissens, doch war diese durch die fast völlig fehlende Kenntnis <strong>der</strong> griechischen Sprache<br />
sehr eingeschränkt und durch den Einfluß <strong>der</strong> christlichen Theologie sehr selektiv. Im Mittelpunkt<br />
standen die „sieben freien Künste“, Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Musik, Geometrie<br />
und Astronomie, die als einziger Wissensbestand aus dem Altertum übriggeblieben waren. Erst die<br />
Bestrebungen Karls des Großen sowie die För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> innerhalb des Christentums entstandenen<br />
Schulwissenschaft (Scholastik) in den Kloster- und Kathedralschulen leiteten einen Neuanfang auf<br />
niedrigem Niveau ein.<br />
63
Der für Europa entscheidende Aufschwung begann mit dem am Ende des 11. Jahrhun<strong>der</strong>ts einsetzenden<br />
Wandlungsprozeß, <strong>der</strong> nahezu alle Lebensbereiche erfaßte und bis zum Beginn des 14.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>ts andauerte. Das Bevölkerungswachstum in jenen Jahrhun<strong>der</strong>ten erzwang sowohl die<br />
Erschließung neuer Anbauflächen als auch eine Verbesserung <strong>der</strong> landwirtschaftlichen Methoden<br />
und löste einen Aufschwung von Handwerk, Gewerbe und Handel aus. Dies war verbunden mit<br />
<strong>der</strong> Gründung neuer und dem Wachsen bestehen<strong>der</strong> Städte. Im 12./13. Jahrhun<strong>der</strong>t erlebte das<br />
Geistesleben eine große Blütezeit. Das Grundmuster <strong>der</strong> scholastischen Methode: Herausarbeiten<br />
<strong>der</strong> Fragen, Abgrenzen und Unterscheiden <strong>der</strong> Begriffe sowie Disputation mit logischem Beweis<br />
<strong>der</strong> Antwort und Erörterung <strong>der</strong> Begründung, wurde verfeinert und mehrfach methodisch bereichert.<br />
Das Bestreben, eine Übereinstimmung von kirchlicher Lehre und Philosophie nachzuweisen, blieb<br />
weiterhin wichtigstes Motiv wissenschaftlicher Tätigkeit. Die Bekanntschaft mit naturphilosophischen<br />
Schriften des Aristoteles und <strong>der</strong> jüdisch-arabischen Philosophie, die Gründung <strong>der</strong> ersten Universitäten<br />
und die wissenschaftlichen Auseinan<strong>der</strong>setzungen zwischen den christlichen Orden <strong>der</strong><br />
Dominikaner und <strong>der</strong> Franziskaner för<strong>der</strong>ten diesen Aufschwung und verschafften auch <strong>der</strong> Naturforschung<br />
einen gewissen Spielraum. Die dabei erzielte Einheit des mittelalterlichen Denkens mit <strong>der</strong><br />
Überzeugung, die Philosophie sei die Magd <strong>der</strong> Theologie, zerbrach an verän<strong>der</strong>ten Akzentuierungen<br />
philosophisch-theologischer Fragen und an neuen Auffassungen zum <strong>Wissenschaft</strong>sbegriff sowie zur<br />
Sprachphilosophie. Dies führte im 14./15. Jahrhun<strong>der</strong>t zur Abkehr von <strong>der</strong> zunehmend in inneren<br />
Streitigkeiten <strong>der</strong> einzelnen Schulen erstarrten scholastischen Lehre und zu ersten Ansätzen eines<br />
neuen Selbstverständnisses von Philosophie und Naturforschung.<br />
Wesentliche Impulse erhielt die europäische Geistesentwicklung auch durch den Kontakt mit den<br />
arabischen <strong>Wissenschaft</strong>en und dem tradierten Wissen <strong>der</strong> Antike. Die Entstehung des arabischen<br />
Großreiches im 7. und 8. Jahrhun<strong>der</strong>t, das von Nordwestindien über Nordafrika bis zur Pyrenäenhalbinsel<br />
reichte, gehörte zu den wichtigen Ereignissen, die zur endgültigen Auflösung <strong>der</strong> antiken Mittelmeerwelt<br />
führten. Obwohl sich in diesem Reich sehr bald einzelne Dynastien herausbildeten, wurde<br />
die kulturelle und wissenschaftliche Entwicklung nicht gestört und erlebte im 10./11. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
einen Höhepunkt. In Bagdad, Buchara und Cordoba entstanden bedeutende Bildungszentren. Den<br />
arabischen Gelehrten kommt nicht nur das große Verdienst zu, den antiken Wissensschatz bewahrt<br />
und durch vielfältige Kommentare erläutert zu haben, son<strong>der</strong>n sie fügten diesem auch zahlreiche<br />
neue Erkenntnisse hinzu. Ab dem 13. Jahrhun<strong>der</strong>t verlor das arabische Großreich zunehmend an<br />
Einfluß, ohne daß dies unmittelbar einen Nie<strong>der</strong>gang <strong>der</strong> <strong>Wissenschaft</strong>en zur Folge hatte.<br />
In China stand am Beginn des hier betrachteten Zeitraums die Reichseinigung durch die Sui-<br />
Herrscher (581–618) und die Schaffung eines geeigneten institutionellen Rahmens für die Verwaltung<br />
und Sicherung des Reiches. Die nachfolgenden Herrscher <strong>der</strong> Tang-Dynastie entwickelten auf dieser<br />
Basis eine leistungsfähige Zentral- und Lokalverwaltung und dehnten die Beziehungen Chinas bis<br />
Europa aus. Etwa 100 Jahre lang, bis zur Mitte des 8. Jahrhun<strong>der</strong>ts, pflegte China einen reichen<br />
Austausch geistiger und materieller Güter mit westlichen Völkern. Nach langen Machtkämpfen und<br />
einer Reichsteilung konnte die Song-Dynastie 960 nochmals große Teile des Reiches vereinen und<br />
günstige Bedingungen für <strong>Wissenschaft</strong> und Kunst schaffen. Die Basis dafür bildete ein wirtschaftlicher<br />
Aufschwung in Landwirtschaft, Handwerk und Handel (einschließlich des Überseehandels<br />
nach Japan, Malaysia, Südindien u. a.). Bei rasch wachsen<strong>der</strong> Bevölkerung bildeten sich bereits<br />
Ballungsgebiete mit mehr als einer Million Einwohner. Die Song-Dynastie war jedoch zunehmend<br />
den Angriffen äußerer Feinde ausgesetzt und unterlag schließlich den Mongolen, die 1278 das<br />
ganze Reich eroberten. Die Mongolen-Herrscher schufen eine völlig neue Staatsorganisation, die<br />
die chinesische Bevölkerung unterdrückte, Kultur und <strong>Wissenschaft</strong>en aber gewisse Freiräume ließ.<br />
In dieser Zeit erhielt man in Europa durch Reisende wie Marco Polo u. a. auch erstmals direkt Kunde<br />
von China und den Leistungen <strong>der</strong> chinesischen <strong>Wissenschaft</strong>en, die sich insbeson<strong>der</strong>e durch die<br />
praktische Ausnutzung von Naturerkenntnissen auszeichneten.<br />
64
65 505 – 525<br />
um 505<br />
A. M. S. Boethius W<br />
A. M. S. Boethius beginnt mit <strong>der</strong> Übersetzung<br />
und Kommentierung von Schriften griechischer<br />
Autoren, insbeson<strong>der</strong>e Aristoteles, und beeinflußt<br />
damit sehr stark die <strong>Wissenschaft</strong>sentwicklung<br />
im <strong>Mittelalter</strong>. Seine mathematischen Abhandlungen<br />
überliefern wichtige Teile des Nikomachosschen<br />
Werkes sowie einige Auszüge aus Euklids<br />
Elementen.<br />
A. M. S. Boethius W<br />
A. M. S. Boethius kommentiert Schriften des Porphyrios<br />
und setzt sich ausführlich mit <strong>der</strong> <strong>Wissenschaft</strong>sklassifikation<br />
und <strong>der</strong> Einteilung <strong>der</strong><br />
Logik bei Aristoteles auseinan<strong>der</strong>.<br />
Tao Hongjing<br />
C<br />
Tao Hongjing entdeckt neue Reaktionen zur „Verdrängung<br />
von Metallionen“ bei Eisen- und Kupfersalzen<br />
und beschreibt eine Kristallform vom<br />
weißen Quarz sowie die Flammprobe von Salpeter.<br />
Tao Hongjing<br />
B<br />
Der Arzt und Alchemist Tao Hongjing bearbeitet<br />
das älteste chinesische pharmazeutische Werk<br />
Materia Medica. Er beschreibt 730 medizinische<br />
Substanzen, davon 365 neue, und verbessert <strong>der</strong>en<br />
Klassifikation, indem er die Heilwirkung <strong>der</strong><br />
Arzneien berücksichtigt.<br />
um 510<br />
A. M. S. Boethius M<br />
A. M. S. Boethius führt wohl erstmals den Begriff<br />
„Quadrivium“ für die vier mathematischen<br />
Fächer Arithmetik, Geometrie, Astronomie und<br />
Musik ein und schreibt zu ersteren Handbücher,<br />
die lange als Lehrbücher dienten. In <strong>der</strong> neupythagoreischen<br />
Arithmetik greift er auf Nikomachos<br />
zurück.<br />
Eutokios<br />
M<br />
Eutokios kommentiert die Kreismessung und<br />
Über Kugel und Zylin<strong>der</strong> von Archimedes, die<br />
Bücher 1 bis 4 <strong>der</strong> Conica des Apollonios<br />
u. a. Für einige Probleme überliefert er mehrere<br />
historisch interessante Lösungen.<br />
Āryabhaṭa<br />
A<br />
Āryabhaṭa lehrt die tägliche Drehung <strong>der</strong> Erde<br />
um ihre Achse, an<strong>der</strong>e indische Astronomen lehnen<br />
dies aus physikalischen Gründen ab. Seine<br />
Lehre wird nicht aufgegriffen.<br />
um 517<br />
Johannes Philoponos<br />
P<br />
Johannes Philoponos kritisiert die Bewegungslehre<br />
des Aristoteles. Die Himmelskörper bewegen<br />
sich durch die ihnen innewohnende Kraft,<br />
die vom göttlichen Beweger als Impetus übertragen<br />
wird. Auch geworfene Körper bewegen sich<br />
nach <strong>der</strong> Trennung vom Beweger ohne Hilfe des<br />
umgebenden Mediums auf Grund des erteilten<br />
Impetus bis dieser verbraucht ist und <strong>der</strong> Körper<br />
zum Stillstand kommt bzw. zum natürlichen Ort,<br />
die Erde, zurückkehrt. Ein Vakuum ist prinzipiell<br />
möglich.<br />
um 520<br />
Johannes Philoponos<br />
P<br />
Johannes Philoponos schreibt ausführlich über<br />
Aristoteles, die philosophischen Aspekte <strong>der</strong><br />
Arithmetik von Nikomachos und die erste Abhandlung<br />
über ein Astrolabium. Er ist einer<br />
<strong>der</strong> bedeutendsten byzantinischen Aristoteles-<br />
Kommentatoren.<br />
Johannes Philoponos<br />
G<br />
Johannes Philoponos wendet sich gegen die Auffassung<br />
von <strong>der</strong> Ewigkeit <strong>der</strong> Welt.<br />
Johannes Philoponos<br />
G<br />
Johannes Philoponos schließt aus den heißen<br />
Quellen sowie den „Feuerkesseln“ auf Sizilien,<br />
Lipari und in an<strong>der</strong>en Gegenden, daß die Erde im<br />
Inneren Feuer bergen müsse, ein Gedanke, <strong>der</strong><br />
letztlich auf Empedokles zurückgeht.(vgl. 450<br />
v. Chr.)<br />
um 525<br />
Anthemios von Tralleis<br />
M • P<br />
Der Architekt Anthemios von Tralleis verfaßt<br />
eine Schrift über Brennspiegel, die aus kleinen<br />
Planspiegeln zusammengesetzt sind. Er wendet<br />
dabei Kenntnisse über Kegelschnitte an, gibt<br />
die Fadenkonstruktion <strong>der</strong> Ellipse, bestimmt den<br />
Brennpunkt <strong>der</strong> Parabel u. a. Er soll eine Reihe<br />
interessanter mechanischer Experimente durchgeführt<br />
haben, wie das Vortäuschen eines Blitzes<br />
mittels Brennspiegeln usw.<br />
525<br />
Dionysius Exiguus<br />
A<br />
Die chronologischen Studien des Abts Dionysius<br />
Exiguus bilden die Basis für die Einführung <strong>der</strong><br />
christlichen Zeitrechnung und die Festlegung des<br />
Osterfestes.
529 – 570 66<br />
529<br />
Benedikt von Nursia<br />
W<br />
Benedikt von Nursia stiftet das Kloster Montecassino<br />
und for<strong>der</strong>t von den Mönchen eine ausgewogene<br />
Aufteilung <strong>der</strong> Arbeit in manuelle und<br />
geistige Tätigkeit.<br />
Justinian I.<br />
W<br />
Schließung <strong>der</strong> Akademie und an<strong>der</strong>er Philosophenschulen<br />
in Athen durch Kaiser Justinian I.<br />
als Stätten heidnischen Glaubens. Dies verursacht<br />
ein zeitweises Auswan<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Gelehrten an den<br />
persischen Hof und trägt zur Verbreitung griechischen<br />
Gedankengutes in Asien bei.<br />
um 530<br />
Sergios von Resaina<br />
W<br />
Sergios von Resaina (Mesopotamien) übersetzt<br />
Werke von Platon, Aristoteles, Porphyrios,<br />
Pseudo-Dionysios und Galen ins Syrische. Er ist<br />
einer <strong>der</strong> bedeutendsten Vermittler griechischer<br />
Philosophie und <strong>Wissenschaft</strong> ins Syrische und<br />
schafft wichtige Voraussetzungen für die Rezeption<br />
dieses Wissens durch die Araber.<br />
um 535<br />
Damaskios, Isidoros von Milet<br />
M<br />
Das sog. Buch XV <strong>der</strong> Elemente von Euklid zur<br />
Geometrie regulärer Körper wird von Damaskios<br />
o<strong>der</strong> von Isidoros von Milet verfaßt.<br />
um 540<br />
Simplikios<br />
M<br />
Simplikios schreibt wichtige Kommentare zu<br />
Werken des Aristoteles und zu Buch I <strong>der</strong><br />
Elemente von Euklid.<br />
Simplikios<br />
A<br />
Simplikios, bedeutendster Repräsentant des Neuplatonismus<br />
im 6. Jahrhun<strong>der</strong>t, versucht die Stabilität<br />
<strong>der</strong> Bewegung <strong>der</strong> Himmelskörper zu erklären<br />
und spricht von Unverän<strong>der</strong>lichkeit <strong>der</strong><br />
Himmelserscheinungen.<br />
um 550<br />
Varahamihira<br />
A • M<br />
Varahamihira faßt fünf klassische astronomische<br />
Werke zusammen und gibt u. a. wichtige Relationen<br />
zwischen Sinus, Cosinus und Sinus versus<br />
sowie eine Sinustafel an.<br />
Aetios von Amida<br />
B<br />
Aetios von Amida verfaßt ein medizinisches<br />
Sammelwerk, in dem er neben den Erkenntnissen<br />
älterer Autoren auch eigene Erfahrungen einbezieht.<br />
Kosmas Indikopleustes<br />
G<br />
Der Kaufmann Kosmas Indikopleustes befuhr<br />
nach 525 Nil, Rotes Meer sowie Indischen Ozean<br />
und gelangte nach Abessinien, Ostafrika, Persien,<br />
Indien und Ceylon. Als Mönch beschreibt er um<br />
550 diese Gebiete in seiner Topographia Christiana,<br />
die zugleich eine naiv-dogmatische Auseinan<strong>der</strong>setzung<br />
mit dem Weltbild des „Heiden“<br />
C. Ptolemäus ist.<br />
um 552<br />
B<br />
Vermutlich Nestorianer-Mönche bringen Maulbeerbaum<br />
und Seidenraupe nach Griechenland,<br />
dem bis Mitte des 12. Jahrhun<strong>der</strong>ts einzigen europäische<br />
Land, das eine Seidenraupenzucht besitzt.<br />
553<br />
Prokopios<br />
A<br />
Der byzantinische Geschichtsschreiber Prokopios<br />
erwähnt erstmals die Mitternachtssonne.<br />
555<br />
Cassiodor<br />
W<br />
Cassiodor gründet bei Scylaceum zwei Klöster<br />
und baut den Ansatz des Benedikt von Nursia<br />
zum Grundsatz <strong>der</strong> allgemeinen Pflege <strong>der</strong> <strong>Wissenschaft</strong>en<br />
in den Klöstern aus. Die Realisierung<br />
dieser Ideen hat die Bewahrung antiker Literatur<br />
in den mittelalterlichen Klöstern zur Folge.<br />
569<br />
Zemarchus<br />
G<br />
Der byzantinischer Herrscher Zemarchus entsendet<br />
eine Gesandtschaft, die bis 571 zum Altai<br />
reist, um Handelsbeziehungen mit China anzubahnen.<br />
um 570<br />
Zhen Luan<br />
M<br />
Zhen Luan kommentiert viele frühen chinesischen<br />
mathematischen Schriften, die so vor <strong>der</strong><br />
Vernichtung bewahrt wurden, und überliefert<br />
z. B. ein frühes Problem zur unbestimmten<br />
Analysis.
67 570 – 620<br />
Zhen Luan<br />
M<br />
Zhen Luan berichtet, daß Xu Yue erstmals um<br />
190 eine Beschreibung mehrerer chinesischer<br />
Versionen des Abakus (Suan-pan) und von magischen<br />
Quadraten gab. Da keine weiteren Beweise<br />
für dieses frühe Auftreten von Abakus und magischen<br />
Quadraten in <strong>der</strong> chinesichen Mathematik<br />
bekannt sind, wird Zhen Luan als Autor vermutet.<br />
Trotzdem sind es sehr frühe Belege für beide<br />
Themenkreise, was Zweifel an <strong>der</strong> Authentizität<br />
des Werkes zur Folge hat.<br />
um 580<br />
Alexan<strong>der</strong> von Tralleis<br />
B<br />
Alexan<strong>der</strong> von Tralleis schreibt ein 12bändiges<br />
medizinisch-therapeutisches Sammelwerk<br />
in griechischer Sprache hauptsächlich über die<br />
Pathologie und Therapie <strong>der</strong> inneren Erkrankungen.<br />
Dabei wi<strong>der</strong>spricht er den Lehren <strong>der</strong><br />
Autoritäten, wenn sie nicht mit <strong>der</strong> eigenen<br />
praktischen Erfahrung übereinstimmen.<br />
um 594<br />
B<br />
In Frankreich werden unter römischen Einfluß<br />
Äpfel durch Pfropfen auf Wildformen veredelt.<br />
V. Cordus beschreibt Mitte des 16. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
bereits 33 Apfelsorten und 50 Birnensorten.<br />
um 600<br />
B<br />
In Mitteleuropa löst <strong>der</strong> geregelte zeitliche Wechsel<br />
von Acker- und Weideland (geregelte Feldgraswirtschaft)<br />
die wilde Feldgraswirtschaft ab.<br />
Zhen Quan<br />
B<br />
Zhen Quan beschreibt Anfang des 7. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
die Symptome <strong>der</strong> Zuckerkrankheit (Diabetes<br />
mellitus), einschließlich des süßen Urins.<br />
Die Kropfbildung behandelt er mit Schilddrüsen<br />
von Tieren (Schilddrüsenhormon) und verabreicht<br />
Seetang. Letzteres könnte als Erfahrungswissen<br />
schon vorher bekannt gewesen sein.<br />
604<br />
Shotoku Taishi<br />
M<br />
Prinz Shotoku Taishi führt mit Hilfe des Koreaners<br />
Kwanroku einen chinesischen Kalen<strong>der</strong> in<br />
Japan ein, <strong>der</strong> später mehrfach verbessert wird.<br />
Er soll auch den Abakus (Soroban) und arithmetische<br />
sowie medizinische Kenntnisse verbreitet<br />
haben, was bez. des Saropan wohl eine Legende<br />
ist.<br />
um 610<br />
Zhao Yuanfang<br />
B<br />
Zhao Yuanfang verfaßt eine Abhandlung in 50<br />
Kapiteln über die Ursachen und Symptome einer<br />
großen Anzahl von Krankheiten. Das Buch hat<br />
vor allem theoretischen Charakter und enthält<br />
keine therapeutischen Vorschriften.<br />
um 613<br />
Isidor von Sevilla<br />
G<br />
In dem zwischen 612 und 613 entstandenen Werk<br />
De natura rerum diskutiert Isidor von Sevilla u. a.<br />
Ebbe und Flut, die Nilüberschwemmungen, Erdbeben<br />
und Vulkanismus. Er nennt den Mond als<br />
mögliche Ursache von Ebbe und Flut, daneben<br />
aber auch ein anziehendes Vermögen <strong>der</strong> Sonne<br />
sowie Windlöcher in den Tiefen des Ozeans,<br />
durch welche in wechseln<strong>der</strong> Folge bald ein Aufsaugen,<br />
bald wie<strong>der</strong> ein Ausstoßen des Meerwassers<br />
erfolgt.<br />
Isidor von Sevilla<br />
G<br />
Isidor von Sevilla führt bei seiner Beschreibung<br />
des Ätna die Entstehung <strong>der</strong> Vulkane auf unterirdische<br />
Höhlungen und Gänge zurück, welche<br />
mit Schwefel und Erdpech gefüllt sind, die<br />
durch einen starken Windzug, welcher von außen<br />
in diese Gänge eintritt, entzündet werden. Eine<br />
ähnliche Erklärung geben Beda Venerabilis und<br />
später Peter von Ailly.<br />
Isidor von Sevilla<br />
G<br />
Die Tatsache, daß das Meer trotz des ständigen<br />
Zulaufes durch die Flüsse nicht überläuft, führt<br />
man im <strong>Mittelalter</strong> vor allem auf die Verdunstung<br />
des Meerwassers durch die Sonne zurück sowie<br />
darauf, daß Teile davon ins Erdreich versickern<br />
(welche dann ausgesüßt zu den Quellen zurückgelangen),<br />
so etwa bei Isidor von Sevilla und um<br />
703 bei Beda Venerabilis.<br />
um 620<br />
Vagbatha d. Ä.<br />
B<br />
Vagbatha d. Ä. schreibt eine Zusammenfassung<br />
<strong>der</strong> acht Teile <strong>der</strong> Medizin, die einen umfassenden<br />
Überblick über Therapie sowie chirurgische<br />
und an<strong>der</strong>e Behandlungsmethoden geben. In <strong>der</strong><br />
indischen Medizin ist die Chirurgie hoch entwickelt,<br />
z. B. werden Darmnaht und Blasensteinschnitt<br />
ausgeführt. Da das Werk in zwei nicht<br />
wesentlich verschiedenen Versionen bekannt ist,<br />
werden teilweise zwei Autoren gleichen Namens<br />
angenommen.