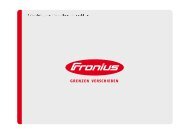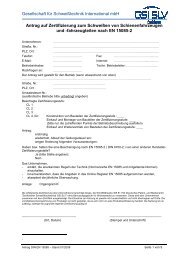SFI-Aktuell 2009 - SLV Duisburg
SFI-Aktuell 2009 - SLV Duisburg
SFI-Aktuell 2009 - SLV Duisburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Schweißprozesse und -ausrüstung<br />
Werkstoffe und deren Verhalten beim Schweißen<br />
Konstruktion und Gestaltung<br />
Fertigung und Anwendungstechnik<br />
<strong>SFI</strong>-<strong>Aktuell</strong><br />
© GSI <strong>2009</strong><br />
<strong>2009</strong>
HAUPTGEBIIET 1<br />
INTERNATIONALER<br />
SCHWEISSFACHINGENIEURLEHRGANG<br />
nach Richtlinie DVS -IIW 1170<br />
Mitglied im DVS –<br />
Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V.<br />
,<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt
Hauptgebiet 1:<br />
Schweißprozesse und -ausrüstung<br />
Die in den <strong>SFI</strong>-Unterlagen/CD-ROM "<strong>SFI</strong>-<strong>Aktuell</strong>" enthaltenen Normenauszüge sind mit Erlaubnis des DIN Deutsches Institut für Normung e.V.<br />
wiedergegeben. Maßgebend für das Anwenden der Norm ist deren Fassung mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der Beuth Verlag GmbH,<br />
Burggrafenstraße 6,10787 Berlin, erhältlich ist.<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt
Themenübersicht<br />
Hauptgebiet 1: Schweißprozesse und –ausrüstung<br />
Kapitel<br />
Thema<br />
1.01 Allgemeine Einführung in die Schweißtechnik<br />
1.02 Autogenschweißen und verwandte Verfahren<br />
1.03 Elektrotechnik, ein Überblick<br />
1.04 Der Lichtbogen<br />
1.05 Stromquellen für das Lichtbogenschweißen<br />
1.06 Einführung in das Schutzgasschweißen<br />
1.07 WIG-Schweißen<br />
1.08 MIG/MAG- und Fülldrahtschweißen<br />
1.09 Lichtbogenhandschweißen<br />
1.10 Unterpulverschweißen<br />
1.11 Widerstandsschweißen<br />
1.12.1 Sonderschweißprozesse<br />
Laserstrahl-, Elektronenstrahl-, Plasmaschweißen<br />
1.12.2 Sonstige Schweißprozesse<br />
(mit Ausnahme der in Abschnitt 1.12.1 genannten)<br />
1.13 Schneiden und andere Nahtvorbereitungsverfahren<br />
1.14 Beschichtungsverfahren<br />
(Plattieren, thermisches Spritzen)<br />
1.15 Vollmechanisierte Prozesse und Roboterschweißen<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt
Themenübersicht<br />
Kapitel<br />
Thema<br />
1.16 Hart- und Weichlöten<br />
1.17 Kunststofffügen<br />
1.18 Fügen von Keramik und Verbundwerkstoffen<br />
1.19 Laborübungen<br />
• Praktische Übungen und Vorführungen mit den verschiedenen Schweißprozessen<br />
mit dem Ziel, die Einsatzmöglichkeiten der Prozesse und den Einfluss der<br />
Schweißparameter auf Schweißnahtgüte zu demonstrieren.<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt
Allgemeine Einführung in die<br />
Schweißtechnik I/II<br />
<strong>SFI</strong><br />
1.01-1 u. 1.01-2<br />
Seite 11<br />
1.4.3 Wolfram-Inertgasschweißen (WIG; 141)<br />
Bild 8: Wolfram-Inertgasschweißen<br />
Der Lichtbogen (13) brennt zwischen einer nichtabschmelzenden Wolfram-Elektrode (11) und dem<br />
Werkstück (10) in einem inerten Schutzgasmantel (16). Der Schweißstab (9) wird stromlos abgeschmolzen.<br />
Die Schweißstabzufuhr erfolgt manuell oder mechanisch.<br />
Stromquelle:<br />
Gleich- und Wechselstrom mit fallender Kennlinie. WIG-Schweißgerät mit HF-<br />
Zündung und zusätzlichen Steuerfunktionen.<br />
Wolframelektroden: nach DIN EN 26848<br />
Schutzgase: Argon, Helium, Wasserstoff und Formiergas nach DIN EN 439<br />
Schweißstäbe: für unlegierte Stähle und Feinkornbaustähle nach DIN EN 1668<br />
Anwendung:<br />
Fast alle Metalle schweißbar, alle Schweißpositionen von 0,2...6 mm Werkstückdicke<br />
(wirtschaftlich); hauptsächlich Qualitätsschweißungen im Rohrleitungs-,<br />
Kessel-, Behälter- und Reaktorbau, Maschinenbau, Flugzeugbau, Raumfahrt,<br />
auch Auftragschweißen.<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH Schweißprozesse und -ausrüstung<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt
Autogenschweißen und verwandte<br />
Verfahren<br />
<strong>SFI</strong> / 1.02<br />
Seite 20<br />
Trockene Gebrauchsstellenvorlagen (Entnahmestelleneinrichtung)<br />
Temperaturgesteuert<br />
Druckgesteuert<br />
Bild 11: Gebrauchsstellenvorlagen<br />
Bei der temperaturgesteuerten Gebrauchsstellenvorlage ist nach einem leichten Flammenrückschlag die<br />
weitere Brenngaszufuhr nicht unterbunden. Die Sicherung löst erst ab Temperaturen von etwa 90 bis<br />
100°C aus. Nach dem Auslösen kann diese nicht selbst entriegelt werden. Die druckgesteuerte<br />
Gebrauchsstellenvorlage hat gegenüber der Einzelflaschensicherung zusätzlich eine Gasnachströmsperre<br />
eingebaut. Schon bei leichtem Flammenrückschlag oder geringem Druckanstieg schließt nicht<br />
nur das Gasrücktrittventil, sondern es löst auch die druckgesteuerte Nachströmsperre aus. Nach dem<br />
Auslösen kann man diese mit einem Hebel wieder entriegeln.<br />
Tabelle 6: Einbauorte<br />
Einbauort<br />
Gebrauchsstellenvorlage<br />
am Druckminderer<br />
an der Entnahmestelle der Ring- oder Stichleitung<br />
Einzelflaschensicherung<br />
am Druckminderer<br />
im Brenngasschlauch<br />
am Schweiß- bzw. Schneidgerät<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH Schweißprozesse und -ausrüstung<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt
MIG-/ MAG und Fülldrahtschweißen III<br />
<strong>SFI</strong> / 1.08-3<br />
Seite 2<br />
A B C D E F G H I<br />
Bild 1: Statische Kennlinie und Lichtbogenkennlinie. Lichtbogenlänge bei unterschiedlichen Arbeitspunkten<br />
Bild 2: Lichtbogenspannung und Schweißstrom bei verschiedenen Schutzgasen (Werte aus Versuchsreihen)<br />
Je nach Schweißaufgabe muss der Schweißer die Art des Werkstoffübergangs wählen (Kurz-, Übergangs-<br />
oder Sprühlichtbogen, bzw. den Langlichtbogen anstelle des Sprühlichtbogens bei CO 2 als<br />
Schutzgas). In Tabelle 1 sind Schweißdaten für unterschiedliche Drahtdurchmesser und Werkstoffübergänge<br />
bei Stahl aufgelistet. Diese Daten helfen bei der Grobeinstellung der Schweißanlage.<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH Schweißprozesse und -ausrüstung<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt
Sonderschweißprozesse II/III<br />
Elektronenstrahl-, Laserstrahlschweißen<br />
<strong>SFI</strong><br />
1.12.1-2 u. 1.12.1-3<br />
Seite 1<br />
0 Inhaltsverzeichnis 1<br />
1. Elektronenstrahlmaterialbearbeitung 1<br />
2. Laserstrahlmaterialbearbeitung 9<br />
1. Elektronenstrahlmaterialbearbeitung<br />
Kurzbezeichnung: EB (electron beam)<br />
1.1 Grundlagen<br />
Bild 1: Prinzipieller Aufbau einer Elektronenstrahlanlage für die Materialbearbeitung<br />
Zur Erzeugung des Elektronenstrahls wird eine Wolframkathode stark erhitzt um eine Emission von<br />
Elektronen aus der Kathodenoberfläche zu ermöglichen. Zwischen Kathode und Anode wird eine Hochspannung<br />
angelegt (60 - 150 kV), die die aus der Kathode austretenden Elektronen stark beschleunigt.<br />
Die austretenden Elektronen bewegen sich auf das Werkstück zu, wobei sie mittels Fokussierspulen<br />
gebündelt werden. Durch diese Bündelung auf einen minimalen Strahldurchmesser von 0,1 - 0,2 mm<br />
werden Energiedichten > 10 6 W/cm² erreicht.<br />
Die hochbeschleunigten Elektronen treffen auf das Werkstück auf und setzen ihre kinetische Energie in<br />
Wärmeenergie um. Dadurch wird das Werkstück entsprechend der eingesetzten Energie (es fließen<br />
Ströme im Milliampere-Bereich) erwärmt, partiell geschmolzen oder verdampft.<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH Schweißprozesse und -ausrüstung<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt
Vollmechanisierte Prozesse und<br />
Roboterschweißen II/III<br />
<strong>SFI</strong><br />
1.15-2 u. 1.15-3<br />
Seite 14<br />
Die nachfolgenden Bilder zeigen noch einmal die unterschiedlichen Bewegungsabläufe der beiden<br />
Steuerungsarten.<br />
Punkt-zu-Punkt-Steuerung (PTP)<br />
Bahnsteuerung (CP)<br />
[ 1 ] [ 1 ]<br />
Start Position<br />
Start Position<br />
[ 2 ] [ 2 ]<br />
[ 3 ] [ 3 ]<br />
Bild 19: Bewegungsabläufe im PTP- und CP-Betrieb<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH Schweißprozesse und -ausrüstung<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt
HAUPTGEBIIET 2<br />
INTERNATIONALER<br />
SCHWEISSFACHINGENIEURLEHRGANG<br />
nach Richtlinie DVS -IIW 1170<br />
Mitglied im DVS –<br />
Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V.<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt
Hauptgebiet 2: Werkstoffe und ihr Verhalten beim<br />
Schweißen<br />
Die in den <strong>SFI</strong>-Unterlagen/CD-ROM "<strong>SFI</strong>-<strong>Aktuell</strong>" enthaltenen Normenauszüge sind mit Erlaubnis des DIN Deutsches Institut für Normung e.V.<br />
wiedergegeben. Maßgebend für das Anwenden der Norm ist deren Fassung mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der Beuth Verlag GmbH,<br />
Burggrafenstraße 6,10787 Berlin, erhältlich ist.<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt
Themenübersicht<br />
Hauptgebiet 2: Werkstoffe und ihr Verhalten beim Schweißen<br />
Kapitel<br />
Thema<br />
2.01 Herstellung und Bezeichnung der Stähle<br />
2.02 Prüfen der Werkstoffe und der Schweißverbindung<br />
2.03 Gefüge und Eigenschaften reiner Metalle<br />
2.04 Legierungen und Zustandsschaubilder<br />
2.05 Eisen-Kohlenstoff-Legierungen<br />
2.06 Wärmebehandlung von Grundwerkstoffen und Schweißverbindungen<br />
2.07 Aufbau der Schweißverbindung<br />
2.08 Kohlenstoff und Kohlenstoff-Manganstähle<br />
2.09 Feinkornbaustähle I<br />
2.10 Feinkornbaustähle II<br />
2.11 Rissbildung in Schweißverbindungen<br />
2.12 Anwendung von Baustählen und hochfesten Stählen<br />
2.13 Niedrig legierte Stähle für Tieftemperaturanwendungen<br />
2.14 Niedrig legierte warmfeste Stähle<br />
2.15 Korrosion (Einführung)<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt
Themenübersicht<br />
Kapitel<br />
Thema<br />
2.16 Hoch legierte (korrosionsbeständige) Stähle<br />
2.17 Verschleiß (Einführung)<br />
2.18 Schutzschichten<br />
2.19 Hoch legierte , kriechfeste und hitzebeständige Stähle<br />
2.20 Gusseisen und Stahlguss<br />
2.21 Kupfer und Kupferlegierungen<br />
2.22 Nickel und Nickellegierungen<br />
2.23 Aluminium und Aluminiumlegierungen<br />
2.24 Sonstige Metalle und Legierungen<br />
2.25 Fügen unterschiedlicher Werkstoffe<br />
2.26 Metallografische Übungen<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt
Legierungen und Zustandsschaubilder III<br />
<strong>SFI</strong> / 2.04-3<br />
Seite 9<br />
a) b)<br />
c) d)<br />
Bild 13: Lichtmikroskopische Darstellung bainitischer Gefüge<br />
a) feinnadeliger Bainit<br />
b) grobnadeliger Bainit<br />
c) Übergang nadeliger/körniger Bainit<br />
d) körniger Bainit<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt<br />
Werkstoffe und ihr Verhalten beim<br />
Schweißen
Hoch legierte (korrosionsbeständige)<br />
Stähle I bis IV<br />
<strong>SFI</strong><br />
2.16-1 bis 2.16-4<br />
Seite 9<br />
Legierung L4<br />
<br />
<br />
<br />
Legierung L3<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Legierung L2<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Legierung L1<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Bild 8: Erstarrungstypen<br />
Die Umwandlung des Hochtemperaturferrits bei sinkender Temperatur beginnt an den Zellrändern und<br />
verläuft dann nach innen.<br />
Dies ist wichtig zu wissen, um die nachfolgenden metallographischen Bilder zu verstehen.<br />
Bild 9: Vollaustenitische Erstarrung des Schweißgutes<br />
Bild 9 zeigt eine völlig austenitische Erstarrung. Dabei bleiben die bei hoher Temperatur gebildeten Zellen<br />
bis auf Raumtemperatur unverändert erhalten.<br />
Die Zellen bilden eine Zellkolonie von parallel gewachsenen Säulen (Zellen), die alle die gleiche Kristallorientierung<br />
haben und daher zu einem Korn im Schweißgut gehören.<br />
(siehe voranstehende Legierung L4 )<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt<br />
Werkstoffe und ihr Verhalten beim<br />
Schweißen
Aluminium und Aluminiumlegierungen I<br />
<strong>SFI</strong> / 2.23-1<br />
Seite 3<br />
2. Grundlagen der Herstellung von Aluminium<br />
Wichtigster Rohstoff zur Gewinnung von Aluminium ist das Erz Bauxit. Aus diesem wird nach dem<br />
Bayer-Verfahren das Oxid Al 2 O 3 (Tonerde) hydrometallurgisch abgetrennt.<br />
Bild 1: Prinzip des Bayer-Verfahrens<br />
Das Prinzip dieses Kreislaufprozesses ist die Extraktion von Aluminiumhydroxid aus Bauxit mit Natronlauge<br />
bei höherer Temperatur, Abtrennung des festen Rückstandes (Rotschlamm) nach Abkühlen der<br />
Suspension, teilweise Ausfällung von Aluminiumhydroxid aus der dann übersättigten Aluminatlauge<br />
durch Impfkristallisation und Rückführung der Lauge nach Abtrennen des kristallisierten Hydroxids. Das<br />
so gewonnene Aluminiumhydroxid wird thermisch zu Oxid dehydratisiert.<br />
Das Verfahren nutzt zwei physikalisch-chemische Eigenschaften des Systems Al 2 O 3 -Na 2 O-H 2 O, nämlich<br />
die Temperaturabhängigkeit der Löslichkeit von Aluminiumhydroxid in Natronlauge und die Metastabilität<br />
übersättigter Aluminatlösungen.<br />
Der Bayer-Prozess ist in den letzten Jahrzehnten durch Verfahrensoptimierungen weiter verbessert worden,<br />
so dass eine höhere Produktivität erzielt und hauptsächlich der Energiebedarf bedeutend reduziert<br />
werden konnte. Es wurden in der Vergangenheit zwar auch andere Gewinnungsverfahren entwickelt wie<br />
z.B. der Aufschluss mit Säure, jedoch werden diese Verfahren bisher technisch nicht eingesetzt.<br />
Aufgrund der starken Bindungskräfte des Oxids wird das Aluminium weltweit ausnahmslos mit Hilfe der<br />
Schmelzflusselektrolyse vom Sauerstoff getrennt. Die dabei insgesamt benötigte Energie ist mit ca.<br />
14 kWh pro kg Al relativ hoch.<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt<br />
Werkstoffe und ihr Verhalten beim<br />
Schweißen
HAUPTGEBIIET 3<br />
INTERNATIONALER<br />
SCHWEISSFACHINGENIEURLEHRGANG<br />
nach Richtlinie DVS -IIW 1170<br />
Mitglied im DVS –<br />
Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V.<br />
,<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt
Hauptgebiet 3:<br />
Konstruktion und Gestaltung<br />
Die in den <strong>SFI</strong>-Unterlagen/CD-ROM "<strong>SFI</strong>-<strong>Aktuell</strong>" enthaltenen Normenauszüge sind mit Erlaubnis des DIN Deutsches Institut für Normung e.V.<br />
wiedergegeben. Maßgebend für das Anwenden der Norm ist deren Fassung mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der Beuth Verlag GmbH,<br />
Burggrafenstraße 6,10787 Berlin, erhältlich ist.<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt
Themenübersicht<br />
Hauptgebiet 3: Konstruktion und Gestaltung<br />
Kapitel<br />
Thema<br />
3.01 Grundlagen der Statik der Tragkonstruktionen<br />
3.02 Grundlagen der Festigkeitslehre<br />
3.03 Gestaltung und zeichnerische Darstellung von Schweißverbindungen<br />
3.04 Grundlagen der Schweißnahtberechnung<br />
3.05 Verhalten geschweißter Verbindungen bei unterschiedlichen<br />
Beanspruchungen<br />
3.06 Gestaltung vorwiegend ruhend beanspruchter Schweißkonstruktionen<br />
3.07 Verhalten geschweißter Verbindungen bei dynamischer Beanspruchung<br />
3.08 Gestaltung dynamisch beanspruchter Schweißkonstruktionen<br />
3.09 Gestaltung geschweißter Druckgeräte<br />
3.10 Gestaltung geschweißter Aluminiumkonstruktionen<br />
3.11 Schweißverbindungen an Betonstählen<br />
3.12 Einführung in die Bruchmechanik<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt
Grundlagen der Festigkeitslehre II<br />
<strong>SFI</strong> / 3.02-2<br />
Seite 3<br />
b) bei gleichzeitiger Biegebeanspruchung zu Schubspannungen τ. Die Verteilung der Schubspannungen<br />
über den Querschnitt kann man sich anhand eines Modells verdeutlichen. Zerschneidet<br />
man ein auf Biegung beanspruchtes Balkenelement durch eine horizontale Ebene, so lässt sich das<br />
Gleichgewicht am Balkenelement wie folgt darstellen.<br />
F<br />
x<br />
z<br />
1 2<br />
x<br />
1<br />
M y,1<br />
dx<br />
+<br />
M = M + dM<br />
max M y<br />
M y<br />
-<br />
+<br />
V z<br />
M y,1<br />
M = M + dM<br />
a<br />
T . dx<br />
R+dR<br />
Bild 6: Schubbeanspruchung bei gleichzeitiger Beanspruchung aus Querkraft und Biegemoment<br />
Die auftretenden Schubspannungen τ werden mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingungen am infinitesimalen<br />
Stabelement dx abgeleitet. An den Schnittstellen x 1 und x 1 + dx betragen Querkraft und Biegemoment:<br />
V z , M y bzw. V z , M y + dM y .<br />
Aus dem Balken wird ein Element der Länge dx herausgetrennt und die Schnittgrößen werden an den<br />
Schnittufern angetragen. An der Schnittstelle x 1 hat die Biegespannung den dargestellten Verlauf.<br />
An der Stelle x 1 +dx wächst diese Spannung auf σ + d σ . Die Spannungsresultierende des außerhalb der<br />
Schnittlinie a-a liegenden Querschnittsteils (schraffiert). Sie im Schnitt x 1 R und Schnitt x 1 + dx R • dR,<br />
d.h., dass unterhalb der Linien a-a liegende Stück wird durch die Differenzkraft dR auf Schub beansprucht.<br />
Damit am Element Gleichgewicht herrscht müssen T • dx und dR im Gleichgewicht stehen. T ist<br />
dabei die Schubkraft in der Schnittebene a-a und hat die Dimension einen Kraft pro Längeneinheit. Unter<br />
Berücksichtigung der vorhandenen Blechdicke ergibt sich daraus die Schubspannung.<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH Konstruktion und Gestaltung<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt
Verhalten geschweißter Verbindungen<br />
bei dynamischer Beanspruchung I<br />
<strong>SFI</strong> / 3.07-1<br />
Seite 2<br />
1.2 Der Mechanismus der Ermüdung<br />
Bei zeitlich veränderlicher, häufig wiederholter ("dynamischer") Beanspruchung werden in Mikro- und<br />
Makrobereichen plastische Formänderungen ausgelöst, die die weitere Beanspruchbarkeit vermindern,<br />
erst im Mikro-, dann im Makrobereich Risse einleiten und vergrößern und schließlich zu einem ("statischen")<br />
Restbruch führen. Ermüdung ist daher Risseinleitung und Rissausbreitung, wobei nach<br />
Schwingspielen gezählt die Phase stabiler Rissausbreitung einen wesentlichen Teil der Gesamtlebensdauer<br />
umfassen kann. Die Mikro- und Makrokerben mit ihren örtlichen Kerbspannungsspitzen sowie die<br />
Formunstetigkeiten mit ihren großräumigeren Strukturspannungserhöhungen sind dabei ausschlaggebend.<br />
Oberflächen- und Umgebungseinflüsse (Rauhigkeit, Korrosion, Temperatur) haben außerdem besonders<br />
starke Wirkung. Eine Vielzahl weiterer beanspruchungs-, werkstoff- und fertigungsbedingter Parameter<br />
bestimmt zusätzlich in vielfältiger Kombination den Ermüdungsvorgang.<br />
1.3 Der Ermüdungsbruch<br />
Ausgehend von Kerben (oder Fehlstellen) entstehen Anrisse, die bei immer wiederkehrender Beanspruchung<br />
wachsen. Der Bruch tritt dann ein, wenn der verbliebene Restquerschnitt nicht mehr in der Lage<br />
ist, die Beanspruchung zu übertragen. Deshalb weist das Bruchbild eines Dauer- bzw. Ermüdungsbruchs<br />
im Allgemeinen zwei Bereiche auf:<br />
Kerbe<br />
fortschreitende<br />
Rissbildung<br />
Restbruch<br />
Rastlinien<br />
Rastlinien<br />
Restbruchfläche<br />
Bild 1: Ermüdungsbruch (Schematisch)<br />
Kerbe<br />
Bild 2: Ermüdungsbruch eines Bolzens<br />
Bereich des Dauerbruchs<br />
Der Dauerbruch ist gekennzeichnet durch eine verformungsarme, glatte, sprödbruchartige Oberfläche.<br />
Auf dieser Oberfläche sind im Mikroskop oftmals Rastlinien erkennbar, die den Rissfortschritt beschreiben.<br />
Der Ausgangspunkt des Dauerrisses befindet sich im Kerbgrund einer Kerbe (Wurzelkerbe, Übergangskerbe<br />
Schweißnaht - Grundwerkstoff, Fehler in der Schweißnaht usw.).<br />
Bereich des Restbruchs<br />
Die Oberfläche des Restbruches ist abhängig von der Duktilität des Werkstoffs. Bei duktilen Werkstoffen<br />
ähnelt die Form der Restbruchfläche der eines Verformungsbruches. Plastische Deformationen sind erkennbar.<br />
Bei spröden Werkstoffen ist auch der Restbruch sprödbruchartig.<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH Konstruktion und Gestaltung<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt
Gestaltung geschweißter<br />
Aluminiumkonstruktionen I/II<br />
<strong>SFI</strong><br />
3.10-1 u. 3.10-2<br />
Seite 4<br />
2.2 Anwendungsbeispiele<br />
Bild 2: Fahrleitungsausleger<br />
Bild 3: Schiff-Volumensektion aus Al<br />
Bild 4: Autobahn-Schilderbrücke<br />
Bild 5: LKW mit Dreiseitenkipperaufbau aus Al<br />
Bild 6: Wagenkasten-Rohbau aus Al<br />
Bild 7: Einsatz von Al für Pkw-Bauteile<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH Konstruktion und Gestaltung<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt
HAUPTGEBIIET 4<br />
INTERNATIONALER<br />
SCHWEISSFACHINGENIEURLEHRGANG<br />
nach Richtlinie DVS -IIW 1170<br />
Mitglied im DVS –<br />
Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V.<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt
Hauptgebiet 4:<br />
Fertigung und Anwendungstechnik<br />
Die in den <strong>SFI</strong>-Unterlagen/CD-ROM "<strong>SFI</strong>-<strong>Aktuell</strong>" enthaltenen Normenauszüge sind mit Erlaubnis des DIN Deutsches Institut für Normung e.V.<br />
wiedergegeben. Maßgebend für das Anwenden der Norm ist deren Fassung mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der Beuth Verlag GmbH,<br />
Burggrafenstraße 6,10787 Berlin, erhältlich ist.<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt
Themenübersicht<br />
Hauptgebiet 4: Fertigung und Anwendungstechnik<br />
Kapitel<br />
Thema<br />
4.01 Einführung in die Qualitätssicherung geschweißter Konstruktionen<br />
4.02 Qualitätskontrolle während der Fertigung<br />
4.03 Eigenspannungen und Verzug<br />
4.04 Werkstatteinrichtungen, Schweißeinrichtungen und Haltevorrichtungen<br />
4.05 Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit<br />
4.06 Messen, Kontrollieren und Aufzeichnen von Schweißdaten<br />
4.07 Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung<br />
4.08 Wirtschaftlichkeit<br />
4.09 Reparaturschweißen<br />
4.10 Gebrauchstauglichkeit (Fitness for Purpose)<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt
Einführung in die Qualitätssicherung<br />
geschweißter Konstruktionen III<br />
<strong>SFI</strong> / 4.01-3<br />
Seite 11<br />
11. Bedeutung von Gesetzen, Verordnungen, Erlassen, Normen und Richtlinien<br />
Bild 10: Bedeutung von Gesetzen, Verordnungen usw.<br />
Erkenntnisstand<br />
z.B. Gesicherte Forschungsergebnisse<br />
z.B. Vornormen<br />
Stand von Wissenschaft und<br />
Technik z.Z. ATOMGESETZ<br />
“HÖCHSTANSPRÜCHE”<br />
Stand der Technik<br />
z.B. IMMISSIONSSCHUTZGESETZ<br />
“TECHNISCH MACHBAR”<br />
z.B. DIN-Normen<br />
Die allgemein anerkannten<br />
Regeln der Technik<br />
z.B. StGB, BGR-Krane<br />
“TECHNISCH-<br />
ÜBLICH”<br />
Verbreitungsgrad<br />
Bild 11: Rechtsbegriffe bzw. Formulierungen des Gesetzgebers;<br />
Schutz vor verschieden gearteten Gefahren und Schäden.<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH Fertigung und Anwendungstechnik<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt
Gesundheitsschutz und<br />
Arbeitssicherheit I/II<br />
<strong>SFI</strong><br />
4.05-1 u. 4.05-2<br />
Seite 9<br />
Anmerkungen:<br />
alt Neu alt Neu<br />
Der zylindrische Flaschenmantel kann<br />
verschiedene Farben aufweisen, von<br />
denen eine farblich dargestellt ist und<br />
die andere(n) in Klammern erwähnt<br />
ist (sind).<br />
alt<br />
Neu<br />
Stickstoff<br />
dunkelgrün<br />
dunkelgrün<br />
schwarz<br />
grau (dunkelgrün,<br />
schwarz)<br />
Wasserstoff<br />
rot<br />
rot<br />
rot<br />
rot<br />
Sauerstoff (technischer) Kohlendioxid Formiergas (Gemisch Stick-/Wasserstoff)<br />
blau<br />
weiß<br />
grau<br />
grau<br />
rot<br />
rot<br />
blau<br />
blau (grau)<br />
grau<br />
grau<br />
rot<br />
(dunkelgrün)<br />
grau<br />
Acetylen Helium Gemisch Argon/Kohlendioxid<br />
gelb<br />
kastanienbraun<br />
grau<br />
braun<br />
grau<br />
leuchtendgrün<br />
gelb<br />
(schwarz)<br />
kastanienbraun<br />
(schwarz, gelb)<br />
grau<br />
grau<br />
grau<br />
grau<br />
Argon Xenon, Krypton, Neon Druckluft<br />
grau<br />
dunkelgrün<br />
grau<br />
leuchtendgrün<br />
grau<br />
leuchtendgrün<br />
grau<br />
grau<br />
(dunkelgrün)<br />
grau<br />
(schwarz)<br />
grau<br />
(leuchtendgrün)<br />
grau<br />
grau<br />
Die Gasflaschen sind mit einem Gefahrgutaufkleber nach DIN EN 1089-2 zu kennzeichnen.<br />
Zahlenerklärung:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Risiko und Sicherheitssätze<br />
Gefahrzettel<br />
Zusammensetzung des Gases bzw.<br />
des Gasgemisches<br />
Produktbezeichnung des Herstellers<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
EWG-Nummer bei Einzelstoffen oder<br />
das Wort "Gasgemisch"<br />
Vollständige Gasbenennung nach GGVS<br />
Herstellerhinweis<br />
Name, Anschrift und Telefonnummer des Herstellers<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH Fertigung und Anwendungstechnik<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt
Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung<br />
<strong>SFI</strong><br />
4.07-1 – 4.07-10<br />
Seite 11<br />
Eine weitere Möglichkeit zum Nachweis des an Fehlstellen auftretenden Streuflusses ist das Abtasten<br />
der durchfluteten Oberfläche mittels einer empfindlichen Tastsonde. Diese Methode hat jedoch bei der<br />
manuellen Schweißnahtprüfung, besonders im Baustellenbetrieb keine wesentliche Bedeutung und wird<br />
deshalb hier nicht weiter erläutert.<br />
Magnetisierung<br />
Es wird generell zwischen drei Grundprinzipien zur Magnetisierung des Werkstückes unterschieden:<br />
Jochmagnetisierung<br />
Für die Prüfung von Schweißverbindungen ist die Jochmagnetisierung am gebräuchlichsten.<br />
Feldrichtung<br />
Rissanzeigen<br />
Riss<br />
1. Arbeitsgang 2. Arbeitsgang<br />
Bild 10: Magnetisierung mit Elektrojoch (Fa. Karl Deutsch)<br />
Die beiden Pole eines Elektromagneten werden so aufgesetzt, dass das Prüfstück den magnetischen<br />
Kreis schließt und somit der magnetische Fluss von außen eingeleitet wird.<br />
Es werden bevorzugt solche Fehler angezeigt, deren Längsrichtung senkrecht zur Verbindungslinie<br />
zwischen den Polen des Magneten - also quer zur Feldrichtung - verläuft.<br />
Magnetisierung durch stromdurchflossene Leiter<br />
Kabelwicklung<br />
Füllfaktor = 1<br />
Feldrichtung<br />
Rissverlauf<br />
Stange<br />
Bild 11: Magnetisierung durch Kabelrichtung (Skript Magnetpulverprüfung VECTOR)<br />
Das Prüfstück wird - ggf. berührungsfrei - in eine feste Spule gebracht bzw. mit einem isolierten elektrischen<br />
Leiter umwickelt. Der elektrische Strom im Leiter erzeugt ein ringförmiges Magnetfeld um den<br />
Leiter herum, das wiederum einen richtungsgleichen magnetischen Fluss im Prüfstück erzeugt. Das<br />
© 2008 GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH Fertigung und Anwendungstechnik<br />
Nachdruck und unbefugte Weitergabe sind unzulässig und werden gesetzlich verfolgt
W i c h t i g - Vor der Nutzung bitte aufmerksam lesen<br />
Wenn Sie Ihr GSI-Produkt in der Bundesrepublik Deutschland, in der Schweiz, in Österreich oder in<br />
Liechtenstein gekauft haben, trifft der folgende Lizenzvertrag für Sie zu.<br />
Gesellschaft für Schweißtechnik international<br />
(im folgenden auch GSI genannt)<br />
Software Lizenzvertrag<br />
Nachfolgend sind die Vertragsbedingungen für die Benutzung von GSI-Software durch Sie, den<br />
Endverbraucher (im folgenden auch "Lizenznehmer") aufgeführt.<br />
Daher lesen Sie bitten den nachfolgenden Text vollständig und genau durch.<br />
Wenn Sie mit diesen Vertragsbestimmungen nicht einverstanden sind, so dürfen Sie das Programm<br />
nicht fortsetzen.<br />
Vertragsbedingungen<br />
1. Gegenstand des Vertrages<br />
Gegenstand des Vertrages ist das auf dem Datenträger (CD-ROM) aufgezeichnete<br />
Computerprogramm, die Programmbeschreibung und Bedienungsanleitung sowie sonstiges<br />
zugehöriges schriftliches Material. Sie werden im folgenden auch als "Software" bezeichnet.<br />
Die GSI macht darauf aufmerksam, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, Computer-<br />
Software so zu erstellen, dass sie in allen Anwendungen und Kombinationen fehlerfrei arbeitet.<br />
Gegenstand des Vertrages ist daher nur eine Software, die im Sinne der Programmbeschreibung und<br />
der Benutzungsanleitung grundsätzlich brauchbar ist.<br />
2. Umfang der Benutzung<br />
Die GSI gewährt Ihnen für die Dauer dieses Vertrages das einfache nichtausschließliche und<br />
persönliche Recht (im folgenden als "Lizenz" bezeichnet), die beiliegende Kopie der GSI-Software auf<br />
einem einzelnen Computer und nur an einem Ort zu benutzen.<br />
Als Lizenznehmer dürfen Sie Software in körperlicher Form (d. h. auf einem Datenträger<br />
abgespeichert) von einem Computer auf einen anderen Computer übertragen, vorausgesetzt, dass sie<br />
zu irgendeinem Zeitpunkt auf immer nur einen einzelnen Computer genutzt wird.<br />
Eine weitergehende Nutzung ist nicht zulässig.<br />
3. Besondere Beschränkungen<br />
Dem Lizenznehmer ist untersagt,<br />
a) ohne vorherige schriftliche Einwilligung der GSI die Software einschließlich aller Bilder,<br />
Animationen, Videos, usw. oder das zugehörige schriftliche Material an einen Dritten zu übergeben<br />
oder einem Dritten sonst wie zugänglich zu machen.<br />
b) die Software von einem Computer über ein Netz oder einen Datenübertragungskanal auf einen<br />
anderen Computer zu übertragen<br />
c) ohne vorherige schriftliche Einwilligung der GSI die Software abzuändern, zu übersetzen,<br />
zurückzuentwickeln, zu entkompilieren oder zu entassemblieren,<br />
d) von der Software abgeleitete Werke zu erstellen oder das schriftliche Material zu vervielfältigen,<br />
e) es zu übersetzen oder abzuändern oder vom schriftlichen Material abgeleitete Werke zu erstellen.
4. Inhaberschaft an Rechten<br />
Sie erhalten mit dem Erwerb des Produkts nur Eigentum an dem körperlichen Datenträger, auf dem<br />
die Software aufgezeichnet ist. Ein Erwerb von Rechten an der Software selbst ist damit nicht<br />
verbunden. Die GSI behält sich insbesondere alle Veröffentlichungs-, Vervielfältigungs- und<br />
Verwertungsrechte an der Software vor.<br />
5. Vervielfältigung<br />
Die Software und das zugehörige Schriftmaterial sind urheberrechtlich geschützt.<br />
Soweit die Software nicht mit einem Kopierschutz versehen ist, ist Ihnen das Anfertigen einer einzigen<br />
Reservekopie nur zu Sicherungszwecken erlaubt. Sie sind verpflichtet auf der Reservekopie den<br />
Urheberrechtsvermerk der <strong>SLV</strong> <strong>Duisburg</strong> anzubringen bzw. ihn darin aufzunehmen. Ein in der<br />
Software vorhandener Urheberrechtsvermerk sowie in ihr aufgenommene Registrierungsnummern<br />
dürfen nicht entfernt werden.<br />
Es ist ausdrücklich verboten die Software, wie auch das schriftliche Material, ganz oder teilweise in<br />
ursprünglicher oder abgeänderter Form oder in mit anderer Software zusammengemischter oder in<br />
anderer Software eingeschlossener Form zu kopieren oder anders zu vervielfältigen.<br />
6. Übertragung des Benutzungsrechtes<br />
Das Recht zur Benutzung der Software kann nur mit vorheriger Einwilligung der GSI und nur unter den<br />
Bedingungen dieses Vertrages an einen Dritten übertragen werden.<br />
Verschenken, Vermietung und Verleih der Software sind ausdrücklich untersagt.<br />
7. Dauer des Vertrages<br />
Das Recht des Lizenznehmers zur Benutzung der Software erlischt automatisch ohne Kündigung,<br />
wenn er eine Bedingung dieses Vertrages verletzt. Bei Beendigung des Nutzungsrechtes ist er<br />
verpflichtet, die Originaldiskette wie alle Kopien der Software einschl. abgeänderter Exemplare sowie<br />
das schriftliche Material zu vernichten.<br />
8. Schadensersatz bei Vertragsverletzung<br />
Die GSI macht darauf aufmerksam, dass Sie für alle Schäden aufgrund von<br />
Urheberrechtsverletzungen haften, die der GSI aus einer Verletzung dieser Vertragsbestimmungen<br />
durch Sie entstehen.<br />
9. Änderungen und Aktualisierungen<br />
Die GSI ist berechtigt Aktualisierungen der Software nach eigenem Ermessen zu erstellen.<br />
10. Gewährleistung und Haftung der GSI<br />
a) Die GSI gewährleistet gegenüber dem ursprünglichen Lizenznehmer, dass zum Zeitpunkt der<br />
Übergabe der Datenträger (CD-ROM), auf dem die Software aufgezeichnet ist, und die mit der<br />
Software zusammen ausgelieferte Hardware unter normalen Betriebsbedingungen und bei normaler<br />
Instandhaltung in Materialausführung fehlerfrei sind.<br />
b) Sollte der Datenträger (CD-ROM) oder die damit ausgelieferte Hardware fehlerhaft sein, so kann<br />
der Erwerber Ersatzlieferung während der gesetzlichen Gewährleistungszeit ab Lieferung verlangen,<br />
Er muss dazu die Diskette, die eventuell mit ihr ausgelieferte Hardware einschl. der Reservekopie und<br />
des schriftlichen Material und einer Kopie der Rechnung/Quittung an die GSI oder an den Händler,<br />
von dem das Produkt bezogen wurde, zurückgeben.<br />
c) Wird ein Fehler im Sinne von Ziff. 10b nicht innerhalb angemessener Frist durch eine<br />
Ersatzlieferung behoben, so kann der Erwerber nach seiner Wahl Herabsetzung des Erwerbspreises<br />
oder Rückgängigmachen des Vertrages verlangen.
d) Aus den vorstehend unter 1. genannten Gründen übernimmt die GSI keine Haftung für die<br />
Fehlerfreiheit der Software. Insbesondere übernimmt die GSI keine Gewähr dafür, dass die Software<br />
den Anforderungen und Zwecken des Erwerbers genügt oder mit anderen von ihm ausgewählten<br />
Programmen zusammenarbeitet. Die Verantwortung für die richtige Auswahl und die Folgen der<br />
Benutzung der Software sowie der damit beabsichtigten oder erzielten Ergebnisse trägt der Erwerber.<br />
Das gleiche gilt für das die Software begleitende schriftliche Material. Ist die Software nicht im Sinne<br />
von 1. grundsätzlich brauchbar, so hat der Erwerber das Recht den Vertrag rückgängig zu machen.<br />
Das gleiche Recht hat die GSI, wenn die Herstellung von im Sinne von 1. brauchbarer Software mit<br />
angemessenem Aufwand nicht möglich ist.<br />
e) Die GSI haftet nicht für Schäden, es sei denn, dass ein Schaden durch Vorsatz oder grobe<br />
Fahrlässigkeit seitens der GSI verursacht worden ist. Gegenüber Kaufleuten wird auch die Haftung für<br />
grobe Fahrlässigkeit ausgeschlossen.<br />
Eine Haftung wegen evtl. von der GSI zugesicherten Eigenschaften bleibt unberührt. Eine Haftung für<br />
Mangelfolgeschäden, die nicht von der Zusicherung umfasst sind, ist ausgeschlossen.<br />
11. Ist der Lizenznehmer Vollkaufmann so wird auf diesen Vertrag das Recht der Bundesrepublik<br />
Deutschland angewendet.<br />
12. Für alle aus diesem Lizenzvertrag sich ergebenden Rechte und Pflichten gilt für beide Teile<br />
<strong>Duisburg</strong> als Erfüllungsort und Gerichtsstand.<br />
GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH<br />
Aachener Straße 172<br />
40223 Düsseldorf<br />
Tel. (02 11) 15 96 227, Fax (02 03) 3 60 90 02<br />
Ihr Ansprechpartner:<br />
Schweißtechnische Lehr und Versuchsanstalt <strong>Duisburg</strong>; Niederlassung der GSI mbH<br />
Bismarckstraße 85, Postfach 101262,<br />
D-47012 <strong>Duisburg</strong>,<br />
Telefon: Inland: 0203/37810, Ausland: 0049203/37810<br />
Telefax: Inland: 0203/3781228, Ausland: 0049203/3781228
Anschriften der Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalten<br />
in der GSI mbH<br />
Berlin-Brandenburg Hannover<br />
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt<br />
Berlin-Brandenburg<br />
Niederlassung der GSI mbH<br />
Luxemburger Straße 21<br />
13353 Berlin<br />
Telefon 030 45001-0, Telefax 030 45001-111<br />
Internet www.slv-bb.de<br />
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Hannover<br />
Am Lindener Hafen 1<br />
30453 Hannover<br />
Telefon 0511 21962-0, Telefax 0511 21962-22<br />
Internet www.slv-hannover.de<br />
<strong>Duisburg</strong> München<br />
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt <strong>SLV</strong> <strong>Duisburg</strong> Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt <strong>SLV</strong> München<br />
Niederlassung der GSI mbH<br />
Niederlassung der GSI mbH<br />
Bismarckstraße 85<br />
Schachenmeierstraße 37<br />
47057 <strong>Duisburg</strong><br />
80636 München<br />
Telefon 0203 3781–0, Telefax 0203 3781-228<br />
Telefon 089 126802-0, Telefax 089 181643<br />
Internet www.slv-duisburg.de<br />
Internet www.slv-muenchen.de<br />
Fellbach Saarbrücken<br />
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt <strong>SLV</strong> Fellbach Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt im Saarland<br />
Niederlassung der GSI mbH<br />
Niederlassung der GSI mbH<br />
Stuttgarter Straße 86<br />
Heuduckstraße 91<br />
70736 Fellbach<br />
66117 Saarbrücken<br />
Telefon 0711 57544-0, Telefax 0711 57544-33<br />
Telefon 0681 58823-0, Telefax 0681 58823-22<br />
Internet www.slv-fellbach.de<br />
Internet www.slv-saar.de<br />
Halle Mecklenburg-Vorpommern<br />
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Halle GmbH<br />
Köthener Straße 33a<br />
06118 Halle (Saale)<br />
Telefon 0345 5246-0, Telefax 0345 5246-412<br />
Internet www.slv-halle.de<br />
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt<br />
Mecklenburg-Vorpommern GmbH<br />
Alter Hafen Süd 4<br />
18069 Rostock-Marienehe<br />
Telefon 0381 811-5010, Telefax 0381 811-5099<br />
Internet www.slv-rostock.de<br />
Nord<br />
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Nord<br />
an der Handwerkskammer Hamburg im DVS<br />
Goetheallee 3<br />
22765 Hamburg (Altona)<br />
Telefon 040 35905-400, Telefax 040 35905-444<br />
Internet: www.slv-nord.de<br />
Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt<br />
Mannheim GmbH<br />
Käthe-Kollwitz-Straße 19<br />
68169 Mannheim<br />
Telefon: 0621 3004-0, Telefax: 0621 3004-291<br />
Internet: www.slv-mannheim.de