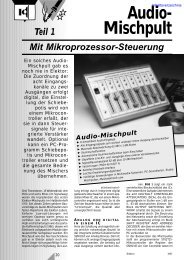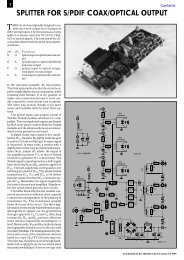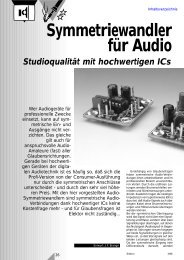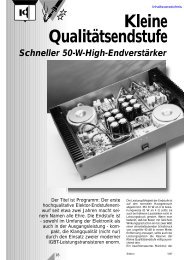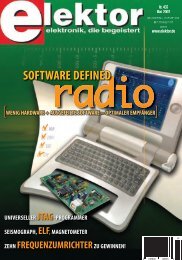PASSIVER SUBWOOFER Technische Daten - WebHTB
PASSIVER SUBWOOFER Technische Daten - WebHTB
PASSIVER SUBWOOFER Technische Daten - WebHTB
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
gewinnen wir gegenüber der passiven<br />
Ausführung eine zusätzliche Oktave<br />
am unteren Ende des Frequenzbereichs.<br />
Der -3-dB-Punkt bei 20 Hz (!)<br />
verleiht so Filmen mit Surround-<br />
Sound ein eindruckerweckendes Baßfundament.<br />
D IE PASSIVE V ERSION<br />
Um einen Subwoofer an eine schon<br />
existierenden Audio-Anlage anzuschließen,<br />
muß er über zwei getrennte<br />
Anschlüsse für den linken und den<br />
rechten Kanal verfügen. Dies bedeutet<br />
entweder den Einsatz eines Systems<br />
mit zwei Lautsprechern oder eines<br />
Lautsprechers mit doppelter Schwingspule.<br />
Jede dieser Schwingspulen ist<br />
über ein Filter mit einem Kanal verbunden.<br />
Wir haben uns für die zweite,<br />
platzsparende Möglichkeit entschieden.<br />
Der eingesetzte Baßlautsprecher, ein<br />
SPH-300TC von Monacor, ist ein relativ<br />
preiswerter Typ, der dennoch über<br />
einen schwergewichtigen Permanentmagneten<br />
verfügt. Der Konusdurchmesser<br />
beträgt 30 cm, die für diese Anwendung<br />
wichtige Luftverdrängung<br />
(V d ) ordentliche 200 cm 3 . Auch die anderen<br />
Parameter des SPH-300TC sprechen<br />
für einen Einsatz des Lautsprechers<br />
in einem Baßreflexgehäuse.<br />
Die Abstimmung wurde mit dem<br />
Boxen-Simulationsprogramm Boxcalc<br />
berechnet, wobei ein günstiger Kompromiß<br />
zwischen kleinem Gehäusevolumen<br />
und niedriger -3-dB-Frequenz<br />
angestrebt wurde. Als Resultat erhielten<br />
wir ein 65-l-Gehäuse mit einem auf<br />
etwa 23 Hz abgestimmten Reflexrohr.<br />
Der Frequenzverlauf der Box in Bild<br />
1 zeigt, daß der -3-dB-Punkt auf etwa<br />
40 Hz liegt, was für einen großen Lautsprecher<br />
in einem für Audio-Verhältnisse<br />
kleinen Gehäuse ein gutes Ergebnis<br />
darstellt. Die Frequenz von 40<br />
Hz ist auch niedrig genug, um den<br />
Subwoofer als passive Version in eine<br />
schon existierende Anlage zu integrieren.<br />
Eine elektronische Korrektur ermöglicht<br />
es, noch eine gute Oktave tiefer<br />
zu gehen. Diese aktive Variante soll<br />
nächsten Monat vorgestellt werden.<br />
D IE F ILTER<br />
Neben der Wahl des Lautsprechers<br />
und der Berechnung des Gehäuses<br />
muß noch ein passives Filter entworfen<br />
werden. Angesichts der Vorgabe,<br />
möglichst preiswert zu bleiben, ist dies<br />
bei einem Subwoofer gar kein so leichtes<br />
Unterfangen, wie es auf dem ersten<br />
Blick erscheinen mag. In Bild 2 ist die<br />
Impedanzkurve das Subwoofers abgebildet.<br />
Die beiden Schwingspulen sind<br />
dabei parallel geschaltet, um ein vertrauenswürdiges<br />
Meßergebnis zu erzielen.<br />
Die Impedanzangabe muß deshalb<br />
für jede Schwingspule verdoppelt<br />
Elektor 3/96<br />
1<br />
werden. Die Kurve<br />
weist zwei Spitzen auf,<br />
eine bei 10 Hz aufgrund<br />
der Baßreflex-<br />
Abstimmung (die<br />
genau im Minimum<br />
bei 23 Hz liegt) und die andere knapp<br />
über 50 Hz, verursacht von der Resonanzfrequenz<br />
des Lautsprechers im<br />
Gehäuse.<br />
Normalerweise wird die obere Grenzfrequenz<br />
eines Subwoofers auf oder<br />
niedriger als 100 Hz festgelegt, damit<br />
er nicht den normalen Stereo-Boxen ins<br />
Gehege kommt. Ein passives Filter<br />
funktioniert aber nur ideal, wenn es<br />
auch ohmsch abgeschlossen wird.<br />
Wählt man aber eine Grenzfrequenz<br />
von 100 Hz, verdirbt die Resonanzspitze<br />
bei 52 Hz den theoretisch berechneten<br />
Frequenzgang des Filters erheblich.<br />
Aus diesem Grund muß der<br />
Impedanzverlauf des<br />
Lautsprechers zunächst<br />
korrigiert werden.<br />
Häufig glättet man die<br />
Resonanzspitze mit zu<br />
den Schwingspulen<br />
parallel geschalteten<br />
2<br />
Bild 1. Der Frequenzgang<br />
des Monacor SPH-300TC<br />
in einem 65-l-<br />
Baßreflexgehäuse, das<br />
auf 23 Hz abgestimmt ist.<br />
Bild 2. In der<br />
Impedanzkurve der parallelgeschalteten<br />
Schwingspulen ist die<br />
Spitze ein Problem für<br />
das Passivfilter.<br />
55<br />
RCL-Kreisen, die<br />
genau auf die Resonanzfrequenzberechnet<br />
sind. Die<br />
Werte der Bauteile<br />
dieser Kreise sind<br />
in der Regel dermaßen hoch, daß die<br />
Spulen und Kondensatoren nicht nur<br />
viel Raum einnehmen, sondern sich<br />
die Korrektur der Resonanz auch als<br />
ein ziemlich teures Vergnügen erweist.<br />
Wir beschreiten deshalb einen anderen<br />
Weg: Statt der teuren RCL-Resonanzkreise<br />
werden zwei ohmsche Widerstände<br />
parallel zu den Schwingspulen<br />
geschaltet, so daß die Spitzen zwar<br />
nicht komplett verschwinden, aber<br />
doch auf zwei harmlose Buckel reduziert<br />
werden. Danach kann man die<br />
Dimensionierung des Filters einem Simulationsprogramm<br />
(hier Calsod)<br />
überlassen, so daß der gewünschte<br />
Frequenzgang er-<br />
reicht wird. Es<br />
wurde übrigens -<br />
um die Zahl der<br />
Bauteile gering zu<br />
halten - ein aus L1<br />
und C1 bestehen-