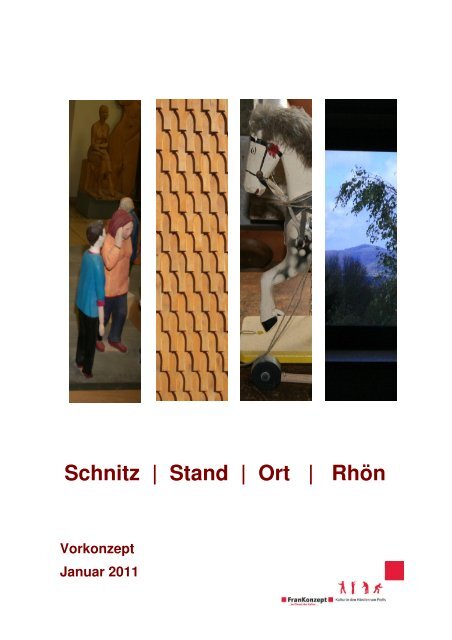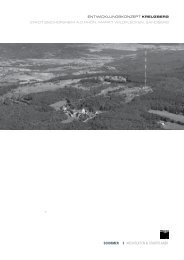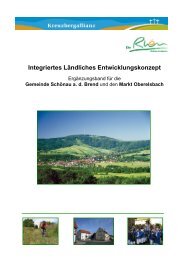Schnitz | Stand | Ort - Kreuzbergallianz
Schnitz | Stand | Ort - Kreuzbergallianz
Schnitz | Stand | Ort - Kreuzbergallianz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Vorkonzept<br />
Januar 2011
Vorkonzept zum Kooperationsprojekt<br />
„Holzbildhauer, Holzschnitzkunst, Gebrauchswaren<br />
der Gemeinde Sandberg<br />
und Spielzeugherstellung<br />
in der Rhön“<br />
und der Stadt Bischofsheim a. d. Rhön
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Inhalt<br />
Einleitung: Aufgabenstellung 3<br />
- Genese der Projektidee 3<br />
- Holzschnitzerei in der Rhön 4<br />
Rahmenbedingungen 1: Holzschnitzerei im regionalen Umfeld 7<br />
- Museum Obere Saline Bad Kissingen 7<br />
- Rhönmuseum Fladungen 8<br />
- Kreisgalerie Mellrichstadt und Kloster Wechterswinkel 9<br />
- <strong>Schnitz</strong>ermuseum Empfertshausen 10<br />
- Schaufenster der Region Kreuzberg 11<br />
Rahmenbedingungen 2: Gemeinde Sandberg 13<br />
- Geschichte und Gegenwart der Holzschnitzerei 15<br />
- Protagonisten und Akteure in der Gemeinde Sandberg 18<br />
- Historische Objekte und Sammlungsbestände 20<br />
- Mögliche Projektstandorte 21<br />
o Rathaus Sandberg 22<br />
o Alte Schule Sandberg 24<br />
o Alternativstandorte Langenleiten 25<br />
o Dorfgemeinschaftshaus Kilianshof (Schaufenster) 27<br />
Rahmenbedingungen 3: Stadt Bischofsheim a. d. Rhön 28<br />
- Geschichte und Gegenwart der Holzschnitzerei 30<br />
- Protagonisten und Akteure in Bischofsheim a. d. Rhön 33<br />
- Ausstellungsobjekte und Sammlungsbestände 36<br />
- Möglicher Projektstandort 37<br />
o Schneidmühle Bischofsheim a. d. Rhön 37<br />
Zielsetzung: Vision mit Augenmaß 40<br />
1
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Projektvorschlag: <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön 42<br />
- Gesamtkonzept und Teilprojekte 42<br />
<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Bischofsheim a. d. Rhön:<br />
Holzschnitzschule und Bildschnitzerkunst 46<br />
- Baustein 1: Dauerausstellung (inkl. Anforderungen an die Räumlichkeiten) 46<br />
- Baustein 2: Wechselausstellung 49<br />
- Baustein 3: Werkstatt 51<br />
- Didaktische Zielsetzung 52<br />
<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Sandberg:<br />
<strong>Schnitz</strong>gewerbe und Hausierhandel 53<br />
- Baustein 1: Dauerausstellung (inkl. Anforderungen an das Ausstellungsgebäude)53<br />
- Baustein 2: Dokumentationsstelle 56<br />
- Baustein 3: Schaufenster 56<br />
- Didaktische Zielsetzung 57<br />
<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Langenleiten:<br />
Kunst auf dem Dorfanger 58<br />
- Baustein: Kunstanger 58<br />
- Didaktische Zielsetzung 60<br />
Betriebskonzept 61<br />
- Träger und Betreiber 61<br />
- Personalbedarf 62<br />
- Qualifizierungsmaßnahmen 63<br />
- Veranstaltungsprogramm 63<br />
- Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und Kooperation 64<br />
Budgetrahmen 66<br />
ANHANG<br />
- Arbeitsgespräche und –termine 71<br />
- Literatur 73<br />
2
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Einleitung: Aufgabenstellung<br />
Der Auftrag zum vorliegenden Konzept wurde am 8. September 2010 unter der<br />
Projektbezeichnung „Holzbildhauer, Holzschnitzkunst, Gebrauchswaren und Spiel-<br />
zeugherstellung in der Rhön“ an das Kulturbüro FranKonzept vergeben. In dieser<br />
Benennung, in der ein Berufszweig, eine Kunstrichtung, eine Objektgruppe und ein<br />
Produktionsform miteinander kombiniert werden, spiegelt sich bereits unübersehbar<br />
die grundsätzliche Problematik der Themenstellung: Denn so scheinbar naheliegend<br />
und griffig das Thema „<strong>Schnitz</strong>erei in der Rhön“ auf den ersten Blick zu sein scheint,<br />
so vielgestaltig fasert es sich bei genauerer Betrachtung auf – in verschiedene<br />
Berufszweige (oder –auffassungen), unterschiedliche handwerkliche oder künstle-<br />
rische (Aus)Richtungen, stark differierende Produktpaletten bzw. (Kunst)Werke und<br />
nicht zuletzt in weit auseinander liegende Arbeitsweisen und Absatzmärkte.<br />
Genese der Projektidee<br />
Auslöser für das <strong>Schnitz</strong>erei-Projekt in der Rhön ist ein Ausstellungsprojekt des<br />
Museums Obere Saline in Bad Kissingen, das ab 13. Mai 2011 die Spielzeugsamm-<br />
lung „Hilla Schütze“ dauerhaft öffentlich präsentieren wird. Diese Präsentation will<br />
nicht allein historisches Spielzeug ausstellen, sondern insbesondere auch Herstel-<br />
lungsorte und Vertriebswege von Spielwaren in und aus der Rhön aufzeigen, um so<br />
auch die Region um das Kurbad Kissingen mit einzubeziehen. Gemeinsam mit dem<br />
Leader-Regionalmanagement der Landkreise Bad Kissingen und Rhön- Grabfeld<br />
wurde nach möglichen Anknüpfungspunkten in den ehemaligen <strong>Ort</strong>en der Spielzeug-<br />
herstellung und damit auch nach Projektpartnern vor <strong>Ort</strong> gesucht. In der Gemeinde<br />
Sandberg hatte sich in Verbindung mit Maßnahmen der Dorferneuerung bereits ein<br />
aktiver „Arbeitskreis Kunst und Kultur“ gebildet, der sich unter anderem um Ausstel-<br />
lungsräumlichkeiten für örtliche Künstler – darunter auch Bildschnitzer – bemühte.<br />
Bei Gesprächen wurde 2009 eine Zusammenarbeit zwischen dem Museum Bad Kis-<br />
singen und der Gemeinde Sandberg vereinbart. Ziel sollte die (Weiter)Entwicklung<br />
3
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
von zwei inhaltlich zusammengehörigen, zeitlich und fördertechnisch aber voneinan-<br />
der unabhängigen Projekten sein: zum Einen die Realisierung der Spielzeugausstel-<br />
lung im Museum Obere Saline bis Mai 2011 und zum Anderen die Einrichtung einer<br />
ergänzender Aus- und Darstellung vor <strong>Ort</strong> in Sandberg. Auch die Stadt Bischofsheim<br />
a. d. Rhön zeigte Interesse an einer solchen örtlichen Ausstellung und schloss sich<br />
daher mit der Gemeinde Sandberg zusammen, um das nun vorliegende Konzept er-<br />
stellen zu lassen. Grundlagen des Interesses in Bischofsheim a. d. Rhön bildete ei-<br />
nerseits die in der Stadt beheimatete Holzschnitz- bzw. Holzbildhauerschule und<br />
andererseits die bereits bestehenden Vorüberlegungen zur Einrichtung eines „Kultur<br />
ErlebnisZentrums“. Letztlich entstand so eine Projektidee, die durchaus disparate<br />
Handlungsansätze und Interessenslagen unter dem Thema „Holzschnitzerei“ zusam-<br />
menbringen will. Ein entsprechendes Konzept muss den Anforderungen aller beteilig-<br />
ten Kommunen und Akteure gerecht werden, ohne dabei die übergeordnete themati-<br />
sche und strategische Zielsetzung des Gesamtprojektes aus den Augen zu verlieren.<br />
Holzschnitzerei in der Rhön<br />
Unzweifelhaft ist es sinnvoll und wünschenswert, das Thema „<strong>Schnitz</strong>erei in der<br />
Rhön“ vor <strong>Ort</strong> sowohl für Gäste und Touristen als auch für die einheimische Bevöl-<br />
kerung verständlich, modern und unterhaltsam aufzubereiten und darzustellen. Doch<br />
anders als womöglich in anderen traditionellen <strong>Schnitz</strong>regionen, wie etwa dem Erz-<br />
gebirge, dem Berchtesgadener Land oder in Oberammergau, lässt sich in der Rhön<br />
weder die Entstehung des <strong>Schnitz</strong>handwerks noch dessen Entwicklung oder gar<br />
seine heutigen handwerklichen und künstlerischen Formen zu einem einheitlichen<br />
Gesamtbild zusammenfassen. Die Vorstellung von einer „typisch rhönerischen<br />
<strong>Schnitz</strong>kunst“ mit einem bestimmten Stil, bestimmten Produkten oder Themen, wie<br />
sie zeitweise – insbesondere seit den 1950er Jahren – durchaus bestanden hatte, ist<br />
mittlerweile längst obsolet. Elke Böhm zeigte, dass die Anfertigung von „Rhöner Krip-<br />
pen“ auf die Anregung eines Kreuzberg-Besuchers aus Fulda Ende der 1930er Jahre<br />
zurückgeht und es meist Auftragsarbeiten sind; Wolfgang Brückner benannte singu-<br />
läre Bildschnitzer vor der Rhön – in Mühlfeld und Ostheim – als Produzenten der so<br />
4
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
genannten „Rhönwackler“ und Walter Stolle lokalisierte den Ursprung der „Rhöner<br />
Masken“ kurz vor der Mitte des 19. Jahrhunderts punktgenau in Oberelsbach. Statt<br />
uralter, einheitlicher, tiefverwurzelter, landschaftsgebundener<br />
und landschaftstypischer Traditionen findet die moderne<br />
Forschung also vergleichsweise junge singuläre Ereignisse,<br />
konkret benennbare vereinzelte Protagonisten und genau<br />
lokalisierbare einzelne <strong>Ort</strong>schaften. Das „Rhönerische“ zerfällt<br />
in Einzelteile. Wirkliche regionale – um nicht zu sagen<br />
gesamt- “rhönerische“ – Bedeutung konnte allein die Holz-<br />
schnitzschule beanspruchen, die 1862 von Poppenhausen nach Bischofsheim a. d.<br />
Rhön verlegt wurde und sämtliche <strong>Schnitz</strong>erei im Gebiet (zumindest der bayerischen<br />
Rhön) maßgeblich prägte. Sie machte die Holzschnitzerei zu einem verbreiteten Ge-<br />
werbe im Rhöngebirge, das insbesondere der großen Armut entgegenwirken sollte.<br />
Dabei wandelte sich die Ausrichtung und Zielsetzung der Holzschnitzschule im Laufe<br />
der Zeit von der anfänglichen Vermittlung grundlegender Fertigkeiten zur Herstellung<br />
einfacher Figuren und Massenware bis hin zur expliziten Ausbildung von künstleri-<br />
schen Bildhauern in der heutigen Staatlichen Berufsfachschule für Holzbildhauer. Die<br />
Absolventen der <strong>Schnitz</strong>schule ihrerseits fertigten (zumindest anfangs) vor allem das<br />
in Serie, was sich verkaufen ließ, wobei sich<br />
– je nach Nachfrage – Wellen in der Pro-<br />
duktion abzeichneten, wie etwa die Ferti-<br />
gung einfacher Spielzeugfiguren für den<br />
Bad Kissinger Souvenirhandel Ende des 19.<br />
Jahrhunderts, die massenhafte Produktion<br />
von Galanteriewaren für US-Soldaten nach<br />
dem Zweiten Weltkrieg oder die Herstellung von Wurzelmännchen seit den 1970er<br />
Jahren. Auch ungelernte Arbeitskräfte verdienten an der Massenproduktion, sei es,<br />
dass sie ebenfalls zum Messer griffen, oder aber den Vertrieb der Ware übernah-<br />
men. Daneben fanden sich aber auch stets künstlerisch arbeitende Bildschnitzer, die<br />
individuelle Werke schufen, wie beispielsweise Emil Arnold aus Langenleiten. Auch<br />
5
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
heute bietet die Holzschnitzerei in der Rhön weiterhin ein ähnlich uneinheitliches<br />
Bild: Neben den Ateliers ausgebildeter Künstler finden sich handwerklich arbeitende<br />
Betriebe, in der Erwachsenenbildung tätige Kunst-<br />
handwerker, auf den Verkauf maschinell (vor)produ-<br />
zierter <strong>Schnitz</strong>ereien spezialisierte Werkstätten oder<br />
gar ein Fräsbetrieb. Die angebo-<br />
tenen Produkte reichen von<br />
maschinell hergestellten rohen<br />
Fräslingen über handgearbeitete<br />
Einzelstücke bis hin zu Kunst-<br />
werken. Dabei sind aktuell die<br />
mitunter scharfen und heftigen Abgrenzungsbemühungen<br />
zwischen den einzelnen <strong>Schnitz</strong>betrieben und den jeweils<br />
vertretenen künstlerischen Vorstellungen vom eigenen Beruf<br />
klar erkennbar. Somit ist weder in der Vergangenheit noch in<br />
der Gegenwart eine in irgendeiner Form einheitliche „Rhöner<br />
Holzschnitzerei“ nachweisbar – und doch ist die Aufarbeitung<br />
der „<strong>Schnitz</strong>erei in der Rhön“ Themenstellung des Projekts.<br />
6
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Rahmenbedingungen 1:<br />
Holzschnitzerei im regionalen Umfeld<br />
Die große Relevanz des Themas „Holzschnitzerei“ in der Rhön hat selbstverständlich<br />
bereits sichtbaren Niederschlag auch in anderen – hauptsächlich musealen – Ein-<br />
richtungen der Region gefunden. Jede dieser Einrichtungen legt ihren ganz eigenen<br />
Schwerpunkt auf einzelne Teilbereiche des Gesamtthemas und beleuchtet Aus-<br />
schnitte des Rhöner <strong>Schnitz</strong>wesens. Dabei stehen alle Institutionen bisher weitge-<br />
hend unverbunden nebeneinander. Die Initiierung eines neuen <strong>Schnitz</strong>projektes in<br />
der Region muss sich sehr präzise im Umfeld der bestehenden Einrichtungen<br />
positionieren, um regionale Konkurrenzen zu vermeiden und stattdessen Synergie-<br />
effekte zu befördern. Die Kooperation mit dem Museum Obere Saline in Bad<br />
Kissingen weist bereits in die richtige Richtung. Es bestehen zudem gute Chancen,<br />
das <strong>Schnitz</strong>projekt in Sandberg und Bischofsheim a. d. Rhön auch mit dem<br />
zukünftigen Rhönmuseum in Fladungen und der Kreisgalerie in Mellrichstadt zu<br />
vernetzen.<br />
Museum Obere Saline Bad Kissingen<br />
Das Museum in der Oberen Saline beherbergt derzeit zum Einen das Bismarck-<br />
Museum, das in z.T. original eingerichteten Wohnräumen die Verbindung des<br />
Reichskanzlers zur Kurstadt Kissingen<br />
beleuchtet, und zum Anderen Museums-<br />
abteilungen zur Stadt- und Regionalge-<br />
schichte, die sich insbesondere auf die<br />
Salzvorkommen und deren Nutzung bzw.<br />
auf die Entwicklung des Heilbades<br />
Kissingen konzentrieren und damit ein<br />
prägnantes Charakteristikum der Lokal-<br />
und Regionalgeschichte in den Vordergrund der Präsentation rücken. Am 13. Mai<br />
2011 wird eine weitere, rund 130 qm große Ausstellungsabteilung eröffnet<br />
7
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
werden, die auf der Spielzeugsammlung der Sammlerin Hilla Schütze basiert. Das<br />
Konzept der künftigen Ausstellung kreist um die Spielzeugherstellung in der Rhön<br />
und den folgenden Verkauf der geschnitzten Spielwaren vor allem auch in Bad<br />
Kissingen. Geplant ist eine Einleitung ins Ausstellungsthema, in der die Spielzeug-<br />
produktion als Noterwerb in den armen Rhöndörfern vorgestellt wird. Dabei sollen<br />
alle nachweisbaren Produktionsorte für Spielzeuge aufgezeigt werden: U.a. Bischofs-<br />
heim a. d. Rhön, Sandberg, Langenleiten, Empfertshausen, Frankenheim, Motten<br />
und Oberbach. Die Handelsbeziehungen nach Bad Kissingen lassen sich vor allem<br />
über den Ladenbesitzer Friedrich Meinel greifen, der seine Spielwaren – insbeson-<br />
dere die „weißen Pferde“ – in Sandberg produzieren ließ und sie in Bad Kissingen<br />
verkaufte. Auch zwischen der Holzschnitzschule in Bischofsheim a. d. Rhön und Bad<br />
Kissingen bestanden zeitweise Handelsbeziehungen.<br />
Die neue Ausstellung im Museum Obere Saline wird sich explizit der Spielzeugher-<br />
stellung und dem –handel, und damit lediglich einem (wenn auch durchaus bedeut-<br />
samen) Teilaspekt der <strong>Schnitz</strong>erei in der Rhön widmen. Die Idee, mit ergänzenden<br />
dezentralen Ausstellungen auf die Produktionsorte in der Rhön zu verweisen, ist da-<br />
bei wegweisend – eröffnet sie doch die Möglichkeit, die große Vielfalt des <strong>Schnitz</strong>the-<br />
mas räumlich aufzuschlüsseln. Die Beschränkung auf die Spielwarenproduktion, die<br />
im Rahmen der Ausstellung in Bad Kissingen aus verschiedenen Gründen unum-<br />
gänglich ist, muss im Hinblick auf ein Konzept für Sandberg und Bischofsheim a. d.<br />
Rhön allerdings aufgebrochen werden.<br />
Rhönmuseum Fladungen<br />
Das Rhönmuseum in Fladungen besteht seit 1921 und verfügt – neben<br />
älteren, größeren plastischen Werken aus Holz – auch über eine an-<br />
sehnliche Sammlung hölzerner <strong>Schnitz</strong>waren. Es ist nicht zuletzt dem<br />
zentralen Charakter des Rhönmuseums zu verdanken, dass die dortigen<br />
Sammlungsstücke letztlich auch die falsche Vorstellung von einer<br />
„Rhöner Volkskunst“ schufen. Hier fanden erstmals Oberelsbacher<br />
Holzmasken größere Aufmerksamkeit (1939 besaß das Museum fünf<br />
8
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
solcher Stücke), und es wurde mit dem Ankauf des sog. „Hochzeitszuges“ 1954 erst-<br />
mals einer „Rhönerische“ Kleinfigurenschnitzerei postuliert. Seither fielen <strong>Schnitz</strong>-<br />
waren, die den Exponaten im Rhönmuseum glichen, unter den Begriff des „Rhöneri-<br />
schen“, den erst jüngere Forschungen, wie von Elke Böhm, Wolfgang Brückner oder<br />
Walter Stolle, dekonstruierten. Derzeit ist die gesamte Samm-<br />
lung des Rhönmuseums eingelagert, um die im Jahr 2011<br />
anlaufende Sanierung des großen Amtsgebäudes zu ermög-<br />
lichen. Nach Abschluss der Arbeiten (voraussichtlich 2013)<br />
wird sich die Ausstellung nach einem neuen, derzeit noch<br />
nicht weiter ausgearbeiteten Konzept in einem anderen Ge-<br />
bäudeflügel wieder präsentieren. Angedacht sind einzelne Themenschwerpunkte,<br />
etwa zur Keramik oder zur Schreinerei, wobei sicherlich die Holzschnitzerei erneut<br />
eine Rolle spielen wird. Nachdem das Betriebskonzept und die künftige Personal-<br />
struktur noch nicht abschließend geklärt sind, sind gesicherte Aussagen über Koope-<br />
rationsoptionen derzeit nicht sicher möglich. Allerdings sieht die Leiterin des Fränki-<br />
schen Freilandmuseums Fladungen Dr. Sabine Fechter, die derzeit als fachliche Be-<br />
raterin fungiert und deren Haus das Rhönmuseum womöglich angeschlossen werden<br />
wird, wünschenswerten Abstimmungsbedarf zwischen einem <strong>Schnitz</strong>ereiprojekt in<br />
Sandberg und Bischofsheim und dem Rhönmuseum im Vorfeld von dessen<br />
Neuaufstellung.<br />
Kreisgalerie Mellrichstadt und Kloster Wechterswinkel<br />
In der Kreisgalerie Mellrichstadt findet sich unter den zahlreichen Kunstwerken ver-<br />
schiedenster Epochen, die durchweg mit der Rhön in Verbindung stehen, auch eine<br />
Reihe von Werken aus Holz. Dabei handelt es sich gemäß der kunstgeschichtlichen<br />
Ausrichtung der Galerie nicht um hölzerne Gebrauchsgegenstände, Galanteriewaren<br />
oder sog. „Volkskunst“, sondern um Arbeiten z.T. durchaus namhafter Bildschnitzer.<br />
Als 1973 der Kreis die Trägerschaft der kurz vor ihrer Schließung stehenden<br />
Bischofsheimer Holzschnitzschule übernahm, übernahm er damit auch die noch<br />
vorhandenen künstlerischen Arbeiten, die mittlerweile in der Kreisgalerie präsentiert<br />
9
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
werden. Darüber hinaus steuerte die Holzschnitzschule bzw.- Holzbildhauerschule<br />
auch in jüngerer Zeit aktuelle Arbeiten zur Ausstellung in Mellrichstadt bei. Präsen-<br />
tiert werden die Kunstwerke der Schule<br />
heute in einem Dachraum der Kreisgalerie.<br />
Mit der Eröffnung des sanierten Klosters<br />
Wechterswinkel steht dem Landkreis Rhön-<br />
Grabfeld neben der Dauerausstellung zur<br />
regionalen Kunstgeschichte in der Kreis-<br />
galerie nun auch eine stattliche Wechselaus-<br />
stellungsfläche zur Verfügung: Im Erdgeschoss wird zeitgenössische Kunst ausge-<br />
stellt, wobei der Schwerpunkt auf der Bildhauerei liegt. Verwiesen sei auf die Richard<br />
Mühlemeier Retrospektive im Herbst 2010. Mit der Aus-<br />
stellung zum „Rhöner Krippenweg“ im Winter 2009/10<br />
widmete sich Kloster Wechterswinkel auch der traditio-<br />
nelleren <strong>Schnitz</strong>kunst. In seinen beiden inhaltlich von der<br />
Kulturagentur des Landkreises betreuten Einrichtungen<br />
in Mellrichstadt und Wechterswinkel bemüht sich der<br />
Kreis Rhön-Grabfeld demnach um aktuelle künstlerische Entwicklungen auf dem Ge-<br />
biet der Plastik im Allgemeinen und der Holzskulptur im Besonderen, ohne dass je-<br />
doch die beiden betreffenden Einrichtungen sich ausschließlich der künstlerisch an-<br />
spruchsvollen Holzbearbeitung widmen oder gar den Begriff der „Holzschnitzerei“ in<br />
irgendeiner Form zur Selbst- und Außendarstellung nutzen. Eine künftige Zusam-<br />
menarbeit zwischen einem <strong>Schnitz</strong>projekt in Sandberg / Bischofsheim und den Ein-<br />
richtungen des Kreises scheint in jedem Fall sinnvoll und wohl auch realisierbar, zu-<br />
mal der Kreis – vertreten durch die Kulturagentur – an Vorbereitungsgesprächen in<br />
Sandberg/Bischofsheim bereits beteiligt war und die Konzentration auf Bildschnitze-<br />
rei in keiner seiner Einrichtungen explizit im Mittelpunkt steht.<br />
<strong>Schnitz</strong>ermuseum Empfertshausen<br />
1898 wurde im thüringischen Empfertshausen eine <strong>Schnitz</strong>schule gegründet, die bis<br />
heute existiert und – im Gegensatz zur Bischofsheimer Einrichtung – von Beginn an<br />
eine handwerkliche Ausbildung mit Meisterprüfung im Bildschnitzerhandwerk<br />
10
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
anbietet. Im ehemaligen Schulgebäude von Empfertshausen, das heute an der Stelle<br />
der ersten <strong>Schnitz</strong>schule steht, wurde am 22. September 2000 ein kommunal getra-<br />
genes und von einem eigens gegründeten Verein („Rhöner<br />
Holzbildhauerverein e.V.“) betriebenes <strong>Schnitz</strong>ermuseum<br />
mit „kultureller und touristischer Begegnungsstätte“ eröff-<br />
net. Das Gebäude verfügt über einen Seminarraum für Vor-<br />
träge, über Möglichkeiten für<br />
Schauschnitzvorführungen und<br />
über Ausstellungsräume, in<br />
denen die „Holzschnitztradition“<br />
des <strong>Ort</strong>es dargestellt wird.<br />
Gezeigt werden historische <strong>Schnitz</strong>arbeiten an<br />
Fachwerkbalken, Möbeln und Ge-brauchsgegenständen,<br />
religiöse <strong>Schnitz</strong>arbeiten oder die im thüringischen Raum<br />
verbreitet hergestellten hölzernen Pfeifenköpfe. Vor allem<br />
aber werden Arbeiten aus ört-lichen <strong>Schnitz</strong>werkstätten<br />
präsentiert. Aktuelle Produkte lokaler Hersteller werden dabei auch zum Kauf<br />
angeboten. Die Ausstellung selbst ist in Inhalt und Gestaltung eher schlicht gehalten<br />
und von vordergründig lokalem An-spruch. Thematische Überschneidungen oder<br />
eine Konkurrenzsituation zum geplan-ten <strong>Schnitz</strong>projekt in Sandberg/Bischofsheim<br />
sind nicht zu erwarten. Eine künftige lockere Zusammenarbeit (wechselseitige<br />
Ausstellungen) scheint indes denkbar, ohne dass jedoch die beiden Einrichtungen<br />
direkten Bezug aufeinander nehmen müssten.<br />
„Schaufenster der Region“ Kreuzberg<br />
Das „Schaufenster der Region“ am Kreuzberg existiert momentan nur als ein Vor-<br />
haben der <strong>Kreuzbergallianz</strong> (Zusammenschluss von 5 Gemeinden im Umkreis des<br />
Kreuzbergs, beraten vom Ingenieurbüro für Planung und Umwelt IPU in Erfurt). Im<br />
Zuge einer Neuregelung des fließenden und parkenden Verkehrs auf dem Kreuzberg<br />
soll das sanierungsbedürftige Parkwächterhäuschen einem Ausstellungspavillon<br />
weichen, der rund 50 qm Ausstellungsfläche bieten soll. Angedacht sind dort die<br />
11
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Präsentation und die Vermarktung regionaler Produkte und Spezialitäten, worunter in<br />
jedem Fall auch die Holzschnitzerei gefasst würde. Damit würde am Kreuzberg eine<br />
explizit kommerziell ausgerichtete Einrichtung entstehen, die eine wichtige Aufgabe<br />
im Bereich des Verkaufs regional produzierter <strong>Schnitz</strong>waren erfüllen und damit den<br />
wirtschaftlichen Bedürfnissen der <strong>Schnitz</strong>werk-<br />
stätten entgegenkommen könnte. Eine solche<br />
Einrichtung wäre im Hinblick auf ein LEADER-<br />
gefördertes „nicht-produktives“ <strong>Schnitz</strong>projekt<br />
eine überaus wünschenswerte Ergänzung, da<br />
sich so die förder-technisch nicht unproblema-<br />
tische Einbeziehung von Verkaufsaktivitäten in<br />
das Projekt vermeiden ließe und so an einer anderen Stelle – jenseits von ökonomi-<br />
schen Erfordernissen – eine verstärkte Konzentration auf die inhaltlichen Aspekte<br />
des Themas möglich wäre.<br />
Zusammenfassung<br />
Der knappe Überblick über die mit der Holzschnitzerei in der Rhön befassten, öffent-<br />
lichen Einrichtungen zeigt, dass es trotz unverkennbarer neuer Aktivitäten in dieser<br />
Hinsicht an einer umfassenden und gezielten Bearbeitung des Gesamtthemas unter<br />
wissenschaftlicher-künstlerischen Prämissen und in identitätsstiftender und touris-<br />
musfördernder Absicht bislang mangelt. Sämtliche bestehenden oder im Entstehen<br />
begriffenen Institutionen widmen sich nur Teilbereichen der Gesamtthematik und<br />
gliedern diese in der Regel größeren Zusammenhängen (Geschichte der Rhön,<br />
Kunst der Rhön, Vermarktung regionalere Produkte) ein, so dass der Begriff der<br />
„Holzschnitzerei“ – ausgenommen in Empfertshausen – nirgends explizit mit dem<br />
Namen der Einrichtung in Verbindung gebracht wird. Hier könnte ein neues Projekt in<br />
Sandberg und Bischofsheim a. d. Rhön ansetzen. Unzweifelhaft gilt aber auch, dass<br />
dieses neue Projekt den engen Kontakt mit bestehenden oder geplanten Einrichtun-<br />
gen suchen muss, um inhaltliche Überschneidungen oder gar Konkurrenzsituationen<br />
zu vermeiden. Es scheint im Gegenteil sinnvoll, die bestehenden Einrichtungen und<br />
deren inhaltlichen Schwerpunkte in das Konzept für Sandberg/Bischofsheim mit<br />
einzubeziehen, um auf diese Weise die gesamte Region in die Aufarbeitung des<br />
vielgestaltigen Themas zu integrieren.<br />
12
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Rahmenbedingungen 2:<br />
Gemeinde Sandberg<br />
Die Gemeinde Sandberg liegt mit ihren fünf <strong>Ort</strong>steilen inmitten der Hohen Rhön am<br />
südlichen Hang des Kreuzberges im Landkreis Rhön-Grabfeld auf Höhen zwischen<br />
372 m (Schmalwasser) und 562 m über NN (Kilianshof). Insgesamt leben auf einer<br />
Gemeindefläche von rund 28 qkm 2.752 Einwohner (<strong>Stand</strong> 2008), davon mit 943<br />
Einwohnern die meisten am Verwaltungssitz in Sandberg. Es folgen nach der Ein-<br />
wohnerzahl Langenleiten, Waldberg, Schmalwasser und Kilianshof. Insgesamt ist in<br />
den vergangenen Jahren ein Bevölkerungsrückgang durch Abwanderung aus den<br />
Walddörfern zu verzeichnen.<br />
Die <strong>Ort</strong>steile Sandbergs sind historisch junge Gründungen. Schmalwasser - der am<br />
niedrigsten gelegene <strong>Ort</strong> - ging 1506 aus einer illegalen Rodung zur Ansiedlung von<br />
Köhlern inmitten des gewaltigen fürstbischöflichen Forstgebietes im Amt Aschach<br />
hervor. Erst knapp 200 Jahre später kam es dann mit Erlaubnis des Landesherrn zur<br />
Rodung der vier höhergelegenen sog. „Walddörfer“ Waldberg (1683), Langenleiten<br />
(1689), Sandberg (1691) und Kilianshof (1690/95). Die Dörfer wurden als regelmäßi-<br />
ge Straßenangerdörfer auf Ausläufern des Kreuzbergs angelegt: Entlang der zu<br />
einem langgestreckten Anger verbreiterten Dorfstraße reihten sich gleichmäßig die<br />
Gehöfte. Diese Struktur prägt die <strong>Ort</strong>sbilder – mit Ausnahme von Schmalwasser - bis<br />
heute.<br />
13
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Das Leben in den Walddörfern war hart, der Boden stei-<br />
nig, das Klima rau – Bedingungen, die die Landwirt-<br />
schaft enorm erschwerten. Im 19. Jahrhundert fanden<br />
sich in den Walddörfern nicht zuletzt aufgrund der Real-<br />
erbteilung fast ausschließlich kleine und mittlere landwirt-<br />
schaftliche Betriebe sowie ein stattliche Zahl (nahezu)<br />
besitzloser Tagelöhner. Die Einwohner waren auf Ein-<br />
kommensquellen außerhalb der Landwirtschaft – etwa im<br />
Kleinhandwerk, in der Waldarbeit (z.B. Köhlerei) oder im<br />
Müllerhandwerk – dringend angewiesen. Verschiedenste<br />
Versuche zur gezielten Gewerbe- und Hausindustrieförderung vom 18. Jahrhundert<br />
bis in die Zeit des Nationalsozialismus blieben weitgehend erfolglos. Lediglich die<br />
Leinenproduktion gegen Ende des 18. Jahrhunderts und die Holzschnitzerei 100<br />
Jahre später konnten zeitweise als Erfolg verbucht werden. Seit den 1970er Jahren<br />
schließlich nahm die Ackernutzung im Bereich der Walddörfer rapide ab, die Land-<br />
wirtschaft verlor ihre Bedeutung als Erwerbszweig und der Wald eroberte viele<br />
Flächen zurück. Die Einwohner verdienen ihr Einkommen heute zumeist außerhalb<br />
und pendeln in die erreichbaren Städte Bad Neustadt, Bad Kissingen oder Schwein-<br />
furt. In der Gemeinde Sandberg selbst bestehen einige kleinere Unternehmen –<br />
darunter auch Holzschnitzbetriebe und Künstlerateliers – sowie einige Einzelhändler<br />
und wenige gastronomische und touristische Betriebe, vor allem Pensionen und<br />
Anbieter von Privatunterkünften.<br />
Die Stärkung des Tourismus in den Walddörfern – die sich<br />
selbst auf der „Sonnenseite des Kreuzbergs“ (BM Beinhauer)<br />
sehen – ist ein erklärtes Ziel der künftigen <strong>Ort</strong>sentwicklung.<br />
Dabei helfen die durch Maßnahmen der Regionalentwicklung<br />
deutlich verbesserten Rahmenbedingungen. So passieren<br />
heute „Jakobsweg“ und „Hochrhöner“ Langenleiten, bevor sie<br />
den Kreuzberg erreichen, und seit 2008 durchquert auch der<br />
beliebte „K-Weg“ (Kreuzbergtour) das Gemeindegebiet in<br />
Kilianshof und nördlich von Sandberg.<br />
14
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Auch die projektierte Mundart-Scheune in Waldberg (Kooperationsprojekt der Mund-<br />
artakteure der Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld, und der Gemeinde<br />
Sandberg) und der Ausbau des Waldberger Pfarrgemeindehauses als Pilgerstelle<br />
(Projekt der Kirche) weisen in Richtung neuer touristischer Konzepte. Es gilt, die Auf-<br />
enthaltsqualität in den Walddörfern zu steigern, um zu verhindern, dass sie weiterhin<br />
nur als Durchgangsstation oder Parkplatz auf dem Weg zum Kreuzberg dienen.<br />
Geschichte und Gegenwart der Holzschnitzerei<br />
Die gewerbliche <strong>Schnitz</strong>erei in den Walddörfern geht auf die 1862 von Poppenhau-<br />
sen nach Bischofsheim a. d. Rhön verlegte Holzschnitzschule des „Polytechnischen<br />
Zentralvereins für Unterfranken und Aschaffenburg“ zurück, die auch von Schülern<br />
aus Sandberg besucht wurde. Als 1877 der Spielwarenfabrikant Friedrich Meinel in<br />
Pferde aus Zitterpappelholz – schnitzen. Offenbar instal-<br />
lierte er auf diese Weise ein Zwischenmeistersystem: Ein<br />
Meister leitet ungelernte Arbeiterinnen und Arbeiter an,<br />
versorgt sie mit den notwendigen Rohstoffen und lässt<br />
dann in der eigenen Werkstatt und/oder in Heimarbeit die<br />
bei ihm bestellten Waren fabrizieren. Ende des 19. Jahr-<br />
hunderts schnitzten 30 Arbeiter Reiseandenken und<br />
Spielwaren für den Verkauf in Bad Kissingen. Meinels<br />
Bad Kissingen eine Filiale eröffnete,<br />
suchte und fand er geeignete Produzenten<br />
seiner Ware in Sandberg. Er richtete im<br />
<strong>Ort</strong> gleich neben der Kirche eine „<strong>Schnitz</strong>-<br />
schule“ ein, machte mit Hilarius<br />
Katzenberger einen Bischofsheimer<br />
Absolventen zum Lehrer und ließ dort<br />
Spielwaren – insbesondere die weißen<br />
Tod 1911 und der Rückgang im Badebetrieb aufgrund der politischen Lage vor dem<br />
Ersten Weltkrieg ließ das Sandberger <strong>Schnitz</strong>gewerbe kurzfristig einbrechen.<br />
15
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Mit Galanteriewaren im Stil der <strong>Schnitz</strong>waren<br />
aus Empfertshausen wurden neue Märkte er-<br />
schlossen. Es etablierte sich in der Zwischen-<br />
kriegszeit vor allem in Sandberg und Waldberg<br />
ein ausgeprägter Hausierhandel, der die Holz-<br />
und <strong>Schnitz</strong>waren – aber auch Stoffe – in weitem Umkreis vertrieb. Zeitzeugenbefra-<br />
gungen durch den Arbeitskreis Kunst und Kultur ergaben, dass zur Mitte des 20.<br />
Jahrhunderts über die Hälfte der Sandberger Haushaltungen zumindest im winterli-<br />
chen Nebenerwerb mit der <strong>Schnitz</strong>erei beschäf-<br />
tigt waren – sei es als gelernte <strong>Schnitz</strong>er, als<br />
Hilfsarbeiter oder Hausierhändler. Insbesondere<br />
mit den US-amerikanischen Besatzungstruppen<br />
gewannen die Sandberger <strong>Schnitz</strong>er und Händ-<br />
ler einen neuen Kundenstamm, der schlichte<br />
Dekorationswaren (z.B. Schornsteinfeger) und einfachsten Wandschmuck in großen<br />
Mengen abnahm und in die Vereinigten Staaten schickte. Ein massiver Einbruch er-<br />
folgte in den 1970er Jahren. Er konnte zum Teil durch die Ferti-<br />
gung von Wurzelmännchen aufgefangen werden, die bis heute in<br />
Kilianshof von Werner Holzheimer angefertigt und in die süddeut-<br />
schen Mittelgebirge (Schwarzwald, Bayerischer Wald) geliefert<br />
werden. Insgesamt jedoch wandelte sich der Konsumentenge-<br />
schmack. Die Zahl der Holzschnitzer und <strong>Schnitz</strong>warenhändler<br />
ging in Sandberg drastisch zurück – heute existiert im <strong>Ort</strong> selbst<br />
keine <strong>Schnitz</strong>werkstatt mehr. In enger Abhängigkeit von Sand-<br />
berg entwickelte sich auch die <strong>Schnitz</strong>erei in Schmalwasser.<br />
Allein der Betrieb Theo Holzheimers, der am letzten Boom der<br />
Rhöner <strong>Schnitz</strong>waren in den 1960er und 1970er Jahren Anteil<br />
hatte, wird heute noch von dessen Sohn Günther fortgeführt.<br />
Robert Holzheimer – ein Lehrling Theo Holzheimers – gab<br />
hingegen seine Werkstatt vor einigen Jahren altersbedingt auf.<br />
Insgesamt hatte sich die wirtschaftliche Situation der Holzschnitzer in den Walddör-<br />
fern während der letzten dreißig Jahre deutlich verschlechtert.<br />
16
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Eine in Teilen andere Entwicklung nahm die Bildschnitzerei in Langenleiten insbe-<br />
sondere durch die Aktivitäten des Gemeindepfarrers Johann Kippes, der 1913 die<br />
Pfarrei übernahm. Aus der Zeit vor dessen Amtsantritt<br />
sind weniger <strong>Schnitz</strong>arbeiten, als vielmehr die sog. „Rhön-<br />
tische“ überliefert; Tische mit verschiebbarer Platte und<br />
Einlegearbeiten, die Ende des 19. Jahrhunderts in fast<br />
jedem Langenleitener Haushalt standen. Als Hersteller<br />
bekannt ist der „Zoudlschreiner“ Phillip Kessler. Pfarrer<br />
Kippes, der sich mit zahlreichen Maßnahmen der Armutsbekämpfung in Langenleiten<br />
widmete, veranstaltete schließlich 1916 einen<br />
ersten Kurs zur Herstellung von Holzschuhen<br />
und kümmerte sich um den Vertrieb der von 47<br />
oft kriegsinvaliden Männern hergestellten<br />
Schuhe. Aus diesen und anderen Anläufen zur<br />
Gewerbeförderung ging 1924/25 letztlich die<br />
„Rhönindustrie Langenleiten“ hervor, ein statt-<br />
liches mit Maschinen zur Holzverarbeitung ausgestattetes Fabrikgebäude, in dem vor<br />
allem Kleinmöbel für Kindergärten produziert wurden. Es bestand allerdings auch<br />
eine kunstgewerbliche Abteilung, in der Holzschnitzereien – unter anderem für die<br />
Sandberger Händler – angefertigt wurden. Der Betrieb florierte nur wenige Jahre, war<br />
bald überschuldet und wurde nach dem Tod von Pfarrer<br />
Kippes 1939 von verschiedenen Personen weitergeführt, bis<br />
ein Brand die Fabrik 1945 zerstörte. Nach dem Wieder-<br />
aufbau der Rhönindustrie wurde die Möbelproduktion zur<br />
einzigen Betriebssparte. Neben der Förderung der gewerb-<br />
lichen Holzverarbeitung und <strong>Schnitz</strong>erei förderte Pfarrer<br />
Kippes auch selbstständige, künstlerisch tätige <strong>Schnitz</strong>er,<br />
insbesondere den Autodidakten Friedrich Arnold, der vor<br />
allem Verzierungen an Möbeln, Spazierstöcken etc. schnitz-<br />
te und mehr noch dessen Sohn Emil Arnold, der seine hoch-<br />
wertigen Arbeiten (vor allem Kruzifixe, Madonnen und Krip-<br />
penfiguren) in der „Rhönindustrie“ anfertigte und sie unter<br />
17
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Vermittlung von Kippes in weitem Umkreis verkaufen konnte. Es ist insbesondere<br />
diese künstlerisch anspruchsvolle Holzschnitzerei, die sich in Langenleiten bis heute<br />
zu einer Tradition verfestigte, die über Günther Metz zu dessen Sohn Klaus und<br />
seiner Ehefrau Heike führt und natürlich in Herbert Holzheimer einen weiteren<br />
wichtigen Vertreter findet.<br />
Protagonisten und Akteure in der Gemeinde Sandberg<br />
Die Gemeinde Sandberg ist nomineller Auftraggeber des vorliegenden Konzeptes.<br />
Hinter diesem Engagement steht zum einen die Gemeinde selbst mit dem Gemein-<br />
derat und ihrem Bürgermeister Detlef Beinhauer, zum anderen aber auch ein bereits<br />
existierender Arbeitskreis Kunst und Kultur, der sich im Zusammenhang mit der Ein-<br />
leitung von Dorferneuerungsmaßnahmen im Gemeindegebiet zusammengefunden<br />
hat. Zentrale Personen des Arbeitskreises sind die Journalistin Barbara Hippeli aus<br />
Schmalwasser, das Bildhauerehepaar Klaus und Heike Metz aus Langenleiten, der<br />
Holzbildhauer Herbert Holzheimer ebenfalls aus Langenleiten und der Sandberger<br />
Bürgermeister Detlef Beinhauer. Außerdem gehören dem Arbeitskreis an: Ludmilla<br />
Barwitzki (Schmalwasser), Manfred Bühner (Sandberg), Alfons und Werner Holzhei-<br />
mer (Kilianshof), Günther Metz (Langenleiten), Michael Popp (Schmalwasser), Sieg-<br />
fried Söder (Waldberg) und Rosa Strauß-Carl (Langenleiten). Insgesamt scheinen im<br />
Arbeitskreise die maßgeblichen Akteure aus dem Bereich der (Holzschnitz-)Kunst<br />
Sandbergs zusammengefasst. Zahlreiche Arbeitskreismitglieder nahmen zudem aktiv<br />
an den vorbereitenden Sitzungen für die Erstellung des vorliegenden Konzepts teil<br />
und unterstützten die Konzeptionsarbeiten bereitwillig und mit großem Engagement.<br />
18
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Den bisherigen Aktivitäten nach zu schließen möchte der Arbeitskreis die künftige<br />
Entwicklung der Gemeinde Sandberg aktiv in allen <strong>Ort</strong>steilen mitgestalten. Die Be-<br />
gleitung und Steuerung möglicher Maßnahmen der Dorferneuerung im Hinblick auf<br />
deren kulturelle Wirkung und Bedeutung soll dazu ebenso beitragen, wie die Initiie-<br />
rung eigener künstlerischer, kultureller oder lokalhistorischer Projekte. So sollen zum<br />
Beispiel die Möglichkeiten für kulturelle Aktivitäten in den Gemeindeteilen, etwa<br />
durch einen Ausstellungsraum, gestärkt und die ästhetisch ansprechende Gestaltung<br />
der <strong>Ort</strong>sbilder befördert werden. Mit einer Zeitzeugenbefragung zur Geschichte der<br />
Holzschnitzerei im <strong>Ort</strong>steil Sandberg wurden zudem bereits Schritte hinsichtlich der<br />
Aufarbeitung der lokalen Vergangenheit unternommen.<br />
2009 griff der Arbeitskreis Kunst und Kultur kurzentschlossen die Idee einer Vernet-<br />
zung mit der neuen Spielzeugausstellung im Museum Obere Saline Bad Kissingen<br />
auf und traf sich mehrfach mit den dortigen Projektverantwortlichen Herrn Weidisch<br />
und Frau Schmalz. Eigene Überlegungen hinsichtlich eines Ausstellungsraumes<br />
wurden mit der Idee „dezentraler Zusatzausstellungen“ kombiniert und so zur Grund-<br />
lage des nunmehr vorkonzipierten <strong>Schnitz</strong>projekts in den Walddörfern. Grundsätzlich<br />
stand von Beginn an die Idee einer historischen Dauerausstellung und eines lebendi-<br />
gen Wechselausstellungsbereichs im Raum. Die Arbeitskreismitglieder sicherten da-<br />
rüber hinaus zu, das (Ausstellungs-)Projekt auch nach dessen Fertigstellung zu be-<br />
treuen und zu begleiten, mithin also dessen nachhaltige Lebensfähigkeit zu gewähr-<br />
leisten. Es wurde die Bereitschaft signalisiert, beispielsweise Wechselausstellungen<br />
zu organisieren, eine Sammlung aufzubauen oder geschichtliche Forschung zu be-<br />
treiben. Im Hinblick auf derartige Zukunftsaufgaben wird die Gründung eines Förder-<br />
und Betreibervereins unerlässlich sein. Erfahrungsgemäß ist allerdings die Bereit-<br />
schaft zur Mitarbeit in einem solchen Verein größer, wenn bereits erste Realisie-<br />
rungsschritte im Projektverlauf zu verzeichnen sind und die künftige Aufgabenvielfalt<br />
für einen Betreiberverein klarer überschaubar ist. Insgesamt muss das vorhandene<br />
bürgerschaftliche Engagement in Sandberg als außerordentlich günstig für die Reali-<br />
sierung eines <strong>Schnitz</strong>ereiprojektes in der Gemeinde angesehen werden.<br />
19
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Historische Objekte und Sammlungsbestände<br />
Grundlage für die Einrichtung einer Dauer- und die Veranstaltung von Wechselaus-<br />
stellungen ist die Verfügbarkeit von Ausstellungsstücken. Geeignete kommunale<br />
Sammlungsbestände sind in Sandberg nicht vorhanden, doch befinden sich zahl-<br />
reiche historisch aufschlussreiche und bedeutsame Einzelstücke in Privatbesitz, nicht<br />
zuletzt bei den Mitgliedern des Arbeitskreises Kunst und Kultur. Bei Manfred Bühner<br />
tion seines Vaters (z.B. Schornsteinfeger) auch einen<br />
Schuhkarton mit dessen handgezeichneten Schablo-<br />
nen auf, nach denen Gesellen die Entwürfe in Serie<br />
schnitzen konnten. Hochwertige künstlerische Arbei-<br />
ten hat Herbert Holzheimer in Langenleiten gesam-<br />
melt. Er besitzt zwei „Rhöntische“ mit Einlegearbeiten<br />
befindet sich in der Scheune in Sandberg ein Lei-<br />
terwagen, wie er bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts<br />
für Verkaufsfahrten bis ins Ochsenfurter Gäu Ver-<br />
wendung fand, wobei darauf sowohl Stoffe als auch<br />
<strong>Schnitz</strong>waren angeboten wurden. Entsprechende<br />
einfache Galanterieware besitzen sowohl Manfred<br />
Bühner als auch Herbert Holzheimer in Langenleiten.<br />
Günther Holzheimer in Schmalwasser bewahrt ne-<br />
ben nicht verkauften Einzelstücken aus der Produk-<br />
des „Zoudlschreiners“ und kennt die Besitzer wie-terer solcher Tische. Er weiß auch,<br />
wo sich einige der verzierten Spazierstöcke von Friedrich Arnold befinden. Krippen-<br />
figuren und eine Kreuzigungsgruppe von dessen Sohn Emil Arnold besitzt Herbert<br />
Holzheimer hingegen selbst. Nach vielfachen Berichten befindet sich in der ehema-<br />
ligen Sandberger <strong>Schnitz</strong>schule noch die vollständig erhaltene Werkstatteinrichtung<br />
der Holzschnitzfamilie Katzenberger, die allerdings bislang aufgrund der familiären<br />
Verhältnisse keinem der Arbeitskreismitglieder zugänglich war.<br />
20
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Insgesamt sind in der Gemeinde Sandberg zahlreiche historische Objekte aus dem<br />
Themenfeld der Holzschnitzerei in Privatbesitz erhalten geblieben und es ist mit Si-<br />
cherheit davon auszugehen, dass genauere Nachforschungen weitere interessante<br />
Objekte zum Vorschein bringen würden (dasselbe gilt im Übrigen auch für historische<br />
Fotografien zum Thema). Dennoch sind gerade diese Besitzverhältnisse für die Ein-<br />
richtung einer öffentlich geförderten Dauerausstellung nicht unproblematisch. Nach-<br />
haltigkeitsanforderungen und Zweckbindungsfristen verlangen eine gesicherte Über-<br />
lassung von Exponaten für einen Zeitraum von rund 15 Jahren. Im Gegenzug muss<br />
ein möglicher Leihnehmer den Besitzern der Objekte eine konservatorisch einwand-<br />
freie und sichere Unterbringung langfristig garantieren. In der Regel lassen sich dies-<br />
bezüglich in Einzelfällen befriedigende Lösungen finden, doch ist es schwierig und<br />
riskant, eine komplette historische Dauerausstellung allein auf der Grundlage privater<br />
Leihgaben einzurichten. Unproblematisch ist hingegen die Bestückung wechselnder<br />
Ausstellungen mit Exponaten aus Privatbesitz. Nicht zuletzt die eigenen Werke der<br />
im Arbeitskreis Kunst und Kultur engagierten Künstler könnten dafür herangezogen<br />
werden.<br />
Mögliche Projektstandorte<br />
Gemäß der Vorüberlegungen, die diesem Konzept zugrunde liegen, wird die Einrich-<br />
tung einer lokalen Ausstellung angestrebt, die historische Entwicklungslinien des<br />
<strong>Schnitz</strong>gewerbes in Sandberg ebenso aufzeigt, wie sie auf das aktuelle Kunstschaf-<br />
fen in der Gemeinde hinweist. Verschiedene <strong>Stand</strong>ortvarianten für ein solches Vor-<br />
haben wurden geprüft. Die folgenden Ausführungen betreffen insbesondere die<br />
Tauglichkeit der entsprechenden Lokalitäten für die Nutzung als Ausstellungsraum,<br />
wie sie von Ausstellungsmachern unter gestalterischen und didaktischen Gesichts-<br />
punkten beurteilt werden kann. Aussagen zum baulichen Zustand, wie sie zum Auf-<br />
gabengebiet von Architekten und Statikern gehören, werden nicht gemacht.<br />
21
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Rathaus Sandberg<br />
Präferiert wurden zu Beginn der Konzeptionsarbeiten Räumlichkeiten im Unterge-<br />
schoss des 1989 fertiggestellten Rathauses der Gemeinde Sandberg in der Schul-<br />
straße 6. Das Verwaltungsgebäude liegt<br />
abseits der breiten Hauptstraße (Kreuzberg-<br />
straße) von Sandberg am Rand des Dorfes.<br />
Der Haupteingang im Erdgeschoss führt den<br />
Besucher zum großen Ratssaal und über<br />
einen Flur zum Verwaltungstrakt. Hier befindet<br />
sich ein Treppenhaus, das einerseits die Bü-<br />
ros im Obergeschoss erschließt und andererseits die Kellerräume. Für Ausstellungs-<br />
zwecke sind prinzipiell zwei Kellerräume denkbar: Zum einen ein etwa 76 qm großer<br />
Mehrzweckraum, der sich mit einer Glasfront<br />
ebenerdig ins Freie öffnet und als direkter Zu-<br />
gang zur Ausstellung genutzt werden könnte,<br />
und zum anderen ein über einen weiteren kur-<br />
zen Flurabschnitt zu erreichender fensterloser,<br />
von Betonpfeilern gegliederter Lagerraum von<br />
rund 163 qm Fläche direkt unterhalb des Rats-<br />
saales. Eine ganze Reihe von Gründen sprechen gegen eine Nutzung der Räum-<br />
lichkeiten für die Einrichtung von Dauer- und Wechselausstellungsräumen. Generell<br />
problematisch ist bereits die Lage des Rat-<br />
hauses abseits der Kreuzbergstraße. Es wird<br />
kaum gelingen, durchfahrende Kreuzbergbe-<br />
sucher aufzuhalten und in eine schmale Sei-<br />
tenstraße umzulenken. Diese Situation wird<br />
zudem verschärft durch die Lokalisierung der<br />
Ausstellungsräume im Keller des Rathauses.<br />
Der Zugang über eine Terrasse an der straßenabgewandten Gebäudeseite ist für<br />
<strong>Ort</strong>sfremde nur schwer zu finden und zudem gänzlich unattraktiv.<br />
22
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Auch die Räume selbst sind für Ausstellungszwecke problematisch. Zwar ließe sich<br />
die noch bestehende Zweckbindung für den Mehrzweckraum bei Bedarf wohl ab-<br />
lösen und es könnte mit dem derzeit darin beheimateten Rhönclub sicherlich ein<br />
23<br />
Arrangement gefunden werden, doch<br />
wäre der Raum dann noch immer ein<br />
unattraktiver Mehrzweckraum. Eine<br />
Umgestaltung des Raumes selbst wäre<br />
für die Einrichtung einer Ausstellung un-<br />
umgänglich. Dies gälte umso mehr für<br />
den weit größeren Lagerraum, der mo-<br />
mentan über keinen ausstellungstaug-<br />
lichen Fußboden, keine adäquate Wand-<br />
oder Deckenbehandlung und über keine ausstellungstaugliche Beleuchtung verfügt.<br />
Angesichts der beträchtlichen Raumgröße – als Ausstellungsfläche für Sandberg<br />
ohnehin überdimensioniert – wür-<br />
de allein die Instandsetzung des<br />
Raumes einen hohen fünf- bis<br />
sechsstelligen Betrag kosten, so<br />
dass das immer wieder für die<br />
Kellerlösung ins Feld geführte<br />
Argument der Kostenersparnis<br />
nicht mehr zuträfe. Zusammen-<br />
fassend lässt sich festhalten, dass<br />
die ungünstige Lage abseits der<br />
touristischen Wege, die unattrak-<br />
tive Unterbringung im Kellerge-<br />
schoss und die überdimensio-<br />
nierten Raumgrößen (verbunden<br />
mit hohen Instandsetzungskosten)<br />
gegen die Einrichtung einer Ausstellung im Rathauskeller sprechen. Ein mangelnder<br />
Besucherzuspruch wäre abzusehen.
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Alte Schule Sandberg<br />
Die Alte Schule von Sandberg steht giebelseitig zur Kreuzbergstraße, in die sie ein<br />
Stück weit über die sonstige Häuserflucht hineinragt, und markiert dabei zugleich die<br />
Abzweigung der Schulstraße zum Rathaus<br />
der Gemeinde. Mit Ausnahme der Kirche ist<br />
die Alte Schule das städtebaulich derzeit<br />
prägnanteste Gebäude des <strong>Ort</strong>es, nicht we-<br />
gen seiner architektonischen Gestaltung, son-<br />
dern allein aufgrund der exponierten Lage am<br />
Dorfanger. Die Alte Schule umgeben in den<br />
Nachbarhäusern ein Bäcker, ein Metzger, ein Einzelhandelsgeschäft und eine Bank-<br />
filiale, so dass im Umkreis der Alten Schule von einem <strong>Ort</strong>skern gesprochen werden<br />
kann. Architektonisch handelt es sich bei der<br />
Alten Schule um einen teilunterkellerten,<br />
zweigeschossigen Fachwerkbau auf einem<br />
Steinsockel, der von der Schulstraße her<br />
traufseitig mittig erschlossen wird und derzeit<br />
im oberen Abschnitt Schindelverkleidung auf-<br />
weist. Die letzte Nutzung als Wohnhaus spie-<br />
gelt sich in einer sehr kleinräumigen Zimmerstruktur. Sowohl im Erdgeschoss als<br />
auch im Ober- und Dachgeschoss sind jeweils mehrere kleine Zimmer abgetrennt.<br />
Die über den zentralen Flur erreichbare Trep-<br />
pe ist eng und gewunden. Derzeit steht das<br />
Gebäude zum Teil leer, das Obergeschoss<br />
wird jedoch bewohnt und der kommunale<br />
Bauhof nutzt im Erdgeschoss einen Aufent-<br />
haltsraum, da er derzeit die zum Haus ge-<br />
hörigen Freiflächen nutzt. Der Zustand des<br />
Gebäudes scheint dem Alter und der Nutzung entsprechend zu sein. Es ist die Lage<br />
des Gebäudes in der <strong>Ort</strong>smitte an der Kreuzbergstraße in direkter Blickachse zum<br />
zweiten örtlichen Zentrum – der Kirche –, die die Alte Schule zu einem geeigneten<br />
24
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
<strong>Stand</strong>ort für das <strong>Schnitz</strong>projekt in Sandberg macht. An dieser Stelle ließe sich die<br />
Aufmerksamkeit von Gästen und Touristen so weit erregen, dass sie bereit sind, für<br />
einen offensichtlich interessanten, kurzen Aufenthalt die Fahrt zum Kreuzberg zu<br />
25<br />
unterbrechen. Anderer-<br />
seits brächte ein ästhe-<br />
tisch modernes Gebäude<br />
(saniert oder neu) an die-<br />
ser Stelle des Dorfes<br />
eine wichtige städtebau-<br />
liche Aufwertung. Leider<br />
ist das Gebäude selbst<br />
für eine museale Nutzung nur wenig geeignet. Die mit insgesamt 150 qm durchaus<br />
großflächigen Stockwerke sind in viele enge Einzelzimmer unterteilt, die Raumhöhe<br />
ist durchgängig niedrig und die Zugänglichkeit durch die schmale gewundene Treppe<br />
eingeschränkt. Die für eine Ausstellungsnutzung not-<br />
wendige Gebäudesanierung könnte allerdings die<br />
Kleinteiligkeit auflösen und die Zugänglichkeit verbes-<br />
sern, so dass es im Hinblick auf die Möglichkeiten zur<br />
Einrichtung von Ausstellungsflächen durchaus mög-<br />
lich wäre, das Gebäude zu nutzen. Die Kosten für<br />
Erhalt und Sanierung der Alten Schule wären aller-<br />
dings beträchtlich. Eine Alternative könnte im Abriss<br />
der alten Schule und in der Aufrichtung eines Neu-<br />
baus bestehen. So würde der zentrale, überaus ge-<br />
eignete <strong>Stand</strong>ort weiterhin genutzt werden und es<br />
böten sich zudem größere Spielräume bei der Gestal-<br />
tung des städtebaulich wichtigen Gebäudeumfeldes in diesem Bereich der Kreuz-<br />
bergstraße. Ein älterer Beschluss des Gemeinderates zum Abriss der Alten Schule<br />
liegt bereits vor. Denkmalschutz besteht für das Gebäude nicht, so dass Abriss und<br />
bedarfsgerechter Neubau letztlich durchaus als Optionen erscheinen, die allen An-<br />
forderungen an Besucherfreundlichkeit und Nachhaltigkeit gerecht werden könnten.
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Alternativstandorte Langenleiten<br />
Das derzeitige Zentrum der Bildschnitzkunst in der Gemeinde Sandberg ist der <strong>Ort</strong>s-<br />
teil Langenleiten. Dort arbeiten gleich mehrere Bildhauer und –schnitzer sowie Grafi-<br />
ker; darüber hinaus ist dort einer der wenigen deutschen Betriebe zur Herstellung<br />
von Holzfräslingen beheimatet. Mehrere <strong>Stand</strong>orte für ein Projektmodul wurden hier<br />
diskutiert:<br />
- Das griechische Restaurant Akropolis, das zum Verkauf<br />
steht. Der große Gebäudekomplex aus den 1970er Jah-<br />
ren steht am Dorfrand (Ende der Rhönstraße) direkt an<br />
der Umgehungsstraße St 2267 und verfügt über große<br />
Parkflächen. Für ein Projektmodul erscheint das Gebäude allerdings über-<br />
dimensioniert, das Ambiente ist wenig einladend und letztlich befindet sich die<br />
Gastwirtschaft noch in Privatbesitz und müsste von der Gemeinde eigens<br />
angekauft werden.<br />
- Die Alte Schule von Langenleiten, ein ruinöser Zweck-<br />
bau der 1960er Jahre am <strong>Ort</strong>srand (Abzweigung vom<br />
Kippesweg), der derzeit als Jugendtreff und Atelier einer<br />
Künstlerin genutzt wird. Nur im Rahmen eines größeren<br />
Nutzungskonzeptes (etwa als multifunktionales Gemeindehaus) könnte das<br />
Gebäude saniert werden; für ein Projektmodul zur Holzschnitzerei ist es viel<br />
zu groß.<br />
- Die Posthalle in Langenleiten steht am Kippesweg in<br />
unmittelbarer Nähe der alten Schule jedoch deutlich<br />
näher an der Lindenstraße. Es handelt sich um eine<br />
ehemalige Wagenhalle zur Unterbringung des Postbus-<br />
ses und einem kleineren heute als Garage eingerichteten Anbau. Die Gesamt-<br />
anlage ist in schlechtem Zustand. Eine sinnvolle Sanierung erscheint proble-<br />
matisch, wenngleich Größe und Lage des Gebäudes für ein kleineres Projekt-<br />
modul durchaus denkbar wären.<br />
26
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
-<br />
- Der Dorfanger von Langenleiten zieht sich als breiter,<br />
beidseitig von Straßen (Lindenstraße) begrenzter<br />
Grünstreifen mitten durch den <strong>Ort</strong>, allein unterbro-<br />
chen durch die <strong>Ort</strong>skirche. Derzeit befinden sich auf<br />
dem Dorfanger neben Parkplätzen im Kirchenumfeld und Verkehrsschildern<br />
auch einige Denkmäler, etwa Bildstöcke, Hochkreuze und eine Madonnen-<br />
figur, sowie einige Informationstafeln für Wanderer und Touristen. Im Zuge der<br />
Dorferneuerung soll der Dorfanger neu gegliedert und gestaltet werden. Denk-<br />
bar und sinnvoll wäre dabei die Einbindung von Freiluftelementen aus dem<br />
<strong>Schnitz</strong>projekt, um auch in Langenleiten auf die Rhöner <strong>Schnitz</strong>tradition zu<br />
verweisen.<br />
Dorfgemeinschaftshaus Kilianshof (Schaufenster)<br />
An das frisch sanierte Dorfgemeinschaftshaus Kilianshof – gelegen an der zentralen<br />
Kreuzung des <strong>Ort</strong>es – wurde außen ein verglaster Erker mit rund 2 qm Grundfläche<br />
(ca. 2,5 m x 0,7 m) angefügt. Am Gemein-<br />
schaftshaus und mithin am Schaufenster führt<br />
der K-Weg vorbei, der nur in Kilianshof bebau-<br />
tes Gemeindegebiet durchschneidet. Für ein<br />
eigenständiges Projektmodul ist das Schaufens-<br />
ter aufgrund seiner Abmessungen sicherlich zu<br />
klein. Als Werbeplattform könnte es allerdings<br />
dazu dienen, Wanderer auf ein größeres Projektmodul in Sandberg, das der K-Weg<br />
am nördlichen <strong>Ort</strong>srand passiert, hinzuweisen.<br />
27
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Rahmenbedingungen 3:<br />
Stadt Bischofsheim a. d. Rhön<br />
Die Stadt Bischofsheim an der Rhön (448 m. ü. NN) am Fuße des Kreuzbergs liegt<br />
im Landkreis Rhön-Grabfeld. Geologisch zählt sie zur Hohen Rhön bzw. Hochrhön,<br />
die sich über Teile des Bundesländer Bayern, Hessen und Thüringen erstreckt, sowie<br />
zum „Naturpark Bayerische Rhön“ und zum „UNESCO Biosphärenreservat Rhön“.<br />
Zur Stadt Bischofsheim a. d. Rhön zählen die fünf<br />
Stadtteile Frankenheim mit der Ruine Osterburg,<br />
Haselbach mit dem Weiler Kreuzberg, Oberweißen-<br />
brunn, Unterweißenbrunn und Wegfurt. Auf einer<br />
Fläche von 67,72 qkm leben hier insgesamt 4887<br />
Einwohner (<strong>Stand</strong> 2008). Die Stadt als ehemaliger<br />
Verwaltungssitz des Bistums Würzburg (Erstnen-<br />
nung 1270) verfügt über einen historisch gewachse-<br />
nen <strong>Ort</strong>skern, der sich um den zentralen Marktplatz<br />
gruppiert und von einer gut erhaltenen Stadtmauer<br />
eingefasst wird. Nördlich des Marktplatzes mit ei-<br />
nem Brunnen von 1582/92 schließen sich die Stadt-<br />
pfarrkirche aus der Regierungszeit des Fürstbi-<br />
schofs Julius Echter von Mespelbrunn (Grundsteinlegung 1607), der Zentturm aus<br />
dem 13. Jahrhundert, das historische Rentamt und das Rathaus an. Bei drei großen<br />
Stadtbränden wurde die alte, aus Ackerbürger- und Handwerkerhäusern bestehende<br />
Bausubstanz empfindlich dezimiert. Im Westen der Stadt fließt die Brend, die von<br />
zahlreichen Mühlen genutzt wurde.<br />
Die traditionell von der Landwirtschaft lebenden Ackerbürger in Bischofsheim erleb-<br />
ten dank der bereits seit dem 16. Jahrhundert ansässigen Tuchmanufaktur im An-<br />
schluss an den Dreißigjährigen Krieg einen gewaltigen Aufschwung dieses Betriebs-<br />
zweiges und ihrer Stadt. Bis zu 100 Meister waren hier tätig, wobei die Tuchherstel-<br />
28
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
lung mit Schwankungen bis in das 19. Jahr-<br />
hundert hinein eine große Bedeutung für<br />
den <strong>Ort</strong> besaß. Südwestlich der Stadt er-<br />
hebt sich mit 928 m ü. NN das höchstgele-<br />
gene Wallfahrtsziel in der Diözese Würz-<br />
burg, das nach dem Bau des Klosters und<br />
der Wallfahrtskirche (1681) im 18. Jahrhun-<br />
dert eine Blüte erlebte, die wiederum auch auf Bischofsheim a. d. Rhön ausstrahlte.<br />
Berühmtheit erlangte die bis heute von den Franziskanern betriebene und bei<br />
Wallfahrern wie Besuchern gleichermaßen beliebte Klosterbrauerei.<br />
Ihre wirtschaftliche Kraft schöpft die Stadt heute aus den ansässigen Einzelhändlern,<br />
Dienstleistern, Gastronomen und Handwerksbetrieben. Die touristische Attraktivität<br />
Bischofsheims resultiert einerseits direkt aus der geografischen Zugehörigkeit zur<br />
Natur- und Kulturlandschaft Rhön, andererseits aber vor allem aus der unmittelbaren<br />
Nähe zum Franziskanerkloster und Wallfahrtsort Kreuzberg. Mit 18.210 Übernach-<br />
ungen pro 1.000 Einwohner ist die touristische Intensität in Bischofsheim a.d. Rhön<br />
vergleichsweise hoch. Die durchschnittlich kurze Aufenthaltsdauer von 2,8 Tagen<br />
liegt dabei im Trend. Seine Rolle als Unterzentrum innerhalb einer ländlich strukurier-<br />
en Region und in räumlicher Nähe zur prosperierenden Kreisstadt Bad Neustadt a.d.<br />
Saale versucht die Stadt Bischofsheim a. d. Rhön zu behaupten und mit einem breit<br />
angelegten städtebaulichen Entwicklungskonzept zu festigen (Integriertes städte-<br />
bauliches Entwicklungskonzept Bischofsheim a.d. Rhön, Oktober 2010). Hierzu ist<br />
ein tiefgreifender Transformationsprozess und Strukturwandel in den Bereichen<br />
Städtebau, Einzelhandel und Tourismus notwendig (Integriertes städtebauliches<br />
Entwicklungskonzept Bischofsheim a.d. Rhön<br />
– Maßnahmenkatalog, Oktober 2010). Das<br />
Kloster Kreuzberg mit dem 2008 eröffneten<br />
„Bruder Franz Haus“ wird in der touristischen<br />
Bedeutung für die Region weiterhin großen<br />
Stellenwert einnehmen. Es zählt schon heute<br />
zu den beliebtesten Ausflugszielen der<br />
bayerischen Rhön.<br />
29
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Geschichte und Gegenwart der Holzschnitzerei<br />
Die Herstellung von Holzwaren als winterlicher Nebenerwerb einer in kargen land-<br />
wirtschaftlichen Verhältnissen lebenden Bevölkerung stellt in der Rhön ein histori-<br />
sches Faktum dar, das sich erst im Laufe des 19. Jahrhunderts professionalisierte<br />
und – in Abhängigkeit von Konjunktur- und Modewellen – zu einem eigenen teils<br />
sogar hauptberuflichen Betriebszweig entwickelte. Einen besonderen Anteil an der<br />
Festigung des holzverarbeitenden Hausgewerbes<br />
und der –industrie hatte die ab 1862 in Bischofs-<br />
heim a. d. Rhön ansässige Holzschnitzschule. Sie<br />
bildete nicht nur in der Fertigung bestimmter Holz-<br />
waren aus, sondern produzierte und vermarktete<br />
auch in großem Stil zur Refinanzierung des Eigen-<br />
betriebs und wirkte durch ihre Vorbildfunktion stil-<br />
bildend. Die hier ausgebildeten Holzschnitzer lies-<br />
sen sich zum Teil in unmittelbarer Nähe mit einem<br />
eigenen Betrieb nieder. Parallel zur schulischen<br />
Ausbildung gab es aber auch weiterhin den un- oder angelernten Nebenerwerbs-<br />
schnitzer in der groben wie feineren Holzwarenproduktion, der seine Produkte in Ei-<br />
genregie direkt oder über Händler vermarktete.<br />
Insgesamt jedoch stellt den zentralen Ausgangspunkt für die Holzschnitzerei in Bi-<br />
schofsheim a. d. Rhön die im Jahr 1862 von Poppenhausen bei Weyhers hierher<br />
(Pfarrgasse 12) verlegte Holzschnitzschule dar, die 1852/53 vom „Polytechnischen<br />
Zentralverein für Unterfranken und Aschaf-<br />
fenburg“ gegründet worden war. Sie setzte<br />
die vorangegangen Anstrengungen des Ver-<br />
eins in Verbindung mit staatlichen Hilfsmaß-<br />
nahmen zur Förderung des Hausgewerbes<br />
in der Rhön fort. Die angefertigten Holz-<br />
schnitzereien wurden anfangs vom Verein und seinen sog. „Rhöndepots“, später<br />
teilweise über Kaufleute in den Handel gebracht. Vermutlich hatten strategische<br />
30
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Überlegungen der Vermarktung schließlich auch für die Verlegung der Schule in das<br />
besser an den Verkehr angeschlossene Bischofsheim a. d. Rhön verantwortlich ge-<br />
zeichnet. Kamen die Schüler in den Anfangsjahren noch aus der näheren Umgebung<br />
oder aus Bischofsheim a. d. Rhön selbst, so dehnte sich das Einzugsgebiet der<br />
Schule ab den 1870er Jahren aus. Es folgte 1876 der Umzug der Schule in den<br />
Pfarrgrund (heute Anwesen Michael Wagner), wo ihr ein Ausstellungsraum im<br />
Schweizerstil angegliedert wurde. Eine grundlegende Reform führte 1902 zur Um-<br />
wandlung der „<strong>Schnitz</strong>schule“ mit Massen-<br />
produktion in eine staatlich anerkannte<br />
Lehrwerkstätte, die 1913 einen Neubau an<br />
der Straße nach Unterweißenbrunn erhielt<br />
(heute Anwesen des Ateliers Warrings). Der<br />
Verkauf der in der Schule produzierten Holz-<br />
waren diente mithin zur Finanzierung der<br />
auch an der Unterstützung mittelloser Schü-<br />
ler interessierten Schule, führte jedoch nach jahrzehntelanger Ausbildung in den<br />
1920er Jahren schließlich zu einer ernsten Konkurrenzsituation mit den niedergelas-<br />
senen selbstständigen Holzschnitzern. 1939 übernahm der Bezirksverband Main-<br />
franken die Trägerschaft. Der Neubeginn in der Nachkriegszeit gestaltete sich<br />
schwierig: Er wurde von künstlerischen Auseinandersetzungen und schwindenden<br />
Schülerzahlen belastet und von der Streichung der Fördermittel bedroht. Auch mit<br />
dem Umzug der Schule in die ehemalige Villa des Fabrikanten Hoesch 1952 konnte<br />
ein weiterer Rückgang der Schülerzahlen nicht verhindert werden. Der damalige<br />
Landkreis Bad Neustadt a.d. Saale – heute Landkreis Rhön-Grabfeld – übernahm<br />
1972 schließlich die Schule vom Bezirk Unterfranken und garantierte so nach einer<br />
kurzen Schließzeit von 1971/72 bis 1973/74<br />
ihren Fortbestand in einem 1978 errichteten<br />
Neubau. Seit 1980/81 führt sie den Titel und<br />
Status einer „Staatlichen Berufsfachschule für<br />
Holzbildhauer“, seitdem teilen sich Freistaat<br />
und Landkreis die Aufgaben der Trägerschaft.<br />
Im Jahr 1996 übernahm der langjährige Leh-<br />
rer und Bildhauer Rudolf Schwarzer<br />
31
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
die Schulleitung. Die dreijährige Ausbildung zum Holzbildhauer zielt<br />
auf eine breite Vermittlung der Grundtechniken des Bildhauerhand-<br />
werks und die Förderung individueller künstlerischer Gestaltungsfä-<br />
higkeiten: „Ziel ist es, das plastische Gestalten als persönlichen Aus-<br />
druck zu entdecken und darin eine Könnerschaft zu entwickeln.“<br />
(http://www.holzschnitzschule.de/htm/berufsfachschule.htm#ziele-grundsaetze;<br />
Zugriff 11.1.2011). Der Abschluss befähigt zum eigenständigen Arbeiten<br />
und qualifiziert für ein weiterführendes Kunsthochschulstudium.<br />
Die Tradition der Holzschnitzerei wird auch heute noch in Bischofsheim a. d. Rhön<br />
sicht- und greifbar. So führt vom Marktplatz aus ein mit einem Altstadt-Rundgang<br />
kombinierter Holzskulpturen-Weg entlang von 19 Stationen durch Bischofsheim a. d.<br />
Rhön. Ein Flyer informiert über den Verlauf des Rundwegs und die dabei gestreiften<br />
Sehenswürdigkeiten. Sämtliche dabei präsen-<br />
tierten 19 Holzskulpturen wurden von Schülern<br />
der örtlichen Schule für Holzbildhauer geschaf-<br />
fen. Die Installationen setzen im Rundgang auf<br />
freie Assoziationen der Spaziergänger und<br />
verzichten weitestgehend auf erläuternde<br />
Beschilderungen.<br />
Initiiert vom Diözesanbüro Bad Neustadt entstanden im<br />
Jahr 2007 – wiederum unter Beteiligung von Arbeiten der<br />
SchülerInnen der Holzbildhauerschule Bischofsheim a. d.<br />
Rhön – zehn Kunststationen am Franziskusweg auf Höhe<br />
der Thüringer Hütte. Sie setzen die zehn Strophen des<br />
„Sonnengesangs“ künstlerisch um und bieten in Kombi-<br />
nation mit sieben Lesestationen Anreize zur Reflexion<br />
und Meditation. Ein Flyer informiert über die Wegefüh-<br />
rung, eine Ergänzung erfährt das Projekt durch die Pub-<br />
likation „Atem-Wege“ mit zahlreichen Abbildungen und<br />
inspirierenden Texten.<br />
32
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Letztlich weist auch das sanierte und 2008 eröffnete Bruder Franz<br />
Haus am Franziskanerkloster Kreuzberg Anknüpfungspunkte zur<br />
Holzschnitzerei auf. Es bietet neben der Dauerausstellung „Franz<br />
von Assisi und Gottes Schöpfung“ auch Räume der Stille und ein<br />
Informationszentrum mit touristischen Informationsbroschüren zur<br />
Stadt Bischofsheim a. d. Rhön, dem Kreuzberg und der Rhön. In<br />
den Veranstaltungsräumen des Mehrfunktionenhauses können<br />
auch Ausstellungen stattfinden, so etwa die Sonderausstellung<br />
„Rhöner Weihnachtskunst“ (28.11.2010 – 9.1.2011), zum Beispiel mit Arbeiten der<br />
Holzschnitzer- und Bildhauerfamilie Metz (Langenleiten), von Herbert Holzheimer<br />
(Langenleiten), Günther Holzheimer (Schmalwasser) und der Bischofsheimer Holz-<br />
schnitz-Meisterbetriebe Karin Barth, Uli Klemm und dem Künstlerehepaar Warrings.<br />
Neben den öffentlichen Einrichtungen sind es die noch immer vor<br />
<strong>Ort</strong> in Bischofsheim a. d. Rhön tätigen Holzschnitzbetriebe, die<br />
heute das Bild der Stadt als einem aktiven Zentrum der Rhöner<br />
Holzschnitzerei mitbestimmen. Dabei handelt es sich durchweg<br />
um Familienbetriebe, die ohne Angestellte ihren eigenen Lebens-<br />
unterhalt durch Herstellung und Vertrieb von gewerblichen<br />
<strong>Schnitz</strong>waren oder auch ambitionierter <strong>Schnitz</strong>kunst bestreiten.<br />
Protagonisten und Akteure in Bischofsheim a. d. Rhön<br />
Lokaler Hauptakteur ist die traditionsreiche, seit über 150 Jahren in Bischofsheim a.<br />
d. Rhön ansässige Staatliche Berufsfachschule für Holzbildhauer unter der Leitung<br />
von Rudolf Schwarzer. Aufgrund ihrer spezifischen individuellen Ausbildungssituation<br />
und der konsequent verfolgten künstlerischen Grundsätze genießt die Schule als<br />
Ausbildungszentrum großes Ansehen. Sie ist ein für Bischofsheim a. d. Rhön wert-<br />
volles Alleinstellungsmerkmal. Im Bewusstsein um ihre Tradition lenkt die Einrichtung<br />
die gestalterische Ausbildung ihrer Schülerinnen und Schüler in eine von zeitgenös-<br />
33
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
sischer Formensprache und künstlerischer Modernität inspirierte Zukunft.<br />
Interessante Bezüge zum aktuellen Kunstgeschehen ergeben sich auch durch das<br />
Lehrerkollegium der Schule, das – z.B. mit Herbert Holz-<br />
heimer (Langenleiten) – zum Teil freischaffend von künst-<br />
lerischer Arbeit lebt. Viele ehemalige Absolventen sind<br />
ebenfalls als herausragende Künstler in der Rhön ansäs-<br />
sig, z.B. Jan Polacek (Oberwaldbehrungen), Martin Bühner<br />
(Hohenroth), Lothar Bühner (Bad Neustadt) oder Günter<br />
Metz (Langenleiten).<br />
Mit verschiedenen Aktionen – wie etwa mit dem oben beschriebenen Bischofsheimer<br />
Holzskulpturenweg und dem Franziskusweg – rückt die Schule immer wieder ins<br />
Licht der Öffentlichkeit und wird als künstlerisch prägende Kraft in der Region wahr-<br />
nehmbar. Als Institution mit großem kreativen Potential und dichter Vernetzung in die<br />
Kunstszene zählt die Holzbildhauerschule zweifellos zu den wichtigsten Partnern für<br />
ein <strong>Schnitz</strong>projekt in der Rhön. Die ausdrückliche Dialog- und Kooperationsbereit-<br />
schaft der Schule wäre in eine Arbeitsgemeinschaft fruchtbar zu integrieren.<br />
In Bischofsheim a. d. Rhön ist eine Anzahl an handwerklich und künstlerisch arbei-<br />
tenden Holzschnitz-Meisterbetriebe tätig. Ihre Werkstätten und Ateliers sind mit gere-<br />
gelten Öffnungszeiten für Gäste, Besucher und interessierte Käufer geöffnet. Zu den<br />
Betrieben und Ateliers zählen:<br />
- Karin Barth (Bauersbergerstr. 39)<br />
- Uli Klemm (Ahornstr. 36)<br />
- Herbert Lucht (Gerberzwinger 35)<br />
- Martin Sitzmann (Floßgrabenweg 6)<br />
- Christel und Detlef Warrings (Neustädter Str. 12)<br />
34
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Darüber hinaus haben die beiden ehemaligen Schüler der Bischofs-<br />
heimer Holzbildhauerschule Claudia Fink – akademische Bildhaue-<br />
rin – und Roland Ehmig – Holzbildhauermeister – am Marktplatz 19<br />
ihre „Schauwerkstatt“ eingerichtet. Mit der öffentlich wirksamen Prä-<br />
senz ihrer Werkstatt möchten sie auch einen Beitrag zur Identitäts-<br />
stiftung der Stadt Bischofsheim a. d. Rhön mit dem Thema Holzbild-<br />
hauerei leisten und das Sujet gleichzeitig in der Öffentlichkeit stär-<br />
ker verankern. In der „Schauwerkstatt“ können Besucher kleinere<br />
Kunstwerke erwerben und einen Blick ins Atelier werfen. Neben<br />
ihren Auftragstätigkeiten bieten die beiden Künstler als zweites un-<br />
ternehmerisches <strong>Stand</strong>bein auch Mal- und <strong>Schnitz</strong>kurse an, die sie<br />
aufgrund der großen Nachfrage mit Teilnehmern aus dem gesam-<br />
ten Bundesgebiet in den Werkräumen der kommunalen Kreuzberg-<br />
schule durchführen, die ihnen während der Ferienzeiten zugänglich<br />
sind. Dadurch beschränken sich die Kursangebote auf die Ferienzeiten, während je-<br />
doch nach geäußerten persönlichen Erfahrungen das Potential für Kurse über den<br />
gesamten Jahresverlauf durchaus vorhanden wäre. Voraussetzung hierfür wäre ein<br />
dauerhaft nutzbarer Werkraum in entsprechender<br />
Größe und Ausstattung. Große Aufgeschlossenheit<br />
äußern Claudia Fink und Roland Ehmig an einer Be-<br />
teiligung an einer größeren gemeinsamen Koopera-<br />
tion zur Präsentation und Vermittlung des histori-<br />
schen Erbes der Holzschnitzerei wie auch an der<br />
Vermittlung der moderne Holzbildhauerei.<br />
Ebenfalls an einer Weiterentwicklung des Themas interessiert zeigt sich Matthias<br />
Wild als Inhaber und Betreiber des seit 2007 in Bischofsheim a. d. Rhön ansässigen<br />
„Hauses der kleinen Wunder“. Das „Haus“ versteht sich als Mitmachmuseum für die<br />
ganze Familie und verspricht spannende Sinneserlebnisse auf neuer Ebene. Durch<br />
seine verkehrsgünstige Lage an der Zufahrtstraße zum Kloster Kreuzberg (Rhön-<br />
straße 6) erfreut sich die Einrichtung einer großen Beliebtheit. Herr Wild signalisierte<br />
unter bestimmten Gesichtspunkten eine mögliche Beteiligung an einer Präsentation<br />
des Themas <strong>Schnitz</strong>ens in der nahe gelegenen Schneidmühle.<br />
35
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Ein betriebsübergreifendes, kommunikatives oder strategisches Netzwerk zur Popu-<br />
larisierung der historischen oder aktiven Holzschnitzerei und Holzbildhauerei in Bi-<br />
schofsheim a. d. Rhön existiert zur Zeit nicht. Vielmehr scheinen für den Außenste-<br />
henden die Partikularinteressen der einzelnen Akteure die öffentliche Wahrnehmung<br />
dieses Themas in der Stadt zu dominieren. So lässt es etwa die Einzel-Präsentation<br />
der Werkstätten auf einer städtischen Info-Tafel auf dem Marktplatz vermuten. Auch<br />
eine gemeinsam organisierte Anlaufstelle sucht der interessierte Gast vergeblich.<br />
Flyer zum Holzskulpturen-Weg und teils zu einzelnen Werkstätten sind jedoch in der<br />
Tourist-Information im 2004 sanierten Messnerhäuschen erhältlich. Eine Arbeitsgrup-<br />
pe „Kultur“ unter Einbindung auch der Akteure in der Holzbildhauerei wird als „Run-<br />
der Tisch“ mit Vertretern aus Vereinen, Kultur und Stadtverwaltung im Maßnahmen-<br />
katalog des städtischen Entwicklungskonzept jedoch kurz- bis mittelfristig empfohlen.<br />
Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die im Entwicklungskonzept formulierten<br />
Überlegungen zur Einrichtung eines KulturErlebnisZentrums in der Schneidmühle,<br />
wie weiter unten auszuführen sein wird.<br />
Ausstellungsobjekte und Sammlungsbestände<br />
Die in der Holzbildhauerschule angefertigten Schülerarbeiten gehen gemäß den Ver-<br />
einbarungen zwischen dem Freistaat Bayern und dem Landkreis Rhön-Grabfeld in<br />
das Eigentum des Landkreises über, der auch Sachaufwandsträger ist. Im Regelfall<br />
führt diese Vereinbarung zur Aufbewahrung der Objekte in der Holzbildhauerschule.<br />
Hier wäre im Einzelfall die Verfügbarkeit möglicher Ex-<br />
ponate abzustimmen. Auch im Dialog mit ehemaligen<br />
SchülerInnen und Akteuren der Schule sollte nach Mög-<br />
lichkeiten des Sammlungsaufbaus gesucht werden.<br />
Einen eigenen, bereits vorhandenen Sammlungskom-<br />
plex bilden im Handel erworbene Hinterlassenschaften<br />
des ehemaligen Leiters der Holzschnitzschule (1981-<br />
1996) Uwe Günther. Hierunter befinden sich neben Bü-<br />
chern und Bleistiftskizzen auch etwa 25 eigene Kunst-<br />
werke aus Bronze, Aluminium, Stein, Terrakotta und<br />
Holz.<br />
36
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Wünschenswert wären auch Exponate des ehemaligen Schülers (1954-1956) und<br />
Schulleiters (1973-1981) sowie Vorgängers von Uwe Günther, Philipp Mendler, des-<br />
sen figurative Kunst mit Freiplastiken in Mellrichstadt sowie in Bad Neustadt a.d.<br />
Saale und in Bischofsheim a. d. Rhön vertreten ist. 1999 vergab der Landkreis erst-<br />
mals den Mendler-Preis für eine Absolventenarbeit der Bischofsheimer Holzbild-<br />
hauerschule.<br />
Zur weiter zurückliegenden Geschichte der Holzschnitzerei im Allgemeinen und der<br />
Holzschnitzschule im Besonderen sind leider nur wenige Exponate erhalten. Das<br />
Atelier Warrings hat der Stadt einige Leihgaben zur Verfügung gestellt, die in einer<br />
Vitrine hinter der Eingangstür zum Rentamt<br />
präsentiert werden. Es handelt sich um 3<br />
weiße Spielzeugpferde, eine Kreuzigungs-<br />
gruppe, gerahmte Einzelblätter aus Muster-<br />
büchern der Spielzeughersteller, um zwei<br />
Lehr- und Unterrichtsbücher der Holz-<br />
schnitzschule, um eine gerahmte Kohle-<br />
skizze (Maske) und ein geschnitztes Möbel-<br />
fragment.<br />
Ferner bewahrt die Stadt eine Fundsammlung von Objekten aus der ab 1897 durch-<br />
geführten Ausgrabungen an der Osterburg auf, die derzeit von Dr. Joachim Zeune<br />
aufgearbeitet wird.<br />
Möglicher Projektstandort<br />
Im Rahmen intensiver Bemühungen um ein städtebauliches Gesamtkonzept kon-<br />
zentriert die Stadt Bischofsheim a. d. Rhön alle kulturellen Impulse und Anregungen<br />
momentan auf das geplante KulturErlebnisZentrum Schneidmühle.<br />
Schneidmühle Bischofsheim a. d. Rhön<br />
Im Zuge der Erstellung eines städtischen Entwicklungskonzeptes wurde unter reger<br />
Anteilnahme der Bevölkerung der Wunsch nach einem Kultur- und Begegnungs-<br />
37
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
zentrum laut. Ein das Entwicklungskonzept begleitender Arbeitskreis Tourismus,<br />
Freizeit und Kultur formulierte 2009 erste Vorstellungen hierzu im Hinblick auf ein<br />
mögliches KulturErlebnisZentrum am <strong>Stand</strong>ort Schneidmühle.<br />
Die Schneidmühle liegt<br />
nördlich außerhalb des<br />
von der alten Stadtmauer<br />
eingefassten Stadtkerns<br />
an der verkehrsreichen<br />
Rhönstraße (Kreisstraße<br />
10) direkt am kanalisierten<br />
Bachlauf der Brend. Sie<br />
besteht aus einem<br />
zweigeschossigen Haupt-<br />
und Wohnhaus und der diagonal anschließenden alten Säge. Die aufgegebene Müh-<br />
le befindet sich in städtischem Eigentum und ist stark sanierungsbedürftig. Das<br />
Wohn- und Haupthaus bietet im Erd- und Obergeschoss<br />
jeweils ca. 200 qm Nutzfläche, hinzu kommt ein Dachraum<br />
mit etwa 170 qm Grundfläche. Das gesamte Anwesen liegt<br />
von der Straße zurückgesetzt hinter einem größeren Vor-<br />
platz. Geplant ist zudem der Neubau einer großen Veran-<br />
staltungshalle in direkter Verbindung mit dem historischen<br />
Mühlenanwesen. 7.200 qm umfasst das Areal der Schneid-<br />
mühle insgesamt; es zählt damit zu den sechs Schlüssel-<br />
gebieten für Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus<br />
West und ist somit vorrangig und mit besonderem Augen-<br />
merk zu behandeln. Der Maßnahmenzeitraum für die Sa-<br />
nierung und Einrichtung wurde auf 2013-15 gelegt und mit einem Kostenvolumen<br />
von 3,18 Mio. Euro beziffert.<br />
Um der Bedeutung des Areals an der Schneidmühle gerecht zu werden, veranstal-<br />
tete die Stadt Bischofsheim a. d. Rhön in Kooperation mit der Hochschule Coburg –<br />
38
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Fakultät Design – unter dem Motto „KulturErlebnisZentrum Schneidmühle Bischofs-<br />
heim“ im Sommersemester 2010 einen Studentenwettbewerb. Den Studierenden der<br />
Fachrichtung Architektur unter der Leitung von Prof. Hans-Peter Hebensperger-<br />
Hüther wurde die Aufgabe gestellt, das Areal der Schneidmühle unter Einbeziehung<br />
des bestehenden Baudenkmals selbst und mittels Ergänzung durch einen Neubau<br />
für kulturelle und touristi-<br />
sche Zwecke sowie für das<br />
städtische Vereinsleben<br />
nutzbar zu machen. Die<br />
Ergebnisse wurden von<br />
einer fachkundigen Jury<br />
prämiert und in einer Bro-<br />
schüre publiziert (Doku-<br />
mentation zum Studen-<br />
tenwettbewerb KulturErlebnisZentrum Schneidmühle Bischofsheim, 2010). Den 1.<br />
Preis errang Johanna Vogt mit ihrem Vorschlag für einen „behutsamen Umgang mit<br />
historischer Bausubstanz“, der nicht nur das Wohngebäude sondern auch die „alte<br />
Schneide“ selbst erhält, und der geschickten landschaftlichen Integration eines Hal-<br />
lenneubaus in nordwestlicher Richtung.<br />
In den Vorüberlegungen im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes wurden zum<br />
Projekt Schneidmühle verschiedene Nutzungsideen formuliert, die neben einer Ver-<br />
anstaltungshalle auch Ausstellungsflächen für verschiedene Zwecke (Osterburgfunde<br />
/ Holzschnitzschule / Rhönclub / Faschingsverein) umfassten.<br />
39
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Zielfestsetzung: Vision mit Augenmaß<br />
Ein multikommunales Projekt zur <strong>Schnitz</strong>erei in der Rhön sollte ein anspruchsvolles<br />
Ziel vor Augen haben und dabei zugleich eine Reihe pragmatischer Anforderungen<br />
erfüllen. Es geht darum, eine Vision mit Augenmaß zu entwickeln. Als Leitlinien der<br />
Projektidee gelten folgende, nicht zuletzt aus Gesprächen mit verschiedensten<br />
Projektbeteiligten gewonnenen, Grundsätze und Ziele:<br />
1. Das Projekt soll das ungemein vielseitige Phänomen der Holzschnitzerei in<br />
der Rhön für Gäste und Einheimische auf moderner wissenschaftlicher Basis an-<br />
schaulich und unter Benennung der Fakten aufbereiten. Es gilt, ein regional wichti-<br />
ges und kulturlandschaftlich verwurzeltes Thema auf einem adäquaten Niveau so zu<br />
präsentieren, dass sich Einheimische in der Darstellung wiederfinden und Gäste<br />
spannende Einblicke in die Region gewinnen können. Es handelt sich in erster Linie<br />
um ein Projekt zur Aufwertung des regionalen Selbst- und Außenbildes in kultureller<br />
Hinsicht und weniger um ein Projekt zur kommerziellen Absatzsteigerung für einzelne<br />
Holzschnitzbetriebe.<br />
2. Das Projekt soll als multikommunales Kooperationsprojekt nicht nur an ei-<br />
nem <strong>Ort</strong> Informationen bieten, sondern in der <strong>Schnitz</strong>region in der (bayerischen)<br />
Hohen Rhön jeweils lokale thematische Schwerpunkte bilden und darstellen. Es gilt,<br />
Gäste und Einheimische auf die Spur der Rhöner <strong>Schnitz</strong>erei zu setzen und sie auf<br />
ihrer thematischen Entdeckungsreise durch die Region und auch in <strong>Ort</strong>e zu führen,<br />
die sie womöglich ohne diesen thematischen Leitfaden nicht besucht hätten. Dazu<br />
sind eine klare Strukturierung und eine taugliche Besucherlenkung notwendig.<br />
3. Das Projekt soll jeder beteiligten Kommune stets auch Anknüpfungspunkte<br />
zu eigener, gemeindeinterner Kulturarbeit bieten, indem es beispielsweise entspre-<br />
chend nutzbare Räumlichkeiten vorhält oder einen Ausgangspunkt für kulturelle Ini-<br />
tiativen jeder Art (z.B. lokalhistorische Forschung etc.) bildet. Die enge Einbeziehung<br />
lokal agierender und kulturinteressierter Gruppierungen ist dazu unerlässlich.<br />
40
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
4. Das Projekt soll keine beteiligte Gemeinde finanziell und personell über-<br />
fordern. Grundsätzlich gilt, dass das Projekt in den beteiligten Kommunen nach Mög-<br />
lichkeit jeweils an andere Maßnahmen angegliedert werden sollte (z.B. Dorferneue-<br />
rung, städtisches Entwicklungskonzept). Ehrenamtlich engagierte Personen müssen<br />
in die Projektplanung aktiv integriert werden.<br />
41
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Projektvorschlag: <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Unter dem Titel „<strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön“ soll – wie unter einer Dachmarke – eine<br />
ganze Reihe denkbarer Maßnahmen in der Region gebündelt und umgesetzt wer-<br />
den. Dabei will der Projekttitel bewusst keine Anklänge an eine völlig unhistorische<br />
romantisierende Verklärung der Rhönschnitzerei zur „traditionellen Volkskunst“ zu-<br />
lassen, sondern vielmehr andeuten, dass es sich bei der <strong>Schnitz</strong>erei in der Rhön zu-<br />
nächst explizit um ein Gewerbe handelt, das in der Region angesiedelt wurde. Die<br />
knappen vier Wortbestandteile erlauben zudem eine knackige grafische Übersetzung<br />
in eine Wort-Bildmarke, die es erlaubt, das Gesamtprojekt gezielt zu bewerben. Aus<br />
dem übergreifenden Projekttitel selbst lassen sich auch problemlos Titel und Be-<br />
zeichnungen der einzelnen Teilprojekte entwickeln, die einfach als „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> |<br />
Sandberg“ oder „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Bischofsheim“ geführt werden, und so ihre Zugehörig-<br />
keit zur Dachmarke „<strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön“ auf den ersten Blick zu erkennen<br />
geben. Dabei erlaubt die Offenheit des Titels, dass durchaus unterschiedliche<br />
Teilprojekt mit womöglich weit differierenden Themenstellungen unter der<br />
Dachmarke vereinigt werden können.<br />
Gesamtkonzept und Teilprojekte<br />
Das Gesamtkonzept „<strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön“ möchte in Form einer dezentralen<br />
Präsentationsweise die verschiedenen Facetten der <strong>Schnitz</strong>erei in der Rhön an un-<br />
terschiedlichen <strong>Ort</strong>en für Gäste und Einheimische erlebbar machen. Interessierte<br />
sollen – so die Idee – auf eine Entdeckungsreise durch die Region gelockt werden.<br />
An jedem Projektstandort wird auf die anderen <strong>Stand</strong>orte verwiesen, so dass der Be-<br />
sucher neue themenspezifische Ziele auswählen und ansteuern kann, ohne dass er<br />
auf einen festgelegten Rundkurs geschickt wird. Alle Projektstandorte würden mit<br />
einem einheitlichen Logo gekennzeichnet.<br />
42
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Um dem Besucher der Rhön die Orientierung zu erleichtern gilt es, ein klar struk-<br />
turiertes regionales Gesamtkonzept zu erstellen, das inhaltliche und organisatorische<br />
„Doppelungen“ und Überschneidungen verhindert, um auf diese Weise alle lokalen<br />
Ressourcen optimal zu nutzen. Dabei kann es nicht darum gehen, die <strong>Stand</strong>orte hie-<br />
rarchisch zu gliedern, sondern jeden <strong>Stand</strong>ort als selbstständiges Element im Ge-<br />
samtverbund zu werten. Die Teilprojekte in Sandberg und Bischofsheim a.d. Rhön<br />
sollten sich – nicht zuletzt im Hinblick auf die Spielzeugausstellung an prominenter<br />
Stelle in Bad Kissingen – als gleichberechtigte Einrichtungen zum selben regionalem<br />
Phänomen verstehen. Eine Differenzierung zwischen den Teilprojekten erfolgt ledig-<br />
lich über die Zuweisung unterschiedlicher thematischer Schwerpunkte und unter-<br />
schiedlicher organisatorischer Aufgaben, die auch der Besucherlenkung dienen kön-<br />
nen. Dabei spielen stets die spezifische lokale Geschichte und die aktuellen Rah-<br />
menbedingungen eine entscheidende Rolle. In den beiden Kommunen Sandberg<br />
und Bischofsheim a.d. Rhön - schlagen wir insgesamt drei <strong>Stand</strong>orte vor:<br />
<strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Bischofsheim a.d. Rhön: Holzschnitzschule und Bildschnitzerkunst<br />
<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Sandberg: <strong>Schnitz</strong>gewerbe und Hausierhandel<br />
<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Langenleiten: Künstlerateliers am Dorfanger<br />
43
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Grundsätzlich weisen die unterschiedlichen aus der örtlichen Geschichte bzw. den<br />
gegenwärtigen Verhältnissen resultierenden Themenstellungen jeden <strong>Stand</strong>ort als<br />
eigenständiges Teilprojekt aus, das sein Thema auch auf eigenständige Weise prä-<br />
sentiert: So soll in Bischofsheim a.d. Rhön eine kultur- und kunsthistorische Aus-<br />
stellung entstehen, die von einer Wechselausstellungsfläche und einer Schau- und<br />
Übungswerkstatt ergänzt wird. Für die Zuweisung dieser beiden für das Gesamtpro-<br />
jekt zentralen Bausteine nach Bischofsheim a.d. Rhön spricht vor allem das geplante<br />
KulturErlebnisZentrum Schneidmühle, das in einer Lage mit hoher touristischer Fre-<br />
quenz entstehen soll und – so die Hoffnung – genügend Raum zur Unterbringung<br />
des <strong>Schnitz</strong>themas bietet. Der „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Bischofsheim“ soll ein Stück weit als er-<br />
ste Anlaufstelle für Besucher dienen und Gäste dann in andere Projektstandorte wie-<br />
terleiten. In Sandberg soll eine kleinere historische Ausstellung den örtlich bedeut-<br />
samen Aspekten der gewerblichen <strong>Schnitz</strong>erei und des Hausierhandels nachgehen.<br />
Angeregt wird dazu eine Dokumentations- und Forschungsstelle, die alle örtlichen<br />
Überlieferungen zur Holzschnitzerei (Objekte, Fotos, Zeitzeugenaussagen) in<br />
Privatbesitz sammelt und/oder katalogisiert. In Langenleiten schließlich verweist eine<br />
Freiluftausstellung einzelner Kunstobjekte auf dem „Kunstanger“ auf die örtlichen<br />
Künstlerateliers.<br />
Derzeit ist das Gesamtkonzept auf die beiden Kommunen Sandberg und Bischofs-<br />
heim a. d. Rhön beschränkt, doch bietet der Ansatz selbstverständlich die Möglich-<br />
keit einer Ausweitung – etwa im Rahmen der <strong>Kreuzbergallianz</strong> oder weiter gefasst im<br />
Rahmen der Landkreise Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen. Für eine Zusammenar-<br />
beit mit dem Museum Obere Saline in Bad Kissingen sind die Weichen in Sandberg<br />
und Bischofsheim a. d. Rhön bereits gestellt. Das dort unabhängig realisierte Aus-<br />
stellungsprojekt könnte durchaus auch nachträglich beispielsweise als „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> |<br />
Bad Kissingen: Spielwaren und Souvenirhandel“ dem Verbund angeschlossen wer-<br />
den. Für einen „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> Oberelsbach: Holzmasken und Faschingsbrauch“ bestün-<br />
den bereits erste mit dem LEADER-Regionalmanagement angestellte Überlegungen.<br />
Auch das Rhönmuseum in Fladungen könnte sich bei der anstehenden Neueinrich-<br />
44
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
tung darauf einstellen und eventuell als „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Fladungen: Rhönschnitzerei als<br />
so genannte Volkskunst“ firmieren. Wünschenswert wäre auch eine Beteiligung im<br />
Umkreis der abgesiedelten <strong>Ort</strong>e des Truppenübungsplatzes Wildflecken, um die Ge-<br />
schichte der einfachen Holzwaren, vor allem aus Dalherda, aufzubereiten. Bei der<br />
Hinzunahme neuer Teilprojekte gilt es durchweg darauf zu achten, dass es sich um<br />
qualitativ adäquate Projekte handelt, die stets dezidiert lokale Spezifika im Zusam-<br />
menhang mit der <strong>Schnitz</strong>erei behandeln. In jedem Projekt muss der enge Zusam-<br />
menhang zwischen dem jeweils behandelten Thema und den lokalen Verhältnissen<br />
eines Rhönortes zum Ausdruck kommen. Für die Sicherstellung dieses Anspruches<br />
gälte es einen Verein zu gründen, der sich der inhaltlichen Weiterentwicklung des<br />
Projektes widmet.<br />
45
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Bischofsheim a. d. Rhön:<br />
Holzschnitzschule und Bildschnitzerkunst<br />
Für den „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Bischofsheim a. d. Rhön“ werden drei einzelne Bausteine<br />
vorgeschlagen. Dabei handelt es sich zum ersten um eine hochwertige<br />
Dauerausstellung insbesondere zu Geschichte und Gegenwart der<br />
Holzschnitzschule, zum zweiten um eine Wechselausstellungsfläche, die allen<br />
Beteiligten am Gesamtprojekt „<strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön“ zur Verfügung steht, und<br />
zum dritten um eine Schau- und Lehrwerkstatt, die für Veranstaltungen aus dem<br />
Bereich der bildnerischen Holzbearbeitung genutzt werden soll. Alle Bausteine sind<br />
ausdrücklich im Hinblick auf die Schneidmühle konzipiert, die im Rahmen des<br />
Förderprogramms Stadtumbau West zum „KulturErlebnisZentrum“ ausgebaut werden<br />
soll.<br />
Baustein 1: Dauerausstellung<br />
Thematisch bezieht sich eine im Rahmen des Gesamtkonzeptes „<strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> |<br />
<strong>Ort</strong> | Rhön“ stimmige Dauerausstellung am „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Bischofsheim a. d. Rhön“<br />
selbstverständlich in erster Linie auf die örtliche Holzschnitz- bzw. Holzbildhauer-<br />
schule, als dem lokalen Spezifikum auf dem Gebiet der Holzverarbeitung. Bei der<br />
Ausarbeitung zu einer Ausstellung ist allerdings zu beachten, dass es sich dabei um<br />
ein grundlegendes Thema für die Entwicklung der <strong>Schnitz</strong>erei in der Rhön insgesamt<br />
handelt. Die Ausstellung in Bischofsheim a. d. Rhön könnte durchaus als „Auftakt“<br />
oder „Einstieg“ ins Thema Holzschnitzen in der Rhön verstanden werden. Um dieser<br />
Aufgabe gerecht werden zu können, muss die Ausstellung in Bischofsheim a. d.<br />
Rhön als selbstbewusste und in sich geschlossene Einrichtung auftreten, die deutlich<br />
und offensiv für sich beworben werden kann. Das gilt es insbesondere im Hinblick<br />
auf die angedachte Eingliederung des <strong>Schnitz</strong>projektes in das KulturErlebnisZentrum<br />
Schneidmühle mitzubedenken. Dabei spricht nichts gegen die Bündelung kultureller<br />
Präsentationen und Aktivitäten an dieser Stelle, solange der Abschnitt „<strong>Schnitz</strong> |<br />
<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong>“ deutlich und eigenständig erkennbar bleibt und nicht zu einem traurigen<br />
Anhängsel einer unübersichtlichen Kulturangebotsvielfalt verkümmert.<br />
46
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Eine sinnvolle Ausstellungsgliederung in Bischofsheim a. d. Rhön sollte chronolo-<br />
gisch angelegt sein und beginnend mit den Anfängen der <strong>Schnitz</strong>schule in Poppen-<br />
hausen, über ihren Umzug nach Bischofsheim a. d. Rhön berichten, über ihre (wirt-<br />
schaftlichen) Erfolge, die Existenzkrise der Nachkriegs-<br />
zeit und dem – nunmehr verstärkt künstlerischen – Neu-<br />
anfang der Jahre nach 1973 bis hinein in die Gegenwart.<br />
Wünschenswert ist es, nicht allein allgemeine Entwick-<br />
lungslinien darzustellen, sondern womöglich gezielt den<br />
Biografien einzelner Lehrer und Absolventen nachzu-<br />
spüren. Mit deren Lebenswegen ließe sich die Bedeutung<br />
der Schule für das gesamte frühere <strong>Schnitz</strong>gewerbe in der<br />
Rhön und für die heutige Kunstlandschaft weit über die<br />
Grenzen der Region hinaus anschaulich darstellen.<br />
Dieser ausstellungsdidaktische Ansatz, der über einzelne<br />
<strong>Schnitz</strong>er, Unternehmer und Künstler die Geschichte der<br />
Schule und deren Bedeutung für die ökonomische und kul-<br />
turelle Regionalentwicklung aufzeigen will, deckt sich mit der<br />
in Bischofsheim a. d. Rhön bereits vorhandenen Idee zur<br />
Präsentation von Werkgruppen einzelner Kunstschaffender.<br />
Allerdings reichen die momentanen Sammlungsbestände für<br />
eine solche Präsentation leider noch nicht aus. Zur Vorberei-<br />
tung der Ausstellung gälte es daher, zunächst historische<br />
Untersuchungen zu einzelnen Absolventen der Holzschnitzschule durchzuführen und<br />
deren beruflichen Werdegang zu erforschen, wobei es zugleich wünschenswert er-<br />
scheint, auch ältere Produkte und Werke ehemaliger Holzschnitzschüler zu sam-<br />
meln. Weit wichtiger jedoch als die Sammlung solcher älterer <strong>Schnitz</strong>ereien (eine<br />
solche Ausstellungseinheit ließe sich mit Leihgaben des Ateliers Warrings und mit<br />
Flachware gestalten), ist ein verstärktes Engagement beim Aufbau einer Sammlung<br />
mit Kunstwerken von der Nachkriegszeit bis zur Gegenwart. Bisher vorhanden ist<br />
lediglich ein kleiner Bestand aus dem Nachlass des ehemaligen Schulleiters Uwe<br />
Günther.<br />
47
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Da enge Verbindungen zwischen dem Bildhauer Wilhelm Uhlig und der Holzschnitz-<br />
schule bestehen (der mütterlicherseits aus Bischofsheim stammende Künstler ist dort<br />
als Kurator tätig), könnten auch Werke aus seinem Atelier gezeigt werden. Die ande-<br />
re im Zusammenhang mit der angedachten Ausstellung genannte Künstlerpersön-<br />
lichkeit – Ferdinand Lammeyer – steht als Maler leider nicht in direkter persönlicher<br />
Beziehung zur Bischofsheimer Holzschnitzschule und sollte daher auch nicht im<br />
Mittelpunkt der Ausstellung stehen. Die Chancen für den Aufbau einer Sammlung mit<br />
Arbeiten ehemaliger Holzschnitzschüler stehen im Verlauf von Vorbereitungsarbeiten<br />
zur Einrichtung einer konkreten Ausstellung in der Schneidmühle allerdings gut: Die<br />
Bereitschaft zur Abtretung eines oder mehrerer Werke für ein ganz konkretes Aus-<br />
stellungsprojekt ist erfahrungsgemäß hoch. Selbstverständlich sollte eine solche,<br />
einmal initiierte Sammlung auch nach Fertigstellung der Ausstellung stetig um hoch.-<br />
qualifizierte Schülerarbeiten erweitert werden.<br />
Grundsätzlich würde die Dauerausstellung am „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Bischofsheim a. d.<br />
Rhön“ in einen (aufgrund der Exponatsituation zwingender Weise kleineren) histo-<br />
rischen Abschnitt und einen größeren modernen Abschnitt (in welchem in höherem<br />
Maße dreidimensionale Kunstwerke präsentiert werden) unterteilt sein:<br />
- Die Holzschnitzschule des Polytechnischen Zentralvereins<br />
- Die staatliche Berufsfachschule für Holzbildhauer<br />
Während der historische Abschnitt sich nach derzeitigem <strong>Stand</strong> der Dinge auf wenige<br />
Quadratmeter reduzieren ließe (etwa rund 30 qm) brauchen zeitgenössische Kunst-<br />
werke für eine angemessene Präsentation auch ein angemessenes Platzangebot.<br />
Da die genaue Anzahl der Werke derzeit noch nicht absehbar ist, sind konkrete An-<br />
gaben natürlich problematisch. Um jedoch Großzügigkeit zu signalisieren und einen<br />
gewissen Kunstgenuss zu ermöglichen, erscheinen 100 qm als untere Grenze.<br />
Wünschenswert wären damit also insgesamt 130-150 qm Ausstellungsfläche für die<br />
Dauerausstellung am „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Bischofsheim a. d. Rhön“. Die Schneidmühle böte<br />
mit ihren rund je 200 qm Nutzfläche in Erdgeschoss und Obergeschoss entsprechen-<br />
den Raum. Dabei ist zur Einrichtung einer weitgehend statischen Dauerausstellung<br />
48
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
das Obergeschoss geeigneter. Zusätzliche Ausstellungsabschnitte, etwa zu Künst-<br />
lern, die zwar mit Bischofsheim a. d. Rhön, nicht aber mit der <strong>Schnitz</strong>schule verbun-<br />
den sind (Ferdinand Lammeyer) oder zur Osterburg, wären denkbar. Angesichts der<br />
künftig gezeigten Kunstwerke gilt es bei der Gebäudesanierung - insbesondere im<br />
Hinblick auf Raumklima und Beleuchtung - museale <strong>Stand</strong>ards einzuhalten.<br />
Baustein 2: Wechselausstellung<br />
Die in der Schneidmühle vorhandenen räumlichen Möglichkeiten sowie deren Lage<br />
an der Zufahrt zum Kreuzberg prädestinieren diesen <strong>Stand</strong>ort zur Einrichtung einer<br />
Wechselausstellungsfläche. Der Arbeitskreis Kunst und Kultur in Sandberg sprach<br />
deutlich den Wunsch aus, im Rahmen des <strong>Schnitz</strong>projektes Ausstellungsfläche zur<br />
wechselnden Präsentation aktueller künstlerischer Arbeiten und historischer Erkennt-<br />
nisse zu schaffen. Diese Wechselausstellungsfläche ist im Hinblick auf Lagegunst<br />
und Raumangebot in der Bischofsheimer Schneidmühle ansprechender und öffent-<br />
lichkeitswirksamer einzurichten als in Sandberg. Allerdings muss der entsprechende<br />
Ausstellungsraum dann natürlich auch für Ausstellungsvorhaben der Sandberger<br />
Kulturschaffenden zur Verfügung gestellt werden. Grundsätzlich sollte der Wechsel-<br />
ausstellungsraum allen mit dem Projekt „<strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön“ assoziierten<br />
Institutionen und Protagonisten offen stehen, zudem aber auch allgemein von der<br />
Stadt Bischofsheim a. d. Rhön genutzt werden können. Wichtig ist eine dauerhafte<br />
und nachhaltige Belebung der Räumlichkeiten durch mehrfach jährlich wechselnde<br />
Ausstellungen. Erfahrungsgemäß beanspruchen Wanderausstellung für ländlich<br />
strukturierte Regionen und kleinere Präsentationsorte (wie sie beispielsweise der<br />
Bezirk Unterfranken zur Verfügung stellt) selten mehr als 50 qm. Da in Bischofsheim<br />
a. d. Rhön künftig nicht ausschließlich, jedoch als besonderer Schwerpunkt plasti-<br />
sche Kunst präsentiert werden soll, scheint es angemessen, etwas mehr Raum für<br />
Wechselausstellungen anzusetzen. Etwa 70 qm klimatisierter und gut beleuchteter<br />
Wechselausstellungsraum sind wohl ausreichend. Wichtig ist für Wechselausstel-<br />
lungsflächen, dass sie – wenn möglich – schnell und direkt vom Gebäudeeingang<br />
aus erreichbar sind, so dass sie in der Besucherlenkung komplett vom Dauerausstel-<br />
lungsbereich und anderen Gebäudeeinrichtung abgetrennt werden können. Eine<br />
Erdgeschosslage wäre zu bevorzugen, zudem dort auch der häufigere Wechsel der<br />
49
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Präsentation zu einer sicht- und spürbaren Lebendigkeit der Einrichtung führt. In den<br />
vorläufigen, aus dem Coburger Studierendenwettbewerb hervorgegangenen Sanie-<br />
rungsvorschlägen lassen sich zwei grundsätzliche Unterschiede im Umgang mit dem<br />
Erdgeschoss der Schneidmühle erkennen:<br />
Zum einen die strikte Tren-<br />
nung von der benachbar-<br />
ten Veranstaltungshalle<br />
und damit verbunden die<br />
Herstellung von multifunk-<br />
tional nutzbaren Räumen<br />
im Erdgeschoss der<br />
Schneidmühle, und zum<br />
anderen die enge Anglie-<br />
derung an die Veranstal-<br />
tungshalle durch die Unter-<br />
bringung von Funktionsräumen<br />
(Foyer, Garderobe, Toiletten) in<br />
der Schneidmühle. Im Hinblick auf<br />
eine mögliche Wechselausstel-<br />
lungsfläche im Erdgeschoss der<br />
Schneidmühle haben beide Vor-<br />
schläge Vor- und Nachteile: Na-<br />
türlich ist bei der strikten Trennung<br />
von Halle und Mühle das Raum-<br />
angebot im Erdgeschoss größer, zugleich jedoch nimmt die Besucherfluktuation ab.<br />
Veranstaltungsbesucher kommen so nicht direkt in einen eigentlich wünschenswer-<br />
ten Kontakt mit dem „<strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong>“ und den wechselnden Ausstellungsange-<br />
boten. Bei der weiteren Sanierungsplanung sollte dieser Aspekt berücksichtigt<br />
werden.<br />
50
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Baustein 3: Werkstatt<br />
Einige Bildschnitzer in der Rhön bieten in unregelmäßigen Abständen <strong>Schnitz</strong>kurse<br />
für Laien und Hobbyschnitzer an. Die Betreiber der Schauwerkstatt am Bischofs-<br />
heimer Markt - Claudia Fink und Roland Ehmig - betrachten ihre Kursangebote sogar<br />
als wichtiges ökonomisches <strong>Stand</strong>bein. Dabei ist das<br />
Platzangebot in ihrer Werkstatt zu gering und die Zu-<br />
gänglichkeit der Kreuzbergschule eingeschränkt. Auch<br />
Herr Schwarzer als Leiter der Holzbildhauerschule war<br />
durchaus an der Idee einer gläsernen Werkstatt inter-<br />
essiert, wie sie bereits vor geraumer Zeit in Bischofs-<br />
heim a. d. Rhön angedacht war, aber letztlich nur<br />
durch Fink/Ehmig in privatem Rahmen umgesetzt wer-<br />
den konnte. Mit dem „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Bischofsheim a. d.<br />
Rhön“ in der Schneidmühle könnte nun eine solche<br />
gläserne Werkstatt installiert werden. Diese Werkstatt<br />
müsste im Wortsinne gläsern – mithin rundum gut einsehbar – sein, um dem Ziel<br />
einer lebendigen, aktiven Einrichtung zur Rhönschnitzerei zu entsprechen. Es sollten<br />
kleinere Gruppen von rund 10 Personen in der zweckdienlich ausgestatteten Werk-<br />
statt arbeiten können. Das Raumangebot sollte etwa 50 qm betragen. Alle Arbeits-<br />
geräte und Werkzeuge müssten in der Werkstatt dauerhaft untergebracht und ver-<br />
fügbar sein und zudem wäre eine gute Zugänglichkeit direkt vom Hof oder Garten her<br />
wichtig für die Anlieferung von Arbeitsmaterialien. Somit wäre erneut eine Unterbrin-<br />
gung der Schau- und Lehrwerkstatt im Erdgeschoss der Schneidmühle in direkter<br />
Nachbarschaft zur Wechselausstellungsfläche anzustreben.<br />
Hinsichtlich der Nutzung der Werkstatt gilt, dass diese grundsätzlich allen mit der<br />
Holzschnitzerei verbunden Personen, Unternehmen und Institutionen für Veranstal-<br />
tungen zur Verfügung stehen sollte. Über Nutzungsentgelte, etwa für privatwirtschaft-<br />
liche Aktivitäten, müsste im Einzelfall nachgedacht werden. Grundsätzlich jedoch<br />
sollte es das Ziel sein, eine hohe Nutzungsfrequenz und damit eine hohe Auslastung<br />
für die Werkstatt zu erreichen, um so Aktivität und Leben in das Gebäude zu bringen.<br />
51
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Didaktische Zielsetzung<br />
Der „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Bischofsheim a. d. Rhön“ soll für die Besucher als „Türöffner“<br />
dienen, gewissermaßen als Foyer zur <strong>Schnitz</strong>landschaft Rhön. Dazu prädestiniert ihn<br />
das hier verhandelte Ausstellungsthema – schließlich begründete die <strong>Schnitz</strong>schule<br />
die gewerbliche <strong>Schnitz</strong>erei in der Rhön – und die herausragende Lage an der<br />
touristisch hochfrequentierten Zufahrt zum Kreuzberg. Dem künftigen Besucher soll<br />
dieser leicht auffind- und erreichbare thematische Einstieg bei der Orientierung im<br />
<strong>Schnitz</strong>gebiet Rhön helfen. Ihm sollen hier einerseits Grundlagen zum inhaltlichen<br />
Verständnis der anderen „<strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong>e“ und ihrer Traditionen vermittelt<br />
werden, und andererseits soll ein Anreiz zum Besuch noch weiterer „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong>e“<br />
geboten werden. Schau- und Lehrwerkstatt bzw. Wechselausstellungsfläche sollen<br />
diesen einführenden Effekt weiter unterstützen und möglichst viele Ausstellungs-<br />
bzw. Veranstaltungsbesucher an den <strong>Stand</strong>ort Bischofsheim a. d. Rhön locken, um<br />
diese dann in die anderen „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong>e“ weiterzuleiten. Auf diese Weise entsteht<br />
eine für den Besucher nachvollziehbare Struktur, die im Sinne einer gezielten<br />
Besucherlenkung wirkt.<br />
52
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Sandberg:<br />
<strong>Schnitz</strong>gewerbe und Hausierhandel<br />
Für Sandberg sind ebenfalls drei Projektbausteine geplant, nämlich eine kulturhistori-<br />
sche Dauerausstellung, ein lokalhistorisches Forschungs- und Dokumentationspro-<br />
jekt und ein werbendes Schaufenster. Alle Projektbausteine sind möglichst genau auf<br />
die aktuellen Gegebenheiten und zukünftigen Planungen in Sandberg abgestimmt.<br />
Baustein 1: Dauerausstellung<br />
Die Dauerausstellung in Sandberg widmet sich inhaltlich dem <strong>Schnitz</strong>gewerbe und<br />
dem daraus resultierenden Hausierhandel. Zeitweise waren über die Hälfte aller<br />
Sandberger Haushalte an der Herstellung oder dem Vertrieb einfacher <strong>Schnitz</strong>waren<br />
beteiligt, wofür nicht zuletzt das händleri-<br />
sche Engagement des Spielzeugherstel-<br />
lers Friedrich Meinel verantwortlich zeich-<br />
nete, auf den die Einrichtung der als<br />
<strong>Schnitz</strong>schule bekannten Sandberger Pro-<br />
duktionsstätte der Familie Katzenberger<br />
zurückgeht. Hier wurden in erster Linie<br />
Tierfiguren – u.a. die „weißen Pferde“ –<br />
hergestellt, die in Bad Kissingen zahlreiche Abnehmer fanden. Im Zentrum einer<br />
künftigen Ausstellung könnte der historische Hausierwagen stehen, den die Familie<br />
Bühner in ihrer Scheune aufbewahrt, möglicherweise ergänzt um ein (holzgeschnitz-<br />
tes) Zugtier. Hinter dem Wagen und zu beiden Seiten gruppieren sich jeweils drei<br />
Ausstellungsabschnitte:<br />
- Die Herstellung der <strong>Schnitz</strong>waren<br />
- Der Formenwandel der <strong>Schnitz</strong>waren<br />
- Der Verkauf der <strong>Schnitz</strong>waren<br />
53
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Im Bereich der Herstellung gilt es, die Geschichte der Sandberger <strong>Schnitz</strong>schule als<br />
einem örtlichen Produktionszentrum nachzuspüren und dabei – wenn möglich - vor<br />
allem die Betreiberfamilie Katzenberger genauer vorzu-<br />
stellen. Daneben sollten aber auch andere Formen der<br />
Gewerbeausübung (analog zum Ausstellungskonzept in<br />
Bischofsheim a. d. Rhön) am Beispiel einzelner Personen<br />
und Familien aufgezeigt werden, beispielsweise die Ne-<br />
benerwerbsschnitzerei von ungelernten <strong>Schnitz</strong>ern. Im<br />
Bereich zum Formwandel der <strong>Schnitz</strong>waren werden Bei-<br />
spiele für verschiedene Modewellen im Bereich der Rhö-<br />
ner <strong>Schnitz</strong>waren präsentiert, von den Menagerien der<br />
Wende zum 20. Jahrhundert über die Galanteriewaren<br />
der 1920er Jahre und die Andenkenproduktion der Nachkriegszeit bis zu den Wurzel-<br />
männchen. Abschließend werden im Bereich zum Thema Verkauf die verschiedenen<br />
Vermarktungswege aufgezeigt, wobei ein Schwerpunkt auf dem Hausierhandel liegt,<br />
wie er vor allem in Sandberg und (mit Abstrichen) in Waldberg zu besonderer Blüte<br />
gelangte.<br />
Eine solche streng auf ihr Thema konzentrierte Ausstellung ist mit den in Sandberg<br />
vorhandenen Exponaten durchaus zu erstellen. Dabei können je nach Bereitschaft<br />
der privaten Besitzer der Stücke mehr oder weniger Originalexponate in die Ausstel-<br />
lung integriert werden. Ein wesentlicher Teil der Inhaltsvermittlung wird zudem jedoch<br />
auch über Bildmaterial und Texte erfolgen müssen. Grundsätzlich ist der Platzbedarf<br />
für eine solche Ausstellung flexibel, das Raumangebot sollte 50 qm allerdings nicht<br />
unterschreiten. Deutlich mehr als 75 qm scheinen umgekehrt zu groß für das avisier-<br />
te Ausstellungsthema.<br />
Derzeit steht in Sandberg kein lagegünstiger, ausstellungstauglicher Raum in dieser<br />
Größenordnung zur Verfügung. Denkbar wäre angesichts des Platzbedarfs sicherlich<br />
der Mehrzweckraum im Rathauskeller, der jedoch angesichts seiner ungünstigen<br />
Lage im <strong>Ort</strong> kein erkennbares Besucheraufkommen erwarten lässt und – als Räum-<br />
54
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
lichkeit innerhalb des Rathauses – zudem eine personelle Betreuung bei Öffnung<br />
erfordert. Wir möchten daher eine andere Lösung vorschlagen, die sich möglicher-<br />
weise mit Maßnahmen der Dorferneuerung kombinieren lässt, wie sie der Vertreter<br />
der ALE Herr Eisentraut mehrfach angeregt hat. Demnach würde die Alte Schule<br />
gemäß bereits erfolgtem Gemeinderatsbeschluss abgerissen und der kommunale<br />
Bauhof in einem neuen Domizil untergebracht. Die so entstehende, bis zum Pfarrer-<br />
Straub-Haus reichende Freifläche mitten im <strong>Ort</strong>skern könnte dann neu gestaltet wer-<br />
den. Neben der Verbreiterung der Einfahrt zur Schulstraße und gärtnerischen Ele-<br />
menten könnte ein kleiner moderner Ausstellungsbau entstehen, der – je nach ge-<br />
wünschten Aufwand – mehrere Funktionen in sich vereinigen könnte: Hier könnte im<br />
Erdgeschoss des Neubaus eine auf etwa 60 qm ausgelegte Dauerausstellung ent-<br />
stehen, wie sie oben skizziert wurde. Der technische Aufwand dafür könnte gering<br />
gehalten werden, da sich die Ausstellung vor allem auf Bild- und Textreproduktionen<br />
sowie einzelne weniger empfindliche (und weniger wertvolle) Exponate beschränken<br />
ließe. Frostfreiheit müsste garantiert werden und Strom vorhanden sein. Denkbar ist<br />
dabei eine robuste Ausstellungsgestaltung, die eine stetige Aufsicht während der Öff-<br />
nungszeiten überflüssig macht. Während der Saison könnten kommunale Mitarbeiter<br />
den Schließdienst übernehmen. Unterbringen ließe sich in einem solchen Gebäude<br />
bei Bedarf auch eine öffentliche Toilettenanlage, die nicht unerheblich zur Aufent-<br />
haltsqualität im Umfeld der örtlichen Einzelhandelsgeschäfte und eines künftigen<br />
<strong>Schnitz</strong>standorts beitragen könnte. Denkbar wäre auch eine öffentlich begehbare<br />
Dachterrasse mit Sitzgelegenheiten. Insgesamt scheint ein eingeschossiges Gebäu-<br />
de mit rund 80 qm Grundfläche ausreichend, das womöglich kostengünstig in moder-<br />
ner Bauweise erstellt werden könnte.<br />
55
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Baustein 2: Dokumentationsstelle<br />
Die Geschichte der <strong>Schnitz</strong>erei in Sandberg ist bislang keinesfalls ausreichend er-<br />
forscht. Mit einer Zeitzeugenbefragung hat der Arbeitskreis Kunst und Kultur bereits<br />
erste Schritte auf dem Weg zu einer intensiveren Aufarbeitung des Themas unter-<br />
nommen, die in Form kontinuierlicher Forschungsarbeit fort- und weitergeführt wer-<br />
den sollten. Ziel sollte die Erfassung aller in Sandberg und den <strong>Ort</strong>steilen vorhande-<br />
ner Überlieferungen zur Holzschnitzerei im Gemeindegebiet sein. Originale Exponate<br />
– sowohl Produkte der <strong>Schnitz</strong>warenherstellung, als auch Arbeitsgeräte oder ein-<br />
schlägig mit der <strong>Schnitz</strong>erei und dem Handel in Verbindung stehende Objekte –<br />
sollten systematisch in Privathaushalten gesucht und ausführlich mit Foto und Inven-<br />
tarblatt dokumentiert werden. Sollten die Besitzer es wünschen, könnten Einzel-<br />
stücke auch zu einer kommunalen Sammlung zusammengetragen werden. Nur auf<br />
diese Weise lässt sich ein Überblick über die in vielen Haushalten verstreuten histori-<br />
schen Zeugnisse gewinnen. Analog sollte dabei natürlich auch nach einschlägigen<br />
historischen Fotografien geforscht werden. Eventuelle Funde gälte es zu digitalisie-<br />
ren und mit möglichst genauen Angaben zu versehen. Selbstverständlich sollten<br />
auch die Zeitzeugenbefragungen fortgeführt werden. Vielleicht lassen sich Biografien<br />
einzelner Holzschnitzer(familien) erstellen. Solche Biografien müssten auch mithilfe<br />
archivalischer Quellen untermauert werden. Die Ergebnisse könnten schließlich in<br />
eine Online-Dokumentation oder eine Buchpublikation münden.<br />
Baustein 3: Schaufenster<br />
Kilianshof ist der einzige Gemeindeteil Sandbergs, den der beliebte „K-Weg“ rund um<br />
den Kreuzberg durchschneidet. Das an das Dorfgemeinschaftshaus in Kilianshof an-<br />
gesetzte Schaufenster sollte daher unbedingt zur Werbung für den „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> |<br />
Sandberg“ genutzt werden. Die Schaufenstergestaltung sollte das Projekt „<strong>Schnitz</strong> |<br />
<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön“ thematisieren und deutlich auf<br />
den „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Sandberg“ verweisen, wobei nicht<br />
allein die Ausstellung beworben werden sollte, son-<br />
dern auch die für Wanderer oft wichtigen Einrich-<br />
tungen, wie Toiletten, Rastplätze oder Einzelhan-<br />
delsgeschäfte.<br />
56
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Didaktische Zielsetzung<br />
Das Teilprojekt in Sandberg zielt darauf ab, einerseits im Sinne einer lokalen Iden-<br />
titätsbildung die bislang noch nicht zusammenhängend erforschte Geschichte der<br />
<strong>Schnitz</strong>erei im <strong>Ort</strong> aufzuarbeiten und in Form einer Ausstellung als Teil der eigenen<br />
Geschichte zu präsentieren. Andererseits soll die Ausstellung in einem eigenen<br />
Ausstellungsgebäude in der <strong>Ort</strong>smitte und direkt an der Kreuzbergstraße vorbeifah-<br />
rende Touristen und Gäste aufmerksam machen und zum Anhalten verleiten. Die<br />
jedermann kostenlos zugängliche Präsentation zur Geschichte der <strong>Schnitz</strong>erei und<br />
des Hausierhandels in Sandberg soll Interesse für den <strong>Ort</strong> und für das Projekt<br />
„<strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön“ wecken. Der neugeschaffene gärtnerisch gestaltete<br />
Freibereich zwischen Kreuzbergstraße und Pfarrer-Straub-Haus sollte darüber hi-<br />
naus Aufenthaltqualität bieten, etwa durch eine übersichtliche Info-Tafel zur <strong>Ort</strong>sge-<br />
schichte und Dorfanlage oder durch Rast- und Ruheplätze (evtl. auch auf einer<br />
Aussichtsdachterrasse). In diesem Zusammenhang wäre es wichtig, dass auch der<br />
umliegende Einzelhandel Angebote für etwaige Gäste vorhält (Coffee to go,<br />
Getränke, Brotzeit, Zeitungen etc.).<br />
57
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Langenleiten:<br />
Kunst auf dem Dorfanger<br />
In Langenleiten soll im Rahmen der Umgestaltung des Dorfangers als eine Maßnah-<br />
me der Dorferneuerung ein „Kunstanger“ entstehen.<br />
Baustein: Kunstanger<br />
Heute ist Langenleiten der Gemeindeteil Sandbergs, in dem die meisten aktiven<br />
Künstler leben und arbeiten (Herbert Holzheimer, Günther Metz, Klaus und Heike<br />
Metz, Peter Carl und Rosa Strauß-Carl, Karin Quader). Darüber hinaus befindet sich<br />
in Langenleiten die Fräserei Nöth, die Figuren für die Gewerbe- und Hobbyschnitzer<br />
vorfräst. Im <strong>Ort</strong>sbild Langenleitens ist diese hohe Zahl von Künstlern und ihren Ate-<br />
liers kaum ablesbar. Eine Freiluftausstellung auf dem Dorfanger könnte Abhilfe<br />
schaffen und Langenleiten sichtbar zu einem „Künstlerdorf“ machen. Insgesamt<br />
denkbar wären fünf neue Stationen, die jeweils konkreten Ateliers bzw. Betrieben<br />
zugeordnet würden: Den Anfang würde am Beginn der Lindenstraße eine Station der<br />
Fräserei Nöth machen. Ein ganzes Stück weiter in Richtung Kirche stünde eine<br />
Station für das Atelier Carl.Strauss, danach folgte eine Station für die Familie Metz.<br />
Die Kirche von Langenleiten sollte unter Hinweis auf<br />
das große Kruzifix vom Emil Arnold ebenfalls als Station<br />
mit aufgenommen werden. Den Abschluss würde ein<br />
Werk nahe des Ateliers von Herbert Holzheimer am<br />
Ende der Lindenstraße bilden. Prinzipiell sollten die<br />
Werke jeweils aus der Produktion der Ateliers und<br />
Werkstätten stammen, vor denen sie aufgestellt sind.<br />
Wo dies nicht möglich ist (das Atelier Carl Strauß arbei-<br />
tet graphisch und malerisch), gilt es in Absprache eine<br />
adäquate Ersatzlösung zu finden. Prinzipiell muss die<br />
Gemeinde Sandberg die Kunstwerke ankaufen, wobei<br />
mit Unterstützung von LEADER und der Kulturstiftung des Bezirks Unterfranken<br />
eventuell eine hohe Förderquote möglich wäre.<br />
58
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Insgesamt kann ein solcher „Kunstanger“ nur im Zusammenhang mit<br />
einer umfassenden Umgestaltung des gesamten Angers in Langenlei-<br />
ten realisiert werden. Schließlich gilt es, den Kunstwerken auch einen<br />
angemessenen Rahmen zu geben. Dazu muss zum einen die Grün-<br />
fläche insgesamt neu gegliedert werden – eventuell durch einen Was-<br />
serlauf, wie es ihn früher mitten auf dem Anger gab – und zum<br />
anderen müssen die sich heute schon auf der Grünfläche befindlichen<br />
unter-schiedlichen Objekte neu strukturiert werden. Die historischen<br />
Denk-mäler dagegen - ein Bildstock, eine Marienfigur und zwei<br />
Hochkreuze - können in das Konzept des „Kunstangers“ integriert<br />
werden. Wichtig ist zudem eine Überarbeitung der vorhandenen<br />
Informationstafeln und deren Ergänzung um eine Tafel zum „<strong>Stand</strong> |<br />
<strong>Ort</strong> | Langenleiten“.<br />
Die fünf modernen und die fünf historischen Kunstwerke (Bildstock, zwei Hochkreu-<br />
ze, Marienfigur, Kruzifix) sollten für Besucher entweder über eine kleine Broschüre<br />
oder durch kleine Info-Täfelchen neben den betreffenden Werken erschlossen wer-<br />
den. Zudem muss bei der Aufstellung bedacht werden, dass im Winter sämtlicher<br />
59<br />
Schnee aus den Höfen und von den<br />
Straßen Langenleitens auf den<br />
Anger geschoben wird, wo er dann<br />
alle dort befindlichen Kunstwerke<br />
bedeckt. Möglicherweise sollten für<br />
die einzel-nen Werke im Winter<br />
temporäre Schutzvorrichtungen<br />
(Einhausungen) vorgesehen werden.
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Didaktische Zielsetzung<br />
Das Teilprojekt in Langenleiten hat zuallererst die Aufgabe, auf die Aktualität bild-<br />
künstlerischer Arbeiten in der historischen <strong>Schnitz</strong>landschaft Rhön hinzuweisen und<br />
damit den ganz auf geschichtliche Entwicklungen ausgerichteten Projektstandorten<br />
eine dezidiert zeitgenössische Ergänzung an die Seite zu stellen. Diese inhaltliche<br />
Differenz zum „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Sandberg“ ebenso wie zum „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Bischofsheim<br />
a. d. Rhön“ soll bereits in der Darstellungsform als Freiluftausstellung auf dem Dorf-<br />
anger von Langenleiten zum Ausdruck kommen.<br />
Darüber hinaus soll der Kunstanger – wenn möglich – helfen, Kontakte zwischen<br />
interessierten Besuchern und einheimischen Künstlern herzustellen. Die Stationen<br />
sollen Gäste in die Höfe, Ateliers und Betriebe der ansässigen Bildschnitzer und<br />
anderer Künstler weiterleiten. Dabei sind alle Betriebe auf Besuch eingerichtet und<br />
haben in der Regel Ausstellungs- und Verkaufsräumlichkeiten. Das Atelier Carl.<br />
Strauss gestaltet momentan seinen Hofbereich für den Empfang von Gästen um.<br />
60
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Betriebskonzept<br />
Investitionen in umfangreiche kulturelle Strukturentwicklungsprojekte sind nur ge-<br />
rechtfertigt, wenn die begründete Aussicht auf einen dauerhaften Betrieb und eine<br />
nachhaltige Belebung des Projektes besteht. Im Folgenden soll eine gangbare Mög-<br />
lichkeit aufgezeigt werden, wie der Dauerbetrieb des Projekts „<strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> |<br />
Rhön“ gewährleistet werden könnte.<br />
Träger und Betreiber<br />
Als Träger der verschiedenen Teilprojekte – der einzelnen „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong>e“ also – treten<br />
selbstverständlich die jeweiligen Kommunen auf. Ihnen obliegt es, die Teilprojekte zu<br />
finanzieren, zu realisieren und deren dauerhafte Pflege und Betreuung sicherzustel-<br />
len. Dabei soll den einzelnen Kommunen die enge Anbindung der Teilprojekte an<br />
verschiedene kommunale Vorhaben helfen. Wichtig ist dabei auch die lokale Einbin-<br />
dung ehrenamtlicher Mitarbeiter.<br />
Der Betrieb des Gesamtprojekts „<strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön“ kann allerdings nicht in<br />
den Händen einer einzelnen Kommune liegen, insbesondere, wenn sich außer Sand-<br />
berg und Bischofsheim a. d. Rhön weitere Gemeinden dem Vorhaben anschließen<br />
sollten. Dann gälte es, einen Förder- und Betreiberverein zu installieren, der Aufga-<br />
ben im Sinne des Gesamtprojektes übernimmt. Neben Vertretern der beteiligten<br />
Kommunen müssen in einen solchen Verein unbedingt jeweils lokal engagierte Ak-<br />
teure eingebunden werden, die unerlässliche Fachkompetenz in den Förderverein<br />
tragen könnten. Die wesentlichen Aufgaben des Förder- und Betreibervereins wären:<br />
- Weiterentwicklung des Gesamtprojekts (Aufnahme neuer „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong>e“)<br />
- Gemeinsames Marketing (Werbematerialien, Medienarbeit, Messeauftritte)<br />
- Programmgestaltung für den Wechselausstellungsraum in Bischofsheim a. d.<br />
Rhön (Organisieren und Kuratieren von Ausstellungen, Veranstaltungen etc.)<br />
61
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Der Förder- und Betreiberverein müsste selbstverständlich von den projektbeteiligten<br />
Kommunen mit angemessenen Finanzmitteln zur Erfüllung seiner Aufgaben<br />
versehen werden.<br />
Personalbedarf<br />
Angesichts der derzeitigen Anzahl von zwei am Projekt beteiligten Kommunen be-<br />
steht für den Förder- und Betreiberverein kein Personalbedarf, der nicht ehrenamtlich<br />
abgedeckt werden könnte. Für die kontinuierliche Betreuung der Teilprojekte hinge-<br />
gen bedarf es sicherlich personeller Unterstützung durch den Träger. Das gilt insbe-<br />
sondere für den Bereich der Instandhaltung der Einzelprojekte: Für ein „Kultur<br />
ErlebnisZentrum“ in der Bischofsheimer Schneidmühle ist eine kommunal getragene<br />
hausmeisterliche Aufsicht über alle Teile des Zentrums sicherlich ebenso notwendig,<br />
wie ein regelmäßiger Reinigungsdienst. Entsprechende Instandhaltungs- und Reini-<br />
gungsaufgaben gilt es in geringerem Maß auch in Sandberg zu erledigen. Dort ist<br />
entsprechend unseres Projektvorschlags keine kontinuierliche Betreuung der Dauer-<br />
ausstellung notwendig; einfaches Auf- und Abschließen durch Gemeindemitarbeiter<br />
genügt. In Bischofsheim a. d. Rhön wird eine personelle Betreuung der Ausstellung<br />
während der (saisonal differierenden) Öffnungszeiten nicht zu vermeiden sein, wobei<br />
zunächst versucht werden kann, eine Regelung auf ehrenamtlicher Basis (mit Auf-<br />
wandsentschädigung) zu finden. Da in der Hauptsaison allerdings eine kontinuier-<br />
liche Öffnung auch unter der Woche angestrebt werden sollte, besteht die Gefahr,<br />
dass diese nicht mit ehrenamtlichen Mitarbeitern realisiert werden kann. In diesem<br />
Fall müsste über andere personelle Lösungen nachgedacht werden. Ggf. ehrenamt-<br />
lich absolviert werden kann hingegen das Führungsprogramm in den einzelnen Ein-<br />
richtungen oder gar an mehreren „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong>en“ zugleich im Rahmen von komplet-<br />
ten Rundfahrten. Wichtig ist die organisatorische Anbindung der Aufsichts- und<br />
Führungsdienste an eine zentrale (am besten kommunale) Stelle – etwa an die<br />
Bischofsheimer Tourist-Information.<br />
62
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Qualifizierungsmaßnahmen<br />
Sämtliche Planungs- und Realisierungsarbeiten der Teilprojekte müssen unter enger<br />
Einbindung der lokalen Akteure sowie der gesamten Öffentlichkeit stattfinden. In re-<br />
gelmäßigen Treffen und Sitzungen werden Arbeitsfortschritte vorgestellt und disku-<br />
tiert. Erfahrungsgemäß erwächst aus solchen Sitzungen ein Personenkreis, der sich<br />
weiterhin am nachhaltigen Betrieb der Einrichtung beteiligen möchte. Dieser Perso-<br />
nenkreis ist motiviert genug, um weiteren Qualifizierungsmaßnahmen zu absolvieren.<br />
Dabei gilt es insbesondere GästeführerInnen zu schulen. Denkbar ist – bei entspre-<br />
chendem Bedarf – die Schulung für Stadt- und <strong>Ort</strong>sführerInnen insgesamt oder aber<br />
die Schulung von spezifischem Führungspersonal mit Schwerpunkt „<strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> |<br />
<strong>Ort</strong> | Rhön“.<br />
Veranstaltungsprogramm<br />
Die Verantwortung für ein reichhaltiges Veranstaltungsprogramm am „<strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong><br />
| <strong>Ort</strong> | Rhön“ trägt der oben erwähnte Förder- und Betreiberverein. Spezifische Ver-<br />
anstaltungen und Aktivitäten zur <strong>Schnitz</strong>erei stimmt der Verein mit den kommunalen<br />
Projektträgern der einzelnen „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong>e“ ab. Das gilt im Besonderen für die Wech-<br />
selausstellungsfläche in Bischofsheim a. d. Rhön. Generell besteht aber selbstver-<br />
ständlich für jede Kommune die Möglichkeit, eigene Veranstaltungen am jeweiligen<br />
„<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong>“ zu initiieren und durchzuführen.<br />
Im Zentrum des Programms stehen die Wechselausstellungen am „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Bi-<br />
schofsheim a. d. Rhön“. Empfehlenswert scheint zum Saisonauftakt im Frühjahr eine<br />
zentrale größere Präsentation, und womöglich zwei oder drei weitere Ausstellungen<br />
im Jahreslauf mit eventuell kürzerer Laufzeit. Attraktiv ist sicherlich auch eine vor-<br />
weihnachtliche Sonderausstellung mit jahreszeitlich bedingter Themensetzung. Auch<br />
für die Schau- und Lehrwerkstatt sollten Termine fixiert werden, die sicherstellen,<br />
dass zumindest an erfahrungsgemäß hochfrequentierten Wochenenden ein <strong>Schnitz</strong>-<br />
künstler vor <strong>Ort</strong> ist.<br />
63
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Sicherlich von großem öffentlichen Interesse ist die Veranstaltung von Messen,<br />
Märkten und Verkaufsausstellungen, wobei dabei stets auf die über die ökonomi-<br />
schen Interessen Einzelner stehende Gesamtaufgabe des Projekts „<strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> |<br />
<strong>Ort</strong> | Rhön“ geachtet werden muss, das in erster Linie als Instrument der Regional-<br />
entwicklung auf kulturellem und touristischem Gebiet und weit weniger der Förderung<br />
eines Berufs- und Gewerbezweiges dient.<br />
Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und Kooperation<br />
Über die Möglichkeiten der Erweiterung des derzeit auf Sandberg und Langenleiten<br />
sowie Bischofsheim a. d. Rhön beschränkten Projekts „<strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön“<br />
wurde weiter oben bereits ausführlich gesprochen, damit sind die wesentlichen po-<br />
tentiellen Kooperationspartner der Region benannt. Darüber hinaus sind langfristig<br />
sicherlich auch überregionale Partnerschaften, etwa in andere <strong>Schnitz</strong>landschaften,<br />
denkbar und reizvoll.<br />
Insgesamt dienen Kooperationen vor allem der Steigerung der öffentlichen Aufmerk-<br />
samkeit. Eine Ausstellung in einer einzelnen Gemeinde der Hohen Rhön kann in der<br />
Vielfalt der Freizeit- und Informationsangebote leicht übersehen werden. Eine in ei-<br />
nem stringenten Gesamtprojekt vereinte größere Region (mit momentan drei, später<br />
womöglich mehr Teilprojekten) ist hingegen nicht zu übersehen. Öffentlichkeitsarbeit<br />
beginnt im Hinblick auf das Projekt „<strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön“ also nicht erst mit<br />
dem Drucken von Werbebroschüren, sondern vielmehr noch mit der Schaffung des<br />
notwendigen Gewichts, um in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Dann<br />
allerdings gilt es, dieses Gewicht auch besucherwirksam nach außen zu vermitteln.<br />
Dazu bedarf es einerseits der Herstellung ansprechender Werbematerialien – Bro-<br />
schüren, Land- und Postkarten, Homepage, Imagefilm – und andererseits einer re-<br />
gelmäßigen Zusammenarbeit mit regionalen und womöglich überregionalen Institu-<br />
tionen. Wichtige Kooperationspartner für das Projekt sind dabei nicht zuletzt die re-<br />
gionale Tourismuswerbung und die Kulturagentur des Landkreises.<br />
64
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Als konkrete Maßnahmen zur Beförderung der internen Kommunikation und einer in<br />
die Zukunft gerichteten Öffentlichkeitsarbeit sollten folgende Maßnahmen ergriffen<br />
werden, sobald in den Partnergemeinden grundsätzliche Zustimmung zu einem<br />
Kooperationsprojekt herrscht.<br />
- Wechselseitige Informationsveranstaltungen zum Projektstand in den<br />
beteiligten Kommunen für Interessierte aus der Partnergemeinde<br />
(Transparenz)<br />
- Einrichtung einer festen Arbeitsrunde („Initiative <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön“)<br />
mit Verantwortlichen beider momentan beteiligten Kommunen und anderen<br />
lokalen Akteuren<br />
- Vorbereitung zur Gründung eines Förder- und Betreibervereins für das<br />
multikommunale Projekt „<strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön“<br />
- Entwicklung einer Wort-Bild-Marke „<strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön“<br />
- Frühzeitige Schaffung einer Internetpräsenz des Projektes<br />
- Einleitung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zum Gesamtprojekt<br />
65
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Budgetrahmen<br />
1. Gemeinsame Kosten für Bischofsheim a. d. Rhön und Sandberg<br />
Bewerbung und Vermarktung – nicht investiv<br />
KOSTENPUNKT KOSTEN NETTO<br />
1. Entwicklung Wort-Bild-Marke 2.500,00 €<br />
2. Faltblatt / Werbeflyer und Plakat 4.500,00 €<br />
3. Messedisplays (2 Stück) 1.000,00 €<br />
4. Homepage 4.000,00 €<br />
5. Pressearbeit zur Eröffnung (Texte, Konferenz) 2.000,00 €<br />
ENDSUMME 14.000,00 €<br />
Starthilfe für den Betrieb – nicht investiv<br />
KOSTENPUNKT KOSTEN NETTO<br />
1. Initiierung und Begleitung des Fördervereins (inkl.<br />
Durchführung von 5 Arbeitstreffen)<br />
2. Entwicklung von Führungsprogrammen für 3<br />
<strong>Stand</strong>orte (inkl. Schulung)<br />
66<br />
4.200,00 €<br />
4.300,00 €<br />
ENDSUMME 8.500,00 €<br />
Gesamtsumme Netto: 22.500,00 €<br />
Gesamtsumme Brutto (inkl. 19% MwSt.): 26.775,00 €
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
2. Einzelkosten „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Bischofsheim a. d. Rhön“<br />
Die Kostenschätzung zur Sanierung und zum ausstellungstauglichen Ausbau der Räumlichkeiten in<br />
der Schneidmühle muss von Seiten des künftigen Architekturbüros erstellt werden.<br />
Konzeptionskosten – investiv<br />
KOSTENPUNKT KOSTEN NETTO<br />
1. Rahmenkonzept (Dauerausstellung) 9.500,00 €<br />
2. Feinkonzept inkl. Abbildungs- und Textrecherchen<br />
(Dauerausstellung)<br />
67<br />
13.500,00 €<br />
ENDSUMME 23.000,00 €<br />
Kosten für Ausstellungseinrichtung (ca. 150 qm) - investiv<br />
KOSTENPUNKT KOSTEN NETTO<br />
1. Ausstellungsgestaltung 7.500,00 €<br />
2. Betextung 6.000,00 €<br />
3. Ausstellungsarchitektur (Vitrinen, Tafeln,<br />
Inszenierungen)<br />
41.000,00 €<br />
4. Grafik (Bildrechte, Layout, Druck, Realisation) 13.000,00 €<br />
5. Audiovisuelle Medien 12.000,00 €<br />
6. Restaurierung, Objektmontage, etc. 6.000,00 €<br />
7. Projektierung, Vorbereitung, Betreuung 4.000,00 €<br />
ENDSUMME 89.500,00 €<br />
Kosten für Wechselausstellungsraum (ca. 70 qm) - investiv<br />
KOSTENPUNKT KOSTEN NETTO<br />
1. Gestaltung 3.000,00 €<br />
2. Podeste, Vitrinen 10.000,00 €<br />
3. Stellwandsystem 10.000,00 €<br />
ENDSUMME 23.000,00 €
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Kosten für Werkstatt (ca. 50 qm) - investiv<br />
KOSTENPUNKT KOSTEN NETTO<br />
1. Gestaltung 2.000,00 €<br />
2. Möblierung (Schränke, Werkbänke, Arbeitsleuchten) 12.500,00 €<br />
3. Werkzeuge, Arbeitsgeräte (ca. 10 Pers.) 11.500,00 €<br />
ENDSUMME 26.000,00 €<br />
Kosten für bauliche Maßnahmen in Gebäude und Umfeld - investiv<br />
KOSTENPUNKT KOSTEN NETTO<br />
1. Empfangstresen / Shop / Garderobe<br />
(Gestaltung und Bau)<br />
68<br />
10.500,00 €<br />
2. Kassensystem 6.500,00 €<br />
3. Werbung am Gebäude (Fahnen, Schaukasten) 4.500,00 €<br />
ENDSUMME 21.500,00 €<br />
Gesamtsumme Netto: 183.000,00 €<br />
Gesamtsumme Brutto (inkl. 19% MwSt.): 217.770,00 €
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
3. Einzelkosten „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Sandberg“ & „<strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Langenleiten“<br />
Die Kostenschätzung zum Abriss der „Alten Schule“ und zur Erstellung eines Ausstellungspavillons<br />
muss von Seiten des künftigen Architekturbüros erstellt werden. Auch die Kosten für die<br />
Gesamtgestaltung des Dorfangers von Langenleiten muss ein geeignetes Planungsbüro ermitteln.<br />
Konzeptionskosten (Gesamtprojekt) - investiv<br />
KOSTENPUNKT KOSTEN NETTO<br />
1. Rahmenkonzept (Dauerausstellung, Außenbereich) 4.000,00 €<br />
2. Feinkonzept inkl. Abbildungs- und Textrecherchen<br />
(Dauerausstellung, Außenbereich)<br />
69<br />
5.000,00 €<br />
ENDSUMME 9.000,00 €<br />
Kosten für Ausstellungseinrichtung (ca. 60 qm) - investiv<br />
KOSTENPUNKT KOSTEN NETTO<br />
1. Ausstellungsgestaltung 2.500,00 €<br />
2. Betextung 3.500,00 €<br />
3. Ausstellungsarchitektur (Vitrinen, Tafeln, Podeste) 15.000,00 €<br />
4. Grafik (Bildrechte, Layout, Druck, Realisation) 5.000,00 €<br />
5. Beleuchtung 6.000,00 €<br />
6. Projektierung, Vorbereitung, Betreuung 3.000,00 €<br />
7. Werbung am Gebäude (Fahnen, Schaukasten) 3.500,00 €<br />
ENDSUMME 38.500,00 €<br />
Kosten für Dokumentationsprojekt - investiv<br />
KOSTENPUNKT KOSTEN NETTO<br />
1. PC / Laptop 1.000,00 €<br />
2. Digitalkamera mit Stativ 800,00 €<br />
3. Tonaufnahmegerät 500,00 €<br />
ENDSUMME 2.300,00 €
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Kosten für Kunstanger– investiv<br />
KOSTENPUNKT KOSTEN NETTO<br />
1. Vier Plastische Kunstwerke 40.000,00 €<br />
2. Ca. 7 Infotafeln 7.500,00 €<br />
ENDSUMME 47.500,00 €<br />
Gesamtsumme Netto: 97.300,00 €<br />
Gesamtsumme Brutto (inkl. 19% MwSt.): 115.787,00 €<br />
70
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Arbeitstreffen und –gespräche<br />
Zur Vorbereitung des vorliegenden Konzeptes führten wir eine Reihe von Arbeitsge-<br />
sprächen und <strong>Ort</strong>sbegehungen vor <strong>Ort</strong> in den beteiligten Gemeinden durch:<br />
4. Oktober 2010<br />
- Barbara Hippeli (Schmalwasser)<br />
- Robert Holzheimer (Schmalwasser)<br />
- Günther Holzheimer (Schmalwasser)<br />
- Werner Holzheimer (Kilianshof)<br />
- Werner Holzheimer (Langenleiten)<br />
- Familie Metz (Langenleiten)<br />
- Gesprächsrunde im Rathaus (Sandberg)<br />
14. Oktober 2010<br />
- Bürgermeister Baumann (Bischofsheim a. d. Rhön)<br />
- Bruder-Franz-Haus (Kreuzberg)<br />
21. Oktober 2010<br />
- Peter Weidisch und Birgit Schmalz (Bad Kissingen)<br />
- Claudia Fink und Roland Ehmig (Bischofsheim a. d. Rhön)<br />
- Matthias Wild (Bischofsheim a. d. Rhön)<br />
3. November 2010<br />
- Gesprächsrunde im Rathaus (Sandberg), u.a. mit Hr. Eisentraut (ALE)<br />
9. November 2010<br />
- Herbert Holzheimer (Langenleiten)<br />
- Heike und Klaus Metz (Langenleiten)<br />
- Peter Carl und Rosa Strauss-Carl (Langenleiten)<br />
- Fräserei Nöth (Langenleiten)<br />
71
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
18. November 2010<br />
- Rudolf Schwarzer (Bischofsheim a. d. Rhön)<br />
- Bürgermeister Baumann, Gerhard Nägler, Felix Schmigalle (Bischofsheim a.<br />
d. Rhön)<br />
3. Dezember 2010<br />
- Herbert Holzheimer (Langenleiten)<br />
- Manfred Bühner (Sandberg)<br />
- Sabine Fechter (Fladungen)<br />
72
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Literatur:<br />
150 Jahre Holzschnitzschule in Bischofsheim. Staatliche Berufsfachschule für<br />
Holzbildhauer. Hrsg. v. Landkreis Rhön Grabfeld. Bad Neustadt 2003.<br />
300 Jahre Sandberg. Ein Bildband zur 300-Jahr-Feier mit historischen Texten.<br />
Würzburg 1991.<br />
Albert, Reinhold: Chronik von Bischofsheim a. d. Rhön mit Haselbach und dem<br />
Kreuzberg. Bischofsheim a.d. Rhön 2010.<br />
Böhm, Elke: Krippen aus der Rhön. Bilder einer Kulturlandschaft. Lindenberg 1998.<br />
Böhm, Elke: Masken. Volkskunst und Brauchtum der Rhön. München 2002.<br />
Brückner, Wolfgang: Rhöner <strong>Schnitz</strong>figuren aus dem 19. Jahrhundert. Petersberg<br />
2008.<br />
Clauss, Herbert: <strong>Schnitz</strong>en in der Rhön. Hrsg. v. Institut für Volkskunstforschung.<br />
Leipzig 1956.<br />
Ehmig, Roland u. Fink, Claudia: Die Holzbildhauerschule Bischofsheim im Wandel<br />
der Zeit. IN: Region & Nachhaltigkeit. Anregungen und Berichte zum<br />
Biospähenreservat 2007, S.164-172.<br />
Fleischer, Max: Die Holzschnitzerei in der Hohen Rhön. In: Arndt (Hg.): Die<br />
Heimarbeit im rhein-mainischen Wirtschaftsgebiet Bd. 3. Jena 1914, S. 441-488.<br />
Geheimnisvolle Masken aus der Rhön. Von jüdischen und christlichen Bartmännern.<br />
Ausstellungskatalog des Hessischen Landesmuseums Darmstadt. Darmstadt 2005.<br />
73
Vorkonzept<br />
Kooperationsprojekt <strong>Schnitz</strong> | <strong>Stand</strong> | <strong>Ort</strong> | Rhön<br />
Historische Kulturlandschaft der Walddörfer – Sandberg, Waldberg, Langenleiten,<br />
Schmalwasser und Kilianshof (= Historische Kulturlandschaft Rhön 2). Hrsg. v. der<br />
bayerischen Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön. Petersberg 2010.<br />
Jansen, W.: Die Heimarbeit in der Rhön. Jena 1929.<br />
Mein Dorf Langenleiten. Heimatbuch zur 300-Jahrfeier. Langenleiten 1989.<br />
Schad, Peter: Die sogenannten Hausgewerbe der bayerischen Rhön im 19.<br />
Jahrhundert: Holzwarenindustrien, Krugbäckereien, Webereien. Diss. Nürnberg<br />
1971.<br />
Staubitz, Max: Die Holzschnitzerei in der Hohen Rhön. In: Arndt (Hg.): Die<br />
Heimarbeit im rhein-mainischen Wirtschaftsgebiet Bd. 1. Jena 1914, S. 200-212.<br />
74