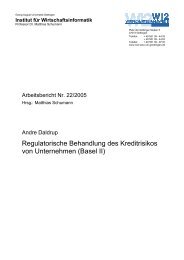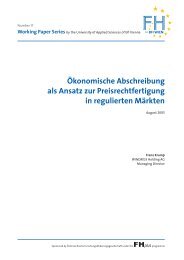Open PDF - EconBiz
Open PDF - EconBiz
Open PDF - EconBiz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
MITTEILUNGEN UND BERICHTE<br />
Nr.30 (2001)<br />
Forschungsinstitut für Leasing an der Universität zu Köln<br />
Herausgeber: Prof. Dr. Hans E. Büschgen<br />
Redaktion: Dipl.-Kff. Patricia Hanauer<br />
Vorwort<br />
Von Prof. Dr. Hans E. Büschgen<br />
Tätigkeitsbericht des Forschungsinstituts fiir Leasing<br />
an der Universität zu Köln fiir den Berichtszeitraum<br />
November 1999 bis Dezember 2000<br />
von Prof. Dr. Hans E. Büschgen<br />
Der Einsatz moderner Informations- und<br />
Kommunikationsmedien bei Leasinggesellschaften<br />
Von Prof. Dr. Hans E. Büschgen<br />
Besondere Problemstellungen von Leasinggesellschaften im<br />
Rahmen des KonTraG<br />
von Dipl.-BW Karl-Heinz Helfrich, Sprecher des Vorstands<br />
der Diskont und Kredit AG und Sprecher der Geschäftsfihrung<br />
der Disko Leasing GmbH, Düsseldorf<br />
Integriertes Scoringsystem im gewerblichen Leasinggeschäft<br />
v o n D ip l. Vl|/ H ans - J o ac him Sp i t t I er, G e s c h äft sführ er der<br />
MMV Leasing GmbH, Koblenz<br />
l3<br />
51<br />
77
Vorwort<br />
Die Entwicklungsdynamik der Leasingbranche hält weiter an und scheint in der<br />
jüngsten Vergangenheit sogar noch Forcierung erfahren zu haben. Begründet liegt dies<br />
zum einen in der weiter gehenden Technisierung und Integration der Finanzmärkte mit<br />
der Folge der allgemeinen Wettbewerbsintensivierung sowie der Innovationskraft der<br />
Marktteilnehmer, die einen permanenten Prozess der Neuerung induziert. Vor dem<br />
Hintergrund dieser Entwicklungen hat auch das heute in vielen Bereichen und Branchen<br />
intensiv diskutierte ,,eBusiness" Einzug in die Leasingbranche gefunden. Aus diesem<br />
Grund wird im Rahmen des diesjährigen Forschungsbeitrags in den Mitteilungen und<br />
Berichten des Forschungsinstituts für Leasing an der Universität zu Köln der Einsatz<br />
modemer Informations- und Kommunikationsmedien bei Leasinggesellschaften als<br />
Thematik besonders hervorsehoben.<br />
Unter meiner Leitung hat das Forschungsinstitut für Leasing an der Universität zu Köln,<br />
das der betriebswirtschaftlichen Leasingforschung in Deutschland nunmehr seit<br />
siebzehn Jahren einen institutionellen Rahmen gibt, die Ergebnisse der Forschungsarbeit<br />
in regelmäßigen Abständen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zu diesem Zweck<br />
erschienen erstmals im Jahre 1986 die ,,Mitteilungen und Berichte des<br />
Forschungsinstituts fi.ir Leasing an der Universität zu KöIn". Seitdem ist eine breite<br />
Vielfalt an Forschungsergebnissen mit Leasingbezug im Rahmen der - bis zum heutigen<br />
Tag 29 - veröffentlichten ,,MuBs" thematisiert worden. Da ich mein Amt als Direktor<br />
des Instituts zum Jahresende 2001 beenden muss, stellt die 30. Ausgabe der<br />
,,Mitteilungen und Berichte" die letzte Veröffentlichung unter diesem Namen dar,<br />
zumindest in Verbindung mit dem Forschungsinstitut fiir Leasing an der Universität zu<br />
Köln.<br />
Zugleich verabschiede ich mich hiermit von den Freunden und Förderern unserer<br />
Institutsarbeit und bedanke mich herzlich für das Interesse, das uns von vielen Seiten<br />
und immer wieder zugetragen wurde, sowie fiir die Förderung unserer<br />
wissenschaftlichen Arbeit, die über die vielen Jahre hinweg der betriebswirtschaftlichen<br />
Forschung und Lehre zu Gute gekommen ist.<br />
Köln, im Oktober 2001 Prof. Dr. Hans E. Büschsen
Tätigkeitsbericht<br />
des Forschungsinstituts<br />
für Leasing<br />
an der Universität zu Köln für den Berichtszeitraum<br />
l. Leasingforschung<br />
1999t2000<br />
von Prof. Dr. Hans E. Büschsen<br />
Im Rückblick auf die Institutstätigkeit ist auch in diesem Berichtszeitraum eine große<br />
inhaltliche Bandbreite der leasingspezifischen Fragestellungen, die im Mittelpunkt der<br />
wissenschaftlichen Arbeit des Leasinginstituts standen, festzustellen. Die wichtigsten<br />
Inhalte dieses vielftiltigen Spektrums sollen im Folgenden kurz skizziertwerden.<br />
Ein primär wissenschaftshistorisch ausgerichtetes Forschungsprojekt, das im<br />
Berichtszeitraum 199811999 eingeleitet wurde, war die Darstellung des Leasing in der<br />
Betriebswirtschaftslehre seit der Markteinführung dieser Finanzdienstleistung in den<br />
sechziger Jahren. Ziel dieses Projektes war es unter anderem, die wichtigsten<br />
Ergebnisse der bisherigen betriebswirtschaftlichen Leasingforschung inhaltlich<br />
zusammenzustellen, um auf diese Weise den Stand der wissenschaftlichen Diskussion<br />
des Leasing zu dokumentieren. Der Forschungsgegenstand<br />
,,Leasing" wurde zu diesem<br />
Zweck unter Zuhilfenahme entscheidungsorientierter sowie institutionenökonomischer<br />
Ansätze von unterschiedlichen betriebs-wirtschaftlichen Perspektiven her beleuchtet.<br />
Die Ergebnisse haben gezeigt, dass einerseits zwar Fragen der Vorteilhaftigkeit des<br />
Leasing gegenüber anderen Finanzierungsalternativen<br />
sowie die Problematik der<br />
steuerlichen Konsequenzen von Leasingfinanzierungen mittlerweile als geklärt<br />
angesehen werden können, die betriebswirtschaftliche Analyse des Leasing unter<br />
institutionenökonomischen Gesichtspunkten jedoch erst in ihren Anftingen steht. So<br />
sind die Intermediärsfunktionen, die Leasinggesellschaften erfüllen, sowie die daraus<br />
resultierenden Transaktionskosteneffekte<br />
bislang kaum erforscht und sollen unter<br />
kognitiven Gesichtspunkten<br />
sicherlich noch interessante<br />
Forschungsergebnisse<br />
erwarten
6<br />
lassen. Im Einzelnen wurden die Resultate dieses Forschungsprojekts lnteressenten in<br />
zwei publikationen zugänglich gemacht. Da in den Publikationen unter anderem im<br />
Kontext der Institutionalisierung betriebs-wirtschaftlicher Leasingforschung auf das<br />
Beispiel des Forschungsinstituts für Leasing an der Universität zu Köln verwiesen<br />
wurde" übernahmen diese Veröffentlichungen zugleich Funktionen im Rahmen der<br />
Öffentl i c hke itsarbe it.<br />
Gegenstand der Institutsarbeit war außerdem die kornplette Überarbeitung und<br />
Neuauflage der Leasing-Bibliographie, die nunmehr weit über 4.000 Literaturquellen<br />
zum Thema Leasilg lach verschiedenen Stichworten geordnet umfasst. Im Gegensatz<br />
zv früheren Exemplaren der Leasin-g-Bibliographie, die in einem ersten Band<br />
leasingrclevante Veröffentlichungen bis Ende 1995 und in einem zweiten Band<br />
Ergänzulgcn für die Jahre 1995, 1996 und 1997 beinhalten. stellt die diesjährige<br />
Neuauflage ein umfassendes Gesamtwerk dar, das Quellen von 1966 bis einschließlich<br />
April 2000 abdeckt. Des Weiteren wurde in dieser Auflage neben deutschsprachiger<br />
Literatur auch eine geu,isse Anzahl leasingrelevanter englischsprachiger Publikationen<br />
miteinbezogen. Bei der Erstellung der Leasing-Bibliographie wurde auch weiterhin auf<br />
Grund des mittlerweile sehr umfängreichen leasingspezifischen Schrifttums auf ein<br />
alphabetisches Register verzichtet. Da zugleich aber die Gliederung, nach der den<br />
einzelnen Literaturquellen Themenschu'erpunkte zugeordnet werden, weiter verfeinert<br />
worden ist, kann davon ausgegangen r.verden. dass die'Bibliographie ihre Funktion als<br />
umfassender und praktischer Führer durch die Leasingliteratur auch weiterhin erflillen<br />
kann. Dieses Projekt war auf Grund seines Umfängs und zu'ecks weitgehender<br />
Sicherstellung der Vollständigkeit der angegebenen Quellen mit einem entsprechend<br />
großen personellen sowie zeitlichen Aufwand verbunden, der sich aber angesichts<br />
dessen. dass die Leasing-Bibliographie sich in der Öffentlichkeit wachsender<br />
Beliebtheit erfreut, m.E. gelohnt hat. Die Leasing-Bibliographie ist in gebundener Form<br />
als ,,Mitteilungen und Berichte" Nr. 29 unseren Mitgliedern kostenlos zugeschickt<br />
worden. Nichtmitglieder können diesen Band zu einem Kostenbeitrag von DM 65,- an<br />
unserem Institut erwerben. Darüber hinaus wird mit großer Resonanz weiterhin eine<br />
Diskettenversion angeboten, die neben der vorhandenen thematischen Sortierung der<br />
euellen zudem anderweitige Sortierungen, z.B. eine alphabetische Sortierung oder eine<br />
Sorlierung nach Erscheinungsdatum, ermöglicht.
Bereits im vorigen Jahr habe ich die zunehmende Bedeutung ertragsorientierter<br />
Planungs- und Kontrollsysteme für Leasinggesellschaften angesprochen. Ein weiterer<br />
Teil der Forschung bezog sich daher auch in diesem Jahr auf die besonderen Probleme<br />
im Rahmen der Gestaltung leasingspezifischer Controlling-Systeme und der Integration<br />
von auf die speziellen Belange des Leasinggeschäfts zugeschnittenen Controlling-<br />
Konzepten. Zwar fanden sich bislang bereits Arbeiten, die sich mit Teilaspekten dieses<br />
Themenkomplexes beschäftigten; an einer geschlossenen, leasingspezifischen<br />
Darstellung fehlte es jedoch. Dieses Defizit ist nun beglichen worden. Herr Dr. Marcus<br />
Albrecht, ehemaliger Mitarbeiter am Forschungsinstitut ftir Leasing, hat im Oktober<br />
seine Dissertation mit dem Titel ,,Controlling als markt- und erfolgsorientiertes<br />
Steuerungskonzept für Leasinggesellschaften" im Rahmen der Schriftenreihe ,,Leasing-<br />
Studien", die von Herrn Feinen und mir herausgegeben wird, veröffentlicht.<br />
Ein weiterer Schwerpunkt der Institutsarbeit lag während des Berichtszeitraumes auf<br />
einer empirischen Untersuchung der Leasingbranche. In Zusammenarbeit mit der<br />
Beratungsgesellschaft Heidrick & Struggles ülder & Partner<br />
- eines der flihrenden Untemehmen auf dem Gebiet der Top-Management-Beratung -<br />
haben wir einen Fragebogen ausgearbeitet, der die Basis für eine Erhebung über die<br />
Erwartungen der Leasingbranche hinsichtlich der zukünftigen Markt- und<br />
Branchenentwicklung darstellte. Grundlage ftir die Entwicklung des Fragebogens war<br />
eine umfassende Bestandsaufnahme aktueller Entwicklungstrends im Leasingbereich<br />
durch die Mitarbeiter des Forschungsinstituts. Der Erhebungsbogen wurde an alle<br />
deutschen Leasinggesellschaften mit Marktbedeutung versandt und die Ergebnisse der<br />
Auswertung sowie deren ausführliche Kommentierung im Rahmen einer Studie mit dem<br />
Titel ,,Leasingwirtschaft vor dem Strukturwandel" dargestellt. Ich möchte mich an<br />
dieser Stelle noch einmal herzlich für Ihre Mühe bei der Beantwortung der Fragebögen,<br />
die sich in der hohen Rücklaufquote wiederspiegelte, bedanken.<br />
Angesichts der aktuell zu verzeichnenden Umfeldentwicklungen des Leasing-geschäfts,<br />
die schlagwortartig mit zunehmender Komplexität und Veränderungsdynamik des<br />
Marktumfeldes und insbesondere des Kundenverhaltens charakterisiert werden können<br />
- eine Entwicklung, die nicht zuletzt durch technologische Fortschritte auch zukünftig<br />
weiter verstärkt werden dürfte - avanciert der Einsatz moderner Informations- und<br />
Kommunikationsmedien im Rahmen von eusiness-Strategien zu einem kritischen<br />
Erfolgsfaktor im Wettbewerb unter Leasinggesellschaften. Es hat sich gezeigt, dass die
ö<br />
deutsche. aber auch die internationale Leasingbranche nur unzureichend Antworten auf<br />
die Probleme und Herausfordenrngen der ,,New Economy" (hierunter verstehe ich in<br />
einer weiten Fassung die Unterstützung ökonomischer Prozesse durch die neuen<br />
Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologie) gefunden hat.<br />
Natürlich kann eine wissenschaftliche Untersuchung wettbewerbsstrategischer Aspekte<br />
nicht allein auf theoretischer Basis erfolgen. Vor dem Hintergrund des praktischen<br />
Wissenschaftszieles. das unbestreitbar irn Mittelpunkt steht, ist eine empirische<br />
Fundierung der aufgestellten bzw. zugrunde gelegten Hypothesen über die Entwicklung<br />
des Einsatzes moderner Kommunikations- und Informationstechnologien in der<br />
Leasingbranche von entscheidender Bedeutung flir die Realitätsnähe und die praktische<br />
Verwendbarkeit der abgeleiteten Aussagen. Ziel dieses empirisch basierten<br />
Forschungsprojekts ist es daher, Entwicklungen und Trends festzumachen sowie<br />
mögliche leasingspezifische Problemfelder und Barrieren aufzuzeigen und auf dieser<br />
Basis geeignete Strategieempfehlungen ftir Leasinggesellschaften abzuleiten. Die<br />
Ergebnisse dieser Untersuchung werden voraussichtlich im kommenden Jahr unter<br />
anderem in den ..Mitteilungen und Berichten" veröffentlicht.<br />
)<br />
a)<br />
Veröffentlichu n gen u nd Öffentlich keitsarb eit<br />
Veröffentlichungen<br />
Büschgen, Hans E: Leasing als Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre, in: Leasing-<br />
Handbuch ftir die betriebliche Praxis, hrsg. von Wolfram Eckstein und Klaus Feinen. 7.<br />
Auflage, Frankfurt am Main 2000, 5.251-274.<br />
Büschgen, Huns E : Leasingwirtschaft vor dem Strukturwandel - Tendenzen und<br />
Perspektiven für Märkte, Unternehmen und Führungskräfte, hrsg. von Heidrick &<br />
Struggles/Mülder & Partner, München 2000.<br />
Büschgen, Hsns E : Die Entwicklung des Leasing als wissenschaftliche Disziplin, in:<br />
Der Langfristige Kredit, 5 l. Jg., H. 22, S. 784-187 .<br />
Büschgen, Hans E : Kreditprüfung, in: Handwörterbuch der Rechnungslegung und<br />
Prüfung, hrsg. von Wolfgang Ballwieser, Adolf G. Coenenberg und Klaus v. Wysocki,
3. Auflage, Schäffer-Poeschl Verlag (Veröffentlichung erfolgt nach Auskunft des<br />
Verlags im i. Halbjahr 2001)<br />
Büschgen, Hans E : Ökoleasing, in: Lexikon nachhaltiges Wirtschaften, Oldenbourg<br />
Verlag (Veröffentlichung erfolgt nach Auskunft des Verlages voraussichtlich im 1.<br />
Quartal200l)<br />
Büschgen, Hans E (Hrsg.): Mitteilungen und Berichte des Forschungsinstituts für<br />
Leasing an der Universität zu Köln, Nr. 29 (2000), Leasing-Bibliographie.<br />
Albrecht, M.: Controlling als markt- und erfolgsorientiertes Steuerungskonzept filr<br />
Leasins-Gesellschaften. Wiesbaden 2000.<br />
b) Sonstige Offentlichkeitsarbeit<br />
Auch in diesem Berichtszeitraum deutet die Vielzahl von Anfragen und<br />
Auskunftsersuchen sowohl von Seiten der Leasingpraxis als auch von Seiten der<br />
Studierenden an meine Mitarbeiter und mich auf einen hohen Bekanntheitsgrad hin. Die<br />
geleistete Hilfestellung erfolgte in Form von Literaturhinweisen wie auch geführten<br />
Gesprächen. Hierbei ist erfreulicherweise auch weiterhin eine Zunahme der Anzahl von<br />
Auskunftsersuchen der Studenten, die an anderen Universitäten und Fachhochschulen<br />
mit der Erstellung leasingspezifischer Seminar- oder Diplomarbeiten befasst sind und<br />
im Forschungsinstitut für Leasing eine zentrale Anlaufstelle sehen, zu verzeichnen.<br />
Aber auch hinsichtlich der Zahl fachlicher Anfragen, die von Institutionen außerhalb<br />
des Hochschulbereichs an das Institut gerichtet wurden, insbesondere von<br />
Leasinggesellschaften, Anwaltskanzleien, Journalisten und Unternehmensberatungen,<br />
ist für den Berichtszeitraum eine deutliche Zunahme zu konstatieren. Hier konnte das<br />
Institut in zahlreichen Beratungsgesprächen fundierte fachliche Hilfestellung sowie<br />
einen wichtigen Beitrag zur Steigerung des Verständnisses und der Akzeptanz des<br />
Leasing in der Öffentlichkeit leisten.<br />
Den hohen Bekanntheitsgrad hat unser Forschungsinstitut neben den vielftiltigen<br />
Veröffentlichungen vor allem seiner Präsenz im Internet zu verdanken. Unser<br />
Intemetauftritt ist Anfang des Jahres neu überarbeitet worden und wird seitdem in<br />
regelmäßigen Abständen aktualisiert. Unter der Adresse http://www.uni-
10<br />
koeln.de/leasing sind Erläuterungen der institutsspezifischen Konzeption sowie eine<br />
Vorstellung der Redaktion zu finden. Zudem ermöglicht unsere Intemetpräsenz die<br />
Onlinebestellung der Leasing-Bibliographie und anderer Mitteilungen und Berichte, den<br />
direkten Zugriff auf eine Auswahl bereits veröffentlichter Mitteilungen und Berichte,<br />
die im Volltext (im <strong>PDF</strong>-Format) geöffnet und gelesen werden können, sowie die<br />
unmittelbare Kontaktaufnahme mit dem Institut, was sich in dem Anstieg der Anfragen<br />
an unser Institut wiederspiegelt.<br />
Wie bereits in den Vorjahren möchte ich aber an dieser Stelle nochmals darauf<br />
hinweisen, dass das Leasinginstitut, soweit dies im Rahmen seiner Möglichkeiten liegt,<br />
den Mitgliedern des Förderkreises in allen betriebswirtschaftlichen Fragen gern zur<br />
Verfügung steht. dass es hierbei jedoch nicht die Aufgabe eines Unternehmensberaters<br />
wahrnehmen kann. Diese Feststellung gilt um so mehr flir Anfragen von<br />
Beratungsgesellschaften. die das Forschungsinstitut während des Berichtsjahres im<br />
Zusammenhang der Entwicklung leasingspezifischer Konzepte fiir ihre Mandanten<br />
mehrfach kontaktiert haben. Natürlich sind auch in solchen Fällen die Mitarbeiter<br />
grundsätzlich zv Gesprächen bereit; gteichwohl erscheint mir mit Blick auf<br />
Beratungsunternehmen und andere erwerbswirtschaftlich tätige Unternehmen, die<br />
Leistungen des Forschungsinstituts in Anspruch nehmen und ihrerseits die von ihnen<br />
geleistete Arbeit den Mandanten in Rechnung stellen, der Hinweis gestattet, dass<br />
Spenden an den Verein zur Förderung des Forschungsinstituts, das grundsätzlich keine<br />
Rechnungen für geleistete Dienste stellt, durchaus erlaubt sind.<br />
3.<br />
a)<br />
Leasing und universitärer Lehrbetrieb<br />
Universitäre Rahmenbedingungen<br />
Die Studentenzahlen sind im Vergleich zu den Vorjahren relativ konstant geblieben. An<br />
der Universität zu Köln studieren nach wie vor gegenwärtig insgesamt rund 63.000<br />
Studenten, davon etwa 10.000 an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen<br />
Fakultät, 7.000 an der Juristischen und 20.000 an der Philosophischen Fakultät. Am<br />
Institut waren im vergangenen Jahr zwei wissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt: zum<br />
einen Herr Dr. Albrecht, der im }y'rärz 2000 auf Grund seiner abgeschlossenen<br />
promotion ausschied, und Frau Dipl.-Kff. Hanauer, die ihre Tätigkeit am Institut im<br />
Februar 2000 beeann. Des Weiteren sind zwei Hilfskräfte mit je acht Wochenstunden
ll<br />
tätig, deren Mitarbeit für leasingspezifrsche Aufgaben wie auch flir die<br />
Aufrechterhaltung unserer institutseigenen Bibliothek unentbehrlich sind. Die<br />
Reduktion der Anzahl an wissenschaftlichen Mitarbeitern und Hilfskräften in Relation<br />
zu den vergangenen Jahren ist auf die Entkoppelung von Bankseminar und<br />
Forschungsinstitut für Leasing zurückzuführen. Hinsichtlich der Betrauung mit und der<br />
konkreten Bearbeitung von leasingspezifischen Problemstellungen ist die personelle<br />
Besetzung im Vergleich zu vorherigen Berichtszeiträumen allerdings gleich geblieben.<br />
Weitere Mittel des Forschungsinstituts fi.ir Leasing konnten für Ersatz- und<br />
Modernisierungsinvestitionen in unserem Computerbereich wie auch für unsere - auch<br />
überregional große Bekanntheit genießende - Leasing-Bibliothek eingesetzt werden. Im<br />
vergangenen Jahr wurden fiir rund 4.500 DM Neuerscheinungen aus Institutsmitteln<br />
hierin eingestellt. An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen fiir die bereitgestellten<br />
Mittel herzlich bedanken; sie leisten einen wertvollen Beitrag zur Förderung der<br />
Forschung und Lehre. Konkret konnte die aus Mitteln des Instituts finanzierte Leasing-<br />
Bibliothek im Berichtszeitraum um 40 Exemplare erweitert werden, so dass nunmehr<br />
ein Bestand von rund 840 Quellen existiert, von denen weit mehr als die Hälfte<br />
leasingspezifische Fragestellungen thematisieren. Nicht unerwähnt bleiben sollen<br />
zudem die aus unserer Institutsarbeit erzielten Einnahmen, die als Kostenbeitrag mit der<br />
Abgabe institutseigener Veröffentlichungen erzielt werden (MuB Nr. 21 Leasingverfah-<br />
ren im Hochschulbau, MuB Nr. 29 Leasing-Bibliographie). Sie belaufen sich<br />
gegenwärtig auf fast 1.200 DM und stehen fiir die Belange des Leasinginstituts zur<br />
Verfiigung.<br />
c) Diplomarbeiten<br />
Erfreulicherweise lässt sich bei der Vergabe von Diplomarbeiten mit leasingspezifischer<br />
Themenstellung eine steigende Tendenz verzeichnen, die sich anscheinend auf die<br />
zunehmende Beliebtheit der Thematik ,,Leasing" Seitens der Studenten zurückflihren<br />
lässt. Korrespondierend mit aktuellen Fragestellungen im Finanz-dienstleistungssektor<br />
lug das Interesse der Studenten an leasingspezifischen Diplomarbeiten im<br />
Wintersemester 199912000 und im Sommersemester 2000 thematisch unter anderem im<br />
Bereich der Refinanzierung von Leasinggesellschaften, insbesondere unter dem Aspekt<br />
des Einsatzes moderner Finanzinstrumente. Daneben stießen aber auch strategische<br />
Fragen des grenzüberschreitenden Leasing und die daraus resultierenden Chancen für<br />
deutsche Leasinggesellschaften, investitionstheoretische Analysen des Leasing-
t2<br />
geschäfts sowie generell Fragen der Marktpolitik von Leasinggesellschaften bei den<br />
Studierenden auf großes lnteresse. Eine thematisch sicherlich am ungewöhnlichsten, aus<br />
wissenschaftlicher Sicht gleichwohl eine der interessantesten Arbeiten ist eine<br />
Diplomarbeit zum Thema Venture Leasing. Diese Diplomarbeit ist von unserem Institut<br />
in Zusammenarbeit mit Siemens Financial Services in München vergeben worden und<br />
ist zu Zeit noch in Bearbeitung. Ebenfalls noch in Bearbeitung ist eine Diplomarbeit im<br />
Bereich des institutionellen Wohnungsbaus, deren Themenvergabe mit der<br />
Unterstützung von Herm Feinen erfolgt ist und die interessante Ergebnisse erwafien<br />
lässt. Im Zusammenhang mit leasingspezifischen Diplomarbeiten möchte ich wiederholt<br />
auf die grundsätzliche Problematik aufmerksam machen, dass die Arbeiten bereits<br />
während der Bearbeitungsphase aufgrund sich ändernder Rahmenbedingungen schnell<br />
an Aktualität verlieren können. Deshalb möchte ich hier nochmals an die Praxis appel-<br />
lieren. meinen Mitarbeitern oder mir aufkommende Entwicklungen, die von nicht<br />
unmittelbar in das Marktgeschehen Involvierten nur mit zeitlicher Verzögerung erkannt<br />
werden können. mitzuteilen, damit auf dieser Basis eine möglichst auch den<br />
Praktikerbelangen gerecht werdende Leasingforschung betrieben werden kann. Diese<br />
Aufforderung bezieht sich selbstverständlich nicht nur auf Fragen des internationalen<br />
Leasing, sondern auch auf weitere, von der Praxis als relevant erachtete Themenkreise.<br />
4. Verschiedenes<br />
Abschließend möchte ich auf eine bereits erwähnte personelle Veränderung hinwersen:<br />
Anfang des Jahres hat sich Herr Dr. Marcus Albrecht, der seit 1998 ftir das<br />
Forschungsinstitut tätig war, neuen Aufgaben in der Unternehmenspraxis zugewandt.<br />
Den Aufgabenbereich der geschäftsführenden Assistentin nimmt seither Frau Dipl.-Kff.<br />
Patricia Hanauer wahr, die Ihnen - wie gewohnt - in allen das Institut sowie die<br />
Institutsarbeit betreffenden Fragen sowie selbstverständlich auch als Ansprechpartnerin<br />
in fachlicher Hinsicht zur Verfiigung steht. Beiden möchte ich in diesem<br />
Zusammenhang für ihre im Interesse des Forschungsinstituts fiir Leasing stehende<br />
Arbeit danken; ihre Unterstützung war mir in diesem Berichtszeitraum unentbehrlich.<br />
Nicht zuletzt gilt mein ganz besonderer Dank natürlich allen Mitgliedern des<br />
Fördervereins für die Unterstützung unserer Arbeit in Forschung und Lehre.
Vorwort<br />
l3<br />
Der Einsatz moderner Informations- und<br />
Kommunikationsmedien bei Leasinggesellschaften<br />
1. Zielsetzung der Umfrage<br />
- Das Internet als Chance und Herausforderung -<br />
(Ergebnisse einer Umfrage)<br />
von Prof. Dr. Hans E. Büscheen<br />
2. Charakteristik der Teilnehmer der Untersuchung<br />
3. Status quo der Nutzung moderner Informations- und Kommunikationsmedien durch<br />
Leas ingge s e I I s chaften<br />
3.1. Präsentation im Internet<br />
3.2. Nutzung von eBusiness-Anwendungen im Vertrieb<br />
3.3. Nutzung von eBusiness-Anwendungen in der Beschaffung<br />
3.4.Integration von Datenverwaltungs- und -verarbeitungssystemen im Rahmen der<br />
Nutzung von eBusiness-Anwendungen<br />
3.5. Bewertung des derzeitigen Entwicklungsstandes<br />
4. Hinderungsfaktoren der Implementierung von eBusiness-Lösungen<br />
4.l.Interne Faktoren<br />
4.1.1. Die Unternehmensgröße<br />
4.1.1. Das Leasingobjekt<br />
4.1.1. Die Beziehung zum Hersteller<br />
4.2.Externe Faktoren<br />
5. Optimierungspotenziale und Ausblick<br />
Anhang<br />
Literaturverzeichnis
I4<br />
Der Ein satz moderner Informations- und Kommunikationsmedien<br />
1. Vorwort<br />
bei Leasinggesellschaften<br />
Das Internet als Chance und Herausforderung<br />
(Ergebnisse einer Umfrage)<br />
von Prof. Dr. Hans E. Büscheen<br />
Vor dem Hintergrund des technologieinduzierten Wandels. der in den letzten Jahren auch nicht<br />
technikaffine Unternehmen und Branchen erreicht hat, ist auch die Leasingbranche zahlreichen<br />
Veränderungsprozessen ausgesetzt. Neben einer allgemeinen Globalisierungstendenz haben<br />
insbesondere das Aufkommen, die schnelle Verbreitung und der zunehmende Gebrauch<br />
moderner lnformations- und Kornmunikationsmedien zu weit reichenden unternehmensinternen<br />
und -externen Neuerungen flir Leasinggesellschaften gefiihrt. Diesen neuen Rahmenbedingungen<br />
ist vor allem das Eindringen ausländischer Wettbewerber in den deutschen Markt r.rnd das<br />
zunehmende Auftreten von Non- oder Nearbanks, die mittlerweile ihr Angebot auch auf das<br />
Leasing- und Finanzierungsgeschäft ausweiten, zuzuschreiben. lnsbesondere itn Massengeschäft<br />
äußern sich diese Zusammenhänge in einem vermehfien Druck auf Leasinggesellschafien. ihr<br />
Preis- und somit KostenniveaLt zu senken. Gleichzeitig sehen sich Leasinggesellschaften auf<br />
Grund der hohen Produkt- und Markenhomogenität sowie etner relativ niedrigen<br />
Kundenloyalität gezwungen, ihr Angebot positiv von dem der Konkurrenz abzuheben. Somit<br />
verlangt der immer stärkere Wettbewerb im Bereich Leasing nach innovativen eBusiness-<br />
Lösungen, um neue Kunden zu gewinnen, vothandene zu halten und dabei noch Kosten<br />
einzusparen. Zudem ist durch den Einsatz von Internet und eMail eine zunehmende<br />
Konditionentransparen z zu erwarten, die zusätzlich zum bereits intensivierten<br />
Wettbewerbsumfeld die Preise und Margen der Leasinganbieter drückt. Die Befürchtung, dass<br />
eine solche ,,Innovations- und Margenspirale" eher negative als positive Auswirkungen auf die<br />
Leasingbranche haben könnte, kann möglicherweise ursächlich für eine zurückhaltende<br />
Einstellung von Leasinggesellschaften bezüglich des extensiven Einsatzes modemer<br />
Informations- und Kommunikationsmedien sein.
15<br />
Neben dem bereits heute spürbar verstärkten Wettbewerbsumfeld in der Leasingbranche sind in<br />
der näheren Zukunft für Leasinggesellschaften weitere Veränderungen auch durch die geplante<br />
Einführung neuer verschärftet Eigenkapitalerfordernisse für Banken, die aus dem als ,,Basel II"<br />
bekannten Regelwerk entspringen, abzusehen. Eine solche Neuregelung, wie sie momentan mit<br />
ihrem Für und Wider zur Diskussion steht, könnte zu deutlichen Umstrukturierungen im<br />
deutschen Finanzwesen und insbesondere im Bankwesen führen. Dabei wird bereits eine<br />
Entwicklung zugunsten der Leasingbranche prophezeit, indem auf Grund der neuen Regelungen<br />
durch Basel II im Mengengeschäft eine Verlagenrng von der Kreditfinanzierung der Banken hin<br />
zur Finanzierung durch Leasingkonstruktionen erwartet wird. Dieser Chance, neue<br />
- ursprünglich dem traditionellen Kreditgeschäft angestammte - Kunden zu akquirieren, müssen<br />
Leasinggesellschaften frtihzeitig mit einem geeigneten strategischen Ansatz begegnen. Der<br />
primäre Fokus sollte hierbei auf ein offensives Marketing und einen erstklassigen Kundenservice<br />
gelegt werden, der eine Kundenakquisition und -bindung nachhaltig unterstützt. Für beides ist<br />
heutzutage der Einsatz moderner Informations- und Kommunikationsmedien unerlässlich, sodass<br />
auch dieser voraussichtliche Trend die Anwendung geeigneter eBusines-Anwendungen forciert.<br />
Vor allem der Faktor,,Time-to-Market" spielt bei der Implementierung von eBusiness-Lösungen<br />
eine herausragende Rolle. Ein Unternehmen, das frühzeitig Engagement hinsichtlich neuartiger<br />
eBusiness-Anwendungen zeigt, zeugt von Innovationskraft und Marktvision und kann sich -<br />
unter der Prämisse, dass diese Anwendungen entsprechenden Qualitätsstandards genügen - einen<br />
bedeutenden Wettbewerbsvorsprung bei der Akquisition neuer Kundschaft sichern. Daher sollte<br />
der Faktor der neuen technologischen Möglichkeiten im Rahmen der Kommunikation und<br />
Information bei der strategischen Planung von Leasinggesellschaften nicht vernachlässigt<br />
werden.<br />
In den letzten Jahren konnte ein vermehrtes Engagement von Finanzdienstleistern nicht nur bei<br />
der Unternehmenspräsentation im World Wide Web (WWW), sondern auch bei der Abwicklung<br />
von Geschäften über das Internet und andere elektronische Wege verzeichnet werden. Eine<br />
solche Hinwendung zu dem, was heute unter dem Begriff ,,eBusiness" weithin diskutiert wird,<br />
scheint insbesondere von Banken und Versicherungen vorangetrieben zu werden, seitens der<br />
Leasingbranche aber zunächst nur mit großer Zurückhaltung zu erfolgen. Diese Tatsache mag zu<br />
einem großen Teil in der Untauglichkeit bestimmter Objekte für eine Vermarktung und einen<br />
Abschluss von Leasingverträgen per Internet und eMail begründet liegen; sie bietet aber keine<br />
Erklärung dafür, warum für Leasingobjekte, die die Anforderungen fi.ir einen Vertrieb über das<br />
Internet (nämlich Standardisierung und geringer/mittlerer Anschaffungswert) erfüllen, bis auf<br />
wenige Ausnahmen offenbar keine Forcierung des eBusiness seitens deutscher
16<br />
Leasinggesellschaften erfolgt. Mögliche Begründungen können in der fehlenden Kenntnis über<br />
Einsatzmöglichkeiten und Chancen, der (noch) unzureichenden Sicherheit bei der Übertragung<br />
von Daten auf elektronischem Wege und der - bereits angesprochenen - Besorgnis über<br />
Konditionentransparenz und/oder einen Verlust an Kundenbindung gesucht werden. Vor dem<br />
Hintergrund dieser Überlegungen ist durch das Forschungsinstitut für Leasing an der Universität<br />
zLr Köln eine Umfrage bezüglich des Einsatzes modetner Informations- und<br />
Kommunikationsmedien durchgeführt worden, um den aktuellen Status quo hinsichtlich der<br />
Nutzung moderner Medien sowie die Einstellung der Leasingbranche zur Einbindung des<br />
lnternet in Verlrieb, Administration und Beschaffung näherungsweise abbilden zr können. Für<br />
ihre erhebliche Mitarbeit bei Konzipierung, Durchführung und Auswertung unserer Befragung<br />
danke ich vor allem meiner Mitarbeiterin" Frau Dipl.-Kff. Patricia Hanauer.<br />
2. Zielsetzung der Umfrage<br />
Ziel der Befragung ist es, einen Überblick darüber zr erhalten. inwieweit deutsche<br />
Leasinggesellschaften das Intemet bereits in ihre Wertschöpfungskette integrierl haben und wie<br />
die diesbezügliche strategische Ausrichtung und Planung für die kommenden Jahre aussieht.<br />
Neben einem generellen Vergleich der Leasingbranche mit verwandten Finanzdienstleistern wird<br />
der Rücklauf der Befragungsunterlagen dabei . schwetpunktmäßig nach zwer<br />
Differenzierungsrnerkmalen ausgewertel. Ztm einen wird branchenintem nach dcr<br />
Unternehmensgröße unterschieden, url vor dem Hintergrund der steigenden Bedeutung des<br />
Internet auch frir kleine und mittelgroße Leasinggesellschaften größenabhängige Unterschiede in<br />
der Implementierung von eBusiness-Strategien zu identifizieren. Nachdem eBusiness noch stets<br />
als Domäne der großen Unternehmen gesehen wird, soll mit Hilfe der Auswertungen untersucht<br />
werden, inwieweit kleine und mittelgroße Unternehmen die Chancen des eBusiness erkannt<br />
haben und an der Entwicklung teilhaben. Zum anderen wird ein Vergleich zwischen<br />
herstellerabhängigen und herstellerunabhängigen Leasinggesellschaften durchgeführt, um<br />
herauszuarbeiten, ob es hinsichtlich des Befragungsgegenstandes Unterschiede zwischen diesen<br />
beiden Formen des Leasinggeschäfts gibt. Darüber hinaus werden Verbessetungspotenziale, die<br />
durch den Einsatz von eBusiness-Anwendungen eneicht werden können, sowie mögliche<br />
Problemfelder bei der Einflihrune beleuchtet.
3. Charakteristik der Teilnehmer der Untersuchung<br />
Die empirische Grundlage der Untersuchung bildet die schriftliche Befragung der Vorstände und<br />
Geschäftsfiihrer deutscher Leasinggesellschaften. Es wurden insgesarnt 210<br />
Leasinggesellschaften angeschrieben, wobei sowohl auf die Mitgliederbasis des Bundesverbands<br />
Deutscher Leasinggesellschaften (BDL) als auch auf die des Interessenverbands Deutscher<br />
Leasinggesellschaften (tDL) zurückgegriffen wurde. Hieraus ergibt sich. dass 56% aller<br />
angeschriebenen Unternehmen dem BDL und 44oÄ dem IDL angehören.' Zwar -gingcn rund 85<br />
Antworten ein; da aber einige Leasinggesellschaften erklärten. dass sie auf Grund ihrer<br />
institutionellen oder geschäftlichen Struktur nicht in der Lage seien. den Fragebogen in<br />
sinnvoller Weise auszuflillen. konnten insgesamt nur 75 Antwoficn ausgewertet u'erden. Die<br />
Quote r.erwertbarer Antworten beträgt sotnit insqesatnt 369/0. u'as sowohl irn Vergleich zr-t<br />
f-rtiheren Umfiagen des Forschungsinstituts für Leasing als auch im Vergleich ztt anderen<br />
Umfragen in dcr Branche eine bernerkenswert hohe Rücklaufquote darstellt. Die Rticksendung<br />
der Fragebögen teilweise in anonymer Form lässt allerdings keinen Rückschluss darliber zu.<br />
wieviele der Antworten auf Leasinggesellschaften mit BDl-Mitgliedschaft und wieviele auf<br />
Leasing-eesellschaften mit IDL-Mitgliedschaft entfallen. Ich danke allen antwortenden<br />
Leasinggesellschaften für ihre Mitu'irkung an Llnserer Umfi'age.<br />
Hinsichtlich der Untemehrnensstmktur verteilt sich der Rücklauf zu etwa gleichen Teilen auf<br />
konzerngebundene Lurd nichtkonzerngebuudene Leasinggeseilschaften. So gehört circa die Hälftc<br />
der an der Umfi'age teilnehmenden Leasinggesellschaften einem Konzern an, währeud die andere<br />
Hältte angibt. jeweils als selbstständige bzw. konzern-unabhän-eige Gesellschaft zu agicren. Des<br />
Weiteren bef-rnden sich nur l1% der Untemehtnen in einet'vom Flersteller der Lcasingobjekte<br />
abhängigen Relation; 899/o stellen<br />
herstellerunabhängige Leasing-<br />
gesellschaften dar. Einen<br />
repräsentativen Querschnitt der<br />
deutschen Leasingwirtschaft zeigt<br />
auch die Verleilung der<br />
Untemehrnensgrößen. Gemessen<br />
am jährlichen Geschäftsvolumen<br />
weist das Durchschnitts-<br />
geschäftsvolumen einen Wert von<br />
'<br />
Mögliche Doppelmitgliedschaften bleiben hierbei unbenicksichtigt.<br />
Abb. 1: Anzahl der Mitarbeiter
t8<br />
circa € 450 Mio. auf. Das Geschäftsvolumen der Unternehtnen verteilt stch dabei auf eine<br />
Bandbreite mit einem Minirnurn von € 92.000 und einctn Maximutn von € 7.5 Mrd.. Auch<br />
anhand der Mitarbeiterzahl n'ird clie Größenordnung der befiagten Unternehmen rcf-lektiert. So<br />
sind rnittelgroße r-rnd große Leasinggesellschaften nahezu zr"r gleiche'n Teilen r,'ertreten f ervcils<br />
l8% fiir Unternehmen rnit 100 bis 300 Mitarbcitern und l5?i, ftr Untemehmen mit mehr als 300<br />
Mitarbeitern), während kleine Leasinggesellschaften rrit unter 50 Mitarbcitern atn stärksten<br />
repräsentierl sind (64%) und Gesellschafien rnit Mitabeitcrzahlen zrvischen 50 und 100 in der<br />
Umfrage einen vernachlässigbar klcinen AntciI einnehmen (3u"o).<br />
Vor clem Hintergruncl, dass die Machbarkeit der Einbindr.rng des Internet sowohl in dcn Vertrieb<br />
als auch in administrative Aufgabcn unter anderern stark von dctn verleastcn Objekt abhlin-eig zu<br />
sein scheint, kommt der Objektart inr Rahmen der Urnfiage eine besondere Bedeutr,rng zu. Auf<br />
Grund dessen war es Ltnter anderem ein Zicl der Befiagung. rnit Hilfc detaillierter.<br />
leasingobjektbezogener Fragcn relativ exakt das Produrktsortinrent der teilnehmenden<br />
Leasinggesellschaften abbilden zu können. Im Ergebnis erbringt die Urnfiage. dass alle befiagten<br />
Untemehmen Mobilien verleasen. u,obci nur jecle zehntc Leasiu-r{-ucsellschafi angibt. sowohl irn<br />
hnrnobilien- als auch im Mobilienleasing tätig zlr sein. Die Ausu'crtung zei-ut fetrier. dass nach<br />
wie vor clas Lcasing irn Transportmittelbereich stark übenviegt (siehe Abb. 2)1. Die Tatsache.<br />
dass das Leasing von Hard- uncl Sofir,varekompouentcn nahezu mit detn Lcasing von Maschinen<br />
gleichzieht. reflektiert die zunehmende Bedeutung von und Nachfiage nach elektrot.tischcn<br />
Datenver-arbeitun-ussystencn. vol.l deren sehr kurzen' Halbu'ertzeiten das Leasing - als<br />
Alternative zum Kauf - profitiert. Des Weiteren ist -uut cin Dnttel aller befragten Unternehtnen<br />
nicht auf bestirnmte Mobilien spezialisiert. sondern verleast Mobilien jeglicher Art.<br />
r<br />
Grundsätzlich ist bci den fblgcnden Darstellungen der Ergebnisse zu berücksichtigen. dass au1' Gruncl der<br />
Mäglichkeit r.,on Mehrfachnennungcn bei cinigen Fragen die Sumrne pro Kritcriurn mehr als 1000,ir bctragen kanu.
1 00%<br />
90',;<br />
80".<br />
70.i<br />
609b<br />
50','.<br />
40e;<br />
30"/;<br />
20q.<br />
1 09.<br />
0..<br />
19<br />
Abb. 2: Verleaste Objekte<br />
sonst. Transpodm ttel<br />
Schiffe<br />
Bahnen<br />
Transportmittel<br />
Flugzeuge<br />
Büromaschinen<br />
Baumaschinen<br />
sonst. l\,4obilien<br />
Die Verteilung der Leasingobjekte spiegelt sich unmittelbar in dem durchschnittlichcn<br />
Anschaffungswert wieder. Da die bei Weiterl alr ueisten verleasten Mobilien PKW und<br />
Hardware sind. ist es nicht überraschend. dass der durchschnittliche Neupreis von<br />
Leasingobjekten zwischen DM 10.000 und DM 150.000 liegt. So rveisen über zwei Drittel aller<br />
Leasingobjekte einen Anschaflirnqswefi innerhalb dieser Preisgrenzen auf-. Jedes fünfte<br />
Leasingobjekt kostet bei der Anschaffüng zwischen DM 150.000 und DM 1 Mio.. und irnmerhin<br />
jedes zehnte kostet mehr als DM I Mio., sodass innerhalb der Umti'age auch das Big-Ticket-<br />
Leasing gut repräsentiert ist. Unter einen AnschafTungsn'ert von DM 10.000 1?illt hingegen nllr<br />
loÄ aller Leasingobjekte. Auf Grund dieser geringen Prozentzahl lässt sich schlussfolgern. dass<br />
es sich beirn Leasing von Softrvarc und Büromaschinen (da diese die beiden einzigen<br />
signifikanten Mobilienarten mit einem<br />
möglichen Neupreis von Lrnter DM<br />
10.000 sind) nur vereinzelt um<br />
Standardsoftware und -büromaschinen<br />
handelt. In den weitaus häufigeren<br />
Fällen werden fblglich hochwertige und<br />
unter Umständen sogar speziell<br />
angeferligte Maschinen und Software-<br />
prograrnme verleast.<br />
150t.000 TDM<br />
Abb. 3: Anschaftungswert der Leasingobiekte<br />
1 0t50 TDM<br />
69"!
4.<br />
Status quo der Nutzung moderner Informations' und<br />
Kom m u n i kationsmed ien d u rch Leasi n ggesel lschaften<br />
20<br />
In den vcrgan-liencn .lahren haben sich clie Auf-uabenbereiche. dic tibcr tlodernc clel
2l<br />
Abb. 4: Entrvicklung der N utzungspotenziale elektronischer M edien<br />
N utzu ngs potenzia le<br />
von eBusiness-<br />
Anwendungen:<br />
Funktion in der<br />
Wertschöpf u ngskette:<br />
Phase 1 Phase 2<br />
Phase 3 Phase 4<br />
mt<br />
l'"''""1 @<br />
passlve<br />
Vertriebspolitik<br />
a ktive<br />
Vertriebspolitik<br />
Bus ness-to-Busrness<br />
..eProcurement"<br />
Administrat on:<br />
interakt ves Data<br />
N,,lanagement<br />
Die vier Phasen der Implementierung von eBusiness-Anrvendr,rngen u'erden von Untemehmen in<br />
unterschiedlicher Intensität und Schnelligkeit durchlaufen. Ebenso weisen auch ganze Branchen<br />
im Vergleich zu anderen Wirtschaftssektoren Unterschiede in den Fortschritten bei der<br />
Integration moderner Medien in ihre Wertschöpfungsketten auf. Anhand unserer Befragung soll<br />
festgestellt werden, wie weit die Leasingbranche in dieser Entwicklung fbrtgeschritten ist<br />
beziehungsweise u'elche Bereiche der Werlschöpfungskette bereits auf elektronische Medien<br />
r,rmgestellt r,vorden sind. Daher ist eine separate Betrachtuug der Anu cndun-esgebiete<br />
Präsentation. Vertrieb. Beschaffung und Administration sinnvoll.<br />
4.1. Präsentation im lnternet<br />
Ursprünglich erfrillten Intemet und eMail allein Informations- und Komrnunikationszwecke.<br />
Neben dem Infonnationstransfer in elektronischer Briefform und der relativ simplen Darstellung<br />
von Unternehmensinhalten und Produkteigenschaften gehen in jüngster Vergangenheit die durch<br />
diese neuen Medien eröffneten Möglichkeiten aber weit über eine einfache Präsentation hinaus;<br />
sie vollbringen vielmehr die Verbindung zwischen Kommunikation und Präsentation. indem sie<br />
auf interaktive Weise eine gezielte Inforrnationsabfrage nach Bedarf des Nutzers errnöglichen.
Bezüglich dcr Präsentatiot't in't<br />
Intenret zcigt die vorlicge Irde<br />
Befragun,u. class cler bei n citcur<br />
donrinierendc Tcil - nrirnlich 8,5'lu -<br />
cler I-casinggcscllschaf tcn citte<br />
eigene llomepagc bcsitzt. Dicsc<br />
Zahl crhöht sich auf 1009i,. r'nertti<br />
nllr dic Date'n grol.icr und<br />
mittclgrof.ler L-cas inggescl lschal tcrr<br />
in clic Ausu'crlrrng [:ingang<br />
22<br />
tltden.' Das Ergclrnis lrisst dic Schlussfblgcnrng zu" dass cinc Intcrnctpriisenz r,on klciltclt<br />
Ciescllschaftcn vcrnachlässict riirci. Tatsiichliclr uciscn clcn I)atcn dcr Urnfiage zulblgc ttur cirei<br />
Viertel alle.r klcincn I-casrnggcscllschafi ciuc cigcne Ilonrcpag.- attt.+ ZtLnr altcicrct.t lassctt dic<br />
[:igebnisse clcr' I nrfia('c crl
,)<br />
Auf die Frage. wie gr-rt eine Leasinggesellschaft ihren cigenen ALrftritt im World Wide Web<br />
(WWW) irn Vergleich zu anderen Lcasinggesellschafien bcurtcilt" stufi sich die Hälfic auf einer<br />
Skala von I (sehr gut) bis 4 (schlecht) mit ..gut" (2) ein und itnrnerhin cin Drinel befand sich als<br />
,,durchschnittlich" (3). Erstaunlichcnveise schätzen sich die Unternchtnett im Vergleich zu<br />
anderen Finanzdienstleisturlgs-qesellschafien (nicht Leasing) ganz ähnlich ein - ttttd clas. obrvohl<br />
Banken und Versicherungen bei c'ler Nutzung von cBustuess-Anrvetrdungcn u'eit über dern<br />
deutschlanclu,eiten Durchschnitt licgen.s lnsbesortrlere dcn Infcrrtnationsnutzen ilirer Website<br />
beurteilen die Leasinggcsellschaften als hoch. Dabei steht die lnfbrmatron i.ibcr d:is Utrtcrnehmen<br />
selbst alt erstcr Steilc. kurz gclblgt \ on den NIöglichlieiten dcr KontaktaLrfhal.une über<br />
Internetr'eMail Lrnd der Infbnnzrtion riber clie zu vcrlc-asetrdcn Ob.jel
-sonsilgelnf<br />
o rm atio n<br />
1.1<br />
Abb. 9: Websitenutzungdurch Kunden/ Interessenten<br />
Bestellung _\_<br />
inlorm atl0n<br />
| ^rcinn^h oL lo -,<br />
D-.<br />
Kontaktau'lnahm e<br />
29..<br />
ln f o rr-n atio n<br />
Gese lschalt<br />
.1C.,<br />
Das WWW rvird aber nicht nur n-rit dem Zicl dcr Unte nrehnrcirspniscntation uncl ticr Inlnrmation<br />
potenziellel Kundschaft per untelnehmenseiscncr'flonrcpauc. sonrlo'n aucii i'crcttrzclt tLir<br />
Werbezu,eckc ar-rßelhalb der eigenen [{orncpagc scnutrt. ln-ttncrltitt fäst icdc sicbcnte<br />
Leasin-ugescllschaft bctreibt Werbung in irgenclerner Fonr (2.B. so scllulrt llanncrucrbitttg)auf'<br />
anderen Wcbsites. Sornit wird das lntenret als rrcit rcichcrrrles \{criirrrn uuch nrtl rlctir ltcl dcr<br />
Ansprachc tiberregionaler Kunclschaft ern-qesctzt. Glc-ichri ohl gebcrr rLrncl ztt ci [)rittcl allcr'<br />
befragtcn [,ntelnehnren an. ihrc ber,'orzugtc Ziclgruppe nicht über c]as Intct'lrct zit ct't'c'iclttlr unrl<br />
zrvei FLinftcl sind der Meinr-urg. dass siclr ihre Lcasingob.lcl
Abb. 12: Bannerwerbung außerhalb der<br />
eigenen Website<br />
ia<br />
157o<br />
25<br />
Abb. 14: Eignung der Leasingobjekte für<br />
Vermarktung per Internet<br />
4.2. Nutzung von eBusiness-Anwendungen im Vertrieb<br />
Abb. 1 3: Zielgruppenerreichung<br />
Die Vorteile der Implernentierung von eBusiness-Anwendungen irn Vertrieb von<br />
Leasinggesellschaften liegen in erster Linie in einer Verbessemng der Kundenbezichungen<br />
begründet. Der Auf- und Ausbau von kundennahen und insbesondere kundenfi'eundlichen<br />
internetbasierten Anwendungen erleichtert nicht nur die Akquirierung neuer Kunden, sondern<br />
vernag auch durch Erhöhung der Kundenzufriedenheit die Bindung der bestehenden Kundschaft<br />
an die Leasinggesellschaft zu verstärken. Neben diesen primär auf die Person (bzrv. das<br />
Unternehmen) des Kunden abgestellten Faktoren können modetne elektronische Medien unter<br />
preispolitischen Gesichtspunkten auch ein aggressives Pricing unterstützen. Dies mag<br />
insbesondere vor dem Hintergrund der bereits oben angesprochenen lntensivierung des<br />
Wettbewerbs in der Leasingbranche sowie einer mit der Reichweite des WWW einhergehenden<br />
Konditionentransparenz einen sinnvollen strategischen Ansatz darstellen.<br />
ia
Callcenter<br />
(Outbound)<br />
Zeitschriften/Plakal<br />
I nternet<br />
Fernseh-/<br />
Radiowerbung<br />
P rospekte/Ansch reib<br />
Telefon<br />
sonstig<br />
l()<br />
Abb. 15: Eingesetzte Medien zur Kundenansprache<br />
Der Einsatz von eBusiness-Anu'endungen irn Vertrieb von Leasinggcsellschaften kautt dr,rrch die<br />
Auswertung ciner Kombination von Fragcr,. dic dic Präsenz dcr Unternehtrtttns itr Ittternet<br />
einerseits und die Bcziehr-rng der Leasinggesellschaft zutr Kunden attdererseits bctrefl-en.<br />
qualitativ gut abgebildet vn,erden. Während die Untemehllenspräsentation im Internet<br />
vertriebspolitisch e ine rein passivc MafJuahnre clarstcllt und ehcr als Ergänzung LUr<br />
beziehungsweise Untcrstützr,rng der e igentlichen Vertricbstätigkeit fiurgiert. u ähletl<br />
Leasinggesellschaften als aktive Ansprechwege vorzugsweise noch die traditionellcrl<br />
Vertriebsfonnen der Ansprache per Telefon undioder ProspektiAnschreiben. Die modcrnen<br />
Abb. 15: Formen der Kontaktaufnahme<br />
auf elektronischem Wege<br />
Medien Callcenter und Internet 'ur erden<br />
zur Kontaktaufnahrne mit Ktrnden nur<br />
vergleichsrveise wenig eingesetzt (siehe<br />
Abb. l6) Wenn -ucfragt nach der<br />
tatsächlichen Kontaktar-rfhahme auf<br />
elektroniscl'rern We ge. räumcn die<br />
meisten (80%) auch cit.t. nur indirekt in<br />
Fonn einer cigenen Website Kontakt<br />
aufzunehmen. während nur 12% eine direkte Kundenansprache in Form von per eMail<br />
verschickten Werbebriefen oder Prospekten vornehmen.
21<br />
Bei den angesprochenen Formen der Kontaktaufnahrne handelt es sich aber nur um einen Teil<br />
der Vertriebstätigkeit, nämlich um die Anbahnung des ,.Verkaufsgesprächs". Wenn auch hier<br />
schon der Einsatz moderner Informations- und Kommunikationsmedien in Relation zur<br />
Unternehmenspräsentation geringcr ist, so ist er es bei der eigentlichen Abwicklung der<br />
Transaktion erst recht. So ist eine Bestellung und Abwicklung des Leasinggeschäfts per Intemet<br />
nur bei 3% der Leasinggesellschaften möglich eine Tatsache, die sich darin widerspiegelt, dass<br />
drei Viertel aller befragten Unternehmen (nahezr:) kein Geschäftsvolumen auf das lntemet<br />
zr-rrückflihren können. Lediglich jedes neunte Untemehmen sieht immerhin 2olo bis 5% seines<br />
Geschäftsvolurnens - direkt oder indirekt - durch eBusiness generiert und nur zwet der 75<br />
befragten Leasinggesellschaften haben angegeben, dass jeweils 5% bis 10% und l0% bis 20'%<br />
ihres Geschäftsvolr-unen auf eBusiness zurückzuführen sind. Dabei weisen die Prognosen für die<br />
kommenden 5 Jahre eindeutig auf eine steigende Tendenz bei der Liber das Internet<br />
abzuwickelnden Transaktionen (siehe Abb. l7). Die Leasingbranche ist sich also beu'usst. dass<br />
ein nnauthaltsarner Wandcl in Gange ist. der auf die steigende Bedcutung von cBusiness-<br />
Lösungen bei der Abwicklung von Leasinggeschäften hinweist.<br />
90.0".<br />
80.0"o<br />
70,0q.<br />
60,0'n<br />
50.0q;<br />
40,09.<br />
30,0c.<br />
2A,Aq"<br />
10 Oqo<br />
0.0q"<br />
82,8.4<br />
aktuelles e-<br />
Geschäftsvolu men<br />
Abb. 17: Geschätsvolu<br />
durch eBusiness<br />
0'07" 0'095<br />
32,3o/o<br />
3,1"/" 3,1"/"<br />
prognostiziertes e-Geschäftsvolumen in den<br />
nächsten 5 Jahren
4.3. Nutzung von eBusiness-Anwendungen in der Beschaffung<br />
28<br />
lm Rahmen der Beschaffung spielt das Internet insbesondere fiir das Zusammentreffen von<br />
Leasinggesellschaft und Hersteller der zu verleasenden Leasingobjekte einc Rolle. Dabei ist die<br />
Art und Weise der Nutzung dieses Mediums in hohern Masse davon abhängig, in welcher<br />
Beziehung Leasinggesellschaft und Hersteller zueinander stehen. Während für<br />
herstellerabhängige Gesellschaften ein internetbasiertes interaktives Bestellsystem von prirnärer<br />
Bedeutr-rng ist, dient das WWW für herstellerunabhängige Gesellschaften eher der<br />
Kontaktar-rfnahme und -pflege sowie der fallweisen Verhandlr-urg und Bestellung. Auch wird für<br />
Letztere das Aufkomtnen virlueller Marktplätze von hohem Interesse sein. lnsbesondere<br />
Business-to-Business-(B2B-)Marktplätze, auf denen Produkte zrvischen Unternehmen gehandelt<br />
werden, können aus Sicht der Beschaffung verschiedene Vorteile rnit sich bringen. Hierzr-r zählen<br />
neben einer generellen Beschleunigung des Einkauf.s- bzrv. Bestellprozesses, die zugleich die<br />
Lieferantenauswahl. die Preisbildung als auch die eigentliche Bestellabwicklung betrifft, vor<br />
allem Kostenreduktionen durch günstigere Einkar.rfskonditionen und niedrige<br />
Transak t ionskosten.6<br />
Die Umfrage zeigt allerdings, dass sowohl ar"rf Seiten der herstellerabhängigen als auch seitens<br />
der herstellerunabhängigen Leasinggesellschaften noch kein ausgeprägtes Engagernent<br />
hinsichtlich der beschaffungspolitisch intendierten Intemetnutzung vorhanden ist. So u'ill<br />
lediglich ein Drittel aller befragten Untemehmen eine Verbindung zum Hersteller per Intemet<br />
aufbauen (im Vergleich zu 60%, die im Rahrnen von B2B-Anwendungen eine Verbindung zLrtn<br />
Leasingnehmer per lnternet erwünschen). Diese Zahlen ändern sich nur wenig, wenn eine<br />
Unterscheidung zwischen Herstellerabhängigkeit und unabhängigkeit zu Grunde gelegt u'ird.<br />
Auch bei der Frage nach den Funktionen, die über das WWW abgewickelt werden, geben nur<br />
16% eine Kontaktaufnahme zum Hersteller an, und sogar nur 90Ä tätigen tatsächlich die<br />
Leasingobjektbestellung über dieses Medium. Dabei r,vird von herstellerabhängigen<br />
Gesellschaften die Bestellung per Internet im Vergleich zur elektronischen Kontaktaufnahme<br />
ähnlich wichtig bewertet fieweils 37%). Herstellerunabhängige Gesellschaften schreiben einer<br />
Kontaktaufnahme mit dem Hersteller allerdings eine größere Bedeutung zu als der Bestellung<br />
per Internet. Dies unterstützt die These, dass das primäre Ziel einer herstellerbezogenen<br />
Internetnutzung flir herstellerunabhängige Leasinggesellschaften in der Pflege von Kontakten<br />
6<br />
Verschiedene Unternehmensberatungen haben je nach gchandelter Produktarl Kosteneinsparungen r,on bis zu 30",,'n<br />
des herkömmlichen Einkaufspreises feststellen können. Vgl. Hudetz, Kai. Elektronische Marktplätze Chancen r,rnd<br />
Risiken. in: Mitteilungcn des Instituts für Handelsfbrschung an der Universität zu Köln. hrsg. r". Müller-Hagedorn.<br />
Lothar. jg.53 (2001), Nr.5. S. 77.
mit verschiedenen Herstellern gesehen wird; bei vom Hersteller der Leasingobjekte abhängigen<br />
Unternehmen spielen hingegen die Automatisierung und die Vereinfachung der Bestellung eine<br />
bedeutendere Rolle.<br />
Abb. 1 8: Durch den Internetauftritt<br />
angesprochene Zielgruppe<br />
"------& , --=\<br />
( 4<br />
,MW<br />
ii:tifl:ll'J'<br />
\*"*5<br />
Abb.20: Funktionen des Internetauftritts aus der Sicht<br />
herstellerunabhängiger Leasinggesellschaften<br />
Anbindung interne EDV -<br />
19",i><br />
Leasingobjektbestellung<br />
Hersteller<br />
8%<br />
Kontaktaufnahme<br />
Hersteller<br />
't60/"<br />
Vertragsabschluss<br />
1770<br />
Kundenansprache/<br />
Kontaktaufnahme<br />
400Ä<br />
Abb. 1 9: Durch den Internetauftritt<br />
abzuwickelnde Funktionen<br />
4.4. lntegration von Datenverwaltungs- und -verarbeitungssystemen<br />
im<br />
Rahmen der Nutzung von eBusiness-Anwendungen<br />
Die vierte Phase im Rahmen der sukzessiven Implementierung von eBusiness-Anwendungen im<br />
Leasinggeschäft involvierl den Aufbau und die Anbindung von Systemen, die den Datentransfer,<br />
die Datenverarbeitung sowie die Datenverwaltung ermöglichen und adrninistrative Aufgaben<br />
vereinfachen. Hierbei handelt es sich um den letzten Schritt, der zur Automatisierung des<br />
gesamten Geschäftsprozesses führ1. Kerngedanke ist, dass jede Anderung oder Neuerung im<br />
Frontofficebereich elektronisch weitergeleitet wird und zu einer automatischen Aktualisierung<br />
der Verlrags- und Kundenbestandsdatei im Backoffice flihrt.<br />
EDV<br />
20!"<br />
Abb. 21: Funktionen des Internetauftritts aus der Sicht<br />
herstellerabhängiger Leasinggesellschaften<br />
Anbindung interne EOV<br />
2570<br />
t \<br />
.-bi<br />
t m<br />
Leasingobjeldbestellung ip__gVer<br />
Hersteller<br />
13%<br />
Kontaktaufnahme<br />
Hersteller<br />
13"/"<br />
Kundenansprache/<br />
f Kontaktautnahme<br />
| 29%
30<br />
In einer optimalen Fonn beginnt die elektronische Datenkette mit der<br />
Onlineleasingratenkalkulation. Entscheidet sich der Kunde flir einen Vertra-esabschluss, so kann<br />
er per Internet oder eMail eine Vertragsanfiage formulieretr. die bei der Leasinggesellschafi rnit<br />
FIilfe einer systenriritegrierten Schr.rfa-Anbindung und/odcr intetner Scoringsystetne eine<br />
automatische Bonitätsprüfung nach sich zieht. Ar-rf Grund dieser Daten w'ird seitens der<br />
Gescllschaft sodann einc Leasingcntscheidung geflillt. (Praktisch zwar nicht vcrantwortbar.<br />
theoretisch aber durchaus rnöglich könnte sogar falls genligen akkurate und zuverlässige<br />
Scoringsysteme eingesetzt und entscheidungsrelevante Faktoren in das Systern ntit eingebar-rt<br />
u'erclen auch die Entscheidung übcr den Abschluss eines Leasingvertrags automatisiert<br />
werden.) Nach Abschluss des Leasrngr,'crtrags erfolgt eine automatische Abwicklung und<br />
Finbr-rchLrng des ALrftrags in dcn aktr,rellen Datcnbestand. Dcs Weiteren können auf Basis vorl<br />
Onlinekontoführungen vorn Kunden selbst Vertragsändentngen per Intemet eingegeben u'erdetl.<br />
die durch einen elektronischen Datentransfer zLtr Anpassung des jeu'eiligen Auftra-us irl<br />
aktuellen Datenbestand fiihren. Somit können nicht tiur Stundung. Objckttausch. Vcrlängerung<br />
oder vorzeitige Ablösung rnit internctbasiertcn Datenverarbeitungssystemen bewältigt, sondcrn<br />
auch im Rahmen eines aktiven Customer Data Management Nachfassaktionen mit dern Ziel des<br />
Abschlr.rsses von Folgcverträ-een efllzient durchgeflihrt werden. Durch eine elektronische<br />
Integration von Frontofflce uncl Backof fice wird sotnit der urit der Datenveru'altr-rng<br />
nonnalerr,l,eise verbundene personellc Aufu'and reduziert, Zeit- uud Kostenerspamisse sind die<br />
Folge.<br />
Eine Implementierung solcher Systerne als Resultat strategischer Entscheidungen verfolgt dahcr<br />
einerseits das Ziel ciner ..Lean Organisation" und der damit einhergehenden Kostcnredttzierttng:<br />
auf Grund der Beschleunigung sor,vohl der detn Leasingvertrag zLt Grunde liegencler-t<br />
Entscheidungsprozesse als auch der adrninistrativen Abwicklr"urg begünstigt sie andererseits aber<br />
auch aus einer vertriebspolitischen Perspektive den Aspekt der Schnelligkeit, der im Rahrlen der<br />
Kundenakquisition r-rnd bindung eine bedeutende Rollc spielt. Vor diescrn Hintergrr-rnd<br />
untersttitzen dahcr integrierte Datenverarbeitungssysteme das eingangs erwähnte .,TinTc to<br />
Market". das irn Rahmen der Profilierung von Leasinggesellschaften irn Wettbewerbsumfeld<br />
von Nöten ist.<br />
Nach dem primären Ziel der Kundenansprache und Kontaktaufnahme steht bei den befragten<br />
Leasinggesellschaften an zr,l'eiter Stelle der Wunsch. ihren Internetauftritt an interne<br />
Datenverarbeitungssysteme anzubinden. Diese Notwendigkeit scheint insbesondere \ron<br />
herstellerabhänsieen Gesellschaften crkannt worden rLr sein. da sie der Integration
J I<br />
entsprechender Systerne w'eitaus mehr Bedeutung zuschrciben als es die herstellerr-rnabhängigen<br />
Untenrehmen tlrn (25% irn Vergleich z-u 19oÄ für herstellerunabhän-sige). Ob dies in der Realität<br />
bei den meisten Gescllschaften jecloch schon erfbl-rlt urnd erfblgrciclr inrplementiert worden ist, ist<br />
fi'aglich. Eine solchc Vermutung zu Lasten des E,insatzcs clcktronisch integrierter Systcrne stützt<br />
sich auf die Tatsachc. dass nur cir.rc geringe Anzahl von Nlitarbeitern innerhalb dcr bcfiagten<br />
Unternehnren mit der DLrrchfühn-rng enlsprcchcnder Ar-rfgaben beauftragt ist. lnsbesondere bei<br />
der Frage nach den sich mit cBusiness befassendcn Untcrnehmensbereichen lässt sich crkennen.<br />
dass derprirnäre Einsatz ron..elJusiness-Mitarbeitern" irl Vcrtrieb Lrttd inr Markcting stattfindet.<br />
Abb.22: Unternehmen mit eigenen Abteilungen<br />
für eBusiness und EDV<br />
EDV 52,0o/"<br />
eBusiness<br />
weder EDV noch<br />
eBusiness<br />
22,fo/o<br />
42,7"/o<br />
,/ ,'/ ,/ ,/<br />
0,09'. t 0,0'," 20.0q" 30.0% 40.0'/ä 50,0o/i, 60,0%<br />
Abb. 23: Anzahl der in eBusiness und EDV eingebundenen Mitarbeiter<br />
44,070<br />
eBusiness<br />
\nzrrlr (iur<br />
\ I itr fbc rtcf<br />
! 1-2<br />
Ü 3-5<br />
!5-10<br />
m> 10
Abb. 24: Mit eBusiness beschäftigte<br />
Unternehmensbereiche<br />
Sonstige<br />
80.,'o<br />
EDV<br />
2'l7o<br />
4.5. Bewertung desderzeitigen Entwicklungsstandes<br />
Organisation<br />
120/"<br />
Die 'u-oraus gehenden Ausftihrungen ge-bcrr eirtert Überblick clariibcr. u cichc Proze ssc ittt<br />
Leasing-eeschäft bererts rnit cBusiness-Auncndut'tgen Llntennalrcrt uorclct't sittcl trncl itnricricrt<br />
der Einsatz ltcucr \4eclien in dcr Wertschüpfungskcttc von Leasinggcscllschaticn tbrlgcscltrittcn<br />
ist. Auf Grund dcr hohen Resonanz dcr durchgeführten Umfiage. dre nicht z,tlcIzI clurch iiic gLrte<br />
Rücklaufquote sorvie durch die vielen positiven Kornnrentare in Fort-t-r \ on llrief'cn urtcl<br />
Randbernerkungen demonstriert \l.orden ist. steht auf3er Fragc. dass alle Lcasin-ugcsellschaltcrr<br />
sich des technolo-eischen Wandels in ihreur Unrf'clcl und der damit citthcrgche-tttlcn<br />
Notwendigkeit der eff-ektiveren Nutzung moderner lnfbrrlations- und Konrtnuuikatiottssvstentc<br />
bewusst sind. Die Auswertung der Umfragc zeigt allerdings auch. dass dic tatsaichltchc<br />
Umsetzung und hnplernentierung entsprechender Sl,steme noch nicht sehr u'eit vorangeschrittctt<br />
ist. Während die Nutzung des \,'WW zwecks Präsentatron und Kontaktaufnahure tlit l(unden<br />
(zurnindest bei den großen und mittelgroßen Leasir.rggesellschaften) bereits zutn Stanclard<br />
geworden ist" e rfblgt der eigcntliche Vertrieb nLrr vereinzclt mittels intcnretbasiertcr<br />
Kalkulations- und Bestellsysteme. Hier wcrde n noch sehr häufig die traditioncllcn<br />
Verhandlungs\vege und Mcthoden des Vertragsabschlusses ber,'orzugt. Bcztiglich dcr<br />
Beschaffung via lntcmet und eMail lässt siclr eine noch geringerc Beteiligung \ or.l<br />
Leasinggesellschafteri feststellen als es beirn Vertrieb der Fall ist. Allerdings liefcrt dic Untft'a-i{e
JJ<br />
Hinweise darauf. dass die Nutzung integrierter Beschaffungssysteme insbesondere bei<br />
herstellerabhängigen Leasinggesellschaften einer positiven Tendenz unterliegt. Schließlich kann<br />
die erfolgreiche hnplementierung von Datenveru'altungs- und -verarbeitungssystemen nur für<br />
eine Minorität der in der Leasingbranche tätigen Unternehmen konstatiert werden. Bei einer<br />
par-rschalisierten Einordnung der Leasingbranche in das Vierphasenmodell der<br />
Nutzungspotenziale u'ürdc sornit die eBusiness-spezitische Nutzung im Leasinggeschäft<br />
vorwiegend in der Vertriebsphase angesiedelt werden.<br />
5. Hinderungsfaktoren der lmplementierung von eBusiness-<br />
Lösu ngen<br />
Dcr in Relation zu anderen Branchen geringe Fortschritt r,'on Leasinggesellschaften bei der<br />
Inanspruchnahr-ne uroderner Informations- und Kommunikationsu-ege ntuss auf eine Reihe von<br />
Ursachcn zunickzr.rführen sein. Um die möglichen Hinden-rngsfaktoren einer Implementierung<br />
von eBusiness-Lösungen zu identifizieren. sollcn die letzten beidcn Fragenkomplexe der<br />
Urnfiage herangezogen werden, die sich einerseits auf die Einschätzung der derzeit relativ<br />
geringen Verbrcitung von eBusiness-Anwendungen im Leasinggeschäft r.rnd andererseits auf die<br />
E,rwafiungen bezüglich der ktrnftigen Entwicklung von integrierten eBusiness-Lösungen<br />
beziehen.<br />
0%<br />
Fehlende<br />
Kenntnis<br />
Abb. 25: Gründe für die geringe Bedeutung des eBusiness aus Sicht<br />
ranche<br />
!5 = triffl<br />
Fragwürdigkeit des UnzureichendeKonditionen-<br />
Ungeeignetes Produkt- Betrugs- Verlust an<br />
Zusätzlichen Nutzens Sicherheit transparenz sortiment problem Kundenbindung<br />
trifft voll zu
Abb. 26: Vermuteter Bedeutungszuwachs deseBusiness<br />
a Ä<br />
-l+<br />
für die<br />
Leasingbranche durch vier Faktoren<br />
2.7"/" 1,470<br />
4,1"/" -t<br />
neuesSignaturgesetz verbretteteKenntnisder bewußtes l\,4anagement<br />
für<br />
ansaktronen<br />
Anwendungsmöglichkeiten von eBusiness be Leasrngnehmern<br />
fl R - trifft ninh+ zrr<br />
tr4 = triftl<br />
wah rscheinlich<br />
ntcnt zu<br />
E2 = trifftZU<br />
&1 = trifftvoil<br />
zu<br />
Wie die Ausn.ertung diescr beidcn Fragcnkomple're zei-ut. scheittt clic- Besorgnis darüber'. dass<br />
die Verwendung von intemetbasierten cBusincss-Lösungen eirt erhöltte Kollditiortclltrallsparellz<br />
hervon-uft. der größte Hinderungsf-aktor bei dcr derzcitigetr Ennr,ickluttc Ltnd Einbinclung solchct'<br />
Lösungssystemc seitens der befia-9ten Leasinggesellschaften zr.t scin. Kuapp zue-i Dlittel allcr<br />
Leasinggesellschaften gabcn an, dass diescr [jaktor ursächlich fiir dic clerzeit vc-r-uleichsueisc<br />
geringe Bedeutung modcrner Medien in der Lcasingbranche ist (32% gebcn..triffi roli ztt" ttlld<br />
29oÄ .,triffr zu" an). Als zweiter bedcutsarncr Hinderr-rngsfaktor ist die Lurzureichende Sichcrheit<br />
der Abu'icklung von Transaktionen liber das lntemel zu verzeichnen (160/6 .,trifft voll ztt" r-tnci<br />
29% ..trifft zu"). Des Weiteren schcinen auch die Besor,unis tiber einen Verlr"rst all<br />
Kundenbindung sowie die fehlende Kenntnis über optirnale Einsatzmöglichkeiten von \\'W\\"<br />
und eMail eine Rolle zu spielen. Das f-ehlende Wisscn tiber Einsatzmöglichkeiten scheint eine<br />
zentrales Problem zu sein, da femer die bcfragten Unternehtnen einen Bedeutungszur.r'achs r,'on<br />
eBusiness-Anwendungen in Zukunft dadurch erwarten. dass das Knou'how übcr entsprechende<br />
Nutzungspotenziale in der Leasingbranche eine weitere Verbrcitung findet sowie zu einem<br />
bewussten Management von eBusiness (u.U. als eigenständigen Unternehmensbereich) führt.<br />
Aus diesem Grund scheint im Rahrnen des Management ein Top-down-Ansatz am geeignetsten<br />
zu sein, die lrnplementierung von integrierten Systernen voranzutreiben, zumal neben dem<br />
Ar,rfbau von speziell mit eBusiness-Aufgaben betrauten Abteilungen oder Projektgmppen
35<br />
möglicherweise auch der Einsatz externer Beratungsfirrnen. die über das jeweilige technische<br />
Wissen und einen entsprechenden Erfahrungsfundus verfügen, von Nöten ist.<br />
Die eingangs erwähnte Tatsache. dass Leasinggesellschaften sich der Notwendigkeit von<br />
technologischen Veränderungen und Anpassungen bewusst sind, wird durch ihre Einschätzung<br />
der künftigen Entwicklungstendenzen untermauert. Neben unternehmensinternen<br />
Verbesserur-rgen wie einer verbreiteten Wissensbasis und dem zielorientierteren Management<br />
von eBusiness scheint dabei vor allem die Nachfrageseite das eBusiness voranzutreiben. So<br />
erwarten fast drei Viertel der befragten Unternehmen, dass ein verändertes Kundenverhalten<br />
(insbesondere im Bereich der Beschaffung bei Firmenkunden) die Implementierung geeigneter<br />
Systeme initiieren und deren Entwicklung positiv beeinflusseri wird.<br />
5.1. Interne Faktoren<br />
5.5.1. Die Unternehmenssröße<br />
Es wurde bereits irn Rahmen der Analyse des derzeitigen Entwicklungsstandes ersichtlich, dass<br />
große Leasinggesellschaften hinsichtlich der Implementierung und Nutzung von eBusiness-<br />
Anwendungen weiter fortgeschritten sind als kleine Leasinggesellschaften. Tatsächlich können<br />
mit Hilfe der ausgewerteten Umfrage die Ursachen für einen unterschiedlichen Grad des<br />
Forlschreitens bei kleinen und großen Leasinggesellschaften offengelegt werden.<br />
Eine erste wesentliche Ursache scheint der unterschiedliche Kenntnisstand bei<br />
Leasinggesellschaften zu sein. Während große Leasinggesellschaften einen niedrigen<br />
Wissensstand als Grund frir die geringe Verbreitung von internetbasierten Anwendungssystemen<br />
in der Leasingbranche als unwahrscheinlich erachten (27o/o ,.trifft nicht zu" und 37olo ..trifft<br />
wahrscheinlich nicht zu"), scheint eine fehlende Kenntnis darüber, wie und wofür eBttsiness-<br />
Lösungen eingesetzt werden können, bei kleinen Leasinggesellschaften ausscl'rlaggebend für den<br />
Nicht-Einsatz solcher Lösungen zu sein (20oÄ ,,ffiffl voll zu" und,150Ä,,trifft zu"). Ein zweiter<br />
ursächlicher Faktor, der flir Untemehmen verschiedener Größen jeweils eine andere Bedeutung<br />
aufrveist, ist die Angst vor einer bevorstehenden Konditionentransparenz. Die Befürchtung über<br />
eine Transparcnz der Preise und den ihnen zu Grunde liegenden Kalkulationen ist bei kleinen<br />
7<br />
Es r.vird hier wieder auf die bereits oben verwendete Klassifizierung anhand der Mitarbeiterzahl von<br />
Lcasinggesel lscha ltcn zurückgcgri tfen.
36<br />
Gesellschaften herausragend hoch (siehe Abb. 27). Für große Untemehmen hat dieser Faktor<br />
eine geringere Bedeutung. Auch sind Letztere rveniger über ein mögliches Betrugsproblem. das<br />
sich aus einem verringerten persönlichen Kontakt rnit dem Kunden ergeben könnte, beunruhigt<br />
als kleinere Gesellschaften.<br />
Dies mag in zwei Tatsachen<br />
begründet liegen: Einerseits<br />
verfligen große Unternehmen<br />
(insbesondere solche. die einern<br />
Konzern angehören oder eine<br />
Abhängigkeit vom Hersteller<br />
der Leasingobjekte ar.rfweisen)<br />
u. U. bereits tiber ausreichende<br />
technologische Sicherheits-<br />
standards bezieliLrngsweise sic<br />
Abb, 28: Gründe für die geringe Bedeulung des eBusiness<br />
aus Sicht großer Leasinggesellschaften<br />
if;.<br />
Abb.27: Gründe für die geringe Bedeutung des eBusiness<br />
aus Sicht kleiner Leasinggesellschaften<br />
können sich solche - auf Grund einer Verteilung der dicsbezliglichcn Kosten auf eine bre itere<br />
Geschäftsbasis - eher leisten als Konkuffenten mit geringcrern Geschäftsvoh,nnen lAhnlich,--s<br />
gilt tiir das Knowhow. das evcntuell durcli dic Einbindung extemer Berater kostenintensiv<br />
bezogen werden rnuss); andererseits können mit unzureichender Sicherheit r,rnd/oder<br />
Betrügereien verbundene Risiken wegen der größeren Geschäftsvolumiua besser diversifiziert<br />
werden. sodass sie f ür große Leasinggesellschaften eine geringcre Bedrohr-rng darstellen.<br />
Insofern ist es nachvollziehbar, dass grofJe Leasinggesellschaften einer Implelllefltic-rtlllq von<br />
eBusrness positir,' gegenüberstehen, eine solche strategisch planen und einbinden und somit in<br />
dem Vierphasenmodell bereits weiter fortgeschritten sind. Allerdings scheint zugleich das aktive<br />
Management von eBusiness ein<br />
bedeutender Engpassfäktor z,Ll<br />
sein. der molrentan einen<br />
weiteren technologischen Fort-<br />
schritt bei großen Gesellschaften<br />
bremst. Dies spiegelt sich in der<br />
Tatsache wider, dass allein bei<br />
einer Betrachtung der Daten<br />
großer Leasinggesellschaften<br />
dem bewussten Management voll<br />
eBusiness eine stärkere<br />
Bedeutung zugesprochen wird
J I<br />
als bei einer Auswertung der Antworten aller befragten Leasinggesellschaften. Dies gibt den<br />
Anschein, dass sich mit eBusiness befassende Problemstellungen insbesondere in die<br />
strategische Planung von großen Leasinggesellschaften nur unzureichend eingebunden und<br />
gelöst werden. In diesem Zusammenhang erscheint - wie bereits an früherer Stelle angesprochen<br />
- eine Top-Down-Ansatz flir das weitere strategische Management des optimalen Einsatzes<br />
modemer Technoloeien unerlässlich.<br />
Ein weiterer Faktor ist der potenzielle Verlust an Kundenbindung, der rnit einer fortschreitenden<br />
Verbreitung von eBusiness-Anwendungen einhergehen könnte. Kleine Leasinggesellschaften<br />
sprechen diesern Problem im Vergleich zu großen Untcmehmen eine sehr große Bedeutung zu<br />
(33%.,trifft voll zu" und260Ä,,trifft zu" im Vergleich zu0oÄ,,trifft voll zu" und25oÄ,,trifft zu"<br />
bei großen Leasinggesellschaften). Eine mögliche Begrtindung dafür. dass kleine Gesellschaften<br />
einer Kundenabwanderung relativ hilflos gegenüber stehen, kann in ihrem begrenzten Budget<br />
sowie in den bereits engen Margen im Leasinggeschäti gesehen werden. So können sie<br />
Marketing- r-rnd Werbemaßnahmen mit dem Ziel einer effektiveren Kundenbindung nicht in dern<br />
Maße durchführen wie ihre größeren Konkurrenten. Auch hinsichtlich der Gewährung von<br />
Preiszugeständnissen sind ihre nur Möglichkeiten begrenzt.<br />
5.5.2. Das Leasingobjekt<br />
Eine Verbindung zwischen der Art des Leasingobjekts r-rnd der Nutzung von eBusiness-<br />
Anwendungen scheint nicht von der Hand zu weisen zu sein. Bereits eingangs wurde eru'ähnt.<br />
dass Leasingobjekte zwei Anfbrderungen für einen Venrieb über das Internet erfüllen müssen.<br />
E,ine dieser grundlegenden Voraussetzungen ist die Standardisierung des Leasingobjekts. Eine<br />
weitgehende Automatisierung von Ratenkalkulations-. Bestell- und Datenerfassungsprozessen<br />
auf elektronischem Wege kann nur ftir solche Objekte erfolgen, deren Spezifikationen durch<br />
technologische Systeme erfasst werden können und die somit einen gewissen Grad an<br />
Standardisierung aufrveisen. Dies stützt sich darauf. dass zwecks Vereinfachung der<br />
Datenverarbeitung sowie des Datentransfers - sowohl online als auch ftir die<br />
unternehmensinterne Dateneingabe - Eingabemasken verwendet werden, die nur eine bestimmte<br />
Zahl von Produktvariationen und -spezifikationen antizipieren und erfassen können. Von der<br />
Norm abweichende oder sogar individuell erstellte Objekte können somit in vielen Fällen keine<br />
Berücksichtigung finden. Folglich müssen Leasingobjekte zum Zweck des effizienten Einsatzes<br />
von internetbasierten eBusiness-Anwendungen zu einem gewissen Grad standardisiert sein.
-18<br />
Eine zweite das Leasingobjekt betreffende Voraussetzung ist ein geringer bis mittelgroßer<br />
AnschafTungswefi. Auf Grund der noch vorhandenen Sicherheitsmängel bei Onlinetransaktionen<br />
ist eine Abu'icklung von Verträgen, die über betragsmäßig hohe Geschäftsvolumina<br />
abgeschlossen werden,<br />
(noch) rnit zu großen<br />
Risiken behaftet.<br />
Außerdem u'cisen<br />
großvolumigc Leasing-<br />
objekte häufig nicht-<br />
standardisicrbare<br />
Eigenschaften ar.rf: oft<br />
handelt es sich bei<br />
ihnen sogar um<br />
Spezi al an f-erti gun gen.<br />
Demzufolge steht das<br />
Big-Ticket-Leasing<br />
beim Einsatz volt<br />
Abb. 29: Unterschiedliche Eignung von<br />
Leasingobjekten für eine Vermarktung per Internet<br />
Gesamte<br />
Datenbasis<br />
Davon:<br />
A) Transpor lmittel<br />
LKW<br />
Frugze!qe<br />
Bahfen<br />
Sch lie<br />
B) Maschinen<br />
Baunriischr'en<br />
scfit !e flasah "e'<br />
C) EDV<br />
Soiiriare<br />
D) lmmobilien<br />
f'öql-'ö-t--]<br />
I 61c; I :q.<br />
54q"<br />
[E.q-lr-<br />
]<br />
16,<br />
]<br />
]]<br />
L !x6 :-' I<br />
t r'' f.z{_l<br />
Besorgn s uber Kofdt ofeftrafsparenz<br />
sch echles Mafagement<br />
Beso,qn s !be. (ond t onentränsparefz<br />
ungee gfetes Proddktsofl menl<br />
!fzure chende Srcherh€ 1<br />
ungeergnetes Produklsod menl<br />
!f z!reichende S,cherhe t<br />
!n7!rerchen.le S cheire I<br />
Besorgn s !ber Kond t onentransparenz<br />
8-osofqr : !ber Kofd t onentranspaTenz<br />
eBusiness-Anrvendungen außcn vor. bcziehungsrvcise das eBusiness hat fr"ir großvolurnige<br />
Leasingtransaktioncn eine andere Bcdeutung (nämlich primär ciie Kontaktaufhahme zulrl<br />
Leasingnehmer sor,r,'ic zun Hersteller). tsei Leasin-eobjekten tnit gcringfügigen bis ruittelgroßen<br />
Anschaffungswe rten kann eine Diversitizierung von Risiken. dic sich atts cincr<br />
Onlinetransaktion ergeben. durch dic vergleichsweise größcre Zahl abgcschlossener<br />
Leasingverträge erreicht werden. Eine neitere Erhöhung des Vertragsbestands wird nicht zuIeIzI<br />
durch die lrnplententiemg von eBusiness-Anwendungen, auf deren Basis eine<br />
Kundenakquirierung und -bindr,rng gefördert wird. vorangetrieben. Da auf Grund regehnäßiger<br />
technologischer Fortschritte in Zukunft damit gerechnct werden kann, dass ein Großteil der<br />
derzeitigen Sicherheitsmängel behoben wird. stcht der risikodiversifizierende Efl'ckt einer<br />
größeren Verlragsbasis einem Risiko durch Onlinetransaktionen positir gegcriüber. Auch der<br />
rechtliche Rahmen für einen Onlineabschluss von Verträgen sowic flir die Durchflihmng anderer<br />
Onlir.retransaktionen wird zunehmend vervollständigt; ein erster großer Schritt in diese Richtung<br />
wird mit der Verabschiedung des Signaturgesetzes für Onlineverträge erw'artet.<br />
Die Ergebnisse der Umfrage unterstützen die Bedeutung der beiden Anfbrderungen an<br />
Leasingobjekte flir eine Vermarktr-rng mit Hilfe rnoderner Technologien. Leasinggesellschaften.<br />
die hauptsächlich standardisiefte und betragsmäßig kleine/mittelgroße Objekte (d.h. PKW.
LKW, Büromaschinen, Hard- und Softrvare) verleasen, geben auch jeweils mehrheitlich an, dass<br />
sich ihre Leasingobjekte für einen Onlinevertrieb eignen. Urngekehrt wird im Big-Ticket-<br />
Leasing, das hauptsächlich nichtstandardisierte Güter umfasst (d.h. Flugzeuge, Bahnen, Schiffe<br />
und hnmobilien), von einer fehlenden Eignung der jeweiligen Objekte ausgegangen (siehe Abb.<br />
29). Zugleich wird ersichtlich, dass die primäre Besorgnis von Leasinggesellschaften. die zwar<br />
für einen Onlinevertrieb geeignete Güter verleasen, eine lmplementierung von eBusiness-<br />
Lösungen aber nur zögerlich vorantreiben, in einer zunehmenden Konditionentransparenz liegt.<br />
Hingegen äußern die Leasinggeber von Flugzeugen, Bahnen, Schiffen und Immobilien<br />
Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von eBusiness-basierten Transaktionen. Demzufolge<br />
müssen auch die strategischen Ansätze von Leasinggesellschaften unterschiedlich formuliert<br />
werden. Während irn Small-/Medium-Ticket-Leasing eine Kombination aus vertriebspolitisch<br />
intendierter hnplementierung von eBusiness-Anwendungen und aggressiver Preispolitik einen<br />
sinnvollen Ansatz darzustellen vermag, sollten sich eBusiness-Strategien im Big-Ticket-Leasing<br />
auf verbesserte Kontaktmöglichkeiten mit dem Kunden und dem Hersteller sowie eine<br />
effizientere Datenverarbeitune in der Administration konzentrieren.<br />
5.1.3. Die Beziehuns zum Hersteller<br />
Auf Grund der sich alls einer Herstellerabhängigkeit beziehungsweise -unabhängigkeit<br />
Abb.30: Gründe lür die geringe Bedeutung des eBusiness<br />
aus Sicht herstellerabhängiger Leasingunternehmen<br />
ersebenden Unterschiede lassen sich<br />
mögliche Ursachen elner<br />
langsameren oder schnelleren<br />
Entwicklung im Vierphasenmodell<br />
erkennen. Auffallend ist. dass fast<br />
90% der herstellerabhängigen<br />
Leasinggesellschaflen - gefragt nach<br />
den Gründen flir eine derzeit<br />
vergleichsweise geringe Bedeutung<br />
des eBusiness in der Leasingbranche<br />
den Faktor der unzureichenden<br />
Sicherheit bei der Abwicklung von Transaktionen über das Internet als prirnäre Ursache<br />
benennen (37,5o .,trifft voll zu" und 50% ,,trifft zu"). Im Gegensatz hierzu schreiben nur 40oÄ<br />
der herstellerunabhängigen Gesellschaften den Sicherheitsmängeln eine gewisse Bedeutung z\<br />
(13,8oÄ<br />
,,trifft voll zu" und 26.20Ä<br />
,,trifft zu"). Bei Letzteren werden WWW sowie eMail vor
40<br />
allem zur Kundenansprache und Onlinevertragskalkulation sowie im Rahmen der Bezichung<br />
zum Hersteller vorwiegend für eine Kontaktar"rfnahme und -pflege genutzt. Da der Fokus einer<br />
Intemetnutzung von herstellerabhängigen Untemehmen aber zusätzlich auf der Implementierung<br />
von vollautornatisierten BeschafTungs- beziehungsweise Ordersystemen liegt, ist die Sicherheit<br />
und Zuverlässigkeit der Datenübertragung ftir die herstellerabhängigen Untcniehmen - mehr<br />
noch als für die herstellerunabhängigen - eine unerlässliche Voraussetzun-q. Demzufolge lassen<br />
sich entsprechende technologische Systeme nur dann einsetzen. \\ enn gewisse<br />
Sicherheitsstandards eingehalten werden und dic jeweiligen Systeme einn'andfiei und<br />
zuverlässi g operieren.<br />
Ein weiterer Unterschied zn'ischen den<br />
beiden Unternehrnenstypen crgibt sich<br />
beirn Faktor der Kundenbindung.<br />
Während der Schwerpr-rnkt der<br />
Bewertung von herstellerunabhängigen<br />
Gesellschaften auf einc hohe BedeutLrng<br />
der Bcsorgnis vor einem Verlust an<br />
Kundenbindung hinu'eist" scheinen her-<br />
stellcrabhängige Untcrnehtlcn rnögliche<br />
Kundenabwanderungetr nicht zLr<br />
Abb. 3'1: Gründe für die geringe Bedeutung des eBusiness<br />
aus Sicht herstellerunabhängiger Leasingunternehmen<br />
beftirchten. Eine Begrtindung dieser Tatsaclie lässt sich aus positiven Syner-eicef-fekten. die aus<br />
einer vom Hcrsteller der Lcasingobjekte abhängigen Beziehung elttspringell. ableiten. So<br />
profitieren herstellerabhängige Leasinggesellschaften von der Reputation, dem Nat-tret.t ttlrd cletn<br />
(oft großen) Bekanntheitsgrad des Herstellers sowie seiner Produkte. Eine Kundcnlo.u"alität<br />
bezieht sich in dem Sinne nicht direkt auf die Leasinggesellschaft, sondem vielmehr atrf dic<br />
Produkte des Herstellers beziehungsw'eise auf den Hersteller selbst. Interessenten ftir cin ProdLrkt<br />
werden vom Hersteller automatisch an die verbundene Leasinggesellschaft weitcrgeleitet. die<br />
dann letztlich .,nur" den Finanzierungsbedarf der Herstellcrkunden deckt. Für unabhängige<br />
Leasinggesellschaften ist der Erhalt einer Kundenbiridung hingegen ein essenzieller Faktor. in<br />
dern ihre Existenz be-sründet liegt. Sie können aus der Reputation eines Herstellcrs keine<br />
unmittelbaren Vorteile für ihre Beziehung zum Kunden ziehen. Insof-ern liegen die strategisch<br />
relevanten Erfolgsfaktoren. die zur optirnalen Ausw'ahl und hnplementicrung geeigneter<br />
eBusiness-Lösungen fr.rhren, bei herstellerabhängigen und -unabhängigen Leasinggesellschaften<br />
in unterschiedlichen Faktoren begründet. Während hcrstellerabhängige Unternehmen ihre<br />
prirnären Entwicklungsbcmühungen dem sicheren und zuverlässigcn Datentransfer im Rahrnen<br />
,r..{<br />
t5I
4l<br />
von internetbasierten Order- und Datenverarbeitungssystemen widrnen sollten, stehen beim vom<br />
Hersteller der Leasingobjekte ur-rabhängigen Gesellschaftcn innovative Methoden und<br />
Technologien zur Verbesserung beziehungsweise Aufrcchterhaltung der Beziehung zum und<br />
Kommunikation mit dem Kunden irn Vordersrund.<br />
5.2. Externe Faktoren<br />
Ein externer Faktor. der bislang noch nicht expHzit angesprochen u'urde. aber eine<br />
herausragende BedeutLrng fiir die Entu'ickh-rn-e des eBusiness-Potenzials in dcr ZLrkunft aufr,veist.<br />
entspringt aus einern - \,on Leasinggesellschaften kaurn direkt becinf-lussbarer, veränderten<br />
Kundenverhaltcn auf Seiten der Leasingnehmer. Dcr hcr-rtige moderne ,.User" bindet sou'ohl<br />
lnternet als auch eN{ail in seinc täglichen Geschäfte ein und erwartet zunehmend. einen Großteil<br />
seiner Transaktiorren und Geschaftsbeziehungen über dicsc Mcdien abrvickeln zr-r können. Dies<br />
bezieht sich nicht nur auf Privatpersonen. sondcrn trifft umso mehr aLrf Firmenkunden zu, bei<br />
denen bereits auf Basis unternehmensinterner Systernanbindungen geu'isse Funktionen der<br />
Wertschöpfungskette autornatisiert beziehungslveise ..elektronisiert" lvorden sind. Gerade<br />
Fimenkunden, die untemehmensintern technologische Anpassungen vorgenommen haben und<br />
fiir ihre eigene Geschäftstätigkeit moderne eBusiness-Anwcndungen zum Einsatz kommen<br />
lassen, erwarten eine ähnliche Modernisierung von ihren Geschäftspartnern im Rahrnen des<br />
Verkaufs, der BeschafTung und auch der Finanzierr"urg. Ein geu,isses Nivcau an eBusiness rvird<br />
somit als Standard voraussesctzt: ein Fehlen solcher modemcn Anwendunsen triffi zunehmeud<br />
auf Unverständnis.<br />
Diese Zusammenhänge müssen sich Leasinggesellschaftcn insbesondere vor dem Hintergrund,<br />
dass die Majorität ihrer Kundschaft dern Finnenkundenbereich angehört (81%), vor Augen<br />
führen. Sofer-n Leasingnachfrager in dem Vierphasenrnodell der Nutzung von cBusiness-<br />
Anwendungen weiter fortgeschritten sind als die Leasingbranche (und hiervon ist - legt man eine<br />
aktuelle StudieE zur Verbreitung von eBusiness in unterschiedlichen Branchen zu Grunde -<br />
auszugehen), kann dies zu Unzufriedenheit und rnöglicherweise sogar ciner Abwanderung von<br />
Kunden führen. Von prirnärerer strategische Relevanz flir Leasinggesellschaften ist es daher<br />
zunächst, die optimale vertriebspolitische Nutzung und Integration von eBusiness-Anr'vendungen<br />
voranzutreiben, um den Bedürfnissen und Anforderungen der Nachfrageseite entsprechen zu<br />
können. Hierdurch kann eine Kundenlovalität sestützt sowie eine Basis für eine aktive<br />
'Vgl.<br />
Studie von KPMG: .,eBusiness in dcr dcutschen Wirtschafi". 2001
12<br />
Neukundenakquisition geschaffen werden. Erst wenn an dcr Schnittstelle zum Nachfrager ein<br />
gewisser Standard hinsichtlich des Einsatzes modemer Medien crreicht ist. kann und sollte<br />
seitens der Leasin-egesellschaften zur internen ProzessoptitnierLu,g rnit Hilfe von itrte-uriertctt<br />
Ordersystemen sor,vic Datentransf-er- und Datenverarbeitungssl'stel-nen libergcgangen werdcn.<br />
Eine Formulierung entsprechcnder cBusiness-Strategien kann sich sott'tit zertlich alt dcrn<br />
Vierpl'rasenmodcl1 der N Lttzungspotcnziale oricrrtieren.<br />
6. Zusammenfassung und Ausblick<br />
In Znsammenf'assung der brsher clargele-uten Urnfragecr-ucbnisse ist zu konstaticrcn" ciass<br />
moderne Infbnnations- und Kornmunikationstncdien dcrzeit von Leasin-egesellschaficrt<br />
keineswegs durchgängig intcnsir,' -senlrtzt r,r,crden. Währcncl die Leasin-cbranche in dett<br />
Entu,icklr-urgsstuf'en der Nutzun-uspotcnziale tnodcrner Mcdien tiberwiegend in der<br />
Vertriebsphase angesiedelt ist. rveisen natürlich - in citrer inc'lividucllen Betrachtttng - einzelne<br />
Unternehmen Abweichunger-r davon auf-. Ein Vcrsuch. dic Datenbasis nach bestintmten Kritericri<br />
zu Lnterteilen" urn auf dicsern Wcge cletailliertere Kcnntnisse tibcr den Entwicklungsstand<br />
cinzelner Typen von Leasinggcsellschafien zu crhaiten. hat zu dent Ergcbnis geflihrt. dass klare<br />
Unterschiede insbcsondere zwischen kleinen und großcn Leasinggcscllschaficn vorhanden sind.<br />
Vor allern große konzernangehörigc Unternchmen lvcisct-t crheblichc Forschrittc auch in-t<br />
Bereich der BeschafTung und sogar vereinzclt bei der Ddtenverarbcitutrg und rcrualtltttq auf-.<br />
wohingegen viele kleinerc Gesellschaften das Internct tiber dic cint-ache Präsentatiott hinatts<br />
nicht nutzen. Ferner konnten Unterschiede zr'vischen hcrstellerabhängigen tttlcl<br />
herstellerunabhängigen Leasinggeselischaften ausgetnacht r'vcrden. Dabci zeu-scll Erstcre r ot-l<br />
einern besonders hohen Engagcrnent bei der hnplernentierllng integriencr Datetrtransf-er- Lrrld<br />
Datenverarbeitungssystel-ne ir-n Rahmen der Bestellung voll Lcasin-uobjekten:<br />
herstellerunabhängige Gesellschaften fokussieren mehr die Schnittstelle zun't Leasin-snchttter.<br />
indem sie eBusiness-Lösnngen zr,vecks Vcrbesserung der Kundenakquirientn-q und -bindun-e<br />
einsetzen. Eine ähnliche Ausrichtung ist auch bei einer Unterscheidr-rng zrvischen dem<br />
Small-/Medium-Ticket- und dem Big-Ticket-Leasing zu erkentren. Währcnd bei Leasingobjekten<br />
mit niedrigern Anschaffungswelt eine aktive Nutzung des lnternet in erster Linie zwecks<br />
Verbesserung und Vereinfachung der Beziehr-rng sowie der Transaktionsabwicklung irn Geschäft<br />
mit Leasingnehmern erfolgt. steht bci höherwertigen Objekten die Bestellung beim Hersteller<br />
und im Rahmen der Vertriebstätigkeit lediglich die Kontaktar-rfhahme mit (potenziellen)<br />
Leasingnehmern irn Mittelpunkt.
1 a<br />
Bezüglich der bislang ungenutzten Potenziale des Internet. die es ktinftig richtig zu interpretieren<br />
und auszuschöpf-en gilt, haben die Ergebnisse der Umfrage auch eindeutig die Schwachpunkte<br />
bzw. Hinderungsfaktoren, die einer weiter flihrenden Nutzung entgegenstehen, zu erkennen<br />
gegeben. Die weit verbreitete Besorgnis über eine verstärkte Konditionentransparenz spielt<br />
hierbei eine nicht zll unterschätzende Rolle - ein Faktor. der nur durch eine entsprechende<br />
strategische sou,ie preispolitische Positioniemng entkräftet werden kann. Ein efflzientes und<br />
zielorientiertes strategisches Management scheint aber gerade ein weiterer Schwachpunkt von<br />
Leasinggesellschaften im Rahmen der hnplementierung von eBusiness-Anwettdungen zu sein.<br />
Von daher ist als ein Ergebnis der Urnfiage zu betonen, dass ein zukunftsorientierles eBusiness<br />
bei Leasinggesellschaften nur mit Hilfe eincr aktiven Formuliemng von strategischen Zielen und<br />
Vorgehensu'eisen dLrrch die oberen Managementebenen vorangetrieben u'erden kann.
Anhang<br />
11<br />
UNIVERSITAT ZU KÖLN<br />
Forschungsinstitut für Leasing<br />
Professor Dr. Hans E. Büschgen<br />
Bittc zurück per Fax (02 2l'470 50 -59) odcr per Brief an :<br />
Forschungsinstitut für Lcasing art der<br />
Universität zr-r Köln<br />
Albertus-Magnus-Plätz<br />
50923 Kriln<br />
..Einsatz moderner Informations- und Kommunikationsmedien bei<br />
(1) Institutionelle Aspekte<br />
Leasin ssesell schaft en''<br />
(a) Unternehmensstruktur<br />
Ist Ihre Gescllschati sclbständig'l Cichör't sic e inetr Konzcut att'.'<br />
(b) Herstellerabhänsiskeit<br />
In u'elchcr Beziehurig stchen Sic zuru Herstcllcr dcr l-easingob.lcl 300
(3) Aspek te zur Beziehun g Leasin ggesellschaft/Kun de<br />
a) Kunden<br />
Wcr gehörr überrv'iegcnd zu Ihrer Kundschaft'l<br />
Firmenkundcn<br />
Privatkunden Offcntliche HandiKomrnunallcasins<br />
b) Ansprechwege<br />
Sprechcn Sie potenziellc Kunden aktiv an?<br />
Wenn ja" tiber r'velche Medien:<br />
Telefbn<br />
Ja Ncin. keine direkte Kunclcnansprache<br />
Cal l-Centcr( Outbound-')<br />
Prospekte/Anschreiben<br />
Fcmsehrverbung/'Radiowerbung<br />
Intemct<br />
Z eitschri fieni'Plakate<br />
sonstlges:<br />
45<br />
c) Erreichbarkeit<br />
Welclic Möglichkeitcn haben Ihlc Kunden. Sie anzusprechen?<br />
Call Ccrrter (lnbound<br />
") Kontaktaulnaltrne rnit Mitarbeiter<br />
irn Außendicnst<br />
irn Haus<br />
'l<br />
Wie gut ist Ihre En'cichbarkeit<br />
jederzeit via Tclcfon erreichbar (24h)<br />
jederzeit via Internet crreichbar (24h)<br />
während der üblichen Geschältszeiten via Telefon erreichbar (7 l7h)<br />
d) Marketing<br />
Welchc Marketingn"raßnahmen ftihrr Ihre Gesellschait durch 'l<br />
Fachmcsse Aussendienstbesuch Telefbnrnarketing<br />
N4ailing Fachartzcige Website<br />
Nehmen Sic Kontakt zu ootenziellcn Kunden auf elektronischern Wegc auf 'l<br />
Ja<br />
Nein<br />
Wenn.la<br />
direkte Kontaktaufhahmc in Form von Werbebrief-en oder Prospekte per E-Mail<br />
indirekte Kontaktaufnahme in Form einer eisenen Website<br />
andere<br />
(4) Ihre Präsenz im Internet<br />
a) Homepage<br />
Haben Sie eine Homepage/Website'l<br />
Ja Nein<br />
Wenn ja: - Haben Sie Ihre Website in Suchmaschinen registrieren lassen ?<br />
Ja Netn<br />
- Vem'eisen Sie bei anderen Werbemaßnahmen auf Ihre Websiteadresse ?<br />
Jc Ncin<br />
- Nutzen Sie das lntemet für Werbung außerhalb Ihrer Website<br />
(2.8. bei Suchmaschinen)'? Ja Nein<br />
Erreichen Sie Ihre bevorzugte Zielgruppe über das lnternet 'J<br />
Ja Nein<br />
"<br />
Outbound : Aktive Aquise von Kunden durch ein Call-Center.<br />
"'Inbound<br />
: Passive Betreuung von Kunden durch ein Call-Center (zwecks Erhöhung der Erreichbarkeit)
Eigncn sich Ihre Leasingob.jekte lhrer Meinung nach flir eine Vennarktung im Internet<br />
'l<br />
Ja Nein<br />
46<br />
'l<br />
Bctreiben sie Banneru'erbung ar-11'anderen Wcbsites<br />
.la Nein<br />
Falls Ihre Gescllschaft einerr Konzenr angchärt. gestaltcn Sie Ihre Hornepagc.Wcbsite<br />
unabhängig vor.n Konzcrn 'l<br />
Ja Ncin<br />
'.)<br />
Wer ist vcrantvr'ortlich 1ür Ihre Horr.repagerWcbsite<br />
Konzerntnuttcr<br />
intcmc EDV-Abteiltrng im eigenen Untcmcht.tten<br />
extelrc Dienstleistcr<br />
b) Organisation von ED\'/E-Commerce<br />
FIabcn Sie eine cigcne Abteilung liir<br />
EDV<br />
E-Comrlerce<br />
keins von beiden<br />
Wenn ja. lvicvicle Mitarbciter befassctt sich mit ...<br />
EDV t-2 3-5 5-10 >10<br />
E-Conrrnercc | -2 3-5 5- 10 > I 0<br />
Wclche Untentchurensbereiche befasscn sich bei lhncn im \\'eltestcn Sinnc' niit<br />
E-Comrnerce'J<br />
Marketing Organisation EDV Rechtsabteilung<br />
\icrtricb Sonstige:_<br />
'l<br />
Gibt cs cine organisicrte ProjcktgrLrppc fiir E-Commerce<br />
.Ia Nein<br />
Wie gut schätzcn Sre clic Websitc lhrer Gesellschafi im Vcrgleich zu atrdercn<br />
Leasingscsellschaftcn cin'l<br />
1 - sehr gut 2-gLrt 3-durchscl.rnittlich -1 -sclrlccht<br />
Wic gut schätzen Sie die Wcbsite lhrcr Gesellschafi im Vergleich zu anclercn<br />
Fir.rarrzdienstleisturrgsgesellschafien (niclit Leasing) ein'?<br />
I : sehr gut 2-eut 3:durchschnittlich '1 -schlccht<br />
Wie ott u,ird dic lnternetscite Ihrer Gesellschafi aufgerufcn (Pagevieu's)<br />
'?<br />
0-100 100-500 500-1.000 1.000-1.500 1.500-5.000 > 5.000 nichtbckannt<br />
Unterstreichcn Sie zutrcf'fendes: Pro Tae ' \\'oche r' Monat i .lahr<br />
Wic hoch schätzclt Sie den Werbenutzcu ihrer Wcbsite ein 'l<br />
Infonnationsnutzen gcring rnittel hoch<br />
Unterhaltungsnutzen gct'ine rnittel hoch<br />
Extra-/Zusatznutzen senng rnittel hoch<br />
d) Geschäftsvolumen durch E-Business<br />
Wic hoch ist schätzungsu'cise das Gcschäftsvolumen, das durch E-Busincss in Ihrem<br />
Untcrnehmen (direktindirckt) genericrt rvird'l (in 7o vom Gcsatntgeschäfisvolurnen)<br />
0-2 2-5 5-10 10-20 20-10 > 40<br />
Wic hoch schätzcn Sie das zukünftigc Geschäftsvolutren, das durch E-Business in dcn<br />
nächstcn 5 Jahren in lhrem Unternehmen generiert wird, cin?<br />
(in ?ö vont Gesamtgeschäftsvolumen)<br />
0-2 2-5 5-10 10-20 20-40 > 40
e) Websitenutzung durch Kunden/Interessenten<br />
Wofür wird Ihrc Intemetseite von den Kundenr'lnteressenten Ihrer Meinung nach am mcisten genutzt'?<br />
Information über die Gesellschaft<br />
Information zu Lcasin,qobj ekten<br />
sonstige Infbnnation<br />
Bestcllun-q<br />
Kontaktaufnahrne<br />
e) Zielgruppe<br />
Welche Zielgruppen möchten Sie mit Ihrern Internetauftritt ansprechen'l<br />
Lcasingnchrner Ktlnsutncrtten t B2C' )<br />
Hersteller (B2Brr)<br />
sonstrge<br />
l) Funktion des lnternetauftritts<br />
Welche Funktionen er$rarten Sie übcr das Internet abrvickeln zu können?<br />
Kundenansprache,Konta ktaufnahmc<br />
Abschluß r, on Lcasingverträgen<br />
Kor.rtaktaufhahme rnit dem Herstcllcr<br />
Leasingobjcktbestellung beim Herstcllcr<br />
Anbindung an intcmc DV-Systerne<br />
(5) Die Bedeutung des E-Commerce für Leasing-Gesellschaften könnte<br />
sich in der Zukunft ändern; deshalb interessiert uns lhre subjektive<br />
Einschätn ng künftiger Entwicklungen, hezogen auf die Leusing-<br />
Branche allgemein, also nicht nur auf Ihr Haus.<br />
+l<br />
Dic derzeit vergleichsrveise geringe Bedeutung des E-Commercet't für Leasing-Gesellschaften ist<br />
begründet durch...<br />
trilll roli zu trittl mgls. zu triifi nicht zu<br />
(a) Fehlende Kcnntnis liber<br />
E insatzrnöglichkeiten<br />
(b) Skepsis bczüglich des zusätzlichen<br />
Nutzens durch E,-Cornmerce heutci<br />
in dcr Zukunft<br />
(c) Unztrlcichende Sicherheit bei<br />
Tftrnsaktionen tiber Intemct<br />
(d) Bcsorgr.ris vor Konditioncntransparenz<br />
(e) Ungeeignetes Produktsortiment<br />
(0 Betrugsproblemaulgrundmangclnden<br />
persönlichen Kontaktes<br />
(g) Verlust an Kundenbindnng<br />
"<br />
Als B2C (Business to Consumer) wird der Geschäftskontakt zwischcn Lcasinggesellschait r,rnd Kunde auf<br />
elektronischem Wege (Intemet) verstanden.<br />
't<br />
Als 82B (Business to Busincss) wird der Geschäftskontakt zwischen Leasinggesellschaft und Herstcllcr auf<br />
elektronischem Wege (Internct) verstanden.<br />
't<br />
Unter E-Comrnerce (Electronic Commerce, d.h. der HandeliGeschäftsabschluss via elcktronischer Medien)<br />
versteht man die Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien zur elektronischen<br />
Integration und Verzahnung von Werlschöpfungskettcn.
Die Bedeutung des E-Commerce für Leasinggesellschaften lvird zunehmen durch...<br />
48<br />
tlil'll roll zu tnl'li nrglu. uLr trittt ntcht zLr<br />
(a) cin neues Signaturgesetz fiir Onlinetransaktioncn<br />
n tr fl tr tr<br />
(b) r,'erbrcrtcte Kenntnis dcr Ann crtdr-rngsrnöglichkcitcn<br />
! ! tr ! fl<br />
(c) bcu Lrßtes Managc-t.nct.tt von E-Cotntttcrcc tr n ! tr tr<br />
tund cntsprechcndctt.t Markcting<br />
(d) \'eränclcrles Verhaltcn von Untcnteht.nerr<br />
(dLrrch steigcndc Nachfragc nach<br />
Beschathrngsmöglichkciten tibcr c'las Internet)<br />
D ! tr D !<br />
(6) Anregungen, Anmerkungen, Kommentare usw.:<br />
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
Literaturverzeichnis<br />
Büschgen, Hans E : Praxishandbr-rch Leasing, München 1998.<br />
49<br />
Büschgen, Huns E.: Leasing als Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre. in: Leasing-<br />
Handbuch für die betriebliche Praxis" hrsg. v. Wolfrarn Eckstein und Klaus Feinen, 7.<br />
Auflagc, Frankfurt am Main 2000. 5.251-214.<br />
Büschgen, Huns E.: Leasingwirtschaft vor dern Strukturwandel Tendenzen und<br />
Perspektiven für Märkte" Untemehmen und Führungskräftc, hrsg. v. Heidrick & Struggles/<br />
Mülder & Partner. Mtinchen 2000.<br />
Büschgen, Huns E : Die Entlvicklung des Leasing als .nvissenschaflliche Disziplin, in: Der<br />
Langfristigc Kredit.5L Jg.. H.22, S.784-787.<br />
Frunke, Dirk:Leasin-e: Ein Markt in Bervegung, in: Die Bank. Nr.4.2001. S.305-308.<br />
Hermanns, Arnold; Sauter, Michael: Electronic Commerce Grr-rndla-een, Potenziale,<br />
Marktteilnchmer und Transaktionen, in: Managernent-Handbuch Electronic Comtnerce -<br />
Gmndlagen" Strategien. Praxisbeispiele, hrsg. v. Hermanns, Arnold: Sauter. Michael,<br />
Mi.inchen 1999. S. 13-29.<br />
Hudetz,, Kui: Elektronische Marktplatze - Chancen und Risiken. in: Mitteilungen dcs Instituts<br />
für Handelsfbrschung an der Universität zu Köln. hrsg. v. Müller-Hagedorn. Lothar. Nr. 5.<br />
2001 . s.73-80.<br />
Kulukota, Ruvi; Vl/hinston, Andrew B.: Electronic Commerce - A Manager's Guide. Boston<br />
et al. l99l .<br />
KPMG Consulting GmbH: eBusiness in der deutschen Wirtschaft - Status quo und<br />
Perspektiven, Berlin 2001.<br />
Loebbecke, Clsudia: eCommerce: Begriffsabgrenzung und Paradigmenwechsel, in:<br />
Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, Nr. 2, 2001. S. 93-l 08.
50<br />
Pechtl, Hans: Marketing und E-Commerce. in: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis,<br />
Nr.2,2001, S. 109-123.<br />
Porter, Michsel: Strategy and the Internet, in: Harvard Business Review. Nr. 3,2001. S. 63-<br />
78.<br />
Reichheld, Frederick F.; ScheJter, Plril: E-Loyalty: Your secret weapon on the web, in:<br />
Harvard Business Review', July-August 2000, S. 105-113.<br />
Sauter, Michael: Chancen. Risiken und strategische Herausforderungen des Electronic<br />
Commerce, in: Managernent-Handbuch Electronic Cotntnerce - Grundlagcn, Strategien.<br />
Praxisbeispiele. hrsg. v. Hennanns, Amold; Sauter. Michael. München 1999. S. l0l-117.<br />
Storbeck, OlaJ'.lch bremse nicht bei E-Business. in: Nctzwert - E-Business für Entscheider.<br />
Beilage Handelsblatt votn 10.9.2001, S. N5.<br />
Wumser, Christoph: Electronic Commerce thcorctische Grr"rndlagen und praktische<br />
Relevanz. ir-r: Electronic Commerce - Gmndlagen und Perspcktiven. hrs-q. \'. Wamser,<br />
Christoph. Mlinchcn 2000. S. 3-27.<br />
Weiber, Rolfi Kollmann, Tobiss: Wettbewerbsvorteile ar-rf virtuellen Märkten. in: Handbtrch<br />
Database Management, hrsg. v. Link, Jörg et a1..2. Auflage, Ettlingen 1997. S. 512-,530.
5l<br />
Besondere Problemstellungen von Leasinggesellschaften<br />
im Rahmen des KonTraG<br />
(Vortrag an der Universität zu Köln am 9 . Mai 2001)<br />
l. Problernstellung<br />
von Karl-Heinz Helfrich<br />
2. Anforderungen des KonTraG an das Risikornanagement von Unternehmen<br />
3. Die Geschäftstätigkeit von Leasinggesellschaften als Gestaltun-esbedingung<br />
des Risikomanagements<br />
4. Risikoinventur: Risiken des Mobilien-Leasinggeschäfts<br />
5. Spezielle Fragestellungen der Steuerung von Bonitätsrisiken<br />
6. Analyse bilanzieller Risiken<br />
7. Analyse von Zinsänderungsrisiken<br />
8. Schlussbemerkungen
l. Problemstellung<br />
52<br />
Vermeintliches und tatsächliches Miss-Management, Missbrauch eingeräumter Kompetenzen<br />
sowie eine Reihe mehr oder weniger spektakulärer Unternehmenskrisen bzw.<br />
zusammenbrüche gaben in der Vergangenheit rechtspolitisch wie auch betriebswirtschaftlich<br />
immer wieder Anlass zu Diskussionen darüber, wie eine .,wünschenswerte" - d.h. den<br />
lnteressen der Anteilseigner und anderer Unternehmensbeteiligter entsprechende<br />
Unternehmensführun g und -überwachung sichergestel lt werden könnte.<br />
Sicherlich nicht zuletzr vor dem Hintergrund nachhaltig gestiegener Insolvenzzahlen hat der<br />
deutsche Gesetzgeber die internationale Diskussion urn die Effektivitat von Systetnen der<br />
Unternehmensführung und -kontrolle Mitte der neunziger Jahre aufgegriffen und einigen der<br />
dabei erörterten Fragen rnit dem 1998 in Kraft getretenen.,Gesetz zur Kontrolle und<br />
Transparenz irn Unternehmensbereich" kurz KonTraG genannt einen gesetzlichen<br />
Rahmen verliehen. Ziele dieses Artikelgesetzes waren unter anderern die Stärkung der<br />
Kontrollfunktion des Ar,rfsichtsrates, die Erhöhung der Transparenz im Rahmen der externen<br />
Berichterstattung, die Verbesserung der Kontrolle durch die Anteilseigner sowie die<br />
Verbesserung der Qualitat der Abschlusspnifung. Dabei - und dieser Aspekt steht im<br />
Mittelpunkt unseres heutigen Themas wendet sich das KonTraG rnit besonderer<br />
Aufmerksamkeit auch Fragen des Umgangs mit untemehmerischen Risiken zu: So ist der<br />
vorstand einer Aktiengesellschaft nach der Erweiterung des :\ 9l Abs' 2 des Aktiengesetzes<br />
nunmehr dazu verpfl ichtet,<br />
,, ... geeignete Ma.f3nahmen zu treffen, inshesondere ein Überv'uchungs't.t',\lem einztrrichten,<br />
damit den Fortbestand der Gesellschat'i ge/tihrdende Enhricklungen./rüh erkannt v'erclen"<br />
Kurz gesagt bedeutet diese Formulierung, dass der Vorstand einer Aktiengesellschaft<br />
sicherstellen muss, dass das vom ihm geflihrte Untemehmen ilber ein angemessenes<br />
Risikomanagernent-System verftigt. Besonderes Gewicht erlangt diese spezielle<br />
Organisationsverantwortung dadurch, dass Vorstand und Aufsichtsrat im Falle einer Klage<br />
gezwungen sind nachzuweisen, dass ein funktionsflihiges Risikomanagement-System zum<br />
betreffenden Zeitpunkt bestanden hat und dass dessen Funktionsf?ihigkeit überwacht wurde.
53<br />
Nun könnte man an dieser Stelle zu Recht einwenden, was diese Regelungen eigentlich mit<br />
Leasinggesellschaften zu tun haben, bezieht sich das KonTraG doch offensichtlich auf<br />
Aktiengesellschaften, während die überwiegende Zahl der deutschen Leasinggesellschaften in<br />
der Rechtsform der GmbH firmiert. In der Tat wurde in das GmbH-Gesetz keine<br />
vergleichbare Regelung aufgenommen. Angesichts der Gesetzesbegnindung zum KonTraG<br />
muss allerdings davon ausgegangen werden, dass fiir Gesellschaften mit beschränkter<br />
Haftung - ab einer bestirnmten Untemehmensgröße und organisatorischen Komplexität -<br />
sinngemäß das gleiche wie für Aktiengesellschaften gelten soll; rnit anderen Worten: Die<br />
Neuregelungen im Aktiengesetz entfalten eine Ausstrahlungswirkung auf den<br />
Pflichtenrahmen der Geschäftsführung anderer Gesellschaftsformen. Dies ergibt sich auch aus<br />
den Kommentierungen zum GmbH-Gesetz, denen zufblge die dort umrissene .,Sorgfalt eines<br />
ordentlichen Geschäftsmannes" der im Aktiengesetz konturierten Sorgfaltspflicht des<br />
Vorstandes entspricht. Also muss sich auch die Leasingbranche den Anfordemngen dieser<br />
gesetzlichen Neuerung stellen. Sicherlich haben sich Leasinggesellschaften schon itntner tnit<br />
Fragen des Risikomanagement beschäftigt, zählen doch die Beurteilung, die bewusste<br />
Übernahrne und das ,,Handling" von Risiken seit jeher zu deren Kerngeschäft. Doch sind sie<br />
seit in Kraft treten des KonTraG eben nicht mehr - wie dies bislang der Fall war - in der<br />
Gestaltung ihrer Risikomanagement-Systeme fiei, sondem müssen sich hierbei nunmehr auch<br />
an gesetzlichen Vorgaben orientieren. Und viele der bislang zur Risikoanalyse eingesetzten<br />
lnstrumente werden in Zukunft sicherlich kritischer von den Wirtschaftspnifern hinterfragt<br />
werden. als dies bislans der Fall war.<br />
Welche Anforderr-rngen aus der gesetzlichen Neuregelung an das Risikomanagement von<br />
Untemehmen erwachsen und welche besonderen Problemstellungen mit der Risikosteuerung<br />
bei Leasinggesellschaften verbunden sind, ist Gegenstand der folgenden Ausführungen.<br />
Hierbei wendet sich der zweite Abschnitt zunächst den Vorgaben zu, die sich aus dem<br />
Aktiengesetz flJrr die Ausgestaltung eines Risikomanagement-Systems ableiten. Anschließend<br />
wird ein kurzer Überblick über die Geschäftstätigkeit von Leasinggesellschaften gegeben. um<br />
den weniger mit dem Leasinggeschäft vertrauten Lesem einen kleinen Eindruck davon zu<br />
vennitteln, was dieses Geschäft ausmacht. Doch auch aus einem anderen Grund ist dieser<br />
Punkt im Zusammenhang des Risikomanagement als wesentlich anzusehen: Ein gutes<br />
Verständnis der Geschäftstätigkeit ist - wie die Erfahrung zeigt - eine der zentralen<br />
Voraussetzungen, um die Risikosituation eines Unternehmens überhaupt erfassen und<br />
analysieren zu können. Eine umftingliche und tiefgehende Geschäftsanalyse - hierauf sei
54<br />
bereits an dieser Stelle besonders hingewiesen, weil dieser Aspekt in der Literatur häufig<br />
übersehen wird - muss insofern Ausgangspunkt aller Risiko-bezogenen Überlegungen und<br />
Organisationsmaßnahmen sein. Auf den Überlegungen zur Geschäftstätigkeit aufbauend<br />
werden dann die wichtigsten Risiken erläutert, rnit denen sich Leasinggesellschaften<br />
auseinandersetzen müssen. Hiervon werden schließlich einige herausgegriffen. um die<br />
Besonderheiten des Risikomanagement im Leasinggeschäft zu verdeutlichen und mögliche<br />
Lösungsansätze der Praxis aufzuzeigen.<br />
2. Anforderungen des KonTraG an das Risikomanagement von Unternehmen<br />
Mit Blick auf die bereits zitierte Norm über die Einrichtung eines Risikomanagement-<br />
Systems ftillt unmittelbar auf, dass hierin - wie im gesarnten KonTraG - keine konkreten<br />
Aussagen darüber getroffen werden, welche Bestandteile und welche Struktur ein solches<br />
System aufweisen sollte. Ganz bewusst hat der Gesetzgeber darauf verzichtet, umfassende<br />
und detaillierte Vorgaben zu rnachen und sich statt dessen des Instruments der aus<br />
unbestimmten Rechtsbegriffen zusammengesetzten Generalklausel bedient. Der Gmnd dafür<br />
ist leicht ersichtlich. wenn man sich vor Augen ftihrt, dass die Leitungsauf-eabe des Vorstands<br />
bzw. der Geschäftsführung in unserer Wirtschaftsordnung rnaßgeblich durch das Prinzip der<br />
untemehmerischen Freiheit bestirnmt wird. Umfassende, durch Verankerung in einem<br />
formellen Gesetz jedoch starre Verhaltensvorgaben' würden diesern elementaren Prinzip<br />
vollkommen zuwiderlaufen. Damit stellt sich aber für jeden Vorstand bzw. Geschäftsfi"ihrer<br />
ganz individuell die Frage, wie die besagte aktienrechtliche Nonn für ,,sein" Unternehmen<br />
inhaltlich ausgefüllt werden kann.<br />
Hinsichtlich der Anforderungen, die an ein Risikomanagement-System zu stellen sind" lässt<br />
sich dem Gesetzestext zunächst unmittelbar nur entnehmen, dass die Sichemng des<br />
Unternehmensbestands oberste Zielgröße des Risikomanagement ist und dass das System mit<br />
gewissem zeitlichem Vorlauf auf Bestands-geführdende Entwicklungen reagieren muss.
55<br />
Anforderungen des KonTraG an das Risikomanagement<br />
von Unternehmen<br />
-Der Vorstand einer Aktiengesetlschaft hat geeignete Maßnahmen zu treffen,<br />
insbesondere ein Uberwachungssystem einzurichten, damit den Fortbestand<br />
der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen frühzeitig erkannt werden."<br />
Bindungswirkung für andere<br />
Rechtsformen?<br />
Gilt auch für Gesellschaften mit<br />
beschränkter Haftung!<br />
9 91 Abs. 2 AktG<br />
wt--t<br />
Bestandssicherung als Zielsetzung<br />
ausreichender zeitlicher Vorlauf<br />
J L<br />
w<br />
Unternehmenskrise als Ausgangspunkt<br />
c Vermeidung von Zielverfehlungen<br />
o Krisen-Frühwarnung<br />
o Rend ite- R isi ko- Steueru ng<br />
Abb. l: Das KonTraG als Rahmenbedingung des Risikomanagement<br />
Von der Zielsetzung der Bestandssicherung gelangt man gedanklich jedoch schnell zu dem<br />
Begriff der Unternehmenskrise, der in betriebswirtschaftlicher Hinsicht konkreter fassbar ist.<br />
Folgt man der Auffassung, dass der Bestand eines Unternehmens maßgeblich von der<br />
Zielrealisiemng seiner Anspruchsgruppen abhängt, so lässt sich eine Unternehmenskrise als<br />
Zustand beschreiben, in dem die Zielerreichung dteser Anspruchsgruppen so welt<br />
beeinträchtigt ist, dass diese ihre Beiträge zufit Unternehrnen einstellen.<br />
Nun hängt die Zielerreichung der einzelnen Anspruchsgruppen wiederum maßgeblich von der<br />
Er:reichung der (finanziellen) Unternehmensziele ab. Verfehlt ein Unternehmen also seine<br />
Ziele tn einem Maß, das existentiellen Anspruchsgruppen nicht mehr tolerierbar erscheint,<br />
gehen hierdurch wichtige Ressourcen verloren, mit der möglichen Folge, dass ,"sich das<br />
Unternehmen auflöst". Für ein Risikomanagement-System ergeben sich aus dieser<br />
Überlegung folgende Anforderungen:<br />
( I ) Es muss sicherstellen, dass die existenziellen Unternehmensziele nur innerhalb<br />
bestimmter Bandbreiten schwanken, die so gesteckt sind, dass den Vorstellungen<br />
möglichst aller Anspruchsgruppen entsprochen werden kann.
)o<br />
(2) Es muss sicherstellen, dass Krisen verursachende Entwicklungen hierzu zählen auch<br />
eintretende Risiken bereits zu einem Zeitpunkt erkannt werden, zu dem noch Zeit zur<br />
Einleitung von Gegenmaßnahmen besteht.<br />
(3) Es muss im Hinblick auf die Erwaftungen der Kapitalgeber sicherstellen, dass ein<br />
ansemessenes Verhältnis zwischen Ertrag und Risiko des Geschäfts besteht.<br />
Damit wird deutlich, dass ,,Risikomanagernent" im Sinne des Aktiengesetzes sehr weit zu<br />
verstehen ist und zugleich auch Ertragsmanagement bedeutet. Gleichwohl soll hier eine<br />
Beschränkung auf Aspekte der Risikosteuerung im engeren Sinne, also auf Fragen der<br />
Analyse und Handhabung von Risiken. erfolgen.<br />
{Jm den Anforderungen des Aktiengesetzes Rechnung zu tragen, gestaltet man ein<br />
Risikomanagement-Systern idealerweise als in die Zukunfl gerichteten Steuerungsprozess -<br />
genauer müsste man eigentlich von einem Regeh-rngsprozess sprechen -, der die in<br />
nachstehender Abbilduns darsestellten Phasen umfasst.<br />
. Filiale D<br />
Abb. 2: Risikomanagement als Steuerungsprozess<br />
'I'<br />
a<br />
Vorstand<br />
Zourulubteilungen<br />
. Kreditpr'ülurrg<br />
In der Phase der Risikoidentifikation uncl Systematisiemng geht es zunächst darum<br />
herauszufinden, welche Risiken überhaupt bestehen und wie diese Risiken wirken.<br />
Gleichzeitig ist auch darüber zu entscheiden, welche dieser Risiken aufgrund ihrer Bedeutung<br />
als Steuerungs-relevant einzustufen sind. Man kann diese Phase auch als Risikoinventur<br />
bezeichnen. Da der Steuerungsprozess mehr als einmal durchlaufen wird, beinhaltet diese
)t<br />
Phase nattirlich auch. die Ergebnisse der Risikoinventur immer wieder kritisch zu<br />
hinterfragen. Im zweiten Schritt. der Phase der Ri,sikoanalrse und -hew'ertung. gllt es dann,<br />
für jede rclevante Risikoart einen Wert zu ermitteln. der die möglichen finanziellen<br />
Konsequenzen eintretender Risiken zum Ausdruck bringt; die einzelnen Risikowerte sind<br />
zusammenzufassen und den vorhandenen Deckungsmitteln gegenüberzustellen. Sollte sich<br />
dabei ergeben. dass die vorhandenen Risiken die Tragftihigkeit der Gesellschaft übersteigen,<br />
ist darüber naclizudenkcn, u,elche Maßnahmen gecignet sind, um wicder ein ,.angetnessenes"<br />
Verhältnis zwischen beiden Größen zu effeichen. Welches Verhältnis als angemessen zu<br />
bezeichnen ist, entscheidet sich vor dem Hintergrund der Risikoneigung der Anteilseigner<br />
bzw. der Untcmehrnensleitung. Der Steuerungskreislauf wird schließlich dadurch<br />
geschlossen. dass clie eingeleiteten risikopolitischen MafJnahmen hinsichtlich ihrer<br />
Wirksarnkeit übern'acht werden. Außerdem ist danach zu fi'agen. ob bzu'. inwieweit sich die<br />
den getroffenen Stcuerun-esentscheidungen zu Grunde liegenden Annahmen als realistisch<br />
eru'eisen (Modellrisikcn). Dabei sind zwei Aspekte l'on zcntraler Bedeutung: Erstens -<br />
theoretisch eine Selbstverständlichkeit - muss der gesarnte Prozess nattirlich durch ein<br />
Risiko-bezogenes Informationssystem begleitet werden. das allen Entscheidungsträgern die<br />
erforderlichen Informationen zeitnah und lückenlos bereitstellt. Deckt man hierbei aber nur<br />
die fbrmale Seite ab. also das Risikoberichtswesen. f-ehlt ein wesentliches Element:<br />
Mindestens von gleicher Bedeutung ist närnlich. dass ein infbnnales Kommunikationssystem<br />
entsteht. durch das särntliche Verantworlliche unrnittelbar von neu entstehenden und bis dahin<br />
unbert'rcksi chti eten Risiken erfähren.<br />
Hierrnit in Zusammenhang steht der zweite an-eesprochene Aspekt. nämlich<br />
Risikomanagement im Unternehmen nicht als Institution. sondern als Funktion zu begreifen.<br />
Sicherlich ist immer auch eine lnstitution erfbrderlich. die den Steuerungsprozess trägt<br />
(koordiniert). Doch sollte dies nicht darüber hinwegtäuschen. dass Risikornanagement<br />
Aufgabe aller Mitarbeiter im Unternehmen ist - aus diesern Grund ist ar"rch die Darstellr.uig<br />
des Steuerungskreislaufs auf der Folie mit einem Organigramm unterlegt. Ein entsprechendes<br />
Grundverständnis und Verantwortungsgeftihl bei den Mitarbeitern zu entwickeln. ist eine<br />
wichtige, vielfach unterschätzte Aufgabe des Risikomanagement. Hinsichtlich des<br />
Handlungsbedarfs, der sich aus der Erweiterung des $ 9l AktG ergibt. sind es im<br />
Wesentlichen vier Handlungsfelder, die hierdurch abgegrenzt rverden; nämlich<br />
Systemgestaltung, Systemdokumentation, Organisation sowie Berichtswesen und<br />
Kommunikation.
Systemgestaltung<br />
und Methoden<br />
58<br />
Handlungsfelder<br />
Dokumentation Organisation<br />
. Verfahren zur Messung . Umfassende Darstellung<br />
u. Analyse bestehender des RM-Systems (organi-<br />
Risiken<br />
. Steuerungsverfahren<br />
satorische Maßnahmen)<br />
in Form eines Risikohandbuchs<br />
Abb. 3: Handlungsfelder des KonTraG<br />
Handlungsbedarf<br />
Risikoberichtswesen u.<br />
interne Kommunikation<br />
. Risiko-bezogene . Bedarfs-gerechtes und Zeit-nahes<br />
Gestaltung von<br />
Prozessen und<br />
Risikoberichtswesen<br />
. reibungslose Risiko-<br />
Strukturen Kommunikation<br />
Bei der Sr.stemgestaltung geht es vor allem darum. cinc sachgerechte metl-rodischc Basis zu<br />
schaffen, um eine realistische Einschätzung der Risikolage des Unternehmens l'otnehuen zu<br />
können. Wie auch im Finanzierungsgeschäft zählt hierzu irr"r Lcasinggeschäff zunächst cin<br />
Rating-System. dass eine differenzierte und rnöglichst zur'et'lässigc Klassif-izierung dcr<br />
einzelnen Kunden nach ihrer Bonität errnöglicht. Denn cin solches System stellt die<br />
Ausgangsvoraussetzung für die Analyse des Kreditrisikos dar. dass dcn -eröf3ten Anteil anr<br />
Gesamtrisiko einer Leasinggesellschaft ausmacht. Es gilt aber auch. geei-unete<br />
Bewertungsverfahren einzusetzen, um jcder Risikoart einctr entsprechenden Risikou ert<br />
zuordnen zu können.<br />
Neben methodischen nehmen auch organisatorische A.spekte einen sehr l-rohen Stellenn'ert<br />
ein. Wie sich aus den Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer ergibt. ist dabci<br />
insbesondere dafür zu sorgen, dass eindeutige, von Dritten nachvollziehbare Regelungen über<br />
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sowie klare Regelungen der betrieblichen Abläufe<br />
bestehen. Die Einrichtung eines Überwachungssystems für die Funktionsftihigkeit des RM-<br />
Systems und die Einhaltung der getroffenen Maßnahmen I?illt ebenfalls unter diesen Punkt.<br />
Diese Aufgaben könnte beispielsweise von einer internen Revision wahrgenommen werden.<br />
Die lückenlose und ausführliche Dokumenlation des Risikomanagement-Systems stellt ein<br />
weiteres wichtiges Aufgabenfeld dar, das im Rahmen der Umsetzung der gesetzlichen
59<br />
Vorgaben anzugehen ist. Gemeint ist damit die Erstellung eines Risikohandbuchs. Dieses ist<br />
deshalb von so hoher Bedeutung, weil es die Grundlage der gesetzlich vorgeschriebenen<br />
Funktionspnifung des Risikomanagements durch die Wirtschaftsprüfer ist. Fehlende oder<br />
unvollständige Dokumentation sowie Unstimmigkeiten zwischen Dokumentation und<br />
tatsächlicher Handhabung können dabei (laut Prüfungsrichtlinie des IDW) zu Zwetfeln an der<br />
dauerhaften Funktionsftihigkeit des Risikomanagement-Systems führen. Und schließlich -<br />
hierauf wurde bereits hingewiesen - ist natürlich für eine systematische, reibungslose und<br />
zügige Weiterleitung Risiko-bezogener Informationen zLr sorgen (Berichtswesen und<br />
Kornntunikution). Als Voraussetzung hierflir wird dabei ein angemessenes Risikobewusstsein<br />
sowie eine ausreichende Kommunikationsbereitschaft aller Mitarbeiter angesehen. Diese<br />
Eigenschaften sind u.a. durch entsprechende Schulungsmaßnahmen zu fördem.<br />
Man sieht also. dass Risikornanagement nach KonTraG bzw. AktG selbst im engeren Sinne<br />
verstanden - weitaus mehr ist. als man zunächst vennuten könnte. Nimmt man die<br />
gesetzlichen Vorgaben emst und aus betriebswirtschaftlicher Sicht spricht alles dafür. dies<br />
zu tun so gilt es eben nicht nur, geeignete Risiko-Messverfähren einzuflihren. Es gehört<br />
auch dazu, die entsprechenden organisatorischen Rahmenbedingungen zu schaffen. Gerade<br />
diesen Punkt, der in der Literatur eine eher geringe Rolle spielt, sollte rnan, wie die<br />
Erfahrunsen in der Praxis zeigen, nicht unterschätzen.<br />
3. Die Geschäftstätigkeit von Leasinggesellschaften als Gestaltungsbedingung<br />
des Risikomanagements<br />
Grundsätzlich besteht die Geschäftstätigkeit von Leasinggesellschaften darin, nach Maßgabe<br />
ihrer Kunden Investitions- bzw. Konsumgüter zu etwerben und den Kunden diese Objekte fiir<br />
einen begrenzten Zeilraum gegen Entgelt zur Nutzung zu überlassen. Im Anschluss an die<br />
Zeit der Nutzungsüberlassung erfolgt die Verwefiung der im Eigentum der<br />
Leasinggesellschaft stehenden Objekte, und zwar, indem diese an den Leasingnehmer<br />
beziehungsweise über den Markt verkauft oder dem Leasingnehmer weiterhin gegen Entgelt<br />
überlassen werden (Mietverlängerung). Es sind also im Wesentlichen zwei Aktivitäten, die<br />
die Geschäftstätigkeit von Leasinggesellschaften ausmachen, nämlich zuln einen die<br />
Nutzungsüberlassung, die zugleich meist eine Finanzierungsfunktion erfüllt. und zum anderen<br />
die Objektverwertung, das heißt, der Handel mit gebrauchten Maschinen, Fahrzeugen usw.
60<br />
Hinzukommen kann eine Dienstleistungsfunktion. die darin besteht, den Kunden bestimmte<br />
Aufgaben abzunehmen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Objekt bzw. dem<br />
Objektbetrieb stehen, so z.B. Wartungsarbeiten, Wittschaftlichkeitsrechnungen oder<br />
ähnliches. Zwar erbringen die Leasinggesellschaften diese Leistungen nicht selbst, sondern<br />
greifen hierzu auf Subunternehmer zurück; doch können sie diese Leistungen aufgrund von<br />
Nachfiagemacht und besserem Marktüberblick in aller Regel kostengünstiger und<br />
zuverlässiger gewährleisten als ihre Kunden dies könnten.<br />
Geschäfts-Sparten<br />
lmmobilien-Leasing Mobilien Leasing<br />
Nutzungsüberlassung<br />
Abjektverwertung<br />
Service-Leistung<br />
Abb. 4: Geschäftstätigkeit von Leastnggesellschaften<br />
Je nach Art der im Wege des Leasing überlassenen Objekte ist zwischen Mobilien- Lrnd<br />
Immobilien-Leasinggeschäft zu unterscheiden. lm Intmobilien-Leasing tätige Gesellschaften<br />
konzentrieren ihre Aktivitäten in erster Linie auf das Leasing von Grundstlicken. Gebäuden.<br />
standortgebundenen Betriebsanlagen (t.8. Kraftwerke) sowie Großrnobilien wie etwa<br />
Flugzeugen oder Schiffen. Die Refinanzierung der Leasinggeschäfte erfolgt dabei rneist unter<br />
steuerlichen Gesichtspunkten über so genannte Objektgesellschaften. also über<br />
Beteiligungsmodelle, um auf diese Weise die Kapitalkosten zu senken. Geschäftsgegenstand<br />
des Mobitien-Leasing-GeschäJis sind hingegen bewegliche Wirtschaftsgüter, so vor allern<br />
Kraftfahrzeuge, Produktionsmaschinen sowie EDV-Geräte und Büromaschinen. Anders als<br />
irn lmrnobilien-Leasing-Geschäft erfolgt die Finanzierung hier durch Forderungsverkauf -<br />
eine Finanzierungsmöglichkeit, die sich ebenfalls Steuer reduzierend auswirkt - sou'ie durch<br />
Aufnahme mittel bis langfristiger Darlehen.<br />
9 39 AO / Leasingerlasse I<br />
Operate Leasing Finanzierungs-Leasing<br />
Vollamortisationsvertrag<br />
Teilamortisationsvertrag
6l<br />
Dass sich Investitionsvolumina und Risiken in beiden Geschäftszweigen ganz grundlegend<br />
voneinander unterscheiden, liegt auf der Hand; da eine differenzierende Darstellung jedoch<br />
den Rahmen dieses Beitrags übersteigen würde, soll hier eine Beschränkung auf das<br />
Mobilien-Leasinggeschäft erfolgen. Nicht unerheblich wenn man nach den Risiken des<br />
(Mobilien-)Leasinggeschäfts fragt, ist die Unterscheidung zwischen den verschiedenen<br />
Produktarten, und zwar zwischen Operate- und Finanzierungsleasing sowie zwischen Voll-<br />
und Teilamortisationsverträsen.<br />
Bei der Produktgestaltung sind Leasinggesellschaften an die so genannten Leasingerlasse der<br />
Finanzverwaltung gebunden. Diese Erlasse dienen der Konkretisierung des $ 39 der<br />
Abgabenordnung. einer Generalnorm, die die steuerliche Zurechnung von Wirrschaftsgütern<br />
regelt. Ohne an dieser Stelle auf Einzelheiten einzugehen. sei hierzu nur gesagt, dass sich die<br />
Zurechnung von Wirtschaftsgütern in steuerlicher Hinsicht danach bemisst, ob der Besttzer<br />
den Eigentümer während der Nutzungsdauer wirtschaftlich von der Einwirkung auf das<br />
Wirtschaftsgut ausschließen kann. Wie diese sehr allgemein gefasste Formulierung speziell<br />
im Falle des Leasing zu interpretieren ist, wird - wie gesagt - durch die Leasingerlasse<br />
geregelt. Ist beabsichtigt - und dies ist meist der Fall dass das Leasingobjekt steuerlich dem<br />
Leasinggeber zugerechnet wird, muss sich die Vertragsgestaltung innerhalb des durch die<br />
Erlasse vorgegebenen Rahmens bervegen. Grundsätzlich geht es dabei um die Frage, welcher<br />
der Vertragspartner die Chance einer Wertsteigerun! und das Risiko einer Wertminderung des<br />
Leasingobjekts trägt.<br />
Im Wesentlichen sind es zwei Kriterien, die für die Zurechnungsfrage ausschlaggebend sind.<br />
nämlich die Amortisation und das Verhältnis von Veftragslaufzeit zu betriebsgewöhnlicher<br />
Nutzungsdauer. Stark vereinfacht gesagt sieht die Regelung vor, dass das Leasingobjekt in<br />
steuerlicher Hinsicht dann dem Leasinggeber zugerechnet wird, wenn<br />
der Leasingnehmer<br />
Herstellungskosten des<br />
garantiert und<br />
die Vertragslaulzeitzwischen<br />
40 und 90 Prozent der betriebssewöhnlichen<br />
Nutzungsdauer liegt.<br />
einen vollständigen Rückfluss der Anschaffungs- bzw.<br />
Objekts sowie aller entstehenden Kosten des Leasinggebers
62<br />
Sind diese Voraussetzungen erflillt, spricht man von so genanntem Finanzierungsleasing.In<br />
Gegensatz dazu handelt es sich um Operate-Leasing. wenn die vom Leasinggeber<br />
eingesetzten Mittel während der Vertragslaufzeit nur teilweise zurückfließen und das Objekt<br />
mehrmals vermietet werden muss, um eine vollständige Amortisation zu erreichen. Es bedarf<br />
keiner großen Überlegungen, um zu erkennen, dass sich diese beiden Produktarten ganz<br />
grundlegend hinsichtlich ihrer Risikostruktur unterscheiden: Während das Investitionsrisiko<br />
beim Finanzierungsleasing vollständig vom Leasingnehmer getragen wird, liegt es im Falle<br />
des Operate-Leasing beim Leasinggeber. lnsofem geht mit dem Abschluss von Operate-<br />
Leasing-Geschäften eine erhebliche Risikokumulation einher, die von der Leasinggesellschaft<br />
hervoragende Objekt- und Markt-bezogene Kenntnisse sowie hohe Kompetenz in der<br />
Obj ektverrvertung verlan gt.<br />
Im Rahmen des Finanzierungsleasing, das in der Praxis überwiegt und auf das sich die<br />
folgenden Ausführungen konzentrieren, sind wie bereits angedeutet - wiederum zwei<br />
Vertragstypen von Bedeutung, nämlich der Voll- und der Teilamortisationsvertrag.<br />
Vollamortisationsverträge zeichnen sich dadurch aus. dass die investierten Mittel des<br />
Leasinggebers bereits während der Vertragslaufzeit vollständig über die Leasingraten<br />
zurückfließen. Bei Teilamortisationsverträgen ist dies nicht der Fall. Zwar garantierl der<br />
Leasingnehmer auch hier die Vollamortisation, doch fließt nur ein Teil des eingesetzten<br />
Kapitals über die Leasingraten zur-Lick. Der noch offene Rest ist als Einmalzahh-rng nach<br />
Ablauf der Vertragslaufzeit ftillig und wird gegebenenfalls mit einem Verrvertungserlös<br />
verrechnet.<br />
In Bezug auf die Risiken dieser Produkttypen ist wichtig zu erkennen. dass bei Teil-<br />
amorlisationsverträgen dem Kundenvorteil einer niedrigeren und nutzungsgerechteren<br />
Ratenbelastung während der Vertragslaufzeit aus Sicht der Leasinggesellschaft der Nachteil<br />
erhöhter Risiken gegenübersteht. Denn mit zunehmendem Zeithorizont von Zahlungen steigt<br />
die Unsicherheit hinsichtlich der Entwicklung der Kundenbonität und des Objektwertes und<br />
damit die Möglichkeit, dass es ntZahTungsausfüllen kommt.
4. Risikoinventur: Risiken des Mobilien-Leasinggeschäfts<br />
OJ<br />
Die Risikoinventur bildet den Ausgangspunkt aller Risiko-bezogenen<br />
Gestaltungsmaßnahmen. Sie beinhaltet eine möglichst vollständige Erfassung aller in- und<br />
externen E,influssfaktoren, die negative Zielabweichungen verursachen können. Diese<br />
Einflussfaktoren sind nach Untemehrnensbereichen. nach Art, Ausmaß und zeitlicher<br />
Reichweite der Bedrohung sowie nach ihrer Beeinflussbarkeit zu systematisieren. Eine<br />
regelmäßige, systematische Risikoinventur zu gewährleisten, ist eines der neuen<br />
Erfordernisse, die das KonTraG flir Leasinggesellschatien mit sich bringt. Ganz wesentlich ist<br />
hierbei, flir jedes der identifizierten Risiken eine eindeutige und allgemein verständliche<br />
Definition zu geben. Denn in aller Regel hat jeder Mitarbeiter eine höchst eigene Vorstellung<br />
darüber, was sich hinter den Begriffen verbirgt, mit denen die einzelnen Risikoaften benannt<br />
werden. Doch meist decken sich diese Vorstellungen eben keineswegs mit den Sachverhalten,<br />
die tatsächlich hinter den verwendeten Begriffen stehen. Wenn also beispielsweise von<br />
Zinsänderungsrisiken die Rede ist, so ist noch längst nicht jcdem klar. dass hiennit die Gefahr<br />
der Barwertrninderung eines in bestimmter Weise abgegrenzten Cash-Flows gemeint ist.<br />
Insofem bilden klare Abgrenzungen der identifizierten Risiken eine der zentralen<br />
Ausgangsvoraussetzungen flir eine effektive Risikokornmunikation.<br />
Methodisch kommen flir eine Risikoinventur ganz unterschiedliche Vorgehensweisen in<br />
Betracht. So kann man beispielsweise auf Fralebögen zunickgreif-en, Expertengespräche<br />
fiihren, Workshops durchführen, Schadenstatistiken auswerten, Akten und andere Unterlagen<br />
durchsehen der Phantasie sind hier im Grunde keine Grenzen gesetzt. Bei der Disko Leasing<br />
haben wir uns dazu entschieden, zunächst auf analytischem Wege eine grundlegende<br />
Risikosystematik zu entwickeln, um diese in einem zweiten Schritt durch alle Führungskräfte<br />
sowie weitere erfahrene Mitarbeiter auf Vollständigkeit prüfen zu lassen und gegebenenfalls<br />
inhaltlich weiter auszufüllen. Diese Vorgehensweise hat sich bewährt, weil hierdurch nicht<br />
nur eine intensive Auseinandersetzung aller Verantwoftungsträger mit der Risikosituation der<br />
Gesellschaft angeregt wurde, sondern zugleich auch eine hohe Akzeptanz des Ergebnisses<br />
erzielt werden konnte. Die wichtigsten Risiken, die das Leasinggeschäft typischerweise birgt,<br />
die man also bei jeder Gesellschaft im Rahmen der Risikoinventur mindestens findet. sollen<br />
nachfolgend erläutert werden. Hierbei werden ausschließlich operative Risiken des<br />
Leasinggeschäfts betrachtet, die sich anhand der zu Grunde liegenden Zielgröße abgrenzen<br />
lassen: So können diejenigen Risiken, die sich unmittelbar auf den operativen Periodenerfolg
auswirken, als operativeRisiken<br />
bezeichnet werden, während es sich bei Risiken. die auf das<br />
Erfol gspotential wi rken, um so genannte strategische Risiken handelt.<br />
Setiebsrisiken<br />
unsachgemäße Bonitätsbzw.<br />
Objektprüfung<br />
Fehler bei der<br />
(Vertrags-)<br />
Bearbeitung<br />
Organ isationsrisiken<br />
lT- Risiken<br />
Ausfallrisiken<br />
Bonitätsrisiko<br />
(materiell<br />
/ formal)<br />
Lieferanten-Bonitätsrsk.<br />
Drittkäufer Bonitätsrsk.<br />
Bestand shaftu ngsrisi ko<br />
betrügerisches Handeln<br />
64<br />
bilanzielle Risiken<br />
Preisrisiken<br />
lnvestitionsrisiken<br />
(bei Operate Leasing)<br />
Abb. 5: Typische operative Risiken des Mobilien-Leasinggeschäfts<br />
Liquiditätsrisiken<br />
Ref inanzierungsrisiken<br />
Auslastu ng<br />
Ref inanzieru ngslinie<br />
nachlassende Zahlungsmoral<br />
der Kunden<br />
Im Zusammenhang mit der bereits angedeuteten Finanzierungsfunktion des Leasing entstehen<br />
natürlich bei jeder Leasinggesellschaft Bonitätsrisiken. Diese Risiken, die auch als<br />
Adressenausfallrisiken bezeichnet werden, bestehen ganz allgernein gesagt in der Gefahr, dass<br />
ein Vefiragspartner die ihrn obliegenden Verpflichtungen nicht einhält. so dass der<br />
Leasinggesellschafi ein Zahlungsausfall entsteht. hn Rahmetr des Leasinggeschafts ist dabei<br />
prinzipiell zw.ischen zwei Ausprägungen dieser Risikoart zu unterscheiden. und z\\'ar<br />
zwischen dem Lieferanten-Bonitätsrisiko und dem Leasingnehmer-Bonitätsrisiko.<br />
Das Lieferanten-Bonitcitsrisiko, das sich letztlich nur auf die Gewährleistungsfrist eines<br />
Leasingobjekts erstreckt, umfasst dreierlei: Erstens das Risiko unzureichender Lieferftihigkeit<br />
und Lieferwilligkeit eines Lieferanten, zweitens das Risiko der Insolvenz eines Lieferanten<br />
sowie drittens das Risiko der Nichterbringung notwendiger War-tungsleistungen durch den<br />
Lieferanten, wodurch die Funktionsftihigkeit des Leasingobjekts beeinträchtigt wird und die<br />
Verweftungschancen reduzieft werden. Lieferanten-Bonitätsrisiken lassen sich nur bis zu<br />
einem gewissen Grad auf den Leasingnehmer überwälzen.<br />
Von weitaus größerer Bedeutung im Hinblick auf den Schadenserwaftungswert ist das<br />
Lea.singnehmer-Bonitcitsrisiko, das während der gesamten Verlragslaufzeit besteht und das als<br />
die Gefahr einer mangelnden Zahlungsfühigkeit oder Zahlungsbereitschaft eines
65<br />
Leasingnehmers definiert werden kann. Da bei einem Nachlassen der wirtschaftlichen<br />
Leistungsflihigkeit des Leasingnehmers tendenziell auch dessen Bereitschaft zur Wartung und<br />
Werterhaltung des Leasingobjektes nachlässt, besteht eine Wechselwirkung zwischen dem<br />
Leasingnehmer-Bonitätsrisiko sowie dem Objekt bezogenen Vetwertungsrisiko.<br />
Eine spezielle, häufig unterschätzte Variante des Leasingnehmer-Bonitätsrisikos stellt das so<br />
genannte Be.standshafiungsrisiko dar, das im Zusammenhang forfaitierter Leasinggeschäfte<br />
auftritt. Die Forfaitierung eines Leasinggeschäfts. das heißt der Verkauf der zukünftigen<br />
Raten- und Restwertforderungen an eine Bank, bietet einer Leasinggesellschaft die<br />
Möglichkeit, das Leasingnehmer-Bonitätsrisiko auf den Fordemngskäufer abzuwälzen und<br />
sich insofem vor Zahlungsausfüllen zu schützen. Allerdings haftet die Leasinggesellschaft<br />
dabei für den Bestand der Forderung sowie für die Freiheit der Forderung von Einw'endungen<br />
und Rechten Dritter. Damit besteht die Möglichkeit. dass die Risikoüberwälzung unter<br />
Umständen nicht wirksam wird, nämlich dann, wenn die Forderung zu diesem Zeitpunkt<br />
keinen rechtlichen Bestand hat.<br />
Dass diese Risikokategorie - vor allem bei kleineren und rnittleren Leasinggesellschaften<br />
existenzbedrohende Ausmaße annehmen kann. r.vird irnrner wieder durch Beispiele in der<br />
Praxis belegt. Insofem erfordert die Risikoüberwälzung durch Forfaitierung eine hohe<br />
Professionalität bei Abschluss und Erfüllung des Leasingverlrages. denn eine Verletzung der<br />
Informations- und Sorgfaltspflichten der Leasinggesellschaft kann neben der faktischen<br />
Rtickverlagerung des Bonitätsrisikos sogar zu einern Vertragsrücktritt des Forderungskäufers<br />
fiihren.<br />
Oblektrisiken sind diejenigen Risiken, die sich aus dem Besitz und Betrieb eines<br />
Leasingobjekts ergeben. Objektrisiken liegen in technischem und wirtschaftlichem Verschleiß<br />
eines Leasingobjekts begründet und umfassen auch die Gefahr des (teilweisen) Untergangs<br />
des Objekts. Ausdruck eingetretener Objektrisiken ist ein übermäßiger Wertverfall des<br />
Leasingobjekts, das heißt eine über den im Normalfall zu emartenden Wertverzehr<br />
hinausgehende Wertminderung.<br />
Bei Vollarnortisationsvefträgen fallen die Objektrisiken, wie bereits angedeutet. geringer aus<br />
als bei Teilamortisationvefträgen, da der Rückfluss des investierten Kapitals über die Raten<br />
hierbei schneller erfolgt. Bei Teilamortisationverträgen erhöht sich das Objektrisiko, wenn der
66<br />
Restwert im Verhältnis zum realisierten Marktwert zu hoch angesetzt wird. Ebenso erhöht<br />
sich das Objektrisiko, wenn ein erwarteter, die Vollamortisation der Leasinginvestition<br />
übersteigender Nacherlös bei der Kalkulation der Leasingraten mietmindernd berücksichtigt<br />
wird (sogenannter verdeckter Restr,vert). Gmndsätzlich gilt schließ1ich, dass sich das<br />
Objektrisiko um so rnehr veringert, je weiter sich die Vertragslar,rfzeit dern vorgesehenen<br />
Ende nähert.<br />
Zinsänderungsrisiken entstehen in Mobilien-Leasinggesellschaften vornehmlich dadurch.<br />
dass Leasinginvestitionen nicht laufzeitgerecht flnanziert werden. das heißt die<br />
Refinanzierung dern Betrag nach nicht für die Gesamtlaufzeit des Refinanzierungsbedarfs<br />
gesichert und/oder der Refinanzierungszins nicht frir die gesamte Laufzeit fest vereinbart ist.<br />
In diesen Fällen besteht grundsätzlich die Gefähr. dass es zu einer nicht kostendeckenden<br />
Margenveränderung bei der Anschh,rssfinanzierung und Neufestsetzung des<br />
Refinanzierungszinssatzes kommt. Daneben besteht die Möglichkeit, dass Leasingverträge<br />
vorzeitig beendet werden und dem Leasinggeber Liquidität zufließt. die er irn Neugeschäft<br />
nicht mehr zurn ursprünglichen Aktivsatz anlegen kann. In allen Fällen besteht die Gefähr,<br />
dass aufgrund einer Marktzinsveränderung negative Ergebnisbeiträge ausgewiesen werden.<br />
Bilanzielle Risiken stellen schließlich eine Risikoart dar. die in diescr Form ausschließlich bei<br />
Leasinggesellschaften auftritt. Aufgrund des speziellen Charakters dicser Risikoart sou'ie alts<br />
Gründen besserer Verständlichkeit soll dieser Punkt allerdings noch für einen Moment<br />
zurückgestellt r-rnd erst im Zusammenhang der Risikoanalyse ausftihrlicher auf-uegriffen<br />
werden.<br />
5. Spezielle Fragestellungen der Steuerung von Bonitätsrisiken<br />
Hinsichtlich der Steuerung von Bonitätsrisiken ist bei Leasinggesellschaften vieles ähnlich<br />
wie im Bankbereich. Wie in Banken wird auch in Leasinggesellschaften vor jedem neuen<br />
Geschäftsabschluss eine Bonitätsanalyse durchgeführt. Hierbei werden die üblichen Kriterien<br />
geprüft. bei Firmenkunden beispielsweise vor allem die aktuelle und zLr erwartende<br />
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage mittels einer Bilanzanalyse, daneben aber auch<br />
Faktoren wie Marktposition und Branche des Kunden, Qualitat des Management und<br />
ähnliches. Idealerweise erfolgt die Bonitätsbeurleilung rnittels eines Rating-Verfahrens. und
ot<br />
so sind einige Leasinggesellschaften im Zuge der Umsetzung der Vorgaben des KonTraG<br />
dazu übergegangen, solche Systeme einzuführen.<br />
Vor Vertrag sa bsc h luss :<br />
Beurteilung der Bonität des Leasingnehmers Beurteilung der Bonität des Lieferanten<br />
Na ch Vertra g sa bsc h luss :<br />
Rating-Analyse<br />
Risikoprämien<br />
Analyse des aktuellen und potentiellen<br />
Bonitätsrisikos z.B. auf der Grundlage<br />
Segment spezifischer Standard-<br />
Risikokosten<br />
Abb. 6: Steuerung des Bonitätsrisikos<br />
Bonitätsrisiken<br />
Wertentwicklung der Objekte<br />
z.B. technischer Fortschritt oder<br />
neue gesetzliche Regelungen<br />
(Abgasnormen o.ä.);<br />
Verhalten des Leasingnehmers<br />
Anders als eine Bank ist eine Leasinggesellschaft aber stets originäre Eigentümerin des zu<br />
finanzierenden Objekts und typischerweise bildet das Objekt die einzige Sicherheit des<br />
Leasinggebers. Insofern liegt auf der Hand, dass insbesondere Objekt- bezogene Kriterien<br />
neben den genannten Kriterien eine wichtige Rolle bei der Entscheidung über den<br />
Geschäftsabschluss spielen. Stabiler Wertverlauf, Drittverwendungsftihigkeit und<br />
Marktgängigkeit sind wesentliche Aspekte, die Gegenstand jeder Antragsprüfung sind und die<br />
untrennbar mit Fragen der Leasingnehmer-Bonität verbunden sind. So kann es beispielsweise<br />
vorkommen, dass bei hervorragenden Objekteigenschaften durchaus Zugeständnisse in<br />
puncto Leasingnehmer-Bonität gemacht werden. Andererseits gilt es aber zu berücksichtigen.<br />
dass die Wertentwicklung eines Wirtschaftsgutes in aller Regel degressiv verläuft, so dass es<br />
- relativ gesehen - zu höheren Zahlungsausl?illen kommt, wenn der Leasingnehmer zu<br />
Beginn der Vertragslaufzeit zahlungsunftihig wird. Derartige Überlegungen hinsichtlich des<br />
,,trade-offs" zwischen Leasingnehmer-Bonität und Objekteigenschaften rvurden in<br />
Leasinggesellschaften bislang eher intuitiv und aus der Erfahrung des Einzelnen heraus<br />
angestellt. Hier stehen Leasinggesellschaften - ganz anders als Banken - seit in Kraft treten<br />
des KonTraG vor der Herausforderung, geeignete Verfahren zLr entwickeln, uffi die<br />
Zusammenhänge zwischen Objekt und Bonität sowie die damit verbundenen<br />
Entscheidungsspielräume transparent zu machen und zu dokumentieren. Natürlich sind diese
68<br />
Informationen auch bei der Kalkulation von Risikoprämien von entscheidender Bedeutung.<br />
Vorstellbar wären hierzu beispielsweise umfangreiche Verweftungsstatistiken, die Sammlung<br />
und Archivierung von Marktdaten und, darauf aufbauend, die Konzeption von<br />
Expertensystemen. Allerdings befindet sich die Branche in dieser Hinsicht eher noch im<br />
Anfangsstadium.<br />
6. Analyse bilanzieller Risiken<br />
Auch mit dieser Risikoar-t werden sich Leasinggesellschaften zukünftig viel intensiver<br />
auseinandersetzen müssen als dies bislang, also vor in Kraft treten des KonTraG, crforderlich<br />
war. Vor allem mitilere und Meinere Gesd)schaften dürften )ier attf Scbüertgkdten sIoßen,<br />
da die Analyse dieser Risiken personelle und technische Ressourcen erfordert, über die diese<br />
Gesellschaften in der Regel nicht verfügen. Worum geht es dabei?<br />
Bilanzielle Risiken entstehen - kurz gesagt - aufgmnd der Anwendung handels- und<br />
steuerrechtlicher Bewertungsvorschriften. Beispielc hierftir sind etwa die Abschreibung des<br />
Vennietvelnögens über die betriebsgewöhnlichcn Nutzungsdallerrl anstatt über die<br />
Verlragslaufzeit oder die lineare Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus<br />
der Forfaitierung über die Grundmietzeit. Dies kann daztt führen. dass die bei Ablauf der<br />
Grundmietzeit ausgewiesenen Restbuchwerte deutlich über dem Marktwert des<br />
Leasingobjektes liegen und insofern nr-rr teilweise durch die Veru'ertttn-eserlöse gedeckt sind.<br />
So kommt es mit der Ausbuchung des Objekt bei Venragsende zu einem Buchverlust. dern<br />
Buchgewinne in früheren Rechnungsperioden gegenüberstehen. Und auch die Wahl des<br />
Abschreibunssverfahrens hat Einfluss auf die zeitliche Verteilung des Geschäflserfblgs' Ein<br />
einfaches Beispiel mag dies verdeutlichen:<br />
Abb. 7: Bilanzielle Risikcrr<br />
Ausgangsdaten: TA-Vertrag über 54 Monate; Vertragsbeginn: 1. Juli 2000; AW:2.000.0O0 DM; TA-Wert: 10% AW;<br />
Aktiv-Satz: 7,115Vo p.a.; Leasingrate:40.00O,40 DM, gerundet auf 40.000 DM; Verwertungserlös: 185.000 DM:<br />
Finanzierung: Laulzeitkongruentes Darlehn zu 5o/o p.a., Zins und Tilgung jährlich; Anlaufkosten: 7.500 DM; Laufzeitkosten:<br />
150 DM pro Monat; Verwertungskosten: 3.000 DM; Risiko: O,24o/o p.a. vom AW; Bnd: 60 Monate.<br />
1. Gewinn- und Verlustrechnung Aeschäftsjahr<br />
bei linearer Abschreibung<br />
Erträoe a-s Leasrnqraten<br />
Abschreibung<br />
Zinsaufwand<br />
Betflebsaufwand<br />
Aufwendungen i Risiko<br />
Ve rwe rtu ngsergebn I s<br />
Buchwertabgang<br />
[,4 i nde re rlösausgleich<br />
Summe GuV: 69.8O0 orvr w** Jahrcsergöbnis<br />
2. Gewinn- und Verlustrechnung<br />
Geschäftsiahr 2000<br />
2A00 20Q1<br />
bei degressiver Abschreibung Erträge aus Leasingraten 240.000<br />
(3O%) und Übergang zu linearer Abschreibung 300 000<br />
nach dem zweiten Laufzeitiahr Zinsaufwand<br />
Betriebsaufwand<br />
50 000<br />
8.400<br />
Aufwendungen / Risiko<br />
Verwertungsergebnls<br />
Buchwertabgang<br />
2400<br />
l\,4 i nde re r1ösausol eich<br />
Summe GuV: 69.800 ofvf **" Jahresersebnii -120'8oo<br />
240.000 480.000<br />
200.000 400.000<br />
50.000 80.000<br />
8.400 1.800<br />
2.40A 4.800<br />
-20.800 -6.50e<br />
2001<br />
480.000<br />
51 0.000<br />
80.000<br />
1.800<br />
4.800<br />
-1 1 6.€00<br />
2042<br />
480.000<br />
400.000<br />
60.000<br />
1.800<br />
4.800<br />
13.4@<br />
2AA2<br />
480.000<br />
340.000<br />
60.000<br />
1 .800<br />
4.800<br />
73.400<br />
2AA3 2AA4<br />
480.000 480.000<br />
400.000 400.000<br />
40.000 20.000<br />
1.800 4.800<br />
4.800 4.800<br />
1 85.000<br />
200.000<br />
15.000<br />
33./t00 50.400<br />
20ü3 2AQ4<br />
480.000 480.000<br />
340.000 340.000<br />
40.000 20.000<br />
1 800 4.800<br />
4.800 4.800<br />
1 85.000<br />
1 70.000<br />
15.000<br />
93.400 140.1100
69<br />
Es handelt sich dabei um einen fiktiven Teilamortisationsvefirag über ein Objekt mit einem<br />
Anschaffungswert von 2 Millionen DM und einer Vertragslaufzeit von 54 Monaten. Die<br />
monatliche Leasingrate beträgt gerundet 40.000 DM bei einem kalkulierten TA-Wert von<br />
200.000 DM, die Abschreibungsdauer ist 60 Monate. Alle weiteren Daten des Beispiels<br />
können Abbildung 7 entnommen werden. Die Gewinn- und Verlustrechnungen der einzelnen<br />
Rechnungsperioden sind ebenfalls in Abbildung 7 dargestellt, und zwar einmal bei linearer<br />
Abschreibung und einmal bei degressiver Abschreibung. Hierbei wurde davon ausgegangen,<br />
dass eintretende Risiken das GuV-Ergebnis des Beispielvertrages anteilig belasten - bei<br />
einem nicht-leistungsgestörten Geschäft dürften ansonsten natürlich keine Aufivendungen aus<br />
eingetretenen Risiken ausgewiesen werden. Man sieht deutlich, dass über die Gesamtlaufzeit<br />
gesehen zwar ein Gewinn entsteht, über die einzelnen Rechnungsperioden verteilt aber<br />
sowohl Gewinne als auch Verluste ausgewiesen werden. Vor allem bei degressiver<br />
Abschreibung wird der Effekt deutlich größer.<br />
Bezogen auf einen großen, heterogenen Verlragsbestand besteht die besondere Problernatik<br />
nun darin. dass aus der GuV nicht mehr erkennbar ist. ob es sich bei ausgewiesenen<br />
Gewinnen oder Verlusten um tatsächlich aufgetretene Gewinne oder Verluste oder um<br />
Buchgewinne oder Buchverluste handelt. Damit könnte es in einer rein Perioden-bezogenen<br />
Betrachtung beispielsweise dazu kommen, dass Buchgewinne in Form von Liquidität<br />
ausgeschüttet werden, denen keine tatsächlichen Gewinne gegenüberstehen. Um die<br />
erforderliche Transparenz in die externe Rechnungslegung zu bringen, bedarf es eines<br />
speziellen Rechnungsverfahrens. das als Substanzwertrec'hnung bezeichnet wird. Die<br />
Grundidee der Substanzwertrechnung besteht darin, sämtliche in der Zukunft zu erwaftenden<br />
Aufwands- und Ertragswirkungen des Verlragsbestands einer Mobilien-Leasinggesellschaft in<br />
einer Größe und auf einen Zeitpunkt bezogen zu verdichten. Während der Jahresabschluss der<br />
Gesellschaft die - nach handels- beziehungsweise steuerrechtlichen Kriterien ermittelten -<br />
Erfolgswirkungen des Veftragsbestands in der aktttellen Rechnungsperiode widerspiegelt,<br />
antizipiert die Substanzwertrechnung bzw. der Substanzweft der Gesellschaft die<br />
Erfolgswirkungen des Vertragsbestands aller zukünftigen Rechnungsperioden bis zum Ende<br />
von dessen LaufzeithorizonL Durch Addition des handelsrechtlichen Jahresergebnisses und<br />
der Veränderung des Substanzwefies lässt sich das sogenannte betriebswirtschaftliche<br />
Ergebnis eines Geschäftsjahres berechnen, das als Maßstab für den wirtschaftlichen Erfolg<br />
des Geschäftsjahres sowie als Richtlinie der Ausschüttungsbemessung zu verstehen ist. Der
10<br />
Aufbau einer Substanzweftrechnung und die einzelnen Komponenten. die darin einfließen,<br />
sind in der nächsten Abbildung dargestellt:<br />
f. Lineare<br />
Abschreibung<br />
2. Degressive<br />
Abschreibung<br />
S u b stanzwe rt berech n u n g<br />
zukün{tige Leasingraten<br />
Verwertungserlöse<br />
Restbuchwert<br />
zukünltiger Zinsaufwand<br />
Risikoaufwend ungen<br />
zukünft. Betriebsaufw.<br />
Substanzwert<br />
SubstanzwertdiJf erenz<br />
betriebsw Ergebnis<br />
S u bsta n zwertbe rec h n u n g<br />
zukünftige Leasingraten<br />
\/an^/ö d, rn^corlÄeo<br />
Restbuchwert<br />
zukünftiger ZinsauJwand<br />
R isi koa ufwend u n g en<br />
zukünft. Betriebsaufw.<br />
gub6tanzwert<br />
Substanzwe rtdif'ferenz<br />
betriebsw. Ergebnis<br />
Abb. 8: Substanzwertrechnung<br />
31. Dez 2000 31. Dez. 2001<br />
1.920.000 1.440.000<br />
200.000 200.000<br />
1.800.000 1.400.000<br />
200.000 120.000<br />
19 200 14.400<br />
10.200 8.400<br />
90.600 97.200<br />
90.600 6.600<br />
69.800 0<br />
31. Dez. 2000<br />
1.920.000<br />
200.000<br />
1.700.000<br />
200.000<br />
19.200<br />
10.200<br />
190.600<br />
190.600<br />
69.800<br />
31 Dez.2001<br />
1.440.000<br />
200.000<br />
'L 1 90.000<br />
120.000<br />
14.400<br />
8.400<br />
307.200<br />
1 16.600<br />
0<br />
31. Dez. 2002<br />
960.000<br />
200.000<br />
1.000.000<br />
60.000<br />
9.600<br />
6.600<br />
83.800<br />
-13.400<br />
0<br />
31. Dez. 2002<br />
960.000<br />
200.000<br />
850.000<br />
60.000<br />
9.600<br />
6.600<br />
233.800<br />
-73.400<br />
0<br />
3l. Dez. 2A03<br />
31. Dez. 2404<br />
480.000<br />
200 000<br />
600 000<br />
20.000<br />
4.800<br />
4.800<br />
50.400<br />
-33.400<br />
0<br />
31. Dez. 2003<br />
31. Dez 2004<br />
480.000<br />
200.000<br />
510.000<br />
20.000<br />
4.800<br />
4.800<br />
't40.400<br />
-93.400<br />
0<br />
0<br />
-50.400<br />
0<br />
0<br />
-140 400<br />
0<br />
Wie das Beispiel zeigt, ist das betriebswirtschaftliche Ergebnis in beiden Beispielftillen<br />
gleich, das heißt, das betriebswirtschaftliche Ergebnis eines Leasinggeschäfts<br />
beziehungsweise eines Geschäftsjahres ist unabhängig von der gewählten<br />
Abschreibungsmethode bzw. der Abschreibungspolitik der Leasinggesellschaft. Durch die<br />
degressive Abschreibung werden zu Beginn der Verlrpgslaufzeit zwar höhere stille Reserven<br />
gelegt als bei linearer Abschreibung, allerdings kommen diese auch tn einern entsprechelid<br />
höheren Substanzwerl des Geschäfts zum Ausdruck. Während der Vertragslaufzeit realisiert<br />
sich diese stille Reserve in ungleichmäßiger Form im Jahresabschluss, jedoch steht diesern<br />
Effekt jeweils eine genau entgegengesetzte Veränderung des Substanzwertes gegenüber, so<br />
dass das betriebswirtschaftliche Ergebnis ftir die auf das Jahr des Geschäftsabschlusses<br />
folgenden Jahre Null beträgt.<br />
lm Gegensatz zur externen Rechnungslegung, in deren Rahmen der Erfolg des Geschäfts irn<br />
Beispiel willkürlich den letzten Jahren der Vertragslaufzeit zugeordnet wird, ordnet das<br />
betriebswirtschaftliche Ergebnis den Geschäftserfolg darnit derjenigen Rechnungsperiode zu,<br />
in der dieser tatsächlich verursacht wurde.
7. Analyse von Zinsänderungsrisiken<br />
11<br />
Vor ähnliche Probleme wie bei der Beurteilung des GuV-Ergebnisses sind<br />
Leasinggesellschaften auch bei der Analyse bestehender Zinsänderungsrisiken gestellt. Das<br />
klassische Instrument, mit dem vielfach an diese Aufgabe herangegangen wird, ist die<br />
Zinsbindunssbilanz.<br />
In Banken geht man dabei so vor, dass die in der Bilanz ausgewiesenen Festzins-Aktiva und -<br />
Passiva entsprechend ihrer jeweiligen Restlaufzeit mit ihrem jeweils ausstehenden Kapital<br />
definierten Laufzeitbändem zugeordnet werden. Ein Zinsänderungsrisiko besteht in dieser<br />
Perspektive dann, wenn das ausstehende Kapital in einem oder mehreren dieser<br />
Laufzeitbänder nicht mit den dagegen stehenden Finanzierungsmitteln übereinstimmt.<br />
Versucht man nun, dieses Verfahren auf eine Leasinggesellschaft zu übertragen, so stößt man<br />
dabei auf das Problem, dass in deren Bilanz keine Forderungen ausgewiesen werden sondern<br />
Restbuchwefte von Objekten. Statt Forderungsbeträgen würde man also Vermögenswerte in<br />
die Zinsbindungsbilanz einer Leasinggesellschaft einstellen. Dahinter steht die Überlegung.<br />
dass das in der Bilanz ausgewiesene Vermögen dem gebundenen Kapital entspricht und<br />
insofern - nach der Logik der Bilanz - durch das auf der Passivseite ausgewiesene Kapital<br />
frnanzierL wird. Allerdings geht dieser Gedanke für das Leasinggeschäft nicht auf. Wie das<br />
folgende Beispiel unterstreicht, stimmen die Restbuchwerte eines Leasingobjekts im Regelfall<br />
nicht mit dem gebundenen Kapital überein.
Beisoiel:<br />
TA-Vertrag<br />
AW: ca.4,1 Mio. DM<br />
Laufzeit: 60 Monate<br />
AfA-Dauer: 72 Monate<br />
TA-Wert: 10% des AW<br />
45m.m,m<br />
l<br />
4.000.0m,m l<br />
3.500.0m,m<br />
3.m.m,m<br />
2.5m.000,m<br />
2.000.000,m<br />
1.sm.0m.m<br />
1,000.000,00<br />
5m.0m,m<br />
0,m<br />
Stichtag<br />
12<br />
Restbuchwen<br />
Abb. 9: Buchwert-/Restschuld-Versleich<br />
Reslschuld<br />
Differenz<br />
31.1 2.1 999 3.783.930.50 3.834.169,41 -50.238.91<br />
31.12.2000<br />
31 .12.2001<br />
3.095.941 ,58<br />
2.407.952,66<br />
3.1 43.855.05<br />
2.423 181,03<br />
-47.913.47<br />
-15.228,37<br />
31 .12.2002 1.715.963,74 1 .670.812,16 49.151,58<br />
31 12.2003 1.031 .974,82 885.354,49 146.620,33<br />
31 .12.2004<br />
0.00<br />
0,00 0,00<br />
Bestand RAP fikt. Uberhang<br />
3 772.768.41 11 .16239<br />
3.026.106.77 69.834,81<br />
2.279.445.53 128507,13<br />
1532.784,29 187.179.45<br />
786.123,05 245.851 .77<br />
0,00 0.00<br />
Angaben jeweils in DM<br />
- Restbrcfr €ll<br />
*, Fbstschuld<br />
V*rlu.:f sän*r:r*r g. rlit<br />
Vrrrlr';]f slailiza!; r ÄlÄ l]; r*r<br />
lÄr:la1er;;:h1air* i.irl1 i:.114* ü*i<br />
e r,":r;**lie !::*ill<br />
Hierbei sind die jerveiligen Restbuchwerte sow'ie die Restschuld. die sich durch Aufteilung<br />
der Leasingrate mit dern Aktivzins (Nominalzins) des Vertrages ergibt, für einen TA-Vertrag<br />
rnit 60 Monaten Laufzeit zu den jeweiligen Bilanzstichtagen gegenübergestellt.<br />
Vertragsgegenstand ist eine Maschine, deren Abschreibungszeit 72 Monate betragt und deren<br />
Anschaffungskosten sich ar,rf rund 4.1 Millionen DM belaufen. Der TA-Wert u,urde rnit 10<br />
Prozent des Anschaffungswefies kalkuliert. Man .sieht gleich. dass Restbuchwert und<br />
Restschuld zu keinem Zeitpunkt der Vertragslaufieit übereinstimmen. Interessanter Weise<br />
liegt die Restschuld dabei in den ersten drei Laufzeitjahren über dem jeweiligerr<br />
Restbuchwert, in den darauf folgenden beiden Jahren hingegen darunter.<br />
Nimmt man nun an, dass dieses Geschäft dr"rrch Forderungsverkauf finanziert worden wäre.<br />
zeigt sich noch ein anderes Bild, das jedoch ebenfalls keinerlei Realitatsbezug aufrveist: In<br />
konsequent bilanzieller Betrachtung ist dann närnlich der Bestand des passiven<br />
Rechnungsabgrenzungspostens. der ftir die Einnahme aus dern Forderungsverkauf gebildet<br />
werden muss, auf der Passivseite der Zinsbindungsbilanz anzusetzen. Wie das Beispiel zeigt<br />
führ-t diese Darstellung zu dem widersinnigen Ergebnis, dass ein wachsender Aktivüberhang<br />
und damit ein Zinsänderungsrisiko ausgewiesen würde, wo im Grunde gar kein Risiko<br />
besteht; denn die Forfaitierung stellt ein Geschäft bis auf das Wiederanlagerisiko - von<br />
Zinsänderunssri siken frei.
Ursächlich für diese Verzerrungen sind, wie bereits angedeutet, im Wesentlichen zwei<br />
Effekte: Zurn einen der Umstand, dass die Vertragslaufzeit zwangsläufig immer unterhalb der<br />
Abschreibungszeit liegt und der Kapitalrückf'luss sornit schneller als die Abschreibung des<br />
Objekts erfolgt. Zum anderen der Umstand, dass die Auflösung des passiven RAPs gemäß<br />
steuerrechtlicher Regelungen linear und nicht entsprechend des Tilgungsverlaufs zu erfolgen<br />
hat und außerdern über die kürzere Vertrasslaufzeit vorsenommen werden muss.<br />
Aus diesen Gründen ist es nicht rnöglich, das Zinsänderungsrisiko einer Leasinggesellschaft<br />
mittels einer Zinsbindungsbilanz und unter Rückgriff auf bilanzierte Größen zu ennitteln.<br />
Sachgerechter erscheint hingegen, sich von dieser Betrachtungsweise zu lösen und auf strikt<br />
Zahlungsstrom-bezogene Verfahren zurückzugreifen. Die Vorgehensweise ist auf der<br />
folgenden Übersicht clargestellt.<br />
1. Schritt: Analyse der Ausgangssituation<br />
Auswahl aller Zinsänderungsrisiken unterliegenden Aktiv- und Passivgeschäfte und Abbildung<br />
der Zahlungsströme dieser Geschäfte in einer Ablaufbilanz.<br />
2. Schritt: Erstellen einer Barwertbilanz<br />
Laufzeit gerechte Diskontierung der Ablaufbilanz mit Zinssätzen der aktuellen Zinsstrukturkurve.<br />
Ergebnis: Barwert des Risiko behafteten Zahlungsstroms aus lnvestitionen und Finanzierungen.<br />
3. Schritt: Festlegen standardisierter Zinsänderungs-Szenarien<br />
Ableitung möglicher zukünftiger Zinsstrukturen - z.B. Parallelverschiebungen und Drehungen<br />
der Zinsstrukturkurve; Forward-Rates; statistische Methoden (VaR); Zinsprognosen.<br />
4. Schritt: Simulation der Erfolgswirkungen eintretender Zinsänderungsrisiken<br />
Analvse der Veränderung des Cash-Flow-Barwertes bei Eintreten der Definierten Zinsszenarien<br />
unter Verwendung so genannter Überhangkoeffizienten und Laufzeithebel.<br />
5. Schritt: Entscheidung über mögliche Risiko politische Maßnahmen<br />
Z.B. : Kompensatorische Eigengeschäfte / Volumen- oder Ergebnislimite<br />
Abb. I 0: Zahlungsstrom-orientierte Analyse des Zinsänderungsrisikos<br />
In einem ersten Schritt werden die Zahlungsströme aller Leasinggeschäfte. dic<br />
Zinsänderungsrisiken unterliegen, in einer Ablaufbilanz zusammengefasst. Eine Ablaufbilanz<br />
fasst die zukünftig zu erwartenden E,in- und Auszahlungen entsprechend ihres zeitlichen<br />
Anfallens zusamrlen und ennittelt den Zahlungssaldo jedes Laufzeitbandes. Nicht ganz<br />
einfach ist dabei festzulegen, welche Geschäfte mit welchen Zahlungsstrom-Bestandteilen in<br />
die Analyse eingehen. Wesentliche Kriterien, nach denen sich dies im Leasinggeschäft<br />
bestimmt,'sind zum einen die Vertragsart, zum anderen die Finanzierung eines Geschäfts: So<br />
können Geschäfte, die im Wege des Forderungsverkaufs finanziert wurden. beispielsweise als
l4<br />
Risiko frei betrachtet und aus der Analyse allsgenommen werden. Handelt es sich jedoch um<br />
einen Teilamortisationsvertrag. bei dem lediglich die Raten, nicht aber der Restwert fbrfaitierl<br />
wurden. ist der Restwert natürlich in der Analyse zu berücksichtigcn.<br />
lst die Ablar,rfbilanz erstellt. erfolgt eine Laufieit-gerechte Diskontierung dcr einzelnen<br />
Überhänge mit Zinssätzen der aktuellen Zinsstrukturkurve. Im Ergebnis erhält rnan ar,rf diese<br />
Weise den Barwert des mit Zinsändemngs-Risiken behafteten Gesamt-Zahlungsstromes aus<br />
Leasing-lnvestitionen ur.rd Finanzicrungen. Dieser Baru'ert bildet die Refcrcnzgrößc der<br />
Risikoanalyse, bei der danach gefragt wird. wie sich kurzfristige Zinsänderungen auf den<br />
Cash-Flow-Barwert auswirken. Dementsprechend ist es in einem dritten Schritt zunächst<br />
erforderlich. standardisierte Zinsänderungs-Szenarien f-estzulegen. Wie diese ausschen. ist<br />
unte rnehmensindividuell festzulegen. jedoch solltcn hierbei zumindest Szenariell tür<br />
Parallelverschiebungen und Drehungen der ZinsstruktLtrkurve, cin Szcnario. dctn die<br />
impliziten Ztnssdtz,e zu Grunde liegen. cin auf liistorischer Sirnulation basierendes Szenario<br />
sowie natürlich Zinsprognosen verwendet u et'den.<br />
Der vierte Verfahrensschritt erstreckt sich dann. uie bcreits angedeutet. auf die Analyse der<br />
Veränderung des Cash-Flow-Barwertes bei Eintreteu dcr definicrten Zinsszenarier,. Auhand<br />
der so ermittelten Risikowerte sowie vor dem Hintergrund der vorhandenen Deckungslnittel<br />
kann dann über rnögliche Risiko politische Maßnahmen nachgedacht u'erden.<br />
Insgesamt lässt sich festhalten, dass dieses Verfahren dem Zinsänderttngsrisiko ri'citaus bcsser<br />
gerecht wird, als die bilanzielle Betrachtungsweise, und zw'ar nicht nur deshalb. r.ieil es<br />
rechnerisch genauer ist, sondern auch, weil es dem Un-rstand Rechnung trägt. dass<br />
Leasinggesellschaften ihre Objekte nicht um des Eigentums w'illen eru''erben. sondern ut.t.t<br />
hierdurch einen Zahlungsstrom zu generieren.
8. Schlussbemerkungen<br />
l5<br />
Die Übernahme von Risiken und der umgang mit Risiken zählt seit jeher zu den wesentlichen<br />
Merkmalen des Leasinggeschäfts. Und so haben sich Leasinggesellschaften immer schon mit<br />
Fragen des Risikomanagernent auseinandergesetzt. Dennoch war es in der Vergangenheit<br />
vielfach so, dass die Weiterentwicklung der Steuerungsinstrumente hinter der<br />
Weiterentwicklung des Vertriebssystems zurückblieb. Ein Grund hierflir mag sicherlich darin<br />
liegen. dass hier - anders als etwa im Bankenbereich - auf Grund fehlender Regulierung<br />
keine unmittelbaren Handlunsszwänse hierzu bestanden haben.<br />
Insofern stellt das KonTraG für die Leasingbranche weniger eine ,,lästige Pflicht" als<br />
vielmehr einen längst ftilligen Handlungsanstoß dar und gibt neue Impulse für eine aktive<br />
Steuerung der Risikosituation und des Geschäftsportfolios. Ein aktives Risiko- und<br />
Erfolgsmanagement erlangt nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund des allmählichen<br />
Rückzugs der Banken aus dem Firmenkreditgeschäft, von dem die Branche rnerklich<br />
profitiert, durch den aber auch neue Risiken entstehen. zunehmend an Bedeutung. Dabei<br />
entstehen aufgrund des Objektbezugs des Geschäfts und aufgrund von Besonderheiten der<br />
Rechnungslegung spezielle Problemstellungen, die in dieser Weise bei keinem anderen<br />
Untemehmenstyp auftreten, die aber zugleich wie in diesem Beitrag deutlich werden sollte<br />
- den besonderen betriebswirtschaftlichen Reiz der'Risikosteuerung bei Leasinggesellschaften<br />
ausmachen.
Literatur<br />
76<br />
Albrecht, M: Controlling als markt- und erfolgsorientieftes Steuerungskonzept für Leasing-<br />
Gesellschaften, Wiesbaden 2000.<br />
Arthur Andersen (Hrsg.): KonTraG / KapAEG Erläuterungen zu den wichtigsten<br />
Vorschriften und praktische Hinweise zur Umsetzung.<br />
Eckstein, W. u. Feinen, K. (Hrsg./: Leasing-Handbuch fiir die betriebliche Praxis, 7. Auflage,<br />
Frankfurt am Main 2000.<br />
Gtilv,eiler,l.: Strategische Unternehrnensführung, 2. Auflage. Frankfurt am Main und New'<br />
York 1990.<br />
Helfrich, K.-H.: Substanzwerlrechnung macht Leasing-Gesellschaften transparenter (Teil l).<br />
in: Finanzierung Leasing Factoring, 42. Jahrgang (1995), Heft 6, S. 220 - 224.<br />
Helt'rich, K.-H.: Substanzweftrechnung macht Leasing-Gesellschaften transparenter (Teil 2).<br />
in: Finanzierung - Leasing Factoring, 43. Jahrgang ( 1996). Heft 1, S. 37 - 39.<br />
Hommelho//, P u. Mattheus, D.: Gesetzliche Grundlagen: Der"ttschland und international. in:<br />
Praxis des Risikomanagements Grr-rndlagen. Kategorien, branchenspezifische und<br />
strukturelle Aspekte, hrsg. v. D. Dörner, P. Horväth u. H. Kagermann, Stuttgart 2000, S. 5<br />
40.<br />
Institttt der Wirt.scha/isprüt''er: IDW EPS 340, Die Prüfung des Risikofrliherkennungssysterxs<br />
nach r\ 317 Abs.4 HGB, in: DieWirtschaftsprüfung, 1998. S.927 931.<br />
Krorn.sc.hröder, B. u. Liic:k, tr/.: Grundsätze risikoorientierter Untentehmeustiberu'achung. in:<br />
Der Betrieb, 51. .lahrgang ( 1998), Heft 32. S. 1573 1576.<br />
Kn'stek, L.l.: Unternehmungskrisen Beschreibung, Vermeidung und Beu'ältigung<br />
überlebenskritischer Prozesse in Unternehmungen, Wiesbaden 1 987.<br />
Lück, W.: Der Umgang mit untemehmerischen Risiken durch ein Risikomanagementsystem<br />
und durch ein Überwachungssystem. in: Der Betrieb,51. Jahrgang (1998), Hett 39, D. 1925<br />
I 930.<br />
Oehler, A. u. (Jnser', M.: Finanzwirtschaftliches Risikomanagement, Berlin u.a. 2001 .<br />
Schierenbeck, H.: Ertragsorientiertes Bankmanagement. Band 1 und 2, 6. Auflage, Wiesbaden<br />
1999.<br />
Wiedemann, A.: Die Passivseite als Erfolgsquelle - Zinsmanagement im Unternehmcn.<br />
Wiesbaden 1998.
Vorwort<br />
7l<br />
Integriertes Scoringsystem im gewerblichen Leasing-<br />
Geschäft<br />
l. Definition Scoring<br />
(Vortrag an der Universität zu Köln am 27 . Juni 2001)<br />
2. Gninde für ein Scoringsystem<br />
von Dipl. VW Hans-Joachim Spittler<br />
3. Entwicklung eines Scoringsystems - des Scoringsystems der MMV Leasing GmbH<br />
4. Implementierung des Scoringsystems in die EDV-gestützte Vorgangsbearbeitung<br />
5. Monitoring \ on Scoringsystelnelt<br />
6. Weiterentwicklungsmöglichkeiten<br />
I . Fazit
Vorwort<br />
Der Vortrag soll ein Risk-Managernent-Modell fiir das Massengeschäft vorstellen: d.h. für<br />
78<br />
Geschäfte unterhalb der Obligen. fiir die die Offenlegr-rng des Jahresabschlusses verlangt u,ird.<br />
Die Angaben und Daten aus der Praxis beziehen sich auf die sich im Einsatz befindlichen<br />
Scoringsysterne bei der MMV Leasing.<br />
l. Definition Scoring<br />
Man subsumiert unter diesern Begriff lnathematiscli statistische EDV--uesttitzte Verfähren zLrr<br />
Prognose von Kundenverhalten. r.vobei man aus Erf-ahnrngs\\'cfien der Ver-eangenheit ar"rf<br />
gleichgelagerte Ereignisse in Gegenwart und Zr-rkunft schließt. Ziel ist die jeu'eilige<br />
Entscheidung irn Einzelfall. Solche Verfahren w'erclc'n nebcn clcr Kreditwirtschaft u.a. auch in dcr<br />
Versicherungswirtschaf\ zur Berechnung von Versicherungsrisiken angcr.vandt. und sie sind aucii<br />
aus der Markt- und Wahlforschung allgernein bekannt. Die Qualität von Scoringrnodellen hängt<br />
von der zur Verfi"igung stehenden Datenbasis ab jc -uröße'r die Datenbasis ist ttln so 1'rräzisc'r<br />
wird die Prognose. Das englische Wort "to score" stamrnt aus detn sportlichen Bcrcich und lässt<br />
sich mit "Tref-fer "punktelr"<br />
erzielen". oder<br />
"Erfolg<br />
habett" übcrsctzett.<br />
Für Scoring werden lnformationen tiber Zahlr,rngsverhalten. die bctrieblichc u irtschaftliche<br />
Situation, aber auch soziodemographische Phänomene. wie Alter. Sitz des Unternehntens u.ä.<br />
verarbeitet. Die prognostisch wichtigsten Merkmale werden analytisch identifiziert Lttrd dann trit<br />
Hilfe multivariater bzw. rnathematisch statistischer Methoden gruppiert und in Fortrt einer Scorc-<br />
Tabelle (Score-Karte) dargestellt. Mit dieser Score-Karte werden dann Einzelliille analy'sicrt<br />
bzw. abgearbeitet. Das Grundprinzip einer Scoringer,tscheidung kann rltan rtttt c-inet'<br />
Verkehrsampel vergleichen: grün bedeutet "einverstanden".<br />
rot hcißt "ab-eelehnt"<br />
und gelb<br />
erfordelt "$,eiter überlegen. weiter analysieren. u'eitere lnfbrmationen einholen"" ulr dautt zt"t<br />
einer Entscheidung zu kommen.
)<br />
a)<br />
Gründe für ein Scoringsystem<br />
Beschleunigung der Entscheidungen im Standard-Geschäft<br />
79<br />
Vorneweg sei hierzu festgestellt, dass sich die Bearbeitungszeit einschließlich der<br />
Kreditentscheidung - durch den Einsatz von Scoring bei der MMV Leasing flir die Scoringflille<br />
im Regelfall auf unter 10 Minuten reduziert hat. Das System basiert auf der Nutzung der breiten<br />
Informationsbasis der Creditreform (also einer Auskunftei) und den eigenen Erfahrungen /<br />
Kenntnissen der MMV Leasing über den zu beurteilenden Kunden. Bei Geschäftsvorf?illen, die<br />
das System eindeutig positiv oder negativ scorl, kann im Regelfal1 auf Bankauskünfte verzichtet<br />
werden, was zu einer Verkürzung der Durchlaufzeiten um 3 - 5 Tage fiihrt. Neben diesem<br />
Zeitvorterl bringt der Verzicht auf Bankauskünfte auch den strategischen Vorteil. den mit dem<br />
Kunden in Verbinduns stehenden Banken keinen Hinweis auf eine anstehende lnvestition zu<br />
geben.<br />
Selbstverständlich wird mit der Beschleunigung auch den Marktanforderungen der<br />
Vertriebspartner und Kunden nach schneller Antragsentscheidung Rechnung getragen. Fakt ist,<br />
dass es im Regelfall relativ lange dauert bis ein Kunde seine Investitionsentscheidung trifft,<br />
wenn diese aber gefallen ist, muss die Finanzierungsentscheidung - zumindest im<br />
Massengeschäft - nahezu sekundengleich vorliegen. Mit dieser Marktgegebenheit, die sich<br />
sicherlich rational nicht erklären lässt. ist irn Taeesseschäft zu leben.<br />
b) Verringerung der Prozesskosten für die Antragsbearbeitung im Standardgeschäft<br />
Schnellere Durchlaufzeiten verrinsem losischerweise die Prozesskosten.<br />
c) Die elektronisch gespeicherten Unternehmens- und Bonitätsdaten der Kunden können<br />
gut zu Akquisitionszwecken genutzt werden<br />
Wie noch zu zeigen sein wird, bedarf es flir jeden zu entscheidenden Fall umfangreicher,<br />
strukturierter Daten. Diese Daten bilden eine ideale Materialsammlung für aktives<br />
Databasemarketing, d.h. gezielte Kundenselektionen, wobei das Scoringsystem zwangsläufig zur<br />
Kompletterfassung eines Neukunden ftihrt. Darüber hinaus bieten die umfangreichen erfassten<br />
Daten auch eine gute Grundlage für ein qualifiziertes Kreditüberwachungssystem.
80<br />
Einleuchtend ist auch, dass das bzgl. Neukunden gespeicherte Beurteilungsmaterial die<br />
kurzfristige Nachakquisition wesentlich erleichtert.<br />
d) Objektivierung des Entscheidungsprozesses<br />
Durch ein akzeptiertes und verständlich aufgebautes Scoringsystem werden die Entscheidungen<br />
transparenter und durch die Objektivierung auch besser nachvollziehbar.<br />
e) Optimierung der Risikokosten<br />
Verschiedentlich wird als Grund für ein Scoringsystem auch eine Reduzierung der Risikokosten<br />
angegeben. Ein derartiger Effekt ist aus zweierlei Hinsicht denkbar. Grundsätzlich bildet man<br />
zusätzlich die bisherige Kreditvergabepraxis rechnerisch ab. Nun kann zum einen die<br />
Objektivierung der Entscheidung einen risikominirnierenden Effekt erzielen und zum anderen<br />
kann man die Annahmequoten, d.h. die Intervalle der Rot-. Gnin- oder Gelbenscheidungen<br />
verändern und damit strensere Annahmekriterien schaffen.<br />
Ziel des nachfolgend darzustellenden Scoring-Systems u,ar primär eine Beschieunigung der<br />
Entscheidungspraxis, sekundär eine Verringerung der Prozesskosten - alles unter dcr Prärnisse<br />
einer gleichbleibenden Entscheidungsqualität.<br />
3. Entwicklung eines Scoringsystems - des Scoringsystems der MMV Leasing GmbH<br />
Das erste System wurde gemeinsam mit Prof. Häussler von der Fachhochschule Rosenheim<br />
sowie dem "Verband der Vereine Creditreform" entwickelt. Zunächst war es erforderlich, das<br />
Einsatzgebiet des geplanten Scoringsystems genau zu definieren. Hier lag es nahe einen Bereich<br />
zu wählen, mit dem man eine möglichst hohe Scoringquote realisieren konnte. Die MMV<br />
Leasing hat sich flir den Verlriebsleasing-Sektor entschieden, d.h. für den Bereich, in dem<br />
Leasinggegenstände aus dem Sektor Bürokommunikation und Bürotechnik vermietet werden.<br />
Die Einzelvertragsgrenze wurde bei DM 20.000,-- festgelegt und das Kundengesamtengagement<br />
eines zu scorenden Falls wurde auf DM 30.000,-- begrenzr, LLm zu verhindern, dass durch<br />
mehrere Einzelseschäfte ein zu großes Einzelkundenvolumen entsteht.
8l<br />
Auf der Basis des zukünftig zu scorenden Segmentes musste nun eine repräsentative Stichprobe<br />
analysiert werden, um wie bereits ausgeführt - die vorhandene Kreditentscheidungsstruktur im<br />
zukünftigen Scoringsystem abzubilden. Diese Stichprobe wurde aus abgelaufenen Verträgen<br />
zusammengestellt, da man erst nach Ablauf des Veftrages schlussendlich die Güte der<br />
Bonitätsentscheidung abschließend beurleilen kann. Damit die Stichprobe die Kundschaft auch<br />
wirklich repräsentiert, auf die das Scoringsystern zukünftig angewendet werden soll, rnüssen die<br />
zu untersuchenden Merkmale nicht nur bei schlechten. schlechtgewordenen und guten sondern<br />
auch bei frtiher abgelehnten Verträgen erfasst werden. Die Erfässung abgelehnter Verträge ist<br />
häufig ein großes Problem. das diese üblicherweise nicht EDV-technisch festgehalten werden.<br />
Für sämtliche Verträge der Stichprobe wurden alle Merkmale. die nicht automatisch aus EDV-<br />
Dateien ersichtlich waren. teilweise mit erheblichern manuellen Aufwand aus den Altakten<br />
ermittelt und crtässt.<br />
Bei dem zugrundeliegenden Modell wurden insgesamt ca. 3.500 Verträge davon ca. 1.500 gute<br />
Verträge, also Verträge die von Anfang bis Ende ohne Probleme lief-en. ca. 1.000 während der<br />
Laufzeit schlecht gewordene Verträge und ca. 1.000 abgelehnte Vcrträge - angesehen. die<br />
erforderlichen Merkrnale vervollständigt und pro Vertrag 37 Kriterien abschließend erfässt.<br />
Selbstverständlich musste exakt definiert werden, was Llnter einem guten und einetn schlechten<br />
Verlrag zLt verstehen ist. Hier gibt es sicherlich von Unternehmen zu Unternehmen<br />
unterschiedliche Abgrenzungskriterien für die Klassifizierung eines schlechten Vertrages. Man<br />
kann dies an der Mahnstufe aufhängen oder aber erst die Abgabe an die Rechtsabteilung als<br />
Entscheidungskriterium ansehen bzw. last not least die Insolvenzsetzung.<br />
Wichtig ist auch, dass bei den Stichproben Kundengruppen ausgeschieden werden, die zukünftig<br />
nicht über das Scoringsystem laufen sollen, z.B. öffentliche Verwaltungen, Komtrunen,<br />
Sozialversicherungen, Kreditinstitute u.ä. Der nächste Schritt war dann die Ermittlung von<br />
"trennscharfen<br />
Merkmalen". Der Bogen der analysierten Merkmale spannte sich von leicht<br />
einzusehenden Kriterien, wie Rechtsform, Objektschlüsse1, Anzahl der aktiven Verträge.<br />
Kapitalausstattung, Creditreformindex, Anzahl der Mitarbeiter u.ä. bis zu Merkrnalen. die<br />
zunächst nicht alltaglich erscheinen, wie beispielsweise Alter der einzelnen Geschäftsflihrer,<br />
gewünschte Veftragsart, Vertragslaufzeit usw.. Insgesamt wurden im vorliegenden Fall 37<br />
Kriterien untersucht und festgehalten. Diese Kriterien sind dann mit Hilfe eines statistischen<br />
Verfahrens - im vorliegenden Fall einer multivariaten Diskriminanzanalyse - bzgl. ihrer<br />
interessierenden statistischen Eigenschaften analysiert worden. Interdependenzen wurden
82<br />
festgestellt und mit geeigneten mathematisch-statistischen Mitteln wurden die besten<br />
"Merkmale"<br />
ausgewählt und eine geeignete Punktebewertung bestimmt.<br />
Die Methode eine Diskriminanzanalyse wurde auf Anraten des Fachmannes gewählt. Es gibt hier<br />
viele andere verwendbare Verfahren, die aber wohl keine eindeutige Überlegenheit haben. Zu<br />
beachten ist außerdem, dass bei kompliziefteren komplexeren Verfahren auch das Problem, dass<br />
die Erklärung der Punktebewertung, die ohnehin nicht immer leicht nachzuvollziehen ist, nur<br />
noch von Mathematikem nachvollzogen werden kann. Nebenbei sei etwähnt, dass für die<br />
Stichprobe natürlich eine äußerst sorg{?iltige und exakte Erfassung von großer Bedeutung ist.<br />
IJnter Statistikern gilt: "garbage<br />
in : garbage out" (garbage : Abfall), d.h. aus nur oberflächlich<br />
definiertem oder ungenau erfasstem Datenmaterial resultieren auch nur ungenaue oder unsinnige<br />
Punktbewertungen. Zu empfehlen ist deshalb die Datenerfassung nicht extern von Aushilfen<br />
durchführen zu lassen sondern eigene Mitarbeiter einzusetzen. Dies gewährleistet zum einen,<br />
dass unklare Akteninformationen richtig interpretiert und erfasst werden und zum anderen, dass<br />
sich die Mitarbeiter später auch mit dem daraus resultierenden Scoringsystem leichter<br />
identifizieren können. Vor allem der Aspekt der Identifizierung mit dem System darf nicht<br />
unterbewertet werden. Mitarbeiter, die bisher Entscheidungen mühsam anhand von Akten<br />
vorbereiten mussten und teilweise auch getroffen haben, waren gezwungen zukünftig die<br />
Entscheidung einer Maschine zu akzeptieren. Die frühe Einbindung in das neue System hat im<br />
vorliegenden Fall sicher wesentlich zur späteren Akzeptanz beigetragen.<br />
Aufgabe des Statistikers war es "trennscharfe" Merkmale zu ennitteln, d.h. Merkmale, mit denen<br />
es möglich ist, gute und schlechte Verträge zum Zeitpunkt der Entscheidung abzugrenzen. Es ist<br />
leicht einzusehen, dass dies keine einzelnen Merkmale sein können sondem nur eine<br />
Kombination von verschiedenen Merkmalen mit unterschiedlichen Gewichten. Im Regelfall<br />
reichen bei einem Scoringsystem, wie es erforderlich war, 8 - 14 Merkmale aus, wobei im<br />
vorliegenden Fall die optimale Struktur mit l0 Merkmalen erreicht werden konnte. Die einzelnen<br />
Merkmale werden in Ausprägungen eingeteilt und mit Punkten versehen, wobei gilt, dass je<br />
höher die Punktebewertung ist, um so höher ist die zukünftige Zahlungsmoral des Kunden<br />
einzustufen. Alle Merkmale werden dann in einem sog. Punktebewertungssystem (Score-Kafte)<br />
zusammengefasst. Bei der Einzelfallbearbeitung werden die Punkte der enthaltenen Merkmale<br />
addiert; dies ergibt den Score-Wert oder den Gesamtpunktwert des Einzelfalls.
Nachfolgend 2 Beispiele:<br />
P Alter der Firma<br />
Alter in Jahren<br />
P Rechtsform<br />
83<br />
GmbH & BGB uttzctGewerbe- Freie<br />
Rechtsform AG GmbH KG OHG Co.KG Gesellschaft f irma betrieb Berufe<br />
funkte 30 0 30 40 20 10 40 10 50<br />
Die Punkteverteilung beim Alter der Firma kann tnan sicher nachvollziehen, wobei sich die<br />
Identität der Punktzahl bei "keine Angabe" und bei "Alter bis 6 Jahre" statistisch ergeben hat.<br />
Bei der Punkteverteilung bzgl. der Rechtsform sieht man allerdings deutlich, dass die<br />
Erfahrungen aus dem Geschäft, welches der Score-Karte zugrunde liegt, einfließen.<br />
Die individuelle Basis einer Score-Karte wird noch deutlicher, wenn man die regionale<br />
Risikostruktur als Merkn-ral betrachtet. Bei den Überlegungen zugrundeliegenden Score-Karten<br />
war es nicht möglich mit einer 3- oder gar 4- bzw.5-stelligen Postleitzahl zu operieren. Es ist<br />
nachvollziehbar, dass auch ein überregional tätiges Leasingunternehmen nicht flächendeckend<br />
überall repräsentativ tätig sein kann, so dass im vorliegenden Fall die regionale Risikostruktur<br />
auf 2-stellige Postleitzahlen subsumiert werden musste, um zu einem aussageftihigen Ergebnis<br />
zu gelangen.<br />
Das Ergebnis der Stichprobe führte zu einer Score-Karte mit folgenden Werten:<br />
Punktewert Entscheidung Anteil<br />
1 370 sofort ablehnen 13,100h<br />
)71 550 manuell weiterprüfen 34.t0%<br />
55 | - 1.000 sofort annehmen 52,200<br />
Bei Addition der<br />
werden können.<br />
t,^;^^<br />
nElttg<br />
Anqabe<br />
brs<br />
1<br />
brs<br />
2<br />
positiven und negativen Entscheidungen sieht man, dass ca. 660Ä aller<br />
Leasinganträge, dieim<br />
Scoringverfahren bearbeitet werden, auch sofort vom System entschieden<br />
bis<br />
6<br />
bis<br />
11<br />
ü ber<br />
1t<br />
funkte 50 0 22 50 O4 105
Im<br />
a)<br />
b)<br />
c)<br />
84<br />
Auf die Notwendigkeit der Akzeptanz des Systems wurde bereits hingewiesen, und es ist leicht<br />
nachzuvollziehen, dass die Entscheidungen des Systems auch ohne jegliche Einschränkung<br />
akzeptiert werden müssen, d.h. Rot-Fälle sind rot und dürfen nicht durch irgendwelche<br />
Manipulationen emeut aufgegriffen werden; es sei denn, nachweislich sind falsche<br />
Informationen, z.B. über Firmenalter in die Score-Karte eingeflossen. Diese strikte Handhabung<br />
hört sich einfach an, sie bedarf aber, vor allern in der Anfangsphase, einer eindeutigen<br />
Durchsetzung, wobei eine mehr als dreijährige Erfahrung zeigt, dass man bei konsequenter<br />
Anwendung im Regelfall keine Probleme hat.<br />
4. Implementierung des Scoringsystems in die EDV-gestützteYorgangsbearbeitung<br />
d)<br />
e)<br />
vorliegenden Fall wurden folgende technischen Schritte vorgenommen:<br />
Programmierung der Score-Karte<br />
Aufbau einer Programm-zu-Programm-Kommunikation zwischen dem Leasingdialog-<br />
System des Unternehmens und dem Zentralrechnersystem der Creditrefonn<br />
Eingang der Creditreform-Auskunftsdaten in strukturierler und codierter Form sowie deren<br />
automatisierte Verarbeitung im Scoringsystem<br />
Integration des Scoringsystems in die notmale Antragsbearbeitung<br />
Aufbau einer Kundendatenbank mit den gelieferten Creditreform-luformationen<br />
Sicher sehen derartige EDV-Aufgaben auf dem Papier immer etwas einfacher aus als cs in<br />
Wirklichkeit ist. Hier hilft allerdings sehr, die richtigen Partner ausgewählt zu haben. denn es<br />
sind eine ganze Reihe von schwierigen Fragen zu bewältigen: z.B. die Handhabung wenn die<br />
Auskunftei die Auskunft nicht gespeichert hat, die Handhabung bei Abweichung der<br />
lnformationen der Auskunftei und den eigenen vorliegenden Informationen u.ä.<br />
Nachdem man das System implementiefi hat, läuft die technische Abwicklung im Regelfall mit<br />
folsenden Schritten ab:<br />
a)<br />
b)<br />
Die vorhandenen und bekannten Kundendaten werden in das System eingegeben<br />
Durch eine Online-Verbindung zür Auskunftei wird der Kunde lokalisierl und eindeutig<br />
bestimmt
85<br />
c) Die strukturierten Auskunftsdaten der Auskunftei bzgl. des Kunden werden übertragen und<br />
in das eigene System eingepflegt<br />
d) Die Einzelkreditentscheidung wird vom System getroffen<br />
5. Monitoring von Scoringsystemen<br />
Es ist offensichtlich, dass ein Scoringsystem nur so lange sachgerecht entscheiden kann wie die<br />
Kundenstruktur und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stichprobe und der jeweils<br />
aktuellen Praxis nicht zu weit auseinanderdriften. Das Scoringsystem muss daher im laufenden<br />
Einsatz permanent daraufhin überprüft werden, ob die auf der Basis der Entwicklungsstichprobe<br />
vorhergesagten Trennungseigenschaften gültig bleiben. Hierzu sind verschiedene Auswertungen<br />
(EDV-Statistiken) erforderlich, die sinnvoller Weise bereits bei der ImplementierLrng des<br />
Scoringsystems gleichzeitig programmieft werden. Zwn Monitoring gibt es die<br />
unterschiedlichsten Erhebungsmethoden und Systerne, von denen nachfolgend einige<br />
angesprochen werden sollen:<br />
a) Stabilitäts- und Verteilungsbericht<br />
Beispiel für einen bestimmten Zeitraum:<br />
Rot Gelb Grun Srmme<br />
:coflngluote<br />
Entwicklungsstich<br />
probe<br />
13,7% 34,10/o 52,2% 100,0%<br />
Aktuelle<br />
Anträqe<br />
3.14210,9o/o10,78237,30/o 14,96651,8%28.890 100,0%48,20/o<br />
Dieser Bericht stellt dar, ob die Verteilung der beurteilten Verträge auf die Punkteklassen Rot,<br />
Gelb und Grün insbesondere auf die Entscheidungsintervalle in dem Rahmen bleibt. wie er von<br />
der Entwicklungsstichprobe vorhergesagt wurde oder ob sich Punkteverleilungen verschoben<br />
haben. Daniber hinaus gibt es natürlich die Möglichkeit die Gelb-Entscheidungen detaillierter<br />
nach verschiedenen Punktintervallen und nach Entwicklungen im Zertablauf zu überprüfen.
) Gegenentscheidungsquote<br />
86<br />
Trotz größter Disziplin, d.h. Akzeptanz der Scoringentscheidungen, wird es den ein oder anderen<br />
Fall flir manuelle Gegenentscheidungen geben, d.h. in diesen Fällen wird Rot zu Grün und Grün<br />
zu Rot. Diese manuellen Eingriffe müssen in allen Fällen penibel dokumentiert werden, wobei<br />
die Erfahrung zeigt, dass dann, wenn sie 5% der Scoringenscheidungen übertreffen, das System<br />
erhebliche Mängel aufweist und überarbeitet werden muss.<br />
c) Schlechtenrate<br />
Hier betrachtet man die Entwicklung der<br />
Gesamtentscheidungen. wobei noch einmaldie<br />
Abgrenzung gut / schlecht in Erinnerung gerufen<br />
werden soll.<br />
d) Dynamische Rückstandsberichte<br />
schlechtgewordenen Geschäfte in Relation zu den<br />
Diese dokumentieren die Schlechtenratenentwicklung im Zeitablauf, d.h. alle in einem Quartal<br />
aktivierten Leasingverlräge werden über die Zeitachse beobachtet. Ein Vergleich mit den<br />
prognostizierten Schlechtenraten bei Projektbeginn zeigt dann. ob das System dann noch "im<br />
Ruder ist". Abschließend zu diesem Abschnitt sei darauf hingewiesen, dass ein Scoring-System<br />
in der Regel in 2 4 Jahren überarbeitet werden muss, Wobei diese Erneuerung dann aufgrund<br />
der vorhandenen Datenbasis relativ unkompliziert ist.<br />
6. Weiterentwicklungsmöglichkeiten<br />
a) Modifikation der bestehenden Scoringsysteme<br />
Hier ist vor allem an eine Erweiterung der Objektwertgrenzen sowie an eine Verkleinerung des<br />
"Gelb-Bereiches"<br />
zu denken. Da ein Scoringsystem per Definition die Entscheidung treffen soll,<br />
ist der ldealzustand natürlich dann erreicht, wenn treffsicher sofort zwischen grün und rot<br />
entschieden wird und der Gelb-Bereich völlig verschwunden ist. Es muss eigentlich nicht<br />
erwähnt werden, dass ein derartiges System natürlich theoretisch effektiv, in der Praxis jedoch<br />
fast nicht sinnvoll sein wird.
87<br />
Hinsichtlich der Entwicklung weiterer Scoringsysterne sei ausdrücklich nochmals auf die<br />
Grundbedingungen eines ausreichenden Mengengerüstes hingewiesen, d.h. nicht jedes Geschäft<br />
eignet sich fiir ein Scoringsystem. Die Stichprobe sollte erfahrungsgemäß zwischen 1.000 und<br />
5.000 Grundeinheiten umfassen, dies bedeutet, dass ein jährliches Neugeschäft von mindesten<br />
2.000 Anträgen eines Segments welches auf Scoringftihigkeit untersucht werden soll, gegeben<br />
sein müsste.<br />
7. Fazit<br />
Scoringsysteme bieten aufgrund von eigenen Erfahrungswerten gutes Risk-Management für das<br />
Breitengeschäft, d.h. sie sind ein effizientes Instrument zur Antragsprüfung und Entscheidung irn<br />
Standardgeschäft. Derartige Systerne bieten positive Kosten- und Marketingaspekte. wobei bei<br />
konsequenter Anwendung keine Verschlechterung des Risikoergebnisses eintreten darf. Eine der<br />
Haupterfolgsfaktoren für Scoringsysteme ist die frühzeitige Einbindung aller betroffener<br />
Mitarbeiter und Fachbereiche. Das für Scoringsysteme erforderliche Monitoring bietet den<br />
Vorteil gleichzeitig zu einer Verfeinerung des Kreditüberwachungssystems beizutragen.<br />
Abschließend seien aber auch die Grenzen erwähnt: Scoringsysteme sind nllr so gut wie die<br />
Menschen den Grundstein eelest haben. mit Ihnen umgehen und sie weiterentwickeln'