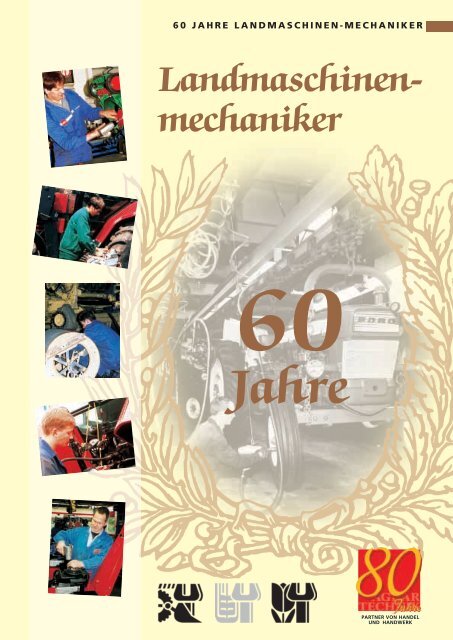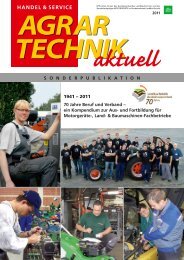Landmaschinen- mechaniker - BuFa-MOT
Landmaschinen- mechaniker - BuFa-MOT
Landmaschinen- mechaniker - BuFa-MOT
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
60 JAHRE LANDMASCHINEN-MECHANIKER<br />
<strong>Landmaschinen</strong><strong>mechaniker</strong><br />
60<br />
Jahre<br />
PARTNER VON HANDEL<br />
UND HANDWERK
2<br />
60 JAHRE LANDMASCHINEN-MECHANIKER<br />
Jung gebliebener<br />
Sechziger<br />
Auch der Lanz-Bulldog kann heuer seinen 80sten Geburtstag feiern. Hier in den 30er-Jahren bei<br />
Versuchen zur Entwicklung von Mähdreschern. Von Anfang an war der Bulldog natürlich auch<br />
eine wichtige Maschine bei der Ausbildung von Mechanikern.<br />
Zum Beruf des <strong>Landmaschinen</strong><strong>mechaniker</strong>s<br />
könnte man den Spruch<br />
zitieren: „60 Jahre und kein bisschen<br />
leise”. Ursprünglich war es ein reiner Monoberuf<br />
zur Sicherung der Nahrungsmittelproduktion.<br />
Heute sind die Gesellen und<br />
Meister Technik-Allrounder, die sich mit<br />
allen in den Boden oder die Landschaft<br />
eingreifenden Maschinen- und Geräten<br />
bestens auskennen. Doch nun der Reihe<br />
nach.<br />
1941: „Offizielle Geburt”<br />
Natürlich gab es schon vor 1941 eine Verbandsorganisation<br />
für <strong>Landmaschinen</strong>. Der<br />
erste <strong>Landmaschinen</strong>handelsverband wurde<br />
bereits 1910 gegründet. Ende Februar<br />
1941 kam das „zweite Standbein” der Branche<br />
hinzu. Mitten im Krieg entstand per<br />
Dekret der <strong>Landmaschinen</strong><strong>mechaniker</strong>:<br />
Der Reichsinnungsmeister ordnete die Errichtung<br />
von Pflichtinnungen des „<strong>Landmaschinen</strong>handwerks”<br />
an. Wer persönlich<br />
befähigt und wessen Betrieb ausreichend<br />
ausgestattet war, durfte diesen Innungen<br />
beitreten. Von rund 25 000 Antragstellern<br />
fanden schließlich 5 000 Berücksichtigung.<br />
Man war „kriegswichtig”, man genoss Sonderstatus<br />
und man benötigte in der Folgezeit<br />
vor allem ein gerüttelt Maß an Improvisationstalent,<br />
so zum Beispiel bei der<br />
Umrüstung von Schleppern auf den Betrieb<br />
mit Holzgas-Generatoren. Sitz des ersten<br />
Reichsinnungsverbandes war Berlin.<br />
Anfangs ein Monoberuf<br />
In der Nachkriegszeit gab es dann 1949<br />
noch 3 300 Betriebe mit 20 000 Beschäftigten.<br />
Der <strong>Landmaschinen</strong>handwerker war<br />
wichtiger denn je. Er leistete seinen – nicht<br />
unbedeutenden – Beitrag zum Boom der<br />
Folgejahre. Im November 1948 war aus<br />
dem „Hauptverband des deutschen <strong>Landmaschinen</strong>handels<br />
e.V.” und dem „Hauptinnungsverband<br />
des <strong>Landmaschinen</strong>handwerks”<br />
die H.A.G. entstanden. Unter<br />
dem Dach dieses ersten Verbandsgebildes<br />
fanden Handel und Handwerk ihre Heimat.<br />
Aus heutiger Sicht ist dies eine Selbstverständlichkeit,<br />
damals war es jedoch eine<br />
Sensation. Auch Jahre später gab es in<br />
vielen Betrieben noch unsichtbare Tren-<br />
Streifzug durch die Geschichte<br />
eines interessanten Handwerks<br />
Fotos: Archiv, Beckschulte<br />
Im Jahr 2001 präsentiert<br />
sich ein 60 Jahre altes<br />
Handwerk „runderneuert”.<br />
Der <strong>Landmaschinen</strong><strong>mechaniker</strong><br />
von heute kann auf<br />
ein solides Fachwissen verweisen.<br />
Es ist ein Beruf, der<br />
so vielseitig ist wie kaum<br />
ein anderer. Doch nun zum<br />
Geschehen in den vergangenen<br />
60 Jahren.<br />
nungsstriche durchs Büro – links Handel,<br />
rechts Handwerk.<br />
Der erste Bundesinnungsmeister war Heinrich<br />
Meyer aus Groß-Liedern, die H.A.G.-<br />
Geschäftsstelle wanderte über Frankfurt<br />
(1948 bis 1950) nach Bad Godesberg<br />
(1951). Die Innungen in Rheinland-Pfalz<br />
fanden 1951 zu einem Landesinnungsverband<br />
zusammen. Dessen erster Erfolg: Ein<br />
Tarifvertrag mit der IG-Metall, ein Stundenlohn<br />
zwischen 1,18 und 1,35 Mark wurde<br />
vereinbart.<br />
Gebrauchtmaschine – was<br />
ist denn das?<br />
Zu Beginn der 50er-Jahre kommt es zu einem<br />
bis dahin unbekannten Phänomen:<br />
Der Landwirt will beim Kauf eines neuen<br />
Schleppers seine alte Maschine in Zahlung<br />
geben! Regional wollten dies bis zu 80 Prozent<br />
der Kunden! Unglaublich!<br />
Doch die Karawane zieht weiter. Bereits<br />
1952 – einige Jahre vor der Europäischen<br />
Wirtschafts Gemeinschaft (EWG) – schließt<br />
sich die Branche europaweit zum „Centre<br />
de liaison international des marchands des<br />
AGRARTECHNIK SONDERDRUCK LMM
machines agricoles et des réparateurs“<br />
(CLIMMAR) zusammen, dem heute mehr<br />
denn je benötigten europäischen Verband.<br />
1954 wird die BFA Lüneburg eingeweiht.<br />
Ein Lehrgang für <strong>Landmaschinen</strong>kaufleute<br />
dauerte 1957 an der BFA Lüneburg genau<br />
fünf Tage.<br />
Drei Jahre später tritt die Innung des Saarlandes<br />
der H.A.G. bei, erst 1969 wird mit<br />
dem Landesinnungsverband Bayern der<br />
Bundesverband komplett.<br />
1955 wird der „Hauptinnungsverband” zum<br />
Bundesinnungsverband. Zum ersten Bundesinnungsmeister<br />
wählt die Versammlung<br />
Heinrich Oestreich aus Lippstadt. Mit fast<br />
100 000 Schlepper-Neuzulassungen geht<br />
das Jahr 1955 in die Branchengeschichte<br />
ein. Wegen ruinösen Marktgebahrens verpflichten<br />
die ersten Hersteller den Handel,<br />
Neumaschinen nur noch zu Listenpreisen<br />
zu veräußern und Gebrauchtmaschinen<br />
nur noch nach Schätzung durch Sachverständige<br />
hereinzunehmen.<br />
Eines der Ergebnisse der Handwerkszählung<br />
1956: Es gab 2 141 <strong>Landmaschinen</strong><strong>mechaniker</strong>-Meister<br />
in 3 594 Betrieben mit<br />
24 148 Beschäftigten, darunter befand sich<br />
eine Frau – ein Verhältnis, an dem sich bis<br />
heute nichts Wesentliches geändert hat.<br />
Auf dem Weg zum<br />
Servicebetrieb<br />
War es bislang vor allem der Vertrieb, dem<br />
die Werkstatt beim Fertigmachen der verkauften<br />
Maschine zur Seite stand, so wendete<br />
sich das Blatt. Die Werkstatt erreich-<br />
Ein erfolgreiches Gespann: Bundesinnungsmeister<br />
Heinz-Jürgen Müller (re.) und Hauptgeschäftsführer<br />
Thomas Fleischmann.<br />
te in den 60er-Jahren erstmals echte Servicefunktionen,<br />
es wurde repariert und gewartet.<br />
Spitzenwerte von bis zu 12 000<br />
Lehrlingen ließen den <strong>Landmaschinen</strong>-<br />
Handwerker auf Position zwölf der Ausbildungsstatistik<br />
im deutschen Handwerk<br />
vorrücken. Jedes Jahr absolvierten fast<br />
400 junge Menschen die Meisterprüfung,<br />
über 3 100 Gesellen bildeten die 3 900 in<br />
AGRARTECHNIK SONDERDRUCK LMM<br />
die Handwerksrolle eingetragenen Betriebe<br />
jährlich aus. Bis zu zwei Milliarden Mark<br />
gaben die westdeutschen Landwirte für Instandhaltungs-<br />
und Reparaturmaßnahmen<br />
aus. Auf satte 9,15 Mark bezifferte die<br />
H.A.G. 1963 den durchschnittlichen Stundenverrechnungssatz<br />
der Werkstatt.<br />
1970 übernimmt Franz Tschauner aus<br />
Frankfurt das Ruder beim Handwerksverband<br />
in der H.A.G. Nach 20 Jahren an<br />
der hauptamtlichen Spitze ging mit Direktor<br />
H.W. Fenge ein Urgestein der Branche<br />
in den Ruhestand; Walter Haffa folgte ihm<br />
nach, eine kaum weniger schillernde Persönlichkeit<br />
der Branche auf dem Stuhl des<br />
Hauptgeschäftsführers. Unter Bundesinnungsmeister<br />
Paul Ritter aus Zell beginnt<br />
ab 1977 die Umstrukturierung des <strong>Landmaschinen</strong>handwerkers<br />
zum -<strong>mechaniker</strong>.<br />
Bereits damals wurde das Berufsbild inhaltlich<br />
um Kommunal- und Gartentechnik<br />
sowie Baumaschinen erweitert. Erst im<br />
März 1989 wurde die (damals) “neue Ausbildungsordnung”<br />
fertig. Diese erste inhaltliche<br />
Diversifikation ist wohl mit ein Grund<br />
dafür, dass es ab Mitte der 70er-Jahre zu<br />
einem Anstieg der in die Handwerksrolle<br />
eingetragenen Betriebe kam. Über viele<br />
Jahrzehnte waren immer um die 4 000 pri-<br />
vate und genossenschaftliche Servicebe-<br />
triebe eingetragen, jetzt stieg die Zahl der<br />
Eintragungen jährlich um 100 Unternehmen.<br />
1987 wurden bereits 4 909 Betriebe gezählt.<br />
Seit 1985 leitet Thomas Fleischmann als<br />
Hauptgeschäftsführer die Geschicke der<br />
H.A.G., damals noch in der Geschäftsstelle<br />
Bonn. 1988 begann das „eheähnliche“ Verhältnis<br />
von Verband und der 20 Jahre älteren<br />
AGRARTECHNIK mit Sitz in Würzburg,<br />
das auch heute in Zeiten von Internet<br />
und E-Commerce noch besteht.<br />
1991 nimmt die H.A.G. mit den Landes-<br />
Fachverbänden aus den neuen Ländern<br />
Der Markt für <strong>Landmaschinen</strong> wird enger (relative Entwicklung)<br />
Landwirtschaftliche Betrtiebe<br />
landw. Vollerwerbsbetriebe<br />
<strong>Landmaschinen</strong>-Fachbetriebe<br />
rund 1 000 Fachbetriebe in ihre Reihen auf.<br />
Das <strong>Landmaschinen</strong><strong>mechaniker</strong>-Handwerk<br />
in Deutschland zählt nun fast 46 000<br />
Beschäftigte in 5 800 Betrieben. Rekordverdächtige<br />
766 Meisterprüfungen werden<br />
1991 verzeichnet. Unter Heinz-Jürgen Müller,<br />
Nordstemmen, als Bundesinnungsmeister<br />
erfährt das LMM-Handwerk – so<br />
die eingebürgerte Abkürzung – seine aktuelle<br />
Ausprägung: Der „neue <strong>Landmaschinen</strong><strong>mechaniker</strong>“<br />
geht aus der Deregulierung<br />
des Handwerks gestärkt hervor,<br />
das Meisterberufsbild wird um Baumaschinen<br />
und Motorgeräte erweitert. Auch<br />
die Gesellenausbildung wird angepasst,<br />
die überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen<br />
fixiert. Mit dem Automobilkaufmann<br />
und Servicetechniker widmet sich<br />
der Berufsstand neuen Aus- und Weiterbildungsthemen,<br />
die den vertretenen Branchen<br />
neue Eckpfeiler bieten. Auch gelingt<br />
es Bundesinnungsmeister Müller, Bildungsund<br />
Handwerksthemen in die Kollegenverbände<br />
im europäischen Umfeld zu tragen,<br />
CLIMMAR veranstaltet 1998 erste<br />
„Ausbildungstage“ in Brüssel. Wesentlichen<br />
Anteil daran hat die neue Bürogemeinschaft<br />
der Geschäftsstelle der H.A.G.<br />
mit dem Bundesverband Metall (BVM) in<br />
Essen.<br />
Heute treffen wir auf einen putzmunteren<br />
60-jährigen <strong>Landmaschinen</strong><strong>mechaniker</strong>,<br />
der bald als „Mechaniker für Land- und<br />
Baumaschinentechnik“ auftreten wird. Mit<br />
seinem Urvater von 1941 verbinden ihn<br />
noch Namensteile, die Technik der ersten<br />
Jahre steht im Museum. Das kann man<br />
vom neuen <strong>Landmaschinen</strong><strong>mechaniker</strong><br />
nicht behaupten: Das moderne <strong>Landmaschinen</strong><strong>mechaniker</strong>-Handwerk<br />
genießt<br />
heute einen soliden Ruf, bietet eine inhaltlich<br />
breite und vielseitige Ausbildung<br />
mit attraktiven Zukunftsaussichten. �<br />
3<br />
Quelle: HAG
4<br />
60 JAHRE LANDMASCHINEN-MECHANIKER<br />
Die umfangreichen, zeitraubenden<br />
Arbeiten vieler Experten aus der<br />
Verbandsorganisation sind erfolgreich<br />
abgeschlossen. In Abstimmung mit<br />
den Sozialpartnern und dem Verordnungsgeber,<br />
dem Bundesminister für Wirtschaft<br />
und Technologie (BMWi), ist ein modernes,<br />
zeitgemäßes Meisterprüfungs- berufsbild<br />
entstanden. Es stellt die Kompetenz des<br />
Meisters als Unternehmer und Führungskraft<br />
eines Betriebs in den Vordergrund.<br />
Natürlich sind auch die notwendigen technischen<br />
Befähigungen definiert. Das neue<br />
Meisterprüfungsberufsbild soll den <strong>Landmaschinen</strong><strong>mechaniker</strong><br />
auf seine künftige<br />
Rolle als Unternehmer vorbereiten.<br />
Fachwissen pur steht künftig nicht mehr im<br />
Vordergrund, der neue Meister wird nach<br />
dem Leitsatz „Wie kann der zukünftige Meister<br />
als Unternehmer am Markt in unserem<br />
Handwerk bestehen?” ausgebildet. Natürlich<br />
hat diese Neuordnung unmittelbare Auswirkungen<br />
auf die Meister-Vorbereitungslehrgänge,<br />
das zusätzliche Wissen wird<br />
Gegenstand der Prüfung sein. Das neue<br />
Meisterprüfungsberufsbild tritt am 1. Juli<br />
2001 in Kraft und löst dann das alte Berufsbild<br />
vom September 1978 ab.<br />
Was sich geändert hat<br />
Das neue „Meisterprüfungsberufsbild“ beschreibt<br />
unter anderem, was für das Bestehen<br />
der Meisterprüfung erforderlich ist. Vorbehaltsbereiche,<br />
mehr oder weniger scharfe<br />
Abgrenzungen zu anderen Handwerken –<br />
wie sie durch die früheren Berufsbilder möglich<br />
waren – gibt es jetzt nicht mehr. Bei der<br />
Neustrukturierung wurde auch Wert auf die<br />
Foto: Beckschulte<br />
Meisterlich<br />
Das neue Meisterprüfungsberufsbild liegt jetzt vor<br />
gesamte Bandbreite der Meisterprüfung gelegt.<br />
Nicht nur Teil I und II wurden überarbeitet,<br />
auch die allgemeinen verbindlichen<br />
Teile III und IV sind nun modernisiert.<br />
Meister als Unternehmer<br />
Ein wesentliches Element des „neuen Meisters”<br />
ist die Aufnahme einer Präambel als<br />
Einführung in das Meisterprüfungsberufsbild,<br />
dort steht schwarz auf weiß:<br />
„Durch die Meisterprüfung im <strong>Landmaschinen</strong><strong>mechaniker</strong>-Handwerk<br />
wird festgestellt,<br />
dass der Prüfling befähigt ist, einen Handwerksbetrieb<br />
selbstständig zu führen, Leitungsaufgaben<br />
in den Bereichen Technik,<br />
Betriebswirtschaft, Personalführung und -<br />
entwicklung wahrzunehmen, die Ausbildung<br />
durchzuführen und seine berufliche Handlungskompetenz<br />
selbstständig umzusetzen<br />
und an neue Bedarfslagen in diesen Bereichen<br />
anzupassen.”<br />
Diese Präambel drückt sehr treffend aus,<br />
was vom neuen Meister erwartet wird. In<br />
Verbindung mit der neuen Meisterprüfung<br />
in allen vier Teilen ergibt dies ein rundes Bild<br />
davon, worauf wir unsere neuen Meister vorbereiten<br />
müssen. Diese müssen wissen,<br />
dass nicht allein die Beherrschung von Techniken<br />
das Überleben der Betriebe am Markt<br />
garantiert, sondern das Zusammenwirken<br />
vieler Elemente. Auch vor dem Hintergrund<br />
der fortwährend geführten Diskussion über<br />
die Beibehaltung der Meisterprüfung ist diese<br />
Fortentwicklung wichtig. Die Sozialpartner<br />
auf Arbeitnehmerseite – für <strong>Landmaschinen</strong><br />
die IG-Metall – trägt die neue<br />
Meisterprüfung mit. Sie akzeptiert damit,<br />
dass der neue Meister weit mehr ist und<br />
kann als ein gut ausgebildeter Geselle oder<br />
Facharbeiter.<br />
Handlungsorientierung<br />
In den neuen Verordnungen ist das Prinzip<br />
der so genannten „Handlungsorientierung”<br />
als Kernelement der neuen Meisterprüfung<br />
konsequent aufgegriffen worden. Nicht die<br />
Prüfung von reinem technischen Fachwissen<br />
soll in der Meisterprüfung und -vorbereitung<br />
im Vordergrund stehen, sondern eine<br />
an die Anforderungssituation der Praxis<br />
ausgerichtete Expertenkompetenz.<br />
Die Handlungsorientierung kommt darin zum<br />
Ausdruck, dass die zu lösenden Prüfungsaufgaben<br />
nicht die Wiedergabe von Wissen,<br />
sondern die Lösung repräsentativer technischer,<br />
betriebswirtschaftlicher und pädagogischer<br />
Praxisprobleme in der Unternehmensführung<br />
erfordern. Zu diesem Zweck<br />
werden entsprechende Prüfungsaufgaben<br />
mit aufgenommen:<br />
• Meisterprüfungsprojekt einschließlich Fachgespräch<br />
und Situationsaufgaben in Teil I,<br />
die vom Kandidaten eine umfassende Problemlösung<br />
verlangen.<br />
• Fallorientierte Prüfungsaufgaben in Teil II,<br />
die den Kandidaten veranlassen, sich mit<br />
der Lösung eines komplexen Technikproblems<br />
auseinanderzusetzen.<br />
• Prüfungsaufgaben in den Teilen III und IV,<br />
die vom Kandidaten die Lösung betriebswirtschaftlicher,<br />
berufs- und arbeitspädagogischer<br />
Fälle verlangen.<br />
Der Kandidat soll also in der Prüfung darlegen<br />
können, dass er in der Lage ist, Expertenwissen<br />
anzuwenden, die Prüfung soll als<br />
Spiegelbild der täglichen Arbeit dienen.<br />
Neue Pfade betreten<br />
Die H.A.G. ist sich bewusst, dass mit den<br />
neuen Prüfungen alte Pfade verlassen werden.<br />
Es ist dabei ersichtlich, dass sich diejenigen,<br />
die sich mit Prüfungen und Prüfungsvorbereitung<br />
befassen, auf neue<br />
Themen und Forderungen einstellen müssen.<br />
Dies wird nicht immer leicht sein, neue<br />
Begriffe wie „Handlungsorientierung“ oder<br />
„fallorientierte Aufgaben“ machen dies deutlich.<br />
Die H.A.G. will die Meisterprüfungsausschüsse<br />
im LMM-Handwerk und die Institutionen,<br />
die Vorbereitungslehrgänge anbieten,<br />
möglichst umfassend bei diesen<br />
neuen Aufgaben unterstützen. Dies wird<br />
nicht leicht und ist zeit- sowie kostenintensiv.<br />
Der Bundesverband hat daher im Zusammenwirken<br />
mit dem Forschungsinstitut<br />
für Berufsbildung im Handwerk an der Uni<br />
Köln (FBH) den Bundesminister für Bildung<br />
und Forschung für ein Projekt gewinnen können,<br />
das Hilfestellungen für die Meisterkurse<br />
und -prüfungen leistet:<br />
• Entwicklung und Erprobung von „Prototypen”<br />
für die Meisterprüfung in den Teilen<br />
AGRARTECHNIK SONDERDRUCK LMM
I bis IV,<br />
• Konzeption und Durchführung von Seminaren<br />
zur Schulung von Mitgliedern der Prüfungsausschüsse<br />
sowie Dozenten der Meisterkurse,<br />
• Entwicklung eines internetgestützten Informationssystems<br />
für Prüfungsausschüsse,<br />
• Erarbeitung von Umsetzungshilfen für die<br />
Meisterprüfungen, im Besonderen Leitfäden<br />
für die Prüfer.<br />
Die Federführung bei der Umsetzung dieser<br />
Maßnahmen übernimmt die Meisterschule<br />
des Fachverbandes (BFA Lüneburg).<br />
Mit dem neuen Berufsbild wurde ein weiterer<br />
Meilenstein gesetzt. Allen, die daran arbeiteten,<br />
die mit ihren Anregungen und ihrer<br />
Kritik für ständige Verbesserungen<br />
sorgten, gilt der Dank der Branche. Zusammen<br />
mit allen Experten ist der Bundesverband<br />
H.A.G. zuversichtlich, zum Beginn<br />
des neuen Jahrtausends einen entscheidenden<br />
Schritt in die Zukunft getan zu haben.<br />
„Update” für die<br />
Gesellenprüfung<br />
Neben dem jetzt abgeschlossenen<br />
neuen Meisterprüfungsberufsbild<br />
wird auch die „restliche” Ausbildung<br />
überarbeitet. Der Startschuss dafür ist<br />
bereits im November 2000 gefallen, Arbeitstitel:<br />
„Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik“.<br />
Schon diese neue Namensgebung<br />
macht die wesentlichen<br />
Bereiche der Ausbildung deutlich: Neben<br />
der klassischen Landtechnik wird die Baumaschinentechnik<br />
stärker eingebunden. Dadurch<br />
erübrigt es sich, einen eigenen Ausbildungsberuf<br />
für Baumaschinen zu kreieren.<br />
Auch der Motorgerätebereich wird deutlich<br />
herausgearbeitet. Damit steht der neue „Mechaniker<br />
für Land- und Baumaschinentechnik“<br />
für den Allrounder, der alle Arbeiten an<br />
Maschinen für die Landwirtschaft über Garten<br />
und Kommune bis hin zu Baumaschinen<br />
beherrscht.<br />
Die Neuordnung der gesamten Fahrzeugtechnischen<br />
Berufe: Dazu gehören<br />
neben dem „alten” <strong>Landmaschinen</strong><strong>mechaniker</strong><br />
vor allem die Kfz-Berufe, die Karosserie-<br />
und Fahrzeugbauer sowie die Zweirad<strong>mechaniker</strong>.<br />
Hier werden folgende<br />
Neuerungen diskutiert:<br />
AGRARTECHNIK SONDERDRUCK LMM<br />
VERÄNDERUNGEN BEI DER MEISTERPRÜFUNG AUF EINEN BLICK<br />
� Beschreibung der Anforderungen in der Meisterprüfung<br />
� Beschreibung der Anforderungen an den Meister als Betriebsleiter („Manager“) -<br />
Technik ist dabei der nötige Unterbau<br />
� Beschreibung von Kenntnissen, Tätigkeiten und Fertigkeiten zum Zwecke der<br />
Meisterprüfung<br />
� Inhalte des Meisterprüfungsberufsbildes:<br />
– Betrieb selbstständig führen<br />
– Leitungsaufgaben in Technik, Betriebswirtschaft und Personal<br />
– Ausbildung durchführen<br />
– berufliche Handlungskompetenz in den Vordergrund stellen<br />
� Meisterprüfung - Teil I: Meisterprüfungsprojekt ist jetzt ein ganzheitliches Projekt:<br />
– Entwurf, Planung, Kalkulation<br />
– Aufbau, Anfertigung<br />
– Protokollierung<br />
– Fachgespräch zum Projekt<br />
– Aufgabendurchführung an Land- und Baumaschinen oder<br />
Motorgeräten<br />
– zusätzlich: Situationsaufgabe vervollständigt die Meisterprüfung<br />
� Meisterprüfung - Teil II: Neue Fächer:<br />
– Maschinentechnik<br />
– Maschineninstandhaltung und -instandhaltungstechnik<br />
– Auftragsabwicklung<br />
– Betriebsführung und Betriebsorganisation<br />
� Aufgabenstellungen werden fallorientiert formuliert, Verbindung mehrerer<br />
Qualifikationen<br />
� Mündliche Prüfung nur zum Bestehen von Teil II erforderlich<br />
• Schaffung einer neuen Gruppe Fahrzeugtechnik,<br />
also die Herauslösung der Berufe<br />
aus der bisherigen Gruppe Metalltechnik,<br />
• Bildung eines gemeinsamen ersten<br />
Lehrjahres mit Schwerpunkt Fahrzeug-<br />
Service,<br />
• Metallbe- und -verarbeitung sollen dann<br />
ab dem zweiten Lehrjahr folgen,<br />
• Die Möglichkeit einer Fachrichtungs- oder<br />
Schwerpunktbildung in der Fachstufe.<br />
Das so genannte „Antragsgespräch“ zur<br />
Eröffnung des Verfahrens findet im Sommer<br />
2001 beim Bundeswirtschaftsminister<br />
statt. Nach der Sommerpause werden<br />
dann die Sachverständigen von Arbeitgeber-<br />
und Arbeitnehmerseite die Inhalte erarbeiten.<br />
Wann die neue Ausbildungsordnung<br />
schließlich in Kraft treten wird, hängt<br />
wesentlich vom zügigen Fortkommen im<br />
laufenden Verfahren ab. Ob dies bereits<br />
zum Ausbildungsbeginn 2002 möglich sein<br />
wird, ist derzeit nicht erkennbar. Wir arbeiten<br />
daran.<br />
5<br />
Quelle: HAG
Foto: Werkbild<br />
Die „neue” Ausbildung<br />
Fahrzeugtechnische Berufe sind neu<br />
geordnet, Schulungen stehen bevor<br />
Die Neuordnung der fahrzeugtechnischen<br />
Berufe hat begonnen, das Berufsbild für<br />
die Meisterprüfng ist fertig. Diskutiert<br />
wird immer noch die Ausbildung<br />
zum “Servicetechniker”.<br />
6<br />
60 JAHRE LANDMASCHINEN-MECHANIKER<br />
Auf der zweiten H.A.G.-<br />
Vorstandssitzung berichteteBundesinnungsmeister<br />
Heinz-Jürgen Müller,<br />
dass die Neuordnung des<br />
Meisterprüfungsberufsbildes<br />
<strong>Landmaschinen</strong><strong>mechaniker</strong><br />
nun abgeschlossen ist. Die<br />
neuen Prüfungsausschüsse<br />
werden demnächst entsprechend<br />
der neuen Vorgaben<br />
geschult. Diese Schulungen<br />
werden gefördert und – koordiniert<br />
von der H.A.G. – an<br />
verschiedenen Standorten in<br />
Deutschland durchgeführt.<br />
Unser Handwerk ist damit<br />
eines der ersten, das die neu-<br />
en Modalitäten erfüllen kann.<br />
<strong>Landmaschinen</strong> in der Gruppe<br />
der fahrzeugtechnischen<br />
Berufe:<br />
Am 25. Juni hat das Antragsgespräch<br />
zur Neuordnung der<br />
fahrzeugtechnischen Berufe<br />
beim Bundes-Wirtschaftsminister<br />
stattgefunden. Neu daran<br />
ist unter anderem, dass das<br />
<strong>Landmaschinen</strong><strong>mechaniker</strong>-<br />
Handwerk in der Grundstufe<br />
den fahrzeugtechnischen Berufen<br />
folgen soll. Ab dem<br />
zweiten Lehrjahr erfolgt die<br />
Ausbildung an Land- und<br />
Baumaschinen, ab dem dritten<br />
und vierten Lehrjahr könnte<br />
eine “Ausprägung” – zum<br />
Beispiel Motorgeräte, Baumaschinen<br />
– erfolgen. Auch die<br />
Bezeichnung als “Mechaniker<br />
für Land- und Baumaschinentechnik”<br />
soll der Branchen-<br />
Realität angepasst sein.<br />
Gegenüber Berufen nach<br />
Handwerksordnung, die nur<br />
von Handwerkern ausgebildet<br />
werden können, soll der neue<br />
Beruf auch nach Berufsbildungsgesetz<br />
(BBiG) geregelt<br />
werden. Dieser kann dazu<br />
auch von anderen Betrieben<br />
außerhalb des Handwerks<br />
ausgebildet werden. Die Industrie<br />
– insbesondere die Vertreter<br />
der Baumaschinenhersteller –<br />
und die Gewerkschaften hatten<br />
ihre Zustimmung zum neuen<br />
Mechaniker für Land- und<br />
Baumaschinentechnik davon<br />
abhängig gemacht, dass der<br />
neue Beruf auch nach BBiG<br />
ausgebildet werden kann. Der<br />
Berufsbildungsausschuss hat<br />
dieser Öffnung im Frühjahr<br />
2001 bereits zugestimmt, der<br />
H.A.G.-Vorstand ist ihm<br />
gefolgt. Mit den Folgen und<br />
der Formulierung eventueller<br />
Maßnahmen, die ein maximales<br />
Verbleiben im Handwerk<br />
sicherstellen sollen,<br />
befasst sich eine eigens dafür<br />
eingerichtete Arbeitsgruppe.<br />
Servicetechniker<br />
Der Servicetechniker Landund<br />
Baumaschinen wird in<br />
der Branche immer wieder<br />
diskutiert. Ein Grund dafür<br />
ist sicher, dass ein großer<br />
Hersteller auf der Basis<br />
des Kfz-Servicetechniker<br />
entsprechend ausbildet. Ein<br />
wesentliches Argument für<br />
den noch in der Konzeption<br />
befindlichen Servicetechniker<br />
ist die Anrechnungsmöglichkeit<br />
auf Teile der Meisterprüfung,<br />
Teile I oder II. Dabei darf<br />
naturgemäß der herstellerspezifische<br />
Anteil einen gewissen<br />
Rahmen nicht überschreiten.<br />
Ein eigenes Konzept erstellt<br />
derzeit der H.A.G.-Berufsbildungsausschuss<br />
in enger<br />
Zusammenarbeit mit dem<br />
Forschungsinstitut für Berufsbildung<br />
im Handwerk (FBH).<br />
Keinesfalls darf man diesen<br />
Servicetechniker mit dem derzeit<br />
noch so genannten Melkservice-Technikerverwechseln.<br />
Diese Bezeichnung steht<br />
für eine Qualifizierungsmaßnahme,<br />
konzipiert von der<br />
DLG, und zwar in enger Zusammenarbeit<br />
mit den Melktechnikherstellern.<br />
Der Absolvent<br />
solcher Kurse wird über<br />
den rein technischen Aspekt<br />
hinaus mit einem größeren<br />
Verständnis für Milchvieh,<br />
Melk-, Milchmanagement und<br />
Tierphysiologie “versorgt”.<br />
DLG und H.A.G. haben dazu<br />
ein Konzept erarbeitet, um eine<br />
“Service-Fachkraft Melktechnik”<br />
zu schaffen, ähnlich<br />
der Elektro-Fachkraft für<br />
Motorgeräte. ■<br />
AGRARTECHNIK SONDERDRUCK LMM
Top-Ausbildung<br />
Die überbetriebliche Lehrlings-Unterweisung<br />
Die so genannte „ÜBL” ist ein wichtiger Teil der Ausbildung<br />
im dualen Sytem. Auf Innungsversammlungen wird<br />
sie immer wieder – zu Unrecht – in Frage gestellt. Fest<br />
steht, dass sie Fertigkeiten vermittelt, die über die Möglichkeiten<br />
vieler Ausbildungsbetriebe hinaus gehen.<br />
Die Überbetriebliche Unterweisung<br />
(ÜBL) steht immer wieder im<br />
Brennpunkt vieler Diskussionen.<br />
Sie ist jedoch Teil der betrieblichen Ausbildung<br />
im dualen System. Die dort definierten<br />
Kurse ergänzen und unterstützen<br />
die betriebliche Ausbildung, sie homogenisieren<br />
das Ausbildungsniveau in bestimmten<br />
relevanten Berufsschwerpunkten.<br />
Der ÜBL kommt gerade im umfangreichen<br />
Berufsbild des <strong>Landmaschinen</strong><strong>mechaniker</strong>-Handwerks<br />
besondere Bedeutung<br />
zu. In Abstimmung mit den Gewerkschaften<br />
hat die H.A.G. deshalb bereits<br />
1991 bestimmte ÜBL-Kurse festgelegt.<br />
An den mit „obligatorisch“ ausgewiesenen<br />
Kursen muss der Lehrling teilnehmen. Sie<br />
stellen Kernelemente der Ausbildung dar<br />
und sind auch eine gute Vorbereitung auf<br />
die Gesellenprüfung. Die „freiwilligen“ ÜBL-<br />
Kurse kann eine Innung in Zusammenarbeit<br />
mit der zuständigen Handwerkskammer<br />
durchführen.<br />
Mit seinem ÜBL-Programm liegt das <strong>Landmaschinen</strong><strong>mechaniker</strong>-Handwerk<br />
– vom<br />
Zeitaufwand her gesehen – weit unter den<br />
Ausbildungsmaßnahmen von anderen Metallhandwerken.<br />
Damit sind auch die Belastungen<br />
für den Einzelbetrieb weitaus<br />
geringer.<br />
Konzentrierte<br />
Wissensvermittlung<br />
Die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung<br />
ist ein Teil der betrieblichen Ausbildung.<br />
Ausbildungsinhalte, die der Betrieb<br />
vermitteln soll, werden an einer Bildungseinrichtung<br />
in konzentrierter Form „eingetrichtert”.<br />
An dieser Stelle ergeht der Appell<br />
an alle Ausbildungsbetriebe und<br />
AGRARTECHNIK SONDERDRUCK LMM<br />
Innungen vor Ort: Sprechen Sie mit den<br />
Ausbildern in Ihren Kursstätten! Nehmen<br />
Sie Einfluss, sagen Sie, was in Ihren Betrieben<br />
gebraucht wird! Üben Sie Kritik,<br />
bringen Sie sich ein! Die ÜBL ist schließlich<br />
ein Ausbildungsteil Ihres Betriebes.<br />
Der Deutsche Handwerkskammertag<br />
(DHKT) hat die Vorteile der ÜBL zusammengestellt.<br />
Hier zuerst die Vorteile für<br />
den Einzelbetrieb:<br />
• Die Ausbildungsinhalte orientieren sich<br />
am betrieblichen Bedarf.<br />
• Das praxisorientierte Lehrgangsangebot<br />
wurde mit den zentralen Fachverbänden<br />
erarbeitet.<br />
• Zeitintensive Ausbildungsinhalte werden<br />
vermittelt, ohne dass sie den betrieblichen<br />
Ablauf stören.<br />
• Fertigkeiten, die über die Spezialisierung<br />
des Betriebs hinausgehen werden vermittelt.<br />
• Neue Technologien sowie Anwendung<br />
von Informations- und Kommunikationstechniken<br />
werden erläutert.<br />
• Kostengünstiges Lehrgangsangebot aufgrund<br />
öffentlicher Förderung.<br />
Nicht nur der Ausbildungsbetrieb, auch<br />
die Lehrlinge profitieren von dieser Art<br />
der Wissensvermittlung:<br />
• Unterstützung bei der beruflichen Grundausbildung,<br />
• systematische Vermittlung von Fachqualifikation,<br />
• Blick über den Tellerrand, Erlernen von<br />
überbetrieblichen Inhalten,<br />
• Zeit zum Lernen außerhalb des betrieblichen<br />
Alltags,<br />
• Arbeiten im Team mit Lehrlingen und<br />
Ausbildern<br />
• Vermittlung neuester Technologie,<br />
• Fördermaßnahmen bei Lernschwierigkeiten.<br />
Fördermittel fließen<br />
Die ÜBL-Lehrgänge werden mit Bundesund<br />
Landesmitteln gefördert. Die noch zu<br />
zahlenden Kursgebühren je Teilnehmer –<br />
bei den gleichen Kursen – variieren dennoch<br />
zwischen den Ausbildungsstätten erheblich.<br />
Dies hat die H.A.G. mit Hilfe einer<br />
Umfrage herausgefunden. Die Ergebnisse<br />
der Befragung liegen bei allen Landesverbänden<br />
vor.<br />
Die Schulungsquote ist der Maßstab für<br />
die Inanspruchnahme eines bestimmten<br />
Lehrgangs: Wieviel Prozent der Lehrlinge<br />
aus der Fachstufe (drittes und viertes Lehrjahr)<br />
nahmen an einem ÜBL-Kurs teil? Hier<br />
die aktuellen Zahlen:<br />
• SCHW-MAG1: 20,4 Prozent,<br />
• M-L1/94: 19,7 Prozent,<br />
• M-L2/94: 14,7 Prozent,<br />
• MET-L2/94: 19,7 Prozent,<br />
• STEU-LF/94: 72,5 Prozent und<br />
• LF-ELT95: 53,6 Prozent.<br />
Die Schulungsintensität ist das Maß für die<br />
Dauer der Kurse, gerechnet in Wochen. In<br />
Deutschland liegt dieser Aufwand im statistischen<br />
Durchschnitt bei 3,5 Wochen.<br />
Neue Lehrgänge in Sicht: Die bestehenden<br />
Lehrgänge sollen so lange fortgeführt<br />
werden, bis eine Überarbeitung im Rahmen<br />
der Neuordnung der Berufsbilder erfolgt<br />
ist.<br />
Aktuell will die H.A.G., so hat es kürzlich<br />
der Berufsbildungsausschuss empfohlen,<br />
den Lehrgang LF-ELT95 überarbeiten. Seine<br />
Inhalte: Vermittlung von Praxiserfahrungen<br />
im Bereich Elektrik/Elektronik. Durch<br />
das „update” soll gewährleistet werden,<br />
dass die Ausbildung konkret an Traktoren,<br />
<strong>Landmaschinen</strong> und -geräten erfolgt. Die<br />
Überarbeitung hat begonnen, über die Ergebnisse<br />
wird laufend informiert.<br />
7
8<br />
60 JAHRE LANDMASCHINEN-MECHANIKER<br />
Arbeitsplanung unter<br />
Verwendung von<br />
technischen Unterlagen<br />
Einstellen, Beurteilen,<br />
Störungen eingrenzen<br />
Demontieren,<br />
Montieren<br />
Elektrische, elektronische,<br />
pneumatische und<br />
hydraulische Steuerungen<br />
und deren Komponenten<br />
Installieren von Anlagen<br />
Ausrüsten, Umrüsten<br />
Top-Job<br />
Aktuelle Materialien zur<br />
Nachwuchswerbung<br />
Ein Beruf wie der <strong>Landmaschinen</strong><strong>mechaniker</strong><br />
– und da sollten sich<br />
alle nichts vormachen – ist<br />
in der Ausbildungslandschaft<br />
emotional nicht überall positiv<br />
besetzt. Wer weiß denn<br />
schon, dass dieser Geselle ein<br />
Technik-Allrounder an Landund<br />
Baumaschinen ebenso<br />
wie an Gartengeräten, auf dem<br />
Golfplatz oder in der Kommunaltechnik<br />
ist? Auch dass die<br />
umfassende technische Ausbildung<br />
ihresgleichen suchen<br />
kann, fällt nicht in die<br />
Rubrik „Allgemeinbildung”. Bei<br />
der Nachwuchswerbung gibt<br />
es noch viel aufzuklären.<br />
Und das versucht der Verband<br />
seit einigen Jahren aktiv,<br />
zuletzt 1999 mit der Aktion<br />
Top-Job.<br />
Top-Job ist<br />
auch der Titel<br />
einer Nachwuchswerbebroschüre<br />
– farbig und<br />
informativ. Sie<br />
zeigt viele Tätigkeiten<br />
und<br />
Arbeitssituationen<br />
dieses<br />
Berufes auf.<br />
„Gute Gründe<br />
für eine gute<br />
Entscheidung“,<br />
nämlich für diesen<br />
Beruf, sind<br />
ebenso enthalten<br />
wie Platz für einen Firmenund/oder<br />
Verbandseindruck.<br />
Drei Einleger beschreiben<br />
komprimiert, welche Tätigkeiten<br />
an welchen Maschinen<br />
im jeweiligen Bereich (<strong>Landmaschinen</strong>,<br />
Motorgeräte, Baumaschinen)<br />
anfallen. Der Betrieb<br />
hat die Wahl, entweder<br />
alle, zwei oder nur einen<br />
Einleger zu nutzen.<br />
Poster für<br />
Stellwände:<br />
Auf Basis der<br />
Deckblätter<br />
Top-Job<br />
gibt es vier<br />
A1-Poster<br />
für die in<br />
den meistenInnungenvorhandenenStellwände.Ausbildungspläne:<br />
Die betrieblicheAusbildungsdauer<br />
von dreieinhalb Jahren<br />
umfasst naturgemäß eine<br />
Menge Stoff. Hierbei die Übersicht<br />
zu behalten<br />
ist nicht<br />
immer einfach.<br />
Deshalb haben<br />
sich die<br />
Ausbildungsplänedurchgesetzt,<br />
die<br />
mit anschaulichenBildern(Piktogrammen)<br />
thematisch<br />
die gesamteAusbildungszeit<br />
abbilden<br />
und erläutern.<br />
Der offizielle<br />
(grüne) Ausbildungsplan<br />
ist damit die optische Umsetzung<br />
der gesamten Lehrzeit,<br />
er gehört zu jedem Lehrvertrag<br />
dazu. Als Umsetzungshilfe für<br />
Motorgeräte-Fachbetriebe<br />
dient ein ähnlicher orangefarbener<br />
Plan. Beide wurden vom<br />
Deutschen Handwerkskammertag<br />
(DHKT) „abgesegnet”.<br />
Neu ist auch ein 15-minütiges<br />
Video zum Beruf mit dem<br />
Titel „Das kannst du werden:<br />
<strong>Landmaschinen</strong><strong>mechaniker</strong>“.<br />
Dieser Film sollte nicht nur in<br />
jedem Landesinnungsverband,<br />
sondern auch in jeder Innung<br />
vorliegen. Aufgrund seiner<br />
professionellen Aufmachung<br />
und Technik kann er auf Nachwuchswerbetagen<br />
aller Art<br />
eingesetzt werden.<br />
Alle hier vorgestellten Materialien<br />
werden auch im<br />
Internet-Shop (unter www.<br />
landmaschinenverband.de )<br />
angeboten.<br />
AGRARTECHNIK SONDERDRUCK LMM
Meister-Schmiede<br />
117. Meisterprüfungs-Lehrgang abgeschlossen.<br />
Die Bundesfachlehranstalt (BFA)<br />
Lüneburg bereitet jährlich in<br />
zwei Kursen Kandidaten in Vollzeitunterricht<br />
auf die Meisterprüfung im<br />
Land- maschinen<strong>mechaniker</strong>-Handwerk<br />
vor. Träger ist die Verbandsorganisation<br />
des <strong>Landmaschinen</strong>-Handels und -Handwerks<br />
aus Bund und Ländern.<br />
Seit der BFA-Einweihung im Oktober 1954<br />
wurden in 117 Lehrgängen insgesamt<br />
3 806 Teilnehmer für die Meisterprüfung<br />
im <strong>Landmaschinen</strong><strong>mechaniker</strong>handwerk<br />
fit gemacht. Pro Jahr sind das über<br />
60 Absolventen, etwa ein Viertel aller<br />
Meisterprüfungskandidaten in Deutschland<br />
– damit ist die BFA „Marktführer“<br />
unter den insgesamt etwa 20 Meisterschmieden<br />
unseres Handwerks.<br />
Traditionell ist die BFA als kompetenter<br />
Dienstleister in allen Ausbildungs- und<br />
Prüfungsfragen in die Verandsorganisation<br />
eingebunden, so im Berufsbildungsausschuss<br />
und seinen vielen, je nach<br />
Themenstellung zusammentretenden<br />
Unterausschüssen, beim Praktischen<br />
Leistungs- wettbewerb der Handwerksjugend<br />
– zuletzt im November 2000 – oder<br />
auch als Gastgeber des „1. Handwerkertages<br />
Land- und Baumaschinen“ im<br />
September 1999. ■<br />
AGRARTECHNIK SONDERDRUCK LMM<br />
Die Bundesfachlehranstalt in<br />
Lüneburg hat seit ihrer Gründung<br />
im Oktober 1954 fast 4000<br />
Teilnehmer in Lehrgängen auf<br />
die Meisterprüfung vorbereitet.<br />
Bundesinnungsmeister Heinz-Jürgen Müller (rechts) und Schulleiter Dr. Fritz Michalczyk (links)<br />
mit den Absolventen des 117. Lehrgangs vom Februar 2001.<br />
Der Praktische Leistungswettbewerb<br />
der Handwerksjugend<br />
führt regelmäßig<br />
in die BFA: Die<br />
Landessieger 2000 – von<br />
links nach rechts – Christian<br />
Sailer (Baden-Württemberg),<br />
Kai Willmann (Niedersachsen),<br />
Patrik Eichenlaub<br />
(Rheinland-Pfalz), Michael<br />
Pischke (Schleswig-Holstein),<br />
Albert Ostermeier<br />
(Bayern), Michael Wohlfahrt<br />
(Thüringen), Jörg Christian<br />
Pockrandt (Hessen), Stefan<br />
Peeters (Nordrhein-Westfalen)<br />
und Marco Randel<br />
(Brandenburg) ermittelten<br />
in einem eintägigen Wettkampf<br />
den Bundessieger:<br />
Christian Sailer aus Angelbachtal<br />
(Ausbildungsbetrieb:<br />
Kirsch GmbH, Meckesheim)<br />
vor Kai Willmann aus Langenbrügge<br />
und Patrik Eichenlaub<br />
aus Steinweiler.<br />
9
ildung<br />
AGRARTECHNIK SONDERDRUCK LMM<br />
10<br />
60 JAHRE LANDMASCHINEN-MECHANIKER<br />
Ausbildung wird<br />
groß geschrieben<br />
Zum Jahreswechsel gab es 6 486 Ausbildungsverhältnisse<br />
Das <strong>Landmaschinen</strong><strong>mechaniker</strong>-<br />
Handwerk bildete zum Jahreswechsel<br />
bundesweit 6 486 Lehrlinge<br />
aus. Die Zahl der Lehrverträge liegt<br />
damit in etwa im langjährigen Mittel. Im<br />
Vergleich zum Vorjahr sind dies 80 Auszubildende<br />
oder 0,9 Prozent weniger. Die<br />
„Anteile” der verschiedenen Lehrjahre liegen<br />
mit 24 im ersten, 26 im zweiten, ebenfalls<br />
26 im dritten und 24 Prozent im vierten<br />
sehr dicht beieinander.<br />
Setzt man das Jahr 1995 gleich 100 an,<br />
wird der Grund des Zuwachses anhand<br />
der Grafik bis ins vergangene Jahr 2000<br />
deutlich: Besonders die Lehrlingszahlen in<br />
den neuen Ländern explodierten förmlich.<br />
Allerdings muss man berücksichtigen, dass<br />
die Ausgangsbasis der Nachwendephase<br />
recht niedrig war. Doch auch in einigen<br />
Westländern wuchsen die Lehrlingszahlen,<br />
zum Beispiel in Rheinland-Pfalz oder<br />
Nordrhein-Westfalen. Der leichte Rückgang<br />
zum Vorjahr ist jedoch im Westen<br />
ebenso nachweisbar wie im Osten.<br />
Jeder Ausbildungsbetrieb – also alle, die<br />
tatsächlich ausbilden – bildet statistisch<br />
gesehen 2,3 junge Menschen aus. Damit<br />
sind heute bereits wieder 17 Prozent der<br />
in den Fachbetrieben Beschäftigten Lehrlinge.<br />
Dies ist auch ein gutes Argument für<br />
die Nachwuchswerbung, denn es besteht<br />
ein intensives Ausbilder-Lehrlings-Verhältnis.<br />
Dass Ausbildung wieder ein Thema<br />
ist, zeigt unter anderem die Tatsache,<br />
dass die Zahl der Ausbildungsbetriebe<br />
steigt. Mehr als die Hälfte der in die Handwerksrollen<br />
eingetragenen Betriebe sind<br />
gleichzeitig auch Ausbildungsbetriebe, ein<br />
Wert der seinesgleichen im gesamten<br />
Handwerk sucht. Statistisch bildet jeder <strong>Landmaschinen</strong>-Fachbetrieb<br />
mehr als einen Lehrling<br />
aus. Spitzenreiter sind hier Schleswig-<br />
Holstein und Mecklenburg-Vorpommern mit<br />
je 2,8 Lehrlingen pro Ausbildungsbetrieb. Die<br />
Schlusslichter Baden-Württemberg, Berlin/Brandenburg<br />
und das Saarland bringen<br />
es jeweils nur auf 1,7 Azubis.<br />
Schulbildung der Lehrlinge: Mehr als 50<br />
Prozent kommen aus der Hauptschule. Im<br />
Westen liegt der Anteil von Hauptschülern<br />
bei fast 60 Prozent. Bayern führt die „Hit-<br />
liste” mit über 80 Prozent an, in Niedersachsen<br />
sind es nur 40 Prozent (Ost-Durchschnitt<br />
knapp 30 Prozent). Etwa ein Drittel<br />
der Azubis sind Realschüler – im Osten<br />
70 Prozent, Spitzenreiter ist Sachsen-Anhalt<br />
mit 83 Prozent. Hin und wieder sind<br />
auch einige Abiturienten unter den Bewerbern.<br />
Der Anteil weiblicher Lehrlinge liegt bei 0,25<br />
Prozent: 16 Mädchen stehen 6 470 Jungs<br />
gegenüber – bei den Neuverträgen sind es<br />
nur noch drei weibliche Azubis (0,17 Prozent).<br />
Dies ist ein wirklich ernsthaft zu hinterfragendes<br />
Missverhältnis. Der Beruf<br />
<strong>Landmaschinen</strong><strong>mechaniker</strong> gilt zwar nicht<br />
gerade als typischer Job für Frauen, doch<br />
sollten sich zum Beispiel Betriebe mit dem<br />
Schwerpunkt Motorgeräte die Frage nach<br />
dem „Warum nicht?“ stellen. Spitzenreiter<br />
ist Bayern mit fünf jungen Damen. Dies ist<br />
allerdings kein Wunder, denn in Bayern<br />
gibt es mit mehr als 1 500 Lehrlingen die<br />
bei weitem höchste Ausbildungsleistung<br />
aller Bundesländer.<br />
Der Ausländeranteil liegt bei gerade 0,7<br />
Prozent, im Westen sind es 0,8 Prozent,<br />
im Osten 0,1 Prozent. Auch wenn die klassischen<br />
<strong>Landmaschinen</strong>-Fachbetriebe eher<br />
im ländlichen Raum beheimatet sind – dort<br />
ist der Anteil ausländischer Mitbürger meist<br />
geringer als in der Stadt – könnten eventuell<br />
noch Potenziale aktiviert werden.<br />
Die Abbrecherquote unter den Lehrlingen<br />
scheitert im <strong>Landmaschinen</strong><strong>mechaniker</strong>-<br />
Handwerk regelmäßig an der Fünf-Prozent-Hürde.<br />
Etwa 250 junge Menschen<br />
schmeißen die Brocken vorzeitig hin. Das<br />
ist bedauerlich, dennoch ein im Vergleich<br />
zu anderen Metallhandwerken geradezu<br />
paradiesischer Wert. Im Westen liegt die<br />
durchschnittliche Abbrecherquote bei 4,9<br />
Prozent (in Baden-Württemberg bei nur 2,2<br />
Prozent), im Osten bei 2,1 Prozent, Brandenburg/Berlin<br />
registriert nur 0,9 Prozent.<br />
Dennoch: Seit drei Jahren steigt der Wert<br />
wieder. Alle diese Informationen veröffentlicht<br />
der Bundesverband regelmäßig<br />
jährlich in der „Lehrlingsanalyse“ des SPE-<br />
ZIAL-Infodienstes Beruf & Bildung. Sie sind<br />
auch im Internet unter „News” (www.landmaschinenverband.de)<br />
archiviert.<br />
Quelle: HAG
Kaufmännische Ausbildung?<br />
Seit Jahren hat sich in der Kfz-Branche<br />
der „Automobilkaufmann“ etabliert,<br />
die Ausbildungszahlen steigen stetig.<br />
Dieser kaufmännische Beruf soll eine Klammer<br />
zwischen den kaufmännischen und<br />
technischen Bereichen der Betriebe bilden,<br />
um den wirtschaftlichen Erfolg auch unter<br />
erheblichem Wettbewerbsdruck zusichern.<br />
Die Berufsbezeichnung lautet „Automobilkaufmann/-frau“;<br />
die Ausbildungsdauer beträgt<br />
drei Jahre, sie findet in Betrieb und Berufsschule<br />
statt. Automobilkaufleute sind,<br />
bezogen auf den Land- und Baumaschinenbereich,<br />
bei Händlern und Herstellern tätig.<br />
Typische Arbeitsgebiete sind Disposition,<br />
Beschaffung, Vertrieb und Kundendienst.<br />
Die Ausbildungsordnung basiert auf den vier<br />
wesentlichen Geschäftsfeldern: Werkstattdienstleistung,<br />
Lagerwirtschaft, Neu- und<br />
Gebrauchtfahrzeuge sowie Finanzdienstleistungen.<br />
Die Auszubildenden werden<br />
während ihrer Lehrzeit mit allen verkaufsvor-<br />
und -nachbereitenden Tätigkeiten sowie<br />
mit allen Dienstleistungen rund um den<br />
AGRARTECHNIK SONDERDRUCK LMM<br />
Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und<br />
Geräten vertraut gemacht. Der Einsatz als<br />
Verkäufer ist nach dieser Ausbildungsordnung<br />
nicht vorgesehen, sicher jedoch möglich.<br />
Dazu sollten dann ergänzende Qualifizierungsmaßnahmen<br />
hinzugezogen werden.<br />
Was bedeutet dies für Land- und Baumaschinenhandel?<br />
Diese Ausbildungsordnung<br />
ist sicherlich sehr gut geeignet, den<br />
eigenen betrieblichen Nachwuchs im kaufmännischen<br />
Bereich heranzubilden. Wenn<br />
er auch ursprünglich für den Pkw-, Nutzfahrzeug-<br />
und Motorradbereich kreiert wurde,<br />
sind die Ausbildungsinhalte auf jeden<br />
Betrieb umsetzbar, der mit Land- und Baumaschinen<br />
umgeht.<br />
Das bedeutet für unsere Mitgliedsbetriebe:<br />
Sie können Ihren eigenen<br />
kaufmännischen Mitarbeiter ausbilden.<br />
Die H.A.G. wirkt mit dem<br />
Zentralverband des Deutschen<br />
Handwerks (ZDH) darauf hin, dass dieser<br />
Ausbildungsberuf überall möglichst<br />
reibungslos umgesetzt werden kann.<br />
11
Seminare 2002<br />
Das Motto des SeminarundWorkshop-Programms<br />
der Verbandsorganisation<br />
lautet: „Top-<br />
Themen mit Top-Referenten<br />
für Top-Unternehmer“. Zu jedem<br />
Thema – alle neu oder<br />
völlig überarbeitet – gibt es<br />
ein Faltblatt mit Gliederung,<br />
Teilnahmebedingungen und<br />
Anmeldeunterlagen. Die Veranstaltungen<br />
sind in aller<br />
Regel an einem Tag durchgezogen<br />
und die Termine so<br />
gelegt, dass thematisch „verwandte”<br />
Seminare an Folgetagen<br />
stattfinden.<br />
Durchführendes Institut ist<br />
die VBL GmbH im Auftrag<br />
des Bundesverbandes H.A.G.<br />
und seiner Landesverbände.<br />
Bei Bedarf lassen sich alle<br />
12<br />
60 JAHRE LANDMASCHINEN-MECHANIKER<br />
Termine auch dezentral – zum<br />
Beispiel in Innungen – durchführen.<br />
Nahezu alle Referenten<br />
stehen Ihnen auch auf dem<br />
„Händlerzentrum“ in Halle 5<br />
Themen / Termine / Region Termin Ort<br />
Erfolgsorientierte Entlohnung<br />
im gesamten Fachbetrieb mit LMV Lorenzen, Soest<br />
Werbung<br />
im Fachbetrieb – effektiv bei kleinem Budget mit Agentur Weiste, Essen<br />
Ersatzteil-/Lager-Management & Einkaufsoptimierung<br />
Dr. Forster, Pfaffenhofen<br />
Gebrauchtmaschinen-Management & Mehrwertverkauf<br />
Dr. Forster, Pfaffenhofen<br />
Kooperation von Fachbetrieben<br />
& Anpassung an die „neue” Agrarpolitik mit Dr. Forster, Pfaffenhofen<br />
Agenturgeschäft<br />
im <strong>Landmaschinen</strong>handel mit Reg.-Dir. Adolf Scheuer, Nordkirchen<br />
Steuerprüfung und Bewertung<br />
– richtig gemacht mit Reg.-Dir. Adolf Scheuer, Nordkirchen<br />
Vermietgeschäft<br />
mit Zukunft – das Erfolgskonzept? TÜV-Nord, Hamburg<br />
Rating – vom Umgang mit Banken<br />
– aus Unternehmersicht mit M. Schwarz, Maintail<br />
19. Februar 2002 Kassel<br />
20. Februar 2002 Fulda/Kassel<br />
21. Februar 2002 Kirchheim<br />
22. Februar 2002 Kirchheim<br />
23. Februar 2002 Kirchheim<br />
26. Februar 2002 Kassel<br />
27. Februar 2002 Kassel<br />
28. Februar 2002 HH/Hannover<br />
4. März 2002 Kassel<br />
Zukunftsfähigkeit im Fachbetrieb<br />
– Was muss ich heute tun, um mich in 10 Jahren strategisch richtig 5. März 2002 Frankfurt<br />
positioniert zu haben? W. Kutschenreiter, Gailingen<br />
Internet & E-Commerce 6. März 2002 Köln/Bonn<br />
für Fachbetriebe – was alles wie geh. agrodealer, Flensburg<br />
Kommunikation mit schwierigen Kunden<br />
(nach Fall des Rabattgesetzes) – auch intern nicht einfach.<br />
J. Wirtz, Selfkant und Werne<br />
Kältetechnik<br />
an <strong>Landmaschinen</strong> – Sachkundelehrgang (2 Tage). IKET, Essen<br />
auf der Agritechnica in Hannover<br />
zur Verfügung. Alle Unterlagen<br />
sind im Internet unter<br />
www.landmaschinenverband.de<br />
sowie unter www.<br />
bufamot.de, jeweils Rubrik<br />
“Termine”, online sicht-,<br />
abruf- und downloadbar. ■<br />
7. März 2002 Köln/Bonn<br />
KW 10/2002 Lüneburg<br />
Grafik: Löffler<br />
AGRARTECHNIK SONDERDRUCK LMM