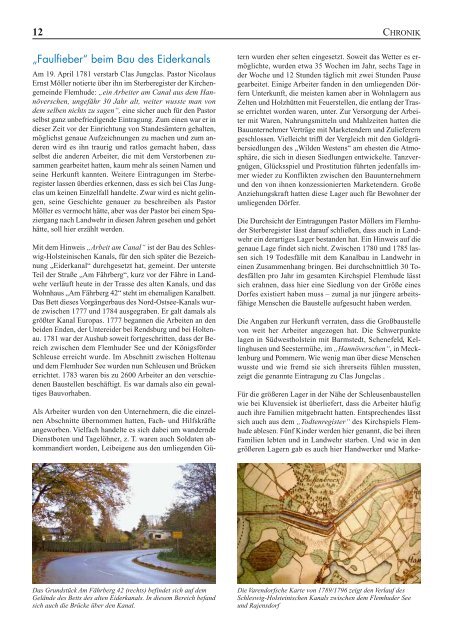Ballonstart v. Fußballplatz Für Alle - Unsere schöne Gemeinde ...
Ballonstart v. Fußballplatz Für Alle - Unsere schöne Gemeinde ...
Ballonstart v. Fußballplatz Für Alle - Unsere schöne Gemeinde ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
12 CHRONIK<br />
„Faulfieber“ beim Bau des Eiderkanals<br />
Am 19. April 1781 verstarb Clas Jungclas. Pastor Nicolaus<br />
Ernst Möller notierte über ihn im Sterberegister der Kirchengemeinde<br />
Flemhude: „ein Arbeiter am Canal aus dem Hannöverschen,<br />
ungefähr 30 Jahr alt, weiter wusste man von<br />
dem selben nichts zu sagen“, eine sicher auch für den Pastor<br />
selbst ganz unbefriedigende Eintragung. Zum einen war er in<br />
dieser Zeit vor der Einrichtung von Standesämtern gehalten,<br />
möglichst genaue Aufzeichnungen zu machen und zum anderen<br />
wird es ihn traurig und ratlos gemacht haben, dass<br />
selbst die anderen Arbeiter, die mit dem Verstorbenen zusammen<br />
gearbeitet hatten, kaum mehr als seinen Namen und<br />
seine Herkunft kannten. Weitere Eintragungen im Sterbe -<br />
register lassen überdies erkennen, dass es sich bei Clas Jungclas<br />
um keinen Einzelfall handelte. Zwar wird es nicht gelingen,<br />
seine Geschichte genauer zu beschreiben als Pastor<br />
Möller es vermocht hätte, aber was der Pastor bei einem Spaziergang<br />
nach Landwehr in diesen Jahren gesehen und gehört<br />
hätte, soll hier erzählt werden.<br />
Mit dem Hinweis „Arbeit am Canal“ ist der Bau des Schleswig-Holsteinischen<br />
Kanals, für den sich später die Bezeichnung<br />
„Eiderkanal“ durchgesetzt hat, gemeint. Der unterste<br />
Teil der Straße „Am Fährberg“, kurz vor der Fähre in Landwehr<br />
verläuft heute in der Trasse des alten Kanals, und das<br />
Wohnhaus „Am Fährberg 42“ steht im ehemaligen Kanalbett.<br />
Das Bett dieses Vorgängerbaus des Nord-Ostsee-Kanals wurde<br />
zwischen 1777 und 1784 ausgegraben. Er galt damals als<br />
größter Kanal Europas. 1777 begannen die Arbeiten an den<br />
beiden Enden, der Untereider bei Rendsburg und bei Holten -<br />
au. 1781 war der Aushub soweit fortgeschritten, dass der Bereich<br />
zwischen dem Flemhuder See und der Königsförder<br />
Schleuse erreicht wurde. Im Abschnitt zwischen Holtenau<br />
und dem Flemhuder See wurden nun Schleusen und Brücken<br />
errichtet. 1783 waren bis zu 2600 Arbeiter an den verschiedenen<br />
Baustellen beschäftigt. Es war damals also ein gewaltiges<br />
Bauvorhaben.<br />
Als Arbeiter wurden von den Unternehmern, die die einzelnen<br />
Abschnitte übernommen hatten, Fach- und Hilfskräfte<br />
angeworben. Vielfach handelte es sich dabei um wandernde<br />
Dienstboten und Tagelöhner, z. T. waren auch Soldaten abkommandiert<br />
worden, Leibeigene aus den umliegenden Gü-<br />
Das Grundstück Am Fährberg 42 (rechts) befindet sich auf dem<br />
Gelände des Betts des alten Eiderkanals. In diesem Bereich befand<br />
sich auch die Brücke über den Kanal.<br />
tern wurden eher selten eingesetzt. Soweit das Wetter es ermöglichte,<br />
wurden etwa 35 Wochen im Jahr, sechs Tage in<br />
der Woche und 12 Stunden täglich mit zwei Stunden Pause<br />
gearbeitet. Einige Arbeiter fanden in den umliegenden Dörfern<br />
Unterkunft, die meisten kamen aber in Wohnlagern aus<br />
Zelten und Holzhütten mit Feuerstellen, die entlang der Trasse<br />
errichtet worden waren, unter. Zur Versorgung der Arbeiter<br />
mit Waren, Nahrungsmitteln und Mahlzeiten hatten die<br />
Bauunternehmer Verträge mit Marketendern und Zulieferern<br />
geschlossen. Vielleicht trifft der Vergleich mit den Goldgräbersiedlungen<br />
des „Wilden Westens“ am ehesten die Atmosphäre,<br />
die sich in diesen Siedlungen entwickelte. Tanzvergnügen,<br />
Glücksspiel und Prostitution führten jedenfalls immer<br />
wieder zu Konflikten zwischen den Bauunternehmern<br />
und den von ihnen konzessionierten Marketendern. Große<br />
Anziehungskraft hatten diese Lager auch für Bewohner der<br />
umliegenden Dörfer.<br />
Die Durchsicht der Eintragungen Pastor Möllers im Flemhuder<br />
Sterberegister lässt darauf schließen, dass auch in Landwehr<br />
ein derartiges Lager bestanden hat. Ein Hinweis auf die<br />
genaue Lage findet sich nicht. Zwischen 1780 und 1785 lassen<br />
sich 19 Todesfälle mit dem Kanalbau in Landwehr in<br />
einen Zusammenhang bringen. Bei durchschnittlich 30 Todesfällen<br />
pro Jahr im gesamten Kirchspiel Flemhude lässt<br />
sich erahnen, dass hier eine Siedlung von der Größe eines<br />
Dorfes existiert haben muss – zumal ja nur jüngere arbeitsfähige<br />
Menschen die Baustelle aufgesucht haben werden.<br />
Die Angaben zur Herkunft verraten, dass die Großbaustelle<br />
von weit her Arbeiter angezogen hat. Die Schwerpunkte<br />
lagen in Südwestholstein mit Barmstedt, Schenefeld, Kellinghusen<br />
und Seestermühe, im „Hannöverschen“, in Mecklenburg<br />
und Pommern. Wie wenig man über diese Menschen<br />
wusste und wie fremd sie sich ihrerseits fühlen mussten,<br />
zeigt die genannte Eintragung zu Clas Jungclas .<br />
<strong>Für</strong> die größeren Lager in der Nähe der Schleusenbaustellen<br />
wie bei Kluvensiek ist überliefert, dass die Arbeiter häufig<br />
auch ihre Familien mitgebracht hatten. Entsprechendes lässt<br />
sich auch aus dem „Todtenregister“ des Kirchspiels Flemhude<br />
ablesen. Fünf Kinder werden hier genannt, die bei ihren<br />
Familien lebten und in Landwehr starben. Und wie in den<br />
größeren Lagern gab es auch hier Handwerker und Marke-<br />
Die Varendorfsche Karte von 1789/1796 zeigt den Verlauf des<br />
Schleswig-Holsteinischen Kanals zwischen dem Flemhuder See<br />
und Rajensdorf