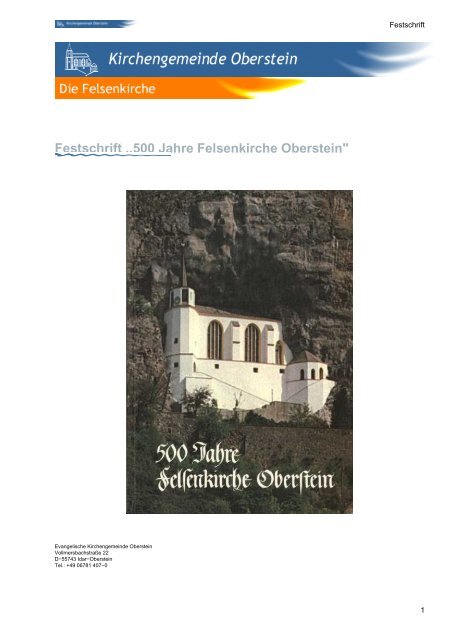Festschrift ,,500 Jahre Felsenkirche Oberstein"
Festschrift ,,500 Jahre Felsenkirche Oberstein"
Festschrift ,,500 Jahre Felsenkirche Oberstein"
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Festschrift</strong> ,,<strong>500</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Felsenkirche</strong> Oberstein"<br />
Evangelische Kirchengemeinde Oberstein<br />
Vollmersbachstraße 22<br />
D−55743 Idar−Oberstein<br />
Tel.: +49 06781 407−0<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
1
H. Peter Brandt: Aus der Geschichte der <strong>Felsenkirche</strong><br />
Das Gesicht einer Stadt wird geprägt durch die Landschaft, in der sie liegt und durch ihre Architektur. Unter Letzterer können<br />
hervorragende Gebäude (im doppelten Sinne des Wortes) oder die Gesamtheit bzw. ein Teil der Bausubstanz einen besonders<br />
charakteristischen Eindruck bewirken.<br />
Eine unverwechselbare, markante Verbindung all dieser Elemente bot über ein halbes Jahrtausend hinweg das Stadtbild von<br />
Oberstein an der Nahe: Fluss, Felswand, Burgen und Kirche im Fels bildeten ein einmaliges Ensemble, das unzählige Maler,<br />
Zeichner, Kupferstecher und Fotografen, Dichter und Schriftsteller, Einheimische, Touristen und Journalisten − Künstler wie<br />
Dilettanten − über Jahrhunderte hinweg im Bilde festgehalten oder beschrieben haben.<br />
Bild 1<br />
Nicht die <strong>Felsenkirche</strong> selbst ist − wie vielfach behauptet wurde − einmalig auf der Welt. Gotteshäuser oder Einsiedlerklausen, die<br />
im oder am Fels gebaut sind, gibt es öfter: an der unteren Nahe bei Bad Kreuznach, bei Serrig an der Saar, am Bischofssitz<br />
Salzburg oder als heute noch bewohntes Kloster auf der griechischen Insel Amorgos, gewiss auch in Jugoslawien, an der<br />
Mittelmeerküste und in vielen anderen Ländern innerhalb und außerhalb Europas.<br />
Das Besondere an der <strong>Felsenkirche</strong> in Idar−Oberstein ist der Gesamteindruck, die Verbindung von Natur und Kultur inmitten einer<br />
Stadt, wobei es sicher kein Zufall ist, wenn man ihre Entstehung mit sagenhaften Vorgängen verknüpft.<br />
Die Sage<br />
Die Sage von der Erbauung der <strong>Felsenkirche</strong> zählt wohl zu den bekanntesten Mythen im Bereich zwischen Mosel und Pfalz, Rhein<br />
und Saat. Über ihre Entstehungszeit können wir keinerlei Aussagen machen, zumal sie gewiss über einige Generationen zunächst<br />
nur mündlich tradiert wurde, bis man sie erstmals niederschrieb. Die bis heute älteste bekannte gedruckte Fassung findet sich in<br />
den Rheinischen Provinzial−Blättern von 1836, wobei es sich allerdings um eine literarisch bearbeitete Form handelt. Seit dieser<br />
Zeit ist aber der Stoff unzählige Male nacherzählt, dramatisiert und gedruckt worden, sodass es praktisch unmöglich ist, eine<br />
authentische Urfassung zu ermitteln.<br />
Im Wesentlichen geht es dabei immer um einen Mord an einem engen Verwandten (Bruder oder Vetter) auf dem alten Schloss in<br />
Oberstein (zeitweise ,, Bosselstein“ genannt), welcher den Anlass zur Erbauung der Kirche gab. Über Ursache und Hergang der<br />
Tat sind drei verschiedene Versionen in Umlauf: Einmal ist die Rede von<br />
a) einem tödlichen Pfeilschuss auf einen Vetter,<br />
b) einer Katze, die ein Bruder dem Anderen in den Stiefel steckt und<br />
c) der gemeinsamen Liebe von zwei Brüdern zu dem Burgfräulein Bertha von Lichtenberg.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
2
In den beiden Fassungen b) und c) haben Scherz bzw. Eifersucht jeweils zur Folge, dass ein Bruder den anderen aus dem Fenster<br />
der alten Burg wirft, und dieser dann zerschmettert an der Stelle liegen bleibt, wo heute die <strong>Felsenkirche</strong> steht. Der Bau des<br />
Gotteshauses ist in allen drei Versionen die von der Kirche (einem Abt oder einem Bischof) auferlegte Sühne für die ruchlose Tat,<br />
wobei der Mörder immer zuvor ruhelos in der Gegend umhergezogen ist bzw. sogar an einem Kreuzzug nach Palästina<br />
teilgenommen hat. Der Missetäter soll an der Stelle, an der das unschuldige Opfer gefunden wurde, mit Hammer und Meißel eine<br />
Höhlung in den Fels geschlagen, eine Kirche darin errichtet haben und tot zusammengebrochen sein. Angeblich hat man Täter und<br />
Opfer danach gemeinsam in dieser Kirche bestattet.<br />
Die Wirklichkeit<br />
Bild 2: Oberstein um 1955<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Nun enthalten alle drei Fassungen nur sehr wenig konkrete Fakten, wobei selbstverständlich die überlieferten Namen (Wirich,<br />
Emich, Eberhard, Werner) nicht allzu viel besagen, da diese häufig in Obersteiner Herrengeschlechtern vorkommen. Die Ursache<br />
für den Streit im Falle b) − der Scherz mit der Katze im Stiefel − wird z.B. auch von der Schmidtburg bei Bundenbach oder Burg<br />
Manderscheid in der Eifel erzählt, weshalb diese Überlieferung als Wandersage anzusehen ist, der kein besonderer Wert zukommt.<br />
Die Liebe zu einem Burgfräulein bietet Stoff für die bekannteste und romantischste Fassung, doch lässt sich ebenso wenig ein<br />
Brudermord in der Familie auf Schloss Oberstein wie eine Bertha von Lichtenberg nachweisen. Die nahe gelegene Burg<br />
Lichtenberg im Westrich war übrigens keineswegs − wie in der Sage − ein Trierer Mannlehen, sondern wurde 1214 oder kurz zuvor<br />
durch Graf Gerlach von Veldenz auf dem Grund und Boden der Remigiusabtei zu Reims errichtet.<br />
Die Fassung a) der Sage, welche von einem Mord an einem Vetter berichtet, könnte der Wirklichkeit noch am nächsten kommen,<br />
wenn auch die daraus abgeleitete Folge, das Ausmeißeln einer so riesigen Höhle in dem harten Fels, damals technisch fast<br />
unmöglich war und in keiner Weise mit dem Baubefund in Übereinstimmung zu bringen ist (vgl. Bild Nr. 8 und Grundriss Bild Nr.<br />
12). In früherer Zeit glaubte man − infolge einer falschen Übersetzung der Umschrift − das sog. ,,Ritterstandbild“ in der<br />
<strong>Felsenkirche</strong> stelle das Opfer der Sage dar, was jedoch mit Sicherheit nicht zutrifft.<br />
3
Bild 3: Epitaph des Ritters Philipp II. von Daun−Oberstein<br />
Tatsächlich hat es aber in der Familie der Herren von Oberstein einmal einen Verwandtenmord gegeben. Durch doppelte<br />
Überlieferung können wir heute sicher sein, dass in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts ein Wirich von Daun im Bette von einem<br />
entfernten Vetter aus dem Geschlecht derer von Bossel zu Stein umgebracht wurde.<br />
Dieser Nachricht liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Ursprünglich bewohnte den Obersteiner Herrensitz das Geschlecht derer<br />
von Stein oder auch Bosselstein genannt. Hier heiratete die Familie von Daun in der Eifel ein, welche die alten Ritter von<br />
(Ober−)Stein langsam aus ihrem Stammsitz verdrängte. Dabei kam es offenbar zu Erbstreitigkeiten. Jedenfalls lässt sich allgemein<br />
feststellen, dass die Familie Daun nach und nach in wohlhabendere Verhältnisse gelangte als die alten Obersteiner, was gewiss zu<br />
Neid und Hass führte. Wilhelm Bossel von Stein erbaute schließlich 1285 eine Burg in Nohfelden, vielleicht um weiteren<br />
Streitigkeiten aus dem Wege zu gehen. Nach seinem um 1303 erfolgten Tode gerieten seine Söhne in finanzielle Schwierigkeiten.<br />
Vor diesem Hintergrund ist der Mord an dem Vetter zu sehen, der sich Ende 1328 oder Anfang 1329 zugetragen haben muss. Der<br />
Täter war offenbar Eberhard Bossel von Stein, dessen Vater einst selbst noch auf der nach seiner Familie benannten alten Burg in<br />
Oberstein gewohnt hatte.<br />
Aus zwei inzwischen im Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf entdeckten Handschriften, welche allerdings erst rd. 200 bzw. 280 <strong>Jahre</strong><br />
später entstanden sind, lassen sich noch weitere Einzelheiten ermitteln, wobei gewisse Ähnlichkeiten zum Inhalt der Sage nicht zu<br />
verkennen sind: Das Opfer Wirich von Daun soll ein ernster und finsterer Geselle gewesen sein (so wird in der Sage der eigentliche<br />
Mörder geschildert). Als Todesursache wird weder ein Sturz vom Fels noch ein Pfeilschuss, sondern ein Erschlagen im Bett<br />
angegeben.<br />
Die Nachfolge Wirichs als Obersteiner Regent übernahm sein Stiefbruder Cuno, der (und nun auch wiederum interessante<br />
Anklänge an die Sage) wegen Familienstreitigkeiten Oberstein verlassen hatte und Mitglied der Deutschordensritter geworden war.<br />
Als solchen verschlug es ihn allerdings nicht nach Palästina, sondern nach Preußen und Liviand, wo man ihn nach dem Mord an<br />
Wirich suchen ließ, um ihm die Regentschaft in Oberstein anzutragen. Dieser Cuno von Daun−Oberstein kehrte tatsächlich zurück,<br />
verehelichte sich auf Anraten einiger Freunde und führte das Geschlecht fort; er wurde zum Stammvater aller nachmaligen Herren<br />
von Daun−Oberstein.<br />
Bild 4: Burg oder Kirche?<br />
Schildmauer und Sakristei während der Sanierungsarbeiten 1928<br />
Der Vollständigkeit halber sei hier auch noch an den Mord an dem neugewählten Trierer Erzbischof Cuno von Pfullingen erinnert,<br />
der durch einen Sturz von Burg Urley (über Ürzig an der Mosel) 1066 zu Tode kam. Die Behauptung, dass der Nutznießer dieser<br />
Tat, der neue Erzbischof Udo von Neuenburg, mit dem Geschlecht der alten Herren von Oberstein verwandt gewesen sei, ist<br />
jedoch in keiner Weise erwiesen, sodass eine Verbindung zur Sage um die Erbauung der <strong>Felsenkirche</strong> reine Spekulation bleiben<br />
muss. Außerdem sind die zeitlichen und räumlichen Zusammenhänge in wirklichem Sinne ,,weit hergeholt“.<br />
Die Vorgängerbauten<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Selbst wenn man alle ,,sagenhaften“ Erklärungsversuche für das Entstehen der <strong>Felsenkirche</strong> außer acht lässt, so bleiben noch<br />
genügend Rätsel um ihre Erbauung. In einer 1812 erschienenen Veröffentlichung wird sie als Denkmal des 11. Jahrhunderts<br />
bezeichnet, was vielleicht nicht so falsch ist. Im <strong>Jahre</strong> 1075 wird jedenfalls erstmals ein Herr von (Ober−)Stein erwähnt. Von der<br />
alten Burg (Bosselstein) sind dagegen erst mehr als 100 <strong>Jahre</strong> später erste urkundliche Nachrichten überliefert. Wenn man davon<br />
ausgeht, dass die gewaltige Felshöhle unterhalb dieser Burg (ca. 25 m lang, 17 m tief − bei einer mittleren Höhe von 12 m) auf<br />
natürliche Weise entstanden ist, so ist es eigentlich gut vorstellbar, dass sich die ersten Herren von Oberstein an dieser Stelle ein<br />
festes Haus, eine Art Burg errichteten, wozu nur verhältnismäßig geringe Aufwendungen erforderlich waren. Für die Annahme,<br />
dass die Höhlung im Fels auf natürliche Weise entstanden ist, spricht nicht nur die ungewöhnliche Größe (von <strong>500</strong>0 m3), sondern<br />
auch die Tatsache, dass die dort errichteten Gebäude ziemlich willkürlich und unsystematisch in den Fels gebaut wurden, was sich<br />
4
ei einer exakten Vermessung ergab. Die Schildmauer bis zur Höhe des Kaffgesimses weist nicht nur eine Stärke von 1,90 m auf,<br />
sondern auch drei schießschartenähnliche Fensteröffnungen, welche die Vermutung nahe legen, dass sich ursprünglich an dieser<br />
Stelle ein Wehrbau befand.<br />
Bild 5: Fußboden im Seitenschiff während der Sanierungsarbeiten 1928<br />
Bild 6: Die <strong>Felsenkirche</strong> um 1820<br />
Lithographie von Ludwig Strack (1761 − 1836)<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Hinzu kommt noch − auch dies ergab die Vermessung (vgl. Grundriss und Querschnitt Bilder Nr. 8 und 12) , dass diese<br />
Schildmauer mehrfach ganz unregelmäßig abknickt und in dem sechseckigen Turm alle Seitenlängen und Winkel ungleich sind.<br />
Beim Bau von Gotteshäusern legte man zu jener Zeit aber sehr großen Wert auf Symmetrie. Da alle Abstände zwischen den<br />
Schießschartenfenstern, den Sakristeifenstern, den Säulen im Hauptschiff und den Gurtbögen ungleich sind (vergl. Grundriss Bild<br />
Nr. 12 u. Bild Nr. 15), vermag man auch schwerlich in der heutigen <strong>Felsenkirche</strong> eine Huldigung an die Trinität zu erkennen. Es<br />
deutet eigentlich alles darauf hin, dass es eben keine Kirche war, die ursprünglich in dieser Höhlung stand. Falls es sich aber um<br />
einen Wehrbau handelte, so ist sogar wahrscheinlich, dass dieser auch über eine Kapelle verfügte, welche nicht unbedingt mit der<br />
heutigen Sakristei identisch sein muss. Die zur Begründung dieser These angeführte Ungleichheit von Mauerwerk, Sakristei und<br />
oberem Teil der <strong>Felsenkirche</strong> belegt lediglich, dass diese nicht gleichzeitig entstanden sind. Mörteluntersuchungen lassen darauf<br />
schließen, dass die heutige Sakristei mit der vorderen Schildmauer zusammen errichtet wurde und somit ursprünglich zur<br />
Wehranlage gehörte (s. Bild Nr. 4).<br />
Tatsächlich wird eine ,,Unterburg im Tale“ wiederholt in mittelalterlichen Urkunden erwähnt, wobei diese bezeichnenderweise auch<br />
manchmal den Namen ,,das Loch“ trägt. Mit ,,im Tale“ ist mit Sicherheit ein Gelände innerhalb der späteren Stadtmauer gemeint,<br />
und was läge da näher, als diese in der Höhlung am Fels zu suchen. Zwar gibt es ein einziges Mal auch eine Nachricht von einer<br />
Unterburg in der Nähe des unteren Stadttores, doch ist diese aus dem 16. Jahrhundert und muss nicht unbedingt mit den<br />
Verhältnissen 200 <strong>Jahre</strong> zuvor in Verbindung gebracht werden.<br />
Obwohl wir davon ausgehen können, dass alle Obersteiner Befestigungsanlagen − Unterburg (1075 ?), Altes Schloss (1197),<br />
Neues Schloss (um 1320) − über eine eigene Burgkapelle verfügten, hat es in Oberstein schon verhältnismäßig früh eine Kirche<br />
gegeben, die allerdings nicht in dem ummauerten Ort, sondern ca. <strong>500</strong> m davon entfernt im Distrikt ,,Auf dem Kreuz“ − an einer<br />
Wegekreuzung im Bereich des heutigen Kaufhauses Woolworth − stand und erstmals 1324, ferner 1329, 1340 und 1382 genannt<br />
wird. Die Möglichkeit, dass es sich dabei um eine Wallfahrtskirche handelte, ist zwar gegeben, aber nicht sehr wahrscheinlich.<br />
Kirchenpatrone dieses Gotteshauses waren Philippus und Jacobus, Dionysius und Walpurgis. Daneben wird 1430 erst und<br />
einmalig eine Kapelle im Tale (also im ummauerten Flecken) genannt, über deren genauen Standort, Alter, Patron und späteres<br />
Schicksal jedoch nichts weiter urkundlich berichtet wird. Natürlich liegt die Vermutung nahe, dass diese sich im Bereich der<br />
Unterburg befand, zumal später an anderer Stelle nie etwas von einer Kapelle berichtet wird. Zwar ist für das 16. Jahrhundert<br />
einmal die Existenz eines Heiligenhäuschens überliefert, doch lag dieses am Niedertore vor der Stadtmauer in Richtung<br />
Nahbollenbach − also nicht ,,im Tale“.<br />
Natürlich fällt der zeitliche Zusammenhang zwischen dem Mord in der Familie der Herren von Oberstein (1328/29) und der ersten<br />
Erwähnung der Kapelle (1340) auf; da die Unterburg jedoch mit Sicherheit älter ist, kann es sich − falls wirklich ein wahrer Kern in<br />
der Sage stecken sollte − dabei nicht um die Erbauung der <strong>Felsenkirche</strong>, sondern bestenfalls um die Errichtung oder Umgestaltung<br />
einer Kapelle innerhalb dieses Baukomplexes handeln.<br />
Der Fußboden der heutigen <strong>Felsenkirche</strong> lag früher jedenfalls erheblich tiefer (s. Bild Nr. 5 und Querschnitt Bild Nr. 8), wie sich bei<br />
5
der Renovierung 1927/29 zeigte. Auch eine diagonal durch das Kirchenschiff verlaufende Mauer, welche man damals fand, lässt<br />
sich mit dem heutigen Bauwerk nicht in Einklang bringen. Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Tür, die am Fuße des<br />
Treppenaufgangs auf verschiedenen alten Darstellungen (s. Bild Nr. 6) und wohl noch 1927 in Umrissen im Außenputz zu sehen<br />
war (s. Bild Nr. 7). Der mittlere und obere Teil des äußerst unregelmäßigen sechseckigen Turms der <strong>Felsenkirche</strong> scheint jünger<br />
als die mächtige ca. 1,90 m dicke Schildmauer zu sein; die verhältnismäßig geringe Wandstärke deutet darauf hin.<br />
Bild 7: <strong>Felsenkirche</strong> 1927<br />
Unter einem der ,,Schießschartenfenster" ist eine rundbogige Vertiefung (Tür?) erkennbar. Außerdem sieht man hier noch an der<br />
Sakristei die ursprüngliche Form eines weiteren ,,Schießscharten−Fensters", das 1928/29 umgebaut wurde<br />
Der Umbau zur <strong>Felsenkirche</strong> 1482 /84 und deren Erstausstattung<br />
Nachdem die Bevölkerung der Siedlung (Ober−)Stein am Fuße der Burg weiter zugenommen hatte, war wohl eine Erweiterung der<br />
alten Kirche auf dem Kreuz oder ein völliger Neubau erforderlich. Wenn man sich nun vergegenwärtigt, dass das bisherige<br />
Gotteshaus rund ½ km vom Ort entfernt lag und andererseits nach Errichtung von zwei weiteren Burgen die alte<br />
Befestigungsanlage ,,im Loch des Fleckens“ nicht mehr gebraucht wurde, so war es eigentlich naheliegend, die dort befindliche<br />
Bausubstanz zu einem Gotteshaus umzugestalten, zumal damit ein verhältnismäßig großer Bauplatz innerhalb der schützenden<br />
Stadtmauer gefunden war.<br />
Angesichts des heutigen Baubefundes und der kurzen Bauzeit kann kein Zweifel bestehen, dass die <strong>Felsenkirche</strong> nicht in einem<br />
einzigen wohlgeplanten Bauabschnitt, sondern durch einen Umbau entstand. Mit Sicherheit haben sich zuvor an dieser Stelle<br />
andere Baulichkeiten befunden, deren Umbau zu einem Gotteshaus − wie wir es seit Jahrhunderten aus zahllosen Abbildungen<br />
und Reisebeschreibungen kennen − sich verhältnismäßig exakt bestimmen lässt:<br />
Am 23. August des <strong>Jahre</strong>s 1482 erteilte Papst Sixtus IV. (1471 −1484) die Bewilligung, ,,dass die alte Kirche vor dem Flecken<br />
Oberstein liegend abgebrochen und eine neue in dem Flecken durch Herrn Wirich von Daun, Herrn zu Falkenstein und zum<br />
Oberstein, gebauet werden möchte...“.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
6
Bild 8: Die <strong>Felsenkirche</strong> 1482/84 im Querschnitt<br />
Rekonstruktionsversuch Brandt<br />
Anders als bei den bisherigen ,,sagenhaften“ Nachrichten, lassen sich die hier überlieferten Fakten leicht verifizieren: Wirich IV. von<br />
Daun−Oberstein lässt sich ebenso sicher als Obersteiner Alleinregent jener Zeit nachweisen wie der genannte Papst. Wirich lebte<br />
von 1418 − 1501 und muss nach dem Tode seines Vaters − 1432, noch unmündig − den daunischen Anteil an der Herrschaft<br />
Oberstein geerbt haben. Er sollte es unter allen Obersteiner Landesherren zu größtem Wohlstand und Ansehen bringen. Rund 100<br />
<strong>Jahre</strong> nach seinem Tode schrieb der Familienchronist über ihn:<br />
,,Dieser Herr ist überaus sinnreich und geschickt gewesen; (er hat) große Ämter bedient; bei Kaiser, König,<br />
Chur− und Fürsten in hohem Ansehen (gestanden), in Ratschlägen und Werken ganz glückselig, daneben sehr<br />
reich gewesen.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Für uns sind in diesem Zusammenhang nur drei biografische Einzelheiten von Interesse: Wirich hatte 1440 eine Gräfin von<br />
Leiningen geheiratet; er erwarb käuflich 1456 die Reichsgrafschaft Falkenstein in der Pfalz, und er galt als ,,tief religiös veranlagte<br />
Natur“. Mindestens fünf seiner Kinder traten in den geistlichen Stand; drei von ihnen erlangten die Würde von Äbtissinnen, und sein<br />
Sohn Philipp wurde sogar Erzbischof und Kurfürst von Köln. Nach dem Erwerb der Grafschaft Falkenstein nannte sich Wirich ,,Herr<br />
zu Falkenstein und Oberstein“; den Titel eines Grafen von Falkenstein erlangten erst später seine Enkel.<br />
Der Bau und insbesondere die Ausstattung der neu errichteten Obersteiner Kirche ist wohl auf seinen frommen Wesenszug<br />
zurückzuführen. Bereits am 18. Januar 1484 (also nach weniger als 17 Monaten) war das neue Gotteshaus im Felsen fertig. Die<br />
ungewöhnlich kurze Bauzeit unterstreicht auch die Annahme, dass es sich hierbei lediglich um einen Umbau handelte. Zur<br />
finanziellen Absicherung dieser Maßnahme (,,zur Handhabung der Kirchen Gottes Dienste“) schenkte Wirich 1484 mit Zustimmung<br />
seiner bereits mündigen Söhne und Nachfolger (Melchior und Emich) der <strong>Felsenkirche</strong> den aus acht Einzelhöfen bestehenden<br />
Hubhof in der Pfarrei (Nieder−)Brombach. Aus der Schenkungsurkunde geht hervor, dass ,,die alt(e) Kirch zum Oberstein<br />
entweihet, die von neuem in den (dem) Tal der Unterburg gebauet und geweihet.“<br />
Es gab bzw. gibt noch weitere Belege für die Errichtung der <strong>Felsenkirche</strong> in den <strong>Jahre</strong>n 1482 /84. Im Neubau befanden sich große<br />
gotische Fenster, welche mit wertvollen buntbemalten Gläsern ausgestattet waren. In einem von ihnen soll sich eine lebensgroße<br />
Darstellung der Äbtissin Walpurgis, der Schutzpatronin des neuen Gotteshauses, befunden haben. Von dieser ursprünglichen<br />
Verglasung sind nur noch geringe Reste erhalten. Glücklicherweise befindet sich darunter ein Bildnis des Stifters in demütig<br />
kniender Haltung mit der Umschrift ,,Wiric vo(n) dune her(r) zu falkenstein und zu(m) oberstein 1482“.<br />
An weiteren Resten von der Originalverglasung sind noch zwei Fragmente erhalten, die sich heute jeweils in den<br />
,Schießschartenfenstern“ des Kaffgesimses befinden: Es handelt sich einmal um eine Darstellung des Bischofs Nikolaus von Myra<br />
7
mit seinem Heiligenattribut, den drei Goldklumpen, sowie das Wappen der Grafen von Leiningen (drei silberne Adler auf blauen<br />
Grund), des Geschlechtes der Ehefrau des Erbauers.<br />
Bild 9: Wirich IV., Fragment der ehemaligen Verglasung<br />
Alle Glasmalereien sind von hoher Qualität und werden verschiedentlich mit den Fenstern im nördlichen Seitenschiff des Kölner<br />
Doms in Verbindung gebracht, welche dort 1507 bzw. 1509 Wirichs Sohn, Erzbischof Philipp von Daun, stiftete.<br />
Bilder 10 und 11<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Früher muss die <strong>Felsenkirche</strong> noch einen weiteren Hinweis auf die Erbauungszeit enthalten haben: Im <strong>Jahre</strong> 1774 wird durch den<br />
Obersteiner Amtmann Christian Carl Jäger ein ,,Pfeilerstein“ erwähnt, der die Inschrift ,,1492“ trug. Man darf davon ausgehen, dass<br />
es sich hierbei um einen Lese− oder Schreibfehler handelt und dass diese <strong>Jahre</strong>szahl ursprünglich 1482 lautete. Dies käme<br />
praktisch einem Beweis für die Erbauungszeit der heutigen <strong>Felsenkirche</strong> gleich, da sich Pfeilersteine und Strebepfeiler bekanntlich<br />
nicht wie Glasfenster später auswechseln lassen.<br />
8
Bild 12<br />
Wenn wir schon vom Auswechseln oder Umsetzen reden, so sollten wir an dieser Stelle einmal kurz festhalten, was sich heute<br />
noch an mehr oder weniger beweglichem Inventar in der <strong>Felsenkirche</strong> befindet und mit Sicherheit älter ist als das Gotteshaus<br />
selbst:<br />
Bild 41<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Da wäre zunächst das berühmte Altarbild zu nennen, das um 1400 entstanden sein soll. Dazu zwei Bemerkungen: Auf dem linken<br />
unteren Seitenflügel, der ,,Christus vor Herodes“ zeigt, befindet sich auf der rechten Wange des Königsthrons die Inschrift<br />
,Fabricius Winck (Ao 1)<strong>500</strong> M (ensis) May“. Nach Meinung von Fachleuten handelt es sich dabei um eine frühe<br />
Restaurierungsinschrift oder um das Datum der Aufstellung des Bildes in der damals erst 16 <strong>Jahre</strong> alten Kirche. Damit erhebt sich<br />
natürlich die Frage nach dem ursprünglichen Standort dieses Kunstwerks. Die ehemalige Kapelle der Unterburg scheidet wohl<br />
ebenso wie die Kirche auf dem Kreuz aus, da in diesem Falle die Aufstellung sicherlich mit der Erstausstattung der Kirche sowie<br />
der Entweihung bzw. Zerstörung der übrigen Gotteshäuser erfolgt wäre. Wenn das Altarbild nicht ursprünglich in Oberstein war, so<br />
erübrigen sich auch alle Spekulationen über den im Mittelteil dargestellten Stifter, einen Geistlichen im weißen Chorrock, der eine<br />
Stola über der linken Schulter trägt. Es war dies die Tracht eines Diakons, eines Vertreters des untersten geistlichen Ranges.<br />
Wenn es sich bei dem Bild um eine Stiftung − etwa aus Anlass der Weihe zum Diakon − für Oberstein handelt, so käme dafür<br />
möglicherweise Richard von Oberstein infrage, der 1419 als Domherr in Mainz genannt wird, danach noch an verschiedenen<br />
Universitäten studierte und schließlich 1459 Mainzer Domdechant wurde (gest. 1487).<br />
Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, dass die alte Kirche auf dem Kreuz nach dem Bau der <strong>Felsenkirche</strong> nicht − wie<br />
1482 vom Papst genehmigt − abgerissen, sondern lediglich − wie 1484 erwähnt − entweiht wurde. Dazu war nur die Entnahme des<br />
beweglichen Inventars sowie eine teilweise Zerstörung des Innenputzes erforderlich. Danach hatte das Bauwerk keinerlei sakralen<br />
Charakter mehr und konnte durchaus profanen Zwecken dienen. Tatsächlich befanden sich Gebäudeteile an dieser Stelle − im<br />
Volksmund ,,das heilige Häuschen“ genannt − im Bereich des Flurbezirks ,,auf dem Kreuz“ noch im <strong>Jahre</strong> 1759.<br />
9
Aus der Zeit vor der Erbauung der <strong>Felsenkirche</strong> stammen schließlich auch noch zwei Grabplatten: die bekannteste − das Epitaph<br />
eines Ritters in voller Rüstung − dient seit über 50 <strong>Jahre</strong>n den ,,Heimatfreunden Oberstein“ als Vereinssymbol. Es handelt sich um<br />
Philipp II. von Daun−Oberstein, den Vater des Erbauers der <strong>Felsenkirche</strong>, der höchstwahrscheinlich am 4. März 1432 in Erfüllung<br />
seiner Lehnspflichten für den Herzog von Lothringen im Kampfe fiel (Bild Nr. 3).<br />
Die deutsche Übersetzung der Umschrift lautet:<br />
,,Im <strong>Jahre</strong> des Herrn 1432, am Mittwoch nach dem Sonntage Estomihi starb Junker Phil (ipp von Daun, Herr<br />
von Oberstein,) dessen Seele in Frieden ruhen möge. Amen‘‘<br />
Direkt neben diesem überlebensgroßen Standbild befindet sich eine wesentlich schlichtere kleine Grabplatte von Philipps Ehefrau<br />
Mena, einer geborenen Raugräfin von Neuenbamberg, die er offenbar 1401 geheiratet hatte. Der Stein zeigt das gespaltene<br />
Wappen der Raugrafen und die deutsche Inschrift (Bild Nr. 3):<br />
,,Meen rvgrafyn fraw zum Obersteyn"<br />
Der Tod Menas wird wohl erst um die Mitte des 15. Jahrhunderts eingetreten sein − jedenfalls vor Erbauung der <strong>Felsenkirche</strong>,<br />
sodass sich auch dieses Grab zuvor an einer anderen Stelle befunden haben muss.<br />
Die kleine Kopfkonsole, welche eine der Rippen des Seitenschiffes stützt (s. Bild Nr. 13) und vielleicht eine Art Selbstdarstellung<br />
des Baumeisters zeigt, stammt dagegen wohl aus der Erbauungszeit. Mit Sicherheit gilt dies für das daunische Rautenwappen, das<br />
am Ansatz einer der Rippen des Hauptgewölbes noch heute erhalten ist (s. Bild Nr. 14).<br />
Aus der Erbauungszeit sind noch einige Ausstattungsgegenstände vorhanden: Der gotische Taufstein, der früher angeblich als<br />
Ständer für einen Weihwasserkessel diente. Er lag übrigens im vorigen Jahrhundert unbeachtet unter den Trümmern vor der Kirche<br />
und wurde erst durch eine Glöcknerin wieder im Innern aufgestellt und 1929 mit einer neuen Kupferschale und einem Deckel<br />
versehen (Bild Nr. 17).<br />
Ferner könnte aus dieser Zeit die Taufschale aus Messing stammen, die eine Darstellung Adams und Evas mit der Schlange im<br />
Paradiese zeigt und möglicherweise von einem Nürnberger Beckenschläger gefertigt wurde.<br />
Die neue Kirche hatte mindestens drei Altäre. Neben einem Hauptaltar werden kurz nach der Erbauungszeit auch ein Marien− und<br />
ein Wolfgangs−Altar genannt. Wir hören von Altareinkünften, die nicht nur aus barem Geld, sondern auch aus Wachs, Käse, Eiern<br />
und Hühnern bestanden, von den Obersteiner Brudermeistern (heute würden wir vielleicht Kirchmeistern sagen), welche das<br />
Vermögen der ,,Kirche zu Oberstein“ zu verwalten hatten, und von verschiedenen Seelenmessen, die an diesen Altären gelesen<br />
wurden. Die Stiftungen dienten zur personellen und materiellen Absicherung des neuen Gotteshauses, das übrigens eine<br />
Walpurgis−Kirche gewesen sein muss. An der Westwand soll sich ein ,,Heiligenhäuschen“ befunden haben, das um 1900<br />
zugemauert, jedoch noch in Umrissen zu erkennen war. Möglicherweise handelt es sich um eine Nische, die beim Umbau 1929<br />
sichtbar wurde (vergl. Grundriss Bild Nr. 12 und Bild Nr. 16).<br />
Sicher lässt sich belegen, dass − entgegen verschiedenen früheren Auffassungen − die Obersteiner Kirche auch nach ihrer<br />
Umgestaltung noch weiterhin zum alten Idarer Pfarrsprengel gehörte. Die <strong>Felsenkirche</strong> war also zunächst lediglich eine Idarer<br />
Filialkirche, wobei allerdings für 1492 belegt ist, dass der Idarer Pfarrer seinen Wohnsitz nach Oberstein verlegt hatte.<br />
Spätestens mit der Reformation wurde Oberstein jedoch zur selbstständigen Pfarrei, welche außer dem Flecken selbst lediglich<br />
noch einen Teil des Dorfes Breungenborn umfasste, jener 1937/38 durch die Anlegung des Truppenübungsplatzes Baumholder<br />
untergegangene Ort. Dort stand eine Michaeliskirche, wo der Obersteiner Pfarrer noch im 16. Jahrhundert zu gewissen Zeiten<br />
Gottesdienste zu halten hatte.<br />
Die <strong>Felsenkirche</strong> vom Ausgang des Mittelalters bis 1742<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Das Ende des Mittelalters brachte für die neuerbaute Kirche gewiss einschneidende Veränderungen. In diesem Zusammenhang<br />
wäre zunächst der Wechsel des Glaubens zu nennen, der in Oberstein schon verhältnismäßig früh − um 1540 − ohne Mitwirkung<br />
des Landesherrn erfolgte. Damals verschwanden gewiss auch die Nebenaltäre aus der <strong>Felsenkirche</strong> und der oben erwähnte<br />
Taufstein sowie weitere Ausstattungsgegenstände, von denen wir bislang keine Nachricht hatten. Es ist schon ungewöhnlich −<br />
wenn nicht sogar einmalig für das Land an der oberen Nahe, das zunächst vollständig von der Reformation erfasst wurde , dass<br />
dabei das heute so bekannte Altarbild erhalten blieb. Oder sollte es ursprünglich gar nicht in der <strong>Felsenkirche</strong> gewesen sein und<br />
erst im Zuge der Gegenreformation aus einem anderen Gotteshaus − vielleicht aus dem Mainzer Raum − hierher gekommen sein?<br />
10
Bild 13<br />
Interessant an der Obersteiner Geschichte ist jedenfalls die Tatsache, dass sich die Landesherren − abgesehen von einer kurzen<br />
Zwischenperiode 1546/47−1554 − stets zum katholischen Glauben bekannten. Trotzdem wurde die Bevölkerung lutherisch und<br />
blieb es auch, nachdem der Augsburger Religionsfriede (1555) der Obrigkeit die Möglichkeit gegeben hätte, ihre Untertanen wieder<br />
zum Religionswechsel zu zwingen. Wahrscheinlich ist es diesen ungewöhnlichen Verhältnissen zu verdanken, dass sich<br />
mindestens noch etwas aus der vorreformatorischen Zeit in der <strong>Felsenkirche</strong> erhalten hat. Ein ,,Denkmal“ besonderer Art dieser<br />
Periode ist sicherlich das Bildnis des katholischen Landesherrn in der protestantischen Kirche. Es handelt sich um eine Darstellung<br />
des Grafen Sebastian von Daun−Oberstein−Falkenstein mit seiner Familie. Dieser war ursprünglich Domhert, hatte wie seine<br />
beiden älteren Brüder den geistlichen Stand verlassen, war jedoch im Gegensatz zu ihnen katholisch geblieben. Er ehelichte 1557<br />
Elisabeth, die Tochter des Wild− und Rheingrafen Philipp Franz von Saim−Vinstingen. Aus der Ehe gingen mindestens drei Söhne<br />
und zwei Töchter hervor.<br />
Bild 43: Sebastiansbild<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Die ganze Familie ist auf dem ,, Sebastiansbild“ dargestellt, das heute an der Rückwand der Empore hängt. Links neben Sebastian<br />
(der in der Bildmitte in Prunkrüstung steht) finden wir seinen ältesten Sohn und Nachfolger Philipp Franz (mit drei Halsketten und<br />
Kleinod). Dieser war einer der markantesten Herren von Oberstein, der durch sein Interesse am Bergbau, den Erlass einer<br />
Zunftordnung für Achatschleifer 1609 und die kostenlose Überlassung eines Bauplatzes zur Errichtung der heutigen Auschleife<br />
1603 allgemein als weitsichtiger Industrieförderer gilt.<br />
Philipp Franz war eine äußerst streitbare Persönlichkeit, die offenbar in permanenter Geldnot lebte und viele Prozesse führte.<br />
Wegen dieser Verhältnisse stritt er sich auch mit seinen Untertanen in Geld− und Steuerangelegenheiten so heftig, dass Erzbischof<br />
11
Lothar von Trier als Oberlehnsherr und Vermittler eingeschaltet werden musste. In diesem Zusammenhang wurde Philipp Franz<br />
von der andersgläubigen Bevölkerung ausdrücklich bestätigt, dass ,,der Herr Graf, waß Vnterhaltung des Pfarrherrn und Schulen<br />
gehörig kein Mangel erscheinen läßt“.<br />
Bild 14: Das Wappen der Herren von Daun am Säulenansatz des Hauptschiffes<br />
Der Grund für die zu jener Zeit ungewöhnliche Toleranz der Herren von Oberstein könnte in dem seltenen Gewerbe innerhalb des<br />
Herrschaftsbereichs, der Achatschleiferei, gelegen haben. Nichts wäre schädlicher für die Wirtschaft des Landes gewesen, als<br />
wenn durch einen Glaubenswechsel auch nur ganz wenige Achatschleifer zur Emigration getrieben worden wären. Das Gewerbe<br />
wurde damals nämlich noch allgemein als Geheimnis behandelt, und kein Schleifer durfte auswandern oder Fremde in der ,,Kunst“<br />
unterweisen.<br />
Philipp Franz starb 1624 in den ersten <strong>Jahre</strong>n des Dreißigjährigen Krieges und fand seine letzte Ruhestätte im Inneren der<br />
<strong>Felsenkirche</strong> vor dem Altar. Unverantwortlicherweise wurde die Grabplatte bei der Renovierung 1927/29 zerstört! Sie enthielt die<br />
Inschrift:<br />
,,Anno 1624, den 4. Januar, ist der wohlgeborene Graf und Herr Philipps Franz (von Daun, Graf von<br />
Falkenstein, Herr von Oberstein und Bruch etc. seines Alters) 64 Jahr 4 Monat 13 Tage in Gott entschlafen.‘‘<br />
Diese Platte enthielt ferner das Familienwappen in einer ungewöhnlichen Ausführung und einen lateinischen Grabspruch, dessen<br />
deutsche Übersetzung wie folgt, lautete:<br />
,,Wenn ich auch Großes gewesen bin, so hat doch alles der Tod mir geraubt; aber Christus gibt mir dafür<br />
Besseres wieder.“<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Schon während der Regentschaft von Philipp Franz war es zu einem Gegenreformationsversuch durch den Oberlehnsherrn, den<br />
Herzog von Lothringen, gekommen, mit welchem die Herren von Daun−Oberstein über Jahrhunderte hinweg in permanentem<br />
Streit lebten. Aus politischen − nicht aus religiösen − Gründen hatte er sich bereits 1616 an Erzbischof und Kurfürst Schweighard<br />
von Mainz gewandt mit der Bitte, die Hilfe des Heiligen Römischen Reiches zu vermitteln. Damals konnten − offenbar wegen<br />
kriegerischer Einfälle − Kirchen und Schulen in der Herrschaft Oberstein nicht mehr ,,bedient“ werden. In Idar gab es zu jener Zeit<br />
offenbar überhaupt keinen Pfarrer mehr. 1626 kam es erneut zu Übergriffen der Lothringer. Sie ließen die Glocken aus der<br />
<strong>Felsenkirche</strong> entfernen und setzten den lutherischen Geistlichen − vermutlich den Magister Johannes Schwab − gefangen.<br />
Wenn sich auch zunächst die Söhne und Nachfolger von Philipp Franz, die Brüder Franz Christoph und Lothar von<br />
Daun−Oberstein, für ihre Untertanen einsetzten, so waren dafür gleichfalls ausschließlich politische Gründe maßgebend. Drei<br />
<strong>Jahre</strong> später zeigten sie nämlich ihr wahres Gesicht. Sie unternahmen nun ihrerseits einen Gegenreformationsversuch in ihrem<br />
Herrschaftsgebiet. Der lutherische Pfarrer Johannes Schwab wurde 1629 endgültig aus Oberstein vertrieben, und man berief<br />
Jesuiten aus Trier zur Bekehrung der Bevölkerung.<br />
Ein Jahr zuvor hatte Franz Christoph von der ausgestorbenen lutherischen Linie der Herren von Daun−Oberstein die Grafschaft<br />
12
Falkenstein in der Pfalz mit der Auflage geerbt, die dortigen Untertanen niemals zur Aufgabe ihres Augsburgischen Bekenntnisses<br />
zu zwingen. Tatsächlich setzte er sich jedoch wenige <strong>Jahre</strong> später über diese Auflage hinweg und machte auch dort den Versuch,<br />
die Bevölkerung zum katholischen Glauben zurückzuführen.<br />
Einige <strong>Jahre</strong> zuvor hatte er bereits zwei Jesuiten aus Trier nach Oberstein kommen lassen, ,,um die Jugend zu reformieren‘‘. Er<br />
sorgte persönlich für den Lebensunterhalt der Patres, welche ,,beständig die Tafel auf dem Schloss“ Oberstein hatten, Nachdem −<br />
wie oben erwähnt − der letzte lutherische Pfarrer den Ort verlassen musste, war diesen Bemühungen offenbar auch Erfolg<br />
beschieden. ,,Die katholische Religion hat wiederum zu Oberstein florieret; nur zwei Haushaltungen widersetzten sich‘‘, schrieb<br />
rund 70 <strong>Jahre</strong> später der bekannte Obersteiner Praemonstratenserpater Leonard Goffiné (s.u.). Der Zeitgenosse sah dies<br />
allerdings etwas anders: Ein katholischer Pfarrer schrieb 1639 aus Oberstein an den Trierer Domdechanten und das Kapitel, dass<br />
sich vornehmlich im Flecken Oberstein die Leute an auswärtige unkatholische Orte begäben und daselbst ihre Kinder taufen<br />
ließen, auch daselbst die Sakramente empfingen“ − für die <strong>Jahre</strong> 1629 − 1641 lassen sich die Namen von fünf katholischen<br />
Geistlichen (drei Jesuiten und zwei Weltpriester) für Oberstein ermitteln. Sie predigten in der <strong>Felsenkirche</strong> und betreuten auch<br />
während der Pesteppidemie − vermutlich 1635 − die Kranken, wobei sich einer von ihnen infizierte und starb.<br />
Bild 15: Aufriss des nördlichen Seitenschiffes 1927; hier sind deutlich die unterschiedlichen Größen der Gurtbögen erkennbar<br />
All diese Ereignisse muss man vor dem Hintergrund des schrecklichen Dreißigjährigen Krieges sehen, der ja ursprünglich als<br />
Religionskrieg begonnen hatte und die Bevölkerung an der oberen Nahe um zwei Drittel dezimierte. Die regierenden Herren von<br />
Oberstein kämpften auf katholisch−kaiserlicher Seite und ließen beide ihr Leben: Lothar, der jüngere, als ,, Oberist−Lieutnant“ bei<br />
der Werbener Schanze 1633 und Franz Christoph als ,,Oberist eines Kürassierregiments“ in der Schlacht bei Wittsdock 1636. Da<br />
deren Brüder, die angeblich beide Domherren waren, schon zu jener Zeit nicht mehr lebten, fiel damit die Herrschaft Oberstein an<br />
die evangelische Linie des Hauses Daun−Oberstein, welche zu Broich (heute Mülheim an der Ruhr) residierte. Franz Christoph<br />
hatte übrigens der Obersteiner Kirche ein Kapital von 3000 Reichstalern hinterlassen, deren Zinserträge vornehmlich für die<br />
bauliche Unterhaltung der <strong>Felsenkirche</strong> gedacht waren. Außerdem sollte damit der Bedarf an Ornatsachen gedeckt werden sowie<br />
ein evtl. verbleibender Rest jährlich am Kirchweihtage (wohl dem Fest der Walpurgis, dem 1. Mai, an dem bis ins 19. Jahrhundert<br />
der Obersteiner Jahrmarkt stattfand) unter die Ortsarmen in der Herrschaft verteilt werden. Franz Christoph war ein entschiedener<br />
Katholik, und ohne konfessionelle Auflage wollte er seine christliche Mildtätigkeit denn auch wohl nicht verstanden wissen. Die<br />
Stiftung enthielt nämlich eine Klausel, welche besagte, falls wider Verhoffen die Obersteiner Kirche erneut in unkatholische Hände<br />
falle, und dort nicht mehr die katholische Religion gepflanzt werde, so müsse das Kapital an die Stadt Mainz fallen mit der<br />
Verpflichtung, die Zinsen für arme (katholische) Studenten der Theologie zu verwenden. Dieser Eventualfall sollte bald eintreten.<br />
Bild 16: Seitenschiff mit ehemaliger Nische während der Umbauarbeit 1929<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
13
Der neue Obersteiner Landesherr Wilhelm Wirich von Daun, Graf zu Falkenstein, Herr zu Oberstein und Bruch, war ein<br />
exzentrischer Mann und überzeugter Lutheraner. Er konnte jedoch infolge der wirren Kriegsverhältnisse in Oberstein nicht schalten<br />
und walten, wie er wollte. Aus einer Anweisung der Trierer Kirchenbehörde von 1639 an den nach wie vor noch katholischen<br />
Pfarrer in Oberstein wird deutlich, wer hier das Sagen hatte. Dieser sollte die Pfarrkinder ermahnen, von ihren (lutherischen)<br />
Irrtümern abzulassen, ansonsten obrigkeitliche Strafe erfolgen würde.<br />
Der Westfälische Friede von 1648 brachte zwar für das Land an der oberen Nahe zunächst kein Ende der kriegerischen Unruhen,<br />
aber bestätigte wenigstens für die Herrschaft Oberstein die rechtliche Absicherung des alten lutherischen Glaubens. Im<br />
Friedensvertrag war nämlich das Jahr 1624 als sogen. Normaljahr festgelegt worden, d.h. der Glaube, der in jenem <strong>Jahre</strong> in einem<br />
Territorium üblich war, solle dort auch in der Zukunft Bestand haben. Hätte man diese verhältnismäßig willkürliche Festsetzung<br />
eines Normaljahres etwas später angesetzt, so hätte dies für Oberstein völlig anders ausgesehen.<br />
Zunächst amtierten aber offenbar noch ein lutherischer und ein katholischer Geistlicher gleichzeitig in Oberstein, bis Letzterer<br />
,,gutwillig“ das Gebiet verließ und nur mehr gelegentlich von der Mosel aus einige Amtshandlungen in Oberstein vollzog. Wilhelm<br />
Wirich wird auch von katholischer Seite bestätigt, dass er die andersgläubigen Untertanen in guter Ruhe“ ließ; er hielt sich sogar in<br />
Oberstein einen katholischen Oberamtmann, der seine Glaubensgenossen tatkräftig unterstützte.<br />
Andererseits war auch die lutherische Gemeinde in jenen Jahrzehnten in großen Schwierigkeiten. So gelang es infolge der<br />
wirtschaftlichen und personellen Not zu Ende des Dreißigjährigen Krieges nur einen Geistlichen zu verpflichten, der zugleich vier<br />
Pfarreien gemeinsam zu betreuen hatte. Es war dies Joh. Georg Musculus, der in den Pfarrsprengeln Allenbach, Wirschweiler, Idar<br />
und Oberstein zugleich amtierte. Aus diesem Grunde stand die <strong>Felsenkirche</strong> von ca. 1650 bis 1660 ,,ledig“, d.h. leer; es konnte hier<br />
aus personellen Gründen überhaupt kein regelmäßiger Gottesdienst stattfinden. Die Obersteiner Gläubigen besuchten während<br />
dieser Zeit die Sonntagspredigt in der alten Idarer Mutterkirche, wo Pfarrer Musculus wohl zeitweise seinen Wohnsitz hatte.<br />
Bild 17: Der spätgotische Taufstein<br />
Ursprünglich hatte man die Toten auf dem kleinen Kirchhof am Fuße der <strong>Felsenkirche</strong> beigesetzt, eine Praxis, die man infolge des<br />
beschränkten Raumes und der zahlreichen Todesfälle wohl in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges aufgeben musste. Jedenfalls<br />
wurden in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts die Verstorbenen auf einem Friedhof am heutigen ,, Kirchhofshübel“ begraben,<br />
der den Gläubigen beider Konfessionen diente. Beerdigungen an der <strong>Felsenkirche</strong> gab es zu jener Zeit nur mehr in<br />
Ausnahmefällen und dann allerdings nur für Protestanten. Bei Hochwasser war nämlich der Simultanfriedhof am Kirchhofshübel<br />
nicht zu erreichen.<br />
Ganz besonders vornehme Tote wurden dagegen seit eh und je im Inneren der <strong>Felsenkirche</strong> bestattet. Dies hätte an erster Stelle<br />
deren Stifter Wirich IV. zugestanden, der jedoch zusammen mit einem Sohn und einem Enkel in der Erbbegräbnisstätte der Familie<br />
seiner Mutter, in der Abteikirche zu Otterberg in der Pfalz, seine letzte Ruhe fand, wie die dort noch vorhandene dicke Grabplatte<br />
ausweist.<br />
Im Inneren der <strong>Felsenkirche</strong> lässt sich bislang lediglich die Bestattung eines einzigen regierenden Landesherrn − des bereits zuvor<br />
erwähnten Philipp Franz − nachweisen, obgleich es möglich ist, dass neben ihm dessen Vater Sebastian und weitere Regenten<br />
hier beigesetzt wurden.<br />
Für die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts lassen sich folgende Beerdigungen in der <strong>Felsenkirche</strong> belegen:<br />
a) Margarethe Mundert, geb. Bell (gest. zw. 1610 − 1619), Ehefrau des obersteinischen Rentmeisters Wilhelm<br />
Mundert (die Grabplatte war 7 Schuh lang; sie ist heute nicht mehr vorhanden).<br />
b) Philipp Friedrich von Daun−Oberstein (gest. 23.5.1615), Sohn dess Grafen Philipp Franz, soll Domherr<br />
gewesen sein (Grabplatte noch vorhanden; ca. 1,80 • 0,67 m). (Bild Nr. 19).<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
14
Bild 57<br />
c) N.N. von Daun−Oberstein (1600 −1615), ein Mädchen; wahrscheinlich eine Tochter von Philipp Franz<br />
(Grabplatte noch vorhanden; ca. 2,05 x 0,93 m).<br />
d) Philipp Franz von Daun Graf von Falkenstein und regierender Herr zu Oberstein (1559 − 1624) (Grabplatte<br />
1927/29 zerstört; Text s.o.).<br />
e) ein katholischer Geistlicher; gest. wohl um 1635 (vielleicht Johann Weirich aus Bernkastel oder Bernhard<br />
Rohr 5)).<br />
f) Anna Magdalena Katharina von Schellard (1642 − 1644), ein Töchterchen des katholischen Oberamtmanns<br />
Johann Christoph von Schellard (Grabplatte 1774 zum letzten Mal gen.).<br />
g) Pfarrer Sonntag der Ältere (gest. um 1645).<br />
Möglicherweise sind die unter Buchst. e) und g) angeführten Personen identisch; in diesen Fällen ist auch nicht sicher, ob<br />
überhaupt Grabplatten angefertigt wurden.<br />
Die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts brachte erneut kriegerische Auseinandersetzungen und einen dritten<br />
Gegenreformationsversuch für die Herrschaft Oberstein. 1680 wurde das Gebiet an der oberen Nahe mit Frankreich reuniert (d.h.<br />
wieder vereinigt). Das neue Schloss Oberstein sollte zur französischen Festung ausgebaut werden. Die Besatzungstruppen waten<br />
katholisch und brachten eigene Garnisonspriester mit, die sich bald auch mit der ,,Missionierung“ der Bevölkerung beschäftigten.<br />
Höchstwahrscheinlich erzwangen die neuen Herren ein Mitbenutzungsrecht an der <strong>Felsenkirche</strong>, das jedoch im Gegensatz zu den<br />
evangelischen Kirchen in Kirn, Weierbach, Kirchenbollenbach oder Birkenfeld nur kurze Zeit gedauert haben dürfte. Ob in diesem<br />
Zusammenhang oder bereits früher (vgl. "Zerstörung und...") die Glocken aus der <strong>Felsenkirche</strong> verschwunden sind, ist nicht<br />
überliefert; merkwürdigerweise stammt das spätere Geläut gerade aus jenen unruhigen <strong>Jahre</strong>n. Die beiden größten Glocken trugen<br />
die Inschrift:<br />
sowie:<br />
,,Mathias Grommel Trier gos mich anno 1682“<br />
,,Alles was Odem hat lobet den Herrn, Ps 150“<br />
und die nicht gedeuteten Buchstaben:<br />
,,I:S:H:A:V:P:D:G:P:C:K:A:S:H:B:N:B:M“<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
15
Auf der mittleren Glocke war zu lesen:<br />
,,M:N:D:M:K: anno 1682“;<br />
sie enthielt ferner das Bibelzitat:<br />
,,Thut alles zu Ehre Gottes, 1. Cor. 10“<br />
Bild 18: Die kleine Glocke von 1686<br />
Beide Texte folgen genau der Lutherübersetzung, womit bewiesen ist, dass beide ursprünglich eindeutig für ein evangelisches<br />
Gotteshaus gedacht waren. Letzteres gilt interessanterweise nicht für die kleinste, die sogen. Schulglocke. Sie enthält eine<br />
lateinische Inschrift, weshalb man sie früher für wesentlich älter − aus der Zeit der Erbauung 1482/84 − gehalten hat. Die deutsche<br />
Übersetzung lautet:<br />
,,Zur Zeit des Pastors Friedrich Bernardi und der Sendschöffen Johann Frank und Mathias Treisch am 2. Juli<br />
1686 (bin ich gegossen worden). Wenn ich geschlagen werde, ertöne ich, das Volk rufe ich zusammen, die<br />
Toten beklag ich und den Blitz vertreib ich − H(eiliger) Stefan, Schutzherr der Kirche von Monzelfe(ld), bitte für<br />
uns."<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Monzelfeld ist ein katholischer Ort bei Bernkastel; für die dortige Kirche lässt sich ebenso ein Schutzheiliger Stefan wie ein Pfarrer<br />
Bernhardi belegen, sodass kein Zweifel besteht, dass diese Glocke ursprünglich für ein völlig anderes Gotteshaus gedacht war. Sie<br />
kam wohl in die <strong>Felsenkirche</strong>, als diese zugleich der katholischen Gemeinde diente. Durch die falsche Übersetzung der Inschrift<br />
und deren danach geschätztes Alter blieb diese Glocke als Einzige erhalten. Die beiden übrigen wurden ein Opfer des Ersten<br />
Weltkrieges. Das Schulglöckchen dient noch heute im Turm der <strong>Felsenkirche</strong> als Stundensignal der Uhr.<br />
16
Bild 19: Grabplatte Philipp Friedrichs von Daun−Oberstein (gest. 1615)<br />
Die Zeit um 1686 war auch in anderer Hinsicht für die Obersteiner Kirchengeschichte von besonderer Bedeutung. Um die<br />
<strong>Felsenkirche</strong> der lutherischen Gemeinde zu erhalten, kam der Obersteiner Amtmann − vermutlich der reformierte Rat und<br />
Oberamtmann Christian Wilhelm Müller von Weiskirch − auf eine ungewöhnliche Idee: Die Protestanten sollten den Katholiken eine<br />
eigene Kirche bauen. Er wusste seinen Landesherrn − es war dies Joh. Carl August Graf zu Leiningen−Heidesheim, ein Enkel des<br />
1682 verstorbenen Wilhelm Wirich von Daun−Oberstein − für diesen Vorschlag zu gewinnen.<br />
Bei der Durchführung dieses Planes ergaben sich jedoch eine Reihe von Schwierigkeiten, da die Protestanten nur das<br />
Allernotwendigste zum Bau eines kleinen, recht primitiven Gotteshauses beitrugen. So entstand eine neue Walpurgiskirche am<br />
Marktplatz in Oberstein (1858 abgerissen; mitten auf der Straße neben der heutigen Drogerie Pullig). Es handelte sich − und das<br />
war für Gotteshäuser in unserer Gegend völlig ungewöhnlich − um einen Fachwerkbau mit rechteckigem Grundriss, dreiseitiger<br />
Apsis und einem Dachreiter−Glockenturm. Die kleine Pfarrkirche hatte auch nur einen Altar, verfügte über einen Kelch mit silberner<br />
Kappe sowie zwei Glöckchen. Ein allgemeines Läuterecht besaß die katholische Kirche jedoch nicht. Bei Beerdigungen auf dem<br />
Simultanfriedhof ,,am Kirchhofshübel“ durften nur die Glocken der <strong>Felsenkirche</strong> läuten.<br />
Das Zusammenleben beider Konfessionen scheint sich immerhin in den ersten <strong>Jahre</strong>n noch einigermaßen erträglich gestaltet zu<br />
haben, was sicher zum Teil am geringen Eifer der evangelischen Pfarrer Heinz und Molter bzw. des Pastors Orphelin lag.<br />
In jenen <strong>Jahre</strong>n, in denen die Herrschaft Oberstein unter französischer Oberherrschaft stand, und der Ort von fremder Besatzung<br />
belegt war, fallen schwere religiöse Bedrückungen und hässliche Streitigkeiten zwischen den Pfarrern und den Konfessionen, die<br />
erst nach dem Frieden von Ryswik 1697, in dem die Franzosen auf Oberstein und viele andere Reunionen verzichten mussten,<br />
wieder langsam abflauen. Wir hören von lutherischen Bürgern, die lieber Haus, Hof und alle Güter in Oberstein verlassen wollen,<br />
um nicht zum Glaubenswechsel gezwungen zu werden, von Wächtern vor der Tür eines Neugeborenen, damit ,,der Pfaff" nicht<br />
herein könne, und von Taufen ,,unter französischem Joch“ sowie vieles andere mehr. Erst 1698 − so steht im lutherischen<br />
Kirchenbuch − ,,hat uns Gott von den Franzosen erlöst“.<br />
Bild 20: Oberstein um 1840<br />
Stich von Scheuren<br />
Nach einer Periode häufigen Pfarrerwechsels bei beiden Konfessionen trafen in Oberstein ab 1695 bzw. 96 zwei starke<br />
Persönlichkeiten aufeinander, die beide ihre religiöse Überzeugung entschieden verteidigten. Es war dies auf evangelischer Seite<br />
der ,,energische, fleißige und ohne Zweifel begabte Pfarrer Johannes Scriba“, der 53 <strong>Jahre</strong> lang als ,,exemplarischer, treufleißiger<br />
und eifriger Seelsorger“ in Oberstein und ab 1717 in Idar wirkte und zum Stammvater vieler alteingesessener Familien der Stadt<br />
wurde. Ihm stand in Oberstein der berühmte Praemonstratenserpater Leonard Goffiné gegenüber. Er ist der Verfasser zahlreicher<br />
christlicher Erbauungsschriften, darunter die 1690 in Mainz erstmals erschienene ,, Christkatholische Handpostill“, die in viele<br />
Sprachen der Weltliteratur übersetzt wurde und bis in unser Jahrhundert zahllose Auflagen erlebt hat.<br />
Goffiné machte seinem Vorgänger heftige Vorwürfe, dass er sich seinerzeit auf den kuriosen Vorschlag des Amtmannes<br />
eingelassen und auf derart ,, glimpfliche Art nun und in Zukunft der Zeiten (. . .) auf das katholische Religionsexercitium“ in der<br />
<strong>Felsenkirche</strong> verzichtet habe. Die Katholiken könnten ,,nimmermehr zur Prozession ihres von altersher zuständigen Gotteshauses<br />
gelangen".<br />
Tatsächlich ist seit 1686 kein katholischer Gottesdienst mehr in der <strong>Felsenkirche</strong> gehalten worden. In der berühmten Chamoschen<br />
Liste, die zur Erläuterung der Vorbehaltsklausel IV des Ryswiker Friedens diente, wird der Alleinbesitz der <strong>Felsenkirche</strong> für die<br />
Protestanten ausdrücklich bestätigt. Sie behielten sogar das Läuterecht für ganz Oberstein; lediglich der Friedhof am<br />
Kirchhofshübel blieb simultan.<br />
Von der <strong>Felsenkirche</strong> selbst hören wir in den nächsten 50 <strong>Jahre</strong>n wenig. Selbstverständlich wurden nach wie vor vornehme<br />
Personen in ihrem Inneren beerdigt.<br />
Es waren dies:<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
17
h) Joh. Georg Musculus (1600 − 1671), Pfarrer zu Allenbach (1630 −55), Kirschweiler (1632 − 55), Idar (1640 −<br />
69) und Oberstein (1641 − 71).<br />
i) Anna Magdalena Heinz geb. Leyser (gest. 20.12.1685), Ehefrau des Idarer Pfarrers Job. Christian Heinz, der<br />
kurz darauf die Obersteiner Pfarrstelle erhielt.<br />
j) Maria Martha de Conde de la Croire, geb. Rheingräfin von Simmern(?) (1611 − 1686), reformierte Mutter des<br />
Oberamtmannes Wilhelm Christian Müller von Weiskirch.<br />
k) Anna Catharina Götz (17.3. − 6.4.1686) Töchterchen des Obersteiner Pfarrers Joh. Sebastian Götz.<br />
l) Franz Daniel Scriba (1703 − 1704), Söhnchen des Pfarrers Johannes Scriba.<br />
m) Wilhelm Christian Müller von Weiskirch (1643 − 1706), leiningischer Rat und Oberamtmann zu Oberstein.<br />
n) Joh. Nicolaus Reichardt (gest. 1728), leiningischer Amtmann zu Oberstein.<br />
Aus dem <strong>Jahre</strong> 1724 ist eine interessante Nachricht überliefert: Erst damals ersetzte man das alte Strohdach der <strong>Felsenkirche</strong>, das<br />
sehr schadhaft geworden war, durch ein festes Schieferdach. Die Kosten beliefen sich auf 810 Gulden. Mindestens seit jener Zeit<br />
befanden sich auch die massiven Eichenkisten mit ihren eisernen Beschlägen in der Kirche, wo sie − an einem praktisch<br />
feuersicheren Ort − zur Aufbewahrung des Orts − und Kirchenarchivs dienten.<br />
Bild 21<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Die Obersteiner Bürger − obwohl sie praktisch alle die Kirchspielschule bis zur Konfirmation besucht hatten − waren nicht in der<br />
Lage, die darin enthaltenen alten Urkunden zu lesen. Man vermutete in den Kisten noch viele Dokumente und Briefschaften und<br />
traute offenbar den leiningischen Beamten und wohl auch ihren Pfarrern nicht recht. Nur so ist es erklärlich, dass man anlässlich<br />
des Besuches eines kurtrierischen Kommissars im <strong>Jahre</strong> 1731 diesen um die Verlesung des Inhaltes bat. Schlüsselgewalt über die<br />
Kisten hatten übrigens die Gerichtsschöffen. Es fanden sich damals jedoch nur zwei Urkunden, die aber für die Geschichte der<br />
Kirche ohne Belang sind.<br />
18
Bild 22: Petrus, aus den Apostelbildern an der Empore<br />
Zerstörung und Wiederaufbau der <strong>Felsenkirche</strong> 1742 − 1800<br />
Die Gesteinsmassen unterhalb des alten Schlosses hängen seit eh und je wie ein Damoklesschwert über Kirche und Ort. Im Laufe<br />
der Geschichte ist es immer wieder im Bereich der Obersteiner Burgen zu Felsstürzen gekommen, die aber fast alle glimpflich<br />
abliefen. Um 1650 war der Ostteil des neuen Schlosses (möglicherweise mit der Burgkapelle) eingestürzt, wobei die Trümmer bis<br />
an das alte Pfarrhaus am Aufgang zur <strong>Felsenkirche</strong> am Marktplatz rollten. Wenige <strong>Jahre</strong> danach lösten sich auch Felsblöcke aus<br />
dem Kirchfelsen; diesmal wurde die Wohnung eines Wollenwebers im Flecken zerstört und eine Mutter mit 5 Kindern unter den<br />
Schuttmassen begraben. Zwei Kinder fanden den Tod, die Übrigen überlebten mit zum Teil schweren Verletzungen. Bei einem<br />
anderen Felssturz war einer Frau, die krank im Bett lag, von einem Stein, der Dach und Decke des Hauses durchschlug, ein Bein<br />
zerschmettert worden.<br />
Im <strong>Jahre</strong> 1742 erfolgte dann plötzlich ein ähnliches Unglück, bei dem keine Menschen zu Schaden kamen. Die schon ,,vor Zeiten<br />
der Reformation in einem Fels stehende und bewunderungswürdiger Weise erbaut gewesene Kirche (wurde) den 23. Dezember<br />
1742 durch Einfall des Felsens zerschmettert und zu Grunde gerichtet“. Der Schaden war in der Tat ganz beträchtlich. Das<br />
gotische Kreuzgewölbe des gesamten Hauptschiffes, dessen Auflageansätze noch heute erkennbar sind (an einer Stelle sogar mit<br />
dem Dauner Rautenwappen), wurde restlos zerstört. Die Landesherrschaft, der sogleich von dem Unfall berichtet wurde, war der<br />
Meinung, dass es ,,freylich nicht ratsam“ sei, den Kirchenbau ,,wiederum in diesen gefährlichen Ort zu setzen“. Man wollte also die<br />
<strong>Felsenkirche</strong> nicht wieder aufbauen und gab lediglich Anweisung, das noch brauchbare Inventar zu bergen. In diesem<br />
Zusammenhang werden genannt:<br />
a) ,,das Epitaphium in dem Herrschaftlichen Stuhl“ (wohl die Grabplatte Philipps II.)<br />
b) ,,das Gemälde auf dem Altar“ (das heutige Altarbild)<br />
c) ,,Pfeifen und Zubehör der Orgel“ (diese war somit auch größtenteils zerstört − sie hatte sich gegenüber der<br />
Kanzel auf der Empore befunden).<br />
d) die Glocken (zur Vorsorge gegen nachträglich einstürzenden Fels).<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Der Turm war offenbar durch den Felssturz nicht beeinträchtigt worden. Da das Kirchengestühl in dieser Zusammenstellung nicht<br />
genannt wird, können wir davon ausgehen, dass es vollständig zerstört war. Gleiches gilt auch für den größten Teil der Fenster mit<br />
den Glasgemälden.<br />
Die Gemeinde war durch das Unglück schwer betroffen. Die Landesherrschaft − damals regierte der verschwendungssüchtige Graf<br />
Christian Carl Reinhard von Leiningen in Heidesheim in der Pfalz − entzog sich weitgehend ihrer Verpflichtung zur Unterhaltung<br />
des Gotteshauses, beschränkte sich auf mehr oder weniger gut gemeinte Ratschläge, machte strenge Vorschriften und leistete<br />
bestenfalls ideelle Unterstützung.<br />
19
Ähnlich wie im Ort Nahbollenbach, der 1739 bis auf wenige Häuser durch Hochwasser oder Feuersbrunst zerstört worden war,<br />
versuchte man, durch sogen. Kollektanten in deutschen und fremden Ländern Geld für die bedürftige Gemeinde zu sammeln.<br />
Dieses Amt übernahm der Obersteiner Bürger und Weißgerber Joh. Christian Schmoll, der zunächst nach Broich an der Ruhr<br />
reiste, im Herbst 1743 dort aber wegen des schlechten Wetters nicht weiterkam und schließlich sogar erkrankte. Die Kollektenreise<br />
wurde im Sommer 1744 durch Georg Otto Klein fortgesetzt. Man versuchte von Broich aus, das sich auch im Besitz der Grafen von<br />
Leiningen−Heidesheim befand, Kontakt zu einem Hofrat Voss in Duisburg aufzunehmen. Dieser verfügte über gewisse<br />
Verbindungen nach Den Haag, wo man erreichen wollte, dass in den Generalstaaten (den Niederlanden) gleichfalls eine Kollekte<br />
für die <strong>Felsenkirche</strong> angeordnet würde.<br />
Inzwischen waren in Oberstein längst Überlegungen wegen einer Reparatur angestellt worden. Im Frühjahr 1743 hatte man den<br />
Maurermeister Thomas Petry aus Bundenbach, offenbar den Vater des nachmals bekanntesten Hunsrücker Barockbaumeisters,<br />
um zwei Alternativ−Kostenvoranschläge gebeten. Es ging einmal um eine Reparatur der alten Kirche bzw. um einen völligen<br />
Neubau an anderer Stelle. Der Voranschlag für den Wiederaufbau enthielt Positionen für die Felssicherung (das Absprengen der<br />
noch überhängenden Stücke durch Pulver und Eisen), die Wiederherstellung der Außenmauern mit einem neuen Holzdach (also<br />
kein Steingewölbe mehr) sowie die Zimmererarbeit. All dies sollte 650 Gulden kosten.<br />
Ein völliger Neubau, wofür ein Platz hinter dem alten Pfarrhaus am Marktplatz in Oberstein vorgesehen war, sollte 60 Schuh lang,<br />
36 Schuh breit und 18 Schuh hoch werden (ohne Turm) und hätte etwa eine Grundfläche von 200 qm gehabt. Hierfür waren die<br />
Kosten mit 1050 Gulden veranschlagt. In beiden Fällen wären die Pfarrkinder zur Holzlieferung sowie zu Fuhr− und Handfron<br />
verpflichtet gewesen. Der Neubaupreis scheint außerordentlich niedrig angesetzt und wenig realistisch gewesen zu sein. Jedenfalls<br />
kostete rund 10 <strong>Jahre</strong> später der Neubau des Kirchenschiffes der Idarer Kirche (auch ohne Turm), der zwar geringfügig größer war<br />
(240 qm Grundfläche), mehr als das Doppelte an barem Geld.<br />
Dies war aber zu jener Zeit in Oberstein noch weniger vorhanden als in Idar. Keiner der beiden Alternativ−Kostenvoranschläge<br />
gelangte zur Ausführung, da die Gemeinde ,,mit Mitteln gänzlich entblößt“ war. In der Zwischenzeit hatte man eine Scheune auf<br />
der rechten Naheseite notdürftig für Gottesdienstzwecke hergerichtet. Es war dies gewiss ein unwürdiger Ort, um als Grabstätte für<br />
das 1½−jährige Söhnchen des Obersteiner Amtmanns Joh. Philipp Jaeger zu dienen. Das Kind wurde daher Ende April 1744<br />
,,weilen die Obersteiner Kirch wie bekannt, eingefallen und voll Steine liegt“, im Inneren der Idarer Pfarrkirche beigesetzt. Da aber<br />
zu jener Zeit bereits abzusehen war, dass eine Reparatur auf jeden Fall billiger als ein Neubau kommen würde, hatte die<br />
Landesherrschaft am 30.12.1743 − also genau ein Jahr nach dem Felssturz − den Wiederaufbau an alter Stelle angeordnet. Am<br />
11. Januar 1744 schlossen daraufhin die ,,Vorsteher der Gemeinde“ mit zwei Moseler Baufachleuten, dem Maurermeister Joh.<br />
Heinrich Kindt aus Trarbach und dem Zimmermeister Joh. Reinhardt Dünkel aus Traben, einen Wiederaufbauvertrag, der von dem<br />
alten Gerichtsschöffen und Büchsenmacher Peter Friedrich Leyser, dem Schöffen und Schuhmacher Hans Georg Loch, dem<br />
Kirchencensor und Rotgerber Hans Georg Klein sowie dem Amtsschultheißen Christian Joachim Spindler unterzeichnet wurde.<br />
Bild 23: Inneres der <strong>Felsenkirche</strong> vor der Renovierung 1928/29<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Die Kosten für dieses Vorhaben sollten sich nunmehr auf 700 Gulden belaufen. Obgleich Amtmann Jaeger in einem Schreiben an<br />
die Landesherrschaft ,,die Sache auf das allerbeste“ empfahl, war ein halbes Jahr später in dieser Angelegenheit immer noch<br />
nichts geschehen. Die Herrschaft hatte wegen finanzieller und technischer Probleme noch kein grünes Licht für die<br />
Wiederherstellung gegeben. Inzwischen waren Fischbacher Bergleute mit Spreng− und Ablösearbeiten des Felsens über der<br />
Kirche beschäftigt, obgleich noch nicht endgültig abzusehen war, ob es wirklich sinnvoll sei, wieder auf diesen gleichen Platz zu<br />
hauen. Die Finanzierung gestaltete sich außerordentlich schwierig. Wie bereits angedeutet, verliefen die Kollektenreisen nicht ganz<br />
reibungslos. Allgemein wird aber angenommen, dass der angesprochene Vertrag mit den Moseler Bauleuten dann schließlich doch<br />
zur Ausführung kam, da wir in den folgenden <strong>Jahre</strong>n nichts mehr diesbezüglich hören. Trotzdem kann ein genaues Jahr für den<br />
Wiederaufbau nicht angegeben werden. Immerhin finden sich in den Obersteiner Almosenrechnungen in der Zeit von 1743 bis<br />
1752 keine Ausgaben für die Kirche. Erst 1753 erscheint dort erstmals eine Position für das Ablösen von Felsstücken am Kirchweg.<br />
1756 wird ein Geländer (Lehne) an der Empore angebracht und im gleichen Jahr offenbar eine Orgel eingebaut. Man darf<br />
annehmen, dass spätestens zu diesem Zeitpunkt die Renovierung der Kirche abgeschlossen war.<br />
Das neue alte Gotteshaus präsentierte sich freilich dem Besucher in schlichterem Gewand. Statt des steinernen Kreuzgewölbes<br />
20
hatte man eine billige Brettertonnendecke im Stile der Zeit gewählt. Das Gestühl war ebenso neu wie die Bohrkirche (Empore),<br />
wobei bislang von der Kunstgeschichte nicht eindeutig eine Datierung von Kanzel, Herrenstuhl sowie den sogen. Apostelbildern<br />
rund um die Empore (früher unter der Orgel) möglich ist. Bemerkenswert an letzteren ist die Darstellung des Apostels Petrus, hinter<br />
dem eine Ansicht von Oberstein (Fluss, Kirche und alte Burg) zu sehen ist. Eine möglichst genaue Datierung dieser Bilder wäre<br />
allein deshalb für uns von besonderem Interesse, da wir es hier u.U. mit der ältesten realistischen Darstellung der <strong>Felsenkirche</strong> zu<br />
tun haben (Bild Nr. 22). Selbst wenn dieses Bild nicht älter als der bekannte Obersteiner Merian−Stich (1654 erstmals<br />
veröffentlicht) ist, so kann das Gemälde mit Sicherheit als exakteste frühe Darstellung der <strong>Felsenkirche</strong> betrachtet werden.<br />
Außerdem belegt diese Wiedergabe, dass die Apostelbilder speziell für die <strong>Felsenkirche</strong> angefertigt und nicht von einem anderen<br />
Ort hierher verbracht wurden.<br />
Bild 24: Die <strong>Felsenkirche</strong> 1927<br />
(hier sind noch deutlich die beiden ,,romanischen" Doppelfenster am Turm erkennbar)<br />
Auch die Orgel − heute ist davon praktisch nur noch der alte Orgelprospekt übrig geblieben − gibt Rätsel auf. Sie trägt die<br />
<strong>Jahre</strong>szahl 1756 und soll aus der berühmten Werkstatt der Gebrüder Stumm in Sulzbach bei Rhaunen stammen. Leider fand sich<br />
dazu kein zeitgenössischer Hinweis. Aus den Almosenrechnungen ist lediglich zu entnehmen, dass sie sehr teuer war (1756:<br />
,,weilen wir noch viele Schuld auf die Orgel haben und wir uns nicht anders zu helfen wissen“), dass man 1757 das Werk noch<br />
nicht bezahlt hatte und schließlich 1758 der letzte Rest der ,,Orgelschuld“ an Christian Essig beglichen wurde.<br />
Dieser Mann war indessen keineswegs der Erbauer, sondern nur der Überbringer des Geldes. Es handelte sich nämlich um einen<br />
Obersteiner Bürger und Kirchenzensor der Gemeinde. Er musste übrigens gerade in jener Zeit infolge der Revolte in der Herrschaft<br />
Oberstein gegen den verhassten leiningischen Regenten sein Amt aufgeben. An anderer Stelle wird ein gewisser ,, Dillmann aus<br />
Birkenfeld“ als Erbauer der <strong>Felsenkirche</strong>norgel von 1756 genannt. Leider konnte diese Nachricht bislang nicht verifiziert werden.<br />
Bild 25: Kanzel und Orgelprospekt von 1756<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
21
Zwar war es gelungen, die <strong>Felsenkirche</strong> in der Mitte des 18. Jahrhunderts wieder entsprechend dem Stile der Zeit herzurichten,<br />
aber es fehlte der Gemeinde doch nach wie vor an vielen Kleinigkeiten. Vom Altartuch wird 1757 berichtet, es sei so zerrissen,<br />
,,daß man sich dabey schämen mußte“. Doch zu einer Neuanschaffung reichte es noch nicht; ein Schneider musste zusammen mit<br />
einem Lehrling einen halben Tag daran flicken. Zwei <strong>Jahre</strong> später hören wir, ,,das Altartuch, so bey dem H. Abendmahl gebraucht<br />
wurde, (sei) ganz und gar zerrissen....., so daß mans nicht mehr weissen (zeigen) konnte“. Eine Neuanschaffung war nicht mehr zu<br />
umgehen. Die Kosten dafür beliefen sich auf 8 Gulden, wobei ein Teil aus der Almosenkasse und der Rest aus den Kirchengefällen<br />
bestritten wurde. 1762 stand der Erwerb einer neuen Abendmahlskanne aus Zinn an (Kosten: 4 Gulden 11 Albus), und 1754<br />
musste ein neuer Chorrock angeschafft werden. Auch Reparaturen an der Kirchentreppe waren erforderlich, doch auch diese<br />
Maßnahme wurde über zwei <strong>Jahre</strong> gestreckt, da offensichtlich die Mittel nicht ausreichten. 1765 wird dann stolz vermerkt: ,,Nun ist<br />
die Treppe wieder in gutem Stand“. Im <strong>Jahre</strong> 1761 war erneut die Abtragung ,,gefährlicher Felspartien“ über dem Gotteshaus<br />
erforderlich geworden.<br />
Der Herrenstuhl in der <strong>Felsenkirche</strong> befand sich − so ist es jedenfalls auf Fotos um 1800 zu erkennen − eine Etage über seinem<br />
heutigen Platz im Seitenschiff. Oft konnten die Obersteiner Landesherrn im 18. Jahrhundert dort nicht gesessen haben, denn die<br />
Herrschaft wurde seit 1636 nur mehr oder weniger als ungeliebtes Anhängsel von anderen Kleinterritorien aus verwaltet. Die<br />
Landesherrn beehrten Oberstein selbst nur selten durch ihre Anwesenheit. Möglicherweise hatten ansonsten die Amtleute, welche<br />
ständig auf dem neuen Schloss in Oberstein wohnten, dort ihren Platz (s. Bilder Nr. 14 und Nr. 23).<br />
Für das 17. und 18. Jahrhundert ist ferner die Existenz besonderer Stühle für Gerichtsschöffen und Kirchenzensoren überliefert,<br />
wie dies in allen Kirchen des Naheraumes üblich war. Selbst die Schöffen von Breungenborn hatten hier ihren Stammplatz. Nach<br />
ihrer Wahl bzw. Ernennung wurden die neuen Amtsträger feierlich ,,sonntags hernach in der Kirche in den Zensor− (bzw.<br />
Gerichts−) Stuhl geführt“. Auch nach der Renovierung um 1750 war dies nicht anders.<br />
Schließlich hatten alle Kirchen auch einen besonderen Platz für den Pfarrer. Vielleicht ist dieser gemeint, wenn berichtet wird, dass<br />
zu Zeiten des Pfarrers (Joh. Carl) Spener, der von 1749 bis 1753 in Oberstein wirkte (er war ein Großneffe des berühmten<br />
Begründers des Pietismus), ehemals ein ,,gewisses Schränkchen“ im Amtsstuhl in der Kirche müßig gestanden“ habe. Da es dort<br />
nicht mehr benötigt wurde, erhielt Speners Nachfolger Friedrich Christian Steinhauer dieses Schränkchen zur Aufbewahrung der<br />
,,Kirchen−Sachen im Mai 1754 in‘s Pfarrhaus ,,in die Kammer neben der großen Stube“ gebracht. Wahrscheinlich ist mit dem<br />
Amtsstuhl der ,, Holzkäfig“ mit der Bank für den Pfarrer gemeint, welche sich noch bis 1927 in der <strong>Felsenkirche</strong> befand (vgl. Bild Nr.<br />
23 − unten vor der Kanzel).<br />
Auch nach der Wiederherstellung des Gotteshauses fanden weitere Beerdigungen im Inneren statt:<br />
o) Georg Philipp Graeckmann (1685 − 1748), von 1717 − 1748 Pfarrer zu Oberstein.<br />
p) Joh. Lorenz Stutz (gest. 1760), von 1758 − 1760 leiningischer Rat und Amtmann in Oberstein.<br />
q) die Schwiegermutter des Rats Stutz.<br />
r) Eleonora Dorothea Graeckmann (1690 − 1768), Ehefrau des ehemaligen Pfarrers.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Als im Oktober 1774 der alte Amtmann Joh. Philipp Jaeger starb (er amtierte von 1729 − 1758 und von 1766 bis zu seinem Tode<br />
auf dem Schloss in Oberstein), ordnete sein Sohn und Nachfolger Christian Carl Jaeger die Beisetzung − wie bislang immer üblich<br />
− im Inneren der <strong>Felsenkirche</strong> an. Er wählte dazu einen Platz bei den − damals noch vorhandenen − Grabplatten Mundert (s.<br />
Buchst. a) und Schellard (s. Buchst. f) vor dem Altar aus. Dazu mussten beide Steine durch den Maurermeister Johannes Saling<br />
gehoben werden. Unter<br />
dem Ersten fand man ,,fast nichts“, unter dem Zweiten jedoch einen Ring und ein<br />
verrostetes Messer; schließlich aber daneben ein offensichtlich herrschaftliches Grab mit<br />
einem in Gold gefassten diamantenen Ring mit einem Dolch, dann ein starker Knochen<br />
und seidene Kleider“.<br />
22
Bilder 26 und 27: Oberstein vor und nach 1855 / 58<br />
Zwei Holzstiche aus zeitgenössischen französischen bzw. englischen Veröffentlichungen;<br />
links: Oberstein vor dem Brand des Schlosses 1855; rechts: nach der Umgestaltung der Felsenkirchturmspitze 1858<br />
Der Eklat war da: Die nunmehrigen Landesherrn, die Grafen von Limburg−Styrum, Nachkommen von Wilhelm Wirich von<br />
Daun−Oberstein, versuchten Christian Carl Jaeger wegen ,,Beleidigung der Asche und Störung Höchstderer großmütterlicher<br />
Ahnen“ zur Rechenschaft zu ziehen. Dieser verteidigte sich mit dem Hinweis, beim Abheben der Grabplatten habe man ,,kein<br />
Gewölb noch sonstige Mauern“ gefunden − im Gegenteil, nichts habe auf eine besondere Bestimmung des Platzes hingedeutet;<br />
man sei lediglich auf ,,längst verweste kleine Stücke einer hölzernen Totenlade“ gestoßen.<br />
Bild 28: Fassung der Quelle an der Rückwand der <strong>Felsenkirche</strong><br />
Er führte ferner aus: ,,Gleich denn ohnehin eine bekannte Sache ist, daß die in der Kirche liegenden Steine um so weniger ein<br />
gewisses Begräbnuß anzeigen, als sie mehrmals von einem Ort zum anderen verlegt worden sind“ ,,Er rechtfertigte seine<br />
Handlungsweise außerdem mit einem Verweis auf die bisher in dieser Hinsicht geübte Praxis: ,,Es ist eine kundbare und deren<br />
Kinder auf der Gaß bekannte Sach, daß die protestantischen Beamten und Geistlichen zu Oberstein in daßiger protestantischer<br />
Kirche ihr Begräbnuß haben“. Die Landesherrschaft konnte Jaeger jun. zwar keine absichtliche Grabschändung nachweisen, doch<br />
wurde sowohl für seinen Vater als auch für künftige Zeiten ein für alle Mal eine Beerdigung im Inneren der <strong>Felsenkirche</strong> untersagt.<br />
Ab 1792, spätestens jedoch 1798, ging es endgültig mit der Feudalzeit in der ,,Herrlichkeit Oberstein“ zu Ende. Erneut überfluteten<br />
französische Kriegsvölker − diesmal waren es die Revolutionsheere − das Nahegebiet. Die vielen kleinen Fürsten wurden verjagt,<br />
die höheren Beamten folgten ihnen vielfach gleich auf dem Fuße, und das Land kam offiziell zum französischen Staat. Man wurde<br />
nun hier aller Errungenschaften, aber auch aller Nachteile der französischen Umwälzung teilhaftig, wozu nicht nur ein neues<br />
Rechtssystem, sondern auch eine Umfunktionierung der Religion gehörten. In diesem Zusammenhang wurde die christliche<br />
Zeitrechnung abgeschafft und ein neuer Revolutionskalender eingeführt. Das Neue Schloss Oberstein wurde als Nationalgut an<br />
Privatleute versteigert; das angestammte Gotteshaus jedoch blieb der Pfarrei erhalten. Aus diesen unruhigen Zeiten ist bezüglich<br />
der <strong>Felsenkirche</strong> folgende Nachricht überliefert:<br />
,,Vor und während des Französischen Revolutionskrieges fand sich noch eine große Tafel vor, welche mit<br />
Papier bedeckt, worauf eine Beschreibung mit lateinischen Lettern gedruckt war. Eine übel verstandene<br />
Ökonomie ließ die Tafel zu Kirchenstühlen benutzen, und das Papier wurde zerrissen − wahrscheinlich mit ihm<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
23
ein Teil der Geschichte Oberstein oder sonst einer Merkwürdigkeit“.<br />
Bilder 29 und 30: Die Turmhaube der <strong>Felsenkirche</strong> vor und nach der Renovierung 1928/29<br />
Felsstürze und Neubaupläne im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts<br />
Mit den geänderten politischen Verhältnissen war auch eine neue Kirchenorganisation verbunden. Erst zu jener Zeit erfolgte die<br />
rechtliche Gleichstellung aller Konfessionen. Durch Verfügung des Birkenfelder Unterpräfekten verlor die <strong>Felsenkirche</strong> 1804 ihr ,,<br />
Läuteprivileg“. Am 26. Floréal des VIII. <strong>Jahre</strong>s der französischen Republik − es war dies der 16. Mai 1805 alter Zeitrechnung −<br />
wurde ein lutherisches Lokalkonsistorium Idar gegründet, dem auch die Pfarrei Oberstein unterstand. Dem Leitungs− und<br />
Aufsichtsorgan dieser Institution gehörten neben sämtlichen Pfarrern der betroffenen Gemeinden auch sog. Notabeln an, die aus<br />
der Gruppe der 25 höchstbesteuerten Familienväter gewählt wurden. Aus Oberstein saß aus diesem Grunde neben dem alten<br />
Pfarrer Bartz auch der wohlhabende Handelsmann Georg Caesar, der 1807 wieder gewählt wurde.<br />
Am 17. Januar 1809 tagte das Lokalkonsistorium erstmals in Oberstein, und zwar im Pfarrhaus am Marktplatz. Der seit 1769 hier<br />
amtierende Geistliche Joh. Philipp Bartz wurde in dieser Sitzung einstimmig an Stelle des verstorbenen ehemaligen<br />
Spezialsuperintendenten Joh. Gottlieb Gottlieb aus Idar − welcher der Sohn eines 1725 in der <strong>Felsenkirche</strong> getauften Juden war −<br />
zum Lokalkonsistorialpräsidenten gewählt. Auf Antrag von ihm wurde in der gleichen Sitzung ein weiteres weltliches Mitglied,<br />
nämlich der Friedensgerichtsschreiber Huber aus Oberstein, in dieses Gremium berufen. Präsident Bartz starb allerdings nach<br />
dreimonatiger Amtszeit am 24. April 1809. Zu Beginn eines Gottesdienstes in der <strong>Felsenkirche</strong> erlitt er einen Schlaganfall.<br />
Nachfolger als Obersteiner Pfarrer wurde Johannes Lichtenberger, der − jedoch vergeblich − für das Amt des<br />
Konsistorialpräsidenten kandidierte.<br />
Das Idarer Lokalkonsistorium bestand nach dem Ende der Franzosenzeit 1813/14 fort. Das Land an der oberen Nahe kam<br />
zunächst unter eine gemeinsame österreichisch−bayerische Verwaltung 1814/15, danach kam Oberstein für 1½ <strong>Jahre</strong> zu Preußen<br />
und wurde sogar Sitz eines preußischen Landkreises. Der ehemalige Rhaunener Notar Ludwig Weyrich, der seit 1817 als<br />
weltlicher Adjunkt der lutherischen Kircheninspektion des Arrondissements Birkenfeld fungierte, nahm in seiner Eigenschaft als<br />
landrätlicher Kommissar die Vereidigung der Pfarrer auf den preußischen Staat vor. 1817 schließlich fiel Oberstein mit einem<br />
großen Teil des Gebietes an der oberen Nahe als ,,Fürstentum Birkenfeld“ infolge einer Entscheidung des Wiener Kongresses an<br />
das ferne Herzogtum Oldenburg. Alle glaubten damals an eine Übergangslösung; doch sollte sich zeigen, dass diese immerhin 120<br />
<strong>Jahre</strong> bis 1937 Bestand hatte. Das Idarer Lokalkonsistorium ging 1817 organisch in der neuen Birkenfelder Landeskirche auf, die<br />
erst 1934 in die Rheinische Kirche überführt wurde.<br />
Die oldenburgische Zeit ist heute noch bei der Bevölkerung − gewiss durch den zeitlichen Abstand mitbedingt − in guter<br />
Erinnerung. In dem Kleinstaat herrschte, obgleich er erst 1849/52 über eine Verfassung verfügte, ein verhältnismäßig liberaler<br />
Geist; das Militär spielte nicht eine so aufdringliche Rolle wie im benachbarten Preußen, und auch die Steuern waren nicht so hoch.<br />
In den ersten <strong>Jahre</strong>n der oldenburgischen Zeit hören wir auch 1826 erstmals nähere Einzelheiten über die − gewiss viel ältere −<br />
Quelle in der <strong>Felsenkirche</strong>, in der sich heute nur mehr Sickerwasser sammelt (Bilder Nr. 12 und Nr. 28). Sie steht möglicherweise<br />
ursächlich in Verbindung mit der natürlichen Höhle im Fels, in die man später die Kirche baute. Die Nachricht lautet:<br />
,,In der Kirche befindet sich ein Brunnen, dessen klares Wasser aus dem Felsen hervorkommt. Hinter ihr ist die<br />
Felsenhöhle noch etwas erweitert, sodass man um sie herumgehen und das unten liegende Oberstein<br />
übersehen kann“.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Im 19. Jahrhundert wurde die <strong>Felsenkirche</strong> mehrfach durch herabstürzende Felsstücke beschädigt. Bereits 1836 tauchte aufgrund<br />
einer Anregung der Birkenfelder Kirchenvisitations−Kommission der Plan zum Bau eines neuen Gotteshauses im damaligen<br />
Pfarrgarten (gegenüber dem heutigen Kirchplatz an der Christuskirche; Bereich Tengelmann) auf. Stadtbürgermeister Caesar<br />
24
stellte − offenbar in seiner Eigenschaft als Privatmann − dafür eine Beihilfe von 300 Louisdor in Aussicht. Er war nebenbei noch als<br />
Geschäftsmann tätig und lebte in ,,notorisch glänzenden Verhältnissen“. Nachdem Caesar jedoch sein dem geplanten Bauplatz<br />
gegenüberliegendes Haus verkauft hatte, weigerte er sich, diese Summe zu geben, da er an dem Platz kein Interesse mehr hatte.<br />
1838 wurde die <strong>Felsenkirche</strong> erneut durch herabfallende Felsen getroffen. Da die Neubaufrage nach wie vor an den Kosten<br />
scheiterte, entschloss man sich wieder zu einer Reparatur.<br />
Ähnlich lagen die Verhältnisse nach einem Felssturz 20 <strong>Jahre</strong> später. Diesmal war die Turmspitze stark in Mitleidenschaft gezogen.<br />
Bei der Wiederherstellung wurde die möglicherweise noch aus gotischer Zeit stammende Turmhaube stark verändert. Bislang hatte<br />
sie eine wesentlich schlankere Form und nur ein kleines Seitentürmchen. Nun wurden gleich drei derartige Aufbauten mit großen<br />
Schalllöchern angebaut, wodurch der gesamte Turm ein plumpes, unvorteilhaftes Aussehen erhielt.<br />
Die Umgestaltung des Turmes von 1858 sowie die Zerstörung des neuen Schlosses durch einen Brand im <strong>Jahre</strong> 1855 bilden<br />
immer gute Anhaltspunkte zur zeitlichen Einordnung der zahllosen Gemälde von Oberstein aus dem 19. Jahrhundert, wie die<br />
beiden hier wiedergegebenen Bilder zeigen (s. Bild Nr. 26 und Nr. 27). Im Inneren der Kirche wurden im Zusammenhang mit der<br />
Reparatur links neben dem Epitaph die vorstehenden Felsen weggesprengt und an deren Stelle eine gerade Mauer aufgeführt.<br />
Bild 31: Blick ins Innere der <strong>Felsenkirche</strong> um 1900.<br />
Neben der Orgel ist zu erkennen, wo sich damals das Altarbild und das Sebastiansbild befanden.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Damals ging man auch die oldenburgische Regierung wegen einer Felsbereinigung über der Kirche an. Die Obersteiner Pfarrei sah<br />
darin eine staatliche Pflicht, doch fand der Birkenfelder Baumeister Meyer einen Grund, sich dieser Forderung zu entziehen.<br />
Doch auf Dauer konnten sich die Oldenburger nicht völlig sperren. Immerhin war und ist ein Teil des Kirchfelsens staatliches<br />
Eigentum. Bei einer Felsbereinigung im <strong>Jahre</strong> 1895 beteiligte sich denn auch der Staat an den Kosten. Schäden an der Kirche<br />
entstanden bei dieser Maßnahme ebenso wenig wie bei der Ablösung größerer Steine neben dem Turm um 1900. Bei dieser<br />
Gelegenheit erhielt der Turm einen neuen Hahn mit einer Kugel. Die Turmuhr gehörte übrigens kurioserweise der politischen<br />
Gemeinde Oberstein. Sie muss sehr alt gewesen sein, wenn sie auch nicht − wie einmal behauptet wurde − aus der Erbauungszeit<br />
der Kirche stammen könnte. Um 1900 verfügte sie noch über ein gutes Gangwerk, ließ sich aber nach Auffassung eines<br />
Turmuhrsachverständigen 1929 nicht auf Elektrizität umstellen, weshalb man sie damals durch ein modernes Werk ersetzte.<br />
Infolge der permanenten Gefährdung der Kirche, der unzureichenden Heizmöglichkeiten und der rapid wachsenden<br />
Bevölkerungszahl von Oberstein reiften um die Mitte des vorigen Jahrhunderts Pläne für einen Neubau im Tale heran. 1862 erteilte<br />
das großherzoglich oldenburgische Konsistorium in Birkenfeld die Erlaubnis zur Errichtung eines Kirchenbaufonds. Wie umstritten<br />
diese Pläne jedoch innerhalb der Gemeinde waren, zeigt die Tatsache, dass die Entscheidung nur mit 13 gegen 12 Stimmen<br />
gefasst wurde und mit der Auflage verbunden war, mit einem Neubau erst zu beginnen, wenn der Fonds ein Kapital von 40000<br />
Talern beinhalte.<br />
Der damalige Gemeindepfarrer, der um das Obersteiner Schulwesen hochverdiente spätere Weimarer Oberschulrat und<br />
Superintendent Dr. phil. Carl Otto Schmidt (1817 − 1878), erließ 1862 sowohl an die eigene Gemeinde als auch ,,für fremde<br />
Länder“ (in deutscher, englischer und französischer Sprache) einen Spendenaufruf zum Bau einer zweiten evangelischen Kirche in<br />
Oberstein. Darin wird die <strong>Felsenkirche</strong> wenig freundlich geschildert: ,,Die Luft in der Kirche ist (....), weil es an der rechten Lüftung<br />
fehlt, dumpf und beengend; in heißen Sommern ist sie kalt (. . . .). Im Sommer vergeht selten ein Gottesdienst, ohne daß es<br />
jemand unwohl wird (....). Ihre innere Einrichtung ist so winkelig, daß Störungen der Andacht oft unbemerkt bleiben<br />
Beim Weggang von Pfarrer Schmidt 1865 waren erst 1.078 Mark im Kirchenfonds. 1877 wurde die Genehmigung zu einer<br />
jährlichen Hauskollekte für den Kirchenbau erteilt. 1878 errichtete der damalige Obersteiner Gemeindepfarrer Carl Heinrich Ludwig<br />
(1819− 1899) eine sogen. ,,Elisabeth−Stiftung“, welche durch Verlosung von Wertgegenständen − insbesondere der heimischen<br />
Industrie − Mittel sammeln sollte. Diese konnten sowohl für einen Neubau als auch später ,,bei Unterhaltung und Verschönerung<br />
der <strong>Felsenkirche</strong> weitere Hülfe leisten“. Der Name dieser Stiftung beruhte auf der irrigen Annahme, die Gemahlin des verhassten<br />
Grafen Christian Carl Reinhard, ,,an deren Hof zu Heidesheim zuerst der Gedanke, eine Kirche in das Tal der Stadt Oberstein zu<br />
bauen, und dazu Mittel zu beschaffen ausgesprochen wurde“, sei Anna Elisabeth von Daun−Oberstein gewesen. In Wirklichkeit<br />
25
hieß diese Frau Gatharina Polyxena, eine geborene Gräfin zu Solms−Rödelheim, welche seinerzeit herzlich wenig für die<br />
<strong>Felsenkirche</strong> bzw. für einen Ersatzbau getan hatte.<br />
Bild 32: Die geplante neue Obersteiner Kirche<br />
Entwurf von Reg.−Baumeister Senz aus Köln, 1910<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Die neue Stiftung führte zunächst eine Wertlotterie durch, deren erste Ziehung am 19. und 20. September 1881 stattfand. Der<br />
Erfolg scheint nicht groß gewesen zu sein. In der Folgezeit wurden noch mehrere vergebliche Versuche zur Ansammlung der<br />
notwendigen Kapitalien unternommen. Der Birkenfelder Geschichtsforscher Dr. med. Christoph Friedrich Upmann stellte der<br />
Stiftung 200 Exemplare seines Buches über die ,,Grafschaft Oberstein“ zur Verfügung. Berta Demeaux gründete einen sogen.<br />
,,Pfennig−Verein“; doch nennenswerte Summen kamen in keinem Falle zusammen. Im <strong>Jahre</strong> 1894 konnte man schließlich für<br />
54.422 Mark ein Gelände in der Hauptstraße (im Bereich des Hauses Demeaux) erwerben, wozu noch 1909 weitere Grundstücke<br />
für 23000 Mark gekauft und konkrete Pläne für eine Bebauung gemacht wurden. Im <strong>Jahre</strong> 1914 fasste man endlich den Beschluss,<br />
mit dem Kirchenneubau im Frühjahr 1916 zu beginnen, wobei die Bausumme auf 250.000 Mark begrenzt wurde. Doch dann kam<br />
der Erste Weltkrieg.<br />
Für das vorige Jahrhundert wären noch folgende Nachrichten nachzutragen: 1843 vereinigten sich Lutheraner und Reformierte zu<br />
einer unierten Landeskirche im Fürstentum Birkenfeld. Da es in den vorangegangenen Jahrhunderten so gut wie keine Reformierte<br />
in Oberstein gegeben hatte, war es diesbezüglich auch nie zu konfessionellen Streitigkeiten gekommen. Im <strong>Jahre</strong> 1846 entstand in<br />
Oberstein eine deutsch−katholische Gemeinde. Die Initialzündung zu dieser Bewegung war von der Heilig−Rock−Ausstellung in<br />
Trier 1844 bzw. vom Protest des Kaplans Johannes Ronge (1813 − 1887) − der angeblich einmal in Oberstein gewesen sein soll −<br />
ausgegangen. Die Deutsch−Katholiken suchten um ein Mitbenutzungsrecht der <strong>Felsenkirche</strong> nach, was ihnen jedoch vom<br />
Großherzog von Oldenburg verweigert wurde.<br />
Am 27. November 1872 kam es zu einer offiziellen Spaltung der katholischen Kirchengemeinde in Oberstein. Zahlreiche Mitglieder<br />
gründeten die Gemeinde der Altkatholiken, die mit dem vom Papst verkündeten Dogma des 1. vatikanischen Konzils nicht<br />
einverstanden waren. Interessanterweise wurde den Altkatholiken zeitweise eine Mitbenutzung der <strong>Felsenkirche</strong> gestattet. Zugleich<br />
kämpfte die 200 Mitglieder starke Gruppe, welche offenbar zunächst in Oberstein stärker war als die dem Papst treu gebliebene<br />
Gemeinde, um die Mitbenutzung der 1855 − 58 neuerbauten katholischen Kirche in Oberstein, ,,was praktisch ein Alleineigentum<br />
der Altkatholiken bedeutet hätte“. Durch das Wohlwollen des protestantischen Großherzogs und die geschickte Taktik katholischer<br />
Landtagsabgeordneter war auch dieses Ansinnen zum Scheitern verurteilt.<br />
26
Bild 33: Die <strong>Felsenkirche</strong> 1927<br />
Am 10. Dezember 1876 wurde dann offiziell die heute noch bestehende ,,Deutsch−katholische freireligiöse Gemeinde Oberstein“<br />
gegründet, die sich zunächst vor allem aus ehemaligen katholischen Bürgern und 1848er−Revolutionären zusammensetzte. Auch<br />
diese neue Glaubensrichtung erlangte kein Mitbenutzungsrecht an einem der Obersteiner Gotteshäuser.<br />
Der Ort Oberstein durfte sich seit 1865 Stadt nennen, erhielt aber erst 1902 eine städtische Verfassung und einen hauptamtlichen<br />
Bürgermeister. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg wurde am 11. November 1918 in der alten Turnhalle in Oberstein − wie auch<br />
in Oldenburg − ein Arbeiter− und Soldatenrat ausgerufen. Das ehemalige Fürstentum Birkenfeld wurde Provinz des neuen<br />
Freistaates Oldenburg, an dessen Spitze für einige Monate ein Direktorium stand. In Birkenfeld kam es im folgenden Jahr zu einer<br />
sogen. Revolution, einem unblutigen separatistischen Putsch, der zu einer freien Republik Birkenfeld führen sollte. In den dazu<br />
ausgeschriebenen Wahlen von 1919 erlebten die Separatisten jedoch eine vernichtende Niederlage gegen alle vereinigten<br />
demokratischen Kräfte, welche anschließend den linksliberalen Idarer Rechtsanwalt Walther Dörr (1879−1964) zum neuen<br />
Regierungspräsidenten wählten.<br />
Die Renovierung 1927/29<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
In einer Zeit, als man an einen Neubau immer noch nicht denken konnte, als die linken Rheinlande wieder von Franzosen besetzt<br />
und Deutschland von wirtschaftlichen und politischen Krisen geschüttelt wurde, stellte sich heraus, dass die <strong>Felsenkirche</strong> wegen<br />
Baufälligkeit einer dringenden Renovierung bedurfte. Der kunstsinnige Regierungspräsident Walther Dörr hat sich um die Rettung<br />
dieses einmaligen Bauwerkes bleibende Verdienste erworben.<br />
Im <strong>Jahre</strong> 1926 forderte er den Obersteiner Stadtbaumeister Schlossbauer und den in Langen bei Darmstadt lebenden Architekten<br />
Wilhelm Heidrich zu einem Gutachten über den baulichen Zustand der Kirche auf. Beide getrennt erhobenen Baubefunde<br />
unterstrichen beängstigend die Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung. ,,Das Wasser der Quelle im Kircheninneren lief über<br />
die zur Empore führenden Stufen und steigerte den ohnehin sehr hohen Feuchtigkeitsgehalt der Luft außerordentlich. Sämtliches<br />
Holzwerk, Verschalungen, Gestühl, Emporenbrüstungen, selbst tragende Holzteile waren von Fäule so zerrissen, dass der Besuch<br />
der Kirche mit Lebensgefahr verbunden war. Da sich die Kirchengemeinde selbst — wie so oft in ihrer Geschichte − nicht in der<br />
Lage sah, die erforderlichen Mittel aufzubringen, und die Inflation den Kirchenbaufonds längst verschlungen hatte, bemühte sich<br />
Dörr sofort um Abhilfe: ,,Es galt, einen Plan zu schaffen, das Baukapital sicherzustellen und dann zur Ausführung des Werkes zu<br />
schreiten. Jede dieser Sonderaufgaben bot ihre eigenen Schwierigkeiten“.<br />
27
Bild 34: Schildmauer und große Fenster<br />
Den Planungsauftrag erhielt der mit Dörr gut bekannte Architekt Heilig, der in den 20er−<strong>Jahre</strong>n zahlreiche öffentliche Aufträge im<br />
Birkenfelder Land (Besatzungshäuser in Idar, Kriegerdenkmale in Herrstein, Hoppstädten u. a., Bürgermeistereigebäude in<br />
Niederbrombach, Jugendherberge auf Burg Birkenfeld, Bebauungspläne für Idar, Birkenfeld, Herrstein u.a.m.) erhalten hatte. Heilig<br />
war ein hervorragender Architekt, dessen ,,Handschrift“ noch heute an der oberen Nahe unverkennbar ist. Er schrieb übrigens<br />
auch ein Buch zum Thema ,,Stadt− und Landbaukunde“ (Berlin 1935).<br />
Bild 35: Gedenktafel für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Zunächst galt es für Walther Dörr, die Mittel für die Sanierung sicherzustellen. Das Oldenburger Finanzministerium war dem Plan<br />
gewogen. Der Birkenfelder Landesausschuss stellte im Haushalt für 1927 40.000 Mark bereit, und die Staatsregierung in<br />
Oldenburg legte aus der Zentralkasse noch einmal 20.000 Mark hinzu. Der Reichsminister für die besetzten Gebiete sowie der<br />
Reichsinnenminister förderten das Vorhaben direkt, während sogar der Preußische Minister für Volkswohlfahrt einen ,,namhaften<br />
Betrag“ aus einer preußischen Sammellotterie beisteuerte. Selbstverständlich mussten auch Kirchengemeinde und Konsistorium<br />
zu den Kosten beitragen. Vorsitzender des Kirchenvorstandes war in jenen <strong>Jahre</strong>n Pfarrer Otto Roth (1867 − 1934), der vor Ort mit<br />
,,praktischem Sinn“ und seiner Fähigkeit zu sachlicher Arbeit“ sehr kooperativ mit dem eigentlichen Träger der Gesamtrenovierung,<br />
der oldenburgischen Regierung in Birkenfeld, zusammenarbeitete.<br />
Es ist wohl auch Regierungspräsident Dörr zu verdanken, dass das bedeutendste Stück des Kircheninventars, das mittelalterliche<br />
Altarbild, in seinem Wert damals erkannt wurde. Ihm war bei seinen Besuchen in den Nachkriegsjahren das Triptychon aufgefallen,<br />
das damals − übrigens ebenso wie das Sebastiansbild − völlig unbeachtet hoch oben neben der Orgel hing ( Bild Nr. 31). Er<br />
befürchtete in dem feuchten Raum den Untergang des Werkes und machte erstmals − zunächst ohne Erfolg − verschiedene<br />
öffentliche Stellen sowie den Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz darauf aufmerksam. Bestärkt wurde er in<br />
seinen Bemühungen von seinem Jugendfreund, dem bekannten Kunstmaler Rudolf Wild−Idar (1871 − 1960). Im <strong>Jahre</strong> 1926 lud<br />
Dörr den ehemaligen Konservator des Oldenburger Augusteums zur Besichtigung des Bildes ein. Dieser bestätigte zwar die<br />
Befürchtungen bezüglich der Gefährdung des Gemäldes, betonte auch die Pflicht zur Erhaltung, verkannte jedoch den<br />
tatsächlichen Wert, indem er es lediglich für eine Werkstattarbeit hielt. Dörr zog nun den Direktor des Hessischen Landesmuseums<br />
in Darmstadt, Hofrat Friedrich Back, einen Sohn des gleichnamigen Birkenfelder Gymnasialdirektors zu, der ein ,, entschiedenes<br />
kunstgeschichtliches Interesse“ zeigte und die Arbeit sogleich erstaunlich korrekt räumlich und zeitlich zuordnete. Er vermittelte den<br />
Darmstädter Restaurator Prof. Wilhelm Horst. Der Reichsminister für die besetzten Gebiete sagte 1927 einen Zuschuss für die<br />
Rettung des Bildes zu, und der Birkenfelder Maler Hugo Zang (1859 −1946) überwachte die sachgerechte Verpackung für den<br />
Transport nach Darmstadt. Nach der Restaurierung des ,,bis zur Unkenntlichkeit verwahrlosten“ Werkes wurde dieses noch im<br />
Sommer des gleichen <strong>Jahre</strong>s in der Sonderausstellung ,,Alte Kunst am Mittelrhein“ in Darmstadt gezeigt. Bei dieser Gelegenheit<br />
konnte man es mit zwei weiteren Bildern aus Mainz und Darmstadt vergleichen, welche man nunmehr ein und demselben Künstler<br />
zuschrieb, den man schon damals nach seinem bedeutendsten Werk als ,,Meister des Obersteiner Altars“ bezeichnete. Zur<br />
Wiederweihe 1929 war dann das Triptychon an seinen ursprünglichen Platz zurückgekehrt: auf den Altar der <strong>Felsenkirche</strong> in<br />
Idar−Oberstein, wo es seit dieser Zeit geblieben ist. (Bild Nr. 37).<br />
28
Bild 36: Die (Bretter) Tonnendecke im Hauptschiff von ca. 1750 − 1927<br />
Um sich ein Urteil über die Gesamtrenovierung 1927 /29 der Kirche bilden zu können, vergleiche man am besten die Bilder vor und<br />
nach der Umgestaltung. (s. Bild Nr. 23, Nr. 29, Nr. 30, Nr. 31, Nr. 36, Nr. 37 und Nr. 39). Die Gefährdung des Gotteshauses war in<br />
Wirklichkeit noch größer, als man ursprünglich angenommen hatte. Diese technischen Probleme bekam man hervorragend in den<br />
Griff, (s. Bilder Nr. 4 und Nr. 5); die Kirche blieb erhalten. Architekt Heilig hat andererseits aber zu wenig Respekt vor der<br />
historischen Leistung seiner Vorgänger gehabt, zu sehr den Bau dem Stil seiner Zeit angepasst und seinen persönlichen Stempel<br />
aufgedrückt. Von Denkmalpflege in unserem heutigen Sinne verstand er wenig.<br />
Bild 37: Das Hauptschiff heute<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Interessant − auch darin wird ein Wandel der Anschauungen deutlich − sind die Kritikpunkte von 1929 im Vergleich zur Gegenwart.<br />
Damals bemängelte man die Ausführung der neu geschaffenen Ehrentafel mit den Namen der im Ersten Weltkrieg gefallenen<br />
Söhne der Gemeinde (s. Bild Nr. 35) und den Außenputz. Die Gedenktafel war den Menschen jener Zeit zu schlicht, zu wenig<br />
imposant. Besonders aber regte man sich über die Farbe des Außenputzes auf, welche Heilig durchaus mit Bedacht in einem<br />
grau−grünen Ton gehalten hatte. Das war eben damals für die Obersteiner ebenso ungewohnt wie die fast weiße Farbe, welche<br />
man nunmehr nach der Felsbereinigung in unseren Tagen wählte.<br />
Aber an Farben kann man sich gewöhnen, zumal derartige ,,Fehler“ später verhältnismäßig leicht wieder zu korrigieren sind. Heute<br />
stören ganz andere Dinge. Da wäre an erster Stelle die Neugestaltung der Turmspitze zu nennen, welche der Architekt mit der<br />
Entschuldigung vornahm, sie sei ja ohnehin nicht mehr original gewesen. (s. Bilder Nr. 29 und Nr. 30). Die neue Form erinnert aber<br />
viel mehr an Heilig (man vergleiche den Dachreiter auf der Bürgermeisterei in Niederbrombach oder die Kirchturmspitze von<br />
Georg−Weierbach) als an die Gotik. Unverantwortlicherweise wurden auch die auf alten Fotos noch zu sehenden − fast romanisch<br />
anmutenden − Schalllöcher zugemauert. (s. Bilder Nr. 24 und Nr. 33). Was innen noch heute besonders negativ auffällt, sind die<br />
Beleuchtungskörper (s. Bild Nr. 36), das Gestühl und die Inschriften (z.B. der völlig stilwidrige Text unter dem Altarbild, s. Bilder Nr.<br />
37 und Nr. 39), die alle einiges über die Zeit der Renovierung aussagen und kaum Rücksicht auf den Befund und die Tradition des<br />
Bauwerkes nehmen.<br />
29
Bild 38: Christuskirche in Oberstein<br />
nach Plänen von Prof. R. Krüger, Saarbrücken, 1965 errichtet<br />
Nun sollte man allerdings einem allein die Schuld nicht geben. Der preußische Generalkonservator Ministerialrat Dr. Hiecke aus<br />
Berlin begutachtete alle Pläne Heiligs und überwachte sogar deren Ausführung. Im oldenburgischen Finanzministerium war man<br />
gleichfalls damit voll einverstanden. Jedes Bauwerk atmet eben den Geist seiner Zeit, und wenn lange und häufig daran<br />
herumgebaut wurde, wird eben der Geschmack vieler Zeiten sichtbar, und so sind in gewisser Weise auch die Veränderungen an<br />
der <strong>Felsenkirche</strong> von 1927 /29 inzwischen schon zu einem Denkmal geworden.<br />
Die <strong>Felsenkirche</strong> in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Zwei Weltkriege verwüsteten große Teile Europas in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zu direkten Kampfhandlungen kam es<br />
dabei in Idar−Oberstein im Gegensatz zu früheren Jahrhunderten nicht. Trotzdem waren Elend und Not groß. Der Kuriosität halber<br />
mag erwähnt werden, dass die <strong>Felsenkirche</strong> im Zweiten Weltkrieg als öffentlicher Luftschutzbunker diente, womit die Nutzung<br />
quasi an die Zeit vor <strong>500</strong> <strong>Jahre</strong>n anknüpfte. Vor 1939 war es zu dem seit rund 100 <strong>Jahre</strong>n geplanten Bau einer zweiten<br />
evangelischen Kirche in Oberstein nicht mehr gekommen, und nach 1945, während der Inflation, der amerikanischen und<br />
französischen Besatzungszeit, konnte man zunächst auch nicht daran denken.<br />
Doch nichts auf der Welt hat ewigen Bestand, und so gingen nun auch die Not− und Hungerjahre einmal wieder zu Ende. Im <strong>Jahre</strong><br />
1960 hatte die evangelische Kirchengemeinde Oberstein Geld genug, um den Neubau eines Gottes− und Gemeindehauses auf<br />
dem schon zu Beginn des Jahrhunderts erworbenen Gelände, Hauptstraße 392 − 394, in Angriff zu nehmen. Unter vier<br />
,,gutachtlichen Vorentwürfen für den Bau eines Gemeindehauses mit Kirchsaal“ wurde ein Plan von Regierungsbaumeister Prof.<br />
Rudolf Krüger ausgewählt und in den <strong>Jahre</strong>n 1961 − 65 die heutige Christuskirche errichtet. Die Gesamtkosten des Projekts<br />
beliefen sich bis zum Tage der Einweihung auf 1.635.795,31 DM.<br />
Ob man heute − nach weniger als 40 <strong>Jahre</strong>n − wieder so bauen würde, sei dahingestellt. Auf Kritik stoßen nach wie vor der<br />
mächtige Glockenturm und die vielen Treppen, welche man eigentlich im Hinblick auf die <strong>Felsenkirche</strong> vermeiden wollte (s. Bild Nr.<br />
38).<br />
Diese trat mit dem Neubau an der Hauptstraße zunächst in den Hintergrund: Sie ist seit dieser Zeit nicht mehr die Hauptkirche der<br />
Gemeinde, was sie fast <strong>500</strong> <strong>Jahre</strong>, selbst bei wechselnden Bekenntnissen, gewesen war. Seit 1965 finden nunmehr hier nur noch<br />
in den Sommermonaten Kurzgottesdienste statt, und natürlich wird − wegen der schönen historischen Kulisse − das alte<br />
Gotteshaus gern als Hochzeitskirche benutzt. Es gibt aber inzwischen viele Einheimische und Neubürger, welche sie noch nie von<br />
innen gesehen haben.<br />
Parallel dazu aber gewann das Bauwerk aus ganz anderer Sicht immer mehr an Bedeutung. Die Zahl der Touristen aus aller Welt<br />
ist ständig im Steigen begriffen; bald werden es 150.000 Besucher im Jahr sein, welche den nach wie vor mühsamen Aufstieg zur<br />
<strong>Felsenkirche</strong> nicht scheuen und auch Verständnis dafür haben, dass hier im Gegensatz zu katholischen Gotteshäusern − ein<br />
Eintrittsgeld erhoben wird. Die <strong>Felsenkirche</strong> ist zum bestbesuchten kunsthistorischen Museum an der oberen Nahe geworden.<br />
Wie sehr sich auch Zeiten und Anschauungen ändern mögen, es gibt Probleme, die immer die gleichen bleiben. Und dazu gehören<br />
auch die geologischen Verhältnisse dieser Gegend: ,,Die verschiedene Richtung und Ausbildung der (. . . .) Kluftsysteme, die<br />
Ergussgesteine mit ihrer unterschiedlichen Festigkeit, die Witterungseinflüsse, der Kluftwasser− und Strömungsdruck und die<br />
Schwerkraft sind Hauptursache der Steinschläge und Felsstürze am Schlossfels in Oberstein‘‘.<br />
Am 6. August 1946 löste sich erneut eine größere Gesteinsmasse, ohne jedoch der Kirche zu schaden. Mitte der 70er<strong>Jahre</strong><br />
zwangen einige kleinere Steinschläge die Behörden wieder einmal zum Handeln. Die Eigentümer des Kirchfelsens − die<br />
Evangelische Kirchengemeinde Oberstein, die Stadt und das Land<br />
Idar−Oberstein Rheinland−Pfalz − hätten im Zweifelsfall bei Schäden haftbar gemacht werden können, daher fand man sich 1977<br />
zu einer Kostenteilung für die umfassendsten Felssanierungen in der Geschichte der <strong>Felsenkirche</strong> zusammen.<br />
30
Geologische Gutachten werden erstellt, Vermessungen und Fallversuche durchgeführt. Schließlich baute man 1978/79 schwere<br />
Fangzäune mit bis zu 6 m hohen Stahlträgern im Abstand von 3 m mit einem Eigengewicht von bis zu 700 kg sowie waagerecht<br />
laufenden Stahlseilen mit einem Durchmesser von 2 cm und einer Bespannung aus Steinschlagschutzmatten.<br />
Darüber hinaus wurde eine Sanierung der gesamten Felswand durchgeführt, wozu eine Arbeitsgemeinschaft auswärtiger<br />
Fachfirmen mit Beginn des <strong>Jahre</strong>s 1980 das wahrscheinlich höchste Arbeitsgerüst in Europa erstellte (Höhe 70 m). Die<br />
schlimmsten Befürchtungen bestätigten sich nun: Man fand tonnenschwere Felsbrocken, die fast lose in der Steilwand hingen. Das<br />
Gestein, das nicht zu halten war, musste mühsam von Hand zerkleinert und über das Gerüst abgefördert werden. Andere<br />
Felspartien wurden mit Sandstrahlgebläse bearbeitet, mit Baustahlgewebe überspannt, mit 1,4 m langen Steckankern befestigt und<br />
mit gefärbtem Spritzbeton überzogen. Insgesamt hat man auf diese Weise vom Gerüst aus 860 qm Felsfläche gesichert, wobei 260<br />
m³ Spritzbeton verarbeitet, 370 laufende Ankerlöcher gebohrt und 84 Felsanker gesetzt wurden.<br />
Es stellte sich allerdings heraus, dass das bereits im Betonwerk eingefärbte Material optisch überhaupt nicht mit dem Fels<br />
harmonierte, sodass an Ort und Stelle nach dem Einbau nochmals ein Anstrich mit einer Lehmbrühe zur besseren farblichen<br />
Anpassung durchgeführt werden musste. Trotzdem blieb das Ergebnis unbefriedigend. Vielleicht wird auch hier im Laufe der Zeit<br />
die natürliche Verwitterung die schlimmsten Wunden heilen.<br />
Bild 64<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Als weitere Maßnahme zur Sicherheit der Besucher der Kirche wurde nach Beendigung der Felsbereinigung im August 1980 mit<br />
einem Tunnelbau begonnen, durch den künftig der einzige Eingang zum Gotteshaus führen soll. Das Tunnelprofil hat eine Breite<br />
von 2,20 und eine Höhe von 2,50 m. Die Tunnelstrecke, welche einen Höhenunterschied von 9,50 m überwindet, ist insgesamt 38<br />
m lang und führt in einer leichten Krümmung zum Hauptschiff der Kirche. Im Frühjahr 1981 war die Gesamtbaumaßnahme<br />
,,Felssicherungsarbeiten im Bereich der <strong>Felsenkirche</strong> Idar−Oberstein“ nach dreijähriger Bauzeit abgeschlossen, und die Kirche<br />
konnte wieder eröffnet werden. Die Kosten für diese aufwendigen Maßnahmen betrugen 3.271.620,61 DM, wohl mehr, als man je<br />
im Lauf der <strong>500</strong> <strong>Jahre</strong> verbaut hatte. Diese Summe wurde im Verhältnis von 40:40:20 vom Lande Rheinland−Pfalz, der Stadt<br />
Idar−Oberstein und der Evangelischen Kirchengemeinde Oberstein aufgebracht, wobei die Stadt zu ihrem Anteil einen Zuschuss<br />
des Landes aus dem Investitionsstock in Höhe von 200.000,− DM erhielt.<br />
31
Bild 39: Blick auf die Empore<br />
Parallel zur äußeren Felssanierung, welche auch das Innere der Kirche durch Staub und Wassereinbruch in Mitleidenschaft zog,<br />
lief unter Mitwirkung des Landesamtes für Denkmalpflege eine Renovierung des Kircheninneren, der abschließend ein neuer<br />
äußerer Anstrich folgte. Fast alle alten Kunstwerke (Altarbild, Sebastiansbild, Apostelbilder, Grabplatten u.a.) wurden von Staub<br />
befreit und farblich neu aufgefrischt. Das ganze Gotteshaus erhielt einen neuen Innenanstrich, wobei die noch vorhandenen<br />
gotischen Gewölberippen nach Befund farblich abgesetzt wurden. In diesem Zusammenhang hat man auch die einzige<br />
Kopfkonsole, auf der eine Rippe des Seitenschiffgewölbes ansetzt, naturalistisch neu gefasst ( Bild Nr. 13). Diese Maßnahmen<br />
wurden in hervorragender Weise von dem Würzburger Restaurator Peter Pracher durchgeführt. Sie kosteten rund 47.000,− DM;<br />
hinzu kamen noch Ausgaben für den Innenanstrich, für eine neue Elektroinstallation u.a. in Höhe von rund 57.000,− DM und rund<br />
18.000,− DM für den Außenanstrich. Die Stadt Idar−Oberstein und das Land Rheinland−Pfalz (Landesamt für Denkmalpflege)<br />
haben sich an diesen Kosten mit 15.000,− DM bzw. 10.000,− DM beteiligt, wozu noch Spenden in Höhe von rund 15.000,− DM<br />
kamen.<br />
Die 1929 eingebaute zweimanualige Orgel war durch die Staubentwicklung der Umbauarbeiten völlig unbrauchbar geworden.<br />
Unter Verwendung alter Pfeifen lieferte Orgelbauer Günther Wienands aus Pforzheim nunmehr für rund 45.400,− DM eine<br />
moderne Elektronik−Pfeifenorgel. Fast 29.000,− DM wurden dazu durch Spenden aufgebracht. Die Glasmalerei mit dem<br />
Stifterbildnis von 1482, die sich zuletzt in der Sakristei befand, wurde 1984 wieder an ihren möglichen ursprünglichen Platz, unten<br />
in einem der großen Fenster des Hauptschiffes eingebaut. Am meisten öffentliches Aufsehen erregte − wie bereits 1929 − der neue<br />
Außenanstrich, der sich natürlich gründlich von dem bisher gewohnten Erscheinungsbild des Gotteshauses unterscheidet. Den<br />
Kritikern sollte man drei Argumente entgegenhalten: Der neue Farbton passt besser zur Entstehungszeit des Gotteshauses als der<br />
bisherige; die nun verhältnismäßig grell erscheinende Farbe wird mit der Zeit nachdunkeln; schließlich gibt es sogar historische<br />
Bilder, auf denen eine weiße <strong>Felsenkirche</strong> zu sehen ist.<br />
Zukunftsperspektiven der <strong>Felsenkirche</strong><br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Durch die Baumaßnahmen von 1977 − 81 wurde die akute Gefahrensituation im Bereich des Kirchfelsens beseitigt und durch die<br />
parallel dazu durchgeführten denkmalpflegerischen Bemühungen am Gebäude selbst das Erscheinungsbild der <strong>Felsenkirche</strong> innen<br />
und außen freundlicher gestaltet. Dennoch leidet nunmehr die Außenansicht durch Beton und Fangzäune erheblich, weshalb die<br />
Maßnahmen nach wie vor vielfach auf Kritik stoßen. Doch niemand konnte eine sichere Alternative aufzeigen. Gewiss werden auch<br />
hier − wie bereits bei der Renovierung 1927 − 29 im Laufe der Zeit die Wunden heilen. Nachdenklicher stimmt schon eine andere<br />
Feststellung der Techniker: Das Ergebnis der Sicherungsarbeiten kann nicht ewig Bestand haben. ,,Nach vergleichbaren<br />
Erfahrungen im Stahlbetonbau kann man jedoch für das Zusammenwirken von Felsanker und Spritzbeton mit einer Lebensdauer<br />
von mindestens 50 <strong>Jahre</strong>n rechnen“. Nun ist die <strong>Felsenkirche</strong> schon <strong>500</strong> <strong>Jahre</strong> alt, und wahrscheinlich wird man im nächsten<br />
halben Jahrtausend über neue technische Möglichkeiten verfügen.<br />
Man könnte sich zwar auf den Standpunkt stellen, dass sie als Gotteshaus nicht mehr gebraucht wird, doch auch dies kann sich<br />
ändern; zurzeit sind kunsthistorische Museen allerdings mehr gefragt. Vielleicht könnte die Kirche auch besser in das kulturelle<br />
Leben der Stadt zu Musikveranstaltungen, zu Festvorträgen u. Ä.. einbezogen werden.<br />
Die lange Geschichte der <strong>Felsenkirche</strong> hat gezeigt, wie wenig relevant doch vieles im menschlichen Leben, über lange Zeiträume<br />
betrachtet, ist. Wie sehr haben sich doch Glauben und Hoffnung, Handel und Wandel, Stadt und Land, Stil und Geschmack immer<br />
wieder gewandelt. Die Kirche im Fels aber ist bei alledem ein Symbol der Beständigkeit geblieben: Ein Mahnmal für die<br />
Vergänglichkeit der Welt: (1624: ,,Wenn ich auch Großes gewesen bin, so hat doch alles der Tod geraubt“) für mehr Toleranz unter<br />
den Menschen: (1698: ,,damit der Pfaff nicht hereinkönne“).<br />
32
Bild 40: Blick auf die <strong>Felsenkirche</strong> 1983<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
33
Max Rupp: Das Altarbild<br />
Ein bedeutendes Werk mittelalterlicher Tafelmalerei ist das Altarbild in der <strong>Felsenkirche</strong>. Da es, bis zur Unkenntlichkeit verwahrlost<br />
und in zu großer Höhe aufgehängt, nicht zur Betrachtung einlud, schenkte man ihm die gebührende Beachtung erst, als die<br />
Renovierung der Kirche akut wurde. Friedrich Back, Direktor beim Hessischen Landesmuseum Darmstadt, bescheinigte ihm ,,ein<br />
entschiedenes kunstgeschichtliches Interesse“, es wurde sachverständig restauriert und stand bei der Wiederweihe der Kirche<br />
1929 wieder auf dem Platz, für den es bestimmt war.<br />
Es ist ein dreiteiliger Altaraufsatz (Flügelretabel). Die mit Leinwand beklebten Bildtafeln sind aus Tannenholz. Von der Malerei auf<br />
den Außenseiten der Flügel ist nichts mehr zu sehen, dagegen ist die Malerei der Innenseiten − Tempera mit Harzlasuren vor<br />
Goldgrund − gut erhalten. Das Mittelstück des Triptychons stellt die Kreuzigung dar, die Flügel zeigen vier Szenen aus der<br />
Passion: links oben Jesus vor Kaiphas, unten Jesus vor Herodes, rechts oben die Verspottung bei Pilatus, unten die Annagelung<br />
ans Kreuz.<br />
Bild 41: Altarbild<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Die ursprüngliche Pracht und Leuchtkraft der Farben ist vergangen, aber es bleibt noch genug des Bewundernswerten: die Vielfalt<br />
der Physiognomien, die Drastik der Gebärden, das dramatische Spiel kontrastierender Formen, die kompositionelle Durchführung.<br />
Ein System korrespondierender Linien und Farben verbindet die einzelnen Szenen miteinander, strebt zur Mitte und gipfelt im<br />
Haupt des Heilands. Die drei Gekreuzigten beherrschen die obere Hälfte des Mittelfeldes, in der unteren Bildhälfte ist eine Gruppe<br />
von fünf Personen durch große goldene Nimben mit den Namen der Dargestellten ausgezeichnet: Johannes, der seine Tränen mit<br />
dem Manteltuch trocknet, Maria Magdalena, Maria, Mutter des Jakobus, und Maria Salome, die sich um die wie leblos daliegende<br />
Mutter Jesu bemühen. Die idealtypischen Gesichter und verhaltenen Gesten, der Belcanto des Linienflusses unterscheiden diese<br />
Gruppe merklich von den scharf charakterisierten, lebhaft agierenden Personen ringsum, lassen das Getümmel auf der rechten<br />
unteren Bildhälfte umso turbulenter erscheinen. Der gesteppte weiße Ärmel eines Berittenen, das hellblaue Hinterteil eines Pferdes<br />
heben sich ab. In der Ecke rechts unten ist das Trio der zwergenhaften Kriegsknechte beim Würfeln um Jesu Kleider in Streit<br />
geraten − die Vorwegnahme einer Brouwerschen Wirtshausszene. Der Gruppe der heiligen Frauen zugewandt, kniet, kindlich klein,<br />
im weißen Chorrock, die Hände betend zusammengelegt, der Stifter des Altars; ,,Miserere mei“ sagt sein Schriftband. Auf dem<br />
blauen Pferd sitzt ein dunkelhäutiger Exot und blickt empor, der fromme Hauptmann, durch ein Schriftband mit den Worten ,,Vere<br />
filius dei erat iste“ gekennzeichnet, wendet sein Gesicht ab, zwei Ritter mit silbernen Helmen diskutieren erregt das Geschehen.<br />
Ein Alter, von der Legende Stephaton genannt, führt den essiggetränkten Schwamm mit einem Rohrstab zu Jesu Mund. In spitzem<br />
Winkel schneidet der Stab die Lanze, die ein Reiter mit geschlossenen Augen, von seinem Begleiter unterstützt, Jesus in die Seite<br />
stößt; der Legende nach ist es der blinde Longinus, den Christi Blut wieder sehend machte. Links neben ihm streckt ein Mann die<br />
Zunge gegen den Dornengekrönten heraus; er hält ein Schriftband mit den Worten: ,, Si tu Christus es descende de cruce“.<br />
Bewegung und reiches Formenspiel erfüllen auch die obere Bildhälfte. Der Goldgrund selbst ist auf allen fünf Bildern von einem<br />
gepunzten Ornamentstreifen umgrenzt. Über die Fläche des mittleren verstreut erkennt man Wellenbänder, von denen<br />
Linienbündel nach unten ausgehen: die Formel für Wolken. In der linken oberen Ecke ist ein Stückchen blauer Himmel ausgespart.<br />
Vier Engel umschweben den gekreuzigten Christus und fangen in goldenen Kelchen sein Blut auf. Er ist mit klobigen Bolzen<br />
angenagelt, während die Schächer in den Achseln über dem Kreuz hängen, das im Unterschied zum mittleren T−förmig ist; ihre<br />
Arme sind an ein Querholz gebunden, ihre Beine baumeln frei herab. Beide Schächer sind dem Heiland zugekehrt. Der linke,<br />
bußfertige, hat den Kopf gesenkt; seine Seele, in Gestalt eines Kindes, wird behutsam von einem Engel umfasst. Der Bösewicht<br />
rechts scheint erhobenen Hauptes den Herrn noch zu lästern, indes ein schwarzer Teufel bereits mir Klauen und Zähnen die arme<br />
34
Seele packt.<br />
Nur auf dem Kreuzigungsbild zeigt das zur tragischen Maske erstarrte Antlitz Christi eine gewisse Größe; auf den Flügelbildern ist<br />
es ausdruckslos und ohne eine Spur jener Majestät, die ihm der Kreuznimbus verleiht. Unausgeprägt und gleichförmig sind die<br />
Hände der im Übrigen durch Gesichtsschnitt, Barttracht, Kleidung, Bewaffnung und anderes Zubehör so auffällig individualisierten<br />
Personen; schablonenhaft sind auch die Pflanzen wiedergegeben.<br />
Außerordentlich ist der Farbenreichtum. Dunkles Blau, Purpurrot, Braun und Grün, Violett, Hellblau, Lila, Orange, Gelb, Weiß und<br />
Gold klingen zu einer vielstimmigen, festlichen Harmonie zusammen, wie sie uns später etwa bei Holbein o. Ä. und Meister Mathis<br />
begegnet.<br />
Seit der ,,Entdeckung“ des Altarbildes in der <strong>Felsenkirche</strong> beschäftigen zwei Fragen alle Kunsthistoriker und Heimatforscher, die<br />
sich mit ihm befassten: Wer hat es gemalt? Wann ist es entstanden? Der Obersteiner Heimatforscher Alfred Loch trug aus seiner<br />
gründlichen Kenntnis der lokalen Geschichte Anhaltspunkte für die Datierung bei, Friedrich Back konnte die Hand unseres Malers<br />
auf zwei weiteren Bildtafeln nachweisen, einer Kreuzigung in der Darmstädter Galerie und einer Passionsszene mit einem Bild aus<br />
der Stephanusgeschichte im Mainzer Museum. Back vermutet die Werkstatt unseres Malers in Mainz, wo Obersteiner Herren<br />
mehrmals geistliche Würden am Dom bekleideten. Da schriftliche Urkunden, Monogramme und Signaturen fehlen, muss über die<br />
genannten drei Werke hinaus mit Begriffen wie ,,verwandt“ oder ,,nahe stehend“ gearbeitet werden. Alfred Stange sieht eine<br />
Verbindung von einer Kreuzigung im Unterlindenmuseum zu Golmar zum ,,Kreis des Obersteiner Altars“, im Golmarer Maler<br />
möglicherweise auch nur ,,ein wahlverwandtes Temperament“. Zumindest das Gleiche kann vom Schottener Altar gesagt werden;<br />
Stange meint, der Obersteiner könne ein Schüler des Schottener Meisters gewesen sein.<br />
Wilhelm Jung machte auf ein Männerantlitz aufmerksam, das bei der Restaurierung des Obersteiner Altars in der rechten oberen<br />
Ecke der Annagelung ans Kreuz freigelegt wurde. Vom Heiligenschein Marias halb verdeckt, vom Rahmen überschnitten, blickt ein<br />
Mann mit roter Kappe aus dem Bild. Jung zweifelt nicht daran, dass es ein Selbstbildnis des Malers ist.<br />
Bild 42: Männerkopf vom Altarbild<br />
(Selbstbildnis des Meisters?)<br />
Bei der Datierung des Altars hat man sich wohl zu sehr auf Eberhard oder Richard von Oberstein als mögliche Stifter festgelegt,<br />
somit auf die Zeitspanne zwischen 1414 und 1487, während der die beiden Herren urkundlich als Mitglieder des Mainzer<br />
Domkapitels nachgewiesen sind. Es gibt formale Indizien dafür, dass der Altar vor 1414 gemalt ist. Bezeichnenderweise ist die<br />
Golmarer Kreuzigung, die unserem Altar in jeder Hinsicht nahe steht, im neuen Katalog des Unterlindenmuseums um ein halbes<br />
Jahrhundert zurückdatiert worden, auf 1360 − 80.<br />
In der Ausstellung ,,Alte Kunst am Mittelrhein“, die 1927 in Darmstadt veranstaltet wurde, hatte der Obersteiner Altar einen<br />
Ehrenplatz.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Der unbekannte Maler erhielt den Namen, unter dem er seither in die Kunstgeschichte eingegangen ist: ,,Meister des Obersteiner<br />
Altars“. Bis auf weiteres, vielleicht für immer, bleibt es bei dieser Nottaufe.<br />
35
Bild 43: Tafelbild mit der Familie des Grafen Sebastian.<br />
Um 1570<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
36
Eberhard Zahn: Die Ausstattung<br />
Als im <strong>Jahre</strong> 1742 ungeheure Felsmassen vom Bosselstein herabstürzten, wurde die gotische <strong>Felsenkirche</strong> aufs schwerste<br />
beschädigt. Die Rippengewölbe des Schiffes stürzten ein, und nur die gewölbten Räume, die sich direkt an das Felsmassiv<br />
anlehnten, blieben anscheinend erhalten. Die Felsmassen und das herabstürzende Gewölbe haben die alte Ausstattung<br />
großenteils unter sich begraben; das berühmte Altarretabel von 1400, das Tafelbild mit der Familie des Grafen Sebastian, der<br />
Taufstein und wahrscheinlich auch Teile der Herrschaftsloge haben die Katastrophe überstanden. Als man wenige <strong>Jahre</strong> danach<br />
an den Wiederaufbau der Kirche ging, mussten die Möblierung und die Ausstattung der Kirche neu geschaffen werden. Anstelle<br />
der Gewölbe baute man eine hölzerne Tonne ein, wie es auch schon in gotischer Zeit bei zahlreichen Kirchen üblich war, wenn<br />
man die Kosten einer Wölbung scheute. Die Kirche erhielt ein einfaches, aber doch interessantes Gestühl: Bankreihen mit<br />
herausklappbaren Sitzen an den Wangen. Die Wangen selbst waren in geschwungenem Kontur aus einem dicken Brett<br />
herausgesägt und endeten oben in einem Kreuz. Die frei stehenden Bänke des Gestühls hatten hinten oder vorne einen Abschluss<br />
mit einfachen Profilen. Im Westen errichtete der barocke Baumeister eine hölzerne Empore auf hohen Pfosten, die bis zur<br />
westlichen Abschlusswand anstieg. Eine weitere schmale Empore zog sich an der Südwand entlang und durchschnitt das<br />
westliche der beiden großen Fenster. Die Brüstungen der Emporen hatten gerahmte Füllungen, die wohl alle bemalt waren. Die<br />
Ostseite, wo der Altar stand, hatte vor dem Felssturz einen apsisartig gewölbten Abschluss, wobei die gotischen Rippen dieses<br />
Altarjoches anscheinend auf den unregelmäßigen Verlauf der Felsennische Rücksicht genommen hatten. Ob ein Triumphbogen<br />
durch eine besondere Rippe angedeutet war, lässt sich nicht mehr nachweisen, denn der barocke Baumeister, der nach dem<br />
Felssturz von 1742 die Kirche erneuerte, baute einen barocken Triumphbogen ein, damit die hölzerne Deckentonne einen geraden<br />
Abschluss erhalten konnte. Der Bogen scheint abgephast gewesen zu sein, wie es aus der fotografischen Aufnahme von 1928<br />
(beim Ansatz links, d.h. auf der Nordseite) zu erkennen ist.<br />
Bild 44: Gewölbte Decke und Triumphbogen vor der Renovierung<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Unter dem Triumphbogen baute der barocke Meister eine Empore mit der Orgel ein, aber doch so, dass man die teils natürliche,<br />
teils in den Felsen eingeriefte Altarnische sehen und erleben konnte. Auch hier wiesen die Füllungen der Emporebrüstung<br />
Gemälde auf es sind die heute noch erhaltenen Apostelbilder an der Westempore (seit 1929). Darüber waren verschiebbare<br />
Holzgitter angebracht. In der Mitte, über dem Altar, schwebte die Orgel mit ihrem schönen dreitürmigen Prospekt, der auf seiner<br />
Lade 1756 datiert ist. Links unten, auf der Nordseite, befand sich ein kleiner Verschlag, wohl zum Umkleiden des Pfarrers<br />
bestimmt, denn der Weg vom Städtchen hierher war doch beschwerlich, und von dort führte ein verstecktes Treppchen auf die<br />
Kanzel. Der Kanzelkorb dürfte 1742 nicht erhalten geblieben sein, obwohl die Ornamente auffallend rückständig für die Zeit nach<br />
1742 sind. Er zeigt einfache barocke Formen ohne die um die Zeit gegen 1750 zu erwartenden Rokokoornamente; lediglich die<br />
Blätter an den Enden des Blüten− und Blattgehänges, die die Ecken des Kanzelkorbs markieren, haben einen Hauch des Royales.<br />
Barockes Blattwerk rahmt auch die ovalen, wohl einst bemalten Schilde in den Füllungen des Korbes. Am Kanzelboden hängt ein<br />
Zapfen in Form einer Weintraube. Einige Teile der Kanzel werden neueren Datums sein. Ein Schalldeckel war anscheinend nie<br />
vorhanden. Obwohl die Kanzel etwas zur Seite gerückt ist, erinnert die Anlage doch noch an die Kanzel−Orgel−Altäre, wie sie in<br />
protestantischen Kirchen häufig zu finden sind.<br />
37
Bild 45: Das 1929 neu gestaltete Hauptschiff<br />
Im Seitenschiff auf der Nordseite, das bei der Katastrophe des <strong>Jahre</strong>s 1742 kaum beschädigt worden ist, befand sich hoch oben<br />
die herrschaftliche Loge, die über zwanzig Stufen über einen schmalen Gang an der nördlichen Kirchenwand zugänglich war. Die<br />
Öffnung zum Schiff hin war mit einer gegliederten und profilierten Brüstung aus Eichenholz abgeschlossen. Kleine gedrungene<br />
Pilaster, die mir Ornamenten verziert sind, unterteilen die Felder der Brüstung. Darüber befindet sich ein reich profilierter Abschluss<br />
mit der Armlehne für die am Gottesdienst teilnehmende Herrschaft. Das Profil verkröpft sich über den kleinen Pilastern. Wegen der<br />
Profile und des noch ans ,,Bandelwerk“ erinnernden Ornaments an den kleinen Pilastern könnte dieser Teil der Empore tatsächlich<br />
den Sturz von 1742 überstanden haben; er müsste dann aus der Zeit um 1720 stammen. Aber bei dem Nachhinken der<br />
Stilentwicklung ist die Entstehung der Emporenbrüstung auch nach 1742 möglich. Das Interessanteste war der Bezug zur<br />
Herrschaft der Obersteiner am Bau selbst: über der Empore befand sich bis 1928/29 das Daun−Obersteiner Wappen, gleichsam<br />
das Hoheitszeichen der Herrschaft, auf einem Gewölbeschlussstein in Sandstein gehauen und mit einem rechteckigen<br />
spätgotischen Rahmen versehen. Ohne diesen sinnvollen Bezug zu achten, hatte Wilhelm Heilig diesen Schlussstein entfernen<br />
und am Mittelpfeiler im Schiff anbringen lassen. Die Empore darunter, wohl für die Hofbediensteten bestimmt, liegt elf Stufen über<br />
dem Boden des Kirchenschiffes. Die Öffnung zum Schiff ist mit einem reich verzierten Rahmen mit Blüten und Blättern versehen.<br />
Trotz einigen Bedenken hinsichtlich des gottesdienstlichen Zeremoniells und der Funktion der Herrschaftslogen neige ich hier in<br />
der <strong>Felsenkirche</strong> dazu, dass die Herrschaft nicht hoch oben dem Gottesdienst beigewohnt hat, sondern in der sich breit öffnenden<br />
,,unteren“ Empore. Denn der Zugang nach oben war und ist etwas unwürdig und sehr beschwerlich. Außerdem macht die Brüstung<br />
mehr den Eindruck eines Baldachins. Aber das sollen nur Vermutungen sein! Die Ornamente um die untere Empore passen zu<br />
denen der Kanzel; die Blüten und Blätter, vor allem die Blattenden, weisen auf die Rocaille hin. Die Rahmen dürften deshalb nach<br />
1742 entstanden sein.<br />
Bilder 46 und 47: Zinnkannen aus dem 17. und 18. Jh.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Der gotische Taufstein stand vor 1929 etwas seitlich hinter dem Altar, und dort entdeckt man auf den alten Fotografien einen<br />
schweren hölzernen Opferstock. Obwohl die Kirche durch spätere Felsstürze erneut beschädigt worden war (1838, 1858), scheint<br />
das Innere den spätbarocken Charakter bewahrt zu haben. Erst mit jener − man muss es offen aussprechen − unglückseligen von<br />
1928/29 durch den Architekten Wilhelm Heilig wurde mit der Einrichtung und Ausstattung rücksichtslos und willkürlich<br />
umgegangen, sodass der Raum heute jene heimelige, aber auch bescheidene Atmosphäre vermissen lässt, die wir auf den alten<br />
Fotos noch erahnen können1). Das Sitzgestühl wurde entfernt und durch ein modernes formloses Kastenwerk ersetzt; die<br />
Holzempore mit der Orgel wurde herausgerissen, dafür zwei Betonemporen eingebaut, mit glatten Sperrholzplatten verkleidet, in<br />
die obere Empore der alte Orgelprospekt eingefügt und hohe Holzgitter angebracht. Der barocke Triumphbogen wurde radikal<br />
herausgerissen. Die alte, ansprechend gestaltete Orgel−Altaranlage des Barocks war von dem Triumphbogen noch eingefasst, ja<br />
umfangen gewesen. Das erhaltene Orgelgehäuse wurde 1929 im Wesentlichen unverändert übernommen. Es ist ein bescheidenes<br />
Werk mit drei Türmen und zwei geraden Zwischenteilen, in der Gestaltung an ältere Traditionen anknüpfend. Die seitlichen Türme<br />
ragen spitz in den Raum hinein, der mittlere, der größte, ist rund. Reiches à jour gearbeitetes Rankenwerk begleitet die Pfeifen und<br />
bildet den seitlichen und bekrönenden Schmuck des ansprechenden Prospektes. Auf der Sockellade steht das Datum: 1756. Am<br />
mittleren Türmchen des Orgelprospektes sitzt unten eine köstliche Maske mit dichtem, das Gesicht rahmenden Haar und mit einer<br />
reichen Krone. Erstaunlicherweise gibt die Ornamentik des Orgelprospektes so gut wie keinen Hinweis auf das Entstehungsdatum<br />
1756; sie ist wie die der Kanzel und Herrschaftsloge noch barock und ohne auffallende Anklänge an das Rokoko. Abgesehen von<br />
der unnötigen Entfernung des Triumphbogens war das Schlimmste die von Heilig vorgenommene Abmauerung der originalen<br />
Felsennische, wo der Altar stand. Das Ganze ist sachlich, aber alles andere als sakral. Gerade dort, wo das schönste und von der<br />
Funktion der Kirche her wichtigste Ausstattungsstück im <strong>Jahre</strong> der Wiedereinweihung 1929 erneut aufgestellt wurde, verspürt man<br />
am wenigsten sakrale Atmosphäre. Denn die Empore ist zu tief angesetzt, obwohl doch feststand, dass die Altartafel von 1400<br />
38
wieder an ihren alten Platz kommen sollte, wo sie wahrscheinlich bis 1742 gestanden hatte. Dort herrscht eine Enge, die das<br />
schöne Bild seiner Würde beraubt. Willkürlich ging der Architekt von 1928 mit der herrschaftlichen Loge um; sie wurde sozusagen<br />
auf den Kopf gestellt. Die steinerne Brüstung unten wurde fast ganz entfernt, und der baldachinartige Aufbau von oben nach unten<br />
versetzt. Außerdem begriff der Architekt auch nicht die herbe Schönheit und die Statik des gotischen Baues, denn er verdeckte mir<br />
seiner neuen durchgehenden Empore den nordöstlichen Pfeiler der Kirche mit seinen Kanten und rückte noch dazu die neu<br />
gestaltete ehemalige Herrschaftsloge und die neuen Emporen vor die nördliche Wandflucht vor. Die sechs Apostelbilder, die bis<br />
1928 die Mitte der westlichen Emporenbrüstung zierten, ließ Heilig hier an der Brüstung der Herrschaftsloge anbringen, fügte aber,<br />
weil die Gemälde nicht hoch genug waren, Namensbeischriften hinzu. Es sind die Apostel (von links) Judas, Matthäus, Markus,<br />
Lukas, Johannes und Simon. Die Bilder erheben zwar keinen künstlerischen Anspruch, aber die Apostel stehen lebendig und<br />
eindringlich vor uns als bäuerliche Gestalten voller Kraft. Die jüngste Restaurierung gab den Bildern wieder ihre strahlenden<br />
Farben zurück. Auch die anderen Emporen sind ohne Rücksicht auf die gotische Architektur eingebaut: wie auf der Altarseite sind<br />
auch im Westteil die Emporen vor die Pfeiler gesetzt. Die auf getünchten Betonpfeilern ruhende Westempore ist heute mit den fast<br />
bäuerlichen Aposteldarstellungen geschmückt, die vor dem Umbau die Orgelempore zierten. Dargestellt sind (von links) Thomas,<br />
Bartholomäus, Jakobus Major, Petrus, Jesus Christus, (in der Mitte), Andreas, Philippus, Jakobus Minor und Matthias. Die Apostel<br />
stehen vor teilweise fantastischen Berglandschaften. Petrus vor den Felsen von Oberstein mit der <strong>Felsenkirche</strong> nach der<br />
Restaurierung seit 1742 mit der Burg Bosselstein darüber; andere stehen vor Burgen und Stadtansichten. Die Gemälde sind wie<br />
die anderen bäuerliche, etwas derbe Kunst, aber doch voller Reiz. Christus in der Mitte ist als Gestalt kleiner als die Apostel, er<br />
steht aber in einer apokalyptischen Vision in einer Wolkenlandschaft mit den sieben Leuchtern. Christus selbst in der Mandorla,<br />
von seiner erhobenen Rechten gehen sieben Sterne aus, von den Augen zwei Flammen, dazu noch vom Munde ausgehend das<br />
Schwert.<br />
Bild 48: Christus als Weltenrichter<br />
Der Maler war beauftragt, diese Vision aus der Offenbarung des Johannes an zentraler Stelle im Kirchenraum, direkt über dem<br />
Altar, bildlich darzustellen. Im Kapitel 1 der Offenbarung sagt Johannes:<br />
Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und die ihn zerstochen haben;<br />
und werden heulen alle Geschlechter der Erde. Ja, amen.<br />
Vers 12. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Als ich mich wandte, sah ich<br />
die sieben goldenen Leuchter,<br />
Vers 13. und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der war eines Menschen Sohne gleich, der war angetan<br />
mit einem langen Gewand und begürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel.<br />
Vers 14. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine<br />
Feuerflamme.<br />
Vers 16. und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes<br />
zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete wie die helle Sonne.<br />
Vers 20. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und die sieben<br />
goldnen Leuchter: die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden; und die sieben Leuchter, die du<br />
gesehen hast, sind sieben Gemeinden.<br />
Kapitel 19, Vers 15. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Heiden schlüge.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
39
Für die evangelischen Auftraggeber und die Künstler war eine solche religiöse Thematik an hervorgehobener Stelle über dem Altar<br />
eine gängige und von der Gemeinde sicher verstandene theologische Verknüpfung; umso unverständlicher bleibt es, dass man<br />
1928/29 auch dieses theologische Programm zerriss, indem man die Bilder dort entfernte.<br />
An der Rückwand hinter der Empore hängt das interessante Bild der gräflichen Familie, ein Werk der deutschen Renaissance.<br />
Dargestellt ist der durch Verzicht seines Bruders Philipp von Oberstein 1554 in den Besitz der Herrschaft gekommene Graf<br />
Sebastian (1554 −1579). Sebastian war und blieb katholisch, obwohl die Herrschaft Oberstein evangelisch war. Er war mit der<br />
Wild− und Rheingräfin Elisabeth verheiratet und hatte drei Söhne und zwei Töchter. Das über der Empore angebrachte<br />
Familienbild zeigt den Grafen Sebastian mit seiner ganzen Familie: links steht der Graf mit seinen Söhnen, rechts die Gemahlin<br />
Elisabeth mit den Töchtern, alle vor einer gewölbten Renaissanceloggia. Der neben dem Grafen stehende älteste Sohn ist Philipp<br />
Franz von Oberstein, der Nachfolger Sebastians und der Begründer der Achatschleiferei durch Erlass der Zunftordnung im <strong>Jahre</strong><br />
1609. Über dem Bildnis des Grafen ist die Auferstehung Christi aus dem Grabe zu sehen, über dem der Gräfin die Verklärung<br />
Christi auf dem Berge Tabor mit den Aposteln Petrus, Jakobus und Johannes; im Himmel erscheinen Moses (links) und Elia<br />
(rechts). Es heißt im Evangelium des Matthäus Kapitel 17, Verse 1 bis 3:<br />
Und nach sechs Tagen nahm Jesus zu sich Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, und führte sie<br />
beiseits auf einen hohen Berg.<br />
Und er ward verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß als<br />
ein Licht.<br />
Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia; die redeten mit ihm.<br />
Das Altarbild ist sicherlich aus zwei Tafelbildern zusammengesetzt oder aus zwei Altarflügeln; man sieht in der Mitte genau, dass<br />
die Architektur auf beiden Bildern nicht genau zusammenpasst. Das Bild ist nicht gut erhalten und musste vor kurzem erneut<br />
restauriert werden. Der verdienstvolle Lokalforscher Alfred Loch meint mit Recht, ,,dieses Grafenbildnis ist das einzige in<br />
Oberstein, das die Erinnerung an ein Geschlecht uns überliefert, das Jahrhunderte in guten und bösen Zeiten für die Geschicke<br />
unserer Vorfahren bestimmend war und uns deshalb als geschichtliche Erinnerung gleich wertvoll sein muss wie das kostbare<br />
Altarbild“2). Die Grabplatte seines Sohnes, des Grafen Philipp Franz, der die Herrschaft erbte und 1624 starb, war noch bis zu<br />
jenem verhängnisvollen Umbau 1929 erhalten; die Reste wurden damals als Deckplatten für eine Kirchhofsmauer verwendet!<br />
Alfred Loch hat uns die Grabinschrift überliefert3).<br />
Erhalten geblieben ist der Rittergrabstein des Junkers Philipp II. von Daun, Herr zum Stein (1394 − 1432); auch da sind einige<br />
Buchstaben der Inschrift während der Umbaumaßnahmen 1929 durch Nachlässigkeit zugrunde gegangen. Philipp steht in voller<br />
Rüstung auf zwei Löwen, die ihren Kopf zur Seite wenden. Der Ritter hält in seinen Händen die Waffen, den Dolch in der Rechten,<br />
das Schwert in der Linken. Philipp trägt über der Rüstung einen Mantel, der oben geschlossen und mit einem Kettenpanzer über<br />
Brust und Schulter bedeckt ist. Links oben das Wappen Philipps, rechts die Helmzier. Das Grabmal, ursprünglich als Tumba<br />
liegend, ist nicht ersten Ranges, aber der Mantel erinnert mit seinen weichen Falten doch noch an die Spätstufe des ,,Weichen<br />
Stiles“ innerhalb der gotischen Stilentwicklung. Die Inschrift des Grabmals lautet: Anno Domini MCCCCXXXII feria tertia Post<br />
Dominicam Estomichi obiit domicellus Phil(ippus de Duna, dominus de Lapide), cuius anima quiescat in pace. Amen; zu Deutsch:<br />
Im <strong>Jahre</strong> des Herrn 1432 am Mittwoch nach Sonntag Estomihi starb Junker Phil(ipp von Daun, Herr zum Stein), dessen Seele in<br />
Frieden ruhen möge. Amen4).<br />
Bild 49<br />
Neben diesem Grabmal ist links oben das Fragment eines Grabsteins eingemauert mit dem gespaltenen Wappen der Raugräfin<br />
von Altenbaumburg (bei Bad Kreuznach) und den Worten:<br />
,,Meen rugrafyn fraw zum Obersteyn“.<br />
Diese Raugräfin Mena war die Frau Philipps von Daun. Beide Steine, der der Mena und der Philipps, gehören also zusammen.<br />
Alfred Peth hat noch zwei weitere Inschriftplatten in der <strong>Felsenkirche</strong> entziffern können. Die der 1,80 m hohen Platte lautet:<br />
ANNO 1615 DEN 23 MAY IST DER WOLGEBORENE PHILIP (FRI)DERICUS VON (DAUN GR)AF ZU<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
40
FALKENSTEIN HERR ZU OBERSTEIN UND BRUCH IN GOTT SELIGLICH ENTSCHLAFEN.<br />
Darunter ist noch das Wappen zu erkennen mit einem weiteren Spruch darunter:<br />
PS 90. HERR LEHR UNS BEDENKEN DAS WIR STERBEN MUSSEN.<br />
Die beiden Buchstaben NF könnte man als eine Steinmetzsignatur deuten 5). Philipp Friedrich war der vierte Sohn des Grafen<br />
Philipp Franz, war designierte Domherr (Straßburg oder Köln), konnte aber wegen seines frühen Todes diese Domherrenstelle<br />
nicht mehr antreten.<br />
Auf der anderen Platte, die 2,05 m hoch und 0,93 m breit ist, kann man lesen:<br />
ANNO (16)15 DEN IN (Z)UM OBERSTEIN UND BRUCH IHRES ALTERS 15 JAHR UND 18 DAG SELICH<br />
GOT GENEDIG ENTSCHLAFEN.<br />
Das früh verstorbene junge Mädchen kann wahrscheinlich nur eine Tochter des Grafen Philipp Franz von Daun−Oberstein (1559 −<br />
1624) gewesen sein6).<br />
An dem Zwischenpfeiler der Nordseite befindet sich unterhalb des gotischen Gewölbeanfängers das Wappen von Daun−Oberstein<br />
mit dem goldenen Grund und dem roten Gitter. Darunter sitzt in dem Pfeiler seit 1929 der ehemalige Schlussstein von dem<br />
Gewölbejoch mir der Herrschaftsloge, den Wilhelm Heilig entfernt hatte und hierher versetzen ließ. Der Stein zeigt ebenfalls das<br />
Wappen Daun−Oberstein. Diese Maßnahme des Architekten Heilig vom <strong>Jahre</strong> 1929 − sie könnte auch heute noch bedenkenlos<br />
durchgeführt werden − gibt einen Einblick in die Schaffensweise eines modernen Architekten, der den historischen und<br />
architektonischen Bezug und die Bedeutung eines Gegenstandes oder eines Baudetails, anscheinend auch nicht die sakrale<br />
Funktion eines früheren Zustandes, weder anerkannt noch erfasst hat. Hier wurde ein Gewölbeschlussstein seiner Funktion<br />
beraubt und wie ein Bildchen an die Wand befestigt.<br />
Im westlichen Joch des Seitenschiffes ist in der Höhe der Empore noch ein hübsches gotisches Köpfchen als Gewölbeanfänger<br />
erhalten. Schließlich muss noch der spätgotische Taufstein genannt werden, ein schöner sechseckiger Stein, der von einem<br />
profilierten Fuß in einen kesselartigen Körper übergeht und mit Blendmaßwerk verziert ist; er stammt aus der Zeit um 1<strong>500</strong>.<br />
Bild 69: Taufschale aus dem 16. Jh.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
In zwei eingebauten Vitrinen vor dem Altarjoch (auf der Südseite) werden einige wertvolle Metallgegenstände und Geschenke an<br />
die Gemeinde der <strong>Felsenkirche</strong> gezeigt. Das wichtigste Stück ist die Taufschale aus Messing mit der Darstellung von Adam und<br />
Eva vor dem Apfelbaum mit der Schlange; der Baum steht im Paradies, das mit Mauern und Türmen umfriedet ist. Um die zentrale<br />
Darstellung läuft eine Umschrift in gotischen Buchstaben herum, die vorläufig noch nicht entziffert werden konnte. Die Taufschale<br />
ist wahrscheinlich ein Erzeugnis der Nürnberger Beckenschläger und entstammt dem 16. Jahrhundert, aber noch der<br />
vorreformatorischen Zeit7). Bemerkenswert sind einige große Zinnkannen, meist Taufkannen mit Deckel, aus dem 17. und 18.<br />
Jahrhundert8), ferner ein bauchiges Zinngefäß ohne Deckel, zwei schwere Eisenschlösser, wohl noch gotisch, und zwei hölzerne<br />
Scheffelmaße aus dem beginnenden 16. Jahrhundert.<br />
41
Bild 50: Kruzifix aus Bergkristall<br />
Von den modernen Gegenständen sind hervorzuheben das Kruzifix aus Bergkristall, eine Arbeit des Obersteiner Graveurs August<br />
Schmelzer (1882 − 1955), und das naturgewachsene Achatkreuz, ein Geschenk der Geschwister Petsch aus Idar−Oberstein. Das<br />
Gegenstück zu diesem Natur−Kreuz aus Achat befindet sich im Museum unterhalb der <strong>Felsenkirche</strong>. Nicht zu vergessen ist ein<br />
altes dickes Buch ,,Auslegung des gantzen Psalters Davids des Königlichen Propheten“, 1644 in Lüneburg gedruckt und ,,Der<br />
gantze Gatechismus“, 1643 gedruckt. Alle Gegenstände sind dank einer ständigen Pflege in einem guten Zustand.<br />
Bild 51: Naturgewachsenes Achatkreuz<br />
In der Kirche stehen noch zwei mittelalterliche Truhen, deren Herkunft unbekannt ist; man vermutet, sie könnten ehemalige<br />
Gemeindetruhen sein. Die eine, die bei der Herrschaftsloge steht, ist auf allen Seiten mir festen eisernen Bändern und Zierstücken<br />
beschlagen, die den schweren Eichenbrettern einen festen Halt geben; große Schlösser sichern die Truhe. Sie dürfte noch aus<br />
dem 14. Jahrhundert stammen. Die zweite Truhe steht auf der Südseite und weist ebenfalls Eisenbeschläge und große Schlösser<br />
auf, scheint aber etwas jünger zu sein. Eine dendrochronologische Untersuchung des Eichenholzes könnte wahrscheinlich<br />
genaueren Aufschluss über die Entstehungszeit beider Truhen bringen 9).<br />
Bild 52: Mittelalterliche Holztruhe<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
In der <strong>Felsenkirche</strong> sind noch einige Fragmente von Glasmalereien erhalten, die teils vor vielen Jahrzehnten der Kirche entfremdet<br />
und über den Kunsthandel zurückgekauft worden sind (um 1929), teils aber immer in der Kirche blieben. Nach den zahlreichen<br />
Beschädigungen durch Felsstürze vom Bosselstein sind nur noch wenige Fragmente der spätgotischen Glasfenster übrig<br />
geblieben. Wahrscheinlich hat man nach der Katastrophe von 1742, oder erst nach denen des 19. Jahrhunderts, die Scherben<br />
aufgesammelt, sie verwahrt und schließlich zusammengesetzt, so gut es ging, und in die Kirchenfenster eingesetzt. Wie man der<br />
<strong>Festschrift</strong> von 1929 entnehmen kann, sollen die beiden noch erhaltenen Holzrahmen mit den Fragmenten im <strong>Jahre</strong> 1889 aus der<br />
Kirche entfernt und in Münchener Privatbesitz gelangt sein. Dafür erhielt die <strong>Felsenkirche</strong> vier Glasbilder ,,im Geschmack (oder<br />
vielmehr Ungeschmack) jener Zeit“10). Die Glasfenster des späten 19. Jahrhunderts sind leider 1928 /29 herausgenommen und<br />
nicht mehr eingebaut worden, eine von der Zeit her verständliche, aber für uns heute doch bedauerliche Maßnahme. Es heißt in<br />
der <strong>Festschrift</strong> fast überheblich, der ,,Baukünstler“ − gemeint ist Wilhelm Heilig − habe sie ,,selbstverständlich in die erneuerte<br />
Kirche nicht wieder aufgenommen, und darüber wird wohl niemand traurig sein“ 11). In Unkenntnis des tatsächlichen<br />
Erhaltungszustandes und der künstlerischen Qualität klammerte man sich damals an die in München entdeckten Obersteiner<br />
Fensterfragmente, die der Konservator Luber erworben und ,,mit vieler Mühe wieder aus den einzelnen Scherben“<br />
zusammengesetzt hatte. Der Architekt Heilig verfasste ein Gutachten, betont darin auch den künstlerischen Wert der Fragmente,<br />
,,empfahl aber, mit Rücksicht auf die großen Kosten der Wiederherstellung der Kirche den Ankauf noch hinauszuschieben“. Da<br />
man der Meinung war, auch das Bildnis des Erbauers Wirichs IV. (1432 − 1501) sei alt, setzte die Gemeinde der <strong>Felsenkirche</strong> alles<br />
in Bewegung, die Fenstertafeln zu erwerben. Sie sind wohl kurz nach der Einweihung der Kirche 1929 in den Besitz der Gemeinde<br />
42
gelangt und in die Sakristeifenster eingesetzt worden. Der Konservator Luber hatte sich zwar Mühe beim Zusammensetzen der<br />
Scherben gemacht, konnte aber doch kein überzeugendes Gesamtbild erzielen. Ein besonderes künstlerisches Gefühl hat Luber<br />
nicht an den Tag gelegt. Das meiste ist schlecht ergänzt, grob übermalt, sogar über die Verbleiungen hinweg! Wie schon erwähnt,<br />
sind zwei Fenstertafeln in der Montierung von Luber erhalten12). Auf der Fenstertafel 1 ist das so genannte Stifterbildnis Wirichs<br />
IV. zu sehen. Da die Fragmente meist willkürlich zusammengesetzt und weitgehend ergänzt sind, kann man kaum von einer<br />
spätgotischen Komposition sprechen. Das meiste ist neu, aus dem 19. und aus unserem Jahrhundert stammend, und auch der<br />
Kopf mit dem Portrait Wirichs muss neu sein. Die Art der Zeichnung ist unkünstlerisch, die Augen liegen schematisch<br />
nebeneinander, getrennt von einer steifen, schief gezogenen Nase, überschattet von ebenso schematisch gezogenen<br />
Augenbrauen. Das Kinn springt in zwei kugelförmigen Verdickungen vor, auch hier ohne zeichnerische und malerische Qualitäten.<br />
Auch die Art, wie die Haare wiedergegeben sind, entspricht in keinem Falle einer spätgotischen Malerei. Das Ganze wird eben<br />
doch von der Hand Lubers sein und stammt damit aus unserem Jahrhundert. Sehr schlecht ist die Zeichnung im unteren Teil des<br />
Gewandes von Wirich, wo die Falten mit einem groben Pinsel aufgemalt wurden. Alt sind sicherlich die Reste des Schriftbandes;<br />
sie sind aber auch nicht genau genug zusammengesetzt. Die Inschrift lautet: ,Wirich von Dune Herr zu Falckenstein und zum<br />
Oberstein 1482“. Der Teil der Inschrift mit“ ... stein 1482“ ist in die zweite Fenstertafel eingefügt. Auch auf dieser Tafel II ist das<br />
meiste neu. Alt sind nur noch das genannte Inschriftfragment mit ,, . . . stein 1482“, ein Teil des Daun−Obersteiner Wappens mit<br />
dem goldgelben, rot gegitterten Schild und einige Ornamentsfragmente. Ein weiteres Bruchstück dieser Tafel nennt die <strong>Jahre</strong>szahl<br />
148. . Kurt Henn veröffentlichte in der <strong>Festschrift</strong> 1929 ein weiteres Glasbild, das ebenso fragmentarisch und stark ergänzt ist und<br />
sich noch in der Kirche befindet13). Henn konnte sich noch keine Klarheit verschaffen, ob eine weibliche Heilige oder ein Heiliger<br />
gemeint ist. Der sicher originale Kopf der nach der Zusammensetzung völlig ungestalten Figur stellt sicherlich den heiligen Nikolaus<br />
von Myra dar, der den Goldklumpen, das Geschenk für die Töchter eines armen Mannes, in der Hand hält. Weitere ornamentale<br />
Fragmente der alten Fenster sind in den kleinen Fenstern der Kirche und in der Sakristei erhalten. Wichtig ist noch ein Fragment<br />
mit dem Wappen der Grafen von Leiningen, denn Wirich IV. war mit Margaretha, Gräfin von Leiningen, verheiratet. (Die Linie<br />
Leiningen−Heidesheim beerbte 1662 die Daun−Obersteiner und ließ auch die <strong>Felsenkirche</strong> nach der Beschädigung von 1742<br />
wiederherstellen). Das Wappen zeigt drei silberne Adler auf schwarzem Grund, darum vier goldene Kreuzblumen, darüber ein roter<br />
dreilätziger Steigbügel− (oder Turnier−) Kragen.<br />
Weitere Erwägungen über die Glasfragmente anzuschließen dürfte sich nicht lohnen. Aber als wichtige Erkenntnis muss<br />
festgehalten werden, dass das Gesicht des Wirich kein Originalbildnis aus spätgotischer Zeit darstellt.<br />
Das bedeutendste Kunstwerk der <strong>Felsenkirche</strong> ist das spätgotische hochberühmte Altarretabel, das an anderer Stelle in dieser<br />
<strong>Festschrift</strong> ausführlich behandelt wird.<br />
Glücklicherweise ist noch eine alte Glocke vorhanden. Sie überstand die Beschlagnahme beider Weltkriege. Nach dem Wortlaut<br />
ihrer Inschrift war sie nicht für Oberstein, sondern für die katholische Kirche zu Monzelfeld bei Bernkastel bestimmt. Aus welchem<br />
Grunde sie dann doch nicht in Monzelfeld erklingen durfte, sondern nach Oberstein gelangte, ist ungeklärt geblieben. Die Inschrift<br />
lautet: ,,sub pastore Friderico BernardiJoanne Frank et Thysone Treish syodalibus, 1686 2. Juli, percussa resono, populum voco,<br />
mortuum defleo et fulgura pello, 5. Stephane ecclesiae Montzelfe(ldensis) patronne ora pro nobis“, zu Deutsch: Zurzeit des Pastors<br />
Friedrich Bernardi und der Sendschöffen Johann Frank und Mathias Treisch am 2. Juli 1686 (zu ergänzen: bin ich gegossen<br />
worden). Wenn ich geschlagen werde, ertöne ich, das Volk rufe ich zusammen, den Toten beklage ich und den Blitz vertreibe ich.<br />
Heiliger Stephan, Schutzherr der Kirche von Monzelfeld, bitte für uns“14). Die drei genannten Personen sind um diese Zeit in<br />
Monzelfeld nachweisbar, und der heilige Stephan wird schon um 1569 als Patron der dortigen Kirche genannt.<br />
Anmerkungen:<br />
1) Vergl. auch Eberhard Zahn, Idar−Oberstein, in: Führer zu vor− und frühgeschichtlichen Denkmälern, Band 34, Mainz 1977, S.<br />
129 ff.<br />
2)Alfred Loch, Aus der Geschichte der <strong>Felsenkirche</strong> und ihrer Gemeinde, in: Die Obersteiner <strong>Felsenkirche</strong>, <strong>Festschrift</strong> für die<br />
Wiederweihe, Oberstein 1929, S. 51.<br />
3) Alfred Loch, ebenda S. 52.<br />
4) Alfred Loch, ebenda S. 37.<br />
5) Alfred Peth, Zwei bisher noch nicht entzifferte Grabplatten in der <strong>Felsenkirche</strong>, in: Mitteilungen des Vereins für Heimatkunde<br />
Birkenfeld und des Vereins Die Heimatfreunde Oberstein, 32,1969, S. 68 ff.<br />
6) Alfred Peth, ebenda S. 70.<br />
7) Walther Zimmermann, Evangelische Kirchenkunst im Rheinischen Oberland, in: Unsere Kirche im Rheinischen Oberland,<br />
herausgegeben vom Evangelischen Sonntagsblatt ,,Glaube und Heimat‘ von Ernst Gillmann, Simmern 1954, S. 480. Weitere<br />
Taufschalen in Kastellaun und Kirschroth.<br />
8) Walther Zimmermann, ebenda S. 487.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
9) So konnte einer der Hauptständer in dem bedeutenden Fachwerkhaus Hauptstraße 468 unterhalb der <strong>Felsenkirche</strong> in Oberstein<br />
43
in die <strong>Jahre</strong> um oder nach 1412 datiert werden; das Haus ist damit eines der ältesten im Nahe− und Moselgebiet. Zur Methode:<br />
Ernst Hollstein, Mitteleuropäische Eichenchronologie. Trierer Grabungen und Forschungen Band 11, Mainz 1980, herausgegeben<br />
vom Rheinischen Landesmuseum Trier.<br />
10) Kurt Henn, Von den farbigen Glasbildern, in: <strong>Festschrift</strong> 1929, S. 73. Ferner:<br />
Kleine Presse, 30. Jahrg. Nr. 142 vom 20. Juni 1914, Frankfurt/Main.<br />
11) Kurt Henn, in: <strong>Festschrift</strong> 1929, S. 73.<br />
12) Die Maße der beiden Fenstertafeln ohne die Holzrahmen: Tafel 1 mit dem angebl. Kopf Wirichs, Höhe 71,3 cm, Breite 27,7 cm.<br />
Tafel II mit Wappen, Höhe<br />
71,8 cm, Breite 27,2 cm.<br />
13) Kurt Henn, in: <strong>Festschrift</strong> 1929, S. 34 und 71.<br />
14) Alfred Loch, in: <strong>Festschrift</strong> 1929, S. 55 f.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
44
Peter R. Pracher: Die Bilder und Grabsteine<br />
Flügelaltar des 14. Jh.<br />
Bild 41: Mitteltafel, Höhe 132 cm, Breite 131 cm,<br />
2 Flügel, je 132 cm hoch, 53,5 cm breit.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Der Flügelaltar, ein dreiteiliges Retabel, mit Darstellungen aus der Passion Christi, ist wohl das bedeutendste Kunstwerk und auch<br />
durch seine herbe realistische Darstellung das Beeindruckendste der Gesamtausstattung dieser Kirche.<br />
In der Mitte ist ein vierfiguriger Kalvarienberg abgebildet, wobei der Stifter in Diakons−Tracht am Fuße des Kreuzes kniet. Der linke<br />
Flügel zeigt oben Christus vor Kaiphas, unten Christus vor Herodes. Am rechten Flügel ist oben Christus vor Pilatus dargestellt und<br />
unten die Kreuzannagelung. Die Rahmenleisten und die Predella mit der Schrift sind moderne Ausstattung.<br />
Der kunsthistorische Rang ist unbestritten. Der Altar dürfte kurz vor 1400 entstanden sein und gilt als hervorragendes Zeugnis der<br />
expressiven Richtung der Malerei am Oberrhein. Einiges ist im Zusammenhang mit Ausstellungen über den künstlerischen Wert<br />
und die Einordnung geschrieben worden, zuletzt bei der Ausstellung ,,Kunst um 1400 am Niederrhein“ im Liebighaus in Frankfurt<br />
1976, wo der Altar auch ausgestellt war.<br />
Zu dieser Zeit hatte sich der Erhaltungszustand der Maischicht der Tafelbilder erheblich verschlechtert. Bedingt durch den immer<br />
wiederkehrenden Zyklus der Winterfeuchtigkeit und der sommerlichen Trocknung, sowie durch ein auf den rückseitigen<br />
Fichtenholzbrettern der Tafelbilder aufgeleimtes Stützkorsett begann die Malschicht sich aufzufalten und drohte herabzufallen.<br />
45
Bilder 53 und 54: Apostelbild vor und nach der Restaurierung<br />
Eine von der Evang. Kirchengemeinde und dem Landesamt für Denkmalpflege angeforderte Notsicherung wurde an Ort und Stelle<br />
mit hauchdünnen Japanpapierstreifen durchgeführt, wobei das Papier die abstehenden Malschollen fixierte. In der<br />
Restaurierwerkstatt wurden diese Malschichtfalten und Blasen mittels Kanülen und verschieden großen Nadeln mit wässrigem<br />
Leim vorsichtig hinterspritzt und mit regulierbaren Heizspachteln angedrückt und getrocknet. Dieser technische Vorgang<br />
wiederholte sich mehrmals bis zur vollendeten Neufestigung der ehemals lockeren Malschicht.<br />
Um einem erneuten Ablösen der Malerei vorzubeugen, wurde das rückseitige moderne Stützparkett − Eichenholzleisten der<br />
50er−<strong>Jahre</strong> mit dem Stecheisen abgelöst. So waren die Tafeln wieder fähig, geringe Bewegungen bei Feuchtigkeitsabnahme −<br />
aufnahme von sich auszugleichen.<br />
Vorderseitig erhielten Fehlstellen im polierten Glanzgold mit Aquarell die notwendige zurückhaltende Retusche, während diese im<br />
Bereich der figürlichen Darstellung mit magerem Dammarharz und Gemäldefarben ausgeführt wurden. Ein dünn aufgetragener<br />
Dammarfirnis beschloss diese Konservierungsmaßnahmen.<br />
Frühere, unauffällige Retuschen von vorhergehenden Restaurierungen (die letzte war 1951/52) blieben unberührt.<br />
Neben der in Harzölfarben ausgeführten Malerei mit kräftiger Bleiweißhöhung der Lichter ist die Behandlung der vergoldeten<br />
Hintergründe einer besonderen Erwähnung wert. Das mit einem Achat (Halbedelstein) geglättete Gold wurde mit einem Messing−<br />
oder Silberstift vorgezeichnet und mit mehreren verschiedenen starken und unterschiedlich geformten Eisenstiften leicht vertieft<br />
gepunktet. Diese verschieden großen Vertiefungen, auch Punzen genannt, schmücken in feinen abwechselnden Linien und Wellen<br />
die Nimben und Hintergründe.<br />
Emporenbilder<br />
Die Tafelgemälde der Empore sind im 17. Jh. entstanden und mit kräftigen, teils streifigen, Ölfarbenstrichen ohne<br />
Kreidegrunduntermalung direkt auf das Eichenholz gemalt worden.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Es gibt zwei verschiedene Maße, wobei Matthäus, Markus, Lucas, Judas, Thaddäus, Johannes und Simon die Größen von 79 cm<br />
Höhe und 30 cm Breite aufweisen. Hier sind die Namen auch unten angeschrieben.<br />
Die größeren Tafelbilder sind die der nachfolgend aufgezählten Heiligen mit ihren Attributen oder den jeweiligen<br />
Märtyrerwerkzeugen wie: Petrus mit dem Schlüssel, Paulus mit dem Schwert, Bartholomäus mit dem Messer, Thomas mit der<br />
Lanze und dem Buch, sowie Jacobus dem Jüngeren mit der Keule, Andreas mit dem Andreas−Kreuz, Matthias mit dem Kreuz und<br />
Jacobus der Ältere mit dem Buch. Alle zuletzt genannten Tafeln haben die Größe von 79 cm Höhe und 64 cm Breite. Dazu komme<br />
noch die Darstellung von ,,Jesus zwischen den 7 Leuchtern“.<br />
46
Bilder 55 und 56: Apostelbilder während der Reinigung<br />
Alle Tafeln waren total vergilbt und verschmutzt, beschädigt (s. Fotos), sowie teilweise auseinander gebrochen.<br />
Eine vorsichtige langwierige Firnis− und Schmutzabnahme brachte wieder die alte Farbigkeit zutage. Fehlstellen wurden<br />
retuschiert und die Malschicht anschließend gefirnisst. Die gegenüberstehenden Fotos zeigen die verschiedenen Zustände.<br />
Auf der Tafel des Petrus ist deutlich die <strong>Felsenkirche</strong> abgemalt und daher ein frühes Portrait ihres Zustandes im 17. Jh.<br />
Das Sebastiansbild auf der Empore<br />
Das Sebastiansbild ist im frühen 17. Jh. entstanden. Es besitzt die Maße von 2,50 m Höhe und 1,70 m Breite. Die Malerei ist mit<br />
Harzölfarben auf verleimte Fichtenholzbretter aufgetragen.<br />
Bild 43: Sebastiansbild<br />
1979 wurde das Tafelbild abgehängt und konserviert. Die Bretter hatten sich durch Schrumpfung an ihren Fugen klaffend geöffnet.<br />
Die Malschicht war aufstehend und locker.<br />
Ein dicker, verbräunter Firnis verhinderte die Ablesbarkeit der Darstellung. Übermalungen früherer Bearbeitungen verfälschten das<br />
Aussehen. Durch eine Oberflächensicherung der Maischicht mit Japanpapier, einer Klebemasse aus Wachs und Dammar und der<br />
Bearbeitung mit Heizspachteln konnte die Malschicht gefestigt werden.<br />
Die Übermalungen und der total gebräunte Firnis wurden mit Lösemitteln unter Zuhilfenahme eines Stereomikroskops abgelöst.<br />
Die klaffenden Bretter wurden wieder verleimt, Fehlstellen wurden geschlossen und anschließend exakt retuschiert.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
47
Ein schützender Firnis aus Dammarharz bildete die Schutzschicht.<br />
Grabsteine in der <strong>Felsenkirche</strong><br />
In der <strong>Felsenkirche</strong> befinden sich 3 Grabsteine aus Sandstein, wovon der des Ritters Philipp von 1432, mit 2,21 m Höhe und 1,05<br />
m Breite der bedeutendste ist. Er zeigt diesen in Lebensgröße in seinem Harnisch, mit untergezogenem Kettenhemd, Kettenhaube,<br />
Arm− und Beinschienen und einem wehenden Mantel.<br />
Bild 57: Grabplatte N.N. von Daun−Oberstein (gest. 1615)<br />
Die Oberfläche des Steines war mit modernen wässrigen Kunstharzfarben mehrmals im Sandsteinton überstrichen worden und<br />
dadurch verschmiert.<br />
Mit Lösepasten auf Benzolbasis wurden diese dicken Schichten abgelöst und mit Neutralisierungsstoffen nachgewaschen und<br />
gereinigt.<br />
In den geschützten Tiefen fanden sich noch minimale Reste einer nicht einzuordnenden Fassung in Blau und Rot.<br />
Nach der Abnahme der Übermalungsschichten wurden die weißen Fehl− und Bruchstellen des Steines mit schwach gebundenen<br />
Lasurfarben punktartig zurückgedrängt.<br />
Die beiden anderen Grabsteine (Größe 2,05 /0,92 m und 1,80/0,66 m), teilweise stark abgetreten (sie lagen ehemals im<br />
Kirchenboden), hatten die gleichen Übermalungszustände und wurden auch, wie der Grabstein des Ritters Philipp, bearbeitet.<br />
Literatur:<br />
Restaurierbericht Peter R. Pracher 1976.<br />
Katalog Kunst um 1400 am Mittelrhein, Liebighaus, Frankfurt 1976.<br />
Nut Nicolaus, Du Monts Handbuch der Gemäldekunde.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
48
Eduard Finke: Die Sanierungsmaßnahmen<br />
Dem Chronisten, der über den Ablauf der letzten Sanierungsarbeiten berichten darf, fällt schon bei der Suche nach einem<br />
geeigneten Anfang auf, dass dies ein schwieriges Unterfangen ist, zumal er weiß, dass kompetente Leute über die Geschichte der<br />
<strong>Felsenkirche</strong> bereits an anderer Stelle dieser <strong>Festschrift</strong> maßgeblich zu Wort gekommen sind. Es bleibt − da es sich bei dem<br />
Chronisten um einen Denkmalpfleger handelt − nicht aus, dass er in die Geschichte der vielfältigen Arbeiten an dieser sehr<br />
spektakulär situierten Kirche einsteigt, um sozusagen die jetzigen Maßnahmen nicht im geschichtslosen Raum schweben zu<br />
lassen.<br />
Wenn man anlässlich der <strong>500</strong>−Jahrfeier der <strong>Felsenkirche</strong> zu Oberstein eine Festwoche veranstaltet und dazu eine <strong>Festschrift</strong><br />
herausgibt, so kann man davon ausgehen, dass sich die Jubilarin nicht in einem desolaten Zustand präsentiert. Dies bedeutet<br />
jedoch nicht unbedingt, dass das zu besprechende Objekt immer gesund gewesen ist, vielmehr muss man annehmen, dass<br />
Renovierungs− bzw. Restaurierungsarbeiten eben ihre Ursache in ,,Krankheiten“ haben, die es zu beseitigen gilt, damit das Objekt<br />
möglichst lange überlebt, zumindest jedoch sich während der Festzeit im allerfeinsten Gewand den Festgeladenen darstellt.<br />
Vergleicht man weiterhin die <strong>Felsenkirche</strong> mit einem Jubilar aus Fleisch und Blut, so kann man nur hoffen, dass derjenige, der die<br />
Therapie aufgrund einer Krankengeschichte verordnet, auch die vorhergehenden Krankheiten analysiert hat. Wie so üblich, geht<br />
man zur Geburtsstunde zurück und entdeckt, vorausgesetzt man nimmt an, dass das Festjahr 1984 nicht willkürlich gewählt ist,<br />
dass die Geburtsstunde im Jahr 1484 geschlagen haben muss. Bei der Untersuchung des Embryonalzustandes ergibt sich, dass<br />
die Geburtshelfer, d.h. die damals für die Erbauung der neuen Kirche Verantwortlichen, bereits 1482 auf Bitten der Bürger, den<br />
Plan eines Erweiterungsbaues der Felsenkapelle in Erwägung gezogen hatten, weil sich in der Enge des Ortes Oberstein kein<br />
geeigneter Bauplatz fand. Am 23. August 1482 traf dann auch die päpstliche Genehmigung ein, und am 10. Januar 1484 konnte<br />
der Neubau eingeweiht werden1). In der Tat bestätigt sich hier die Vermutung, dass was sich 1984 zum <strong>500</strong>. Male jährt, nicht die<br />
Geburt, sondern eigentlich die Taufe des Neugeborenen ist. Die eigentliche Geburtsstunde muss sich demnach folgerichtig im Jahr<br />
1483 vollzogen haben. In diesem Jahr ist Martin Luther geboren worden, dessen <strong>500</strong>. Geburtstag wir im vergangenen Jahr<br />
ebenfalls feiern konnten und dessen Lehren erst im <strong>Jahre</strong> seines Todes, 1546, in Oberstein Eingang gefunden haben. Nach<br />
längeren Streitigkeiten um die konfessionelle Zugehörigkeit der neuerbauten Kirche nach dem Prinzip cuius regio, eius religio“<br />
konnte sich 1641 der Protestantismus endgültig im Obersteiner Gebiet festsetzen. Die katholische Kirchengemeinde erhielt 1684<br />
unter den Franzosen am Marktplatz eine eigene Kirche2).<br />
Es ist sicher, dass die sog. <strong>Felsenkirche</strong> 1484 dieselben Ausmaße hatte, die man heute noch antrifft.<br />
Der Felsen, an dessen Steilhang die Kirche gebaut ist und der für die Geschichte von Oberstein von so eminenter Bedeutung<br />
wurde − nicht zuletzt steht auf ihm das alte Schloss − hat seinen Einfluss auch in negativer Weise auf die Geschicke der von ihm<br />
eigentlich zu beschützenden Kirche wirksam werden lassen. Selbst der benachbarte Felsen − auf dem das sog. Neue Schloss<br />
errichtet ist − versetzte die Bevölkerung mehrfach in Schrecken. Es wird berichtet, dass bereits 1650 die Ostmauer des Neuen<br />
Schlosses gebrochen war und den Berghang hinabrollte bis zu der alten Pfarrwohnung am Marktplatz. Felsstürze bedrohten immer<br />
mehr die Kirche und die Häuser unterhalb der Felsen. 1660 wurde so das Haus eines Wollwebers zerschlagen; zwei seiner Kinder<br />
waren auf der Stelle tot, die Frau und ein weiteres Kind schwer verletzt 3). Das Strohdach der <strong>Felsenkirche</strong> hatte man 1724 durch<br />
Schiefer ersetzt. Achtzehn <strong>Jahre</strong> später hatte der größte Felssturz, den die Kirche bis dahin erlebt hatte, das neu beschieferte<br />
Dach und das gotische Rippengewölbe des Kirchenschiffes zerstört. Die Bevölkerung zeigte sich immer mehr beunruhigt, und zum<br />
Aufbau hatte man keine Lust, denn keiner wollte sich zukünftig beim Gottesdienst einer lebensbedrohenden Gefahr aussetzen. Erst<br />
zwei <strong>Jahre</strong> später, also im <strong>Jahre</strong> 1744, konnte die Kirche wieder eingeweiht werden, nachdem zu dem Wiederaufbau vielerlei<br />
Spenden zur Erneuerung, nicht nur aus Kreisen der Bevölkerung, sondern auch von weither zusammengekommen waren. Da es<br />
jedoch nicht zur Wiederherstellung des gotischen Rippengewölbes ausreichte, überspannte man, als einfachere Lösung, das Schiff<br />
mit einer Tonne, wie dies in der Barockzeit öfters gemacht wurde4).<br />
Nahezu einhundert <strong>Jahre</strong> blieb der Felsen nunmehr ruhig, denn erst 1838 geriet er wieder in Bewegung. Die evangelische<br />
Gemeinde beriet nun in aller Ruhe, ob es nicht zweckmäßiger sei, an anderer Stelle in der Stadt eine neue Kirche zu erbauen, um<br />
dieser nicht zu kontrollierenden Gefahr einfach aus dem Wege zu gehen und auch die Beschwernis des steilen Anstieges zur<br />
Kirche abzuschaffen. Aus Kostengründen konnte dies jedoch nicht bewerkstelligt werden, sodass man sich zunächst mit einer<br />
Reparatur begnügte. Zwanzig <strong>Jahre</strong> später stand man jedoch wieder vor dem gleichen Problem, und kam auch damals nicht<br />
weiter, sondern gab lediglich dem Turm die Gestalt, die er noch bis 1928 /29 beibehalten hat. Die Gedanken um eine Neuplanung<br />
an anderer Stelle kamen jedoch wegen des sich nicht beruhigenden Steinschlages und des beschwerlichen Aufstieges nicht zur<br />
Ruhe, sondern wurden auch durch die Tatsache gefördert, dass die Bevölkerung ständig zunahm und in der Kirche am Felsen kein<br />
rechter Platz mehr war. 1822 gründete man dann einen Kirchenbaufonds, und ein Bauplatz wurde 150 m flussaufwärts − ziemlich<br />
dicht an der Hauptstraße − erworben, auf dem 1916 der Neubau errichtet werden sollte. Der ausgebrochene Krieg verhinderte<br />
zunächst den Neubau, und nach demselben verschlang die Inflation den gesamten Kirchenbaufonds, sodass das Vorhaben<br />
ausgesetzt und zunächst aus den Gedanken der Bevölkerung gewichen war.<br />
Vermutlich als späte Auswirkungen der Romantik rückte die <strong>Felsenkirche</strong> immer stärker in den Mittelpunkt des Interesses der<br />
Bevölkerung, dies nicht nur als Kirche, sondern viel mehr noch als Wahrzeichen und Attraktion der Stadt.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
49
Bild 58: Farbliche Erneuerung<br />
Es ist bemerkenswert, dass bereits 1925 die <strong>Felsenkirche</strong> nach dem Denkmalschutzgesetz für das Großherzogtum Oldenburg vom<br />
18. Mai 1911 unter Schutz gestellt worden war, also über ein halbes Jahrhundert bevor − nach der Gründung des Landes<br />
Rheinland−Pfalz − im <strong>Jahre</strong> 1978 das zurzeit gültige Denkmalschutz− und −pflegegesetz verabschiedet wurde. Der<br />
Regierungspräsident mit Sitz in Birkenfeld ließ den baulichen Zustand der Kirche genauestens untersuchen, und man beschloss<br />
daraufhin eine gründliche Renovierung, die auf lange Sicht Bestand haben sollte. Der damalige Generalkonservator und spätere<br />
Ministerialdirigent Dr. Hiecke nahm von Berlin einen bestimmenden Einfluss auf die Umbaumaßnahmen der <strong>Felsenkirche</strong>, indem er<br />
unter anderem den Architekten Heilig aus Darmstadt empfahl5).<br />
Die Renovierungs− und Umbaumaßnahmen der <strong>Jahre</strong> 1927 bis 1929 verschlangen eine Menge Geld. Eine Inschrift am großen<br />
Pfeiler neben der Quelle beschreibt die Erinnerung an diese Maßnahmen der Renovierung, wie folgt:<br />
,,DIE FELSENKIRCHE VON OBERSTEIN WURDE ERNEUERT IN DEN JAHREN 1927 −29 IM AUFTRAG<br />
DER OLDENBURGISCHEN REGIERUNG IN BIRKENFELD UNTER DEM REGIERUNGSPRÄSIDENTEN<br />
DÖRR DURCH DEN ARCHITEKTEN HEILIG WÄHREND DER AMTSZEIT DES PFARRERS ROTH. AN DER<br />
AUFBRINGUNG DER MITTEL HABEN SICH BETEILIGT: DAS REICH, PREUSSEN, DER FREISTAAT<br />
OLDENBURG, DER LANDESTEIL BIRKENFELD, DIE LANDESKIRCHENKASSE UND DIE<br />
KIRCHENGEMEINDE OBERSTEIN.“<br />
Die Leistung von Architekt Heilig muss heute noch als bedeutsam bezeichnet werden. Heilig betont − 25 <strong>Jahre</strong> nach der<br />
Maßnahme − in einem Schreiben, dass die Trockenlegung der <strong>Jahre</strong> 1927/29 mit all ihren technischen Manipulationen das<br />
gehalten habe, war er einstens versprochen hatte.<br />
Unabhängig von dieser Leistung muss es dem Konservator nach nunmehr über fünf Jahrzehnten gestattet sein, auch kritische<br />
Anmerkungen über die Renovierung der <strong>Felsenkirche</strong> festzuhalten, dies umso mehr, als die Renovierung von damals heute noch<br />
das Erscheinungsbild der <strong>Felsenkirche</strong> prägt. Durch die Beseitigung der barocken Tonnenwölbung und das Einziehen einer flachen<br />
Holzbalkendecke wurden die hohen und breiten gotischen Fenster wieder völlig freigestellt. Andererseits wurden wertvolle<br />
baugeschichtliche Relikte und Hinweise verbaut, wie man auch ganz allgemein feststellen muss, dass eine puristische Bereinigung<br />
sowohl am Innenraum als auch an dem äußeren Erscheinungsbild der Kirche stattgefunden hatte. Da jedoch diese puristische<br />
Grundhaltung sich nicht auf die ehemalige gotische Substanz zurückgezogen hatte, entstand durch die Handschrift Heiligs mehr<br />
ein Dokument des damaligen Stilempfindens als ein Herauskristallisieren der mittelalterlichen Bausubstanz. Selbst barocke<br />
Einbauten wie die Kirchenbänke und andere Ausstattungsstücke wie Emporenteile usw. wurden radikal beseitigt.<br />
Es mag durchaus einen Architekten auszeichnen, wenn durch seine Werke sowohl der Zeitstil als auch sein eigenes Stilempfinden<br />
zum Ausdruck kommt; für die konservatorische Behandlung einer historischen Bausubstanz wäre jedoch mehr Zurückhaltung und<br />
Respekt ihr gegenüber angebracht.<br />
Diese Diskrepanz ist heute im Umgang mit historischer Bausubstanz öfters spürbar, und sie wird andauern und peinlich bleiben,<br />
solange sich die Architekten nicht darüber klar werden können, dass ein Kulturdenkmal nicht dazu geeignet ist, sich und dem<br />
jeweils herrschenden Zeitgeist ein Denkmal zu setzen. Die staatliche Denkmalpflege darf, ja sie sollte vielmehr, trotz vieler<br />
Niederlagen und auch eigener Fehler nicht müde werden, ihrer Verpflichtung als ausgleichender Faktor im Umgang mit dem uns<br />
allen überlassenen Kulturgut nach bestem fachlichen Wissen gerecht zu werden. Das folgende − kommentarlos wiedergegebene −<br />
Doppelzitat möge den Chronisten aus der Gefahr allzu heftiger Kritik befreien, da die beiden zitierten Herren für die retrospektive<br />
Betrachtung dieser Maßnahme am geeignetsten erscheinen. Architekt Heilig schildert einen gemeinsamen Besuch mit Dr. Hiecke<br />
in der <strong>Felsenkirche</strong> im <strong>Jahre</strong> 1952 wie folgt:<br />
,,Gemeinsam in der Kirche stehend drückte er mir die Hand, indem er erklärte: ,,Eine Farbensymphonie, wie ich<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
50
sie selten gesehen habe, im Ganzen betrachtet eine jener wenigen restlos gelungenen Instandsetzungen, die<br />
besonders hervorzuheben ist, weil sie einem Neubau fast gleichkommt, ja, durch die Art und Weise der<br />
Trockenlegung das übliche Ausmaß eines Neubaues noch übersteigt.“6)<br />
Bereits seit 1927 − kurz vor dem Beginn der Renovierungsarbeiten − konnte man auch abends die Konturen dieses Kleinods<br />
oberhalb von Oberstein durch eine installierte Scheinwerferanlage bewundern.<br />
In geziemender Distanz, jedoch mit der Stadt und ihrer Geschichte u. a. durch die Liebe der Bevölkerung engstens verbunden,<br />
erlebte die Kirche dann auch die Vereinigung der beiden Gemeinden mit dem Zusammenschluss von Idar und Oberstein zu einer<br />
Stadt am 1. Oktober 1933. Das Wunschkind der mittelalterlichen Gemeinde musste nun − 450 <strong>Jahre</strong> nach seiner Geburt − im<br />
Innern und Äußern neu gestaltet, als Wahrzeichen der neuen Stadt Idar−Oberstein mit ansehen, wie es in das Großdeutsche Reich<br />
zwangsweise mit übernommen wurde. Der Fels, der seiner behütenden Aufgabe nicht immer ganz gerecht wurde, vielmehr seinen<br />
Schützling arg zerzaust hatte, zeigte sich während der Wirren des letzten Weltkrieges sehr gnädig, denn die Bomben konnten<br />
,,seiner“ Kirche nichts zu leide tun. Lediglich in den letzten Kriegstagen wurden durch eine sinnlose Sprengung der Brücke am<br />
Marktplatz einige Kirchenfenster teilweise beschädigt. Die Sirene, neben dem Turn errichtet, ließ man auch heute in unserer von<br />
vielen Friedensworten erfüllten Zeit bestehen, und so erinnert uns dieselbe an eine unglückselige Zeit.<br />
Unbeeindruckt von dem neuen Gewand der Kirche und den Zeitläufen hielt die Bedrohung durch den Felsen für die Kirche<br />
weiterhin an, und so löste sich am 6. August 1946, gegen 7 Uhr in der Früh, eine größere Masse Gesteins und stürzte zu Tal. Die<br />
Kirche jedoch blieb glücklicherweise unversehrt.<br />
Nahezu unlösbar mit der Geschichte der <strong>Felsenkirche</strong> und deren Bedeutung ist − auch überregional betrachtet − die Existenz ihres<br />
mittelalterlichen Altarbildes verbunden. 1927, während der Renovierungsarbeiten, quasi ,,wieder entdeckt“, beschäftigt es seitdem<br />
die Kunstgeschichte. Im Zusammenhang mit diesem Bericht soll deshalb auf die Odyssee eingegangen werden, der sich das<br />
wertvolle Triptychon während und nach dem Krieg unterziehen musste. Bereits 1927 ausquartiert, restauriert und anlässlich der<br />
Ausstellung ,,Alte Kunst am Mittelrhein“, die 1927 in Darmstadt veranstaltet wurde, einem größeren Kreis vorgestellt, kehrte es<br />
1929 in die <strong>Felsenkirche</strong> zurück. Kurz vor Ausbruch des letzten Krieges begann im Herbst 1939 eine größere Reise, die das<br />
Triptychon unternehmen musste, um es vor den Gefahren des bevorstehenden Krieges zu schützen. Eine diesbezügliche<br />
Empfangsbescheinigung des Provinzialkonservators der Rheinprovinz in Bonn hat folgenden Wortlaut:<br />
,,Zum Zwecke der Bergung gegen Gefährdung im Kriege wurde der o.g. Dienststelle für die Dauer des Krieges<br />
leihweise überlassen:<br />
Laufende Nr. 1 Gegenstand: 1 Flügelaltar aus der <strong>Felsenkirche</strong> in Oberstein (ohne Predella)<br />
Eigentümer: Evangelische Kirchengemeinde in Oberstein<br />
Bemerkungen: Kiste, in der das Altarbild verpackt ist, gehört der Kirchengemeinde.<br />
Datum: 5. September 1939<br />
Im Auftrage: gez. Dr. H. Neu.“<br />
Die evangelische Kirchengemeinde Oberstein bestätigt in einer Erklärung vom 12. Juni 1940 dem Provinzialkonservator, wie folgt:<br />
,,Der Provinzialkonservator hat im staatlichen Auftrage die, in der vorläufigen Empfangsbescheinigung vom 5.<br />
September 1939, gez. Dr. H. Neu aufgeführten, uns gehörigen Kunstgegenstände zu ihrer erhöhten Sicherheit<br />
an einen Ort verbracht, an dem sie aller Voraussicht nach vor Feindeinwirkungen weitestgehend geschützt<br />
sind.<br />
Wir erklären uns mit allen zum Schutz der Gegenstände getroffenen und ggf. noch zu treffenden Maßnahmen<br />
für die Dauer des Krieges einverstanden. Wir sind darauf hingewiesen worden, dass eine etwaige Versicherung<br />
der Kunstgegenstände nach wie vor unsere Angelegenheit ist.<br />
Der Vorsitzende des Presbyteriums gez. Bido, Pfarrer.“<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Erstmals nach dem Kriege wird in einem Schreiben des Landeskonservators von Rheinland−Hessen−Nassau vom 2. Mai 1946 auf<br />
den Verbleib des Triptychons hingewiesen. In diesem Schreiben teilt der Landeskonservator mit, dass seinerzeit der Flügelaltar<br />
durch den Provinzialkonservator auf Schloss Crottorf, einem Wasserschloss bei Friesenhagen im Kreis Altenkirchen, verbracht<br />
worden war. Weiterhin heißt es in diesem Brief, dass die evangelische Gemeinde diesen Altar wieder zurückhaben möchte, und es<br />
wird um Auskunft gebeten, wie eine derartige Rückführung zu bewerkstelligen sei. Nach zahlreicher Korrespondenz ergab sich,<br />
dass das Tafelbild aus dem collecting point in Wiesbaden kurzfristig durch die Amerikaner nach Schloss Dyck bei Grevenbroich<br />
verbracht worden war, um dann wieder in Wiesbaden in dem Sammeldepot zu landen. Von dort kam es endlich im März 1949,<br />
nach zehnjähriger Abwesenheit, in die <strong>Felsenkirche</strong> zurück10).<br />
51
Wegen der zahlreichen Schäden konnte jedoch das Triptychon nicht aufgestellt werden, sodass es nach kurzem Aufenthalt in der<br />
<strong>Felsenkirche</strong> abermals auf Reisen gehen musste: die Restauratorin Flinsch hatte es in ihrem Atelier in Gau−Bischofsheim<br />
restauriert, sodass es 1952 endlich wieder in der <strong>Felsenkirche</strong> aufgestellt werden konnte 11), 12).<br />
Dem Chronisten sei es verziehen, dass er bei der Beschreibung des Krankheitsbildes dieses für Idar−Oberstein so wichtigen<br />
Kindes auch auf dessen ,,Herzstück“ − selbst wenn es nicht von Geburt an eine Einheit mit ihm bildete − eingehen musste. So<br />
gesehen, ist eben das Altarbild nicht ,,nur“ ein Ausstattungsgegenstand, sondern auch die ,,Seele“ der <strong>Felsenkirche</strong>, ohne die ganz<br />
gewiss die <strong>Felsenkirche</strong> nicht das geblieben wäre, was sie heute neben der Baugeschichte hauptsächlich auch für die<br />
Kunstgeschichte bedeutet.<br />
Es dürfte kein Zufall sein, dass die Nachkriegsgeschichte der <strong>Felsenkirche</strong> mit der Sorge der Gemeinde um das dreiflügelige<br />
Altarbild beginnt. Hier setzt nach dem Kriege auch die Tätigkeit der staatlichen Denkmalpflege ein, indem neben dem Bemühen um<br />
die Rückführung des Bildes aus ihren Mitteln auch die Restaurierung in Höhe von DM 1.400,− bezahlt wurde 13).<br />
Mehr als an anderen historischen Kirchengebäuden bedarf es wegen der exponierten Lage der <strong>Felsenkirche</strong> einer<br />
immerwährenden Sorgfalt, die nur zu vergleichen ist mit derjenigen an unseren Burgen und Schlössern, die teilweise ähnlich<br />
spektakulär in die Topografie eingebunden sind.<br />
Zu Beginn des <strong>Jahre</strong>s 1959 wurde von dem ortsansässigen Malermeister Stoltz der Innenraum der Kirche farbig neu gefasst.<br />
Anlässlich einer diesbezüglichen Besprechung konnte die staatliche Denkmalpflege feststellen, dass diese Arbeiten im Großen und<br />
Ganzen einen fachlich guten Verlauf nahmen, baten jedoch, einen Kirchenmaler für die weiteren farbigen Fassungen<br />
hinzuzuziehen14). Mit Schreiben vom 19.1.1959 schildert dann der Kirchenmaler und Restaurator Velte seine Eindrücke, die er<br />
anlässlich eines Besuches in der <strong>Felsenkirche</strong> gewonnen hatte, wie folgt:<br />
,,Bei meinem Besuch am 13. Januar 1959 waren die Wände der Kirche fertig gestrichen. Die gelblichen<br />
Wandteile und Fensternischen wurden ebenfalls im hellen Wandton überstrichen. Die Arkadenbogen wurden<br />
grau betont und mit 3 cm breiten Begleitlinien versehen.<br />
An der Holzdecke wurden die rot angesetzten Absetzungen am Balkenwerk für gut befunden, jedoch der<br />
Farbton etwas verändert (englischrot).<br />
Die Gewölberippen, die Fenstergewände und die Steinepitaphien wurden in einem warmen Graufarbton<br />
nochmals lasiert. An der Orgelempore wurde die Untersicht in englischrot gestrichen.<br />
Die sichtbaren Felsenteile in der Kirche mussten in Grau belassen werden, da sie im Wandton gestrichen<br />
ungünstig wirkten.<br />
Weiter habe ich vorgeschlagen, die vorhandenen Goldabsetzungen an den Emporen und an der Kanzel mit<br />
echtem 22 Karat Rollengold neu zu vergolden.<br />
Die Bänke werden im Farbton der Empore (alteiche) neu lasiert, die Buchbretter und die Abdeckprofile an den<br />
Bankköpfen in einem Schwarzgrau gestrichen, die Buchbrettleisten in englischrot abgesetzt. . . ." 15)<br />
Dieser Bericht schildert den Zustand des Innenraumes, wie er bis zur letzten Renovierung Bestand hatte.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Für das Gesamtkunstwerk <strong>Felsenkirche</strong> ist es nicht unerheblich, dass Dr. Rentsch vom Kunsthistorischen Institut der Universität<br />
Bonn im <strong>Jahre</strong> 1961 im Rahmen einer von der UNESCO geförderten internationalen Gemeinschaftsarbeit die mittelalterlichen<br />
Glasmalereien der <strong>Felsenkirche</strong> in das ,, Gorpus Vitrearum“ aufgenommen hat 16)<br />
Im <strong>Jahre</strong> 1964 stellte man fest, dass der Außenputz an der <strong>Felsenkirche</strong>, anlässlich der Renovierung in den <strong>Jahre</strong>n 1928/29<br />
angebracht, an verschiedenen Stellen gerissen und sich mehrfach gelöst hatte 17). Dieser Schaden trat auf, da man damals den<br />
Außenputz aus Beton hergestellt hatte, dessen Eisenarmierungen durch Rost die Putzschichten aufgesprengt hatte. Die Kosten für<br />
diese Ausbesserungsarbeiten beliefen sich auf DM 3.000,−, von denen DM 2.000,− die staatliche Denkmalpflege übernahm 18).<br />
Nicht zuletzt durch die Ausbesserungsarbeiten am Putzwerk der <strong>Felsenkirche</strong> war ein neuer Außenanstrich notwendig geworden,<br />
der jedoch nach Aussage der Kirchengemeinde erst nach der anstehenden und unbedingt notwendig gewordenen Felsbereinigung<br />
durchgeführt werden sollte. Die Diskussion um den sog. ,,grünen Tarnanstrich“ der <strong>Felsenkirche</strong> begann damals bereits, zumal<br />
man behauptete, dass dieser auf einen Vorschlag der rheinischen Denkmalpflege zurückzuführen sei 19). In einem Schreiben vom<br />
Oktober 1974 betont die rheinland−pfälzische Denkmalpflege hingegen, dass man vorsorglich darauf hinweisen muss, dass bei<br />
einem so einzigartigen und nicht nur für das Stadtbild wichtigen Baudenkmal die neue Farbgebung gründlich überlegt werden<br />
müsse. Den grünlichen Anstrich halte man nicht für glücklich, denn gerade die Vorstellung über die Farbgebung mittelalterlicher<br />
Kirchen habe sich im Laufe der Zeit dahingehend entwickelt, dass z.B. eine neue Farbfassung das Bauwerk vom natürlichen<br />
Hintergrund als ein eigenständig geformtes Kunstwerk durchaus abheben sollte, ohne deswegen in Disharmonie mit der Natur zu<br />
52
treten; dies sei eine Konzeption, die bei Restaurierungen von Kirchen und auch Burgen allgemein zugrunde gelegt werde.<br />
In den folgenden <strong>Jahre</strong>n trat das Problem um die neue Farbgestaltung der <strong>Felsenkirche</strong> aus den bereits erwähnten Gründen in den<br />
Hintergrund.<br />
Bild 59<br />
Im <strong>Jahre</strong> 1976 musste das Altarretabel abermals auf eine Reise gehen, denn es wurde im Frühjahr dieses <strong>Jahre</strong>s zu einer<br />
Ausstellung nach Frankfurt entliehen. Im Gegensatz zu den vorherigen Verschickungen handelte es sich diesmal nicht um eine<br />
Sicherungsverwahrung bzw. um einen ,,Kuraufenthalt“, sondern vielmehr um eine Zurschaustellung dieses sehr wertvollen Bildes.<br />
So begrüßenswert wie es einerseits ist, dass derartige Kunstgegenstände einer sehr breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden, so<br />
muss man andererseits betonen, dass derartige Verleihungen mir äußersten Gefahren für das Objekt selbst verbunden sind. Der<br />
dabei immer wieder angesprochene Versicherungswert kann in keiner Weise dem eigentlichen Wert des Kunstgegenstandes<br />
gerecht werden. Die Tatsache, dass man anlässlich dieser Ausstellung im Liebig−Haus in Frankfurt von der Museumsleitung<br />
darauf aufmerksam gemacht wurde, dass das Bild dringend restauriert werden müsse, da sich an vielen Stellen die Farbe vom<br />
Untergrund abhebe21), kann man nur in hypothetischer Weise ursächlich mit derartigen Reisen von Kulturgütern in Verbindung<br />
bringen. Jedenfalls führte diese Schadensfeststellung anlässlich der Frankfurter Zurschaustellung zu einem größeren<br />
,,Kuraufenthalt“ in den Werkstätten der renommierten Restauratorenfirma Pracher nach Würzburg. Sowohl die angewandten<br />
,,Kurmittel“ als auch die Beschreibung des Zustandes des ,,Patienten“ wird an anderer Stelle dieser <strong>Festschrift</strong> gewürdigt.<br />
Parallel zu den Restaurierungsarbeiten der <strong>Felsenkirche</strong> und deren Altarbild fand die umfangreiche Felssicherung und der Einbau<br />
eines Tunnelstollens zur Verbesserung des Aufganges zur <strong>Felsenkirche</strong> statt.<br />
Kurz nach Rückkehr des Altarbildes begannen auch die Malerarbeiten an der Kirche, sodass die staatliche Denkmalpflege<br />
anlässlich eines Besuches am 19.8.1980 in der <strong>Felsenkirche</strong> feststellen konnte, dass die für die Innenausmalung der Kirche<br />
vorgesehene weiße Farbe bereits gekauft worden war. Dies war aus konservatorischen Gründen nicht zu bemängeln, denn ein<br />
sog. Kirchenweiß konnte, hauptsächlich weil kein originaler Farbbefund zu erwarten war, akzeptiert werden. Bei einem weiteren<br />
Besuch der staatlichen Denkmalpflege in der <strong>Felsenkirche</strong> stellte der amtliche Restaurator nach der Untersuchung der Rippen im<br />
Seitenschiff, wie folgt, fest:<br />
,,Unter der jetzt sichtbaren gelblichen Sandsteinlasur befinden sich noch größere Reste einer Goldockerfassung, basierend auf<br />
einem sehr weißen, weichen Kalkanstrich. Auf dem kleinen Wappenschild der Rippenkonsole im Kirchenschiff sind ebenfalls<br />
Farbreste gefunden worden; sie betreffen einen Rot− bzw. Ockerfarbton. Eine genauere Untersuchung unter Zuhilfenahme eines<br />
Gerüstes solle feststellen, ob weitere originale Farbigkeit anzutreffen sei“ 22).<br />
Diese Untersuchung konnte dann am 11.2.1981 durchgeführt werden; sie führte zu folgendem Ergebnis:<br />
1. Wand− und Gewölbeanstrich.<br />
Im Innenraum der Kirche auf Wand− und Gewölbeflächen kommt der gleiche gebrochene weiße Farbton zur Anwendung, wie er<br />
bereits an der Fassade verarbeitet wurde. Im Sockelbereich müssen jedoch die Dispersionsfarbanstriche (im Sockel schwarz, auf<br />
der unteren Wandfläche weiß) vor dem mineralischen Neuanstrich entfernt werden.<br />
2. Rippen, Spolien, Konsolen.<br />
Die Architektur des Innenraumes wird nach Befund in einem Ockerfarbton gefasst... . Der Ockerfarbton wird auf einer<br />
Weißunterlage verarbeitet, analog des historischen Anstrichaufbaus. Eine anschließende Gliederung der Rippen wird mittels<br />
weißer Fugenstriche, welche identisch sein sollen mit den tatsächlichen Versatzfugen der Rippensteine, durchgeführt.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
53
3. Figürliche Rippenkonsole auf der Empore, nördliches Seitenschiff.<br />
Die bildhauerisch sehr schön in gelb−grünem Sandstein gearbeitete Konsole wird analog eine mittelalterliche Inkarnatsfassung<br />
erhalten.<br />
4. Rautenwappen im Maßwerk sowie auf der darüberliegenden Konsole unter einer<br />
Rippenspolie im Langhaus, Nordwand.<br />
Die beiden Wappenschilde, gleiche Darstellung, werden wieder in ihren heraldischen Farben gefasst. Hierzu wird Kontakt mit dem<br />
örtlichen Museum aufgenommen, um die richtige Farbigkeit zu klären.<br />
5. Reinigung der Grabmale.<br />
Alle Grabmale, drei große, ein kleines, befinden sich in einem sehr guten Zustand. Hier wird nur mit klarem Wasser eine<br />
Oberflächenreinigung durchgeführt. Der Einsatz von Reinigungspasten, Säuren etc. sowie anschließendes Hydrophobieren und<br />
Lasieren ist in diesem Falle nicht notwendig und kommt somit auch nicht zur Durchführung.<br />
Bild 60: Sebastiansbild während der Reinigung<br />
6. Inventar wie Orgel, Kanzel, Herrenstuhl, Kirchengestühl.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Alle notwendigen Maßnahmen an den o.g. Einrichtungsgegenständen werden bei einem der nächsten Ortstermine besprochen und<br />
festgelegt.“23)<br />
In den darauf folgenden Wochen fanden mehrere Besprechungen aller Beteiligten statt, die zum Ziele hatten, die Restarbeiten an<br />
der farbigen Fassung zu einem allseits befriedigenden und harmonischen Ende zu führen. Hierbei wurde sowohl auf die<br />
Innenausstattung als auch auf die Wünsche des Presbyteriums sowie auf die bereits vorhandene farbige Fassung der Kirche<br />
Rücksicht genommen.<br />
Der Befund an den gotischen Rippen im Innenraum war mitbestimmend für die Entscheidung, die bei den<br />
Renovierungsmaßnahmen 1927/28 veränderten Gewände der gotischen Fenster sowohl im Innen− als auch im Außenbereich<br />
gleichmäßig mir dem gelblichen Farbton zu behandeln. So trägt u.a. die einheitliche Behandlung der Außenwände und der<br />
Architekturgliederungselemente zu einer Zusammenfassung des historischen Gebäudes bei. Durch den Auftrag dieser Farbe,<br />
selbst auf die nur torsohaften Gewölbeanfänger im Innenraum der Kirche, soll dem Besucher angedeutet werden − quasi in einer<br />
musealen Phase − dass die ursprüngliche gotische Architektur nicht mehr überall vorhanden ist, man diese jedoch sich in einer Art<br />
gedanklichen Rekonstruktion vorstellen kann.<br />
Den Bürgern von Idar−Oberstein und Umgebung mag dieses neue Kleid ihrer <strong>Felsenkirche</strong> zunächst überhaupt nicht behagt<br />
haben, was u.a. darin begründet ist, dass der grünliche Tarnanstrich bereits in ihr Bewusstsein so tief eingewurzelt war, dass er<br />
fast als historisch angesehen wurde. Übersteigert wird dieses subjektive Empfinden ganz gewiss noch dadurch, dass der Felsen<br />
durch seine Betonkosmetik einen sehr unnatürlichen Eindruck erweckt und dadurch die Kirche ein der Natur widersprechendes<br />
Passepartout umgibt. Wenn man davon ausgehen möchte, dass die <strong>Felsenkirche</strong> gerade von dieser natürlichen Umgebung am<br />
steilen Felshang in ihrem Erscheinungsbild lebt, so ist festzuhalten, dass diese fremdartige Umgebung jetzt leider nur wie eine<br />
Theaterkulisse aus Pappmaschee wirkt. Neben dieser sicher sehr hart klingenden Kritik darf man jedoch nicht vergessen, dass der<br />
Felsen, der im Laufe der Jahrhunderte so viel Ungemach über die Kirche verbreitet hatte, nur durch gewaltsame Maßnahmen ,,<br />
beruhigt“ werden konnte.<br />
54
Bild 61<br />
Mit Dehio kann man deswegen nur klagen:<br />
,,...die Ärzte sind gefährlicher geworden als die Krankheit selbst; sie haben mit ihren höllischen Latwergen in unseren Tälern,<br />
unseren Bergen weit schlimmer als die Pest getobt“24).<br />
Die Narben dieser Operation am Felsen mögen im Laufe der <strong>Jahre</strong> verheilen, sodass allmählich eine natürliche Patina dieselben<br />
bedeckt.<br />
Angesichts der Tatsache, dass die <strong>Felsenkirche</strong> in erster Linie dem Fremdenverkehr als Attraktion dient und in ihr lediglich noch<br />
einige Gottesdienste während des <strong>Jahre</strong>s abgehalten werden, ist es besonders beachtenswert, dass sich die evangelische<br />
Kirchengemeinde Oberstein in so hervorragender Weise immer wieder für die Pflege dieses Idar−Obersteiner Lieblingskindes<br />
einsetzt. Nicht zuletzt deswegen sollte festgehalten werden, dass die Kosten der Renovierungs− bzw. Restaurierungsarbeiten in<br />
Höhe von DM 61.000,− für die <strong>Jahre</strong> 1978/80 allein von ihr − ohne jeglichen Zuschuss der öffentlichen Hand − aufgebracht wurden.<br />
Dank der sparsamen Haushaltsführung und des sehr hohen Anteiles der Eigenleistung beliefen sich die Kosten für die 1981<br />
endgültig abgeschlossenen Arbeiten lediglich noch auf DM 27.<strong>500</strong> von denen die staatliche Denkmalpflege DM 10.000<br />
übernehmen konnte.<br />
Dem Chronisten sei es am Ende seines zur Fünfhundertjahrfeier verfassten Berichtes gestattet, der Jubilarin <strong>Felsenkirche</strong> zu<br />
wünschen, dass diese <strong>Festschrift</strong> unter anderem dazu beitragen möge, die Bedeutung dieses Kleinods am Felsen − über die<br />
Festwoche hinaus − einem noch größeren Kreis von Menschen näher in das Bewusstsein zu rücken.<br />
Letztlich kann nur eine sehr breite Öffentlichkeit in ihrer vielschichtigen Pluralität durch tatkräftige Hilfe die Eigentümer in ihrer<br />
Verpflichtung für die Erhaltung und Pflege dieses Kulturdenkmals auf Dauer unterstützen.<br />
Anmerkungen:<br />
1), 2), 3), 4), 5), 7) Unveröffentlichtes Manuskript von Dr. Albert Münscher im Archiv des Landesamtes für Denkmalpflege<br />
Rheinland−Pfalz in Mainz.<br />
6) Schreiben vom 16.1.1953 an den Landeskonservator von Rheinland−Pfalz in Koblenz−Oberwerth.<br />
8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 16), 18) Topografische Registratur des Landesamtes für Denkmalpflege Rheinland−Pfalz in Mainz.<br />
15) Schreiben von Restaurator Velte an das Landesamt für Denkmalpflege Rheinland−Pfalz in Mainz.<br />
17) Schreiben der ev. Kirchengemeinde Oberstein vom 27.8. an das Landesamt für Denkmalpflege Rheinland−Pfalz in Mainz.<br />
19) Schreiben des Heimatmuseums Idar−Oberstein vom 20.9.1974 an den Landeskonservator von Rheinland−Pfalz in Mainz.<br />
20) Schreiben des Landesamtes für Denkmalpflege in Mainz vom 7.10.1974 an die ev. Kirchengemeinde Oberstein.<br />
21) Schreiben der ev. Kirchengemeinde Oberstein vom 19.8.1976 an das Landesamt für Denkmalpflege Rheinland−Pfalz in Mainz.<br />
22), 23) Aktenvermerke des Amtsrestaurator Elenz im Landesamt für Denkmalpflege in Mainz vom 11.9.1980 und 16.2.1981.<br />
24) ungeändertes Zitat aus der Rede zur Feier des Geburtstages Sr. Majestät des Kaisers, gehalten in der Aula der<br />
Kaiser−Wilhelm−Universität Straßburg am 27.1.1905 von Dr. Georg Gottfried Dehio, o. Professor der Kunstgeschichte.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
55
Siegfried Seuring: Der Altarraum<br />
Als vorgezogene Maßnahme im Rahmen der Gesamtrenovierungsarbeiten wurde 1977 die Umgestaltung des Altarraumes in<br />
Angriff genommen.<br />
Das Studium alter Fotos und Unterlagen gab wenig Aufschluss über den ursprünglichen Zustand des Raumes, sodass mit Dr.<br />
Caspary vom Landesamt für Denkmalspflege in Mainz die Umgestaltungsvorschläge besprochen wurden.<br />
Wichtig erschien zunächst, die in den Altarraum hineinwagenden Bänke zu entfernen, um vor der Altarstufe etwas Raum zu<br />
gewinnen. Der unter den Bänken befindliche Holzboden wurde entfernt, die Platten des Altarraumes vor der Stufe im Kirchenraum<br />
als Ergänzung verlegt und im eigentlichen Altarbereich Anröchter Dolomit, in Farbe und Struktur dem vorhandenen Boden<br />
gleichend, verlegt.<br />
Da der vorhandene Altartisch aus einem gemauerten Unterbau mit stark beschädigter Steinplatte bestand und nicht erhaltenswert<br />
erschien, wurde Bildhauer Klaus Rothe aus Morbach beauftragt, eine neue Mensa zu entwerfen. Von 3 Entwürfen wurde<br />
schließlich die schlankere, gotische, zum vorhandenen Taufstein passende Form ausgesucht, die sich, aus gelbem Kordeler<br />
Sandstein mir einem bildhauerisch gearbeiteten Fries, ausgezeichnet in den Gesamtraum einfügt und das alte Altarbild<br />
hervorragend zur Geltung kommen lässt.<br />
Flankiert von 2 ebenfalls von Bildhauer Rothe entworfenen und in Bronze gegossenen Kerzenleuchtern sowie dem<br />
Bronzealtarkreuz, wurde der Altar mit dem Triptychon zum Mittelpunkt des Raumes.<br />
Bild 62: neues Altarkreuz von Klaus Rothe<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Um die schlechte Beleuchtung zu verbessern − eine Neonröhre hinter einer Holz blende erschien nicht sehr günstig −, wurde die<br />
Decke im Altarbereich neu gestaltet, mit, der Emporenbrüstung nachempfundenen, Kassetten versehen und verdeckt liegende<br />
schwenkbare Einbauleuchten eingebaut.<br />
Dadurch wurde eine bessere Ausleuchtung des Raumes und Beleuchtung des Altarbildes erreicht.<br />
Der nur mit einer primitiven Eisentüre versehene, nur über den Altarraum zu erreichende Zugang zur Orgelempore erhielt eine<br />
kunstvoll geschmiedete Eisentüre, die, von Bildhauer Rothe entworfen, eine zusätzliche Bereicherung wurde.<br />
Um die hinter dem Altarraum in der Sakristei ausgestellten alten Truhen und sakralen Gegenstände, wobei besonders das<br />
wertvolle Altarkreuz aus Bergkristall erwähnt werden muss, besser aus− und darstellen zu können, wurden in die unter dem<br />
Fenster befindliche Nische Vitrinen eingebaut, sodass nun alle wertvollen Gegenstände, ohne dass man den Altarraum zu betreten<br />
braucht, besichtigt werden können.<br />
Die beiden alten Truhen erhielten einen Platz vor dem Herrenstuhl auf der linken und in der Nische zwischen den Vitrinen auf der<br />
rechten Seite.<br />
Nach der Renovierung wurde festgestellt: Der gesamte Raum hat gewonnen, der Altarraum passt sich gut in das Gesamtbild ein.<br />
56
H. Peter Henn: Felssicherungsarbeiten im Bereich der <strong>Felsenkirche</strong> Idar−Oberstein<br />
Geologische Vorgeschichte<br />
Im 15. Jahrhundert wurde die <strong>Felsenkirche</strong> in einer Höhlung des fast senkrecht niederfallenden Schlossfelsens, etwa 60 m<br />
unterhalb des Alten Schlosses erbaut. Seitdem war sie stets den Gefahren von Steinschlägen und Felsstürzen aus den steil<br />
aufragenden Felswänden ausgesetzt. Dies hat einerseits mit dem besonderen Standort der Kirche und andererseits mit den<br />
geologischen Gegebenheiten am Schlossfelsen zu tun.<br />
Der Schlossfelsen besteht aus Ergussgesteinen, die im ausgehenden Erdaltertum entstanden, als es zurzeit des Rotliegenden zu<br />
einer bedeutenden vulkanischen Tätigkeit kam. Mächtige Lavadecken breiteten sich im Raum Idar−Oberstein zwischen den<br />
Sedimentgesteinen des Oberrotliegenden aus. Diese Lavadecken setzen sich aus mehreren Lavaströmen zusammen, bei denen<br />
sich Sohlzone, Kernzone und Dachzone ganz unterschiedlich verhalten. In der Kernzone erstarrte das Magma zu einem dichten<br />
und festen Gestein, während in der Sohl− und Dachzone weniger feste Gesteine (Mandelsteintypus) entstanden. Hier bildeten sich<br />
beim Erkalten des Magmas Blasenräume, die entweder als Hohlräume verblieben oder mit Mineralien wie Achate, Amethyste,<br />
Rauchquarze, Calcit u.a. ausgefüllt wurden. Es sind somit in dem Ergussgestein unterschiedliche Gesteinsfestigkeiten vorhanden,<br />
die sich in der Felswand durch eine sehr unruhige Oberfläche, z.B. durch Vorsprünge und Überhänge darstellen und sich auch<br />
unterschiedlich gegenüber Witterungseinflüssen und Spannungsumlagerungen verhalten.<br />
Entscheidenden Einfluss auf die Steinschlaggefahr haben aber auch die Klüfte. Am Schlossfelsen kann man zwei Kluftsysteme<br />
deutlich unterscheiden. Das eine Kluftsystem wird durch die Abkühlungsflächen bzw. Grenzflächen zwischen den einzelnen<br />
Lavaströmen und Lavadecken gebildet. Diese Trennflächen stellen mechanisch eine Inhomogenität im Gebirge dar und zeichnen<br />
sich morphologisch als Klüfte ab. Das andere Kluftsystem ist durch tektonische, d.h. gebirgsbildende Kräfte entstanden, es<br />
durchschlägt das erste Kluftsystem und prägt im Wesentlichen die Gestalt des Schlossfelsens.<br />
Die Ergussgesteine mit ihren unterschiedlichen Festigkeiten, die verschiedene Richtung und Ausbildung der beiden Kluftsysteme,<br />
die Witterungseinflüsse, der Kluftwasser− und Strömungsdruck und die Schwerkraft sind Hauptursache der Steinschläge und<br />
Felsstürze am Schlossfelsen in Oberstein.<br />
Gefahren für Kirche und Besucher<br />
Seit Bestehen der <strong>Felsenkirche</strong> spielen Steinschläge und Felsstürze eine wichtige Rolle. Die Kirche wurde mehrfach durch<br />
Steinschlag beschädigt und im Jahr 1742 so schwer getroffen, dass man es kaum der Mühe wert hielt, sie wieder herzustellen.<br />
Vergebens wandte sich im <strong>Jahre</strong> 1858 der evangelische Kirchenvorstand zu Oberstein an die Großherzoglich Oldenburgische<br />
Regierung mit der Bitte, ,,die der Kirche Gefahr drohenden Steine“ von Staats wegen beseitigen zu lassen. Hierzu schrieb unter<br />
dem 19. Juli 1858 der Bauinspector Meyer an die Großherzogliche Regierung auszugsweise folgenden Bericht:<br />
,,In Folge Aufgabe Großherzoglicher Regierung von 20ten April d. J. habe ich bei meiner nächsten Anwesenheit in Oberstein die<br />
Grotte, in welcher die Kirche steht, in Bezug auf die in ihr hängenden, der Kirche Gefahr drohenden Steine näher besichtigt, um<br />
Großherzogliche Regierung über die Kosten berichten zu können, welche das Herabnehmen oder Befestigen der fraglichen Steine<br />
verursachen würde. Ich fand nun, dass die Bestimmung dieser Kosten im Voraus eine sehr missliche Sache sei, weil man<br />
einestheils nicht ohne weiteres bis zu diesen Steinen hinankommen und somit weder die Größe der sich lösenden Felsstücke<br />
bestimmen kann, noch weiß, wie fest oder wie lose sie sitzen, und auf welche Weise ihnen am vorteilhaftesten beizukommen ist<br />
und anderntheils, wenn man einmal ans Werk geht, Gerüste u. s. w. anbringt, doch jedenfalls die ganze Grotte durch Anklopfen<br />
untersucht und alles nur irgend Gefährliche beseitigt werden muß. Da nun nach der Erklärung des Kirchenvorstandes die Grenze<br />
zwischen dem Eigentum der Kirche und der Krone, mitten durch erstere gehen sollte und ich bei der Untersuchung fand, daß der<br />
hauptsächlich infrage kommende Stein fast senkrecht über der Frontmauer der Kirche hing, ...<br />
Hierdurch fiele nun jeder Grund weg, auf das Ansinnen des Kirchenvorstandes von Oberstein die gefahrdrohenden Steine von<br />
Seiten des Staats beseitigen zu lassen, einzugehen, da sowohl der Fels über der Kirche als unter derselben Eigenthum der<br />
Kirchengemeinde ist, und halte ich die mir unterm 20ten April d. J. gewordene Aufgabe hiermit für erledigt."<br />
Einige <strong>Jahre</strong> später, 1863, schrieb der Pfarrer in einem Spendenaufruf vom 22. Februar u.a.:<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
57
,,Es geschieht fast jährlich, dass sich von dem Kirchfelsen größere oder kleinere Stücke ablösen und auf die Kirche oder den dahin<br />
führenden Weg herabfallen. Der so verursachte Schaden hat innerhalb der letzten sieben <strong>Jahre</strong> eine Ausgabe von 600 bis 700<br />
Thalern veranlaßt.“<br />
Diese vor über hundert <strong>Jahre</strong>n geschilderte Situation war in den letzten <strong>Jahre</strong>n noch akuter als damals. Im Laufe der Jahrzehnte ist<br />
die Verwitterung der Felswand zunehmend fortgeschritten, und die Zahl der Besucher der <strong>Felsenkirche</strong> nahm ständig zu, sodass<br />
eine immer größer werdende Gefahr aus Steinschlägen und Felsstürzen gegeben war.<br />
Bild 63: Europas höchstes Arbeitsgerüst, 1980<br />
Aufgrund dieser akuten Gefahrensituation haben die Eigentümer der Felsflächen, von denen die Gefahr ausgeht − nämlich die<br />
evangelische Kirchengemeinde Oberstein, die Stadt Idar−Oberstein und das Land Rheinland−Pfalz − im <strong>Jahre</strong> 1977 vereinbart,<br />
Felssicherungsmaßnahmen durchzuführen und die Kosten anteilig zu übernehmen.<br />
Sicherungsmaßnahmen und neuer Zugang durch den Berg<br />
Im Januar 1978 erhielt das Staatsbauamt Idar−Oberstein von der Oberfinanzdirektion Koblenz 1 Landesvermögens− und<br />
−bauabteilung Mainz den Auftrag, die Felssicherungsmaßnahmen zu planen und auszuführen.<br />
Nach Vermessung des Schlossfelsens, mehreren Ortsbegehungen und Durchsteigen der Felswand, Fallversuchen und<br />
−berechnungen konnte ein geologisches Gutachten erstellt werden, das zur Sicherung der Bereiche rechts und links neben der<br />
Kirche, d. h. Sicherung der Zuwegung und Unterlieger, den Aufbau schwerer Fangzäune empfahl. Die Fangzäune wurden 1978/79<br />
erstellt. Sie bestehen aus bis zu 6 m hohen Stahlträgern, im Abstand von 3 m versetzt, mit einem Einzelgewicht bis zu 700 kg,<br />
sowie waagerecht laufenden Stahlseilen 20 mm Durchmesser und einer Bespannung aus Steinschlagschutzmatten.<br />
Die nächste Sicherungsmaßnahme sollte das Kirchenbauwerk selbst und den Kirchenvorplatz schützen. Ein absoluter Schutz der<br />
Besucher im Bereich vor der Kirche wäre nur gewährleistet worden durch den Bau eines 6 m auskragenden Fangzaunes in der fast<br />
senkrechten Felswand oberhalb der Kirche oder durch Zubetonieren der gesamten Felsfläche von der Kirche bis zum Alten<br />
Schloss. Diese Lösungen waren jedoch nicht akzeptabel und teilweise auch nicht durchführbar. Die Steinschlaggefahr vor der<br />
Kirche wurde daher im wahrsten Sinne des Wortes umgangen und ein Tunnel als neuer Zugang zur Kirche vorgesehen. Die<br />
Felswand oberhalb der Kirche wurde nur so weit gesichert, dass keine Gefahr mehr für die Kirche und die Anlieger am Fuße des<br />
Schlossfelsens bestand. Der Auftrag für diese Maßnahmen wurde im Dezember 1979 an eine auswärtige Firmengemeinschaft<br />
erteilt.<br />
Im Januar 1980 konnte bereits mit dem Aufbau des Arbeitsgerüstes, von dem aus die Felssicherungsarbeiten erfolgen sollten,<br />
begonnen werden. Mit einer endgültigen Höhe von rd. 70 m war es wohl in Europa das bisher höchste Gerüst, das an einer<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
58
Felswand entstand. Im Zuge des Aufrüstens hat sich die tiefreichende Auflockerung und Verwitterung des Gebirges in einem<br />
Ausmaß bestätigt, wie es auch die Fachleute vorher nicht vermuteten. Die Sicherungsarbeiten umfassten im Wesentlichen das<br />
Verankern absturzgefährdeter Felsbrocken im rückwärtigen Gebirge mit insgesamt 84 Ankern, 2,50 m bis 6,00 m lang, und<br />
zulässigen Zugkräften bis zu 18 Tonnen. Die kurzen Anker wurden im Gebirge verklebt und die langen Anker wurden mit<br />
Zementmörtel verpresst. Tonnenschwere Felsbrocken, die in 50 m und 60 m Höhe so locker in der Wand hingen, dass sie bereits<br />
bei der Verankerung abzustürzen drohten, mussten unter einem Schutznetz an der Felswand von Hand zerkleinert und über das<br />
Gerüst abgefördert werden. Stark aufgelockerte, verwitterte Felsbereiche wurden mit Baustahlgewebe überzogen und mit dunkel<br />
eingefärbtem Spritzbeton gesichert, der später noch mit Lehmbrühe angestrichen wurde. Klüfte wurden mit Betonplomben<br />
ausgefüllt und überragende Felsbereiche zur Verstärkung der Tragwirkung gewölbeförmig unterspritzt.<br />
Bild 64: Tunnel zur <strong>Felsenkirche</strong><br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Nachdem die Sicherung der Felswand über der Kirche abgeschlossen und somit das Risiko eines Felssturzes weitestgehend<br />
ausgeschaltet war, konnte im Sommer 1980 mit dem Sprengen des Fußgängertunnels begonnen werden. Das Tunnelprofil hat<br />
eine Breite von 2,20 m und eine Höhe von 2,50 m in dem First. Die etwa 38 m lange Tunnelstrecke zeigt zwei Bögen auf und einen<br />
Höhenunterschied von 9,50 m. Wegen der nahe gelegenen Wohnhäuser und des direkt betroffenen Kirchenbauwerks erfolgte der<br />
Vortrieb mit gebirgsschonenden Sprengverfahren, wobei die Sprengerschütterungen laufend gemessen und in festgelegten<br />
Grenzen gehalten wurden. Mitte November 1980 wurde der Tunneldurchschlag in die Kirche vollzogen, nachdem vorher das<br />
Tunnelprofil vom Kircheninnern her auf 1 m Tiefe von Hand ausgebrochen wurde. Zur endgültigen Fertigstellung waren noch<br />
verschiedene Nebenarbeiten, wie Treppenanlage, Eingangsportale, elektrische Beleuchtung und Gestaltung des Tunnelvorplatzes<br />
erforderlich.<br />
Die Gesamtmaßnahme ,, Felssicherungsarbeiten im Bereich der <strong>Felsenkirche</strong> Idar−Oberstein“ konnte zu Ostern 1981 nach fast<br />
3−jähriger, unfallfreier Bauzeit mit einem Kostenaufwand von 3,0 Mio. DM abgeschlossen werden.<br />
59
Alfred Peth: Die <strong>Felsenkirche</strong> − eine Huldigung an die Trinität<br />
Das Fest der Heiligen Dreieinigkeit − Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist −, auch Trinitätsfest genannt, wurde im Mittelalter<br />
unter Papst Johannes XXII. (1316 − 1343) eingeführt und für die gesamte Christenheit allgemeingemacht. Das Wort Trinität kommt<br />
vom lateinischen Trinitas und heißt zu Deutsch Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit. Seitdem gehört die Zahl drei zu den heiligen Zahlen<br />
der Christenheit. Man denke dabei auch an die biblische Teilung der Welt in Himmel, Erde und Wasser (2. Buch Moses, 20,11)<br />
oder an die drei Völker der biblischen Legende: Sem, Hem und Japhet (1. Buch Moses, 10). Was lag da näher, als solche<br />
Zahlensymbolik auch beim Kirchenbau deutlich werden zu lassen? So hat man im Mittelalter beispielsweise Taufkapellen stets<br />
achteckig gebaut. In Italien werden sie Baptisterien genannt. Man erinnere sich auch an die acht Seligsprechungen der Bergpredigt<br />
und an den achteckigen Grundriss vieler Pfalzkirchen. Ein schönes Beispiel ist das heilige Oktogon des Aachener Dorns, das<br />
jedem Besucher deutlich in Erinnerung bleibt. Es sei noch vermerkt, dass sich bei fast allen Religionen eine dreigegliederte Einheit<br />
oder drei göttliche Personen finden lassen. Die trinitatische Symbolwelt ist teilweise kultur− und religionsübergreifend und<br />
allgemeines Menschengut. Wirich IV., der Erbauer der <strong>Felsenkirche</strong>, regierte hier in Oberstein, auf dem neuen Schloss, von 1432<br />
bis zu seinem Tod, 1501. Die Grabkirche der Daun−Obersteiner Familie ist bekanntlich Otterberg in der Pfalz. Dort wurde auch<br />
Wirich begraben. Einer seiner Söhne, Philipp, dem geistlichen Stande bestimmt, wurde Domherr in Trier und seit 1508 Kurfürst und<br />
Erzbischof von Köln. 1515 starb er in der damaligen erzbischöflichen Residenz, dem Poppelsdorfer Schloss in Bonn. Eine der<br />
Töchter war Fürstäbtissin in Essen.<br />
Bild 65<br />
Wirich war sicherlich ein gläubiger Katholik. In die von ihm mit Genehmigung vom 23. August 1482 des Papstes − es war damals<br />
Sixtus IV. − erbaute und 1484 geweihte Kirche ließ er ein Fenster mit dem Bildnis des Schutzpatrons seines Hauses, des Heiligen<br />
Nikolaus von Myra, einsetzen. Sicher spielte auch in seiner Denkweise die heilige Trinität eine besondere Rolle, denn er hat ihr in<br />
der <strong>Felsenkirche</strong> in mehrfacher Hinsicht ein Denkmal gesetzt.<br />
Bild 72: Die drei Bogen des Seitenschiffs<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Wenn man die Kirche von außen betrachtet, erkennt man drei spätgotische Fenster, darunter drei kleine, fast quadratisch<br />
aussehende Fenster in Nischen. Betrachtet man die Sakristei von außen, so erkennt man wiederum drei Fenster. Eines der<br />
Fenster wurde bei der Renovierung in den späten Zwanzigerjahren unseres Jahrhunderts zugemauert. An seiner Stelle wurde ein<br />
neues gebrochen, das später zu einer Tür umfunktioniert wurde. Was man heute nicht mehr erkennen kann, ist ein drittes Fenster<br />
im Turm. Im Inneren des Turms sind die Sandsteingewände dieses Fensters jedoch noch sehr gut zu erkennen. Der mit der<br />
Neugestaltung der Kirche damals beauftragte Architekt Wilhelm Heilig aus Darmstadt war es, der dieses dritte Fenster wegfallen<br />
ließ. Im Inneren der zweischiffigen Kirche sind wieder drei gotische Bogen zu erkennen, die das Seitenschiff abfangen. Aus den<br />
jetzt noch vorhandenen Schlusssteinen der ehemaligen spätgotischen Spitzbogengewölbe kann man erkennen, dass diese auch<br />
aus drei Gewölben stammen. Leider wurden bei der Renovierung mehrere andere Schlusssteine entfernt. Auf alten Fotos des<br />
Kircheninneren sind sie jedoch noch gut zu sehen. So stellt die <strong>Felsenkirche</strong> in der Tat eine Huldigung an die Dreieinigkeit dar.<br />
60
Armin−Peter Faust: Gedanken über zwei Skulpturenfragmente aus der <strong>Felsenkirche</strong><br />
Im Museum unterhalb der <strong>Felsenkirche</strong> befinden sich seit etwa 1937 1) zwei Bruchstücke2) sakraler Skulptur, die wohl mir großer<br />
Wahrscheinlichkeit3) einmal zur Innenausstattung der <strong>Felsenkirche</strong> gehört haben. Es handelt sich um eine kniende Halbfigur, wohl<br />
einen ,,Schmerzensmann“, und ein Weihwasserbecken.<br />
Bilder 66 und 67<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Nun wäre es sicher etwas hochstaplerisch, wollte man diese beiden Ausstattungsstücke der <strong>Felsenkirche</strong> als große Kunstwerke<br />
würdigen, die in aller Munde sein müssten. Aber man ist doch etwas verwundert, dass sie bisher von der<br />
Heimatgeschichtsforschung vollkommen unbeachtet geblieben sind. Kein Katalog, keine Broschüre, keine <strong>Festschrift</strong>, kein<br />
Fachaufsatz hat sie der Aufnahme für würdig befunden4).<br />
Man kann sich natürlich fragen, welche Gründe hinter dieser Ignoranz stehen. Zum einen kann man anführen, dass die beiden<br />
Stücke kunsthistorisch tatsächlich wenig ergiebig und attraktiv sind und dass sie, gemessen am großen Altarbild oder am<br />
Gesamtensemble der <strong>Felsenkirche</strong>, wirklich ohne Bedeutung sind. Zum anderen muss der kritische Betrachter − selbst wenn er<br />
kein Fachmann ist − mit Bedauern feststellen, dass der Erhaltungszustand schlecht und die irgendwann bei der Figur<br />
vorgenommene ,,Restaurierung“ geradezu barbarisch genannt werden muss 5).<br />
Das Weihwasserbecken ist so stark bestoßen, abgegriffen, zerkratzt und beschädigt, dass der Kunsthistoriker, auf keine gesicherte<br />
Einzelform aufbauend, eine Aussage, die eine Datierung, geschweige denn eine Stilanalyse ermöglichte, zu machen in der Lage<br />
ist.<br />
Nur so viel kann gesagt werden, dass es sich um ein Weihwasserbecken aus grauem Sandstein mit stumpfovalem Querschnitt<br />
handelt. Es war wohl an der einen Langseite an einer Wand befestigt und zeigt vier bandartige Wandverstärkungen. Zwischen<br />
diesen Verstärkungen sind Buckelbossen ausgebildet, in welche auf den Schmalseiten kerbschnittartige Einfassungen und<br />
einfache Kreuze gemeißelt sind. An der vorderen Langseite ist eine Swastika 6) in das gewölbte Feld eingegraben. Sie ist wenig<br />
sorgfältig in Kerbschnittform gestaltet und auch etwas aus der Mittelachse gerückt. Überhaupt sind die wenigen intakten Formen<br />
des Beckens recht unregelmäßig und grob gearbeitet und wohl im Zusammenhang mit der Bauskulptur, etwa den Rippen und<br />
Konsolen des Baues zu sehen.<br />
Kunsthistorisch weitaus ergiebiger als das Weihwasserbecken ist die erwähnte Figur eines knienden ,,Schmerzensmannes“ aus<br />
grobkörnigem grauen Sandstein7). Doch auch die Selbstverständlichkeit, mit der hier von einem Schmerzensmann geredet wird,<br />
kann etwas erschüttert werden, wenn man bedenkt, dass im Altarbild von 1410 8) ja bereits im rechten Seitenflügel, und zwar im<br />
oberen Bild, ein Schmerzensmann auftaucht, und es eigentlich nicht üblich war, ein und dasselbe Motiv in einer so bescheidenen<br />
Kirche gleich zweimal aufzustellen9). Es ist aber zu fragen, in welchen anderen ikonologischen Zusammenhang der<br />
Schmerzensmann gehört. Da ein solches ,,Erbärmdebild“, das Christus mit allen Leidensmerkmalen und<br />
Leidenswerkzeugen10) zeigt, in der Regel als sehr persönliches und intimes Andachtsbild fungierte, war es in größeren Kirchen<br />
oder Kapellen meist in Seitenkapellen aufgestellt. Diese Möglichkeit, das Werk zu präsentieren, gab es in der <strong>Felsenkirche</strong> kaum.<br />
Es bleibt also nur die Möglichkeit, dass es in einer Nische stand oder vor der Wand auf einer Konsole. Für die letztere Möglichkeit<br />
der Aufstellung spricht der Sockel der Figur selbst dann noch, wenn wir den unteren Teil, also den besagten Zementbrocken,<br />
wegdenken, der sicherlich eine moderne Hinzufügung ist, zumal das Sockelende der ursprünglichen Figur noch deutlich als Fuge<br />
zu erkennen ist. Denkt man sich jedoch diese Hinzufügung, die vorn etwa 30 mm und hinten etwa 60 mm stark sein dürfte, weg,<br />
taucht ein neues Problem auf. Dann nämlich verwandelt sich die jetzige leichte Vorwärtsneigung in eine leichte Rückwärtsneigung.<br />
Dadurch wird aber auch die Blickrichtung der Figur geändert: sie schaut nicht mehr auf den Betrachter herab, sondern über ihn<br />
hinweg in die Höhe, es sei denn, man hätte die Figur etwa einen Meter über dem Boden aufgestellt. Diese tiefe Aufstellung ist<br />
jedoch völlig unüblich.<br />
61
Bild 68: ,,Der Schmerzensmann"<br />
von Albrecht Dürer<br />
In diesem Zusammenhang kann man natürlich auch nach anderen, der Christus−Ikonographie eigenen Motiven Ausschau halten.<br />
Ein kniender Christus, der nach oben seine Blicke richtet, wäre auch im Zusammenhang mit der Gethsemane−Szene denkbar.<br />
Dagegen spricht jedoch die Tatsache, dass die vorliegende Figur um den Kopf einen eng anliegenden Wulst trägt, der wohl als<br />
Dornenkrone angesehen werden darf, und mit einem Lendentuch bekleidet ist. In der Ölberg−Szene trägt Christus noch keine<br />
Dornenkrone und auch in der Regel ein langes Gewand. Ziehen wir das Motiv Schmerzensmann weiter in Zweifel, dann können wir<br />
fragen, wer oder was es denn sonst sein könnte.<br />
Im Zusammenhang mit der ersten Obersteiner Kirche, die wohl in der Gemarkung ,auf dem Kreuz“ stand, werden die heiligen<br />
Apostel Philippus und Jakobus, sowie der Märtyrer Dionysius als Patrone genannt 11). Aber abgesehen davon, dass völlig unklar<br />
wäre, wie die Skulptur von der Kirche auf dem Kreuz in die <strong>Felsenkirche</strong> gekommen sein könnte, passt der ikonographische<br />
Bestand zu keinem dieser drei Heiligen. Wohl käme man auch mit einer vernünftigen Datierung nicht zurande. Diese<br />
Kombinationen scheiden also aus. Darüberhinaus bliebe noch die Möglichkeit, die besagte Skulptur als heiligen Sebastian zu<br />
deuten, von welchem ja auch ein stattliches Gemälde in der <strong>Felsenkirche</strong> aufbewahrt wird, allerdings aus viel späterer Zeit.<br />
Überprüfen wir die Sebastian−Ikonographie, dann stellen wir fest, dass der vorliegende Befund bis auf wenige Ausnahmen mit<br />
dieser übereinstimmt. Haltung, Bekleidung, Gebärde und Haartracht könnten akzeptiert werden, aber der Wulst um den Kopf<br />
spricht dagegen. Er muss als Dornenkrone gelten, und damit wird eine Identifizierung mit diesem Heiligen unmöglich 12).<br />
Als letzte Möglichkeit wäre noch zu überprüfen, ob es sich vielleicht um einen heiligen Wolfgang handeln könne, denn es ist uns<br />
aus einer Urkunde von 1492 bekannt, dass in der <strong>Felsenkirche</strong> außer einem Marienaltar auch ein Wolfgang−Altar existierte 13).<br />
Aber auch hier ergibt die Überprüfung der üblichen Wolfgang−Ikonographie keine Übereinstimmung 14).<br />
Somit bleibt die Identifikation der vorliegenden Figur mit einem Schmerzensmann, obwohl die Attribute nicht in der üblichen Art und<br />
Weise und zudem unvollständig anzutreffen sind. Zum einen ist es schwer, den Wulst auf dem Kopf der Figur als Dornenkrone zu<br />
deuten, zum anderen ist zwar der Gestus der diagonal übereinander gelegten Unterarme kanonisch, aber es fehlen sowohl die<br />
Wundmale in den Handrücken15) als auch Geißel und Rutenbündel in den Händen16). Kanonisch im weitesten Sinne ist hingegen<br />
die Gesichtsbildung. Die großen Augen, bei welchen die Pupillen ausgebohrt sind, vermitteln sehr anschaulich das Leiden und den<br />
Marterschmerz, zumal sie ein wenig schräg nach oben in Richtung Nasenwurzel zusammengezogen sind. Dazu passt auch die<br />
leichte seitliche Schrägneigung des Kopfes. Die Nase ist etwas bestoßen, der Mund breit und leicht geöffnet, das Kinn<br />
zurückgenommen und weich. Bart ist nicht zu erkennen, und auch das Haar ist recht summarisch behandelt. Arme und Oberkörper<br />
sind fast ohne Details als Großformen gegeben; lediglich die Schlüsselbeine und der Rippenbogen über dem Leib sind angedeutet.<br />
Das Lendentuch besteht aus einzelnen gratigen Wülsten, die an der rechten Seite der Figur zu einem rautenförmigen Knoten<br />
zusammengezogen sind. Die Oberschenkel sind, so weit sie zu erkennen sind, recht kräftig gestaltet.<br />
Fassen wir unsere Beobachtungen am formalen Bestand zusammen, dann kann − wegen der verunklärten Einzelformen − wenig<br />
Gültiges zum Stil gesagt werden. Auf Grund dessen, dass keine saubere Stilanalyse gemacht werden kann, müssen wir uns auch<br />
bei einem Datierungsversuch sehr zurückhalten.<br />
Deshalb soll hier nur so viel gesagt werden: Sowohl der äußere Kontur der Figur in seiner sehr zurückhaltenden Bewegung als<br />
auch die Haltung17) deuten nicht daraufhin, dass es sich um eine Arbeit aus der Hochgotik handelt. Auch die Art und Weise, wie<br />
Haar und Gewand behandelt sind, lässt einen ähnlichen Schluss zu. Der ganze Formenapparat ist reduziert und als recht<br />
bescheiden zu bezeichnen. In der Architektur würde man von Reduktionsgotik sprechen. Das kann einerseits damit<br />
zusammenhängen, dass unsere Skulptur eben das Produkt eines Provinzbildhauers ist, andererseits sind wir auf das 14. und 15.<br />
Jahrhundert verwiesen. Diese grobe Festlegung kann in etwa von der ikonographischen Seite gestützt werden, ist doch der<br />
Schmerzensmann ein bevorzugtes Bildthema der deutschen Mystik18). Das liebevolle Versenken in Leiden und Sterben Christi<br />
und damit das Annehmen und Hinnehmen des eigenen Elends im Sinne einer Annäherung an den Heiland gehören zum Lebensstil<br />
dieser Epoche. Unsere Skulptur entspricht diesem Lebensgefühl und gehört wohl ins selbe Jahrhundert wie die <strong>Felsenkirche</strong><br />
selbst.<br />
Man wird das Ergebnis des hier vorgelegten Aufsatzes wohl als mager bezeichnen müssen, aber es ist in Anbetracht des<br />
Erhaltungszustandes der Skulptur eher redlich als gewagt.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
62
I. Anmerkungen<br />
1) Ob die beiden Stücke, um die es hier geht, auch schon im Bestand des Museums waren, als die Sammlung noch in der<br />
Bahnhofsgaststätte bzw. der Auschule untergebracht war, ließ sich nicht mehr feststellen. Auch wo sich die beiden Fragmente in<br />
der Zeit zwischen 1929 und 1933 befanden, war nicht zu klären. (Vgl. hierzu: Peth, A., 50 <strong>Jahre</strong> Heimatfreunde − 50 <strong>Jahre</strong><br />
Museum . . . . S. 5)<br />
2) Es kann sehr wohl sein, dass der Schmerzensmann ursprünglich als Ganzfigur existierte, denn etwa in Höhe der Kniescheibe ist<br />
eine Fuge zu erkennen. Ähnliches lasst sich auch bei dem Weihwasserbecken feststellen. Es könnte sehr wohl einmal einen Fuß<br />
oder eine Halbsäule als Untersatz gehabt haben. Insofern ist also die Bezeichnung ,,Bruchstücke‘ gerechtfertigt.<br />
3) Die beiden Stücke sind wohl bei den Restaurierungsarbeiten 1928 /29 aus dem Ausstattungsbestand herausgenommen und<br />
später in das 1937 eröffnete Heimatmuseum gelangt. Die Provenienz ist jedoch mit Fragezeichen zu versehen. (Vgl. auch Anm. 1!)<br />
4) Vgl. hierzu die Angaben im Literaturverzeichnis zu diesem Aufsatz. Der Verfasser hat in dieser Literatur keinerlei Hinweise auf<br />
Aufstellung, Herkunft oder kunsthistorische Einordnung finden können. Nur in der <strong>Festschrift</strong>, die anlässlich der Restaurierung 1929<br />
herausgegeben wurde, finden wir einen vagen Hinweis, wenn es in dem Beitrag von Heilig heißt (S. 63): ,Von der einstigen<br />
Innenausstattung konnten nur die künstlerisch wertvollen Stücke übernommen werden. Außer dem bereits erwähnten Grabmal sei<br />
als kostbarstes Innenstück das Klappaltarbild genannt . ... Kanzel und Herrenstuhl sind wieder eingebaut, auch Teile des alten<br />
schönen Orgelgehäuses von 1576. Ebenso sind die Apostelbilder und das große Sebastiansbild erhalten geblieben.“<br />
Wenn es hier heißt, dass nur die kostbarsten Stücke übernommen wurden, kann man annehmen, dass es auch weniger kostbare<br />
gegeben habe. Dazu könnten dann auch der Schmerzensmann und das Weihwasserbecken gerechnet werden.<br />
5) Man hat die ganze Figur nämlich mir einer Zementbrühe überzogen, die alle Einzelformen egalisiert und zudem Pinselspuren<br />
aufweist, die die ganze Oberflächenbeschaffenheit verunklären. Hinzu kommt, dass an den unteren Teil der Figur ein<br />
Estrichbrocken angegossen ist, der sogar die Haltung stark verändert. Ob dies gleichzeitig mir dem Zementüberzug geschah, kann<br />
heute nicht mehr festgestellt werden.<br />
6) Die Swastika kommt in der romanischen Kunst des Mittelalters am häufigsten vor. Die Gotik hat diese Kreuzform weniger.<br />
Daraus nun aber zu schließen, es handele sich hier um ein Weihwasserbecken aus der Romanik, wäre voreilig und müsste<br />
hypothesenhaft bleiben. Es ist wohl eher so gewesen, dass der alte Motivvorrat der Romanik in der Provinz länger wirksam blieb<br />
als in den Kunstzentren des Mittelalters. Die Swastika muss also kein Gegenbeweis dafür sein, dass das Becken aus der Spätgotik<br />
stammt.<br />
7) In der Regel verwandte man für eine solche Figur in unserer Gegend den eher gelblichen Moselsandstein oder den roten aus<br />
der Pfalz. Aus dieser Abweichung ergeben sich jedoch keine weiterführenden Schlüsse.<br />
8) Vgl. hierzu: Rupp, M., Der Meister des Obersteiner Altars und seine Zeit. In:<br />
Max Rupp, Aus 25 <strong>Jahre</strong>n. 5. 176 ff.<br />
9) Es wäre höchstens denkbar, dass der Klappaltar ein steinernes Gesprenge hatte, in welchem Christus als Schmerzensmann in<br />
Begleitung von Engeln erscheint. Diese Lösung ist jedoch sehr unwahrscheinlich.<br />
10) Als Leidenswerkzeuge sind üblich: die Dornenkrone, die Geißelsäule, die Stricke, die Geißel und das Rutenbündel. Vgl. hierzu<br />
die Abbildung des Kupferstiches von A. Dürer!<br />
11) Vgl. hierzu: <strong>Festschrift</strong> für die Wiederweihe... 5. 31 f. und Wild, KE., Dichtung und Wahrheit um die.... S. 63<br />
12) Der heilige Sebastian wird auch häufig als Halbfigur gegeben; allerdings fehlten hier die Marterwerkzeuge, die Pfeile. Das<br />
könnte aber daher rühren, dass bei dem Überpinseln mir Zementschlemme die Bohrlöcher, in welchen die Pfeile steckten,<br />
ausgefüllt wurden und somit verschwanden.<br />
13) Vgl. hierzu: Loch, A., <strong>Festschrift</strong> für die Wiederweihe... 5. 42.<br />
14) Vgl. Reclams Lexikon der Heiligen und der... S. 514 f.<br />
15) Der Zementüberzug macht es unmöglich, so kleine, aber gerade hier wichtige Einzelformen, wie es die Nagellöcher wären, zu<br />
erkennen.<br />
16) Zwischen Daumen und Zeigefinger müssten Bohrlöcher zu erkennen sein, wenn man davon ausginge, dass er in den Händen<br />
Geißelwerkzeuge getragen hätte.<br />
17) Der übliche gotische S−Schwung fehlt hier völlig. Der Körper ist eher steif aufgerichtet.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
63
18) Vgl. Loeffler, H., Ikonographie des Schmerzensmannes... S. 64 ff.<br />
II. Literatur zum Thema:<br />
Brandt, H.P., Die <strong>Felsenkirche</strong> wird <strong>500</strong> <strong>Jahre</strong>. Im: Heimatkalender des Landkreises Birkenfeld (HK) 1984, S. 86 ff.<br />
Dehio−Gall, Handbuch der dt. Kunstdenkmäler Pfalz−Rheinhessen. München 1923.<br />
Hootz, R., Deutsche Kunstdenkmäler. Rheinland−Pfalz−Saar. München 1969 Jahn, J., Wörterbuch der Kunst, Stuttgart 1966<br />
Jung, W., Neue Beobachtungen an Kunstwerken in der <strong>Felsenkirche</strong>. In: HK 1961, S. 95 ff<br />
Loeffler, H., Ikonographie des Schmerzensmannes. Phil. Diss. Berlin 1922<br />
Lili, G., Deutsche Plastik. Berlin 1925<br />
Lueg, W., Chronik der Stadt Idar−Oberstein. Idar−Oberstein 1904<br />
Loch, A., (Hrsg.), <strong>Festschrift</strong> für die Wiederweihe der <strong>Felsenkirche</strong>. Idar−Oberstein 1929<br />
Osten, G. v. d., Der Schmerzensmann. Typengeschichte eines deutschen Andachtsbildwerkes von 1300 − 1600. Berlin 1935<br />
Peth, A., 50 <strong>Jahre</strong> Heimatfreunde − 50 <strong>Jahre</strong> Museum. In: HK 1982, 5. 59 ff.<br />
Peth, A., 50 <strong>Jahre</strong> Heimatfreunde − 50 <strong>Jahre</strong> Museum. In: Mitteilungen d. V. f. Heimatkunde 56. Jg. 1982. Nr. 1/2, 5. 3 ff.<br />
Rupp, M., Der Meister des Obersteiner Altars und seine Zeit. In: Max Rupp, Aus 25 <strong>Jahre</strong>n. Birkenfeld 1973, 5. 176 ff.<br />
Reitenbach, A., Die Graböffnung in der Obersteiner <strong>Felsenkirche</strong> im <strong>Jahre</strong> 1774. In: HK 1957, 5. 137 ff.<br />
Wild, K. E., Dichtung und Wahrheit um die Obersteiner <strong>Felsenkirche</strong>. IN: HK 1956, 5. 63 ff.<br />
Reclams Lexikon der Heiligen und der biblischen Gestalten. (Hrsg. von H. L. Keller) Stuttgart 1970.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
64
Günther Wienands: Die neue Orgel<br />
Über die früheren Orgeln der <strong>Felsenkirche</strong> ist relativ wenig bekannt. Die ursprüngliche Orgel und das Barockgehäuse mit der<br />
<strong>Jahre</strong>szahl 1756 werden der bekannten Orgelbauerfamilie Stumm aus Rhaunen/Hunsrück zugeschrieben. Authentische Beweise<br />
hierfür sind aber nicht mehr auffindbar. Die letzte Orgel wurde von der Firma Waicker in Ludwigsburg im <strong>Jahre</strong> 1929 erstellt und<br />
hatte eine elektrische Traktur (Tonventil−Steuerung). Sie erlitt in den letzten 70−er <strong>Jahre</strong>n ihre endgültige Zerstörung durch<br />
Wassereinbrüche und Beschädigungen bei den Sanierungsarbeiten an Fels und Kirche.<br />
Die Projektierung einer neuen Orgel wurde von den speziellen Verhältnissen der <strong>Felsenkirche</strong> mit ihrem exponierten<br />
physikalischen Status bestimmt. Viele Überlegungen mussten angestellt werden. Zu berücksichtigen war auch, dass die<br />
<strong>Felsenkirche</strong> keine eigentliche Pfarrkirche mit ständigen Hauptgottesdiensten mehr ist und vielmehr eine Sonderstellung einnimmt.<br />
Zunächst wurde eine elektronische Kirchenorgel in Erwägung gezogen. Mehrere Fabrikate wurden geprüft. Für sie sprach der<br />
günstige Preis und weitere ihr nachgesagte Vorteile. Demgegenüber erhoben sich zunehmend Stimmen, welche für die historische<br />
<strong>Felsenkirche</strong> eine Pfeifenorgel für unverzichtbar hielten und forderten. Pragmatische und wirtschaftliche Erwägungen ließen aber<br />
eine Pfeifenorgel ausreichender Größe für nicht realisierbar erscheinen. Die doch sporadischen Benutzungsmöglichkeiten der<br />
Orgel zeigten die Grenze auf.<br />
Die Pforzheimer Orgelbau−Werkstätte Wienands regte einen Lösungsvorschlag an, welcher weitgehend den vorgegebenen<br />
Kriterien gerecht werden konnte. Günther Wienands ist nicht nur ein erfahrener Pfeifenorgelbauer, sondern auch<br />
Elektronik−Ingenieur und hat sich viele <strong>Jahre</strong> mit der Kombination von Pfeifenorgel und Elektronen−Klangwerken befasst und<br />
Forschungsarbeit geleistet. Neue Möglichkeiten im Orgelbau eröffnen sich durch die Vereinigung von Pfeifenorgeln − besonders<br />
solcher mit nur wenigen Registern − mit zusätzlichen, klangähnlichen Registern, wie man sie von der elektronischen Kirchenorgel<br />
kennt. Pfeifenorgel und Elektronenwerk stehen partnerschaftlich nebeneinander und ermöglichen eine Vielfalt von spieltechnischen<br />
und klanglichen Möglichkeiten. Die Stimmangleichung des Elektronenteils an die Pfeifenorgel bei Temperaturunterschieden ist<br />
mittels eines Stimmreglers am Spieltisch leicht und sekundenschnell zu bewerkstelligen. Schwebe−Register der Orgelromantik sind<br />
hierdurch ebenfalls einstellbar.<br />
Die speziellen Kenntnisse des Pforzheimer Orgelbauers auf dem Sektor Kombination von Pfeifenorgel mit Elektronenwerk<br />
erweckten das Vertrauen der Verantwortlichen. Letzlich trat die Realisierung des Orgelprojekts in seine entscheidende Phase. Das<br />
Presbyterium hat gewissenhaft erwogen und sich die Entscheidung nicht leicht gemacht: der Auftrag zum Bau einer Pfeifenorgel,<br />
kombiniert mit einem elektronischen Registerwerk wurde dem Pforzheimer Orgelbauer erteilt. Als denkwürdig darf in diesem<br />
Zusammenhang angemerkt werden, dass die ständige wirtschaftliche Zusammenarbeit und Partnerschaft von Idar−Oberstein und<br />
Pforzheim auf dem Sektor Edelsteine und Schmuck eine erfreuliche Variante erhielt: die Obersteiner <strong>Felsenkirche</strong> erhielt eine<br />
Orgel aus Pforzheim.<br />
Der Hauptteil der Orgel, auch Hauptwerk genannt, umfasst auf dem 1. Manual 6 Pfeifenregister:<br />
Prinzipal 8‘<br />
Holzgedeckt 8‘<br />
Oktave 4‘<br />
Spitzflöte 4‘<br />
Waldflöte 2‘<br />
Mixtur 4−fach.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Die 504 Pfeifen bestehen zu einem großen Teil aus dem Bestand der früheren Orgel, sie wurden aufgearbeitet und umintoniert.<br />
Das Barockgehäuse und das Frontgitterwerk wurden beibehalten. Aufgrund baulicher und technischer Verhältnisse wurde<br />
elektrische Traktur mit Kegelladen gewählt. Der frei stehende zweimanualige Spieltisch mit Pedal steht unter der Orgelbühne auf<br />
der Empore. Die elektronische Erweiterung der Orgel besteht aus 21 Registern mit variabler Lautstärke.<br />
65
<strong>Festschrift</strong><br />
Das Schwellwerk auf dem 2. Manual und das Pedalwerk wird von den elektronischen Registern gebildet, deren Tonabstrahlung auf<br />
der Orgelbühne hinter dem Pfeifenwerk postiert ist. 4 weitere Elektronenregister ergänzen das Hauptwerk. Klanglich dominiert die<br />
Pfeifenorgel mit ihrem edellebendigen Klangbild. Die klangliche Farbpalette liefern die elektronischen Register, welche zugleich<br />
den Pfeifenklang auffüllen, wenn beide zusammen gespielt werden. Traditionelles Orgelgut und fortschrittliche Orgelelemente<br />
wurden so in der <strong>Felsenkirche</strong> zu einer sinnvollen Orgel−Einheit zusammengefasst.<br />
Der Evang. Kirchengemeinde soll Dank und Anerkennung für ihre mutige und weitsichtige Entscheidung zuteil werden. Möge die<br />
neue Orgel in der <strong>Felsenkirche</strong> ihre kirchenmusikalische Aufgabe voll erfüllen und Gemeinde wie Besucher erfreuen.<br />
66
Hartmut Bach: Die Bedeutung der <strong>Felsenkirche</strong> für die Gemeinde heute<br />
,,Welche Bedeutung hat für Sie die <strong>Felsenkirche</strong>?“ habe ich verschiedentlich Obersteiner gefragt und dabei die unterschiedlichsten<br />
Reaktionen erlebt.<br />
Der eine guckte mich an, als käme ich von einem fremden Stern, sonst hätte ich doch die Antwort wissen müssen über die weltweit<br />
einmalige <strong>Felsenkirche</strong>. Ein anderer hatte nur ein Lächeln für mich, in dem alles Mitleid mit der Dummheit des ,,Zugezogenen“ lag.<br />
Wer sonst hätte eine solche Frage stellen können? Und wieder einer schüttelte verständnislos den Kopf, bevor er sagte: ,,Das weiß<br />
man doch. Das ist halt die <strong>Felsenkirche</strong>.“ Und bisweilen kommt dann noch zur Bekräftigung dieses durchschlagenden Arguments<br />
die Bemerkung hinzu: ,,Da bin ich getauft, konfirmiert und getraut worden!“ Und damit ist leider oft auch schon die Zahl der<br />
Besuche in der <strong>Felsenkirche</strong> genannt.<br />
Eine Frau sagte: ,,Wenn ich zwei Wochen aus Oberstein weg bin, dann werde ich unruhig und nervös. Dann muss ich zurück.<br />
Sehe ich aber vom Zug aus die <strong>Felsenkirche</strong>, ist alles wieder in Ordnung. Dann bin ich zu Hause“.<br />
Während der Zeit der Vorbereitung auf die <strong>500</strong>−Jahr−Feier sagte mir ein Gemeindeglied: ,,Für die Festwoche ist mein Haus belegt.<br />
Da kommen alle meine Geschwister von auswärts.“<br />
Was Obersteinern die <strong>Felsenkirche</strong> bedeutet, wird noch an anderer Stelle deutlich: Unsere Gemeinde bittet regelmäßig um ein<br />
freiwilliges Kirchgeld für bestimmte Arbeitsgebiete in der Gemeinde, wie Kindergarten, Sozialstation und Ähnliches. Bei dieser<br />
Sammlung wird am meisten gegeben, wenn sie für die <strong>Felsenkirche</strong> erbeten wird. Ob es nun für die Orgel, Bilder und Grabsteine<br />
oder Verschönerungsarbeiten verwendet werden soll, spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Geht es um ihre <strong>Felsenkirche</strong>, dann<br />
sind die Obersteiner bereit, etwas zu spenden, auch solche, die sonst eher zurückhaltend sind in Bezug auf Gaben für die Kirche.<br />
Darüber hinaus ist in diesem Zusammenhang eines erstaunlich und typisch zugleich: Nur wenige Obersteiner wissen um die<br />
wirklichen Schätze, die die Kirche in ihrem Inneren birgt, sind sich bewusst, wie wertvoll gerade das Altarbild ist.<br />
Über diese Antworten und Tatsachen habe ich lange nachgedacht. Dabei wurde mir klar, dass für viele Obersteiner ,,<strong>Felsenkirche</strong>“<br />
schlicht und einfach ein anderer Name für Heimat ist, die gleiche Bedeutung hat. Oberstein ist ohne die <strong>Felsenkirche</strong> nicht<br />
Oberstein. Ihre Bedeutung ist überwiegend gefühlsmäßig begründet.<br />
Welche ganz andere Bedeutung die <strong>Felsenkirche</strong> für Oberstein auch hat, ist manchem Obersteiner und mir erst deutlich geworden,<br />
als wegen der Felssicherungsmaßnahmen und der anschließenden Renovierung die Kirche nicht besucht werden konnte. Da<br />
blieben auch die Touristen aus, und damit gingen in vielen einschlägigen Geschäften die Umsätze zurück.<br />
Das war einer der Gründe, warum Stadt und Kirchengemeinde alle Anstrengungen unternommen haben, um die Mittel<br />
bereitzustellen, die für die umfangreichen Arbeiten aufgebracht werden mussten. Der Kirchengemeinde ist das jedenfalls sehr<br />
schwer gefallen. Zur gleichen Zeit wurde ein neues Gemeindezentrum im 3. Pfarrbezirk − Struth − errichtet, und ohne den Verkauf<br />
des alten Pfarrhauses in der Wasenstraße und die tatkräftige Unterstützung durch Kirchenkreis und Landeskirche hätten wir die<br />
Mittel nicht aufbringen können.<br />
Bei dieser Summe musste sich das Presbyterium die Frage stellen, ob es noch zu vertreten sei, so viel Geld für die Kirche<br />
aufzuwenden. Weltweit verhungern hunderttausende. Bei der Restaurierung 1929 ist an der <strong>Felsenkirche</strong> so viel zerstört und<br />
verändert worden, was nicht wieder rückgängig gemacht werden kann. Vieles von ihrem ursprünglichen Charakter ist verloren<br />
gegangen. Seit mehr als zwanzig <strong>Jahre</strong>n ist sie auch nicht mehr Gemeindekirche im eigentlichen Sinn.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
Im 1. Pfarrbezirk − Stadt − wurde die seit Jahrhunderten geforderte und seit Beginn unseres Jahrhunderts geplante Kirche gebaut.<br />
Im zweiten Pfarrbezirk − Finsterheck/ Hohl − war gleichfalls ein neues Gemeindezentrum entstanden. Seitdem fand der<br />
sonntägliche Gottesdienst in der <strong>Felsenkirche</strong> nicht mehr statt.<br />
Erst heute wird mir klar, wie sang− und klanglos die bis dahin einzige Predigtkirche der Gemeinde ihre Bedeutung verlor; wie<br />
selbstverständlich man über die Tatsache hinwegging, dass fast ein halbes Jahrtausend lang hier Sonntag für Sonntag Gottes Wort<br />
verkündigt worden war, Menschen es gehört haben und auch hier das größte aller Wunder geschehen war, dass Menschen zum<br />
Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen waren, dass fast ein halbes Jahrtausend lang Menschen hierher zu Taufe und<br />
Abendmahl gekommen waren, kirchliche Trauungen und Konfirmationen gefeiert worden waren. Lag das damals an der<br />
jugendlichen Unbedachtsamkeit von uns Pfarrern, oder wurde damit nicht auch etwas von der Bedeutung der <strong>Felsenkirche</strong> für die<br />
Gemeinde deutlich: Ein Stück Heimat, nicht so sehr Gotteshaus?<br />
67
Ich vermag diese Frage nicht endgültig zu beantworten. Das kann wohl nur jeder für sich selbst tun. Trotz mancher Bedenken bin<br />
ich der Meinung, dass das Presbyterium richtig entschied, als es die Mittel für die umfangreichen Arbeiten zur Verfügung stellte.<br />
Und das aus mancherlei Gründen.<br />
Im letzten Krieg ist in unserem Land so viel Altes zerstört worden, dass es heute wohl unsere Pflicht ist, zu erhalten, was<br />
erhaltenswert ist. Durch die besondere geografische Lage unserer Stadt ist die Gemeinde dazu gezwungen, drei Kirchen und drei<br />
Kindergärten zu unterhalten, obwohl das, gemessen an der Zahl der Gemeindeglieder und dem Steueraufkommen, zu viel ist. Wir<br />
können die drei Kindergärten, die die Gemeinde jährlich ca. 175.000 DM kosten, nur weiterführen, weil uns die Eintrittsgelder der<br />
<strong>Felsenkirche</strong> zur Verfügung stehen. Wenn sie nicht Jahr für Jahr zum Kirchensteueraufkommen hinzukämen, hätten wir längst<br />
Kindergärten schließen müssen. Zumindest nach menschlichem Ermessen bleibt die Kirchengemeinde auf die Eintrittsgelder aus<br />
der <strong>Felsenkirche</strong> angewiesen.<br />
Schließlich war es aus folgendem Grund gerechtfertigt, viel Geld für die Renovierungsarbeiten auszugeben: Seit Errichtung der<br />
neuen Gemeindezentren finden in der <strong>Felsenkirche</strong> nur noch im Sommer Trauungen statt und während der Sommerferien<br />
sonntägliche Gottesdienste, die zum größten Teil von Gemeindegliedern gehalten werden, da zur gleichen Zeit in den anderen drei<br />
Kirchen auch Gottesdienste gefeiert werden. Das eigentliche Gemeindeleben findet in den einzelnen Pfarrbezirken statt. Die<br />
Gemeinde Oberstein besteht rein äußerlich aus drei getrennten Gemeinden. Man geht, wenn man auf der Hohl wohnt, nicht in die<br />
Stadt oder zur Struth zum Gottesdienst. Wenn man schon in den Gottesdienst geht, dann geht man ,,in seine Kirche‘<br />
Da bietet die <strong>Felsenkirche</strong> die einmalige Möglichkeit, die ganze Gemeinde zum Gottesdienst zu versammeln, denn sie ist die<br />
einzige Obersteiner Kirche, von der alle Gemeindeglieder sagen können:<br />
,,Unsere Kirche!“<br />
Darum versammelt sich auch in jedem Jahr in der Sommersaison die ganze Gemeinde zum ersten und letzten Gottesdienst in der<br />
<strong>Felsenkirche</strong>. In der Heiligen Nacht findet ein Gottesdienst in der <strong>Felsenkirche</strong> statt.<br />
Die Zahl der Gemeindeglieder, die diese Gottesdienste besuchen, zeigt uns, dass noch etwas vorhanden ist von der<br />
ursprünglichen Bedeutung der <strong>Felsenkirche</strong> für unsere Gemeinde. Zu diesen Gottesdiensten kommt mancher, der sonst nur<br />
schwer den Weg zur Kirche findet. Und solange es so ist, dass Menschen in die <strong>Felsenkirche</strong> kommen und dort Gottes Wort hören<br />
können − und sei es nur an den wenigen Sonntagen im Jahr, so lange behält die <strong>Felsenkirche</strong> ihre Bedeutung als ,,unsere“ Kirche,<br />
in der die Gemeinde des Herrn Jesus Christus sich zum Beten, Singen und Hören des Wortes Gottes versammelt.<br />
Möge es, so Gott will, noch einmal <strong>500</strong> <strong>Jahre</strong> lang so sein.<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
68
Kurzbiografien der Autoren<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
H. Peter BRANDT, geb. 1941 in Idar−Oberstein,<br />
KVHS−Leiter in Birkenfeld, seit 1962 in der Schriftleitung der ,,Mitteilungen des Vereins für Heimatkunde“.<br />
Aus der Geschichte der <strong>Felsenkirche</strong><br />
Max RUPP, geb. 1908 in Oberstein<br />
Maler, Grafiker, Schriftsteller Idar−Oberstein, Redaktion des Heimatkalenders, Vorstand des Kunstvereins Obere Nahe.<br />
Das Altarbild<br />
Eberhard ZAHN, Dr. phil., geb. 1922 in Heidelberg,<br />
Kunsthistoriker, bis 1983 Leiter der mittelalterlichen und neuzeitlichen Abteilungen des Rheinischen Landesmuseums<br />
Trier.<br />
Die Ausstattung<br />
Peter R. PRACHER, geb. 1938 in Würzburg,<br />
selbstständiger Restaurator in Würzburg.<br />
Die Bilder und Grabsteine<br />
Eduard FINKE, Dipl. Ing. (TH), geb. 1931 in Worms,<br />
wissenschaftlicher Referent im Landesamt für Denkmalpflege Rheinland−Pfalz in Mainz.<br />
Die Sanierungsarbeiten<br />
Siegfried SEURING, geb. 1927 in Pirmasens,<br />
selbstständiger Architekt BDA in Idar−Oberstein.<br />
Der Altarraum<br />
H. Peter HENN, Dipl. Ing. (TH), geb. 1940 in Idar−Oberstein,<br />
Oberbaurat beim Staatsbauamt in Idar−Oberstein.<br />
Felssicherungsarbeiten im Bereich der <strong>Felsenkirche</strong><br />
Alfred PETH, geb. 1931 in Oberstein,<br />
Kaufmann, 1. Vorsitzender des Vereins ,,Die Heimatfreunde Oberstein e.V.“ und Vorstandsmitglied im Verein für<br />
Heimatkunde im Landkreis Birkenfeld.<br />
Die <strong>Felsenkirche</strong> − eine Huldigung an die Trinität<br />
Armin Peter FAUST, geb. 1943 in Weiden Krs. Birkenfeld,<br />
Oberstudienrat am Staatl. Gymnasium Idar−Oberstein, Mitarbeiter beim Heimat−kalender, Kunstverein Obere Nahe und<br />
der Talentförderung.<br />
Gedanken über zwei Skulpturenfragmente aus der <strong>Felsenkirche</strong><br />
Günther WIENANDS, Dipl. Ing. (FH), geb. 1930 in Pforzheim,<br />
Ingenieur und Orgelbauer in Pforzheim.<br />
Die neue Orgel<br />
Hartmut BACH, geb. 1930 in Duisburg,<br />
Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Oberstein.<br />
Die Bedeutung der <strong>Felsenkirche</strong> für die Gemeinde heute<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
69
Abbildungsverzeichnis<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
1. Ansicht der <strong>Felsenkirche</strong>, undatiert<br />
2. Oberstein um 1955<br />
3. Epitaph des Ritters Philipp II. von Oberstein<br />
4. Burg oder Kirche? Schildmauer und Sakristei während der Sanierungsarbeiten 1928<br />
5. Fußboden im Seitenschiff während der Sanierungsarbeiten 1928<br />
6. Die <strong>Felsenkirche</strong> um 1820, Litographie von Ludwig Strack (1761 − 1836)<br />
7. <strong>Felsenkirche</strong> 1927<br />
8. Die <strong>Felsenkirche</strong> 1482/84 im Querschnitt (Rekunstruktionsversuch Brandt)<br />
9. Wirich der IV., Fragment der ehemaligen Verglasung<br />
10. Fragment aus der ehemaligen Verglasung<br />
11. Glasfragment<br />
12. Geometrischer Grundriss der <strong>Felsenkirche</strong>, 1965<br />
13. Kopfkonsole<br />
14. Das Wappen der Herren von Daun am Säulenansatz des Hauptschiffes<br />
15. Aufriss des nördlichen Seitenschiffes 1927<br />
16. Seitenschiff mit ehem. Nische während der Umbauarbeit 1929<br />
17. Der spätgotische Taufstein<br />
18. Die kleine Glocke von 1686<br />
19. Grabplatte Philipp Friedrichs von Daun−Oberstein (gest. 1615)<br />
20. Oberstein um 1840, Stich von Scheuren<br />
21. mittelalterliche Truhe<br />
22. Petrus, aus den Apostelbildern an der Empore<br />
23. Inneres der <strong>Felsenkirche</strong> vor der Renovierung 1927<br />
24. Die <strong>Felsenkirche</strong> 1927<br />
25. Kanzel und Orgelprospekt von 1756 heute<br />
26. Oberstein vor dem Brand des Schlosses 1855<br />
27. Oberstein nach der Umgestaltung der Turmspitze 1858<br />
28. Fassung der Quelle an der Rückwand der <strong>Felsenkirche</strong><br />
29. Die Turmhaube der <strong>Felsenkirche</strong> vor der Renovierung 1927<br />
30. Turmhaube nach der Renovierung<br />
31. Blick ins Innere der <strong>Felsenkirche</strong> um 1900<br />
32. Die geplante neue Obersteiner Kirche, Entwurf von Reg.−Baumeister Senz aus<br />
Köln, 1910<br />
33. Die <strong>Felsenkirche</strong> 1927<br />
34. Schildmauer und große Fenster während der Renovierung 1927/29<br />
35. Gedenktafel für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges<br />
36. Die (Bretter) Tonnendecke im Hauptschiff von ca. 1750 − 1927<br />
37. Das Hauptschiff heute<br />
38. Christuskirche in Oberstein nach Plänen von Prof. R. Krüger, Saarbrücken, 1965<br />
errichtet<br />
39. Blick auf die Empore heute<br />
40. Blick auf die <strong>Felsenkirche</strong> 1983<br />
70
41. Altarbild<br />
42. Männerkopf vom Altarbild (Selbstbildnis des Meisters?)<br />
43. Tafelbild mit der Familie des Grafen Sebastian um 1750<br />
44. Gewölbte Decke und Triumphbogen vor der Renovierung 1927/29<br />
45. Das 1929 neu gestaltete Hauptschiff<br />
46. Zinnkanne aus dem 17. Jh.<br />
47. Zinnkanne aus dem 18. Jh.<br />
48. Christus als Weltenrichter<br />
49. Grabmal<br />
50. Kruzifix aus Bergkristall<br />
51. Mittelalterliche Holztruhe<br />
52. Naturgewachsenes Achatkreuz<br />
53. Apostelbild vor der Renovierung<br />
54. Apostelbild nach der Renovierung<br />
55. Apostelbild während der Reinigung<br />
56. Apostelbild während der Reinigung<br />
57. Grabplatte N.N. von Daun−Oberstein (gest. 1615)<br />
58. Farbliche Erneuerung<br />
59. Blick auf das Orgelprospekt<br />
60. Sebastiansbild während der Reinigung<br />
61. Tafel zur Renovierung 1981<br />
62. Das neue Altarkreuz von Klaus Rothe<br />
63. Europas höchstes Arbeitsgerüst 1980<br />
64. Tunnel zur <strong>Felsenkirche</strong><br />
65. Die <strong>Felsenkirche</strong> heute<br />
66. Die drei Bogen des Seitenschiffs<br />
67. Skulpturenfragment<br />
68. Skulpturenfragment<br />
69. ,,Der Schmerzensmann" von Albrecht Dürer<br />
70. Taufschale aus dem 16. Jahrhundert<br />
71. Die <strong>Felsenkirche</strong> heute<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
71
Fotonachweis<br />
Die Abbildungen dieser Artikel stellten freundlicherweise zur Verfügung:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
H. Peter Brandt, Idar−Oberstein<br />
Karla Dumke, Kempfeld<br />
Dr. Hans F. Häuser, Idar−Oberstein<br />
Foto Hosser, Idar−Oberstein<br />
Evangelische Kirchengemeinde Oberstein<br />
Kreissparkasse Birkenfeld (Birkenfelder Landesbank)<br />
Peter Pracher, Würzburg<br />
Stadt Idar−Oberstein<br />
Verein ,,Die Heimatfreunde Oberstein e.V."<br />
<strong>Festschrift</strong><br />
72