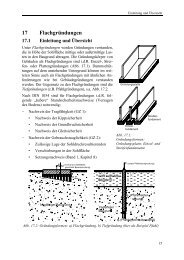10 Anschluss
10 Anschluss
10 Anschluss
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Anschluss</strong><br />
dig einbetoniert wird. Mittels Hammerkopfschrauben<br />
oder ähnlicher Ve r b i n d u n g s m i t t e l<br />
lassen sich z. B. Konsolen als Träger für Installationsleitungen<br />
oder andere Bauteile befestigen<br />
(s. Abb.).<br />
Ankerschienen<br />
A n k e r ( - s c h r a u b e n ) ; zugbeanspruchte Ve r b i ndungsstäbe<br />
zwischen der Stahlkonstruktion und<br />
den massiven Unterbauten (z.B. Fundamente).<br />
A n k e r b o j e; S c h w i m m k ö r p e r, der durch ein Seil<br />
mit dem ausgelegten Schiffsanker verbunden<br />
ist.<br />
Ankerkopf; der Ankerkopf dient zur Verbindung<br />
des Ve r p re s s a n k e r s mit dem Bauwerk. Eine<br />
spezielle Ausbildung des Ankerkopfes ermöglicht<br />
einen Lageausgleich des Widerlagers und<br />
die Fixierung einer Ankervorspannung.<br />
Ankerschiene;<br />
A n k e r v e r p re s s p f a h l; siehe Ve r p re s s m a n t e l p f a h l .<br />
A n k e r v o r s p a n n u n g; die Vo r s p a n n u n g eines Ve rp<br />
re s s a n k e r s dient zur Begrenzung der Ve r f o rm<br />
u n g e n im Gebrauchszustand bezüglich der<br />
Ausgangslage.<br />
A n k e rw a n d; eine rückwärtige Verankerung von<br />
S t ü t z w ä n d e n kann mit aufgelösten oder durchgehenden<br />
Ankerwänden erfolgen. Diese Veran-<br />
<strong>10</strong><br />
kerungsmöglichkeit ist besonders für Uferschutzwände<br />
und im Hafenbau gebräuchlich.<br />
A n k e rz u g g l i e d; das Ankerzugglied als Einstaba<br />
n k e r, Litzen- oder Bündelspanngliedern stellt<br />
beim Ve r p re s s a n k e r s die Verbindung zwischen<br />
Ankerkopf und Verpresskörper her.<br />
A n l a g e n; ortsfeste Einrichtungen wie Betriebsstätten<br />
und Lager. Dazu gehören auch Maschinen,<br />
Geräte, Fahrzeuge und sonstige ortsveränderliche<br />
technische Einrichtungen, die in einem<br />
räumlichen und betriebstechnischen Zusammenhang<br />
stehen und für das Entstehen von<br />
Umweltwirkungen von Bedeutung sein können.<br />
Anlagen, bauliche; siehe bauliche Anlagen.<br />
Anobie; s. Pochkäfer.<br />
A n o r d n u n g s b e z i e h u n g; B e g r i ff aus der N e t zplantechnik,<br />
ist nach DIN 69 900 die quantifizierbare<br />
Abhängigkeit zwischen Ereignissen<br />
oder Vo rgängen. Man unterscheidet die Normalfolge<br />
vom Ende eines Vo rgangs zum A nfang<br />
des Nachfolgers, die Anfangsfolge vom<br />
Anfang eines Vo rgangs zum Anfang des Nachfolgers,<br />
die Endfolge vom Ende eines Vo rg a n g s<br />
zum Ende des Nachfolgers sowie die Sprungfolge<br />
vom Anfang des Vo rgangs zum Ende des<br />
Nachfolgers.<br />
Anpassungsgebot; [BauGB § 1 (4)]; die Bauleitp<br />
l ä n e sind den übergeordneten Zielen der<br />
Raumordnung anzupassen.<br />
A n p r a l l l a s t e n; können z. B. bei Stützen, Säulen,<br />
P f e i l e r n in Tiefgaragen sowie bei Schrammborden<br />
auftreten.<br />
A n r a m p u n g; Höhenänderung eines Fahrbahnrandes<br />
bei Änderung der Fahrbahnquerneigung<br />
oder Fahrbahnbreite.<br />
Anrampungsneigung; auf die Neigung der Grad<br />
i e n t e bezogene Längsneigung eines Fahrbahnrandes.<br />
A n re g e r; latent hydraulische S t o ffe werden<br />
durch Anreger in hydraulische Bindemittel verwandelt,<br />
z. B. wird H ü t t e n s a n ddurch P o rt l a n dz<br />
e m e n t k l i n k e r angeregt; es entstehen H ü t t e nzemente.<br />
A n r u f s c h r a n k e; Bahnschranke, die in der Regel<br />
geschlossen ist und nur auf Anruf durch den<br />
Straßenbenutzer fernbedient geöffnet wird.<br />
A n s c h l a g; Art der Einbindung von Fenster- und<br />
Türenrahmen in die Umfassungswände, zu unterscheiden<br />
in Innen- und Außenanschlag so-
Bauingenieur<br />
Baugenehmigungsverfahren<br />
24
Dampfheizung<br />
D a c h b e g r ü n u n g; Bepflanzung einer Dachfläche.<br />
Richtig ausgeführte Dachbegrünungen schützen<br />
die Dachoberflächen; i. d. R. werden Dachbegrünungen<br />
bei F l a c h d ä c h e r n über D a c h a bd<br />
i c h t u n g e n ausgeführt. Mit besonderen konstruktiven<br />
Maßnahmen lassen sich auch Dachbegrünungen<br />
bis zu Dachneigungen von 45°<br />
herstellen. Im ländlichen Bauwesen Skandinaviens<br />
sind G r a s d ä c h e r z . B. auf geneigten Dächern<br />
mit schuppenartig verlegter Birkenrinde<br />
seit altersher bekannt.<br />
D a c h b a h n e n; Dachbahnen werden aus P V C ,<br />
Ethylencopolymerisat-Bitumen ECB oder Polyisobutylen<br />
PIB in Dicken von 1 bis 2 mm<br />
(evtl. einseitig kaschiert) hergestellt. Sie werden<br />
mit Heißbitumen oder Lösemittelspezialkleber<br />
verklebt oder auch nur gelegt und mit<br />
Platten oder Kies abgedeckt.<br />
D a c h d e c k e r; handwerklicher A u s b i l d u n g s b e r u f .<br />
Er wird als zulassungspflichtiges Handwerk in<br />
der Anlage Ader H a n d w e r k s o rdnung g e f ü h r t .<br />
Der Aufgabenbereich des Dachdeckers umfasst<br />
Dachdeckungen und Dachabdichtungen.<br />
D a c h d e c k u n g; risikoarme Technik, wenn die<br />
material- und konstruktionsbedingten Mindestdachneigungen<br />
eingehalten werden. Geneigte<br />
Dächer erhalten i. d . R. Dachdeckungen. Je<br />
steiler die Dachneigung, desto besser die Regenableitung.<br />
Dachdeckungen werden herg estellt<br />
aus kleinformatigen Einzelteilen wie<br />
D a c h z i e g e l n , D a c h s t e i n e n , Platten aus N a t u rs<br />
t e i n, S c h i n d e l n aus Holz, S c h i e f e r und F a s e rzement<br />
und großformatigen Wellplatten aus Faserzement<br />
oder Metall, Metallblechtafeln und<br />
-bändern und schließlich aus Stroh und Schilf.<br />
D a c h e n t w ä s s e r u n g (DIN EN 12056-3); das auf<br />
Dächern anfallende Regenwasser muss, wenn es<br />
die bauaufsichtlichen Vorschriften verlangen, in<br />
D a c h r i n n e n aufgefangen, in R e g e n f a l l l e i t u n g e n<br />
abgeführt und falls erforderlich auch unterirdisch<br />
abgeleitet werden. Sollen Regenfallleitungen<br />
ausnahmsweise im Innern der Gebäude verlegt<br />
werden, so sind sie aus den für A b w a s s e r l e it<br />
u n g e nangegebenen We r k s t o ffen auszuführen.<br />
Im Einzelfall kann das Regenwasser von Regenfallleitungen,<br />
die nicht unmittelbar an öffentlichen<br />
Verkehrsflächen liegen, auch auf andere<br />
Art abgeführt werden, wenn Vo r s o rge get<br />
r o ffen wird, dass Gebäudeteile gegen Durchfeuchtung<br />
geschützt sind und das Regenwasser<br />
ungehindert ablaufen kann.<br />
56<br />
Regenwasserbehälter müssen unfallsicher abgedeckt<br />
sein.<br />
D a c h e r k e r; auch Z w e rc h h a u s oder L u k a r n e.<br />
Dachaufbau mit eigenem kleinem D a c h u n d<br />
senkrecht stehendem Fenster in der Ebene der<br />
Außenwand des Gebäudes.<br />
D a c h f e n s t e r; auch Gaupe (von ahd. gupen =<br />
gucken) oder Gaube. Dachaufbau mit senkrecht<br />
stehendem Fenster unter angehobener Dachfläche<br />
oder eigenem kleinem Dach. Formen:<br />
z . B. Schleppgaupe oder F l e d e r m a u s g a u p e<br />
(Abbildung).<br />
Dachflächenfenster; sie liegen im Gegensatz zu<br />
Dachfenstern in der Dachfläche. Sie sind i. d. R.<br />
als Schwingflügelkonstruktion ausgebildet.<br />
D a c h f o r m e n; es gibt eine unermessliche Fülle<br />
von regionaltypischen und zumeist klimatisch<br />
bedingten Varianten. In nass-feuchten Klimazonen<br />
haben sich geneigte Dächer und in trockenen<br />
F l a c h d ä c h e r als sinnvoll und konstruktiv<br />
richtig erwiesen. Bei geneigten Dächern gibt es<br />
folgende Grundformen (Abbildung): P u l t d äc<br />
h e r, Satteldächer, Walmdächer und M a n s a rdd<br />
ä c h e r. Eine für den Industriebau entwickelte<br />
Dachform ist das S h e d d a c h. Tu r m d ä c h e r s i n d<br />
meist aus Pyramiden und Kegeln entwickelt<br />
und häufig aus mehreren Körpern zusammengesetzt.<br />
Dachformneigung, Dachpro f i l; F a h r b a h n q u e rprofil<br />
mit Gefälle von der Straßenachse zu den<br />
Fahrbahnrändern.<br />
Dachgaupe; siehe Dachfenster.
der Spannweite gebaut worden (Pantheon,<br />
Rom, 1. Jh. n. Chr., Kuppeldurchmesser 43 m;<br />
Hagia Sophia, Konstantinopel, heute Istanbul,<br />
6. Jh. n. Chr., Kuppeldurchmesser 32 m). Bei<br />
Rotationskuppeln treten in Meridianschnitten,<br />
d. h. den kürzesten Verbindungslinien zwischen<br />
Kuppelscheitel und Widerlagerzone, Meridiandruckkräfte<br />
auf. Im Verlauf der Breitenkreise<br />
Lochziegel<br />
gibt es Ringkräfte, die im Scheitelbereich der<br />
Kuppel i. d . R. Druckkräfte sind. Dort, wo<br />
Ringzugkräfte auftreten können, sicherte man<br />
Kuppeln mit Ringzugankern.<br />
K U RT; kostenorientierte unverbindliche Richtsatz-Tabellen<br />
für Transporte im innerdeutschen<br />
G ü t e r v e r k e h r, herausgegeben vom Bundesverband<br />
Wirtschaftsverkehr und Entsorgung e. V.<br />
159<br />
L
P o l y p ropylen (PP); ein durch Polymerisation<br />
von Propylen (entsteht beim Cracken von Benzin)<br />
gewonnenes Thermoplast. Es besitzt höhere<br />
Festigkeiten und eine höhere Erweichungstemperatur<br />
als Polyethylen. Verwendung: Rohre<br />
(Wa r m w a s s e r, Fußbodenheizung), im Bauwesen<br />
derzeit eher selten.<br />
P o l y s t y rol (PS); entsteht durch Polymerisation<br />
von Styrol, das aus Benzol und Ethylen herg estellt<br />
wird (Thermoplast). Es ist relativ hart,<br />
spröde, glasklar und besitzt einen Oberflächenglanz.<br />
Es kann mit Strangguss- (Extrudern)<br />
und Spritzgussmaschinen verarbeitet<br />
werden. Verwendung: Beschläge, Profile, Behälter,<br />
Dosen.<br />
P o l y s t y rol, expandiert (EPS); wird aus Perlpolymerkugeln<br />
(2 bis 3 mm), in die ein Tr e i b m i ttel<br />
einpolymerisiert wird, hergestellt (Thermoplast).<br />
Polystyrolperlen werden mit Wa s s e rdampf<br />
auf etwa <strong>10</strong>0 °C erweicht und blähen<br />
durch das Treibmittel auf das 30- bis 50-fache<br />
Ausgangsvolumen auf. Findet dieser Prozess in<br />
einer geschlossenen Form statt, verschweißen<br />
die Kugeln zu einem Block, der anschließend<br />
weiterverarbeitet werden kann. Ve r w e n d u n g :<br />
nicht druckfeste Dämmplatten.<br />
Polystyrol, extrudiert (XPS); wird in einem Extruder<br />
(Strangpresse) als unendlicher Schaums<br />
t o ffstrang hergestellt. Es entsteht ein druckfester<br />
Dämmstoff mit einer geschlossenen Porens<br />
t r u k t u r. Als Treibmittel werden FCKW o d e r<br />
teilhalogenierte Kohlenwasserstoffe eingesetzt,<br />
die emittieren können. Verwendung: druckfeste<br />
Dämmplatten (Kelleraußenwände, Parkdecks,<br />
Terrassen).<br />
P o l y s t y ro l b e t o n; gefügedichter L e i c h t b e t o n a u s<br />
Zement, Zuschlag aus expandiertem Polystyrol<br />
(EPS-Beton), Feinsand oder Füller, Wasser und<br />
evtl. Zusatzmitteln. Verwendung: Steine bzw.<br />
geschosshohe Elemente im Wohnbau (als verlorene<br />
Schalung und Verfüllung mit Normalbeton),<br />
im Straßenbau als Tragschicht bei frostgefährdeten<br />
Böden.<br />
Polyurethan; wird durch Polyaddition von Polyisocyanat<br />
und OH-Gruppen enthaltenden Molekülen<br />
synthetisiert. PUR-Schäume werden als<br />
gummiartiger Weichschaum oder als Hartschaum<br />
hergestellt.<br />
Polyurethangießharze; haften gut auf den meisten<br />
Untergründen, sind gut alterungsbeständig,<br />
beständig gegen Benzin, Öle, Fette und ver-<br />
Rechenwert<br />
dünnte Säuren und Laugen, aber unbeständig<br />
gegen konzentrierte Säuren und Laugen und<br />
werden evtl. durch heißes Wasser zerstört. Verwendung:<br />
Oberflächenschutzsysteme.<br />
P o l y u re t h a n h a rt s c h a u m; wird in Formen oder<br />
als endloses Band verschäumt und als Platten,<br />
Bahnen oder Blöcke gefertigt (evtl. ein- oder<br />
zweiseitig beschichtet). Verwendung: Kelleraußendämmung,<br />
Dächer.<br />
P o l y u re t h a n o rt s c h a u m; wird auf der Baustelle<br />
mit einer Misch-Spritzpistole aufgespritzt (Haftung<br />
auf den meisten Untergründen sehr gut),<br />
wo es sofort aufschäumt und aushärtet. Ve rwendung:<br />
Ausschäumen von T ü r z a rgen und<br />
Fensterrahmen.<br />
Polyvinylchlorid (PVC); ein hochmolekularer<br />
thermoplastischer Kunststoff, wird durch Polymerisation<br />
von Vinylchlorid in den Formen<br />
PVC-hart, PVC-weich und PVC-hochdruckgeschäumt<br />
hergestellt. PVC ist ohne We i c h m acher<br />
schwer entflammbar, entwickelt aber beim<br />
Brand Chlorgase. Verwendung: PVC-hart:<br />
Rohre, Fassadenelemente, Fensterrahmen,<br />
Lichtelemente, Rolladenprofile; PVC-weich:<br />
Dach- und Dichtungsbahnen, Fugenbänder;<br />
PVC-hochdruckgeschäumt: Dichtungsprofile,<br />
Sandwichplatten.<br />
Polyvinylidenchlorid (PVDC); und Copolymere<br />
(anionisch, nicht ionisch); kommt sowohl in<br />
amorpher als auch in kristalliner Form vor und<br />
kann in dispergierter Form von einer zur anderen<br />
Form übergehen. Das Polymer ist hochschmelzend,<br />
abriebfest, chemikalienbeständig.<br />
Verwendung: Feuchtesperren, Anstriche.<br />
P o n t o n; schwimmender Hohlkörper, vorwiegend<br />
zum Anlegen von Schiffen.<br />
P o renbeton (Gasbeton); Quarzsand, Z e m e n t,<br />
Kalk, Wasser werden durch ein Treibmittel (z.<br />
B. Aluminiumpulver) bei konstantem Druck<br />
und Temperatur im Autoklaven aufgebläht. Die<br />
Unterscheidung erfolgt nach der Druckfestigkeit.<br />
Verarbeitung zu Planblöcken (Ve r k l e b e n<br />
mit Dünnbettmörtel), Fassadenplatten, Deckenplatten<br />
(B e w e h ru n g benötigt eine Ummantelung!).<br />
Verwendung: Außenwände, Innenwände,<br />
Deckenelemente, Fassadenplatten (Industriebau).<br />
P o re n b e t o n d e c k e n p l a t t e; Fertigteilplatte aus<br />
P o re n b e t o n für Geschoss- und Dachdecken.<br />
In die besonders profilierten Längsfugen wird<br />
i . d . R. Stahlbewehrung eingelegt. Sie werden<br />
205<br />
R
Weiche<br />
winkels und keine Änderung der Ve r s c h i ebungskomponenten<br />
auftreten; an einem festen<br />
Auflager müssen die Ve r s c h i e b u n g s k o m p o n e nten<br />
null sein; Verträglichkeitsbedingungen führen<br />
beim K r a f t g r ö ß e n v e r f a h re n zum G l e ichungssystem<br />
für die statisch Unbestimmten.<br />
Verträglichkeitskontrollen; Überprüfung, ob<br />
Verträglichkeitsbedingungen erfüllt sind; Ausführung<br />
mit Prinzip der virtuellen Kräfte und<br />
R e d u k t i o n s s a t zoder mit Mohrschen Kontro l l e n .<br />
Ve r u n s t a l t u n g s k l a u s e l; L a n d e s b a u o rd n u n g e n<br />
enthalten Verunstaltungsklauseln, die mit unbestimmten<br />
Rechtsbegriffen allerdings keine konkreten<br />
Beurteilungsgrundlagen für die A h ndung<br />
von Verstößen abgeben: Bauliche A n l agen<br />
sind in der Form, in den Proportionen, in<br />
der Art und Verarbeitung der We r k s t o ffe und<br />
der Farbgestaltung so durchzubilden, dass sie<br />
weder für sich noch im Kontext des Straßenbildes<br />
sowie des Orts- und Landschaftsbildes verunstaltet<br />
wirken.<br />
Verwesung; Abbau organischer Stoffe durch Mik<br />
r o o rganismen bei Sauerstoffverbrauch zu<br />
Kohlendioxid, Wa s s e r, Ammoniak und Mineralsalzen.<br />
Ve rw ö l b u n g; meist auf S t a b q u e r s c h n i t t b e z o g e n ;<br />
liegt vor, wenn Stabquerschnitt im verformten<br />
Zustand nicht mehr eben ist; bei To r s i o n k ö nnen<br />
wölbfreie und nicht wölbfreie Querschnitte<br />
unterschieden werden; für letztere ist W ö l bkrafttorsion<br />
von Bedeutung.<br />
Ve rz a h n u n g; (Abb. Ve r z a h n u n g e n); im M a u e rw<br />
e r k s b a u übliche Technik, beim Herstellen einer<br />
Wand eine Verbindungsstelle für eine später<br />
zu errichtende und in die bereits bestehende<br />
einzubindende Wand den Verbandsregeln entsprechend<br />
vorzubereiten. Es gibt Lochverzahnung,<br />
stehende und liegende Verzahnung. Nur<br />
die letztgenannte Verzahnungsart gilt nach DIN<br />
<strong>10</strong>53-1 als ausreichende Verbindung zwischen<br />
t r a g e n d e n und a u s s t e i f e n d e n M a u e r w e r k sw ä nden.<br />
Verzapfung; ein Zapfen am Ende eines Kantholzes<br />
fügt sich in ein am anderen Holz ausgearbeitetes<br />
Loch oder einen durchgehenden<br />
Schlitz. Die Verzapfung gilt als voll gelenkige<br />
Verbindung. Die Verzapfung gewährleistet bei<br />
den Ständern die volle Aufstandsfläche. Das<br />
durchgehende Holz ist bei Überkreuzungen<br />
weniger geschwächt. Das Zapfenschloss bietet<br />
die Möglichkeit, Zugbelastungen aufzuneh-<br />
306<br />
men. Ein Nachteil der Verzapfung liegt in der<br />
schlechten Kontrollmöglichkeit. Die Zapfenlöcher<br />
sollten mit einer Bohrung versehen sein,<br />
damit eingedrungenes Wasser ablaufen kann.<br />
Ve rz e r r u n g; Ve r f o r m u n g eines infinitesimalen<br />
Flächenelements (z. B. Dehnung, Gleitung)<br />
oder eines Stabelements (z. B. L ä n g s d e h n u n g ,<br />
Verkrümmung, Gleitung, Verdrillung).<br />
Verzinken; siehe Feuerverzinken.<br />
Ve rz ö g e re r V Z; B e t o n z u s a t z m i t t e l , das das E rs<br />
t a rre n von B e t o n und M ö rt e l deutlich verzögert<br />
und dadurch die Verarbeitbarkeitszeit verlängert.<br />
Verzweigungslast; siehe ideale Knicklast.