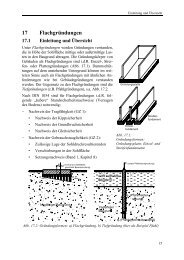Baustoffe – gestern und heute
Baustoffe – gestern und heute
Baustoffe – gestern und heute
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Vorwort<br />
In einer Welt, die durch immer schnellere Veränderungen <strong>und</strong> Entwicklungen<br />
beeinflusst wird, sind auch die technischen Normen dem Wandel<br />
unterworfen. Das Zusammenwachsen der Länder in Europa erfordert bei<br />
den technischen Normen nicht nur ein bestimmtes Maß an Flexibilität<br />
sowie die Möglichkeit zur Anpassung sondern auch einen Ersatz vertrauter<br />
Normen, weil veränderte Umstände, Märkte <strong>und</strong> Technologien es verlangen.<br />
Die Vielzahl der <strong>Baustoffe</strong> erfährt demzufolge durch die Einführung der<br />
internationalen Normen starke Veränderungen in Bezeichnungen, Anforderungen<br />
<strong>und</strong> Qualitätskontrolle.<br />
Für den einzelnen im Bauwesen Tätigen ergeben sich dabei nahezu unüberschaubare<br />
Änderungen.<br />
Die Entwicklung der gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland hat<br />
darüber hinaus in der Vergangenheit eine Vielzahl unterschiedlicher<br />
Normen zur Folge gehabt. Mit dem Mauerbau 1961 wurde die Trennung<br />
der deutschen Normen in DIN <strong>und</strong> TGL besiegelt. Zu beachten ist dabei,<br />
dass DIN-Normen keine Gesetze oder Rechtsverordnungen darstellen;<br />
die TGL-Standards (Technische Güte- <strong>und</strong> Lieferbedingungen) waren<br />
dagegen Rechtsvorschriften. In den ersten Jahren nach 1961 erkannte<br />
man einen Bezug zur DIN-Norm durch das Voranstellen einer 0 vor der<br />
TGL-Nummer.<br />
Beim Bauen im Bestand wird der Projektbearbeiter mit diesen alten Baustoffbezeichnungen<br />
konfrontiert, z. B. mit den Bezeichnungen beim Beton<br />
B 300, Bk 25 oder beim Betonstahl mit StA-O, StA-I oder beim Vollziegel<br />
Mz 150, um nur wenige Beispiele zu nennen.<br />
Anliegen dieses Buches ist es erstens, die alten Bezeichnungen der<br />
<strong>Baustoffe</strong> im Zusammenhang mit den jetzt gültigen darzustellen, um<br />
nicht nur ein aufwändiges Suchen zu ersparen sondern auch um auf die<br />
damaligen Anforderungen an den Baustoff hinzuweisen.<br />
Ein zweites Anliegen ist es, den Zusammenhang zwischen den durch<br />
langjährigen Gebrauch bekannten Bezeichnungen der <strong>Baustoffe</strong> einschließlich<br />
Anforderungen in den DIN-Normen mit den umfangreichen<br />
DIN EN-Normen darzustellen. Diese zunehmende Flut neuer Bezeichnungen<br />
<strong>und</strong> Inhalte erfordert eine Zusammenstellung, aus der die wesentlichsten<br />
baupraktischen Informationen ableitbar sind.<br />
Bekanntlich wurde im Jahr 1985 in der Europäischen Normung das Ziel<br />
formuliert, durch Einführung des so genannten „Neuen Konzeptes“ die<br />
Verwirklichung des Binnenmarktes zu beschleunigen. Der Begriff der<br />
„Harmonisierten Norm“ spielt dabei eine wichtige Rolle.
Bei einer harmonisierten europäischen Norm ist zu beachten, dass wegen<br />
der Zuständigkeit der EU-Mitgliedsstaaten für wesentliche Aspekte<br />
wie z. B. Standsicherheit, Dauerhaftigkeit, Ges<strong>und</strong>heit, Wirtschaftlichkeit<br />
aufgr<strong>und</strong> der bestehenden Regelungen (in Deutschland z. B. die Bauordnungen)<br />
jede Produktnorm national angepasst werden muss <strong>und</strong><br />
zwar durch Restnormen bzw. Anwendungsnormen. Die so genannten<br />
Restnormen bleiben solange erhalten, bis die Festlegungen bei einer<br />
Überarbeitung künftiger EN-Normen eingefügt werden können. Anwendungsnormen<br />
sind erforderlich, wenn die in den europäischen Produktnormen<br />
enthaltenen Bezüge auf andere Produkt- <strong>und</strong> Bemessungsnormen<br />
wegen deren Fehlen sich nicht umsetzen lassen. Weiterhin sind die<br />
aus deutscher Sicht notwendigen technischen Änderungen vorzunehmen.<br />
Daraus resultiert das Nebeneinander von DIN EN- <strong>und</strong> DIN-<br />
Normen zum gleichen Baustoff.<br />
Im Zuge der europäischen Harmonisierung haben damit sowohl europäische<br />
als auch deutsche Stoffnormen nebeneinander Gültigkeit; zukünftig<br />
wird es nur noch europäische Normen geben.<br />
Wesentlich ist, dass die harmonisierten Normen zwar keine verbindliche<br />
Rechtsgr<strong>und</strong>lage, aber Gr<strong>und</strong>lage für das CE-Zeichen sind; eine Behinderung<br />
des In-Verkehrbringens <strong>und</strong> der Verwendung darf dann national<br />
nicht erfolgen. Die nach außen sichtbare CE-Kennzeichnung zeigt die<br />
Übereinstimmung des Produktes mit den wesentlichen Anforderungen<br />
an, stellt aber kein Qualitätszeichen dar. Die Qualität wird national durch<br />
Festlegung bestimmter Klassen aus den zugehörigen DIN EN-Normen<br />
als Mindestanforderung gesichert.<br />
Von den im Buch behandelten <strong>Baustoffe</strong>n, beginnend mit den Bindemitteln<br />
über Mörtel, Betone, Mauersteine usw. bis zu den organischen <strong>Baustoffe</strong>n<br />
<strong>und</strong> Metallen werden als erstes aus den zur Zeit gültigen Normen<br />
nicht nur die Bezeichnungen genannt sondern auch wichtige baupraktische<br />
Eigenschaften abgeleitet bzw. Hinweise zur Zusammensetzung<br />
gegeben. Wenn es aus Sicht des Autors erforderlich war, erfolgte zum<br />
Verständnis weniger bekannter Kenngrößen eine Erläuterung des Prüfprinzips.<br />
Es werden weiterhin Informationen über Bezeichnungen aus<br />
„alten“ Baustoffnormen <strong>und</strong> die Bewertung der Unterschiede in den Anforderungen<br />
mit den jetzt gültigen vorgenommen. Aus den entsprechenden<br />
Tabellen ist auch ableitbar, welche „Alt- mit Neubezeichnungen“ vergleichbar<br />
sind. Aus praktischen Gründen waren bei der Gliederung nach<br />
Baustoffart Abweichungen (z. B. Mauersteine, Dämmstoffe) erforderlich.
Dieses Buch ist kein Baustofflehrbuch im üblichen Sinn, weil z. B. auf<br />
Anwendungen der <strong>Baustoffe</strong> nicht eingegangen wird, das Verständnis<br />
von alten <strong>und</strong> neuen Baustoffbezeichnungen im Vordergr<strong>und</strong> steht.<br />
Die Darstellung des Textes, die aussagefähigen Tabellen sind von ihrem<br />
Inhalt so angelegt, dass das Buch sowohl dem Berufsnachwuchs im weitesten<br />
Sinne als Lehrmaterial als auch dem in Planung <strong>und</strong> Bauausführung<br />
Tätigen bei seinem „Kontakt“ mit dem Baustoff als Hilfsmittel dienen<br />
kann.<br />
Inhalt <strong>und</strong> Form des Buches wurden positiv beeinflusst durch die Diskussionen<br />
mit Herrn Professor Schneider vom Verlag Bauwerk.<br />
Der Autor ist jederzeit für fördernde Hinweise <strong>und</strong> kritische Stellungnahmen,<br />
die zur Verbesserung des Buches beitragen, dankbar.<br />
Wolf-Peter Ettel<br />
im Oktober 2005
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Anorganische Bindemittel 1<br />
1.1 Baukalke 1<br />
1.2 Zemente 4<br />
1.2.1 Heutiger Stand 4<br />
1.2.2 Frühere Bezeichnungen 10<br />
1.3 Putz- <strong>und</strong> Mauerbinder 11<br />
1.4 Hydraulische Boden- <strong>und</strong> Tragschichtbinder 12<br />
1.5 Tonerdezement 13<br />
1.6 Bindemittel auf Basis von CaSO4 14<br />
1.6.1 Gipsbinder <strong>und</strong> Gips-Trockenmörtel 14<br />
1.6.2 Calciumsulfat-Binder, Calcium-Sulfat- 17<br />
Compositbinder, Calciumsulfat-Werkmörtel<br />
1.6.3 Frühere Bezeichnungen 18<br />
1.6.4 Gipsplatten (Gipskartonplatten) <strong>und</strong> 19<br />
Gips-Wandbauplatten<br />
1.7 Bindemittel für Magnesiaestrichmörtel 21<br />
(Magnesiabinder)<br />
1.8 Wasserglas 22<br />
2. Gesteinskörnungen (Zuschläge) 23<br />
2.1 Heutiger Stand 23<br />
2.2 Frühere Bezeichnungen 27<br />
3. Mörtel <strong>und</strong> Estriche 29<br />
3.1 Mauermörtel 29<br />
3.2 Putzmörtel 31<br />
3.3 Estriche 34<br />
3.4 Mörtel <strong>und</strong> Klebstoffe für Fliesen <strong>und</strong> Platten 39<br />
4. Betone 41<br />
4.1 Normalbeton; Schwerbeton; Leichtbeton 41<br />
(gefügedicht)<br />
4.2 Dach- <strong>und</strong> Bordsteine 50<br />
4.3 Haufwerksporiger Leichtbeton 51<br />
4.4 Dampfgehärteter Porenbeton 53<br />
5. Mauersteine 55<br />
5.1 Heutiger Stand 55<br />
5.2 Frühere Bezeichnungen 61
6. Natursteine, Natursteinprodukte 63<br />
7. Glas 67<br />
7.1 Basiserzeugnisse 67<br />
7.2 Sicherheitsglas 68<br />
8. Keramische <strong>Baustoffe</strong> 70<br />
8.1 Keramische Fliesen <strong>und</strong> Platten 70<br />
8.2 Radialziegel; Kanalklinker; Pflasterziegel; 72<br />
Dachziegel<br />
8.3 Steinzeug 74<br />
9. Holz; Holzwerkstoffe 76<br />
9.1 Holz 76<br />
9.2 Holzwerkstoffe 81<br />
9.3 Holzfußböden 87<br />
10. Bitumenhaltige <strong>Baustoffe</strong> 89<br />
10.1 Bitumenhaltige Bindemittel 89<br />
10.2 Asphalt 92<br />
10.3 Abdichtungsbahnen, Bitumenbahnen 95<br />
11. Kunststoffe 99<br />
12. Dämmstoffe 102<br />
12.1 Heutiger Stand 102<br />
12.2 Frühere Bezeichnungen 109<br />
13. Metalle 111<br />
13.1 Gusseisen 111<br />
13.2 Stähle (Stahlbau) 111<br />
13.3 Beton- <strong>und</strong> Spannstähle 118<br />
13.4 Nichteisenmetalle 121