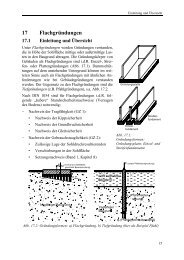Lehmbau Praxis
Lehmbau Praxis
Lehmbau Praxis
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
20<br />
Abb. 2.7 a und b :<br />
salzausblühungen an<br />
einem aus Abbruchmaterial<br />
gewonnenen<br />
sumpfenden Baulehmhaufen<br />
(Jahili fort,<br />
Al-Ain, UAe)<br />
LehmBAU-PRAxIs : 2 Rohstoff BAULehm<br />
miten und Stalaktiten beobachtet werden kann. Wird ein <strong>Lehmbau</strong>stoff, der feinste<br />
und gleichmäßig verteilte Kalksteinpartikel enthält, längere Zeit feucht gelagert, werden<br />
diese Partikel an den Oberflächen angelöst. Trocknet der <strong>Lehmbau</strong>stoff, bilden<br />
sich zusätzlich zur Tonbindung zur Festigkeit des Baustoffs beitragende Kalksteinund<br />
Calcitmineralstrukturen aus. Nicht zu verwechseln sind die hier beschriebenen<br />
Prozesse mit den Effekten, die am <strong>Lehmbau</strong>stoff mit der Zugabe von reaktivem Kalk<br />
als Bindemittel (Calciumhydroxid) ausgelöst werden.<br />
Im Gegensatz zum natürlichen Kalkgehalt führt die Zugabe von reaktivem Kalk zu erheblichen<br />
Wechselwirkungen mit den Tonmineralen und unter Umständen zur negativen<br />
Beeinflussung der Festigkeitseigenschaften.<br />
2.4.2.5 salzgehaltbestimmung<br />
Salze (Chloride, Sulfate und Nitrate) sind in jedem Lehm vorhanden. Oberhalb bestimmter<br />
Konzentrationen können Salze am Bauwerk zu Mängeln oder Schäden führen. Die<br />
meisten Lehme erweisen sich hinsichtlich des Salzgehaltes als unkritisch. Eine Über-<br />
prüfung empfiehlt sich aber vor allem bei:<br />
▸ im küstennahen Bereich gewonnenem Grubenlehm,<br />
▸ Lehmgruben im Umfeld von intensiver Tierhaltung (Gülleeintrag),<br />
▸ Grubenlehm der durch Tausalzeintrag beeinträchtigt sein könnte, und<br />
▸ Baulehmgewinnung aus Abbruchmaterial.<br />
Beim Bauen im internationalen Zusammenhang ist diese Auflistung durch Lehme aus<br />
Steppen- und Wüstengebieten zu ergänzen.<br />
Zum quantitativen Nachweis bauschädlicher Salze wird in der Regel die Ionenchromatographie<br />
oder die Spektralphotometrie verwendet. Herkömmliche nasschemische<br />
Methoden wie Gravimetrie und Potentiometrie werden ebenfalls herangezogen.<br />
Die Frage, welche Salzgehalte im Baulehm akzeptiert werden können, hängt von dem<br />
gewünschten Einsatzzweck (Baustoff und Bauteil), aber auch von den Bedingungen<br />
am Bauwerk ab. Bei wechselfeuchten Bauteilen (z. B. aus Bewitterung oder aufstei-
2.5 AUfBeReItUnG<br />
gender Feuchte) muss die Grenze tiefer gelegt werden als bei dauerhaft trockenen<br />
Bauteilen, da hier die temporär gelösten Salze aus allen Schichten systematisch in die<br />
Verdunstungszone geführt werden. Das kann zu überkritischer Salzanreicherung führen,<br />
was sich in feuchten Flecken, Salzrändern und einem gelockertem Oberflächengefüge<br />
äußern kann. Für den Einsatz an wechselfeuchten Bauteilen ist eine Gesamt-<br />
Anionenkonzentration von bis zu 0,05 M-% meist unproblematisch. Dabei ist auch von<br />
Bedeutung welche Salze vorliegen. Leichtlösliche Nitrate sind grundsätzlich problematischer<br />
als die schwerer löslicheren Sulfate. Bei dauerhaft trockenen Bauteilen liegt<br />
die Obergrenze für den Einsatz um 0,10 M-% Gesamt-Anionenkonzentration.<br />
Es muss außerdem berücksichtigt werden, dass leichtlösliche Salze durch ihre hygroskopischen<br />
Eigenschaften die Baustofffeuchte heraufsetzen. Dadurch können Eigenschaften<br />
wie die Festigkeit, aber auch die Farbe erheblich beeinflusst werden (Abbildung<br />
2.8).<br />
2.5 Aufbereitung<br />
Unter Aufbereitung versteht man die Arbeitsgänge mit denen ein Baulehm für die Verarbeitung<br />
zum Baustoff vorbereitet wird. Ziel der Aufbereitung ist, dass der Baulehm<br />
für die Weiterverarbeitung entsprechend den Anforderungen homogen und ohne störende<br />
Bestandteile vorliegt und die Tonminerale im <strong>Lehmbau</strong>stoff ihre Bindemittelwirkung<br />
entfalten können, d. h. aufgeschlossen sind.<br />
Grubenlehme werden heute in der Regel maschinell, also mechanisch aufbereitet. Die<br />
mechanische Aufbereitung kann durch natürliche Prozesse unterstützt oder bestenfalls<br />
sogar ersetzt werden. Dabei ist jedoch mehr Zeit einzuplanen.<br />
Welches Aufbereitungsverfahren gewählt wird, hängt von zahlreichen Randbedingungen<br />
aber zuallererst vom Baulehm ab.<br />
21<br />
Abb. 2.8 : Dunkle<br />
stellen infolge hygroskopisch<br />
erhöhter<br />
feuchte durch die<br />
Verwendung einzelner<br />
salzbelasteter<br />
Lehmsteine und<br />
deren messtechnische<br />
erfassung (Jahili fort,<br />
Al-Ain, UAe)
Geglättete Putzoberflächen<br />
4.3 UnteRGRünDe Von LehmPUtZen<br />
tabelle 4.3 : merkmale von Qualitätsstufen für Innenputze mit geglätteten Putzoberflächen<br />
Q1 Q2 Q3 Q4<br />
– Standardqualität, genügt üblichen<br />
Anforderungen an Wand- und Deckenflächen.<br />
Erhöhte Anforderungen, nur durch<br />
zusätzliche, über die Standardqualität<br />
Q2 hinausgehende Maßnahmen<br />
zu erreichen.<br />
– – Dekorative Oberputze > 1,0 mm – Dekorative Oberputze < 1,0 mm<br />
– Mittel- bis grobstrukturierte – Fein strukturierte Wandbeklei-<br />
Wandbekleidungen, z. B. Raufaserdungentapeten Körn RM / RG DIN 6742<br />
– Matte, fein strukturierte Anstri-<br />
– Matte, gefüllte Anstriche und<br />
Beschichtungen, z. B. Dispersionsanstrich,<br />
die mit grober Lammfelloder<br />
Strukturrolle aufgetragen<br />
werden.<br />
che und Beschichtungen.<br />
Höchste Anforderungen, nur<br />
durch zusätzliche, über Q3 hinausgehende<br />
Maßnahmen zu erreichen.<br />
Glatte oder strukturierte Wandbekleidungen<br />
mit Glanz, z. B.:<br />
– Metall, Vinyl- oder Seidentapeten<br />
– Lasuren oder Anstriche / Beschichtungen<br />
bis zum mittleren Glanz<br />
– Spachtel- und Glättetechniken.<br />
Anforderungen<br />
eignung<br />
– Messpunktabst. in m bis Messpunktabst. in m bis Messpunktabst. in m bis ebenheitstoleranzen<br />
0,1 1 4 10 15 0,1 1 4 10 15 0,1 1 4 10 15<br />
Stichmaß-Grenzwert mm Stichmaß-Grenzwert mm Stichmaß-Grenzwert mm<br />
DIn 18202<br />
1997-4<br />
3 5 10 20 25 3 5 10 20 25 2 3 8 15 20<br />
tab. 3, Zeile 6 o. 7<br />
– Einlagig: Nach dem Putzauftrag<br />
des Gipsputzes oder gipshaltigen<br />
Putzes auf ggf. vorbehandelten<br />
Putzgrund erfolgen das Abziehen<br />
und das Ausrichten des Putzes.<br />
Durch zusätzliches Filzen wird<br />
die so aufgeschlämmte Fläche<br />
anschließend geglättet.<br />
Zweilagig: Geeignete Putzglätte<br />
wird auf einen ggf. vorbehandelten,<br />
planeben rau abgezogenen, abgebundenen<br />
Unterputz aus Gips-,<br />
Gipskalk-, Kalkgips-, Kalk- oder<br />
Kalkzementputz aufgetragen.<br />
– Vereinzelte Abzeichnungen wie z. B.<br />
Traufelstriche sind nicht auszuschließen.<br />
Schattenfreiheit bei Streiflicht<br />
kann nicht erreicht werden.<br />
Alle Ausführungen wie Q2.<br />
Zusätzlich wird in einem weiteren<br />
Arbeitsgang die Putzoberfläche<br />
entweder mit einem Glättgang<br />
oder mit einem Glättputzauftrag<br />
überarbeitet.<br />
Bearbeitungsspuren wie z. B.<br />
Traufelstriche werden weitgehend<br />
vermieden. Grad und Umfang sind<br />
gegenüber Q2 geringer.<br />
Bei Streiflicht sichtbar werdende<br />
Abzeichnungen sind nicht ganz<br />
auszuschließen.<br />
Putz muss erhöhten Anforderungen<br />
an die Ebenheit entsprechen. Dazu<br />
sind im Allg. Unterputzprofile oder<br />
Putzleisten einzusetzen (ggf. nach<br />
Unterputzauftrag entfernen und<br />
materialgleich ersetzen.)<br />
Alle Ausführungen wie Q3. Zusätzlich<br />
vollflächiges Überarbeiten der<br />
Oberfläche mit einem geeigneten<br />
Spachtel- oder Glättputzmaterial.<br />
In Einzelfällen (glänzende Beschichtungen,<br />
Lackierungen, Lacktapeten)<br />
sind weitere Maßnahmen<br />
(z. B. mehrmaliges Spachteln und<br />
Schleifen) zur Vorbereitung der<br />
Oberfläche notwendig.<br />
Möglichkeit von Abzeichnungen ist<br />
minimiert, unerwünschte Effekte<br />
wie z. B. Schattierung bei Streiflicht<br />
weitgehend vermieden.<br />
Beleuchtungsverhältnisse der<br />
späteren Nutzung müssen zum<br />
Ausführungszeitpunkt bekannt und<br />
möglichst schon gegeben sein. Zu<br />
beachten sind die handwerklichen<br />
Grenzen der Ausführung vor Ort.<br />
Putzflächen, die auch bei Einwirkung<br />
von Streiflicht absolut eben<br />
und schattenfrei erscheinen, sind<br />
handwerklich nicht ausführbar.<br />
Ausführung<br />
Grenzen<br />
57
4.5 VeRARBeItUnG<br />
Trockene Mörtel können auch mit Durchlaufmischern, also üblichen Gipsputzmaschinen<br />
verarbeitet werden. Das trockene Material wird per Zellen- oder Sternrad in eine<br />
Mischkammer mit Mischwendel befördert. Die Verweildauer des Mörtels in der Mischkammer<br />
und die Kontaktzeit mit dem Mischwasser ist sehr kurz (Abbildungen 4.11<br />
und 4.12).<br />
Nicht nur der Wasserkontakt, sondern auch eine innige Durchmischung sorgt für bessere<br />
Verarbeitungs- und Festigkeitseigenschaften. Darum sind Nachmischaggregate<br />
zu empfehlen werden, die zwischen Putzmaschinenausgang und dem ersten Schlauch<br />
eingebaut werden (Abbildung 4.13).<br />
Eine ggf. schwere Gängigkeit des Mörtels in den Transportschläuchen oder schlechte<br />
Verarbeitbarkeit in Folge der kurzen Kontaktzeit mit dem Wasser darf nicht durch<br />
65<br />
Abb. 4.11 : Putzmaschine<br />
(Durchlaufmischer)<br />
Pft G4 mit halb-stehendem<br />
Zellenrad und<br />
mischwendel (foto und<br />
Zeichnung Pft)<br />
Abb. 4.12 : Putzmaschine<br />
(Durchlaufmischer)<br />
PUtZmeIsteR mP25 mit<br />
liegendem sternrad<br />
und mischwendel<br />
(foto und Zeichnung<br />
PUtZmeIsteR)
4.5 VeRARBeItUnG<br />
Für Lehmputze können Putzprofile aus allen gebräuchlichen Werkstoffen verwendet<br />
werden. Bei korrosionsfähigen Materialien ist die ggf. längere Feuchtebelastung während<br />
der Trocknungszeit zu bedenken sowie der Umstand, dass der Lehmputz später<br />
keine korrosionshemmende Wirkung hat.<br />
Wenn Eckschutzprofile verwendet werden, so sind sie besonders gut mit Ansetzbinder<br />
festzusetzen, da Lehmputze die Profile vergleichsweise gering am Untergrund fixieren<br />
(Abbildung 4.18).<br />
Die Arbeit mit Unterputzprofilen kann bei Lehmputzen wegen der vergleichsweise<br />
starken Schwindung ggf. zur Rissbildung führen. Profile, die nicht wieder entfernt<br />
werden können, sollen zumindest mit einer Streifenbewehrung versehen werden.<br />
Dazu ist Fugenband geeignet (Abbildung 4.19).<br />
Abb. 4.19 : Unterputzprofil<br />
mit streifenbewehrung<br />
Mit Abschlussprofilen, beispielsweise aus Edelstahl, lassen sich elegante Begrenzungen<br />
der Lehmputzflächen herstellen. Bei Farbputzen ist darauf zu achten, dass die<br />
Schenkel der Profile vom Unterputz überdeckt sind; das nicht saugfähige Metall könnte<br />
sich sonst in der Oberfläche abzeichnen (Abbildung 4.20).<br />
Abb. 4.20 : Abschlussprofile zur<br />
Ausbildung von schatten-nuten an<br />
holzleisten, Profilschenkel mit einfachem<br />
Zuschnitt und Abkantung<br />
Bei Anschlüssen in Raumecken ist zu bedenken, dass die zuerst erstellten Flächen<br />
durch die Bearbeitung der neuen Flächen im Anschlussbereich verletzt werden können.<br />
Besonders Farbputze sind ggf. durch Abklebungen zu schützen, dies gilt z. B. auch<br />
bei Farbwechseln übereck. Zum Abkleben muss der Putz vollständig trocken sein. Auch<br />
Farbwechsel auf der Fläche werden mit Hilfe von Abklebungen ausgeführt.<br />
69
112<br />
LehmBAU-PRAxIs : 7 InnenDämmUnG mIt LehmBAUstoffen<br />
▸ COND, Programm zur hygrothermischen Beurteilung von Konstruktionen. Basis<br />
ähnlich GLASER, jedoch erweitert um den Flüssigwassertransport innerhalb<br />
der Konstruktion.<br />
▸ DELPHIN, WUFI, Simulationsprogramme zur Berechnung gekoppelter Wärme-,<br />
Feuchtigkeits-, Luft- und Salztransportvorgänge in porösen Baustoffen.<br />
DIN 4108 Teil 3 fordert die Berechnung nach Glaser und die Einhaltung bestimmter<br />
Forderungen und Grenzwerte zum Tauwasserausfall. Dies setzt eine zumindest grobe<br />
Erfassung der Materialeigenschaften des Bestandes voraus.<br />
Genauere Betrachtungen mit Hilfe verfeinerter Verfahren (COND) und rechnerischer<br />
Simulationen (WUFI, DELPHIN) sind zulässig. Kennwerte für die Simulationsberech-<br />
tabelle 7.1: forderungen nach Regeln der technik: DIn 4108-3 2002-02, wtA merkblätter Referat 8<br />
fachwerk, <strong>Lehmbau</strong> Regeln 2009<br />
forderung Quelle<br />
Mindestwärmeschutz Rges ≥ 1,2 m²K / W DIN 4108<br />
Tauwasserschutz allgemein ¹ Austrocknung im Sommer DIN 4108<br />
Austrocknungsgewährleistung<br />
bewitterter Fachwerkfassaden<br />
Schlagregenbeanspruchungsgruppe I ²<br />
≤ 1000 g DIN 4108<br />
Auffeuchtung Holz ≤ 5 % DIN 4108<br />
Auffeuchtung Holzwerkstoffe ≤ 3 % DIN 4108<br />
≤ 500 g WTA<br />
keine dampfsperrenden Schichten WTA<br />
kapillar leitfähige Dämmstoffe WTA<br />
kapillar kontaktschlüssige Konstruktionen WTA<br />
leckagenfreie und hohlraumfreie Ausführung<br />
WTA<br />
S di 0,5 – 2,0 m WTA<br />
R i ≤ 0,8 m²K / W WTA<br />
Begrenzung der Einbaufeuchte Mauerwerkshinterfüllungen und<br />
Ausgleichschichten im feuchten Einbau<br />
D ≤ 3 cm<br />
LR<br />
Leichtlehm im feuchten Einbau D ≤ 15 cm ³ LR<br />
1 Nachweisfrei bei Ri ≤ 1,0 m²K / W und Sdi ≥ 0,5 m.<br />
2 Für Schlagregenbeanspruchungsgruppe II und III Fassadenbekleidung gefordert. Zuordnung der Schlagregenbeanspruchungsgruppe<br />
nach tatsächlicher Exposition und Bewitterung.<br />
3 Bei Außenwänden aus diffusionsoffenen und kapillar gut leitfähigen Baustoffen (Strohlehm, Ziegel mit einer<br />
Rohdichte ≤ 1600 kg / m³) ist D ≤ 20 cm zulässig.
tabelle 7.4 : fortsetzung<br />
Fachwerk 14 cm, Ziegelausfachung<br />
1600 kg / m³, Innenputz<br />
Fachwerk 14 cm, Natursteinausfachung<br />
2200 kg / m³, Innenputz<br />
Massivwand 24 cm Ziegel<br />
1600 kg / m³, Innenputz<br />
Massivwand 365 cm Ziegel<br />
1600 kg / m³, Innenputz<br />
Massivwand 30 cm Naturstein<br />
1800 kg / m³, Innenputz<br />
Bestand<br />
ungedämmt<br />
Leichtlehm<br />
15 cm<br />
+ Lehmputz<br />
7.5.2 schallschutz<br />
tabelle 7.5 : schalldämmmaße ohne und mit Innendämmungen<br />
Fachwerk 14 cm, Lehmausfachung<br />
700 kg / m³, Außen- und Innenputz<br />
Fachwerk 14 cm, Lehmausfachung<br />
1200 kg / m³, Außen- und Innenputz<br />
Fachwerk 14 cm, Ziegelausfachung<br />
1600 kg / m³, Innenputz<br />
Fachwerk 14 cm, Natursteinausfachung<br />
2200 kg / m³, Innenputz<br />
Massivwand 24 cm Ziegel<br />
1600 kg / m³, Innenputz<br />
Massivwand 365 cm Ziegel<br />
1600 kg / m³, Innenputz<br />
Massivwand 30 cm Naturstein<br />
1800 kg / m³, Innenputz<br />
dB Bestand<br />
7.5 BAUstoff- UnD BAUteILweRte<br />
LLst-mauerwerk<br />
11,5 + 1 cm<br />
+ Lehmputz<br />
schilfrohrpl. /<br />
Calc.-siliatpl, 5 cm<br />
+ Lehmputz<br />
1,93 0,69 0,85 0,73 0,52<br />
hfD-Platte /<br />
min.sch.Dpl. 6 cm<br />
+ Lehmputz<br />
2,66 0,74 0,94 0,77 0,54<br />
1,82 0,69 0,85 0,73 0,52<br />
1,36 0,62 0,74 0,66 0,48<br />
2,82 0,80 1,02 0,86 0,58<br />
ungedämmt<br />
Leichtlehm<br />
15 cm<br />
+ Lehmputz<br />
LLst-mauerwerk<br />
11,5 + 1 cm<br />
+ Lehmputz<br />
hfD-Platte *<br />
6 cm<br />
+ Lehmputz<br />
35 43 44 28 38<br />
41 46 47 34 43<br />
45 49 50 38 47<br />
48 51 52 41 49<br />
51 54 54 44 52<br />
56 58 58 49 57<br />
55 57 57 48 56<br />
(Nach überschlägigen Berechnungen des Schall- und Wärmeinstitutes in Alsdorf).<br />
* Bei dynamischer Steifigkeit HFD s’ 50 MN/m³<br />
min.sch.Dpl.<br />
6 cm<br />
+ Lehmputz<br />
131
194<br />
Abb. 10.21 (links) :<br />
Vorbildliche sockelausbildung<br />
mit<br />
horizontalsperre,<br />
Lindenberg /<br />
Brandenburg<br />
Abb. 10.22 (rechts) :<br />
holzsturz und keil-<br />
artigeBefestigungs- klötze neben dem<br />
fenster, Lindenberg /<br />
Brandenburg<br />
LehmBAU-PRAxIs : 10 sAnIeRUnG – hIstoRIsChe LehmBAUsUBstAnZ<br />
Der Stampflehmbau ist bei Wohnbauten entgegen dem Lehmwellerbau nie in Kombination<br />
mit einem leichten Fachwerkobergeschoss anzutreffen. Bei zweigeschossigen<br />
Stampflehmbauten findet man entweder ein Stampflehmobergeschoss auf einem<br />
Erdgeschoss aus Natursteinmauerwerk oder aber – und das wesentlich häufiger –<br />
Erdgeschoss und Obergeschoss sind komplett aus Stampflehm. Giebeldreiecke wurden<br />
häufig aus Lehmsteinen aufgemauert oder auch gewellert. Die übliche Wanddicke<br />
ein- oder zweigeschossiger Stampflehmbauten und auch Scheunen des 19. Jahrhunderts<br />
beträgt 50 bis 60 cm; bei Bauten nach dem Zweiten Weltkriegs oft nur noch<br />
40 cm.<br />
Die Höhe der einzelnen Stampfsegmente betrug ca. 60 bis 80 cm, die Länge zwischen<br />
2 und 4 m.<br />
Die Stampflehmbauten der 1950er Jahre verfügen alle über eine Horizontalabdichtung<br />
in Form einer bituminierten Pappe, die gegen Beschädigung beim Stampfen mit<br />
einer gemauerten Ziegelschicht überdeckt wurde (Abbildung 10.21).<br />
In Deckenbalkenebene wurde die Wand häufig aus Lehmstein- oder Ziegelmauerwerk<br />
ausgeführt, da der Schalungsaufwand um die Deckenbalkendurchdringungen herum<br />
zu hoch war.<br />
Öffnungen wurden vorwiegend mit flachen gemauerten Bögen oder Holzstürzen<br />
überdeckt. Bei den DDR-Stampflehmbauten der späten 1950er Jahre wurden auch Ortbetonstürze<br />
ausgeführt. Die Befestigung der Fenster erfolgte an in den Stampflehm<br />
eingestampften konischen Hartholzdübeln (Abbildung 10.22). Bei Kastenfenstern<br />
wurde häufig die äußere Fensterebene bündig mit der Wandoberfläche angeordnet
10.2 mAssIVLehmteChnIKen<br />
um Spritzwasser im Übergang Fensterbank / Fensterleibung zu vermeiden. Bei Gebäu-<br />
den, bei denen die Fensterebene zurückspringt, wurde dieser Übergang mindestens<br />
aus zwei Ziegellagen gemauert.<br />
Bei einigen Stampflehmscheunen sind die Bereiche über den Toren gewellert statt<br />
gestampft. Durch den Wechsel der Bauweise wurden während der Bauzeit weniger<br />
Schwingungen in die noch empfindlichen Stampflehmwände eingetragen. Außerdem<br />
werden durch das geringere Gewicht des Wellerlehms weniger Lasten in den<br />
Sturz eingetragen.<br />
Abb. 10.23 :<br />
stampflehmscheu-<br />
ne mit wellerlehm<br />
über den toren in<br />
195<br />
Jüdendorf /sachsen-<br />
Anhalt, 2006<br />
Abb. 10.24 a und b :<br />
An den oberflächen<br />
eingestampfte Ziegeloder<br />
Bruchsteinleisten
218<br />
Abb. 10.47 :<br />
Prinzipskizze stakung<br />
und flechtwerk<br />
Abb. 10.48 :<br />
stakung oder<br />
flechtwerk in form<br />
eines fächers<br />
Abb. 10.49 :<br />
Gefach eines sächsi-<br />
schen fachwerkhauses<br />
LehmBAU-PRAxIs : 10 sAnIeRUnG – hIstoRIsChe LehmBAUsUBstAnZ<br />
Als Staken bezeichnet man Langhölzer in Form von Latten oder Knüppeln, die zwischen<br />
die Fachwerkbalken geklemmt wurden. Das Stakwerk ist in der Regel aus dem gleichen<br />
Holz wie die Primärkonstruktion, es sind jedoch auch abweichende Holzarten zu<br />
finden. Meist wurden die Staken durch Spalten gewonnen und mit dem Beil ringsum<br />
grob zu einem rundlich- oder elliptisch-polygonen Querschnitt zugerichtet. Ebenfalls<br />
verwendet wurden kleine Rundhölzer mit vollem Querschnitt. Splintholz wurde nicht<br />
immer beseitigt, jede Stake hatte jedoch einen ausreichend stabilen Kern. Für den Einbau<br />
wurden die Enden der Staken ein- oder zweiseitig, seltener rundum angespitzt.<br />
Die Stakung war meist vertikal, jedoch auch horizontal ausgerichtet. Bei dreiecksoder<br />
trapezförmigen Feldern konnte die Stakung in Form eines Fächers angelegt<br />
werden, alternativ wurde das Flechtwerk zum Fächer verzogen (Abbildung 10.48). Insgesamt<br />
war man bestrebt, mit der Stakung die kürzere Ausdehnung eines Gefaches<br />
zu überbrücken.
10.3 fAChweRKAUsfAChUnGen<br />
Die Staken wurden stramm zwischen die Balken geklemmt. Ihr Abstand untereinander<br />
war so gewählt, dass die Flechtarbeit einerseits gut möglich war, andererseits<br />
jedoch zu einem ausreichend stabilen Ergebnis führte. Sehr häufig findet man eine<br />
Teilung der Gefache in zwei Felder, die Flechtarbeit ist so am einfachsten. Aufgrund<br />
des zugebeilten und polygonen Querschnittes lag die äußere, am Pfosten anliegende<br />
Stake nur punktuell an der Balkenflanke an. Vielfach wurde auch ein Abstand gelassen<br />
Als Hölzer für das Flechtwerk wurden biegsame Ruten gewählt, die sich leicht in das<br />
Stakwerk einflechten ließen. Gleichzeitig mussten sie ausreichend stabil und möglichst<br />
widerstandsfähig bei Feuchtebeanspruchung sein. In vielen Regionen wurden<br />
schnell und gerade wachsende Weidenzweige bevorzugt, auch Hasel- oder andere<br />
Zweige wurden verwendet. Die Ruten wurden zur besseren Verarbeitbarkeit auch<br />
halb oder dreifach gespalten. Die Ruten wurden meist mit dem Beil schräg abgelängt<br />
(Abbildung 10.49).<br />
Die Ruten wurden zu einem annähernd rechtwinkeligen Gitter abwechselnd vor und<br />
hinter die Staken geflochten. Auch ein kreuzweises Verflechten war verbreitet (Abbildung<br />
10.50). Die nicht scharfkantige Querschnittsform der Staken begünstigte das<br />
Umschlingen mit den Ruten und wirkt ihrem Bruch entgegen. Der Abstand der Ruten<br />
untereinander wurde nur so groß gewählt wie es notwendig war, um die plastische<br />
Lehmfüllung gut in die Zwischenräume drücken zu können. Abhängig von deren Beschaffenheit<br />
waren Abstände zwischen Mittelhand- und Fingerdicke üblich. Für sehr<br />
feinen Strohlehm konnte der Abstand der Ruten kleiner sein, manchmal berührt sich<br />
die Ruten auch.<br />
Der Baulehm für plastisch eingebaute Gemische stammte vom Bauplatz oder einer<br />
nicht weit entfernten Grube. Diese konnte an ausgewählter Stelle angelegt sein und<br />
der gesamten Dorfgemeinschaft zur Verfügung standen. Viele alte Straßen- und Flurbezeichnungen<br />
lassen darauf schließen. Der verwendete Lehm war häufig eher mager.<br />
219<br />
Abb. 10.50 :<br />
Rechtwinkelig und<br />
kreuzweise verflochtenes<br />
Gefach
276<br />
LehmBAU-PRAxIs : 11 BAUReChtLIChe UnD BAUGeweRBLIChe AsPeKte<br />
den zweilagigen Kalk-Außenputz ausführen. Scharfkantiges (nicht V-förmiges)<br />
Auskratzen der Stoß- und Lagerfugen im frischen Mauerwerk in einer Tiefe von<br />
0,5 - 1,0 cm zur Verbesserung der Haftung des Kalkputzes.<br />
Fachwerkausfachungen: Luftkalkgrobputz mit Haarzusatz als Unterputz 20 - 25 min<br />
Putzgrund gefachweise und ggf. mehrmals unmittelbar vor dem Putzauftrag<br />
vornässen (Sprühnebel). Kalkputz als Unterputz mit dem Holzbrett aufziehen<br />
und einarbeiten, alternativ schwungvolles Anwerfen mit der Maurerkelle. Her-<br />
stellen einer rauen, griffigen und geeigneten Oberfläche für die nachfolgende<br />
Putzlage. Putzdicke 8 / 10 mm.<br />
Fachwerkausfachungen: Luftkalkfeinputz als Deckputz 20 - 25 min<br />
Putzgrund gefachweise und ggf. mehrmals unmittelbar vor dem Putzauftrag<br />
vornässen (Sprühnebel). Kalkputz als Deckputz aufziehen. Fluchtgerecht und<br />
balkenbündig Abgleichen. Oberfläche fein filzen / glätten, fertig für den nachfol-<br />
genden Kalk-Anstrich. Putzdicke 4 - 6 mm.<br />
11.3.2 Bauteilkosten<br />
tabelle 11.2 : Bauteilkostenvergleich<br />
Bauteilaufbau Lehm Alternative 1 Alternative 2 (einfach)<br />
PUTZE, BEKLEIDUNGEN, ANSTRIcHE<br />
1 Lehmputz zweilagig<br />
+ Grundierung<br />
+ 2 Anstriche Lehm-Streichputz<br />
32,50 – 37,00 € / m²<br />
2 Lehmputz einlagig<br />
+ Grundierung<br />
+ 2 Anstriche Lehm-Streichputz<br />
20,00 – 25,50 € / m²<br />
3 Lehm-Farbputz dünnlagig<br />
auf Grundierung<br />
19,00 – 24,00 € / m²<br />
4 2 Anstriche Lehm-Streichputz<br />
auf Grundierung<br />
8,00 – 12,00 € / m²<br />
5 Kanten gerundet<br />
11,50 – 16,50 € / m<br />
Naturkalkputz zweiliagig<br />
+ 2 Anstriche Kalkfarben<br />
30,50 – 32,50 € / m²<br />
Kalkputz einlagig<br />
+ 2 Anstriche Kalkfarben<br />
17,50 – 23,50 € / m²<br />
Kunstharzrollputz dünnlagig<br />
auf Grundierung<br />
16,50 – 19,50 € / m²<br />
2 Anstriche Kalk-Streichputz<br />
auf Grundierung<br />
8,00 – 12,00 € / m²<br />
Gipsputz einlagig<br />
auf Vorspritz oder Grundierung<br />
+ Raufasertapete<br />
+ 2 Anstriche Dispersionsfarbe<br />
20,50 – 24,50 € / m²<br />
Gipsputz einlagig<br />
+ Raufasertapete<br />
+ 2 Anstriche Dispersionsfarbe<br />
16,50 – 21,50 € / m²<br />
Glasfasertapete<br />
+ 2 Anstriche Dispersionsfarbe<br />
11,00 – 15,50 € / m²<br />
Zellulose-Streichputz<br />
auch Baumwoll-Streichputz<br />
10,50 – 14,50 € / m²<br />
Kanten mit Eckschiene<br />
6,50 – 10,00 € / m