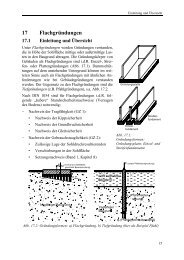Abschnitt A: Grundlagen der Kalkulation
Abschnitt A: Grundlagen der Kalkulation
Abschnitt A: Grundlagen der Kalkulation
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Abschnitt</strong> A:<br />
<strong>Grundlagen</strong> <strong>der</strong> <strong>Kalkulation</strong><br />
1 Stellung <strong>der</strong> <strong>Kalkulation</strong> im baubetrieblichen<br />
Rechnungswesen<br />
In <strong>der</strong> <strong>Kalkulation</strong> werden die durch die Erstellung <strong>der</strong> Bauleistung entstehenden o<strong>der</strong> entstandenen<br />
Kosten berechnet. Hierfür ist es erfor<strong>der</strong>lich, die in einem Unternehmen auftretenden<br />
Vorgänge, die sich mengen- o<strong>der</strong> wertmäßig ausdrücken lassen, zu erfassen. Die Zusammenstellung<br />
und systematische Ordnung <strong>der</strong> Vielzahl von zahlenmäßig erfassbaren Vorgängen<br />
geschieht mit Hilfe des Rechnungswesens, von dem die <strong>Kalkulation</strong> einen Teil bildet. Die wichtigsten<br />
Zweige des baubetrieblichen Rechnungswesens sind in Abb. A 1.1 dargestellt. Ihre Aufgaben<br />
sollen im Folgenden erläutert werden.<br />
1<br />
Rechnungswesen<br />
Unternehmensrechnung<br />
(Finanzbuchhaltung)<br />
Bauauftragsrechnung<br />
Vorkalkulation<br />
Nachkalkulation<br />
Kosten- und<br />
Leistungsrechnung<br />
Baubetriebsrechnung<br />
Kostenartenrechnung<br />
Kostenstellenrechnung<br />
Kostenträgerrechnung<br />
Bauleistungsrechnung<br />
Ergebnisrechnung<br />
Abb. A 1.1: Wichtigste Bereiche des Rechnungswesens im Bauunternehmen<br />
Unternehmensrechnung 1<br />
Die Unternehmensrechnung, auch als Finanzbuchhaltung bezeichnet, erfasst den außerbetrieblichen<br />
Werteverzehr einer Unternehmung (den äußeren Kreis) aus den Geschäftsbeziehungen<br />
zur Umwelt (Kunden, Lieferanten, Schuldner, Gläubiger) und die dadurch bedingten Verän<strong>der</strong>ungen<br />
<strong>der</strong> Vermögens- und Kapitalverhältnisse.<br />
Die Unternehmensrechnung liefert das Zahlenmaterial zur Erstellung <strong>der</strong> Bilanz und <strong>der</strong> Gewinnund<br />
Verlustrechnung, aus denen sich Lage und Gesamterfolg des Unternehmens erkennen<br />
lassen.<br />
Kosten- und Leistungsrechnung <strong>der</strong> Bauunternehmen – KLR Bau, 2001.<br />
Controlling<br />
17
A: <strong>Grundlagen</strong> <strong>der</strong> <strong>Kalkulation</strong><br />
In <strong>der</strong> Bilanz werden Vermögen und Kapital zu einem Stichtag gegenübergestellt; <strong>der</strong> Bilanzsaldo<br />
bringt den Unternehmenserfolg zum Ausdruck.<br />
Die Gewinn- und Verlustrechnung ermittelt den Erfolg als Unterschied zwischen Aufwendungen<br />
und Erträgen. Sie zeigt das Zustandekommen des Erfolges nach seinen Erfolgsquellen und seiner<br />
Zusammensetzung auf.<br />
Kosten- und Leistungsrechnung<br />
Die Kosten- und Leistungsrechnung dient zur Abbildung <strong>der</strong> innerbetrieblichen Vorgänge bei <strong>der</strong><br />
Erstellung von Leistungen innerhalb des Unternehmens. Der in Geldeinheiten bewertete<br />
Verbrauch von Gütern wird als Kosten bezeichnet. Die in Geldeinheiten bewertete Erstellung<br />
von Leistungen wird als Leistung bezeichnet. Die Differenz aus Kosten und Leistung gibt den<br />
Betriebserfolg wie<strong>der</strong>. Die Erstellung und Berechnung <strong>der</strong> Kosten- und Leistungsrechnung<br />
unterliegt keinen gesetzlichen Regeln und Vorschriften. Sie ist eine „freiwillige" Berechnung und<br />
kann daher von <strong>der</strong> Unternehmung nach eigenen Bedürfnissen gestaltet werden.<br />
Die Kosten- und Leistungsrechnung <strong>der</strong> Bauunternehmung glie<strong>der</strong>t sich in die Bereiche<br />
- Bauauftragsrechnung, in <strong>der</strong> die Kosten für auszuführende Bauleistungen geplant werden,<br />
- Baubetriebsrechnung, in <strong>der</strong> die Kosten und Leistungen von erstellten Bauleistungen erfasst<br />
werden.<br />
Bauauftragsrechnung<br />
Die Bauauftragsrechnung <strong>der</strong> Bauunternehmung, auch <strong>Kalkulation</strong> genannt, unterscheidet sich<br />
stark von <strong>der</strong> Auftragsrechnung eines stationären Industriebetriebes. Die auftragsbezogene<br />
Einzelfertigung, die beson<strong>der</strong>e Form des Preiswettbewerbes und <strong>der</strong> Vergabe von Bauleistungen<br />
bedingen in <strong>der</strong> Bauwirtschaft an<strong>der</strong>e <strong>Kalkulation</strong>sverfahren als im stationären Industriebetrieb.<br />
Gegenstand <strong>der</strong> Bauauftragsrechnung ist die Kostenplanung (<strong>Kalkulation</strong>) <strong>der</strong> Bauausführung.<br />
Die Bauauftragsrechnung besteht aus <strong>der</strong> Vorkalkulation, d. h. <strong>der</strong> Ermittlung <strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Erstellung<br />
eines Bauwerks zu erwartenden Kosten, und <strong>der</strong> Nachkalkulation, d. h. <strong>der</strong> Ermittlung <strong>der</strong><br />
tatsächlich entstandenen Kosten zur Überprüfung <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Vorkalkulation getroffenen Annahmen.<br />
Baubetriebsrechnung<br />
Ziel <strong>der</strong> Baubetriebsrechnung ist u. a. die Erfassung <strong>der</strong> Kosten und Leistungen zur Planung und<br />
Kontrolle des baubetrieblichen Geschehens. Sie glie<strong>der</strong>t sich in die Bereiche:<br />
- Kostenartenrechnung zur Erfassung einzelner Kostenarten (z. B. Kosten für Löhne,<br />
Baustoffe o<strong>der</strong> Geräte);<br />
- Kostenstellenrechnung zur Ermittlung <strong>der</strong> auf die einzelnen Kostenstellen (z. B. Baustellen,<br />
Hilfsbetriebe, Verwaltung) entfallenden Kosten;<br />
- Kostenträgerrechnung zur Verrechnung <strong>der</strong> Kosten auf die betrieblichen Leistungen (im<br />
Bauwesen i. Allg. Kostenstelle „Baustelle” = Kostenträger „Bauwerk”);<br />
- Bauleistungsrechnung zur Erfassung <strong>der</strong> erstellten Bauleistung unter Bewertung zu<br />
Verkaufspreisen, z. B. Einheitspreisen;<br />
18
1 Stellung <strong>der</strong> <strong>Kalkulation</strong> im baubetrieblichen Rechnungswesen<br />
- Ergebnisrechnung als Gegenüberstellung von Baukosten und Bauleistung für verschiedene<br />
Zeiträume, z. B. Jahr, Monat, und verschiedene Objekte,<br />
z. B. Gesamtunternehmen, Sparte, Baustelle;<br />
- Controlling als ständiges Werkzeug zur Überwachung <strong>der</strong> Einhaltung <strong>der</strong><br />
Planung und (im Abweichungsfall) zur Ergreifung von Maßnahmen,<br />
die die Abweichung korrigieren o<strong>der</strong> neue realistische Planwerte<br />
vorgeben. In folgenden Stufen ist vorzugehen:<br />
- Messbare Formulierung des Unternehmensziels,<br />
- Auswahl von Handlungsalternativen und Planung <strong>der</strong> Ergebnisse,<br />
- Überwachung <strong>der</strong> Einhaltung <strong>der</strong> Unternehmensziele,<br />
- Ergreifung von Maßnahmen im Abweichungsfall.<br />
Controlling muss sicherstellen, dass das System <strong>der</strong> Personalführung<br />
zur Organisation passt und ein effizientes Informationssystem<br />
vorhanden ist, das auf die Organisation abgestimmt ist.<br />
Controlling hat auch das Finanz-Management-System zu umfassen,<br />
dem bei <strong>der</strong> Bauproduktion wegen <strong>der</strong> langfristigen Vorfinanzierung<br />
beson<strong>der</strong>e Bedeutung zukommt. Der Aufbau des<br />
Rechnungswesens hat sich den Aufgaben des Controllings anzupassen.<br />
Der Controller hat dafür zu sorgen, dass die Erkenntnisse des<br />
Controllings auch in die Unternehmensrealität umgesetzt werden.<br />
Das gilt vor allem für das Baustellen-Controlling, das ein schnelles<br />
Eingreifen erfor<strong>der</strong>t (Gefahr nicht erkannter Baustellenverluste).<br />
Neben <strong>der</strong> unzureichenden Risikoanalyse liegen hier vielfach die<br />
größten Defizite im Bauunternehmen vor. Der <strong>Kalkulation</strong> kommt<br />
im Controlling beson<strong>der</strong>e Bedeutung zu, da in ihr die Planungsvorgaben,<br />
insbeson<strong>der</strong>e das geplante Baustellenergebnis, erarbeitet<br />
werden. Das erfor<strong>der</strong>t eine exakte und realistische Auftragskalkulation.<br />
19
A: <strong>Grundlagen</strong> <strong>der</strong> <strong>Kalkulation</strong><br />
2 Bauauftragsrechnung und <strong>Kalkulation</strong><br />
2.1 Glie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Bauauftragsrechnung<br />
Die auftragsbezogene Kostenermittlung (<strong>Kalkulation</strong>) von Bauleistungen umfasst – in Abhängigkeit<br />
vom Abwicklungsstadium des Bauauftrages – die in Abb. A 2.1 dargestellten <strong>Kalkulation</strong>sarten.<br />
Erstellung des<br />
Angebots<br />
Abb. A 2.1: Arten <strong>der</strong> <strong>Kalkulation</strong> in Abhängigkeit vom Stand <strong>der</strong> Auftragsabwicklung<br />
2.1.1 Vorkalkulation<br />
Die Vorkalkulation ist <strong>der</strong> Oberbegriff für alle Arten <strong>der</strong> Kostenermittlung vor <strong>der</strong> eigentlichen<br />
Bauausführung. Sie besteht aus <strong>der</strong><br />
- Angebotskalkulation,<br />
- Auftragskalkulation,<br />
- Arbeitskalkulation,<br />
- Nachtragskalkulation.<br />
Angebotskalkulation<br />
Aufgabe <strong>der</strong> Angebotskalkulation ist die Kostenplanung von Bauleistungen zur Erstellung des<br />
Angebotes. Ausgegangen wird dabei von einem Leistungsverzeichnis, in dem die auszuführenden<br />
Bauleistungen im Einzelnen beschrieben sind (Positionen), o<strong>der</strong> von einer Leistungsbeschreibung<br />
mit Leistungsprogramm (s. hierzu A 2.4.2). Im Sprachgebrauch werden die Begriffe<br />
„Angebotskalkulation” und „<strong>Kalkulation</strong>” gleichgesetzt.<br />
20<br />
Angebotskalkulation<br />
vor<br />
Auftragserteilung<br />
Auftragsverhandlungen<br />
<strong>Kalkulation</strong><br />
Vorkalkulation Nachkalkulation<br />
Auftragskalk.<br />
(Vertragskalk.)<br />
Arbeitsvorbereitung<br />
Arbeitskalkulation<br />
Erstellung <strong>der</strong> Bauleistung<br />
nach<br />
Auftragserteilung<br />
Nachtragskalkulation
2 Bauauftragsrechnung und <strong>Kalkulation</strong><br />
Auftrags- und Vertragskalkulation<br />
Üblicherweise gehen <strong>der</strong> Auftragserteilung Auftragsverhandlungen voraus. In diesen werden<br />
sämtliche offen stehenden Fragen behandelt, die sich aus <strong>der</strong> Ausschreibung und <strong>der</strong> Weiterführung<br />
<strong>der</strong> Projektplanung während <strong>der</strong> Vergabephase ergeben haben. Die Auftragsverhandlungen<br />
haben den Abschluss eines Bauvertrages zum Ziel. Die sich aus dem Bauvertrag ergebenden<br />
Abweichungen gegenüber den Verdingungsunterlagen müssen in ihren Kosten durch die Auftragskalkulation<br />
überprüft und mit <strong>der</strong> Angebotskalkulation verglichen werden, um die Auswirkungen<br />
auf das kalkulierte Ergebnis erkennen zu können.<br />
Die aus den Auftragsverhandlungen resultierenden Än<strong>der</strong>ungen betreffen z. B. Verän<strong>der</strong>ungen<br />
von Preisen, Fortfall o<strong>der</strong> Hinzufügen von Positionen, Mengenän<strong>der</strong>ungen. Bei öffentlichen Auftraggebern<br />
sind Verhandlungen über die Preise unstatthaft.<br />
Arbeitskalkulation<br />
Nach <strong>der</strong> Auftragserteilung beginnt die Arbeitsvorbereitung für das Bauvorhaben. Ihr Ziel ist die<br />
Erstellung des Bauwerks mit maximaler Wirtschaftlichkeit unter den vorgegebenen Bedingungen.<br />
Da sich hieraus in vielen Fällen an<strong>der</strong>e Vorgehensweisen ergeben, als in <strong>der</strong> Angebotskalkulation<br />
angenommen, sind die Kostenauswirkungen in <strong>der</strong> Arbeitskalkulation zu ermitteln. Die Arbeitskalkulation<br />
stellt also eine Weiterentwicklung <strong>der</strong> Angebots- und <strong>der</strong> Auftragskalkulation<br />
unter Berücksichtigung einer optimalen Bauausführung dar. Die in <strong>der</strong> Arbeitskalkulation ermittelten<br />
Kosten bilden für den Soll-Ist-Vergleich die Kostenvorgabe <strong>der</strong> Bauausführung („Soll-<br />
Kosten") und die Grundlage für die Nachkalkulation.<br />
Nachtragskalkulation<br />
Die Nachtragskalkulation ist notwendig für die Kosten- und Einheitspreisermittlung solcher<br />
Bauleistungen, die nicht vertraglich vereinbart wurden o<strong>der</strong> für die sich die <strong>Grundlagen</strong> <strong>der</strong><br />
Preisermittlung geän<strong>der</strong>t haben, wie z. B. gemäß § 2 Nr. 3 bis 9 VOB/B. Ziel <strong>der</strong> Nachtragskalkulation<br />
ist die Ermittlung <strong>der</strong> Kosten, die die Grundlage des Nachtragsangebotes bilden. Nach<br />
den Bestimmungen des § 2 Nr. 5 VOB/B soll dieser Preis vor Ausführung <strong>der</strong> Bauleistung<br />
festgelegt werden. Er hat sich am Preis vergleichbarer Positionen zu orientieren. Vielfach muss<br />
jedoch die Nachtragskalkulation auf den tatsächlichen Kosten aufbauen, die sich bei <strong>der</strong> Ausführung<br />
ergeben, so dass die Kostenermittlung erst nach <strong>der</strong> Durchführung <strong>der</strong> betreffenden<br />
Arbeiten aufgestellt werden kann. Obwohl die Nachtragskalkulation nicht zum eigentlichen Bereich<br />
<strong>der</strong> <strong>Kalkulation</strong> von Bauleistungen vor <strong>der</strong> Bauausführung zählt, gehört sie zum Bereich<br />
<strong>der</strong> Vorkalkulation.<br />
2.1.2 Nachkalkulation<br />
In <strong>der</strong> Nachkalkulation werden die bei <strong>der</strong> Ausführung tatsächlich entstandenen Kosten- und<br />
Aufwandswerte ermittelt, so dass die Ansätze <strong>der</strong> Vorkalkulation überprüft werden können.<br />
Darüber hinaus soll sie Richtwerte für die Angebotskalkulation ähnlicher Bauvorhaben ermitteln.<br />
Im Gegensatz zum Soll-Ist-Vergleich, <strong>der</strong> den Kostenartenvergleich zum Gegenstand hat, bezieht<br />
sich die Nachkalkulation auf die Positionen des Leistungsverzeichnisses. Sie geht von <strong>der</strong><br />
Arbeitskalkulation aus, glie<strong>der</strong>t jedoch die Positionen nach Erfassungsgesichtspunkten, z. B.<br />
nach einem Bauarbeitsschlüssel (BAS), auf. Am häufigsten ist die Nachkalkulation <strong>der</strong> Lohnkosten,<br />
da sich hier i. d. R. die größten Abweichungen ergeben. Die Grundsätze <strong>der</strong> Nachkalkulation<br />
sind im <strong>Abschnitt</strong> E ausführlicher dargestellt.<br />
21
5 Ablauf <strong>der</strong> <strong>Kalkulation</strong><br />
1<br />
5 Ablauf <strong>der</strong> <strong>Kalkulation</strong><br />
Der Ablauf <strong>der</strong> Kostenermittlung nach <strong>der</strong> bereits beschriebenen <strong>Kalkulation</strong>sglie<strong>der</strong>ung (s. Abb.<br />
A 4.3) wird in 3 <strong>Abschnitt</strong>en erläutert:<br />
- Vorarbeiten für die <strong>Kalkulation</strong>,<br />
- <strong>Kalkulation</strong> über die Angebotssumme,<br />
- <strong>Kalkulation</strong> mit vorberechneten Umlagen.<br />
5.1 Vorarbeiten für die <strong>Kalkulation</strong><br />
Vor <strong>der</strong> eigentlichen Kostenermittlung sind alle Umstände zu erfassen, die sich u. U. kostenbeeinflussend<br />
auswirken können. Zu diesen Vorarbeiten gehören beispielsweise:<br />
Prüfung <strong>der</strong> Verdingungsunterlagen zur Feststellung, ob z. B. in Vorbemerkungen, zusätzlichen<br />
und beson<strong>der</strong>en Vertragsbedingungen o<strong>der</strong> zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen<br />
kostenwirksame Festlegungen getroffen sind, die bei <strong>der</strong> Kostenermittlung berücksichtigt werden<br />
müssen. Dazu gehören beispielsweise:<br />
- Zahlungs- und Abrechnungsmodalitäten;<br />
- Sicherheitseinbehalte;<br />
- Än<strong>der</strong>ungen von Bestimmungen <strong>der</strong> VOB/B und VOB/C, wie z. B.<br />
- keine geson<strong>der</strong>te Vergütung für Schlitze, Öffnungen, Nischen, Durchbrüche, Aussparungen;<br />
- Erhöhung <strong>der</strong> Gewährleistungsfrist auf 5 Jahre;<br />
- Nebenleistungen (z. B. Vergütung von Aussparungen);<br />
- Gleitklauseln (Stoffpreis-, Lohngleitklausel, Selbstbeteiligung);<br />
- Lieferung von Ausführungsunterlagen;<br />
- Mitbenutzung des Wasser- und Energieanschlusses durch an<strong>der</strong>e Unternehmer;<br />
- Bereitstellung von Lager- und Aufenthaltsräumen für an<strong>der</strong>e Unternehmer;<br />
- Verkehrssicherungsmaßnahmen;<br />
- Erhöhung <strong>der</strong> Ausschalfristen nach DIN 1045;<br />
- Vorhalten von Gerüsten und Bauaufzügen über die eigene Benutzungsdauer hinaus.<br />
Die Prüfungspflicht des Bieters hat eine entscheidende Bedeutung, da er nach Ingenstau/Korbion<br />
1 z. B. aus einer lückenhaften Leistungsbeschreibung allein noch keinen Schadenersatzanspruch<br />
begründen kann, wenn die Lückenhaftigkeit erkennbar war. Diese verpflichtet den<br />
Bieter, bei einer Lückenhaftigkeit <strong>der</strong> Leistungsbeschreibung etwaige Zweifelsfragen vor Abgabe<br />
des Angebots zu klären.<br />
Begehung <strong>der</strong> Baustelle zur Informationsbeschaffung über<br />
- Verkehrsverhältnisse, Zufahrten,<br />
- Gelände für Baustelleneinrichtung und Baustellenunterkünfte,<br />
- Bodenbeschaffenheit bei Erdbaustellen,<br />
- Wasser- und Energieversorgung,<br />
- Beseitigung des Aushubs,<br />
- beson<strong>der</strong>e Verhältnisse (z. B. Hochwassergefahr, Bau von Transportbrücken, Schneeverhältnisse,<br />
Grundwasserstand, Auflagen zum Umweltschutz u. Ä.).<br />
Ingenstau/Korbion (2007), VOB Teile A und B, 16. Auflage, Kommentar, B § 3 Nr. 3, Rdn. 4 ff., insbeson<strong>der</strong>e<br />
Rdn. 10.<br />
117
B: Durchführung <strong>der</strong> <strong>Kalkulation</strong><br />
Einholung <strong>der</strong> Baustoffpreise und <strong>der</strong> Angebote <strong>der</strong> Fremdunternehmer;<br />
Entwurf einer Baustelleneinrichtung, um hiernach die Geräteliste aufstellen zu können.<br />
Erarbeitung eines Bauablaufplanes auf Grund <strong>der</strong> vorgegebenen Termine. Daraus müssen<br />
für die <strong>Kalkulation</strong> folgende Angaben zu entnehmen sein:<br />
- Angaben über einzubauende o<strong>der</strong> zu bewegende Massen,<br />
- Einsatzdauer <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen Geräte,<br />
- Art, Anzahl und Einsatzdauer <strong>der</strong> benötigten Arbeitskräfte,<br />
- Arbeitsunterbrechungen (z. B. Winterpause).<br />
Die Aufstellung dieses Bauablaufplans sowie die Ermittlung <strong>der</strong> wirtschaftlichsten Arbeitsmethoden<br />
sind u. a. Aufgaben <strong>der</strong> „Arbeitsvorbereitung”, die in größeren Betrieben von einer beson<strong>der</strong>en<br />
Abteilung durchgeführt wird.<br />
5.2 <strong>Kalkulation</strong> über die Angebotssumme<br />
5.2.1 Ablauf <strong>der</strong> <strong>Kalkulation</strong><br />
Bei diesem Verfahren (auch „<strong>Kalkulation</strong> über die Endsumme” genannt) werden die Beträge für<br />
Gemeinkosten <strong>der</strong> Baustelle, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn, für jeden zu<br />
kalkulierenden Bauauftrag geson<strong>der</strong>t ermittelt. Es ergeben sich daraus für jedes Bauobjekt<br />
Umlagesätze für die Einzelkosten <strong>der</strong> Teilleistungen in unterschiedlicher Höhe.<br />
Abb. B 5.1: Ablauf <strong>der</strong> <strong>Kalkulation</strong> über die Angebotssumme<br />
118<br />
Leistungsverzeichnis<br />
Berechnung des<br />
Mittellohns<br />
Stunden- und<br />
Kostenansätze<br />
Einzelkosten <strong>der</strong><br />
Teilleistungen<br />
Schalung<br />
Baustoffe<br />
Herstellkosten<br />
Beträge für Allgem.<br />
Geschäftskosten,<br />
Wagnis + Gewinn<br />
ANGEBOTSSUMME<br />
Ermittlung <strong>der</strong><br />
Umlagesätze<br />
Ermittlung <strong>der</strong><br />
EINHEITSPREISE<br />
Fremdleistung<br />
Gemeinkosten <strong>der</strong><br />
Baustelle<br />
Gerätekosten
5 Ablauf <strong>der</strong> <strong>Kalkulation</strong><br />
Die <strong>Kalkulation</strong> über die Angebotssumme wird in vier Schritten durchgeführt (s. Abb. B 5.1):<br />
- Ermittlung <strong>der</strong> Herstellkosten,<br />
- Ermittlung <strong>der</strong> Angebotssumme,<br />
- Ermittlung <strong>der</strong> Umlagesätze,<br />
- Ermittlung <strong>der</strong> Einheitspreise.<br />
Der Ablauf einer <strong>Kalkulation</strong> wird an einem Beispiel erläutert, das einen Auszug aus einer Kostenermittlung<br />
für eine Stützwand darstellt. Zur Vereinfachung des Verfahrens wird die <strong>Kalkulation</strong><br />
am zweckmäßigsten mit Hilfe von Formblättern durchgeführt, wobei hier als Beispiel aus den<br />
vielfältigen Möglichkeiten die Formulare des Instituts für Baubetriebslehre <strong>der</strong> Universität Stuttgart<br />
verwendet werden.<br />
5.2.2 Formblätter „<strong>Kalkulation</strong> über die Angebotssumme”<br />
Formblatt 1 zur Ermittlung <strong>der</strong> Einzelkosten und zur Berechnung <strong>der</strong> Einheitspreise. Dieses Formular<br />
besteht aus 4 Teilen, die jeweils noch in Spalten unterglie<strong>der</strong>t sind:<br />
Teil 1: Nummer <strong>der</strong> Position, Spalte für Kurztext, Mengenangabe und Entwicklung <strong>der</strong> Einzelkosten<br />
<strong>der</strong> Teilleistungen (Positionen);<br />
Teil 2: Kostenarten ohne Umlage;<br />
Teil 3: Kostenarten mit Umlagen;<br />
Teil 4: Preis je Einheit und je Teilleistung.<br />
Formblatt 2 zur Berechnung <strong>der</strong> Einzelkosten je Einheit, wenn für verschiedene Teilleistungen<br />
umfangreiche Vorermittlungen notwendig sind (s. Beispiele im <strong>Abschnitt</strong> C). Dieses Formblatt<br />
besteht aus den Teilen 1 und 2 des Formblattes 1.<br />
Formblatt 3 zur Ermittlung <strong>der</strong> Angebotssumme. Dieses Formular, häufig auch als „Schlussblatt<br />
<strong>der</strong> <strong>Kalkulation</strong>” bezeichnet, ist in zwei Teile geglie<strong>der</strong>t.<br />
Teil 1: Ermittlung <strong>der</strong> Angebotssumme mit den Zeilen für die Eintragung <strong>der</strong> Einzelkosten <strong>der</strong><br />
Teilleistungen, <strong>der</strong> Gemeinkosten <strong>der</strong> Baustelle, <strong>der</strong> Herstellkosten und dem Bereich<br />
zur Berechnung <strong>der</strong> Beiträge für Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn;<br />
Teil 2: Ermittlung <strong>der</strong> Umlagensätze (Durchführung <strong>der</strong> Umlage) und Berechnung des Verrechnungslohns,<br />
in an<strong>der</strong>er Literatur auch als Angebotslohn o<strong>der</strong> Mittellohn ASLZ<br />
bezeichnet. Die in früheren Auflagen verwendete Bezeichnung „<strong>Kalkulation</strong>slohn” wurde<br />
aufgegeben.<br />
5.2.3 Einzelschritte bei <strong>der</strong> <strong>Kalkulation</strong> über die Angebotssumme<br />
5.2.3.1 Ermittlung <strong>der</strong> Herstellkosten<br />
Am Anfang <strong>der</strong> <strong>Kalkulation</strong> werden im Formblatt 1, Teil1, die Nummer <strong>der</strong> Position, ein Kurztext<br />
und die Mengenangabe <strong>der</strong> zu kalkulierenden Teilleistung eingetragen (s. a. Abb. B 5.5).<br />
119
B: Durchführung <strong>der</strong> <strong>Kalkulation</strong><br />
132<br />
7 Schalung des Streifenfundaments, Höhe bis 1,00 m. 240 m 2<br />
8 Schalung <strong>der</strong> Wand, Seitenfläche geneigt, als glatte 2.200 m 2<br />
Schalung, Betonfläche sichtbar bleibend, möglichst<br />
absatzfrei, einschl. zusätzlicher Maßnahmen beim Herstellen<br />
und Verarbeiten des Betons, Höhe bis 6,00 m.<br />
9 Betonstabstahl IV S, Durchmesser über 10 bis 20 mm, 70,5 t<br />
Längen bis 14,00 m, liefern, schneiden, biegen<br />
und verlegen.<br />
10 Betonstahlmatten IV M, Ausführung als Listenmatten, 12,5 t<br />
liefern, schneiden, biegen und verlegen.<br />
11 Fugenband mit Randverstärkung aus PVC, Bandbreite 350 mm. 110 m<br />
Leistungsbereich 019 Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser<br />
12 Abdichtung gegen seitliche Feuchtigkeit auf Wänden, Aus- 1.080 m 2<br />
führungshöhe bis 7,00 m, aus 3 Kaltaufstrichen aus<br />
Bitumenlösung, Flächen senkrecht, Untergrund Beton.<br />
5.4.1.3 <strong>Kalkulation</strong>sansätze<br />
Arbeitszeit: 8 h/d = 40 h/Woche = 160 h/Monat<br />
Vorhalten <strong>der</strong> Baustelleneinrichtung :<br />
- Vorhaltekosten siehe Geräteliste (siehe Abb. B 5.12)<br />
- Betriebskosten: Strom: Installierte Leistung 8,6 kW<br />
Gleichzeitigkeitsfaktor 0,5<br />
Betriebsstunden 100 Bh/Mon<br />
Bezugskosten 0,25 €/kWh<br />
Diesel: Verbrauch 0,17 l/kW, Eh<br />
Einsatzstunden 100 Eh/Mon<br />
Bezugskosten 1,30 €/l<br />
Schmierstoffzuschlag 7 %<br />
- Aufräumen und Reinigen: 10 h/Wo<br />
Einrichten und Räumen <strong>der</strong> Baustelle<br />
Lade- und Frachtkostenverrechnungssätze für Geräte, Schalung etc.<br />
- Ladekosten für nicht fahrende Geräte:<br />
Verrechnungssatz Bauhof: 32,50 €/t<br />
Aufwand Baustelle: 0,5 h/t<br />
- Fahrtzeit zur Baustelle: 1,0 h/Strecke<br />
Hydraulikbagger (Radfahrwerk): 23,00 €/h<br />
Mobilkran: 23,00 €/h<br />
- Auf- u. Abbau Strom- u. Wasseranschluss: 50 h + 250,00 €<br />
- Auf- und Abbau lt. Geräteliste: 70 h + 450,00 €
Abb. B 5.12: Geräteliste Stützwand<br />
5 Ablauf <strong>der</strong> <strong>Kalkulation</strong><br />
Anz. Bezeichnung BGL 2007 Gewicht [t] Vorhalte- Abschreibg. Reparatur A+V+R Aufbau Abbau<br />
zeit Verzinsung gesamt<br />
kW einz. ges. [Mon.] [€/Mon.] [€/Mon.] [€] [h] [€] [h] [€]<br />
Selbstfahrende Geräte:<br />
1 Hydraulikbagger (Radf.) (50) D.1.01.0050 - - - 1.930,00 1.470,00 in EKdT<br />
1 Mobilkran (70) - - 4,5 1.910,00 1.610,00 15.840,00<br />
Nichtfahrende Geräte:<br />
1 Verteilerschrank R.2.20.0250 0,20 0,20 4,5 162,00 108,00 1.215,00 30 200,00 20<br />
2 Innenrüttler 2,4 B.9.30.0055 0,02 0,04 4,5 68,00 47,00 1.035,00<br />
1 Autom. Baunivellier Y.0.00.0030 4,5 23,50 15,00 173,25<br />
2 Handbohrmaschinen 1,1 W.0.14.0016 - - 4,5 15,25 8,60 214,65<br />
1 Kreissäge 3 W.4.21.0400 0,10 0,10 4,5 64,00 47,50 501,75<br />
1 Container 1,5 X.3.10.0006 2,50 2,50 4,5 108,00 92,50 902,25 5 50,00 5<br />
1 Miettoilette 4,5 250,00<br />
Schalung/Holz etc 13,76<br />
Summe Kleingeräte 5 100,00 5 100,00<br />
Lichtstrom 0,6<br />
8,6 16,60 20.131,90 40 350,00 30 100,00<br />
Erdarbeiten<br />
Aushub mit Hydraulikbagger (0,6 m³ Tieflöffel, 50 kW)<br />
- Geräteleistung 200 m³/d bei durchschnittlich 8 Eh/d = 25m³/Eh<br />
- Lohnkosten des Geräteführers: 10 % Zuschlag auf Lohnkosten für Wartung und Pflege (Da<br />
<strong>der</strong> Geräteführer die Wartungs- und Pflegearbeiten bei dieser Baustelle außerhalb <strong>der</strong> Einsatzzeit<br />
vornehmen muss, wird für die dafür anfallenden Lohnstunden ein Zuschlag von 10 %<br />
verrechnet.)<br />
- Lohnkosten für 1 Mann Beihilfe bei den Aushubarbeiten<br />
- Betriebsstoffkosten:<br />
- Motorleistung 50 kW<br />
- Betriebsstoffverbrauch 0,17 l/kW, Eh<br />
- Treibstoffkosten 1,30 €/l<br />
- Öle und Schmierstoffe 7 %<br />
50 × 0,17 × 1,30 × 1,07 €/Eh = 11,82 €/Eh<br />
- Gerätekosten/[Eh] des Hydraulikbaggers:<br />
Grundgerät, Ausleger und Tieflöffel<br />
Abschreibung + Verzinsung 100 % BGL 1.930,00 €/Monat<br />
Reparatur 100 % BGL 1.470,00 €/Monat<br />
Summe A + V + R 3.400,00 €/Monat<br />
bezogen auf 160 [Eh/Monat] =<br />
3.400<br />
S)))))))))Q €/Eh = 21,25 €/Eh<br />
160<br />
- Kosten <strong>der</strong> Bodenabfuhr <strong>der</strong> Kippe:<br />
Die Abfuhr erfolgt durch einen Nachunternehmer, LKW-Nutzlast 12,0 t, einfache Transportentfernung<br />
10 km, Leistungssatz nach KURT, Preistabelle III: 5,36 €/t abzüglich 30 % Rabatt;<br />
1 m³ feste Masse = 2,125 t. Kippgebühr 12,50 €/m³ feste Masse.<br />
133
B: Durchführung <strong>der</strong> <strong>Kalkulation</strong><br />
Betonarbeiten, Abdichtung<br />
- Aufwandswerte:<br />
Schalungsarbeiten Fundament 0,8 h/m²<br />
Wand 0,34 h/m²<br />
(s. Berechnungen in B 1.2.2)<br />
Bewehrungsarbeiten BSt IV S 14,0 h/t<br />
BSt IV M 12,0 h/t<br />
Betonierarbeiten Sauberkeitsschicht 0,25 h/m²<br />
Fundament 0,7 h/m³<br />
Wand 0,75 h/m³<br />
Einbau Fugenband 0,50 h/m<br />
Abdichtungsarbeiten 0,1 h/m², Anstrich<br />
- Stoffkosten:<br />
Beton C 12/15 60,00 €/m³<br />
C 20/25 (einschl. Pumpe) 95,00 €/m³<br />
Schalung Fundament 4,10 €/m²<br />
Wand 4,20 €/m²<br />
(s. Berechnungen in B 1.2.2)<br />
Betonstabstahl IV S (geschnitten + gebogen) 620,00 €/t<br />
Betonstahlmatten IV M 670,00 €/t<br />
Fugenband 24,00 €/m<br />
Bitumenlösung 2,50 €/m², Anstrich<br />
Mittellohn ASL 30,53 €/h (Stand: 09/2008)<br />
Der Mittellohn ASL setzt sich aus Arbeiterlöhnen, Sozialkosten und Lohnnebenkosten zusammen,<br />
ein Polier wird nicht eingesetzt.<br />
Gemeinkosten <strong>der</strong> Baustelle<br />
Die Gemeinkosten <strong>der</strong> Baustelle wurden mit Hilfe des Formblattes 2 zusammengestellt (s. Abb.<br />
B 5.15). Die dabei verwendete Nummerierung entspricht den Glie<strong>der</strong>ungsziffern <strong>der</strong> Gemeinkosten<br />
wie sie in Abb. B 2.4 dargestellt ist.<br />
Hilfsstoffe, Werkzeug und Kleingerät: 4,0 % <strong>der</strong> Einzelkostenlöhne<br />
Hilfslöhne: 3,0 % <strong>der</strong> Einzellohnstunden<br />
Kosten eines Bauleiters (anteilig): 5.800,00 €/Mon., betreut weitere Baustellen, wird<br />
mit 10 % angesetzt.<br />
PKW-Kosten (anteilig): ca. 2.500 km; 0,26 €/km<br />
Arbeitsgerüst: Lohn: 0,05 h/m² angerüstete Fläche<br />
SoKo: 3,00 €/m² Gerüstfläche u. Mon.<br />
Verrechnungssätze für Allgem. Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn<br />
(in % vom Anteil an <strong>der</strong> Angebotssumme)<br />
- Allgemeine Geschäftskosten für Lohn, SoKo und Geräte 10 %<br />
- Allgemeine Geschäftskosten für Fremdleistungen 6 %<br />
- Wagnis und Gewinn für Lohn, SoKo und Geräte 2 %<br />
- Wagnis und Gewinn für Fremdleistungen 2 %<br />
Umlage<br />
- gewählte Umlagesätze auf Kostenart: SoKo 15 %<br />
Geräte 15 %<br />
Fremdleistungen 10 %<br />
- <strong>der</strong> Restbetrag wird auf die Lohnkosten umgelegt.<br />
134
Vorarbeiten für die <strong>Kalkulation</strong> – Überschlägige Ermittlung <strong>der</strong> Bauzeit<br />
Baustelle einrichten: < 1 Wo.<br />
Aushub: < 1 Wo.<br />
Fundamente: - ca. 21 m³ Beton/Fundament<br />
- 2 Fundamente/Woche<br />
- benötigter Vorlauf < 3 Wo.<br />
Wände: - Pilgerschrittverfahren (1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 7, 9, 11, ...)<br />
- ca. 21,3 m³/<strong>Abschnitt</strong><br />
- Betonieren mit Pumpe<br />
(Dauer ½ d/<strong>Abschnitt</strong>)<br />
Vorgang/Tage<br />
Schalen 1. Seite<br />
Bewehren/Fugenb.<br />
Schalen 2. Seite<br />
Betonieren<br />
Schalen 1. Seite<br />
Bewehren<br />
Schalen 2. Seite<br />
Betonieren<br />
1 2 3 4<br />
- 2 <strong>Abschnitt</strong>e pro Woche < 10 Wo.<br />
Restarbeiten: < 2 Wo.<br />
Baustelle räumen: < 1 Wo.<br />
18 Wo. = 4,5 Mon.<br />
ca. 5 Monate Bauzeit<br />
5 Ablauf <strong>der</strong> <strong>Kalkulation</strong><br />
5.4.1.4 Ermittlung <strong>der</strong> Angebotssumme und <strong>der</strong> Einheitspreise<br />
Der Rechengang wird mit Hilfe <strong>der</strong> Abb. B 5.13 bis Abb. B 5.17 auf den folgenden Seiten gezeigt.<br />
5<br />
135