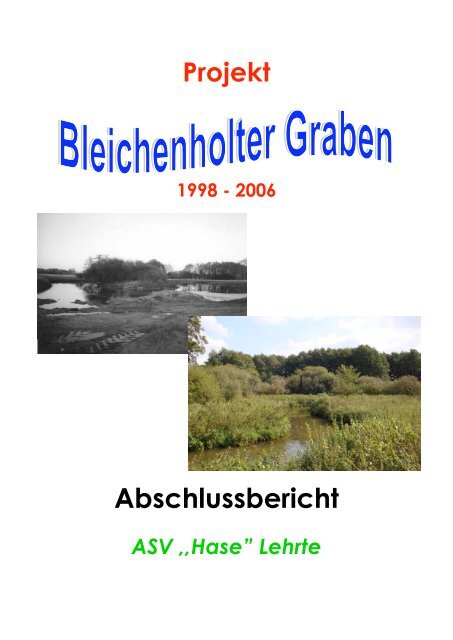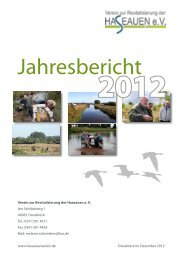Download - Verein zur Revitalisierung der Haseauen eV
Download - Verein zur Revitalisierung der Haseauen eV
Download - Verein zur Revitalisierung der Haseauen eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Projekt<br />
1998 - 2006<br />
Abschlussbericht<br />
ASV ,,Hase” Lehrte
1<br />
Vorwort<br />
Mit dem vorliegenden Bericht findet das 1998 begonnene Projekt „Bleichenholter<br />
Graben“ seinen Abschluss. Das Projekt „Bleichenholter Graben“, als Langzeitstudie<br />
angelegt, dokumentiert die Verän<strong>der</strong>ungen, die sich nach den<br />
Renaturierungsmaßnahmen vor allem hinsichtlich <strong>der</strong> Fischfauna, aber auch <strong>der</strong><br />
Wasserchemie und <strong>der</strong> Flora und Makrofauna im Bleichenholter Graben entwickelt<br />
haben.<br />
Mit dem 1. Bericht aus 1998/99 und den Ergänzungsberichten in den Jahren 2000<br />
und 2002 liegt mit diesem Abschlussbericht, <strong>der</strong> nun Daten aus den Jahren 2004 und<br />
2006 mit berücksichtigt, eine insgesamt umfangreiche und detaillierte Dokumentation<br />
zum Bleichenholter Graben vor.<br />
Die Renaturierungsmaßnahmen haben sich, wie in dieser Dokumentation deutlich<br />
wird, in vielfältiger Weise positiv ausgewirkt. Und wer sich heute an den Ufern des<br />
einstigen Bleichenholter Grabens bewegt, wird einen Eindruck von Gewässern<br />
bekommen, wie sie in den 50-iger und 60-iger Jahren noch in unserer Region<br />
häufiger anzutreffen waren.<br />
Danken möchte ich an dieser Stelle Herrn Kämmereit und Frau Lecour vom LAVES,<br />
die durch ihre aktive Mitarbeit bei den Probebefischungen, aber insbeson<strong>der</strong>e durch<br />
die Auswertung, Darstellung und Interpretation <strong>der</strong> ermittelten Daten den Hauptanteil<br />
am Projekt „Bleichenholter Graben“ getragen haben. Dank gilt auch Herrn Bodo<br />
Zaudtke und Herrn Schlie vom Landesfischereiverband Weser-Ems, die mit den<br />
verbandseigenen Elektro-Geräten die Untersuchungen <strong>der</strong> Fischfauna durchführten;<br />
dem NLWKN, das dem LAVES die Gewässeranalyse-Ergebnisse <strong>zur</strong> Verfügung<br />
stellte; dem Diplom-Biologen Rainer Feistmann aus Rheine, <strong>der</strong> die biologischen<br />
Gewässeruntersuchungen am Bleichenholter Graben durchführte; Herrn Pott von <strong>der</strong><br />
Naturschutzbehörde des Landkreises, <strong>der</strong> das Projekt interessiert und wohlwollend<br />
begleitete und nicht zuletzt bedanke ich mich bei den <strong>Verein</strong>smitglie<strong>der</strong>n des ASV<br />
„Hase“ Lehrte, die bei den Pobebefischungen, teils unter schwierigen Bedingungen,<br />
tatkräftig mit angepackt haben.<br />
( 1. Vorsitzen<strong>der</strong> des ASV Hase“ Lehrte, Oktober 2009 )
I. Die Fischfauna des Bleichenholter Grabens vor und nach<br />
Anschluss an die Mittelradde<br />
1 Einleitung<br />
Der ehemals den Unterlauf <strong>der</strong> Mittelradde bildende Bleichenholter Graben wurde im<br />
Rahmen eines E+E-Vorhabens <strong>zur</strong> „Renaturierung des Hasetals zwischen Haselünne und<br />
Meppen“ an die Mittelradde angeschlossen und führt in <strong>der</strong> Folge den Hauptabfluss <strong>der</strong><br />
Mittelradde <strong>zur</strong> Hase ab.<br />
2<br />
Durch die Maßnahme wurde eine Verbesserung <strong>der</strong> ökologischen Bedingungen,<br />
insbeson<strong>der</strong>e durch eine Diversifizierung des Strömungsregimes, durch eine Verbesserung<br />
<strong>der</strong> Sauerstoffverhältnisse und durch eine Entschärfung <strong>der</strong> Belastungssituation mit Eisen im<br />
Bleichenholter Graben, insbeson<strong>der</strong>e in seinem blind endenden Teil, erwartet.<br />
Um den Zustand vor und nach Durchführung <strong>der</strong> Maßnahmen im Sinne einer<br />
Erfolgskontrolle auch unter dem Aspekt <strong>der</strong> Fischfauna vergleichend betrachten zu können,<br />
wurden durch den ASV „Hase“ Lehrte e.V. in Zusammenarbeit mit dem<br />
Landesfischereiverband Weser-Ems e.V. und mit Unterstützung des LAVES – Dezernat<br />
Binnenfischerei entsprechende Probebefischungen <strong>zur</strong> Dokumentation <strong>der</strong> Entwicklung<br />
durchgeführt. Die Analyse hydrochemischer und hydrophysikalischer Messgrößen erfolgte<br />
durch den NLWKN – Betriebsstelle Meppen.<br />
Die Befunde dieser Untersuchungen sind nachstehend zusammengestellt.<br />
2 Methode<br />
2.1 Befischungsmethode<br />
Zur Erfassung des Status quo ante wurden am 06.08.1998 <strong>der</strong> Bleichenholter Graben, sein<br />
aus dem Lahrer Moor kommen<strong>der</strong> Zufluss und <strong>der</strong> Unterlauf <strong>der</strong> Mittelradde an<br />
verschiedenen Positionen elektrisch befischt. Zur Erfassung <strong>der</strong> Situation nach erfolgtem<br />
Anschluss des Bleichenholter Grabens an die Mittelradde wurden am 23.08.2000 dieselben<br />
Positionen, mit Ausnahme des Zuflusses aus dem Lahrer Moor, befischt, ergänzt um den<br />
Mündungs- und Einlaufbereich des Bleichenholter Grabens (Abb. 1, Tab. 1). Weitere<br />
Befischungen fanden am 08.08.2002, 13.05.2004 und 29.08.2006 statt. Ergänzend wurden<br />
vor dem Hintergrund <strong>der</strong> FFH-Richtlinie durchgeführte Befischungen vom 17.09.2003 und<br />
28.04.2004 mit aufgeführt. Die Streckenlängen wurden jeweils vermessen und variierten in<br />
den einzelnen Untersuchungsjahren nur geringfügig.<br />
Im Bleichenholter Graben und in <strong>der</strong> Mittelradde wurde ein vom Boot aus betriebenes<br />
Elektrofischereigerät (Fa. Mühlenbein, Typ: Deka 7000, Gleichstrom, 200 V, 2<br />
Anodenkescher, 1 Seilkathode) eingesetzt. Der Zufluß aus dem Lahrer Moor wurde watend<br />
mit einem transportablen Impulsstromgerät (Fa. Mühlenbein, Typ Deka 3000) befischt.<br />
Die Anzahl und die Länge (Messung auf den unteren cm, im Jahr 2002 und Folgejahren<br />
Schätzung in 10 cm-Klassen) <strong>der</strong> gefangenen Fische wurden nach Arten getrennt registriert.
Tab. 1: Befischungspositionen (Streckenlängen des Jahres 2000)<br />
Positions-<br />
bezeichnung<br />
B0<br />
B1<br />
B2<br />
B3<br />
B4<br />
B5<br />
M1<br />
M2<br />
M3<br />
M4<br />
M5<br />
M6<br />
3<br />
Lage Strecke<br />
[m]<br />
Bleichenholter Graben<br />
Neuer Mündungsbereich des Bleichenholter Grabens<br />
ca. 120m oberh. D. neuen Mündung in die Hase bis 320m oberh.<br />
Mündung<br />
450m oberh. Mündung bis 650m oberhalb Mündung<br />
880 m oberh. Mündung bis 1030m oberhalb Mündung<br />
1220m oberh. Mündung bis 1350m oberhalb Mündung<br />
100m unterh. Abzweigung d. Bleichenholter Grabens bis<br />
Miittelradde<br />
Mittelradde<br />
ca. 100m oberh. Mündung in die Hase bis 300m oberh. Mündung<br />
300m oberh Mündung in die Hase bis 500m oberhalb Mündung<br />
500m oberh Mündung in die Hase bis 700m oberhalb Mündung<br />
800m oberh Mündung in die Hase bis 1000m oberhalb Mündung<br />
1000m oberh Mündung in die Hase bis 1200m oberhalb Mündung<br />
1200m oberh Mündung in die Hase bis 1400m oberhalb Mündung<br />
60<br />
200<br />
200<br />
150<br />
130<br />
100<br />
200<br />
200<br />
200<br />
200<br />
200<br />
200
Foto 1: Elektrofischen 2006<br />
Tab. 2: Gesamtlänge <strong>der</strong> Befischungsstrecken<br />
Bleichenholter<br />
Graben<br />
Mittelradde<br />
4<br />
Gesamtstreckenlängen [m]<br />
1998 2000 2002 2003/2004 2004 2006<br />
680<br />
1200<br />
840<br />
1200<br />
980<br />
1000<br />
Foto 2: Bleichenholter Graben im oberen Teil, April 2004.<br />
1200<br />
-<br />
1200<br />
1200<br />
1000<br />
1050<br />
Foto 3: Bleichenholter Graben im mittleren Teil, April 2004.
5<br />
2.2 Bewertung <strong>der</strong> Befunde<br />
Im Hinblick auf die Frage nach den Effekten <strong>der</strong> durchgeführten Maßnahme auf die<br />
Fischfauna wird eine Bewertung <strong>der</strong> Befunde mit dem vor dem Hintergrund <strong>der</strong> EG-<br />
Wasserrahmenrichtlinie entwickelten fischbasierten Bewertungssystem für Fließgewässer -<br />
fiBS Vers. 8.0.6 (DUßLING et al. 2008) vorgenommen. Dabei wird <strong>der</strong> Ist-Zustand gegen<br />
eine zuvor erstellte Referenz <strong>der</strong> Fischlebensgemeinschaft mit relativen Häufigkeitsangaben<br />
<strong>der</strong> einzelnen Arten gemessen. Die Referenzfischlebensgemeinschaft spiegelt die<br />
gewässertypspezifische Artengemeinschaft eines anthropogen unbeeinträchtigten<br />
Gewässers bzw. Gewässerabschnittes wi<strong>der</strong> (potentiell natürliche Fischfauna). Dabei gehen<br />
- die natürlichen zoogeographischen Verbreitungsmuster,<br />
- die geomorphologischen Bedingungen <strong>der</strong> einzelnen Gewässer (Naturraum,<br />
Gewässertyp),<br />
- die Gefälleverhältnisse, Temperaturregime usw.,<br />
- historische Daten zum Fischbestand (Artenlisten, Abundanzverhältnisse,<br />
Gewässerzonierung),<br />
- aktuelle Daten zum Fischbestand und<br />
- fischbiologisches Expertenwissen<br />
ein.<br />
Die Bewertung erfolgt durch Klassifizierung folgen<strong>der</strong> fischökologischer Qualitätsmerkmale:<br />
1. Arten- und Gildeninventar<br />
2. Artenabundanz und Gildenverteilung<br />
3. Altersstruktur<br />
4. Migration (indexbasiert)<br />
5. Fischregion (indexbasiert)<br />
6. Dominante Arten (indexbasiert)<br />
Die Gildenzugehörigkeiten <strong>der</strong> Fischarten und die <strong>zur</strong> Berechnung mancher Indizes<br />
notwendigen Informationen liegen in Form deutschlandweit gültiger Tabellen vor (s. Tab. 9).<br />
Zur Gesamtbewertung einer Probestelle werden die 6 o.g. Qualitätsmerkmale klassifiziert.<br />
Bei Qualitätsmerkmalen mit mehreren zugeordneten Parametern, erfolgt dies durch<br />
Mittelung <strong>der</strong> Klassifizierungsergebnisse aller zugeordneten Parameter. Das Gesamtmittel<br />
nimmt einen Wert zwischen 1 und 5 an. Für die ökologische Klassifizierung<br />
gelten folgende (vorläufige) Festlegungen:<br />
> 3,75 Die Probestelle befindet sich im sehr guten ökologischen Zustand<br />
2,51 – 3,75 Die Probestelle befindet sich im guten ökologischen Zustand<br />
2,01 – 2,50 Die Probestelle befindet sich im mäßigen ökologischen Zustand<br />
1,51 – 2,00 Die Probestelle befindet sich im unbefriedigenden ökologischen Zustand<br />
≤ 1,50 Die Probestelle befindet sich im schlechten ökologischen Zustand<br />
Einzelne zu klassifizierende Parameter beziehen sich auf "Leitarten", "typspezifische Arten"<br />
o<strong>der</strong> "Begleitarten". Hierfür gelten folgende Definitionen:
6<br />
Typspezifische Arten: Arten, die in <strong>der</strong> Referenz-Fischzönose mit einem Anteil von ≥ 1 %<br />
vertreten sind.<br />
Leitarten: Teilmenge <strong>der</strong> typspezifischen Arten, die in <strong>der</strong> Referenz-Fischzönose mit einem<br />
Anteil von ≥ 5 % vertreten sind.<br />
Begleitarten: Arten, die in <strong>der</strong> Referenz-Fischzönose mit einem Anteil von < 1 % vertreten<br />
sind.<br />
Die Klassengrenzen <strong>der</strong> einzelnen Bewertungsparameter gehen aus DUßLING et al. (loc.<br />
cit.) hervor.<br />
Die Fangergebnisse <strong>der</strong> einzelnen Befischungspositionen des Bleichenholter Grabens<br />
einerseits und <strong>der</strong> Mittelradde an<strong>der</strong>erseits wurden zusammengefasst. Darüber hinaus<br />
wurden die Befischungsergebnisse <strong>der</strong> Jahre 2002 bis 2006 aufgrund geringer<br />
Individuenanzahlen im Fang gepoolt, um ein hinreichend valides Ergebnis im Hinblick auf die<br />
Bewertung mit fiBS zu erzielen. Dabei bleibt das Ergebnis <strong>der</strong> Ausgangssituation im Jahr<br />
1998 aufgrund geringer Individuenzahlen vergleichsweise unsicher. Eine stärkere<br />
Absicherung des Ergebnisses <strong>der</strong> status quo ante Situation durch Zusammenfassen<br />
mehrerer Befischung war hier nicht möglich.<br />
3 Ergebnisse<br />
3.1 Hydrochemie<br />
Foto 4: Ein Aal wird vermessen.<br />
Die Ergebnisse <strong>der</strong> hydrophysikalischen und hydrochemischen Untersuchungen sind in<br />
Tabelle 3 zusammengestellt. An den einzelnen Positionen des Bleichenholter Grabens sind<br />
1998 Gesamteisen-Konzentrationen in Höhe von 4,3 bis 7,5 mg/l Fe gemessen worden. In<br />
den Folgejahren haben die Konzentrationen deutlich abgenommen und schwanken je nach<br />
Position und Untersuchungsjahr zwischen 1,6 und 4,6 mg/l.<br />
Die Sauerstoffkonzentrationen waren im Bleichenholter Graben vor Anschluss an die<br />
Mittelradde (1998) mit 3,6 bis 5,8 mg/l am niedrigsten. In den Folgejahren wurden keine<br />
Konzentrationen kleiner 5,9 mg/l festgestellt.<br />
Dies deutet darauf hin, dass mit dem Anschluss des Bleichenholter Grabens an die<br />
Mittelradde und <strong>der</strong> damit einhergehenden besseren Durchströmung die Belastung mit Eisen<br />
verringert und <strong>der</strong> Sauerstoffhaushalt verbessert worden sind.
Tab. 3: Hydrophysikalische und hydrochemische Messgrößen<br />
Position 1 2 3 4<br />
7<br />
Datum 22.07. 11.07. 30.07. 11.05. 02.08. 22.07. 11.07. 30.07. 11.05. 02.08. 22.07. 11.07. 30.07. 11.05. 02.08. 22.07. 11.07. 30.07. 11.05. 02.08.<br />
Jahr 1998 2000 2002 2004 2006 1998 2000 2002 2004 2006 1998 2000 2002 2004 2006 1998 2000 2002 2004 2006<br />
Farbe 43 34 32 34 - 43 34 32 34 - 33 34 32 34 - 43 34 32 34 -<br />
Trübung 6 5 1 5 - 6 5 1 5 - 5 5 1 5 - 6 5 5 5 -<br />
Temperatur [°C] 17,8 15,0 23,6 13,2 - 15,4 15,4 19,1 12,8 - 15,3 15,1 21,4 12,7 - 15,2 15,3 20,3 10,8 -<br />
pH-Wert 6,4 7,1 7,2 6,8 - 6,8 7,1 7,0 6,8 - 6,6 7,0 7,3 6,9 - 6,8 6,8 7,3 7,1 -<br />
Leitfähigkeit<br />
[µS/cm 25°C]<br />
224 209 220 220 - 269 220 - 227 - 298 229 360 229 - 262 215 320 370 -<br />
Sauerstoff [mg/ O2] 5,8 9,4 7,5 8,7 - 3,6 9,6 5,9 9,2 - 4,4 9,7 9,3 9,2 - 3,9 9,4 9,0 4,3 -<br />
Ortho-Phosphat<br />
[mg/l P]<br />
Gesamtphosphat<br />
[mg/l P]<br />
0,06
3.2 Fischfauna<br />
3.2.1 Referenz<br />
Die betrachteten Gewässerabschnitte des Bleichenholter Grabens und <strong>der</strong> Mittelradde<br />
(Wasserkörper-Nr. 02038) gehören zum LAWA Typ 15 <strong>der</strong> sand- und lehmgeprägten<br />
Tieflandflüsse und werden zum Fischgewässertyp <strong>der</strong> Hasel-Gründlingsregion gezählt<br />
(MOSCH, LAVES 2008).<br />
8<br />
Im potenziell natürlichen Zustand weisen <strong>der</strong> Bleichenholter Graben und <strong>der</strong> Unterlauf <strong>der</strong><br />
Mittelradde einen gewundenen bis mäandrierenden Verlauf auf. Die dominierende<br />
Sandfraktion bildet feste Sandbänke. Die Ausbildung sandiger Rippelmarken („bewegte<br />
Sohle“) hingegen ist nicht natürlichen son<strong>der</strong>n anthropogenen Ursprungs. Als wichtige<br />
Hartsubstrate stehen kleinräumig verteilte Kiesbänke und insbeson<strong>der</strong>e Baumwurzeln (z.B.<br />
Erlenbewuchs) und Totholz <strong>zur</strong> Verfügung. An strömungsberuhigten Abschnitten werden<br />
Feinsedimente abgelagert. Der Kiesanteil schwankt in Abhängigkeit <strong>der</strong> lokalen<br />
Begebenheiten deutlich. Aufgrund des stark organisch geprägten Umlandes ist <strong>der</strong> Kiesanteil<br />
wesentlich geringer als in an<strong>der</strong>en ansonsten vergleichbaren Gewässern. Die hohe<br />
Tiefenvarianz entsteht durch die Ausbildung von ausgeprägten Prall- und Gleithängen,<br />
Uferabbrüchen und Auskolkungen hinter Totholz.<br />
Die Fischlebensgemeinschaft des Referenzzustands lässt sich wie folgt charakterisieren:<br />
Neben rheophilen Arten, die das sandige Substrat als Laichsubstrat bevorzugen (Gründling,<br />
Steinbeißer), treten vor allem auch Arten auf, die die eingestreuten kiesigen Bereiche zum<br />
Laichen benötigen (Hasel, Bachschmerle, Bachneunauge). Kieslückensystemlaicher, wie die<br />
Salmoniden treten dagegen aufgrund <strong>der</strong> hohen Feinsubstratanteile nicht auf. Ihre<br />
erfolgreiche Fortpflanzung ist auszuschließen. Als anadrome Wan<strong>der</strong>fischart kommt das<br />
Flussneunauge vor. Abschnittsweise treten in Abhängigkeit von Strömung und submersen<br />
Makrophyten indifferente und phytophile Arten hinzu. Zudem wird die<br />
Fischlebensgemeinschaft des Bleichenholter Grabens und des Unterlaufs <strong>der</strong> Mittelradde<br />
durch den Fischwechsel aus <strong>der</strong> Hase geprägt. Dies betrifft insbeson<strong>der</strong>e Arten die ihren<br />
Hauptlebensraum bzw. ihre Adultbestände überwiegend dort haben, und sporadisch in den<br />
Bleichenholter Graben einwan<strong>der</strong>n, wie z.B. Brassen und Aland.<br />
Die Referenzfischlebensgemeinschaft des Untersuchungsgebietes wird insgesamt aus 24<br />
Arten gebildet und setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen (vgl. Tab. 4 und 5):<br />
Leitfischarten: Gründling, Hasel, Aal, Rotauge, Schmerle<br />
Typspezifische Arten: Bachneunauge, Döbel, Güster, Brassen, Steinbeißer, Hecht,<br />
Flussbarsch, Kaulbarsch, Dreist. Stichling und Zwergstichling<br />
Begleitarten: alle weiteren Arten, darunter Auenarten, Flussneunauge und Quappe<br />
3.2.2 Fangergebnisse 1998-2006<br />
Gegenüber dem Referenzartenspekrum konnten aus <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> Begleitarten die<br />
Auengewässer bevorzugenden Arten, Bitterling und Schlammpeitzger, nicht nachgewiesen<br />
werden. Darüber hinaus fehlen <strong>der</strong> Dreistachlige Stichling und insbeson<strong>der</strong>e die Quappe im
9<br />
Fang. Das Flussneunauge trat zwar nicht im Fang auf, konnte aber durch Sichtbeobachtung<br />
festgestellt werden.<br />
Die Fangergebnisse <strong>der</strong> einzelnen Befischungen sind in Tabelle 4 und 5 zusammengestellt.<br />
Wie aus <strong>der</strong> Tabelle 4 ersichtlich ist, dominieren im Fang des Bleichenholter Grabens des<br />
Jahres 1998 insbeson<strong>der</strong>e Gründling und Rotauge. In den Folgejahren erreichen weitere<br />
Arten, wie z.B. Flussbarsch und Hasel, höhere Anteile in <strong>der</strong> Fischlebensgemeinschaft.<br />
Einige Arten treten nur zeitweilig mit höheren Individuendichten auf, wie etwa Brassen, Aland<br />
und Ukelei. Da es sich dabei um Arten handelt, die zumindest als Adulte größere<br />
Wasserkörper bevorzugen, ist dies sicherlich auf den Zuzug aus <strong>der</strong> Hase <strong>zur</strong>ückzuführen.<br />
Die Bestandsdichten <strong>der</strong> einzelnen Fischarten sind in Tabelle 6 und 7 zusammengestellt.<br />
Insgesamt sind die Bestandsdichten <strong>der</strong> typspezifischen Arten und <strong>der</strong> Begleitarten im<br />
Bleichenholter Graben und in <strong>der</strong> Mittelradde als gering einzuschätzen. Die Leitarten<br />
erreichen allenfalls mittlere Bestandsdichten. Höhere Bestandsdichten, wie z.B. im Jahr 2006<br />
beim Hasel und Rotauge in <strong>der</strong> Mittelradde sind vor allem durch hohe Anteile <strong>der</strong><br />
Nachwuchsjahrgänge bedingt.<br />
In <strong>der</strong> Mittelradde sind an jedem Befischungszeitpunkt weniger Arten gefangen worden als<br />
im Bleichenholter Graben. Zudem liegen die Bestandsdichten in <strong>der</strong> Mittelradde<br />
überwiegendenteils unter denen des Bleichenholter Grabens. Dies kann als Hinweis auf eine<br />
größere Strukturvielfalt des Bleichenholter Grabens gegenüber <strong>der</strong> Mittelradde gesehen<br />
werden.<br />
Foto 5:Ein mit dem Elektrogerät gefangener Hech
Tab. 4: Gesamtindividuenzahl und prozentuale Zusammensetzung im Fang des Bleichenholter Grabens<br />
10<br />
Art<br />
Referenz<br />
% N<br />
1998<br />
% N<br />
2000<br />
% N<br />
2002<br />
%<br />
2003/2004<br />
N % N<br />
2004<br />
% N<br />
2006<br />
%<br />
Aal 10,0 2 0,6 9 5,7 12 7,2 5 0,8 66 12,6 13 3,0<br />
Aland 0,5 57 8,8 10 2,3<br />
Bachforelle 1 0,6<br />
Bachneunauge 4,9<br />
Quer<strong>der</strong> 27 4,2<br />
Bitterling 0,1<br />
Brassen 2,0 21 5,8 2 1,2 1 0,2<br />
Döbel 2,0 1 0,3 1 0,6 6 0,9 3 0,6 1 0,2<br />
Dreist. Stichling 2,0<br />
Flussbarsch 4,0 2 0,6 14 8,8 23 13,8 19 2,9 79 15,1 17 3,9<br />
Flussneunauge 0,1<br />
Groppe 1 0,2<br />
Gründling 31,0 74 20,4 47 29,6 55 32,9 383 59 325 62,0 245 55,9<br />
Güster 4,0 70 19,3<br />
Hasel 18,4 5 1,4 48 30,2 10 6,0 87 13,4 7 1,3 93 21,2<br />
Hecht 1,0 9 2,5 3 1,9 4 2,4 5 0,8 3 0,6 5 1,1<br />
Karausche 0,1 2 0,6<br />
Karpfen 1 0,3<br />
Kaulbarsch 2,0 1 0,6 8 4,8 14 2,7 2 0,5<br />
Mo<strong>der</strong>lieschen 0,1 15 4,1 1 0,6<br />
Quappe 0,5<br />
Rotauge 7,0 131 36,1 19 11,9 42 25,1 32 4,9 19 3,6<br />
Rotfe<strong>der</strong> 0,1 4 1,1 1 0,6 45 10,3<br />
Schlammpeitzger 0,1<br />
Schleie 0,1 2 0,6 1 0,2 3 0,7<br />
Schmerle 5,0 14 8,8 6 3,6 6 0,9 4 0,8<br />
Steinbeißer 3,0 1 0,3 1 0,6 1 0,6 21 3,2 4 0,8 1 0,2<br />
Ukelei 23 6,3<br />
Waller 1 0,2<br />
Zwergstichling 2,0 1 0,6<br />
Summe 100,0 363 100,0 159 100,0 167 100,0 649 100,0 524 100,0 438 100,0<br />
Anzahl d. Arten 24 16 12 14 12 10 14<br />
Bewertung mit<br />
fiBS<br />
1,74 3,09 2,77 2,87 2,88 3,11
Tab. 5: Gesamtindividuenzahl und prozentuale Zusammensetzung im Fang <strong>der</strong> Mittelradde<br />
11<br />
Art<br />
Referenz<br />
% N<br />
1998<br />
% N<br />
2000<br />
% N<br />
2002<br />
%<br />
2003/2004<br />
N % N<br />
2004<br />
% N<br />
2006<br />
%<br />
Aal 10,0 25 32,1 12 14,5 6 10,3 14 8,8 9 1,5<br />
Aland<br />
Bachforelle<br />
0,5 2 0,3<br />
Bachneunauge<br />
Quer<strong>der</strong><br />
4,9 2 2,6<br />
Bitterling 0,1<br />
Brassen 2,0 1 1,2 2 1,3 2 0,3<br />
Döbel 2,0 4 5,1 1 1,2 3 5,2 3 1,9 6 1,0<br />
Dreist. Stichling 2,0<br />
Flussbarsch 4,0 1 1,3 5 6,0 1 1,7 6 3,8 9 1,5<br />
Flussneunauge 0,1<br />
Groppe<br />
Gründling 31,0 4 4,8 4 6,9 85 53,1 29 4,7<br />
Güster 4,0 1 1,3<br />
Hasel 18,4 12 15,4 33 39,8 6 3,1 168 27,2<br />
Hecht 1,0 2 2,6 5 6,0 4 6,9 14 8,8 16 2,6<br />
Karausche 0,1<br />
Karpfen 2 2,6<br />
Kaulbarsch 2,0<br />
Mo<strong>der</strong>lieschen 0,1 2 2,6 19 22,9<br />
Quappe 0,5<br />
Rotauge 7,0 26 33,3 40 69 31 19,4 376 60,9<br />
Rotfe<strong>der</strong> 0,1 1 1,2<br />
Schlammpeitzger 0,1<br />
Schleie 0,1<br />
Schmerle 5,0 1 1,3 2 2,4<br />
Steinbeißer 3,0<br />
Ukelei<br />
Waller<br />
Zwergstichling 2,0<br />
Summe 100,0 78 100,0 83 100,0 58 100,0 160 100,0 617 100,0<br />
Anzahl d. Arten 24 11 10 6 8 9<br />
Bewertung mit<br />
fiBS<br />
2,43 2,44 1,77 2,21 2,48
12<br />
Tab. 6: Indiviuduendichten im Fang des Bleichenholter Grabens
13<br />
Tab. 7: Indiviuduendichten im Fang <strong>der</strong> Mittelradde
3.2.3 Bewertung des ökologischen Gewässerzustandes anhand <strong>der</strong> Fischfauna<br />
14<br />
In Tabelle 8 sind die Bewertungsergebnisse des ökologischen Zustandes anhand <strong>der</strong><br />
Fischfauna aufgeführt. Wie aus <strong>der</strong> Tabelle ersichtlich ist, weist <strong>der</strong> Bleichenholter Graben<br />
auf <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> Bewertung mit fiBS vor Umgestaltung einen unbefriedigenden Zustand auf<br />
und verbessert sich nach <strong>der</strong> Umgestaltung zum guten Zustand. Die Mittelradde ist in ihrem<br />
Unterlauf dagegen mit mäßig zu bewerten.<br />
Tab. 8: Gesamtbewertung mit fiBS<br />
1998 2002 -2006<br />
Bleichenholter Graben - Bewertungspunkte 1,74 3,01<br />
Bewertung unbefriedigend gut<br />
Individuenanzahl im Gesamtfang 363 1129<br />
Mittelradde - Bewertungspunkte 2,43 2,48<br />
Bewertung mäßig mäßig<br />
Individuenanzahl im Gesamtfang 78 836<br />
Die Verbesserungen des ökologischen Zustands im Bleichenholter Graben sind im Einzelnen<br />
auf Verschiebungen <strong>der</strong> Abundanz <strong>der</strong> Leitarten und <strong>der</strong>en Altersstruktur, in <strong>der</strong><br />
Gildenverteilung, durch die Zunahme rheophiler Arten (wie Hasel, Gründling und Schmerle)<br />
im Fischregionsindex und <strong>der</strong> Barsch/Rotaugen Dominanz in Richtung des<br />
Referenzzustandes <strong>zur</strong>ückzuführen.<br />
5 Literatur<br />
DUßLING, U., BISCHOF, A., HABERBOSCH, R., HOFFMANN, A., KLINGER, H., WOLTER,<br />
C., WYSUJACKK, K., BERG, R. (2008): Das fischbasierte Bewertungssystem für<br />
Fließgewässer – fiBS: www.LVVG-BW.de<br />
DIEKMANN, M., U. DUßLING & R. BERG (2005): Handbuch zum fischbasierten<br />
Bewertungssystem für Fließgewässer (FIBS). Website <strong>der</strong> Fischereiforschungsstelle Baden-<br />
Württemberg: www.LVVG-BW.de<br />
DUßLING, U., BERG, R., KLINGER, H. & WOLTER, C. (2004): Assessing the Ecological<br />
Status of River Systems Using Fish Assemblages. Handbuch Angewandte Limnologie, 20.<br />
Erg. Lfg. 12/04: 1–84<br />
EG-WRRL (2000): Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom<br />
23. Oktober 2000 <strong>zur</strong> Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen <strong>der</strong> Gemeinschaft<br />
im Bereich <strong>der</strong> Wasserpolitik. Amtsblatt <strong>der</strong> Europäischen Gemeinschaften, L 327: 1–72
Abb. 1: Lage <strong>der</strong> Befischungspositionen und Wasserprobenahmestellen<br />
15
Tab. 9: Charakterisierung <strong>der</strong> Fließgewässer-Fischarten Deutschlands<br />
16
17<br />
II. Biologische Gewässeruntersuchungen 2004<br />
Bleichenholter Graben<br />
Die Biologische Gewässeruntersuchung des Bleichenholter Grabens fand am<br />
12. Mai 2004 statt.<br />
Die Gütebestimmung wurde, wie auch in den Jahren 2000 und 2002 nach dem System von<br />
Detlef Meyer von <strong>der</strong> ALG (Arbeitsgemeinschaft Limnologie und Gewässerschutz e.V.,<br />
Hannover) vorgenommen. Seine Methode ist ausführlich und auch für den interessierten<br />
Laien gut nachvollziehbar in dem Buch: „Makroskopisch-biologische Feldmethoden <strong>zur</strong><br />
Wassergütebeurteilung von Fließgewässern“<br />
(5. völlig überarbeitete Auflage 1999, ISBN 3-9800871-4-X) beschrieben.<br />
Bei einigen Taxa wurde zusätzlich auf die Liste <strong>der</strong> Makroorganismen <strong>der</strong><br />
DIN 38 410 Teil 2 (ältere Version; befindet sich in Überarbeitung)<strong>zur</strong>ückgegriffen.<br />
Falls <strong>der</strong> Saprobienindex-Wert (SI-WERT) abweichend von MEYER ist, wird er in Klammern<br />
daneben gesetzt.<br />
Es erfolgt auch diesmal eine zusätzliche Berechnung nach <strong>der</strong> DIN-Norm.<br />
Die entsprechenden Werte sind ebenfalls in Klammern gesetzt.<br />
Es bedeuten: A = Abundanz o<strong>der</strong> Häufigkeit, S = Saprobienindex,<br />
G = Indikationsgewicht<br />
(A x G)<br />
Häufigkeit (A) x Saprobienindex (S) = Einzelsumme (∑)<br />
A S (DIN - S) ∑ (DIN ∑) G (A x S x G)<br />
Strudelwürmer (Turbellaria)<br />
Dendrocoelum lacteum (Milchweißer Strudelwurm)<br />
2 2,2 (2,2) 4,4 (4,4) 8 (35,2) (16)<br />
Schnecken (Gastropoda)<br />
Planorbarius corneus (Posthornschnecke) 2 2,0 4,0<br />
Anisus vortex (Kleine Tellerschnecke) 2 ohne SI-Wert<br />
Ancylus fluviatilis (Mützenschecke) 4 1,8 (2,0) 7,2 (8,0) 4 (32,0) (16)<br />
Bithynia tentaculata (Langfühlerige Schnauzenschnecke)<br />
3 2,3 (2,3) 6,9 (6,9) 8 (55,2) (24)<br />
Lymnaea stagnalis (Spitzschlammschnecke) 2 1,9 3,8<br />
Lymnaea (Radix) peregra f. ovata (Eif. Schlammschnecke)<br />
3 2,5 (2,3) 7,5 (6,9) 4 (27,6) (12)<br />
Schneckenlaich von verschiedenen Gastropodenspezies<br />
Muscheln (Bivalvia; Lamellibranchia)<br />
Sphaerium corneum (Kugelmuschel) 3 2,5 (2,2) 7,5 (6,6) 4 (26,4) (12)<br />
Unio pictorum (Malermuschel) 2 2,0 (2,0) 4,0 (4,0) 4 (16,0) (8)<br />
Pisidium ssp. (Erbsenmuschel) 3 ohne SI<br />
(A x G)<br />
Häufigkeit (A) x Saprobienindex (S) = Einzelsumme (∑)<br />
A S (DIN - S) ∑ (DIN ∑) G (A x S x G)
18<br />
Krebstiere (Crustacea)<br />
Asellus aquaticus (Wasserassel) 2 3,0 (2,7) 6,0 (5,4) 4 (21,6) (8)<br />
Gammarus pulex (Bachflohkrebs) 4 2,0 (2,1) 8,0 (8,4) 4 (33,6) (16)<br />
Gammarus roeseli (Flussflohkrebs) 3 2,3 (2,0) 6,9 (6,0) 8 (48,0) (24)<br />
Cladocera (Wasserflöhe) 4 ohne SI-Wert<br />
Copepoda (Hüpferlinge) 5 ohne SI-Wert<br />
Eintagsfliegen (Ephemeroptera)<br />
Ephemera danica (Maifliege) 1 1,7 (1,8) 1,7 (1,8) 8 (16,2) (8)<br />
Ephemerella ssp. 3 1,6 (1,6) 4,8 (4,8) 8 (38,4) (24)<br />
Habroleptoides modesta 3 1,4 (1,6) 4,2 (4,8) 4 (19,2) (12)<br />
Heptagenia flava 3 ohne SI(2,0) (6,0) 4 (24,0) (12)<br />
Baetis rhodani (Märzbraune) 7 2,0 (2,3) 14,0(16,1) 8 (128,8) (56)<br />
Baetis fuscatus (Märzbraune) 4 2,0 (2,1) 8,0 (8,4) 4 (33,6) (16)<br />
Baetis vernus (Märzbraune) 4 2,0 (2,1) 8,0 (8,4) 4 (33,6) (16)<br />
Ecdyonurus ssp. 2 1,5 (1,7) 3,0 (3,4) 8 (27,2) (16)<br />
Cloeon dipterum (Olivgrüne) 3 2,0 (2,2) 6,0 (6,6) 8 (52,8) (24)<br />
Caenis spp. 2 ohne SI-Wert)<br />
Köcherfliegen (Trichoptera)<br />
Hydropsyche siltalai (Wasserseelchen) 5 2,0 (1,8) 10,0 (9,0) 8 (72,0) (40)<br />
Hydropsyche ssp. 3 ohne SI-Wert<br />
Anabolia nervosa 2 2,0 (2,0) 4,0 (4,0) 8 (32,0) (16)<br />
Potamophylax rotundipenis 1 2,0 (ohne SI)2,0<br />
Limnephilus spp. 2 2,0 (ohne SI)4,0<br />
Schlammfliegen (Megaloptera)<br />
Sialis lutaria 3 ohne SI (2,3) (6,9) 4 (27,6) (12)<br />
Libellen (Odonata)<br />
Kleinlibellen (Zygoptera)<br />
Calopteryx splendens (Gebän<strong>der</strong>te Prachtlibelle)3 2,0 (2,0) 6,0(6,0) 8 (48,0) (24)<br />
Coenagrion puella (Schlankjungfer) 3 ohne SI-Wert<br />
Großlibellen (Anisoptera)<br />
Aeshna cyanea (Blaugrüne Mosaikjungfer) 2 2,0 (2,0) 4,0 (4,0) 8 (32,0) (16)<br />
Libellula depressa (Plattbauch) 1 ohne SI-Wert<br />
Zweiflügler (Diptera)<br />
Chironomus thummi (Rote Zuckmückenlarven)2 3,6 (3,2) 7,2 (6,4) 4 (25,6) (8)<br />
Simulium ssp. (Kriebelmückenlarve) 6 ohne SI(2,0) (12,0) 8 (108,0) (48)<br />
Simulium ssp. (Kriebelmückenpuppen) siehe unter Larven<br />
Weitere Mückenlarven aus verschiedenen Familien ohne SI-Wert<br />
Käfer (Coleoptera)<br />
Dytiscus marginalis (Gelbrandkäfer) 1 ohne SI-Wert<br />
Platambus maculatus 2 ohne SI(2,3) (4,6) 8 (36,8) (16)<br />
Orectochilus villosus (Bachtaumelkäfer) 3 ohne SI(2,0) (6,0) 4 (24,0) (12)<br />
Hydrophilus spp. 2 ohne SI-Wert<br />
(A x G)<br />
Häufigkeit (A) x Saprobienindex (S) = Einzelsumme (∑)<br />
A S (DIN - S) ∑ (DIN ∑) G (A x S x G)<br />
Wasserwanzen (Heteroptera)<br />
Gerris najas (Teichwasserläufer) 2 ohne SI-Wert
-Corixa spp. (Ru<strong>der</strong>wanze) 3 ohne SI-Wert<br />
-Notonecta glauca (Rückenschwimmer) 2 ohne SI-Wert<br />
-Aphelocheirus aestivalis (Grundwanze) 3 ohne SI-Wert<br />
19<br />
Gesamthäufigkeit 74 Ges.su. 153,1 (1075,4)(512)<br />
Gesamtsumme 153,1 : Gesamthäufigkeit 74 = Saprobienindex 2,07<br />
Dieser Saprobienindex entspricht Güteklasse II .<br />
n<br />
∑ si x Ai x Gi<br />
i = 1<br />
Die Berechnung nach DIN 38 410 Teil 2 erfolgt nach <strong>der</strong> Formel S = ---------------------<br />
n<br />
∑ Ai x Gi<br />
Das Einsetzen obiger Zahlen in die Formel (1075,4 : 512 = 2,10) ergibt<br />
einen<br />
Saprobienindex von 2,10 und entspricht somit <strong>der</strong> Güteklasse II .<br />
Die diesmal gefundenen 46 Makrozoobenthos-Taxa, davon 21 ohne SI-Wert nach MEYER<br />
und/o<strong>der</strong> DIN 38 410 Teil 2, erlauben eine sichere Einordnung in eine Güteklasse II. Die<br />
2002 angedeutete Tendenz hat sich stabilisiert. Der Bleichenholter Graben ist ein relativ<br />
sauberes Fließgewässer <strong>der</strong> norddeutschen Tiefebene und befindet sich im Mai 2004 in <strong>der</strong><br />
Güteklasse II (mäßig belastet, betamesosaprob).<br />
Die Fließgewässerarten haben weiter zugenommen.<br />
Als Beispiele seien auch diesmal die Simuliidenlarven (Kriebelmücken), die<br />
Trichopterenlarvenarten <strong>der</strong> Gattung Hydropsyche, die Malermuschel Unio pictorum und vor<br />
allem die Ephemeropterenlarven <strong>der</strong> Gattungen Ephemerella, Habrophlebia und<br />
Habroleptoides genannt .
20<br />
Foto 7: Sumpfdotterblume am Bleichenholter Graben.<br />
Wasserpflanzenvorkommen 2004<br />
Bleichenholter Graben<br />
Während <strong>der</strong> Biologischen Gewässeruntersuchung am 12. Mai 2004 aufgenommen.<br />
Grüne Fadenalgen (Cladophora ssp.) – geringeres Vorkommen<br />
Wasserlinse (Lemna ssp.) – in ruhigeren Bereichen geringe Vorkommen<br />
Kanadische Wasserpest (Elodea canadensis) – in ruhigeren Bereichen starke<br />
Bestände Frühlings-Wasserstern (Callitriche palustris) – gleiche Bestände wie 2002<br />
Rauhes Hornblatt (Ceraophyllum demersum) – weiter <strong>zur</strong>ückgegangen<br />
Ähriges Tausendblatt (Myriophyllum spicatum) – nicht mehr gefunden<br />
Wasserknöterich (Polygonum amphibium)<br />
verschiedene Laichkräuter (Potamogetonaceae) – ähnlich häufig wie im Mai 2002<br />
u.a. Glänzendes Laichkraut (Potamogeton lucens)<br />
Schwimmendes Laichkraut (Potamogeton natans)<br />
Krauses Laichkraut (Potamogeton crispus)<br />
verschiedene Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae)<br />
u.a. Wasser-Hahnenfuß (Ranunculus aquatilis) – starke Bestände, teils blühend<br />
Sumpfdotterblume (Caltha palustris) – am Ufer<br />
Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acer) – am Ufer und in <strong>der</strong> Weide<br />
Bitteres Schaumkraut (Cardamine amarea) – in <strong>der</strong> angrenzenden Weide<br />
Pfeilkraut (Sagittaria sagittifolia) – am Ufer in geringen Beständen<br />
Wasser-Schwertlilie –Iris- (Iris pseudacorus) – mittlere Bestände<br />
Schilf (Phragmites communis) – im Bereich <strong>der</strong> unteren Aufweitung<br />
Rohrglanzgras (Phalaris ssp.) – bei <strong>der</strong> unteren Aufweitung<br />
Ästiger Igelkolben (Sparganium erectum) – nicht mehr gefunden<br />
verschiedene Seggenarten (Carex ssp.)<br />
Blutwei<strong>der</strong>ich (Lythrum sallicaria) - in <strong>der</strong> Ufervegetation
Bei den Wasserpflanzen handelt es sich wie schon im Jahr 2002 nicht mehr nur um<br />
Stillwasserarten.<br />
Rheophile (strömungsliebende) Pflanzen haben weiter zugenommen<br />
(z. B. Glänzendes Laichkraut Potamogeton lucens, Wasser-Hahnenfuß Ranunculus<br />
aquatilis, Wasserstern Callitriche, Pfeilkraut Sagittaria sagittifolia u.ä.).<br />
21<br />
Seltene und/o<strong>der</strong> beson<strong>der</strong>e Pflanzenarten waren aber nicht darunter. Der nach wie vor<br />
vorhandene grüne Fadenalgenreichtum <strong>der</strong> Gattung Cladophora gibt aber immer noch<br />
Anlass <strong>zur</strong> Sorge. Nährstoffreiches Mittelradde-Wasser begünstigt das Vorkommen.<br />
Im Uferbereich ist auffallend, dass die ehemals größeren Bestände an Stieleichen (Quercus<br />
robur) stark <strong>zur</strong>ückgehen.