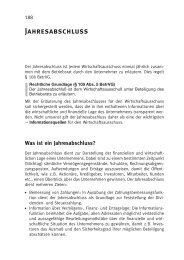Exkurs: Der Corporate Governance Kodex
Exkurs: Der Corporate Governance Kodex
Exkurs: Der Corporate Governance Kodex
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Exkurs</strong>:<br />
<strong>Der</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong> <strong>Kodex</strong><br />
Missmanagement, Unternehmensinsolvenzen, Kompetenzüberschreitungen<br />
und auch eine Reihe von Betrugsfällen haben in jüngster Zeit zu heftiger<br />
Kritik an den Vorständen, Aufsichtsräten und Abschlussprüfern geführt.<br />
Es wurde ihnen vorgeworfen, nicht rechtzeitig auf bedrohliche<br />
Situationen und die dadurch verursachte Bestandsgefährdung von Unternehmen<br />
hingewiesen und/oder entgegengesteuert zu haben. Kurz: Die<br />
Unternehmenskontrolle habe versagt – mit der Konsequenz, dass nicht<br />
nur die Unternehmen selbst in die Krise geraten sind und Anteilseigner<br />
Geld verloren haben, sondern vor allem zahlreiche Arbeitsplätze vernichtet<br />
worden sind und viele Menschen ihre Existenzgrundlage verloren haben.<br />
Sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat wurde in Krisenfällen argumentiert,<br />
man habe nichts von der drohenden Gefahr gewusst, ja nicht<br />
einmal geahnt, da keine Informationen zu den Risiken vorlagen. Um die<br />
Ausrede des Nichtwissens endgültig aus der Welt zu schaffen, sind auf<br />
Ebene der Unternehmensleitung u. a. Vorschriften zur Risikofrüherkennung<br />
formuliert worden. Weiterhin soll die Überwachungsqualität der Aufsichtsräte<br />
verbessert und dauerhaft gesichert werden. Diesem Ziel dient der<br />
deutsche <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong> <strong>Kodex</strong>.<br />
In zwei Schritten wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen,<br />
um diese Überwachungsfunktionen zu stärken. So trat am 1. 5. 1998<br />
das KonTraG (Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich)<br />
in Kraft. Dadurch sind zahlreiche Vorschriften vor allem des Aktiengesetzes<br />
und des Handelsgesetzbuches mit dem Ziel verändert worden,<br />
Unternehmenskontrolle und Kontrollgremien zu stärken. Dazu zählen vornehmlich<br />
der Aufsichtsrat und der Wirtschaftsprüfer. Im Jahr 2002 kam das<br />
TransPuG (Transparenz- und Publizitätsgesetz) dazu. Dieses Gesetz versteht<br />
sich ausdrücklich als Beitrag zur Reform des Aktien- und Bilanzrechts.<br />
So wurden die Rechte des Aufsichtsrats ein weiteres Mal gestärkt<br />
und insbesondere vorgeschrieben, dass bestimmte Geschäfte der Zustimmung<br />
des Aufsichtrats zu unterwerfen sind. Das war bisher nur eine Kann-<br />
Vorschrift. Die Ausgestaltung bleibt dem Aufsichtsrat überlassen.<br />
Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der Deutsche<br />
<strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong> <strong>Kodex</strong> (DCGK). 7 Er ist das Ergebnis einer von der<br />
Bundesregierung berufenen Kommission, in der neben Unternehmensvertretern,<br />
Wissenschaftlern, Vertretern von einschlägigen Berufsständen<br />
auch Gewerkschaftsvertreter mitarbeiteten. Dieser <strong>Kodex</strong> ist kein Gesetz,<br />
sondern hat Empfehlungscharakter. Dadurch jedoch, dass er Eingang ins<br />
7 Die jeweils aktuelle Version gibt es unter http://www.corporate-governance-code.de.<br />
Abgedruckt ist der <strong>Kodex</strong> z. B. bei Köstler/Kittner/Zachert/Müller, Aufsichtsratspraxis,<br />
S. 699 ff.<br />
36
TransPuG und in das AktG gefunden hat, hat er zumindest für börsennotierte<br />
Gesellschaften gesetzesähnlichen Charakter. Denn nach § 161 AktG<br />
müssen Vorstand und Aufsichtsrat einer solchen Gesellschaft erklären, ob<br />
sie den <strong>Kodex</strong> angewandt haben und, falls nicht, warum (»comply or explain«).<br />
Wird dieser Erklärungspflicht nicht nachgekommen, führt dies zur<br />
Einschränkung des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers und möglichen<br />
Haftungsfolgen für Vorstand und Aufsichtsrat. 8 Dieser Erklärungspflicht<br />
wird im Allgemeinen nachgekommen. 9<br />
Die Unternehmen haben aber die Möglichkeit, den <strong>Kodex</strong> komplett abzulehnen<br />
(was etwa 3% der Unternehmen auch tun) bzw. ihn auch komplett<br />
anzuwenden (ca. 13%). <strong>Der</strong> überwiegende Teil der Unternehmen wendet<br />
einzelne <strong>Kodex</strong>empfehlungen nicht an (83%). 10<br />
<strong>Der</strong> Deutsche <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong> <strong>Kodex</strong> ist Bestandteil der allgemeinen<br />
Diskussion um <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong>. <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong> muss<br />
dabei als gute und verantwortungsvolle Unternehmensführung verstanden<br />
werden. Diese Diskussion gibt es natürlich nicht nur in Deutschland, sondern<br />
weltweit und hat ihren Ursprung in den USA. Ziel solcher Empfehlungen<br />
ist vor allem der Schutz der Anleger; im Vordergrund steht der Aktionär.<br />
Dennoch ist der <strong>Kodex</strong> auch für die Seite der Belegschaften<br />
interessant und es müssen sich auch die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat<br />
damit auseinander setzen. Die Kapitel, die sich mit den Aufgaben<br />
und Pflichten des Aufsichtsrats auseinander setzen, stehen daher im Folgenden<br />
im Mittelpunkt der Erläuterungen.<br />
Durch die Empfehlungen des <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong> <strong>Kodex</strong>es sollen vor<br />
allem auch die Informationsgrundlagen des Aufsichtsrats verbessert<br />
werden. In einigen Punkten bleibt der <strong>Kodex</strong> jedoch weit hinter dem Wünschenswerten<br />
zurück. Zur Unterrichtung des Aufsichtsrats heißt es: »Entscheidungsnotwendige<br />
Unterlagen, insbesondere der Jahresabschluss,<br />
der Konzernabschluss und der Prüfungsbericht, werden den Mitgliedern<br />
des Aufsichtsrats möglichst rechtzeitig vor der Sitzung zugeleitet.« 11 An<br />
dieser Stelle wäreeswünschenswert, wenn der <strong>Kodex</strong> den zeitlichen Mindestvorlauf<br />
zumindest für die Vorbereitung der Bilanzsitzung (in Tagen)<br />
festlegen würde. Damit hätten die Aufsichtsratsmitglieder selbst eine Orientierung,<br />
in welchem Zeitraum die gesamten Unterlagen z. B. zum Jahresund<br />
ggf. zum Konzernabschluss zu »verarbeiten« sind. Eine Anzeigepflicht<br />
der verspäteten Information der Aufsichtsratsmitglieder würde mit hoher<br />
Wahrscheinlichkeit jene erzieherische Wirkung erzielen, die im Zusammenhang<br />
mit anderen Empfehlungen erwartet wird. Hier hat die Kommission<br />
eine große Chance verpasst, den Missstand in einigen Unternehmen und<br />
Konzernen – die Unterlagen für den Aufsichtsrat zur Bilanzsitzung nicht<br />
einmal eine Woche vor der Sitzung auszuhändigen – zu beenden.<br />
Ein anderes wichtiges Feld im Rahmen der <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong> ist die<br />
Behandlung von Interessenkonflikten. Hiernach dürfen Vorstandsmitglieder<br />
oder Mitarbeiter sich oder anderen Personen keine Zuwendungen oder<br />
8 Vgl. z. B. Lutter/Krieger, Rechte und Pflichten des Aufsichtsrat, S. 313.<br />
9 So die ersten empirischen Untersuchungen zur Einhaltung des DCGK von v. Werder/Talaulicar/Kolat,<br />
<strong>Kodex</strong> Report 2003: Die Akzeptanz der Empfehlungen des<br />
Deutschen <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong> <strong>Kodex</strong>, DB 2003, S. 1857 ff.<br />
10 Die Zahlen stammen aus v. Werder u. a., a. a. O., S. 1859.<br />
11 DCGK, TZ 3.4.<br />
37
ungerechtfertigten Vorteile gewähren. »Kein Mitglied des Vorstands darf<br />
bei seinen Entscheidungen persönliche Interessen verfolgen und Geschäftschancen,<br />
die dem Unternehmen zustehen, für sich nutzen.« 12 Auftauchende<br />
Interessenkonflikte sind unverzüglich offen zu legen, wesentliche<br />
Geschäfte und Nebentätigkeiten bedürfen der Zustimmung des<br />
Aufsichtsrats. Diese Regelungen sind uneingeschränkt zu begrüßen, auch<br />
wenn sie als Selbstverständlichkeiten zu werten sind.<br />
Auch die Mitglieder des Aufsichtsrats werden auf das Unternehmensinteresse<br />
verpflichtet. Die Entscheidungen dürfen nicht durch persönliche<br />
Interessen beeinflusst sein und die Unternehmen dürfen nicht in den ihnen<br />
zustehenden Geschäftschancen beschnitten werden. »Jedes Aufsichtsratsmitglied<br />
solle Interessenkonflikte, insbesondere solche, die auf Grund<br />
einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern<br />
oder sonstigen Geschäftspartnern entstehen können, dem Aufsichtsrat gegenüber<br />
offen legen.« 13 <strong>Der</strong> Hintergrund dieser Empfehlung ist die Überlegung,<br />
dass ein Aufsichtsratsmitglied nicht zwei Herren dienen soll. Bei<br />
der Aushandlung von Fremdkapitalkonditionen können die Interessen des<br />
Fremdkapital suchenden Unternehmens nicht mit denen der (potenziellen)<br />
Kreditgeber identisch sein.<br />
Die Diskussion über die grundsätzliche Verpflichtung auf das Unternehmenswohl<br />
hat inzwischen auch die hauptamtlichen Gewerkschaftsvertreter<br />
in Aufsichtsräten erfasst. So wird die Verantwortlichkeit für Streikmaßnahmen,<br />
die in Drittwirkung einem Unternehmen Belastungen aufbürden,<br />
als unauflösbarer Interessenkonflikt interpretiert. Diese Auffassung ist aus<br />
Sicht der Arbeitnehmer völlig inakzeptabel und würde nicht nur einen Eingriff<br />
in die Tarifautonomie darstellen, sondern auch die Mitbestimmung<br />
unterhöhlen. Diese Position hat bisher noch keine allgemeine Unterstützung.<br />
Es muss jedoch an dieser Stelle kritisch auf das hohe Risiko, das in<br />
der Weiterentwicklung von Kommissionsempfehlungen liegt, hingewiesen<br />
werden. Zwar sind in dieser Kommission auch Interessenvertreter der Gewerkschaften<br />
vertreten, sie bilden jedoch eine kleine Minderheit gegenüber<br />
den Mitgliedern, die der Kapitalseite zuzuordnen sind.<br />
Ein wichtiges Kapitel des <strong>Kodex</strong>es ist die Bildung von Ausschüssen. Diese<br />
Ausschüsse gelten als grundlegendes Instrument zur Verbesserung der<br />
Aufsichtsratstätigkeit. »<strong>Der</strong> Aufsichtsrat soll abhängig von den spezifischen<br />
Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Mitglieder fachlich<br />
qualifizierte Ausschüsse bilden. Diese dienen der Steigerung der<br />
Effizienz der Aufsichtsratsarbeit und der Behandlung komplexer Sachverhalte.«<br />
14 Ob eine weitgehende Steuerung und Auslagerung der Aufsichtsratsarbeit<br />
in Ausschüsse notwendig bzw. sinnvoll ist, mag von den Gegebenheiten<br />
des Unternehmens abhängig sein. Bei immerhin einem Drittel der<br />
börsennotierten Unternehmen wird auf Ausschüsse komplett verzichtet. 15<br />
Generell muss jedoch gesagt werden, dass durch die Bildung von Ausschüssen<br />
die Verantwortung des Aufsichtsrats im Ganzen nicht aufgehoben<br />
wird. Insbesondere sollte darauf geachtet werden, dass dadurch die<br />
Rechte der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat auch nicht materiell be-<br />
12 DCGK, TZ 4.3.3.<br />
13 DCGK, TZ 5.5.2.<br />
14 DCGK, TZ 5.3.1.<br />
15 Siehe v. Werder u. a., DB 2003, S. 1861.<br />
38
schnitten werden, wie dies manchmal bei der Bildung von Präsidien der<br />
Fall ist.<br />
Ein Ausschuss – der Prüfungsausschuss – wird jedoch empfohlen und<br />
dieser Empfehlung wird von den Unternehmen zur Hälfte entsprochen. Hier<br />
ist eine deutliche Änderung der Haltung zu erkennen, da bis zur Veröffentlichung<br />
des <strong>Kodex</strong>es der Prüfungsausschuss nur in einem Teil der Unternehmen<br />
etabliert war. »<strong>Der</strong> Aufsichtsrat soll einen Prüfungsausschuss<br />
(Audit Committee) einrichten, der sich insbesondere mit Fragen der Rechnungslegung<br />
und des Risikomanagements, der erforderlichen Unabhängigkeit<br />
des Abschlussprüfers, der Erteilung des Prüfungsauftrags an den<br />
Abschlussprüfer, der Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und der<br />
Honorarvereinbarung befasst. <strong>Der</strong> Vorsitzende des Prüfungsausschusses<br />
soll kein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft sein.« 16 In mitbestimmten<br />
Unternehmen ist die Besetzung des Prüfungsausschusses nach<br />
unseren Informationen durchgehend paritätisch vorgenommen worden.<br />
Kritisch angemerkt werden muss jedoch, dass es hier Versuche gibt, die<br />
paritätische Struktur der mitbestimmten Aufsichtsräte auszuhöhlen, indem<br />
eine nach Fachkenntnissen qualifizierte Besetzung des Prüfungsausschusses<br />
verlangt wird. Einem solchen Ansinnen muss gegebenenfalls entgegengesteuert<br />
werden.<br />
Eine ähnliche Problematik ergibt sich mit dem Anforderungsprofil des<br />
DCGK für Aufsichtsratsmitglieder. »Bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern<br />
soll darauf geachtet werden, dass dem Aufsichtsrat<br />
jederzeit Mitglieder angehören, die über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung<br />
der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen<br />
Erfahrungen verfügen und hinreichend unabhängig sind.« 17 Diese<br />
Formulierungen lassen einen weiten Interpretationsspielraum. So kann es<br />
passieren, dass die Arbeitnehmervertreter wahlweise die hinreichende Unabhängigkeit<br />
oder die angeblich fehlenden fachlichen Kenntnisse vorgehalten<br />
bekommen. Insofern ist auch dies ein sensibler Punkt, der möglicherweise<br />
eine Ausstrahlung auf die Mitbestimmungspraxis bekommt.<br />
<strong>Der</strong> Deutsche <strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong> <strong>Kodex</strong> stellt durchaus einen Fortschritt<br />
im Hinblick auf die Informations- und Arbeitsmöglichkeiten des Aufsichtsrats<br />
dar. Dies gilt gerade auch für die Arbeitnehmerseite. Denn die<br />
Arbeitnehmervertreter von sensiblen Informationen und Diskussionen fern<br />
zu halten, wie das ja immer wieder in der Unternehmenspraxis festzustellen<br />
ist, wird durch die geschilderten Neuregelungen erheblich erschwert. Allerdings<br />
gibt es auf der anderen Seite auch Versuche, etwa durch eine entsprechende<br />
Besetzung der Ausschüsse und vor allem auch über eine generelle<br />
Ausrichtung auf eine auf die Interessen der Anteilseigner verkürzte<br />
Unternehmenspolitik, die Mitbestimmung zu unterlaufen oder auszuhöhlen.<br />
Aus unserer Sicht ist es daher nötig, dass die für den <strong>Kodex</strong> verantwortliche<br />
Kommission in ihren Kompetenzen eingeschränkt und dabei insbesondere<br />
auch auf die Achtung der Mitbestimmung verpflichtet wird.<br />
Weiterhin sind verschiedene Problemfelder ohne Resonanz im Deutschen<br />
<strong>Corporate</strong> <strong>Governance</strong> <strong>Kodex</strong> geblieben. Hier ist zum einen die Hinzuziehung<br />
von externen Sachverständigen für den Aufsichtsrat bzw. für eine<br />
16 DCGK, TZ 5.3.2.<br />
17 DCGK, TZ 5.4.1.<br />
39
Seite des Aufsichtsrats zu nennen. Während es inzwischen allgemein in der<br />
Geschäftsführung von Unternehmen Übung geworden ist, in schwierigen<br />
Situationen Unternehmensberater heranzuziehen, gilt dies für den Aufsichtsrat<br />
nicht. Dabei wäre dies besonders in wirtschaftlichen Krisensituationen<br />
oder bei schwerwiegenden strategischen Entscheidungen sinnvoll<br />
und hilfreich.<br />
Ebenfalls ein leidiges Kapitel ist die Frage der Fortbildung der Aufsichtsratsmitglieder.<br />
Auch wenn unterstellt wird, dass die notwendigen fachlichen<br />
Kenntnisse (ursprünglich bei Eintritt in das Gremium) in früheren<br />
Jahren vorhanden waren, muss festgestellt werden, dass die Grundlagen<br />
für die Aufsichtsratstätigkeit sich in den letzten Jahren beträchtlich verändert<br />
haben. Im Gegensatz hierzu wird den Abschlussprüfern der Nachweis<br />
einer aktiven Fortbildung für jedes Kalenderjahr abverlangt. Wieso den<br />
ausgewiesenen Fachleuten eine permanente Fortbildung auferlegt wird, 18<br />
andererseits bei den heterogen zusammengesetzten Aufsichtsräten noch<br />
nicht einmal ein Angebot zur Fortbildung von Unternehmensseite vom <strong>Kodex</strong><br />
anempfohlen wird, bleibt ungeklärt. Angesichts der Dramatik der Umwälzung<br />
von Grundlagen der strategischen Unternehmensführung und der<br />
Rechnungslegungsstandards, die sich auch in der absehbaren Zukunft<br />
fortsetzen wird, ist das Bild des aus sich heraus kompetenten Aufsichtsrats<br />
eine Schimäre. Dies gilt sowohl für die Arbeitnehmer- wie die Arbeitgeberbank.<br />
Bei Umstellung von Rechnungslegungsstandards, der Einführung<br />
neuer Managementkonzepte usw. sollte eine geeignete Form der Schulung<br />
für die Aufsichtsratsmitglieder im Vorfeld der eigentlichen Beratungen stattfinden.<br />
Ebenso erscheint ein Schulungsangebot für neu eintretende Aufsichtsratsmitglieder<br />
sachgerecht. Ähnlich wie bei den externen Beratern<br />
wird auch in der Fortbildung mit einem wirklichkeitsfremden Idealbild des<br />
Aufsichtsratsmitglieds in einer sich kaum ändernden Unternehmensumgebung<br />
operiert. Dieses Bild blockiert die Intensivierung der Aufsichtsratstätigkeit.<br />
Mehr Engagement der Aufsichtsratsmitglieder ist nicht nur über<br />
Erfolgsprämien zu erreichen. Auch strukturierte Angebote zur gezielten<br />
Fortbildung in Grundlagen, die für das Unternehmen bzw. die Unternehmensführung<br />
in Zukunft an Bedeutung gewinnen, ist ein wichtiges Element<br />
zur Effektivierung von Überwachungstätigkeit.<br />
<strong>Der</strong> <strong>Kodex</strong> nennt drei zentrale Punkte, die für die Aufsichtsratsarbeit herauszustellen<br />
sind: »Aufgabe des Aufsichtsrats ist es, den Vorstand bei der<br />
Leitung des Unternehmens regelmäßig zu beraten und zu überwachen. Er<br />
ist in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen<br />
einzubinden.« 19 Darüber hinaus ist er für Bestellung und Entlassung der<br />
Vorstandsmitglieder zuständig. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens<br />
ist dem <strong>Kodex</strong> zufolge mit dem Aufsichtsrat abzustimmen. Damit<br />
unterstreicht der <strong>Kodex</strong> die Bedeutung des Aufsichtsrats für die Unternehmensentwicklung.<br />
In erster Linie zwar auf den Schutz der Anteilseigner und<br />
der potenziellen Anleger gerichtet, verbessert er durchaus auch die Chancen<br />
für die Arbeitnehmer zur Beeinflussung und Kontrolle der Unter-<br />
18 Vgl. § 43 Abs. 2 Satz 4 WPO. Die überwiegende Zahl der Abschlussprüfer ist im<br />
Institut der Wirtschaftsprüfer organisiert und hat sich freiwillig laut Satzung auf die<br />
Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen von mindestens 40 Stunden pro Jahr verpflichtet.<br />
19 DCGK, TZ 5.1.1.<br />
40
nehmenspolitik. Dies setzt freilich voraus, dass die Arbeitnehmer ihre Interessen<br />
auch in die Unternehmenspolitik einbringen und die – sicher beschränkten<br />
– Mitbestimmungsmöglichkeiten im Aufsichtsrat auch wahrnehmen.<br />
41