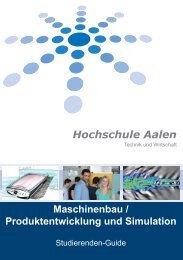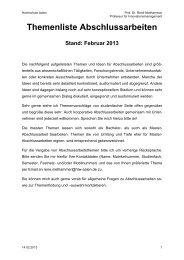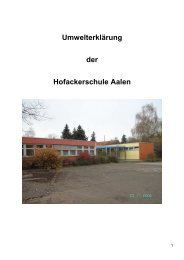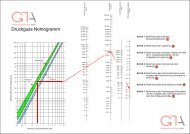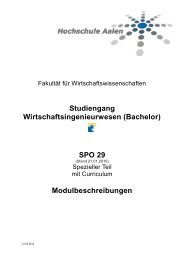Neue Anforderungen an die Lehre in Bachelor- und Master ...
Neue Anforderungen an die Lehre in Bachelor- und Master ...
Neue Anforderungen an die Lehre in Bachelor- und Master ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Neue</strong> <strong>Anforderungen</strong> <strong>an</strong> <strong>die</strong> <strong>Lehre</strong><strong>in</strong> <strong>Bachelor</strong>- <strong>und</strong> <strong>Master</strong>-Stu<strong>die</strong>ngängenJahrestagung des HRK Bologna-ZentrumsJ<strong>an</strong>uar 2009Beiträge zur Hochschulpolitik 1/2009
Das Bologna-Zentrum (BZ) derHochschulrektorenkonferenz (HRK)unterstützt mit f<strong>in</strong><strong>an</strong>zieller Förderung desB<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isteriums für Bildung <strong>und</strong>Forschung (BMBF) den Reform- <strong>und</strong>Modernisierungsprozess der deutschenHochschulen auf ihrem Weg <strong>in</strong> e<strong>in</strong>engeme<strong>in</strong>samen Europäischen Hochschulraum.Damit begleitet <strong>die</strong> HRK <strong>die</strong>Umsetzung des Bologna-Prozesses <strong>in</strong>Deutschl<strong>an</strong>d mit Impulsen <strong>und</strong> „goodpractice“. Das umfassende Service<strong>an</strong>gebotreicht von der Beratung über <strong>die</strong>Aufbereitung von aktuellen Informationenfür <strong>die</strong> verschiedenen Zielgruppen<strong>in</strong>nerhalb <strong>und</strong> außerhalb der Hochschulen.Beiträge zur Hochschulpolitik 1/2009HRK Bologna-ZentrumHerausgegeben von derHochschulrektorenkonferenzVer<strong>an</strong>twortlich:Dr. Peter A. ZervakisRedaktion:Dr. Patrick A. Neuhaus, D<strong>an</strong>iela Mager, PetraMart<strong>in</strong>iAhrstraße 39, 53175 BonnTel.: 0228/ 887-0Telefax: 0228/ 887-110bologna@hrk.dewww.hrk.dewww.hrk-bologna.deBonn, J<strong>an</strong>uar 20091. AuflageNachdruck <strong>und</strong> Verwendung <strong>in</strong> elektronischenSystemen – auch auszugsweise – nur mitvorheriger schriftlicher Genehmigung durch <strong>die</strong>Hochschulrektorenkonferenz. Die HRKübernimmt ke<strong>in</strong>e Gewähr für <strong>die</strong> rechtlicheVerb<strong>in</strong>dlichkeit, Aktualität, Richtigkeit <strong>und</strong>Vollständigkeit der bereitgestelltenInformationen der abgedruckten Texte.Repr<strong>in</strong>t<strong>in</strong>g <strong>an</strong>d use <strong>in</strong> electronic systems of thisdocument or extracts from it are subject to theprior written approval of the Germ<strong>an</strong> Rectors'Conference. The Germ<strong>an</strong> Rectors' Conferencedoes not guar<strong>an</strong>tee the legal obligation,topicality, accuracy <strong>an</strong>d completeness of thepr<strong>in</strong>ted documents.ISBN 978-3-938738-64-1InhaltsverzeichnisVorwort 7Prof. Dr. Margret W<strong>in</strong>term<strong>an</strong>telGrußworte 10Prof. Dr. Andreas P<strong>in</strong>kwart 11M<strong>in</strong>isterialdirigent Peter Greisler 17Prof. Dr. Wilfried Müller 231. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 291.1 Wissenschaftlich kompetent für den Beruf qualifizierenProf. Dr. Dr. h.c. Ulrich Teichler 301.2 Die Bologna-Reform als Harmonisierung von Fragen <strong>an</strong><strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>ngängeDr. Peter Tremp, Thomas Hildbr<strong>an</strong>d 531.3 HIS-Stu<strong>die</strong> zu Stu<strong>die</strong>nabbruchquoten von 2008Dr. Ulrich Heuble<strong>in</strong> 621.4 Arbeitsgruppen 711.4.1 Vermittlung von Kompetenzen <strong>und</strong> Stu<strong>die</strong>rbarkeit (Formulierungvon Lernergebnissen): Der Blick auf Modelle <strong>in</strong> EuropaDef<strong>in</strong><strong>in</strong>g <strong>an</strong>d Teach<strong>in</strong>g Learn<strong>in</strong>g Outcomes 71Prof. Dr. Wendy DaviesZusammenfassung AG 1: Vermittlung von Kompetenzen <strong>und</strong>Stu<strong>die</strong>rbarkeit (Formulierung von Lernergebnissen): Der Blick aufModelle <strong>in</strong> EuropaMar<strong>in</strong>a Ste<strong>in</strong>m<strong>an</strong>n 80
1.4.2 Arbeitsgruppe 2: Zur Bedeutung <strong>und</strong> Umsetzung vonQualifikationsrahmen (fachlich, national, europäisch) 83Die Erhöhung von Freiheitsgraden für Forschung <strong>und</strong> <strong>Lehre</strong>Prof. Dr. Ulrich Bartosch 83Zusammenfassung AG 2: Zur Bedeutung <strong>und</strong> Umsetzung vonQualifikationsrahmen (fachlich, national, europäisch)Dr. Achim Hopbach 1061.4.3 Arbeitsgruppe 3: Kompetenzorientierter Leistungsnachweis:Anspruch <strong>und</strong> Wirklichkeit 109Kompetenzorientiertes Prüfen <strong>in</strong> der Hochschule: Eigentlich e<strong>in</strong>eSelbstverständlichkeit?Prof. Dr. Kar<strong>in</strong> Klepp<strong>in</strong> 109Kompetenzorientierte LeistungsnachweiseProf. Dr. M<strong>an</strong>fred Künzel 117Zusammenfassung AG 3: Kompetenzorientierter Leistungs -nachweis: Anspruch <strong>und</strong> WirklichkeitChrist<strong>in</strong>e Speth 1242. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 1292.1 Tu felix Brit<strong>an</strong>nia? Zur Vermittlung praxisrelev<strong>an</strong>ter Kompetenzen<strong>in</strong> geisteswissenschaftlichen FächernProf. Dr. Kai Brodersen 1302.2 Wissenschafts- <strong>und</strong> Forschungskompetenz als Alle<strong>in</strong>stellungsmerkmalder hochschulischen Bildung?Dr. Fr<strong>an</strong>k Stef<strong>an</strong> Becker 1362.3 Arbeitsgruppen2.3.1 Arbeitsgruppe 1: Wie k<strong>an</strong>n e<strong>in</strong> Konzept „Fit für den Arbeitsmarkt“<strong>in</strong> den Fächerkulturen umgesetzt werden?Erfahrungswerte e<strong>in</strong>er Privat-UniversitätProf. Dr. Hendrik Birus 141Employability: Kategorien, Kriterien, Kompetenzen aus Sicht derHypoVere<strong>in</strong>sb<strong>an</strong>kMart<strong>in</strong>a Bischof 145Das KUBUS-Programm zur Berufsorientierung <strong>an</strong> der He<strong>in</strong>rich-He<strong>in</strong>e-Universität Düsseldorf. E<strong>in</strong> KurzporträtDr. Ulrich Welbers 153Zusammenfassung AG 1: Wie k<strong>an</strong>n e<strong>in</strong> Konzept „Fit für denArbeitsmarkt“ <strong>in</strong> den Fächerkulturen umgesetzt werden?Dr. Volkmar L<strong>an</strong>ger 1582.3.2 Arbeitsgruppe 2: Die Promotion als erste forschendeBerufstätigkeit? 163Employability - Die Promotion als erste forschende BerufstätigkeitDr. Hubert Detmer 163Promotion als erste forschende BerufstätigkeitDr.-Ing. Uwe Koser 169Zusammenfassung AG 2: Promotion als erste forschendeBerufstätigkeit?Dr. Priya Bondre-Beil 1752.3.3 Arbeitsgruppe 3: Zur E<strong>in</strong>richtung von Career Centern 177Strategien für den erfolgreichen Aufbau <strong>und</strong> <strong>die</strong> Etablierung vonCareer Services <strong>an</strong> deutschen HochschulenAndreas Eimer 177Zusammenfassung AG 3: Zur E<strong>in</strong>richtung von Career CenternKar<strong>in</strong> Rehn 184
3. Der St<strong>an</strong>d der E<strong>in</strong>führung des Diploma Supplements 187Monika SchröderVorwort74. ResümeeVizepräsident der HochschulrektorenkonferenzProf. Dr. Wilfried Müller 195Teilnehmerverzeichnis 199Programm der Tagung 209Autorenverzeichnis 217Liebe Leser<strong>in</strong>, lieber Leser,nach den auch <strong>in</strong> der LondonerBildungsm<strong>in</strong>isterkonferenz im Jahr 2007besche<strong>in</strong>igten guten Fortschritten bei der strukturellen Umstellung derStu<strong>die</strong>ngänge auf <strong>Bachelor</strong>- <strong>und</strong> <strong>Master</strong>abschlüsse <strong>an</strong> den deutschenHochschulen werden zunehmend <strong>die</strong> gew<strong>an</strong>delten <strong>Anforderungen</strong> <strong>an</strong> <strong>die</strong><strong>Lehre</strong> sichtbar. Daher hat das Bologna-Zentrum der Hochschulrektorenkonferenz(HRK) am 10.-11. April 2008 <strong>die</strong>sem Thema se<strong>in</strong>e Jahrestagunggewidmet. Geme<strong>in</strong>sam mit vielen deutschen <strong>und</strong> <strong>in</strong>ternationalen Expertensowie Vertretern der Politik wurde der Frage nachgeg<strong>an</strong>gen, welche neuen<strong>Anforderungen</strong> sich <strong>an</strong> <strong>die</strong> <strong>Lehre</strong> konkret stellen.Denn <strong>die</strong> Vermittlung von Qualifikationen <strong>und</strong> Kompetenzen im Studium,<strong>die</strong> Umsetzung der von der Stu<strong>die</strong>nreform verl<strong>an</strong>gten Arbeitsmarktfähigkeit(Employability) <strong>und</strong> <strong>die</strong> Nutzbarmachung der allgeme<strong>in</strong>en <strong>und</strong>fachbezogenen Qualifikationsrahmen fordern <strong>die</strong> Hochschulen nach wievor heraus. Mit Blick auf <strong>die</strong> nächste M<strong>in</strong>isterkonferenz im belgischenLeuven am 28.-29. April 2009 hält <strong>die</strong> HRK e<strong>in</strong>e Diskussion über denhochschulspezifischen Kompetenzbegriff, auch im Rahmen der Debatte ume<strong>in</strong>en Deutschen Qualifikationsrahmen, für notwendig. Wie lassen sich <strong>die</strong>im wissenschaftsbasierten <strong>und</strong> forschungsorientierten Studiumentwickelten Kompetenzen beschreiben? Und wie soll e<strong>in</strong> entsprechendpräzisierter Kompetenzbegriff am besten <strong>in</strong> den Fachkulturen ver<strong>an</strong>kertwerden? Qualifikationsrahmen können Schlüssel<strong>in</strong>strumente für <strong>die</strong>Erreichung zentraler Ziele des Bologna-Prozesses se<strong>in</strong>. Sie <strong>die</strong>nen alsReferenzrahmen zur E<strong>in</strong>ordnung von Qualifikationen <strong>und</strong> Kompetenzenzwischen Ländern, Fächern <strong>und</strong> Bildungse<strong>in</strong>richtungen, werden aber vonvielen Hochschulakteuren <strong>in</strong> ihrer Bedeutung für <strong>die</strong> Hochschulen nochunterschätzt. Daher geht <strong>die</strong>ser B<strong>an</strong>d der Bedeutung von fachspezifischenQualifikationsrahmen als Hilfestellung für <strong>die</strong> stu<strong>die</strong>rendenzentrierteCurriculumsentwicklung nach.
89Dem vieldeutigen Bologna-Begriff der „Employability“ oder auchArbeitsmarktfähigkeit war der zweite Tag der Tagung gewidmet. Denn erspielt <strong>in</strong> der Diskussion über Ziele der Hochschulbildung als Folge desBologna-Prozesses e<strong>in</strong>e gewichtige, häufig jedoch ungeklärte Rolle. Zu denbenötigten Kompetenzen <strong>und</strong> Qualifikationen der Stu<strong>die</strong>renden, <strong>die</strong> <strong>in</strong> denCurricula vermittelt werden sollen, gehört nicht zuletzt auch der expliziteBezug auf <strong>die</strong> Berufspraxis <strong>und</strong> den Arbeitsmarkt. Hier ist e<strong>in</strong>e starkeDifferenzierung der Fachkulturen auszumachen: Je nach Profil derHochschule <strong>und</strong> des Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gs stehen entweder stärker <strong>die</strong> berufsorientierteQualifizierung oder <strong>die</strong> allgeme<strong>in</strong>en Problemlösungskompetenzenim Vordergr<strong>und</strong>. Schließlich wird <strong>die</strong> Promotion unter demGesichtspunkt der ersten forschenden Berufstätigkeit betrachtet.Vorgestellt werden praktische Beispiele aus Hochschul- wie ausUnternehmenssicht, der Blick auf das europäische Ausl<strong>an</strong>d r<strong>und</strong>et das Bildab.Erwähnt werden soll auch, dass als H<strong>an</strong>dlungsauftrag aus der <strong>die</strong>sjährigenJahrestagung des HRK Bologna-Zentrums <strong>die</strong> Durchführung e<strong>in</strong>erNachfolgever<strong>an</strong>staltung im Herbst 2008 <strong>in</strong> Potsdam erfolgte, <strong>die</strong> sichspeziell dem komplexen Thema der „Stu<strong>die</strong>rbarkeit“ <strong>in</strong> den neuenStu<strong>die</strong>ngängen widmete (vgl. http://www.hrkbologna.de/bologna/de/home/1945_3334.php).Ich wünsche Ihnen e<strong>in</strong>e <strong>an</strong>regende Lektüre!Prof. Dr. Margret W<strong>in</strong>term<strong>an</strong>tel
10GrußworteGrußworte: Prof. Dr. Andreas P<strong>in</strong>kwart 11Prof. Dr. Andreas P<strong>in</strong>kwartM<strong>in</strong>ister für Innovation, Wissenschaft, Forschung <strong>und</strong> Technologie desL<strong>an</strong>des Nordrhe<strong>in</strong>-WestfalenIch freue mich sehr darüber, dass <strong>die</strong>se Tagung <strong>die</strong> neuen <strong>Anforderungen</strong><strong>an</strong> <strong>die</strong> <strong>Lehre</strong> im Zuge des Bologna-Prozesses <strong>in</strong>s Zentrum stellt.GreislerP<strong>in</strong>kwartFünf Punkte dazu:1. Der Bologna-Prozess ist <strong>die</strong> strukturelle Reform der akademischenAusbildung, <strong>die</strong> wir dr<strong>in</strong>gend brauchen.Sichtworte: mehr Stu<strong>die</strong>rende ausbilden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em flexiblen System2. Die Umstellung auf <strong>Bachelor</strong> <strong>und</strong> <strong>Master</strong> muss zugleich e<strong>in</strong>e Reformder Inhalte se<strong>in</strong>. Stichworte: von der Input- zur Outputorientierung desAusbildungssystems. Orientierung <strong>an</strong> Zielen: Beschäftigungsfähigkeit<strong>und</strong> Kompetenzen/Qualifikationen (Kernthema der Tagung)3. Bologna ist ke<strong>in</strong> bürokratischer Akt: e<strong>in</strong>mal vollzogen <strong>und</strong> damiterledigt. Bologna ist e<strong>in</strong> Prozess.Sichtwort: Erfolgsbeobachtung; kritische erste Beobachtungen zuStu<strong>die</strong>ndauer <strong>und</strong> Abbrecherquoten, erste Erfahrungen für Lernprozessnutzen (implizit, aber nicht explizit ist damit <strong>die</strong> HIS-Stu<strong>die</strong><strong>an</strong>gesprochen)4. Berufsbefähigung <strong>und</strong> Akzept<strong>an</strong>z auf Seiten der Arbeitgeber ist e<strong>in</strong>erfolgskritischer Punkt im Bologna-Prozess.Stichwort: für mehr Tr<strong>an</strong>sparenz im Ausbildungssystem, aber gegenInflation der akademischen Abschlüsse; <strong>Bachelor</strong> Professional wederfür Absolventen noch Arbeitgeber auf l<strong>an</strong>ge Sicht hilfreich (wirdimplizit, aber nicht explizit <strong>an</strong>gesprochen)5. Die Politik hat <strong>die</strong> Aufgabe, <strong>die</strong> Bed<strong>in</strong>gungen dafür zu schaffen, dass<strong>die</strong> Hochschulen <strong>die</strong> große Herausforderung „neue <strong>Lehre</strong>“ meisternkönnenStichworte: leistungsorientierte Mittelvergabe, Stu<strong>die</strong>nbeiträge,HochschulpaktMüller
12Ich freue mich sehr darüber, dass <strong>die</strong>se Tagung <strong>die</strong> neuen <strong>Anforderungen</strong><strong>an</strong> <strong>die</strong> <strong>Lehre</strong> im Zuge des Bologna-Prozesses <strong>in</strong>s Zentrum stellt. Ich denke,wir dürfen uns viel von <strong>die</strong>ser Diskussion erwarten, zumal sie nicht re<strong>in</strong><strong>in</strong>nerdeutsch <strong>und</strong> <strong>in</strong>nerwissenschaftlich geführt wird, sondern Vertreter derUnternehmen e<strong>in</strong>bezogen s<strong>in</strong>d. Und Sie den Blick auch über den deutschenTellerr<strong>an</strong>d h<strong>in</strong>aus auf <strong>die</strong> Erfahrungen <strong>in</strong> <strong>an</strong>deren Ländern richten.Gerne nutze ich <strong>die</strong> Gelegenheit, Ihnen zu Beg<strong>in</strong>n der Tagung e<strong>in</strong>igewenige Punkte vorzustellen, <strong>die</strong> aus me<strong>in</strong>er Sicht im Kontext IhresTagungsthemas wichtig s<strong>in</strong>d.Sie werden mir sicher gestatten, dass ich dabei kurz auf <strong>die</strong> Erfahrungen <strong>in</strong>Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen rekurriere.In Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen waren zum W<strong>in</strong>tersemester 2007/2008 bis aufwenige Ausnahmen alle traditionellen Diplom- <strong>und</strong> Magisterstu<strong>die</strong>ngängeauf gestufte <strong>Bachelor</strong>- <strong>und</strong> <strong>Master</strong>abschlüsse umgestellt; das s<strong>in</strong>d derzeit<strong>in</strong> NRW etwa 80 Prozent aller Stu<strong>die</strong>ngänge. Auch fürStaatsexamensstu<strong>die</strong>ngänge ist e<strong>in</strong>e Umstellung <strong>in</strong> Vorbereitung. Wirarbeiten etwa bereits <strong>an</strong> der Reform der <strong>Lehre</strong>rausbildung. Nicht alsSelbstzweck. Sondern weil wir den Bologna-Prozess als Ch<strong>an</strong>ce sehen, unsals Vorreiter für e<strong>in</strong>e moderne <strong>Lehre</strong>rausbildung <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d zupositionieren. Auch <strong>die</strong> Reform der Juristenausbildung wollen wirvor<strong>an</strong>treiben.All <strong>die</strong>s <strong>in</strong> der Überzeugung:Der Bologna-Prozess ist <strong>die</strong> strukturelle Reform der akademischenAusbildung, <strong>die</strong> wir dr<strong>in</strong>gend brauchen.Das ist me<strong>in</strong> erster Punkt.• Wir brauchen heute e<strong>in</strong>e Ausbildungs-Struktur, <strong>die</strong> es ermöglicht,mehr junge Leute für das Leben <strong>und</strong> Arbeiten <strong>in</strong> der globalenWissensgesellschaft akademisch zu qualifizieren.• E<strong>in</strong>e Struktur, <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>renden mit unterschiedlichen Zielenerlaubt, ihre Lern- <strong>und</strong> Lebenswege flexibel zu gestalten.Die <strong>Bachelor</strong>- <strong>und</strong> <strong>Master</strong>struktur ist <strong>die</strong> Antwort auf <strong>die</strong>se <strong>Anforderungen</strong>.Grußworte: Prof. Dr. Andreas P<strong>in</strong>kwart 13Me<strong>in</strong> zweiter Punkt:Die Umstellung auf <strong>Bachelor</strong> <strong>und</strong> <strong>Master</strong> muss zugleich e<strong>in</strong>e Reformder Inhalte se<strong>in</strong>.Ankerpunkte für <strong>die</strong> Gestaltung der Stu<strong>die</strong>ngänge s<strong>in</strong>d dabei aus gutemGr<strong>und</strong> nicht mehr e<strong>in</strong>zelne Fach<strong>in</strong>halte <strong>und</strong> Diszipl<strong>in</strong>strukturen, sondernKompetenzen <strong>und</strong> Qualifikationsziele, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Beschäftigungsfähigkeit derAbsolvent<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Absolventen gar<strong>an</strong>tieren.Im Zentrum steht nicht mehr <strong>die</strong> Frage: Was soll der Nachwuchs lernen?Sondern: Was soll der Nachwuchs am Ende des Studiums können?Das ist nach me<strong>in</strong>er Überzeugung der richtige Weg.Wir reden hier nicht von Kle<strong>in</strong>igkeiten. Das ist mir durchaus bewusst. ImZweifel genügt e<strong>in</strong> Blick <strong>in</strong> Ihr Tagungsprogramm, um das zu erkennen.Ich b<strong>in</strong> aber überzeugt, <strong>die</strong> Mühe lohnt. Denn wenn <strong>die</strong> <strong>in</strong>haltlicheWeiterentwicklung der akademischen Ausbildung gel<strong>in</strong>gt:• D<strong>an</strong>n wird unser System effizienter <strong>und</strong> damit wettbewerbsfähiger.• D<strong>an</strong>n wird sich der Bologna-Prozess auf Dauer als e<strong>in</strong> schlagkräftigesInstrument gegen l<strong>an</strong>ge Stu<strong>die</strong>nzeiten <strong>und</strong> hohe Abbrecherquotenerweisen.• D<strong>an</strong>n werden mehr Absolventen früher <strong>und</strong> besser qualifiziert <strong>in</strong> <strong>die</strong>Berufspraxis gehen können.Me<strong>in</strong> dritter Punkt. Bologna ist ke<strong>in</strong> bürokratischer Akt: e<strong>in</strong>malvollzogen <strong>und</strong> damit erledigt. Bologna ist e<strong>in</strong> Prozess.Der ist mit der Umstellung auf <strong>die</strong> neue Abschlussstruktur nichtabgeschlossen.Erfolgreich werden am Ende <strong>die</strong>jenigen se<strong>in</strong>, <strong>die</strong> Bologna als Lernprozessgestalten. Wir sollten also im Auge behalten, dass Bil<strong>an</strong>zen derzeit äußerstvorläufig s<strong>in</strong>d.Ich will damit kritische Beobachtungen <strong>in</strong> der ersten Reformphase nichtvom Tisch wischen.
14Es ist aus me<strong>in</strong>er Sicht sehr wichtig, von Anf<strong>an</strong>g <strong>an</strong> im Auge zu behalten:Wie entwickeln sich <strong>die</strong> Abbrecherquoten <strong>und</strong> <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>nzeiten <strong>in</strong> derneuen Struktur?Es hilft aber wenig, aus ersten Erfahrungen Pauschalurteile abzuleiten.Vielmehr sollten wir erste Erfahrungen austauschen,um über Fächer-, L<strong>an</strong>des- <strong>und</strong> Institutionengrenzen h<strong>in</strong>weg von BestPractice zu lernen <strong>und</strong> immer besser zu werden.Viertens: Berufsbefähigung <strong>und</strong> Akzept<strong>an</strong>z auf Seiten derArbeitgeber ist e<strong>in</strong> erfolgskritischer Punkt im Bologna-Prozess.Die Akzept<strong>an</strong>z von <strong>Bachelor</strong>/<strong>Master</strong> wird <strong>in</strong> dem Maße weiter steigen, <strong>in</strong>dem <strong>die</strong> Tr<strong>an</strong>sparenz über <strong>die</strong> unterschiedlichen Ausbildungen imeuropäischen Bildungsraum größer wird, für <strong>die</strong> akademische wie für <strong>die</strong>berufliche Bildung.Dazu gehört auch e<strong>in</strong>e Klarheit <strong>in</strong> den Abschlüssen. Die Länder haben <strong>in</strong>der Kultusm<strong>in</strong>isterkonferenz immer wieder <strong>die</strong> Haltung aller maßgeblichenHochschulverbände bekräftigt, dass Hochschulabschlüsse ausschließlichvon Hochschulen sowie für e<strong>in</strong> Hochschulstudium vergeben werden.Selbstverständlich müssen hochqualifizierte Menschen <strong>die</strong> Möglichkeithaben zu stu<strong>die</strong>ren. Dies gilt auch für besonders begabteStu<strong>die</strong>n<strong>in</strong>teressierte aus der Berufspraxis, <strong>die</strong> ke<strong>in</strong> Abitur haben.Niem<strong>an</strong>d ist allerd<strong>in</strong>gs mit Etikettierungen geholfen, <strong>die</strong> e<strong>in</strong>enHochschulabschluss suggerieren, wo ke<strong>in</strong>er ist.Solche Etiketten schaden auf Dauer dem Vertrauen <strong>in</strong> <strong>die</strong> Qualität derAusbildung <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d, der beruflichen wie der akademischen.Sie nützen also weder den Absolventen, noch den Arbeitgebern.Und führen im G<strong>an</strong>zen eher zu e<strong>in</strong>er Qualifikationsnivellierung als zurWertschätzung der jeweiligen Qualifikation <strong>in</strong> ihrer <strong>in</strong>dividuellenBesonderheit <strong>und</strong> Stärke.Grußworte: Prof. Dr. Andreas P<strong>in</strong>kwart 15Me<strong>in</strong> fünfter Punkt: Die Politik hat <strong>die</strong> Aufgabe, <strong>die</strong> Bed<strong>in</strong>gungendafür zu schaffen, dass <strong>die</strong> Hochschulen <strong>die</strong> große Herausforderung„neue <strong>Lehre</strong>“ meistern können.Ich möchte jetzt nicht aufzählen, was wir <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen für <strong>die</strong>Qualität der <strong>Lehre</strong> tun. Etwa <strong>in</strong>dem ich Ihnen von der leistungsorientiertenMittelvergabe <strong>in</strong> NRW berichte, <strong>die</strong> <strong>die</strong>jenigen Hochschulen belohnt, <strong>die</strong>viele Stu<strong>die</strong>rende <strong>in</strong> der Regelstu<strong>die</strong>nzeit zum erfolgreichen Abschlussbr<strong>in</strong>gen.Oder <strong>in</strong>dem ich Ihnen unser Modell für Stu<strong>die</strong>nbeiträge vorstelle, das denHochschulen ermöglicht, erhebliche zusätzliche Mittel <strong>in</strong> bessereStu<strong>die</strong>nbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> <strong>Lehre</strong> zu <strong>in</strong>vestieren.Ich möchte nur noch e<strong>in</strong>en Punkt <strong>an</strong>sprechen, der B<strong>und</strong> <strong>und</strong> Ländergeme<strong>in</strong>sam betrifft, <strong>die</strong> große Herausforderung <strong>an</strong> unser akademischesAusbildungssystem, <strong>die</strong> sie nur geme<strong>in</strong>sam erfolgreich <strong>an</strong>gehen können:<strong>die</strong> absehbar steigende Nachfrage nach Hochschulausbildung <strong>in</strong> denkommenden Jahren.Es werden mehr junge Leute mit Hochschulreife <strong>die</strong> Schulen verlassen.Zudem verl<strong>an</strong>gt <strong>die</strong> neue Stu<strong>die</strong>nstruktur e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>tensivere Betreuung derStu<strong>die</strong>renden.Unser Interesse <strong>in</strong> <strong>die</strong>ser Situation muss es se<strong>in</strong>, jedem Interessenten e<strong>in</strong>enhochwertigen Stu<strong>die</strong>nplatz <strong>an</strong>bieten zu können.In den kommenden Jahren haben wir <strong>die</strong> Ch<strong>an</strong>ce, unsere zu niedrigeAkademiker-Quote zu erhöhen. Mit dem Hochschulpakt von B<strong>und</strong> <strong>und</strong>Ländern s<strong>in</strong>d <strong>die</strong> ersten Schritte <strong>in</strong> <strong>die</strong>se Richtung gemacht.In der zweiten R<strong>und</strong>e des Pakts s<strong>in</strong>d aber noch weitere Anstrengungennötig. Wir sollten alles dar<strong>an</strong> setzen, ihn noch <strong>in</strong> <strong>die</strong>sem Jahr unter Dach<strong>und</strong> Fach zu br<strong>in</strong>gen.Die bisher für <strong>die</strong> zweite Tr<strong>an</strong>che des Hochschulpaktes avisierten 3Milliarden Euro werden nach me<strong>in</strong>er Überzeugung allerd<strong>in</strong>gs bei weitemnicht reichen.Darüber müssen wir <strong>in</strong> den kommenden Monaten sprechen.Ich möchte mit <strong>die</strong>sem letzten Punkt unterstreichen, dass es hier um e<strong>in</strong>eder großen Aufgaben <strong>an</strong> unser Wissenschaftssystem geht.Um e<strong>in</strong>en Kraftakt für alle Beteiligten.
16Aber e<strong>in</strong>en, der wichtig ist <strong>und</strong> sich lohnt.Ich wünsche Ihnen <strong>in</strong> <strong>die</strong>sem S<strong>in</strong>ne lebhafte Diskussionen <strong>und</strong> fruchtbarenGed<strong>an</strong>kenaustausch.Vielen D<strong>an</strong>k.Grußworte: M<strong>in</strong>isterialdirigent Peter Greisler 17M<strong>in</strong>isterialdirigent Peter GreislerB<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Bildung <strong>und</strong> ForschungDas Thema <strong>die</strong>ser Jahrestagung, <strong>die</strong> <strong>Lehre</strong> <strong>an</strong> den Hochschulen, steht seitkurzem im Zentrum der hochschulpolitischen Diskussion. Dies hat zume<strong>in</strong>en mit der <strong>an</strong> Dr<strong>in</strong>glichkeit deutlich zugenommenen politischen Debatteum e<strong>in</strong>en drohenden Fachkräftem<strong>an</strong>gel zu tun bei immer noch wachsenderErkenntnis, dass unsere wirtschaftliche Zukunft vornehmlich <strong>in</strong> derProduktion von wissens- bzw. FuE-<strong>in</strong>tensiven Produkten <strong>und</strong>Dienstleistungen liegt.Zum <strong>an</strong>deren wird dabei <strong>die</strong> Sorge zum Ausdruck gebracht, dass <strong>die</strong>Exzellenz<strong>in</strong>itiative, <strong>die</strong> auf <strong>die</strong> Stärkung der Forschung <strong>an</strong> Hochschulenausgerichtet ist <strong>und</strong> dort auch hohe Wellen geschlagen hat, e<strong>in</strong>eVernachlässigung der Hochschullehre zur Folge hat. E<strong>in</strong>e Vernachlässigungsowohl mit Blick auf <strong>die</strong> Aufmerksamkeit, <strong>die</strong> <strong>an</strong> den Hochschulen der<strong>Lehre</strong> gewidmet wird, als auch mit Blick auf <strong>die</strong> F<strong>in</strong><strong>an</strong>zausstattung derHochschulen im Lehrbereich. Ich verstehe <strong>die</strong> Sorge, wir sollten uns aberhüten e<strong>in</strong>s gegen das <strong>an</strong>dere auszuspielen. Die Exzellenz<strong>in</strong>itiative warrichtig für <strong>die</strong> Forschung, für Strukturen <strong>und</strong> zum Teil auch für <strong>die</strong> <strong>Lehre</strong>,da <strong>die</strong> Universitäten wissen, dass sie ohne gute <strong>Lehre</strong> nicht exzellent <strong>in</strong> derForschung se<strong>in</strong> können. Wenn wir <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d jetzt mehr für <strong>die</strong> <strong>Lehre</strong> -auch <strong>in</strong> der Breite - tun wollen, d<strong>an</strong>n sollten wir das tun, aber nicht aufKosten der Exzellenz<strong>in</strong>itiative, <strong>die</strong> wir nachhaltig fortführen wollen.E<strong>in</strong> dritter Zusammenh<strong>an</strong>g besteht mit dem im letzten Jahr zwischen B<strong>und</strong><strong>und</strong> Ländern vere<strong>in</strong>barten Hochschulpakt. Der B<strong>und</strong> verpflichtet sich dar<strong>in</strong><strong>an</strong>gesichts des vor uns liegenden Stu<strong>die</strong>rendenbergs, e<strong>in</strong>en wesentlichenf<strong>in</strong><strong>an</strong>ziellen Beitrag zur Bereitstellung zusätzlicher Stu<strong>die</strong>nkapazitäten zuleisten: Alle<strong>in</strong> bis 2010 wird er 565 Mio € für <strong>die</strong> Aufnahme von 90.000zusätzlichen Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängern <strong>und</strong> -<strong>an</strong>fänger<strong>in</strong>nen zur Verfügung stellen.Vor dem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> des steigenden Fachkräftebedarfs ist <strong>die</strong>s aus me<strong>in</strong>erSicht e<strong>in</strong>e g<strong>an</strong>z wichtige Vere<strong>in</strong>barung <strong>und</strong> auch e<strong>in</strong> wichtiges Signal mitBlick auf <strong>die</strong> allgeme<strong>in</strong>politische Diskussion um <strong>die</strong> Bedeutung derHochschulen für <strong>die</strong> Berufsausbildung <strong>und</strong> für den Erhalt unserer<strong>in</strong>ternationalen Wettbewerbsfähigkeit.
18Aber der Hochschulpakt ist vornehmlich qu<strong>an</strong>titativ ausgerichtet. Erthematisiert nicht eventuelle Mängel <strong>in</strong> der Qualität derHochschulausbildung.Indizien für verbesserungswürdige Zustände <strong>in</strong> der Hochschullehre gibt esviele, nicht zuletzt <strong>die</strong> traditionell l<strong>an</strong>gen Stu<strong>die</strong>nzeiten, <strong>die</strong> e<strong>in</strong>e Ursachefür <strong>die</strong> niedrige Stu<strong>die</strong>rneigung <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d ist. Und auch wenn imDurchschnitt der Anteil der Stu<strong>die</strong>nabbrecher nicht über dem OECD-Durchschnitt liegt, wissen wir doch, dass bessere Betreuungs- <strong>und</strong>Beratungsverhältnisse <strong>die</strong> Zahl der Stu<strong>die</strong>nabbrecher verr<strong>in</strong>gern könnte,was mit Blick auf e<strong>in</strong>e Erhöhung der im <strong>in</strong>ternationalen Vergleich niedrigenAbsolventenquote auch notwendig wäre. E<strong>in</strong>er neuen Stu<strong>die</strong> zufolge liegtDeutschl<strong>an</strong>d bei den Beschäftigten mit Stu<strong>die</strong>nabschluss auf Platz 10 e<strong>in</strong>erVergleichsgruppe aus 15 EU-Staaten <strong>und</strong> ist seit dem Jahr 2000 im<strong>in</strong>nereuropäischen Bildungswettbewerb zurückgefallen: Der Anteil derAkademiker unter den Berufstätigen stieg nur um e<strong>in</strong>en Prozentpunkt auf28 Prozent, während Länder wie Großbrit<strong>an</strong>nien, Sp<strong>an</strong>ien <strong>und</strong> <strong>die</strong>Niederl<strong>an</strong>de um bis zu sechs Prozentpunkte zulegten <strong>und</strong> auf e<strong>in</strong>e Quotevon 34 Prozent kommen. Der Spitzenreiter F<strong>in</strong>nl<strong>an</strong>d hat sogar e<strong>in</strong>enAkademiker<strong>an</strong>teil von fast 40 Prozent. Und Besserung ist nicht <strong>in</strong> Sicht:Aktuellen Umfragen zufolge strebt derzeit nur e<strong>in</strong> Fünftel der deutschen15-Jährigen e<strong>in</strong> Hochschulstudium <strong>an</strong>.Das hat natürlich auch etwas mit unserem leistungsstarken dualenAusbildungssystem zu tun. Hier kommt aber auch e<strong>in</strong> Imageproblem derHochschulen zum Ausdruck, <strong>in</strong>sbesondere mit Blick auf <strong>die</strong> Rekrutierungvon Stu<strong>die</strong>renden aus bildungsfernen Schichten: Ich wünsche mirm<strong>an</strong>chmal, dass <strong>in</strong> öffentlichen Diskussionen um <strong>die</strong> deutschenHochschulen nicht soviel über Mängel, über Stu<strong>die</strong>nabbruch <strong>und</strong>Missbrauch von Hochschulabsolventen als Praktik<strong>an</strong>ten, sondern mehrüber <strong>die</strong> überdurchschnittlichen Ver<strong>die</strong>nstmöglichkeiten <strong>und</strong> über derenüberdurchschnittlich gute Arbeitsmarktch<strong>an</strong>cen gesprochen wird. Wasschadet, ist e<strong>in</strong>e Debatte über Mängel ohne Lösungsperspektive. Wer <strong>die</strong>Segnungen der höheren Bildung nicht <strong>in</strong> der Familie kennen gelernt hat,lässt sich von dem Gejammer über <strong>an</strong>geblich schlechte Ch<strong>an</strong>cen fürAkademiker abschrecken. Wir müssen <strong>die</strong> zu Tage tretenden Probleme derAttraktivität der akademischen Ausbildung <strong>an</strong>gehen.Grußworte: M<strong>in</strong>isterialdirigent Peter Greisler 19Zu den immer wieder gen<strong>an</strong>nten Problemen bei der <strong>Lehre</strong> zählen <strong>die</strong>schlechten Betreuungsrelationen, <strong>die</strong> fehlenden Maßstäbe zurLeistungsmessung <strong>und</strong> generell <strong>die</strong> Probleme <strong>in</strong> der Qualitätssicherung.Im Bereich der <strong>Lehre</strong> funktioniert <strong>die</strong> Masch<strong>in</strong>e Hochschule nicht optimal.Nicht zu vergessen s<strong>in</strong>d auch <strong>die</strong> mit der Umstellung der Stu<strong>die</strong>nstrukturim Zuge der Bologna-Reform auftretenden Fragen, <strong>die</strong> längst noch nichtalle gelöst s<strong>in</strong>d. Insgesamt zeigt sich immer wieder, dass <strong>die</strong> Reputationder <strong>Lehre</strong> bei den meisten <strong>Lehre</strong>nden bedauerlicherweise niedrig ist –deutlich niedriger als <strong>die</strong> der Forschung. Wenn schon frisch berufeneHochschullehrer als erstes über e<strong>in</strong>e zu hohe Lehrbelastung klagen, sagt<strong>die</strong>s auch etwas über den Stellenwert der <strong>Lehre</strong> <strong>in</strong> deren Selbstverständnisaus.Es fehlt aber gleichermaßen <strong>an</strong> Reputationsmöglichkeiten. Die <strong>in</strong> denletzten Jahren von vielen Hochschulen vergebenen Lehrpreise – <strong>und</strong>natürlich auch der von HRK <strong>und</strong> Stifterverb<strong>an</strong>d etablierte ars-legendi-Preisfür exzellente Hochschullehre - oder der mit 250 T€ hoch dotierteExzellenz-<strong>in</strong>-der-<strong>Lehre</strong>-Preis des hessischen L<strong>an</strong>deswissenschaftsm<strong>in</strong>isteriumss<strong>in</strong>d hier g<strong>an</strong>z wichtige erste Maßnahmen, <strong>die</strong>sesReputationsdefizit zu überw<strong>in</strong>den.H<strong>in</strong>ter der <strong>in</strong> der letzten Zeit verschiedentlich erhobenen Forderung nache<strong>in</strong>er Exzellenz<strong>in</strong>itiative für <strong>die</strong> <strong>Lehre</strong> stecken - bei aller Unterschiedlichkeit<strong>in</strong> der jeweiligen Vorstellungen zur konkreten Ausgestaltung - folgendebedenkenswerte <strong>und</strong> e<strong>in</strong>heitliche Aussagen:• Die Zustände <strong>in</strong> der Hochschullehre s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Breite dr<strong>in</strong>gendverbesserungsbedürftig.• Hochschullehre <strong>und</strong> Hochschulforschung s<strong>in</strong>d gleichr<strong>an</strong>gig zubetrachten.• Zur Verbesserung der Zustände <strong>in</strong> der Hochschullehre bedarf eszusätzlicher F<strong>in</strong><strong>an</strong>zmittel.Die vom Wissenschaftsrat für Mai <strong>an</strong>gekündigten „Empfehlungen zurStärkung der Qualität von Studium <strong>und</strong> <strong>Lehre</strong>“ werden hier aus me<strong>in</strong>erSicht e<strong>in</strong>e gute Basis für weitere politische Diskussionen darstellen.
20Grußworte: M<strong>in</strong>isterialdirigent Peter Greisler 21Der kürzlich von Kultusm<strong>in</strong>isterkonferenz geme<strong>in</strong>sam mit demStifterverb<strong>an</strong>d für <strong>die</strong> deutsche Wissenschaft <strong>in</strong>s Leben gerufeneWettbewerb zur Auszeichnung <strong>und</strong> Förderung von exzellenter <strong>Lehre</strong> <strong>an</strong>deutschen Hochschulen ist - neben den bereits erwähnten Lehrpreisen - e<strong>in</strong>weiterer Schritt der Aufwertung <strong>und</strong> der Verbesserung der Qualität derHochschullehre. Dabei sollen hervorragende Konzepte von Hochschulenzur Strategieentwicklung <strong>in</strong> <strong>Lehre</strong> <strong>und</strong> Studium mit e<strong>in</strong>em Preisgeld von biszu e<strong>in</strong>er Million Euro ausgezeichnet werden.Der Wirkungsgrad <strong>die</strong>ser Maßnahme wird g<strong>an</strong>z entscheidend davonabhängen, dass sich möglichst viele Hochschulen dar<strong>an</strong> beteiligen <strong>und</strong>dass <strong>die</strong> d<strong>an</strong>n im Ergebnis gekürten best practice-Ansätze von vielenHochschulen übernommen werden.Aber e<strong>in</strong>s ist auch klar: Wenn e<strong>in</strong> Gr<strong>und</strong>problem der deutschenHochschullehre dar<strong>in</strong> besteht, dass <strong>die</strong>se <strong>in</strong> nennenswertem Umf<strong>an</strong>g <strong>und</strong>im <strong>in</strong>ternationalen Vergleich unterf<strong>in</strong><strong>an</strong>ziert ist, werden durch best practiceAnsätze zur Org<strong>an</strong>isation des Lehrbetriebs erzielte Effizienzgew<strong>in</strong>ne alle<strong>in</strong>nicht ausreichen, <strong>die</strong> Qualität der Hochschullehre nachhaltig zu verbessern.Insgesamt b<strong>in</strong> ich überzeugt, dass es nur e<strong>in</strong> Maßnahmenbündel -bestehend aus qualitativ sowie qu<strong>an</strong>titativ ausgerichteten Maßnahmen -se<strong>in</strong> k<strong>an</strong>n, durch das <strong>die</strong> notwendige signifik<strong>an</strong>te Verbesserung derQualität der Hochschullehre <strong>in</strong> der Breite der Hochschulen erreicht werdenk<strong>an</strong>n.Ich sprach e<strong>in</strong>g<strong>an</strong>gs von der wachsenden Erkenntnis, dass unserewirtschaftliche Zukunft bei den wissens- <strong>und</strong> FuE-<strong>in</strong>tensiven Produkten <strong>und</strong>Dienstleistungen liegt. Auch Bildung selbst ist e<strong>in</strong>e wissens<strong>in</strong>tensiveDienstleistung. Aber zum<strong>in</strong>dest mit Blick auf <strong>die</strong> Hochschullehre - derSchulbereich steht <strong>die</strong>sbezüglich deutlich besser da - ist <strong>die</strong> bestehendeFuE-Basis eher dünn. Wissenschaftlich gesichertes Gestaltungswissen zuden Strukturen <strong>und</strong> Funktionsweisen von Hochschulen, e<strong>in</strong>ewissenschaftliche Beschäftigung mit den Prozessen der Generierung <strong>und</strong>Vermittlung von wissenschaftlichem Wissen, se<strong>in</strong>enErfolgsvoraussetzungen <strong>und</strong> Wirkungszusammenhängen ist bisl<strong>an</strong>g eherrar.Unter dem Dach des neuen BMBF-Rahmenprogramms „EmpirischeBildungsforschung“ wurde deshalb auch e<strong>in</strong> spezieller Förderschwerpunkt“Hochschulforschung“ (im S<strong>in</strong>ne von Forschung über Hochschulen)etabliert. Im Mittelpunkt des Ende letzten Jahres veröffentlichten erstenFörder-Calls steht <strong>die</strong> Hochschullehre. Das BMBF wird im Laufe <strong>die</strong>sesJahres entsprechende FuE-Projekte im Umf<strong>an</strong>g von ca. 12-15 Mio. €starten. In Absprache mit den Ländern wird <strong>die</strong> nächsteFörderbek<strong>an</strong>ntmachung das Thema Leistungsmessung <strong>in</strong> Forschung <strong>und</strong><strong>Lehre</strong> aufgreifen.Mit <strong>die</strong>sem ersten Call wollen wir aus der Forschung heraus e<strong>in</strong>en Beitragzur Professionalisierung der <strong>Lehre</strong> leisten. Uns wurden <strong>in</strong>sgesamt ca. 170Projektvorschläge übermittelt. Alle „gängigen“ Themen – Berufsfähigkeit,soft skills, Überg<strong>an</strong>gsgestaltung, Praxisorientierung <strong>und</strong> Genderfragen -s<strong>in</strong>d vertreten, zum Teil mit orig<strong>in</strong>ellen <strong>und</strong> <strong>in</strong>novativen FuE-Ansätzen.Darüber h<strong>in</strong>aus werden aber auch weniger übliche Themenbereiche wieProkrast<strong>in</strong>ation (Verschleppungstaktik, auch Bummelstudium),Professionalisierung der Stu<strong>die</strong>renden für <strong>die</strong> Bewertung der <strong>Lehre</strong> oderorg<strong>an</strong>isatorisch-strukturelle Vorkehrungen gegen Fehlverhalten vonStu<strong>die</strong>renden <strong>und</strong> <strong>Lehre</strong>nden beh<strong>an</strong>delt.Das Auswahlverfahren wird im Frühsommer abgeschlossen se<strong>in</strong>.E<strong>in</strong>en weiteren Beitrag zur Diskussion um <strong>die</strong> Verbesserung der <strong>Lehre</strong> wirdsicherlich auch <strong>die</strong> HRK leisten können, <strong>die</strong> mit dem Bologna-Zentrum <strong>und</strong>dem Projekt Qualitätssicherung bereits seit Jahren im Zentrum <strong>die</strong>serFragen tätig ist.Ihre Diskussionen heute <strong>und</strong> morgen werden sich gleichermaßen mitzentralen Themen der Hochschullehre, Qualifikationsrahmen <strong>und</strong>Employability beschäftigen. Ich wünsche Ihnen dafür – auch im Namenvon Frau B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>ister<strong>in</strong> Dr. Schav<strong>an</strong> – <strong>an</strong>regende Vorträge <strong>und</strong><strong>in</strong>spirierende Gespräche.Vielen D<strong>an</strong>k !
22 Grußworte: Prof. Dr. Wilfried Müller 23Prof. Dr. Wilfried MüllerVizepräsident der HRK, Universität Bremen2008 blicken wir auf neun Jahre e<strong>in</strong>es Reformprozesses zurück, derbeispiellos ist. Die Bologna-Erklärung von 1999 macht außer dergr<strong>und</strong>sätzlichen Festlegung, dass nach e<strong>in</strong>em ersten berufsqualifizierendenAbschluss e<strong>in</strong> zweiter <strong>und</strong> d<strong>an</strong>n <strong>die</strong> Promotion folgen können, ke<strong>in</strong>eweiteren Vorgaben zu Stu<strong>die</strong>ndauern oder zur Struktur vonBildungssystemen <strong>und</strong> Namen von Abschlüssen. Alle weiterenStrukturvorgaben <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d s<strong>in</strong>d von der nationalen Politik, also vonB<strong>und</strong> <strong>und</strong> Ländern, beschlossen worden. Das Chiffre „Bologna“entwickelte sich aber <strong>in</strong> Zusammenarbeit mit den gesellschaftlichen„Stakeholdern“, also den dar<strong>an</strong> beteiligten Hochschulen, Stu<strong>die</strong>renden,Arbeitgebern <strong>und</strong> Arbeitnehmervertretern, zu e<strong>in</strong>er umfassendenModernisierung aller Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>gebote <strong>und</strong> steht für <strong>in</strong>ternationalverständliche Stu<strong>die</strong>nabschlüsse. Die deutschen Hochschulen haben <strong>die</strong>Stu<strong>die</strong>nreform im Bologna-Prozess von Anf<strong>an</strong>g <strong>an</strong> als strategischenSchwerpunkt ihrer Neuausrichtung <strong>an</strong>genommen. Sie haben sich <strong>die</strong> Zieledes Prozesses zu eigen gemacht <strong>und</strong> begreifen sie als Ch<strong>an</strong>ce sowohl zurInternationalisierung des Studiums <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em geme<strong>in</strong>samen EuropäischenHochschulraum als auch zur Umsetzung von notwendigen Reformzielen,<strong>die</strong> im nationalen Rahmen schon l<strong>an</strong>ge diskutiert wurden. Aus e<strong>in</strong>erReform zur Erhöhung der <strong>in</strong>ternationalen Mobilität hat sich <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>de<strong>in</strong>e gr<strong>und</strong>legende E<strong>in</strong>sicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e umfassende Reform von Studium <strong>und</strong><strong>Lehre</strong> durchgesetzt, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Qualität der Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>gebote tief greifendverbessern wird.Was wurde bisher erreicht? Die deutschen Hochschulen s<strong>in</strong>d engagiertdabei, auf <strong>die</strong> neuen gestuften Stu<strong>die</strong>ngänge umzustellen. Nach denneuesten statistischen Daten der Hochschulrektorenkonferenz bieten <strong>die</strong>deutschen Hochschulen im laufenden Sommersemester über 7.600<strong>Bachelor</strong>- <strong>und</strong> <strong>Master</strong>stu<strong>die</strong>ngänge <strong>an</strong>. Mittlerweile s<strong>in</strong>d also fast 70Prozent aller Stu<strong>die</strong>ngänge <strong>an</strong> deutschen Hochschulen auf Bologna-Kurs.Die Universitäten haben über <strong>die</strong> Hälfte ihres umf<strong>an</strong>greichenGesamtstu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>gebots umgestellt; <strong>an</strong> den Fachhochschulen s<strong>in</strong>d es sogarfast 90 Prozent. Auch bei den Stu<strong>die</strong>renden, <strong>und</strong> allen vor<strong>an</strong> denStu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängern, kommen <strong>die</strong> neuen Stu<strong>die</strong>ngänge gut <strong>an</strong>. Fast jeder
24zweite Stu<strong>die</strong>nstarter setzt auf e<strong>in</strong> <strong>Bachelor</strong>- oder <strong>Master</strong>programm.Tendenz steigend.Wir s<strong>in</strong>d also auf dem richtigen Weg! Aber <strong>die</strong> Bologna-Reform wird nurd<strong>an</strong>n e<strong>in</strong> wirklicher Erfolg, wenn <strong>die</strong> personelle Ausstattung derHochschulen dem gestiegenen Bedarf entspricht. Die neuen Lehrformenstellen den e<strong>in</strong>zelnen Stu<strong>die</strong>renden <strong>in</strong> den Mittelpunkt <strong>und</strong> erfordern e<strong>in</strong>e<strong>in</strong>tensivere Betreuung. Hierfür brauchen wir mehr Personal. Es ist umsodr<strong>in</strong>glicher, dass <strong>die</strong> Politik dazu <strong>die</strong> Mittel bereitstellt, je mehr Stu<strong>die</strong>rende<strong>in</strong> das neue Stu<strong>die</strong>nsystem e<strong>in</strong>treten.„Bologna“ ist auch e<strong>in</strong> Bekenntnis zu e<strong>in</strong>er <strong>an</strong> Lernergebnissen orientiertencurricularen Reform, welche <strong>die</strong> <strong>Lehre</strong> qualitativ verändern wird. DerPerspektivenwechsel h<strong>in</strong> zum Lernenden bzw. Stu<strong>die</strong>renden <strong>und</strong> h<strong>in</strong> zu denim Studium zu erwerbenden Kompetenzen ist e<strong>in</strong> <strong>in</strong>tensiver Prozess, dergerade erst <strong>in</strong> G<strong>an</strong>g kommt. Daher haben wir uns zu <strong>die</strong>ser Ver<strong>an</strong>staltungentschlossen, um mit Ihnen <strong>die</strong> neuen <strong>Anforderungen</strong> <strong>an</strong> <strong>die</strong> <strong>Lehre</strong> zuerörtern.Am ersten Tag widmen wir uns verstärkt der Kompetenzorientierung <strong>und</strong>den Qualifikationsrahmen, der zweite Tag steht im Fokus der„Employability“, e<strong>in</strong>em typischen Schlagwort aus der Bologna-Welt, dasnäherer Konkretisierung bedarf.Die Hochschulen <strong>und</strong> Fachkulturen müssen noch stärker als bisher um <strong>die</strong>Qualität der <strong>Lehre</strong> <strong>in</strong> den umgestellten <strong>Bachelor</strong>- <strong>und</strong> <strong>Master</strong>stu<strong>die</strong>ngängekümmern, <strong>die</strong> untrennbar mit der Qualität der Hochschulabsolventen fürverschiedene Berufsfelder verb<strong>und</strong>en ist.Es ist das besondere Profil des Hochschulstudiums von Beg<strong>in</strong>n <strong>an</strong>wissenschaftsbasiert <strong>und</strong> forschungsorientiert zu se<strong>in</strong>. Das macht eszw<strong>in</strong>gend notwendig, dass den Hochschulabsolventen schon <strong>in</strong> der<strong>Bachelor</strong>stufe, dem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss, <strong>die</strong>notwendigen Methoden- <strong>und</strong> Schlüsselkompetenzen <strong>in</strong>tegrativ vermitteltwerden, aber immer als Ergänzung zu der fachwissenschaftlichenQualifikation. Das wissen spätere Arbeitgeber <strong>an</strong> denHochschulabsolventen sehr zu schätzen. Der Erfolg der Absolventen imBeruf wiederum ist das beste Argument für <strong>die</strong> hohe Wettbewerbsfähigkeitdes St<strong>an</strong>dortes Deutschl<strong>an</strong>d. Deshalb ist e<strong>in</strong>e hohe Qualitätskultur <strong>in</strong>Grußworte: Prof. Dr. Wilfried Müller 25Studium <strong>und</strong> <strong>Lehre</strong>, <strong>die</strong> sich auch um <strong>die</strong> gr<strong>und</strong>sätzlicheBeschäftigungsfähigkeit („employability“) der Hochschulabsolventenkümmert, e<strong>in</strong> so wichtiges Thema: Für <strong>die</strong> Unternehmen, <strong>die</strong> auf e<strong>in</strong>esolide Hochschulbildung ihrer zukünftigen Fach- <strong>und</strong> Führungskräftebauen, für <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>renden, deren Marktwert <strong>und</strong> Karrierech<strong>an</strong>cen imspäteren Beruf von eben jenen Schlüsselkompetenzen mit abhängen, <strong>und</strong>auch für <strong>die</strong> Hochschulen selbst, deren Renommee <strong>in</strong> Zukunft auch von derQualität der geleisteten <strong>Lehre</strong> bestimmt wird. Die vertrauensvolleZusammenarbeit der Hochschulen besonders mit den lokalen <strong>und</strong>regionalen Arbeitgebern ist unbed<strong>in</strong>gt weiter auszubauen, wenn derProzess der <strong>an</strong> Lernergebnissen orientierten Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gsreform Erfolghaben soll. Dazu richten immer mehr Hochschulen eigene Career Centere<strong>in</strong>, <strong>die</strong> sich um Praktika <strong>und</strong> Stellen für ihre Stu<strong>die</strong>renden <strong>und</strong>Absolventen bemühen.Die Sozialpartner haben dabei durchaus e<strong>in</strong>e Verpflichtung, <strong>die</strong> Akzept<strong>an</strong>zvon <strong>Bachelor</strong>- <strong>und</strong> <strong>Master</strong>absolventen zu fördern – im Austausch fürkont<strong>in</strong>uierliche Informationen über <strong>die</strong> Kompetenzentwicklung derHochschulabsolventen. Denn zum Profil e<strong>in</strong>es ersten berufsbefähigendenHochschulabschlusses gehören bereits alle notwendigen Kompetenzen füre<strong>in</strong>en erfolgreichen Berufse<strong>in</strong>stieg. Der Nachweis derKompetenzentwicklung der <strong>Bachelor</strong>-Absolventen wird von denHochschulen durch aussagekräftige Diploma Supplements geleistet.Kompetenzerwerb zeichnet sich aus durch <strong>die</strong> breite wissenschaftlichfun<strong>die</strong>rte Gr<strong>und</strong>ausbildung, <strong>die</strong> Sensibilisierung für Arbeitsmarkt- <strong>und</strong>Praxis<strong>an</strong>forderungen bzw. durch außerfachliche bzw. fachübergreifendeSchlüsselqualifikationen (z. B. durch längere Praktika <strong>in</strong> Unternehmen,Abschlussarbeiten zu praxisrelev<strong>an</strong>ten Themen, betriebswirtschaftlicheKenntnisse im Projektm<strong>an</strong>agement, Ausl<strong>an</strong>ds- <strong>und</strong>Fremdsprachenerfahrung) <strong>und</strong> so gen<strong>an</strong>nter Soft Skills (wieKommunikation, Teamfähigkeit, Flexibilität, Durchsetzungsvermögen)sowie durch <strong>die</strong> akademische Persönlichkeitsbildung (Authentizität,Glaubwürdigkeit, Auftreten). Die wissenschaftliche Qualifikation zeigt sichvor allem <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er bestimmten, theoriegeleiteten Her<strong>an</strong>gehensweise zursystematischen Problemlösung, <strong>die</strong> <strong>in</strong> den Abschlüssen <strong>und</strong>Ausbildungsgängen der beruflichen Bildung der Kammern nicht gegebenist (vgl. Diskussion um den umstrittenen Vorschlag für e<strong>in</strong>en zukünftigen
26„<strong>Bachelor</strong> professional“). Daher entsteht im <strong>Bachelor</strong> der Hochschulenauch ke<strong>in</strong>e Konkurrenz zum dualen System. KompetenteHochschulabsolventen helfen den Unternehmen zudem beim Aufbrechenvon e<strong>in</strong>gefahrenen Denkmustern <strong>und</strong> lieb gewonnenen Gewohnheiten, umsie besser <strong>an</strong> <strong>die</strong> <strong>Anforderungen</strong> e<strong>in</strong>es dynamischen, <strong>in</strong>ternationalenArbeitsmarkts e<strong>in</strong>zustellen. Innovative, nicht-konsekutive <strong>Master</strong>- <strong>und</strong>/oderPromotions<strong>an</strong>gebote der Hochschulen bilden schließlich attraktiveBauste<strong>in</strong>e zur berufsbegleitenden Weiterbildung bzw. -qualifikation, <strong>die</strong>d<strong>an</strong>n auch zu leitenden Aufgaben befähigen können.Die Wirtschaft ist ihrerseits aufgefordert, eigene attraktive Tätigkeitsfelder<strong>und</strong> Entwicklungsperspektiven für <strong>Bachelor</strong>- <strong>und</strong> <strong>Master</strong>-Absolventen<strong>an</strong>zubieten <strong>und</strong> <strong>die</strong> Zusammenarbeit mit den Hochschulen zu <strong>in</strong>tensivieren(z.B. durch Praxistr<strong>an</strong>sfer, Personalaustausch <strong>und</strong> geme<strong>in</strong>sameWeiterbildungs<strong>an</strong>gebote).Qualifikationsrahmen können dabei helfen, <strong>die</strong> Hochschulsystemetr<strong>an</strong>sparenter zu machen. Auf europäischer <strong>und</strong> nationaler sowie auf derEbene der Stu<strong>die</strong>nfächer wird so e<strong>in</strong>e Hierarchie von Qualifikationsniveausbeschrieben, <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>die</strong> e<strong>in</strong>zelnen Abschlüsse e<strong>in</strong>geordnet werden. Auf<strong>die</strong>se Weise wird ihr Verhältnis zue<strong>in</strong><strong>an</strong>der deutlicher. W<strong>und</strong>er darf m<strong>an</strong>von den Qualifikationsrahmen nicht erwarten – e<strong>in</strong>e wichtigeUnterstützung aber schon.Die Qualitätssicherung von Studium <strong>und</strong> <strong>Lehre</strong> ist von zentraler Bedeutungfür das Gel<strong>in</strong>gen der Stu<strong>die</strong>nreform. Denn e<strong>in</strong>e Orientierung <strong>an</strong> rigorosenQualitätskriterien <strong>in</strong> den Hochschulen bestimmt nachhaltig <strong>die</strong> zukünftigeWettbewerbsfähigkeit sowohl der deutschen Hochschulabsolventen <strong>und</strong>der Unternehmen, <strong>in</strong> denen sie tätig werden, als auch der Hochschulen,<strong>die</strong> sie ausbilden. Es s<strong>in</strong>d <strong>die</strong> Hochschulen, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>ngänge gestalten<strong>und</strong> durchführen. Sie führen Instrumente der externen <strong>und</strong> <strong>in</strong>ternenQualitätssicherung e<strong>in</strong>. Ihre Expertise haben sie <strong>in</strong> <strong>die</strong> Forderung derHochschulrektorenkonferenz nach e<strong>in</strong>er neuen „Qualitätsoffensive <strong>in</strong> der<strong>Lehre</strong>“ e<strong>in</strong>gebracht. Sie muss nachhaltig konzipiert se<strong>in</strong>, um <strong>die</strong>gewünschte Breitenwirkung zu erzielen <strong>und</strong> <strong>die</strong> unterschiedlichen Bereichedes Lehrsystems differenziert betrachten zu können. Die Stu<strong>die</strong>rendenprofitieren nur d<strong>an</strong>n dauerhaft von e<strong>in</strong>er höheren Lehrqualität, wenn <strong>die</strong>notwendigen Strukturen zur Qualitätssicherung <strong>und</strong> Weiterentwicklunggeschaffen werden. Anders als <strong>in</strong> der Forschung geht es dabei weniger umGrußworte: Prof. Dr. Wilfried Müller 27Leuchttürme als um <strong>die</strong> Stärkung der <strong>Lehre</strong> im deutschen Hochschulsystem<strong>in</strong>sgesamt, <strong>die</strong> ihm Exzellenz im <strong>in</strong>ternationalen Maßstab sichert. Die Ziele,Strategien <strong>und</strong> Maßnahmen müssen dabei der Unterschiedlichkeit derFachkulturen Rechnung tragen, <strong>und</strong> sie müssen auch <strong>die</strong> <strong>an</strong>grenzendenBereiche wie <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>nberatung oder <strong>die</strong> Career-Services mite<strong>in</strong>beziehen.Neben e<strong>in</strong>er Stärkung von qualitätsfördernden Hochschulstrukturen <strong>und</strong>der Professionalität der <strong>Lehre</strong>nden werden vor allem flexible politische <strong>und</strong>f<strong>in</strong><strong>an</strong>zielle Voraussetzungen für <strong>die</strong> Umsetzung e<strong>in</strong>er qualitativhochwertigen <strong>Lehre</strong> benötigt. Um den Forderungen nach besserenLehrbed<strong>in</strong>gungen mehr Nachdruck verleihen zu können, ist dergeme<strong>in</strong>same Schulterschluss der Hochschulen mit der deutschenWirtschaft, <strong>die</strong> heute Hauptabnehmer der Hochschulabsolventen ist,notwendig.Die Kompetenzorientierung berufsqualifizierender Stu<strong>die</strong>ngänge – zurVermittlung e<strong>in</strong>es ebenso klaren wissenschafts- wie forschungsorientierten<strong>und</strong> persönlichkeitsbildenden Qualitätsprofils der Stu<strong>die</strong>renden – k<strong>an</strong>nallerd<strong>in</strong>gs erst d<strong>an</strong>n flächendeckend umgesetzt werden, wenn <strong>die</strong> Länderfür e<strong>in</strong>e ausreichende F<strong>in</strong><strong>an</strong>zierung der <strong>Lehre</strong> <strong>und</strong> der Betreuungsverhältnissesowie für e<strong>in</strong>en h<strong>in</strong>reichend flexiblen Rechtsrahmen sorgen.Wenn sich <strong>die</strong> Betreuungsverhältnisse zwischen <strong>Lehre</strong>nden <strong>und</strong>Stu<strong>die</strong>renden nachhaltig verbessern sollen, ist e<strong>in</strong>e Reform des Kapazitätsrechtsnötig. Dies liegt auch im ureigensten Interesse der Unternehmen,<strong>die</strong> hochqualifizierte Absolventen dr<strong>in</strong>gend benötigen. H<strong>in</strong>zu kommt <strong>die</strong>E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>es modernisierten Dienst- <strong>und</strong> Tarifrechts, das e<strong>in</strong>eleistungsorientierte Bezahlung <strong>und</strong> flexibilisierte Lehrverpflichtungengestattet. In der modernen Wissenschaftsgesellschaft braucht gute <strong>Lehre</strong>e<strong>in</strong>en ebenso hohen Stellenwert wie gute Forschung. Der Erfolg derStu<strong>die</strong>nreform muss natürlich empirisch rückgekoppelt se<strong>in</strong> durchregelmäßige Stu<strong>die</strong>renden- <strong>und</strong> Absolventenbefragungen <strong>in</strong> derVer<strong>an</strong>twortung der Hochschulen. Die Stu<strong>die</strong>nreform nach dem Bologna-Muster bedeutet Qualitätssteigerung des Studiums.Kompetenzorientierung <strong>und</strong> <strong>die</strong> Vermittlung berufsrelev<strong>an</strong>terQualifikationen gehören zu den wichtigsten Zielen, <strong>die</strong> e<strong>in</strong>e dem Bologna-Format entsprechende Reform des Studiums <strong>an</strong>steuern soll.
28Ich freue mich mit Ihnen auf <strong>in</strong>teress<strong>an</strong>te Diskussionen r<strong>und</strong> um <strong>die</strong>seneuen <strong>Anforderungen</strong> <strong>an</strong> <strong>die</strong> akademische <strong>Lehre</strong> <strong>und</strong> möchte mit e<strong>in</strong>emAusspruch von Goethe schließen:„<strong>Lehre</strong> tut viel, aber Aufmunterung tut alles!“1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 291. Kompetenzorientierung <strong>und</strong>QualifikationsrahmenTeichlerTremp
301.1 Wissenschaftlich kompetent für den Beruf qualifizieren1.1 Wissenschaftlich kompetent für denBeruf qualifizierenProf. Dr. Dr. h.c. Ulrich Teichler, ehem. Internationales Zentrumfür Hochschulforschung, Universität KasselAltes <strong>und</strong> <strong>Neue</strong>s im Bologna-Prozess aus Sicht derHochschulforschungE<strong>in</strong>leitungIn den ersten Jahren des 21sten Jahrh<strong>und</strong>erts herrscht im H<strong>in</strong>blick auf <strong>die</strong>Gestaltung des Hochschulsystems <strong>in</strong> der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschl<strong>an</strong>de<strong>in</strong>e ähnliche „Aufbruchsstimmung“ wie zuvor nur e<strong>in</strong>mal – um 1970. Eswird <strong>die</strong> Ch<strong>an</strong>ce gesehen, den St<strong>an</strong>d der D<strong>in</strong>ge zu bil<strong>an</strong>zieren, vieleTraditionen über Bord zu werfen <strong>und</strong> <strong>Neue</strong>s zu wagen. In <strong>die</strong>ser Situationliegen große Ch<strong>an</strong>cen, aber es gibt auch viele Probleme: IdeologischeTrittbrettfahrer wie unbeirrbare Bedenkenträger äußern sich laut. Es gibt<strong>die</strong> üblichen politisierten Stimmen: Alles Alte war schlecht, alles <strong>Neue</strong> istgut – oder auch umgekehrt. Und es gibt Aufrufe, jeden neuen Schritt nurnach so gründlichen <strong>und</strong> vorsichtigen Abklärungen zu wagen, dass derKairos der Reform verpasst wird.Hier soll der Versuch unternommen werden, gr<strong>und</strong>legende Fragen zurQualifizierung durch den Beruf <strong>an</strong>zusprechen. Was war der St<strong>an</strong>d derVorstellungen von „Bologna“? Was ist neu <strong>an</strong> „Bologna“ – was wurdedurch den Bologna-Prozess <strong>an</strong>gestoßen oder kam gleichzeitig auf <strong>die</strong>Tagesordnung, ohne dass es e<strong>in</strong>deutig dem Bologna-Prozesszuzuschreiben wäre? Was bedeutet dabei <strong>in</strong>sbesondere <strong>die</strong> Diskussionzum schillernden Begriff „Employability“?Die deutsche Diskussion vor dem Bologna-ProzessE<strong>in</strong> heißes ThemaFragen der Wissenschafts- <strong>und</strong> der Berufsorientierung s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> derdeutschen Diskussion seit l<strong>an</strong>gem e<strong>in</strong> „heißes Thema“:• Die humboldtsche „Idee der Universität“ lässt sich <strong>in</strong> <strong>die</strong>sem Kontextals das Postulat beschreiben, dass <strong>die</strong> Reflexion der „Sache“ nichtdurch nur praxisorientierte Erwägungen e<strong>in</strong>geengt werden sollte.1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 31• Der deutsche Staat hat im H<strong>in</strong>blick auf <strong>die</strong> „ Berufsorientierung“ vonStu<strong>die</strong>ngängen e<strong>in</strong> ungewöhnlich starkes „e<strong>in</strong>nehmendes Wesen“: In<strong>die</strong> Rechtwissenschaft, Mediz<strong>in</strong>, <strong>Lehre</strong>rbildung mischt er sichzum<strong>in</strong>dest sichtbarer e<strong>in</strong> als <strong>in</strong> <strong>an</strong>deren Ländern, wie <strong>die</strong> Praxis derStaatsexamen am deutlichsten belegt.• Die Diskussion ist von e<strong>in</strong>er ausgeprägten Wirtschaftsskepsis desKulturbürgertums bee<strong>in</strong>flusst. Die von staatlichen Arbeitgeberngeäußerten Qualifikations<strong>an</strong>forderungen werden als normalh<strong>in</strong>genommen, <strong>die</strong> der privaten Arbeitgeber aber oft als illegitimeE<strong>in</strong>mischung bewertet.• Die Diskussion über <strong>die</strong> Arbeitsmarktsituation vonHochschulabsolventen <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d zeigt: Im Gr<strong>und</strong>e wird erwartet,dass es e<strong>in</strong>e enge Abstimmung zwischen der Menge der Absolventender verschiedenen Fächern <strong>und</strong> den fachlich aff<strong>in</strong>en Stellen<strong>an</strong>gebotengeben müsste. Die früher verbreiteten Klagen über „akademischesProletariat“ <strong>und</strong> „Verdrängungsbewerb“ tauchen <strong>in</strong> neuen Vari<strong>an</strong>ten(z.B. „Taxifahrer Dr. phil.“) immer wieder auf: Obwohl e<strong>in</strong>erseitsweitgehend akzeptiert wird, dass e<strong>in</strong> relativ offener Hochschulzug<strong>an</strong>g<strong>die</strong> Freiheit der Berufswahl unterstreicht, wird <strong>an</strong>dererseits <strong>in</strong>Deutschl<strong>an</strong>d gerne vorwurfsvoll festgestellt, dass <strong>die</strong> Hochschulen <strong>in</strong>m<strong>an</strong>chen Bereichen „zu viele Absolventen produzieren“.• In Deutschl<strong>an</strong>d ist <strong>die</strong> Skepsis gegenüber der Hochschulexp<strong>an</strong>sionnach wie vor weit verbreitet. Zwar gibt es ke<strong>in</strong>e lauten Klagen über„akademisches Proletariat“ <strong>und</strong> „Überqualifikation“ mehr. Aberbedenken wir, dass Deutschl<strong>an</strong>d mit se<strong>in</strong>en ger<strong>in</strong>gen Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fänger-<strong>und</strong> Absolventenquoten weiter entfernt vom OECD-Durchschnitt ist als <strong>in</strong> schlechtesten Zeiten <strong>die</strong> PISA-Testdaten; daszeigt doch, dass wir <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d noch l<strong>an</strong>ge nicht bei e<strong>in</strong>erAkzept<strong>an</strong>z von „Mass higher education“ <strong>an</strong>gekommen s<strong>in</strong>d.Grenzen der „Abstimmung“Für <strong>die</strong> Diskussion zum Verhältnis von Hochschule <strong>und</strong> Beruf ist zwar <strong>die</strong>humboldtsche Idee nicht unerheblich, aber das Gr<strong>und</strong>verständnis von„Beruflichkeit“ ist so stark, dass immer wieder der Wunsch nach e<strong>in</strong>emengen „Match<strong>in</strong>g“ hervorbricht. Die auf der Basis wissenschaftlicherAnalysen e<strong>in</strong>gebrachten Gegenargumente werden regelmäßig „verges-
321.1 Wissenschaftlich kompetent für den Beruf qualifizieren1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 33sen“. Diese seien hier nur <strong>in</strong> Stichworten gen<strong>an</strong>nt: Es gibt e<strong>in</strong>e „objektiveVagheit“ der Qualifikations<strong>an</strong>forderungen; künftige <strong>Anforderungen</strong>lassen sich nur bed<strong>in</strong>gt prognostizieren; das Studium muss im H<strong>in</strong>blickauf den Beruf immer zugleich unterqualifizieren <strong>und</strong> überqualifizieren;unorthodoxe Qualifizierung k<strong>an</strong>n sich als kreativ erweisen; <strong>die</strong> Vielfaltvon Orientierungen der Stu<strong>die</strong>renden <strong>und</strong> Absolventen wird nie e<strong>in</strong>e engeAbstimmung zulassen; Stu<strong>die</strong>rende sollten zugleich kompetent auf <strong>die</strong>vorherrschenden „rules <strong>an</strong>d tools“ der bestehenden Berufstätigkeitenvorbereitet <strong>und</strong> zu „Diplom-Skeptikern“ qualifiziert werden; e<strong>in</strong> Mix ausfachlicher Vorbereitung <strong>und</strong> Flexibilität für den Fall der nicht gel<strong>in</strong>gendenAbstimmung ist unabd<strong>in</strong>gbar.Funktionen der HochschulbildungWenn wir Nu<strong>an</strong>cen für e<strong>in</strong>en Augenblick vernachlässigen, können wire<strong>in</strong>en weitgehenden Konsens darüber feststellen, was <strong>die</strong> Funktionen derHochschulbildung s<strong>in</strong>d• Verstehen <strong>und</strong> ggf. Beherrschen von wissenschaftlichen Theorien,Methoden <strong>und</strong> Stoffen,• kulturelle Bereicherung <strong>und</strong> Förderung derPersönlichkeitsentwicklung,• Vorbereitung auf <strong>die</strong> spätere Berufstätigkeit bzw. auf <strong>an</strong>dereLebensbereiche durch E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> bzw. Vermittlung von den „rules<strong>an</strong>d tools“ <strong>in</strong> der vorf<strong>in</strong>dlichen Praxis <strong>und</strong>• Förderung der Befähigung, <strong>die</strong> bestehende Praxis <strong>in</strong> Frage zu stellen:Skeptisch <strong>und</strong> kritisch zu se<strong>in</strong>, unbestimmte Aufgaben bewältigen zukönnen, zu Innovationen beizutragen.Dimensionen von Wissenschafts- <strong>und</strong> BerufsorientierungWenn wir <strong>die</strong> Diskussion genauer betrachten, wird deutlich, dass nichte<strong>in</strong>fach „Wissenschaftsorientierung“ <strong>und</strong> „Berufsorientierung“gegenübergestellt werden, sondern e<strong>in</strong>e Reihe verschiedener Dimensionwerden <strong>in</strong> <strong>die</strong>sem Kontext <strong>an</strong>gesprochen:• Berufsbereichs- bzw. wissensbereichsbezogene Konfiguration desStu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gs (z.B. Bau<strong>in</strong>genieurwesen vs. Philosophie),• Wissenschaftsbezug bzw. Anwendungsbezug (Betonung desVerstehens der Systemlogik von Wissenschaft gegenüber Betonungdes Tr<strong>an</strong>sfers von systematischem Wissen zur praktischenProblemlösung),• Wissenschaftsorientierung bzw. Praxisorientierung („Pursuit ofknowledge for its own sake“ oder explizite Thematisierung derTheorie-Praxisbeziehungen im Studium),• (Mit-)Vorbereitung auf wissenschaftliche Tätigkeit bzw. auf Verstehen<strong>und</strong> Rezeption von Wissenschaft,• Unterschiedliche Bal<strong>an</strong>cen zwischen Vorbereitung auf Beherrschungvorherrschender „rules“ <strong>und</strong> „tools“ im Beruf <strong>und</strong> Förderung vonSkepsis, Kritik, unbestimmten Berufsaufgaben <strong>und</strong> Innovation,• Unterschiedliche Akzentuierung der Vermittlung von Gr<strong>und</strong>lagen derberuflichen Kompetenzen <strong>und</strong> berufsfertiger Qualifizierung,• Unterschiedlicher Grad der Betonung von generellem Wissen <strong>und</strong>spezifischem (fachlichen bzw. beruflichen) Wissen (nicht automatischgleichzusetzen mit Polyvalenz bzw. Monovalenz des Studiums),• Diszipl<strong>in</strong>arität bzw. Interdiszipl<strong>in</strong>arität,• Konzentration auf <strong>die</strong> „Sache“ bzw. Wirkungsorientierung(Beherrschung des Faches gegenüber „H<strong>an</strong>dlungs“-Kompetenzen“).Universitäten <strong>und</strong> FachhochschulenSeit Beg<strong>in</strong>n der 1970er Jahre ist das deutsche Hochschulwesen durche<strong>in</strong>e Zwei-Typen-Struktur gekennzeichnet, gegenüber der weitereVari<strong>an</strong>ten von untergeordneter Bedeutung s<strong>in</strong>d. Für <strong>die</strong> Zeit vor demBologna-Prozess lassen sich <strong>die</strong> Aufgaben des Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>gebots zwischenden beiden Hochschultypen idealtypisch nach sechs Aspektenunterscheiden:• Universitäten haben wissensbereichs- <strong>und</strong> berufsbereichs-bezogeneKonfigurationen von Stu<strong>die</strong>ngängen, FHs haben ausschließlichberufsbereichsbezogene Stu<strong>die</strong>ngänge,• Wissenschaftsbezug der Stu<strong>die</strong>ngänge <strong>an</strong> Universitäten,Anwendungsbezug <strong>an</strong> FHs,• Nur Universitäten s<strong>in</strong>d für (Mit-)Vorbereitung auf wissenschaftlicheTätigkeit (Wissenschaft als Beruf) zuständig,
341.1 Wissenschaftlich kompetent für den Beruf qualifizieren1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 35• Universitäten betonen graduell stärker Skepsis <strong>und</strong> Unbestimmtes,FHs graduell stärker <strong>die</strong> Beherrschung vorherrschender „rules“ <strong>und</strong>„tools“,• Universitäten betonen eher berufliche Gr<strong>und</strong>legung, FHs eherBerufsvorbereitung,• Universitäten betonen <strong>in</strong> Teilbereichen eher generelles Wissen.Nicht so e<strong>in</strong>deutig s<strong>in</strong>d <strong>die</strong> Unterschiede nach Hochschultyp, (a) wieweit<strong>Lehre</strong>n <strong>und</strong> Lernen auch praxisorientiert zu gestalten ist <strong>und</strong> (b) wieweitdas Studium auf Beherrschen von Theorien, Methoden <strong>und</strong>Wissensstoffen zuführt bzw. auf <strong>die</strong> Entwicklung von „Kompetenzen“.Auch ist bei den Hochschultypen offen, (c) <strong>in</strong> welchem Maße <strong>die</strong>Stu<strong>die</strong>ngänge diszipl<strong>in</strong>är oder <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>är geprägt s<strong>in</strong>d.Das HochschulrahmengesetzDurch das Hochschulrahmengesetz s<strong>in</strong>d alle Hochschulen <strong>und</strong>Fachbereiche <strong>in</strong> <strong>die</strong> Pflicht genommen worden, <strong>die</strong> berufliche Relev<strong>an</strong>zaller Stu<strong>die</strong>ngänge zu reflektieren. Die Formulierungen des HRG:„Die Hochschulen … bereiten auf berufliche Tätigkeiten vor, <strong>die</strong> <strong>die</strong>Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnis <strong>und</strong> wissenschaftlicherMethoden oder <strong>die</strong> Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung erfordern“(§ 2.1).„<strong>Lehre</strong> <strong>und</strong> Studium sollen den Studenten auf e<strong>in</strong> beruflichesTätigkeitsfeld vorbereiten <strong>und</strong> ihm <strong>die</strong> dafür erforderlichen fachlichenKenntnisse, Fähigkeiten <strong>und</strong> Methoden dem jeweiligen Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gentsprechend so vermitteln, dass er zu wissenschaftlicher oderkünstlerischer Arbeit <strong>und</strong> zu ver<strong>an</strong>twortlichem H<strong>an</strong>deln <strong>in</strong> e<strong>in</strong>emfreiheitlichen, demokratischen <strong>und</strong> sozialen Rechtsstaat befähigt wird“(§ 7).Nach <strong>an</strong>fänglich kontroverser Diskussion entwickelte sich e<strong>in</strong>estillschweigende Übere<strong>in</strong>stimmung, dass das HRG alle Stu<strong>die</strong>ngänge zurReflexion der beruflichen Relev<strong>an</strong>z auffordert, aber ke<strong>in</strong>e genauenM<strong>an</strong>date des Berufsbezugs erteilt. Genauere Aussagen wurden denRahmenrichtl<strong>in</strong>ien für <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>ngänge überlassen. Dabei entst<strong>an</strong>denke<strong>in</strong>e verb<strong>in</strong>dlichen fachrichtungsübergreifende, wohl aber fachspezifischeRichtl<strong>in</strong>ien.Veränderungen im Bologna-ProzessDie Bologna-Erklärung von 1999Die Bologna-Erklärung von 1999 enthält ke<strong>in</strong>en Aufruf zu e<strong>in</strong>er stärkeren„Beschäftigungsorientierung der Hochschulen. E<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zige Forderung zuStudium <strong>und</strong> Beruf wurde formuliert: „The degree awarded after the firstcycle shall also be relev<strong>an</strong>t to the Europe<strong>an</strong> labour market as <strong>an</strong>appropriate level of qualification“; <strong>die</strong> deutsche Übersetzung istmissverständlich: “Der nach dem ersten Zyklus erworbene Abschlussattestiert e<strong>in</strong>e für den europäischen Arbeitsmarkt relev<strong>an</strong>teQualifikationsebene.”Die zitierte Formulierung wurde <strong>an</strong>gesichts der Befürchtung gewählt,dass <strong>die</strong> Universitäten derjenigen europäischen Länder, <strong>die</strong> nurL<strong>an</strong>gstu<strong>die</strong>ngänge <strong>an</strong> Universitäten hatten, dazu neigen könnten, das<strong>Bachelor</strong>-Studium nur als e<strong>in</strong> Durchg<strong>an</strong>gsstadium zu e<strong>in</strong>em <strong>Master</strong>-Studium <strong>an</strong>zulegen.Die Bologna-Erklärung empfahl als Kern e<strong>in</strong>e strukturpolitischeMaßnahme: Die E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>er konvergenten Struktur von gestuftenStu<strong>die</strong>ngängen <strong>und</strong> -abschlüssen <strong>in</strong> Europa. Als Ziele <strong>die</strong>serStrukturpolitik n<strong>an</strong>nte sie vor allem <strong>die</strong> Erhöhung studentischer Mobilität:steigende Attraktivität der Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>gebote <strong>in</strong> Europa für Stu<strong>die</strong>rendeaus <strong>an</strong>deren Regionen der Welt <strong>und</strong> Erleichterung der <strong>in</strong>tra-europäischenMobilität. Damit stieg notwendigerweise <strong>die</strong> Bedeutung <strong>in</strong>tra<strong>in</strong>stitutionellerDifferenzierung, ohne dass Aussagen getroffen wurden,was das für <strong>in</strong>ter-<strong>in</strong>stitutionelle Differenzierung (z.B. nach Hochschulartenoder Reputationsrängen) bedeutet. Auch waren <strong>die</strong> Aussagen über Inhalt<strong>und</strong> Funktion von Stu<strong>die</strong>ngängen zurückhaltend, weil <strong>die</strong> europäischeVielfalt der Curricula erhalten werden sollte. Der größte Teil der zunächstempfohlenen Begleitmaßnahmen (z.B. Credit Systems, DiplomaSupplements) war nicht curricular akzentuiert.Was ist „Bologna“?In der öffentlichen Diskussion wird Vieles <strong>und</strong>ifferenziert als <strong>in</strong>tegralerBest<strong>an</strong>dteil des Bologna-Prozesses gesehen. Es lohnt sich dagegen, <strong>die</strong>Genese <strong>und</strong> <strong>die</strong> Bezüge der Aussagen zu differenzieren:• Die Aussagen der Bologna-Erklärung von 1999 (auch der„Sorbonne-Erklärung“ von 1998?)
361.1 Wissenschaftlich kompetent für den Beruf qualifizieren1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 37• Die Aussagen <strong>in</strong> den Kommuniqués der Nachfolgekonferenzen derM<strong>in</strong>ister (Prag, Berl<strong>in</strong>, Bergen, London usw.)• Die Aussagen <strong>in</strong> den Kommuniqués der spezifischen Konferenzen,<strong>die</strong> unter der Ägide der offiziellen Bologna-Follow-up-Group (BFUG)stattf<strong>in</strong>den, z.B. <strong>die</strong> Sw<strong>an</strong>sea-Empfehlungen von 2006.• Hochschulpolitische Akteure drängen darauf, dass ihre Anliegendurch <strong>die</strong> Aufnahme <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Spiegelstrich <strong>in</strong> den Kommuniqués derNachfolgekonferenzen „heilig gesprochen“ werden <strong>und</strong> schiebend<strong>an</strong>n ihre Interpretationen als „Bologna“-Imperative nach.• Es gibt e<strong>in</strong>en „Zeitgeist“ von vermuteten Kontext-Veränderungen<strong>und</strong> Stu<strong>die</strong>nreformimperativen, <strong>die</strong> nicht Spezifisches mit dem Kerndes Bologna-Prozesses zu tun haben, aber immer als Teil desBologna-Prozesses <strong>in</strong>terpretiert werden können, weil <strong>die</strong>ser Prozessnicht im „luftleeren“ Raum stattf<strong>in</strong>detNotwendige DifferenzierungenEntgegen dem starken strukturpolitischen Impetus der Bologna-Erklärungist festzustellen, dass <strong>die</strong> Bologna-Nachfolgekonferenzen im Laufe derZeit immer mehr curriculare Aspekte <strong>an</strong>gesprochen haben:Qualitätssicherung. „Employability“, „Qualifications frameworks“, usw.Die Gründe dafür s<strong>in</strong>d nicht e<strong>in</strong>deutig: H<strong>an</strong>delt es sich um e<strong>in</strong>„Aussprechen“ der ursprünglichen Implikationen im Laufe desImplementationsprozesses? Ist das e<strong>in</strong>e Antwort auf <strong>die</strong> etwaigeEnttäuschung, dass Strukturreformen nicht so viel bewirken wie erhofft?Oder zeichnet sich e<strong>in</strong>e politische Verschiebung <strong>in</strong> Richtung curricularerKonvergenz ab?In jedem Falle lässt sich feststellen, dass der Kern des Bologna-Prozessese<strong>in</strong>ige curriculare Fragen zw<strong>in</strong>gend aufwirft:• Die bereits gen<strong>an</strong>nte Frage der beruflichen Relev<strong>an</strong>z des universitären<strong>Bachelor</strong>s;• Die Frage, wie sich <strong>die</strong> Ansprüche <strong>an</strong> das Kompetenz-Niveau von<strong>Bachelor</strong> <strong>und</strong> <strong>Master</strong> unterscheiden (damit nicht jeder <strong>Bachelor</strong> zue<strong>in</strong>er „Bonsai-Version“ der alten universitären L<strong>an</strong>gstu<strong>die</strong>ngänge oderder neuen <strong>Master</strong> ausgebaut wird);• Fragen von „International education“ <strong>und</strong> der „Europe<strong>an</strong> dimension“der Stu<strong>die</strong>nprogramme <strong>und</strong>• Sp<strong>an</strong>nungen zwischen Entwicklungstendenzen <strong>in</strong> Richtung stärkervertikaler Differenzierung e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> großen „Zones of mutualtrust“ bei begrenzter vertikaler Differenzierung unter deneuropäischen Universitäten.Dagegen haben später zwei Diskussionspunkte <strong>an</strong> Bedeutung gewonnen,<strong>die</strong> eher dem Zeitgeist geschuldet s<strong>in</strong>d als dem Bologna-Prozess: „Outputawareness“ bzw. „Outcome awareness“ sowie „Employability“.Wirkungs-Reflexion <strong>und</strong> professionelle Relev<strong>an</strong>z„Output Awareness“ <strong>und</strong> „Outcome Awareness“In den jüngsten zwei Jahrzehnten hat sich e<strong>in</strong>e gr<strong>und</strong>legendeVeränderung ergeben, <strong>die</strong> für das Verständnis von Studium <strong>und</strong> Beruf vongroßer Bedeutung ist. Wir akzeptieren nicht mehr, dass sich <strong>die</strong>Wissenschaftler<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Wissenschaftler sowie <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>renden alle<strong>in</strong>„auf <strong>die</strong> Sache“ konzentrieren. Auch wird damit der Erfolg des Studiumsnicht mehr alle<strong>in</strong> <strong>in</strong> Form des Beherrschens der „Sache <strong>an</strong> sich“ geprüft.Insofern – <strong>und</strong> nur <strong>in</strong>sofern – könnten wir sagen: „Humboldt ist tot“. Wirerwarten heute darüber h<strong>in</strong>aus zunehmend, dass alle Beteiligten sich derWirkungen von der Befassung mit der Sache bewusst s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> <strong>die</strong>Reflexion dazu strategisch <strong>in</strong> ihr H<strong>an</strong>deln e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen. Deshalb reden wirauch von „kompetenz-orientiertem“ <strong>Lehre</strong>n <strong>und</strong> Lernen, von „Learn<strong>in</strong>goutcomes“ <strong>und</strong> von „Professional relev<strong>an</strong>ce“. Dies impliziert• <strong>in</strong>stitutionelle Dauerreflexion der Wirkungen (unterstrichen durchEvaluation, Akkreditierung, leistungsbezogene Vergütung,<strong>an</strong>tragsbezogene Bereitstellung von Ressourcen usw.),• explizites Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g über den Wissenserwerb h<strong>in</strong>aus: Kompetenz-Orientierung, H<strong>an</strong>dlungskompetenzförderung, Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g von Tr<strong>an</strong>sfer-Qualifikationen,• Ergänzung der Fachstoffe durch professionell bedeutsameSachgebiete (z.B. Verhaltenspsychologie <strong>und</strong> soziale Determ<strong>in</strong><strong>an</strong>tendes Schulerfolgs als Gegenst<strong>an</strong>d der <strong>Lehre</strong>rbildung).Konzepte <strong>und</strong> Begriffe: Wissen, Kompetenz, QualifikationEs gibt ke<strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong> akzeptiertes Konzept von Kompetenz. Diefolgenden Formulierungen aus dem von Tenorth <strong>und</strong> Tippelt im Jahre
381.1 Wissenschaftlich kompetent für den Beruf qualifizieren1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 392007 herausgegebenen Lexikon Pädagogik (S. 413f.) treffen jedochsicherlich auf weitgehende Zustimmung:• „…fachbezogene <strong>und</strong> fachübergreifende Fähigkeiten zur Lösungbestimmter Probleme. Kompetenzen bilden ebenfalls <strong>die</strong> Basis für <strong>die</strong>Formulierung von Bildungsst<strong>an</strong>dards <strong>und</strong> umfassen auch <strong>die</strong>Motivation sowie <strong>die</strong> soziale <strong>und</strong> volative Bereitschaft zur Nutzung<strong>die</strong>ser Problemstrategien…“,• „…<strong>die</strong> erlernbaren kognitiven Fähigkeiten <strong>und</strong> Fertigkeiten, <strong>die</strong>notwendig s<strong>in</strong>d, um bestimmte, domänenabhängige Probleme zulösen…“.Qualifikationen habe ich <strong>in</strong> dem 1995 von Arnold <strong>und</strong> Lipsmeierherausgegebenen H<strong>an</strong>dbuch der beruflichen Bildung wie folgt formuliert:• „Als Qualifikationen (oder zuweilen als personengeb<strong>und</strong>eneQualifikationen oder Qualifikationspotenziale) werden Befähigungen(oder auch nur <strong>die</strong> erlernten Befähigungen), d.h. Kenntnisse,Fähigkeiten <strong>und</strong> Fertigkeiten, über <strong>die</strong> Personen verfügen, bezeichnet,<strong>die</strong> bei der Ausübung e<strong>in</strong>er beruflichen Tätigkeit (ggf. auch bei<strong>an</strong>deren zentralen lebenspraktischen Tätigkeiten) zur Verwendungkommen können.“Welche Begriffe wir immer bevorzugen – wir müssen uns bewusst se<strong>in</strong>,dass wir <strong>die</strong> Ergebnisse des Lernens auf unterschiedlichen Ebenenbestimmen können:(a) Wissen: z.B. „Mathematik“ (Beherrschung von Theorien, Methoden<strong>und</strong> Stoffen),(b) (lernbee<strong>in</strong>flusste) personelle Eigenschaften: z.B. „klug“,(c) funktionale Befähigungen (Kompetenzen, Qualifikationen): z.B.„problemlösungsfähig“.E<strong>in</strong> Problem besteht dar<strong>in</strong>, dass e<strong>in</strong>erseits fachliche Qualifikationen <strong>in</strong> derRegel auf der Ebene des Wissens def<strong>in</strong>iert werden: Die Absolvent<strong>in</strong> bzw.der Absolvent beherrscht Akustik <strong>und</strong> wendet <strong>die</strong> Kenntnisse der Akustik<strong>in</strong> beruflichen Tätigkeiten <strong>an</strong>, <strong>in</strong> denen <strong>die</strong> Anforderung besteht, Akustik<strong>an</strong>wenden zu können. Andererseits werden fachübergreifendeQualifikationen <strong>in</strong> der Regel funktional def<strong>in</strong>iert: Problemlösungsfähigkeitist erforderlich <strong>und</strong> <strong>die</strong> Absolvent<strong>in</strong> bzw. der Absolvent istproblemlösungsfähig.So s<strong>in</strong>d Variablen der fachbezogenen Kompetenzen <strong>und</strong> derfachübergreifenden Kompetenzen <strong>in</strong> der Regel überhaupt nichtvergleichbar. Und jede hat ihre spezifische „Black box“: Beiwissensbezogenen Def<strong>in</strong>itionen weiß m<strong>an</strong> wenig über <strong>die</strong> Verwendung(besonders bei abstraktem Wissen); bei funktionalen Befähigungen weißm<strong>an</strong> wenig, wie <strong>die</strong>se durch das Studium gefördert werden.Beruflicher Erfolg – e<strong>in</strong>e unabd<strong>in</strong>gbare Dimension von „Outcome“Gleichgültig, wie stark oder wie begrenzt wir <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>gebote <strong>und</strong> -bed<strong>in</strong>gungen <strong>an</strong> dem zu erwartenden beruflichen Erfolg „ausrichten“wollen – <strong>in</strong> jedem Falle gehört es <strong>an</strong>gesichts der bestehenden „Outcomeawareness“ heute dazu, dass wir prüfen, wie <strong>die</strong> jeweiligenStu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>gebote <strong>und</strong> -bed<strong>in</strong>gungen mit den späteren „beruflichenErfolgen“ der Absolventen zusammenhängen. Typische Dimensionen des„beruflichen Erfolges“ s<strong>in</strong>d:• glatter Überg<strong>an</strong>g <strong>in</strong>s Beschäftigungssystem,• hohes E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> hohes Ansehen,• ausbildungsadäquate Position,• gute Beschäftigungsbed<strong>in</strong>gungen,• hohe Verwendung der im Studium erworbenen Qualifikationen,• <strong>an</strong>spruchsvolle, selbständige, ver<strong>an</strong>twortliche u.ä. Tätigkeit,• hohe berufliche Zufriedenheit.Das bedeutet jedoch nicht, dass der „berufliche Erfolg“ e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>deutigesMaß von Outcome der Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>gebote <strong>und</strong> -bed<strong>in</strong>gungen ist. Vielmehrist der berufliche Erfolg auch von e<strong>in</strong>er Reihe von „<strong>in</strong>tervenierendenVariablen“ bee<strong>in</strong>flusst:• unterschiedliche sozio-biographische Voraussetzungen,• unterschiedliche Vorbildung,• unterschiede im Stu<strong>die</strong>nverhalten,• relative Autonomie des Überg<strong>an</strong>gs (smarte Berufssuche,„credentialism“, unzureichende Identifikation der Kompetenzen),• Wirkungen berufse<strong>in</strong>führender <strong>und</strong> berufsbegleitenderQualifizierungsprogramme,• regionale Arbeitsmärkte (E<strong>in</strong>kommensunterschiede nach besuchterHochschule hängen <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d mehr vom regionalenWirtschaftsumfeld als von der Qualität der Hochschule ab),
401.1 Wissenschaftlich kompetent für den Beruf qualifizieren1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 41• fachspezifische Arbeitsmärkte (guter Berufserfolg e<strong>in</strong>es Philosophenist etwas <strong>an</strong>deres als guter Berufserfolg e<strong>in</strong>es Betriebswirts.Deswegen produzieren reduzierte Indikatorenmodelle <strong>und</strong> R<strong>an</strong>k<strong>in</strong>gs oftvöllig irreführende Berichte. So hatte das Wissenschaftliche Zentrum fürBerufs- <strong>und</strong> Hochschulforschung Ende der achtziger Jahre nachgewiesen,dass <strong>die</strong> E<strong>in</strong>kommensunterschiede von Absolventen nach besuchterHochschule <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie auf <strong>die</strong> E<strong>in</strong>kommenssituation des regionalenUmfelds der Hochschule <strong>und</strong> allenfalls marg<strong>in</strong>al wirklich auf <strong>die</strong> besuchteHochschule zurückzuführen waren.Die Rolle von Hochschulabsolventenstu<strong>die</strong>nBefragungen von Hochschulabsolventen s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> wichtigesInstrumentarium, mit dem den Hochschulen Rückmeldungen über ihreOutcomes <strong>in</strong> Form der Berufswege <strong>und</strong> -tätigkeiten ihrer Absolventengegeben werden k<strong>an</strong>n. Der Wert solcher Stu<strong>die</strong>n liegt dar<strong>in</strong>, dass• sehr vielfältige Kriterien über den Beruf <strong>an</strong>gesprochen werdenkönnen <strong>und</strong> dass• falsche Zuschreibungen dadurch vermieden werden können, dassviele <strong>in</strong>tervenierende Variablen berücksichtigt werden können.Neben repräsentativen Absolventenstu<strong>die</strong>n für Deutschl<strong>an</strong>d, vor allemdurch <strong>die</strong> HIS GmbH, e<strong>in</strong>igen regionalen Stu<strong>die</strong>n, so durch das BayerischeStaats<strong>in</strong>stitut für Hochschulforschung <strong>und</strong> Hochschulpl<strong>an</strong>ung, <strong>und</strong><strong>in</strong>ternationalen vergleichenden Absolventenstu<strong>die</strong>n mit deutscherBeteiligung, bei denen INCHER Kassel e<strong>in</strong>e große Rolle spielt, führene<strong>in</strong>zelne Hochschulen bzw. e<strong>in</strong>zelne Fachbereiche Stu<strong>die</strong>n über denVerbleib ihrer Absolventen durch. Viele der Ver<strong>an</strong>twortlichen von Stu<strong>die</strong>nzu e<strong>in</strong>zelnen Hochschulen arbeiten neuerd<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Projekt„Stu<strong>die</strong>nbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> Berufserfolg“ zusammen, das vom INCHER-Kassel, <strong>in</strong> Kooperation mit der HRK, koord<strong>in</strong>iert <strong>und</strong> vom BMBFunterstützt wird. E<strong>in</strong> solches Netzwerk hat den Vorteil, dass• hohe qualitative St<strong>an</strong>dards <strong>an</strong>gestrebt werden können,• oft geme<strong>in</strong>same Fragen zur Verbesserung derVergleichsmöglichkeiten gestellt werden, aber Raum für besondereFragen ist, <strong>die</strong> das Profil der e<strong>in</strong>zelnen Hochschule bzw. der e<strong>in</strong>zelnenFachbereiche aufnehmen,• e<strong>in</strong>e Auswertung sowohl nach „Fitness for purpose“ erfolgen k<strong>an</strong>n,wobei <strong>die</strong> Verwirklichung der besonderen Ziele <strong>und</strong> Profile dere<strong>in</strong>zelnen Institution e<strong>in</strong>e zentrale Rolle spielen, als nach „Fitness ofpurpose“, wo übergreifende Ziele <strong>und</strong> Ansprüche als Ausg<strong>an</strong>gspunktfür e<strong>in</strong> „Benchmark<strong>in</strong>g“ se<strong>in</strong> können.Absolventenstu<strong>die</strong>n können <strong>an</strong>regend se<strong>in</strong>, um sich e<strong>in</strong> differenziertesBild von „Professional outcomes“ zu machen. Aber wichtig ist, dass sich<strong>die</strong> zukünftige Gestaltung von Stu<strong>die</strong>ngängen nicht mehr oder wenigeraus dem Umkehrschluss von dem Faktum zur Empfehlung bestimmenlässt. Wenn mehr ehemalige Stu<strong>die</strong>rende von Kunsthochschulen mitkunsth<strong>an</strong>dwerklicher Tätigkeit eher als mit künstlerischen Werken ihrenUnterhalt sichern können, muss daraus nicht geschlossen werden, dass<strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>gebote sich auf <strong>die</strong> Vorbereitung kunsth<strong>an</strong>dwerklicherTätigkeit konzentrieren sollten. Und wenn Siemens oder Telekom sich als<strong>die</strong> häufigsten Beschäftiger von Philosophen erweisen sollten, so mussdas Philosophie-Studium ke<strong>in</strong>eswegs <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>ärenStu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>g für hermeneutische Elektronik umgebaut werden. Hierhaben <strong>die</strong> Angehörigen der e<strong>in</strong>zelnen Fächer <strong>und</strong> Hochschulen große<strong>in</strong>terpretatorische Ver<strong>an</strong>twortung.Zur „Employability“-Diskussion,„Outcome Awareness“ <strong>und</strong> „Employability“Es wird immer wieder versucht, uns weiß zu machen, dass der Bologna-Prozess zu e<strong>in</strong>er stärkeren „Employability” der Stu<strong>die</strong>renden aufrufe. Dasist jedoch <strong>in</strong> zweifacher H<strong>in</strong>sicht falsch:• Die Bologna-Erklärung von 1999 fordert, wie bereits ausgeführt, <strong>die</strong>universitären <strong>Bachelor</strong>-Stu<strong>die</strong>ngänge so <strong>an</strong>zulegen, dass sie nichtalle<strong>in</strong> Vorstufe für e<strong>in</strong> <strong>Master</strong>-Studium, sondern professionell relev<strong>an</strong>ts<strong>in</strong>d.• Der Bologna-Prozess f<strong>in</strong>det zu e<strong>in</strong>er Zeit statt, <strong>in</strong> der „Outcomeawareness“ zu e<strong>in</strong>er Selbstverständlichkeit wird <strong>und</strong> dass <strong>die</strong>„professionelle Relev<strong>an</strong>z des Studiums“ selbstverständlichdazugehört. „Employability“ signalisiert jedoch, dass es im Bologna-Prozess nur um bestimmte Konzepte von professioneller Relev<strong>an</strong>zgeht.
421.1 Wissenschaftlich kompetent für den Beruf qualifizieren1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 43Nicht wenige Akteure <strong>und</strong> Experten sche<strong>in</strong>en <strong>die</strong> allgeme<strong>in</strong>e Popularitätdes Bologna-Prozesses nutzen zu wollen, um bestimmte Interpretationender Beziehung von Studium <strong>und</strong> Beruf <strong>an</strong>deren aufzudrängen.Zum Begriff “Employability”Der Begriff „Employability” ist <strong>in</strong> zweifacher H<strong>in</strong>sicht äußerst unglücklich:• „Employability“ ist e<strong>in</strong> Fachbegriff aus der Arbeitsmarktpolitik <strong>und</strong> -forschung, der sich auf Probleme <strong>und</strong> Maßnahmen für „youth at risk“befasst, d.h. Personen, <strong>die</strong> m<strong>an</strong> überhaupt kaum beschäftigen k<strong>an</strong>n.Das ist nicht das Problem der Hochschulen.• „Employment“ spricht alle<strong>in</strong> <strong>die</strong> „Tausch-Dimension <strong>an</strong>: Überhauptbeschäftigt, E<strong>in</strong>kommen <strong>und</strong> Position; Vertragsdauer, Arbeitsumf<strong>an</strong>g,Sozialleistungen u.ä.; bei den Stu<strong>die</strong>nreformen geht es jedoch primärum <strong>die</strong> „Gebrauchs“-Dimension des Studiums (Verwendung vonQualifikationen, Problemlösungsfähigkeit, selbständiges <strong>und</strong>ver<strong>an</strong>twortliches H<strong>an</strong>deln u.ä.), ergänzt durch <strong>die</strong>Beschäftigungsdimension.Das zweite Bedenken macht auch deutlich, dass <strong>die</strong> E<strong>in</strong>deutschung„Beschäftigungsfähigkeit“ <strong>die</strong> Missverständlichkeit kaum verr<strong>in</strong>gert.Vielmehr• ist „berufliche Relev<strong>an</strong>z“ <strong>in</strong> der deutschen Sprache der <strong>an</strong>gemesseneAusdruck,• gibt es für <strong>die</strong> englische Sprache bisher ke<strong>in</strong>e brauchbare Lösung,denn „professional relev<strong>an</strong>ce“, wie Ulrich Teichler <strong>die</strong>s der EUA imJahre 2004 vorgeschlagen hatte, ersche<strong>in</strong>t <strong>an</strong>gesichts der englischenBedeutung von „Professions“ – nur für hoch qualifizierte Berufe (imGegensatz zu „Vocations“) <strong>und</strong> dabei für „geschlossene“ Berufeverwendet – als zu engführend.Dem Begriff „Employability“ werden sehr unterschiedliche Bedeutungenunterlegt. Sechs unterschiedliche Akzente lassen sich benennen:• Alles <strong>in</strong> der Anlage des Studiums zu tun, was den Beschäftigungs<strong>und</strong>Karriereerfolg der Stu<strong>die</strong>renden erhöht;• Der Tauschwert des Studiums <strong>in</strong>sgesamt: E<strong>in</strong>schließlich der Wahl desrichtigen Faches <strong>und</strong> der richtigen Universität (e<strong>in</strong>schließlich„credentialism“);• E<strong>in</strong>e enge stoffliche Abstimmung von Studium <strong>und</strong> zu erwartenderberuflicher Tätigkeit;• Stärkung von Kompetenzen, <strong>die</strong> <strong>an</strong>ders als durch <strong>die</strong> fachlichen Stoffeerworben werden;• Berufse<strong>in</strong>stiegs- <strong>und</strong> Karrierehilfen: Berufsberatung <strong>und</strong> -vermittlung,Bewerbungstra<strong>in</strong><strong>in</strong>g usw.;• Insgesamt überwiegt e<strong>in</strong> „Jargon der Nützlichkeit“ (Ulrich Teichler).Kategorien berufsrelev<strong>an</strong>ter KompetenzenIn der Diskussion um „employability“ geht es <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie um <strong>die</strong>Klärung, welche Arten von Befähigungen bei den Stu<strong>die</strong>renden gefördertwerden sollen, damit sie <strong>in</strong> <strong>die</strong> Lage versetzt werden, später im Berufkompetent h<strong>an</strong>deln zu können. Immer wieder wird dabei versucht, <strong>die</strong>Kompetenzen neu zu beschreiben <strong>und</strong> zu gliedern, auf <strong>die</strong> es im Beruf<strong>an</strong>kommen mag. Dabei ist bisher ke<strong>in</strong> Konsens über <strong>an</strong>gemessenebegriffliche Bestimmungen der potenziell berufsrelev<strong>an</strong>ten Kompetenzengelungen. Es werden immer wieder neue Listen von drei bis fünfKategorien hervorgebracht, <strong>die</strong> d<strong>an</strong>n jeweils heterogene Aspektesubsumieren.Die folgende Liste wurde von Ulrich Teichler mit der Absicht entwickelt,<strong>die</strong> bisherige Diskussion über Kategorien von „Employability“ zuresümieren, ohne heterogene Aspekte unter e<strong>in</strong>e Kategorie zusubsumieren. Die größere kategoriale E<strong>in</strong>deutigkeit hat allerd<strong>in</strong>gs ihrenPreis dar<strong>in</strong>, dass 11 Kategorien gen<strong>an</strong>nt werden – e<strong>in</strong>e Menge, <strong>die</strong> nichtmehr e<strong>in</strong>fach im Gedächtnis haften bleibt:• Fachliche Qualifikation (z.B. stärkere Spezialisierung; stärkereAuswahl von Stoffen entsprechend veränderten beruflichen<strong>Anforderungen</strong>; Betonung von Theorien, Methoden, <strong>und</strong> Verstehenstatt Beherrschung von Stoffen; neue <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äre Stoffbündel wieetwas Umweltwissenschaften);• Allgeme<strong>in</strong>e kognitive Kompetenzen, <strong>die</strong> durch wissenschaftlichesStudium gefördert werden können; (z.B. allgeme<strong>in</strong> bildende Elementeim Studium; Betonung von Theorien, Methoden, Verstehen usw. <strong>in</strong>e<strong>in</strong>er Weise, dass fachliche Gehalte eher exemplarischen Charakterhaben; kritisches <strong>und</strong> <strong>in</strong>novatives Denken; lernen zu lernen);
441.1 Wissenschaftlich kompetent für den Beruf qualifizieren1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 45• Arbeitsstile (z.B. <strong>in</strong> begrenzter Zeit Aufgaben erledigen; pl<strong>an</strong>en;beharrlich, ausdauernd);• Generelle berufsrelev<strong>an</strong>te Werthaltungen (z.B. E<strong>in</strong>satzbereitschaft;Loyalität; Neugier, Innovationsorientierung; Skepsis, kritischeWerthaltung);• Spezifische berufliche Stile <strong>und</strong> Werthaltungen <strong>in</strong> beruflichenSektoren (z.B. „Bus<strong>in</strong>ess“-Werte <strong>und</strong> Arbeitsstile; Beamten-Werte <strong>und</strong> -Arbeitsstile; Service-Orientierung);• Tr<strong>an</strong>sferqualifikationen (z.B. systematische Konfrontation vonwissenschaftlichen <strong>und</strong> beruflichen Vorgehensweisen;Problemlösungsfähigkeit; <strong>an</strong>wendungsorientierte Qualifizierung);• Sozio-kommunikative Kompetenzen (z.B. Leadership; Team-Fähigkeit;Reden; Überreden; Überzeugen);• „Zusatz“-Qualifikationen: Wissen <strong>in</strong> <strong>an</strong>deren Sachgebieten als demFachstudium, das <strong>in</strong> der Regel nicht auf dem Niveau e<strong>in</strong>eswissenschaftlichen Studiums erworben wird („Führersche<strong>in</strong>e“ fürAbsolventen: (z.B. Fremdsprachen; Recht <strong>und</strong> Wirtschaft; IT);• Befähigungen zur Selbst-Org<strong>an</strong>isation (-bewältigung) des eigenen(beruflichen) Lebens;• Befähigungen zum Umg<strong>an</strong>g mit dem Arbeitsmarkt (z.B. Kenntnissezur Jobsuche; erfolg versprechendes Bewerbungsverhalten);• Internationale Kompetenzen (z.B. Fremdsprachen; Kenntnisse <strong>und</strong>Verstehen zu <strong>an</strong>deren Ländern, Kulturen; Fachrichtungsrelev<strong>an</strong>te„Feldkenntnisse“ zu <strong>an</strong>deren Ländern („Bus<strong>in</strong>ess <strong>in</strong> Ch<strong>in</strong>a“ o.ä.);vergleichendes Denken <strong>und</strong> Verstehen)Zur deutschen SituationDer britische E<strong>in</strong>fluss auf <strong>die</strong> „Employability“-DiskussionDie Diskussion über „Employability“ wird häufig als e<strong>in</strong>e europäischeDiskussion wahrgenommen. Festzustellen ist jedoch, dass <strong>in</strong>Großbrit<strong>an</strong>nien e<strong>in</strong>e Diskussion zu <strong>die</strong>sem Thema entst<strong>an</strong>d, <strong>die</strong> sehr stark<strong>die</strong> dortigen besonderen Bed<strong>in</strong>gungen der Beziehungen von Studium <strong>und</strong>Beruf widerspiegelte. Das Vorherrschen der englischen Sprache <strong>in</strong> dereuropäischen Diskussion hat dazu beigetragen, dass e<strong>in</strong>e stark nationalgeprägte Diskussion als e<strong>in</strong>e europäische <strong>in</strong>terpretiert worden ist.An Hochschulen <strong>in</strong> Großbrit<strong>an</strong>nien wird traditionell auf Allgeme<strong>in</strong>bildung<strong>und</strong> Persönlichkeitsformung stärker Wert gelegt als etwa <strong>an</strong> Hochschulen<strong>in</strong> Fr<strong>an</strong>kreich <strong>und</strong> Deutschl<strong>an</strong>d. Das ist eng verb<strong>und</strong>en mit dem Faktum,dass <strong>die</strong> e<strong>in</strong>zelnen Stu<strong>die</strong>nfächer <strong>in</strong> Großbrit<strong>an</strong>nien nicht so e<strong>in</strong>deutig alsauf bestimmte Beruf zuführend betrachtet werden wie <strong>in</strong> Fr<strong>an</strong>kreich <strong>und</strong>Deutschl<strong>an</strong>d.Die beiden europäischen Hochschulabsolventenstu<strong>die</strong>n (CHEERS <strong>und</strong>REFLEX), <strong>die</strong> <strong>in</strong> den verg<strong>an</strong>genen Jahren durchgeführt worden waren,zeigen, dass britische Absolventen sich über ihre Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>gebote <strong>und</strong> -bed<strong>in</strong>gungen im Rückblick relativ positiv äußern, über ihre beruflicheSituation aber <strong>in</strong> vielen Fällen enttäuscht s<strong>in</strong>d. Verschiedene Bef<strong>und</strong>elegen den Schluss nahe, dass sich <strong>die</strong> Erwartungen <strong>an</strong> professionelleRelev<strong>an</strong>z des Studiums seitens der britischen Absolventen kaum vondenen der fr<strong>an</strong>zösischen <strong>und</strong> deutschen Absolventen unterscheiden.Wie sehr sich e<strong>in</strong> Studium <strong>in</strong> Großbrit<strong>an</strong>nien von e<strong>in</strong>em Studium zumBeispiel <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d im H<strong>in</strong>blick auf se<strong>in</strong>en beruflichen Bezugunterscheidet, lässt sich <strong>an</strong>h<strong>an</strong>d <strong>die</strong>ser beiden vergleichenden Stu<strong>die</strong>nauch im Falle der praktischen Erfahrungen während des Studiumsillustrieren. Britische Stu<strong>die</strong>rende haben im Studium nur halb so häufigverpflichtende Praxisphasen, <strong>und</strong> nur e<strong>in</strong> Drittel so häufigstu<strong>die</strong>nbezogene Praxis-Erfahrungen während ihres Studiums (<strong>in</strong> Praktika<strong>und</strong> Werkarbeit).Daher k<strong>an</strong>n es nicht überraschen, dass <strong>in</strong> Großbrit<strong>an</strong>nien e<strong>in</strong>eKontroverse darüber geführt wird, ob im Studium <strong>die</strong> fachlicheVorbereitung auf den Beruf gestärkt werden sollte oder eher „genericskills“ gefördert werden sollten. Rufe nach e<strong>in</strong>er stärkeren fachlichenVorbereitung werden dabei derzeit häufiger laut als <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d.Notwendige Themen bei der Suche nach e<strong>in</strong>er berufsrelev<strong>an</strong>tenStu<strong>die</strong>nreformDie britische Diskussion über „Employability“ k<strong>an</strong>n als e<strong>in</strong> <strong>in</strong>teress<strong>an</strong>tesnationales Beispiel zur Kenntnis genommen werden, aber <strong>in</strong> jedeme<strong>in</strong>zelnen L<strong>an</strong>d s<strong>in</strong>d besondere Antworten auf <strong>die</strong> folgenden Fragen zusuchen:• Was waren <strong>die</strong> größten Kompetenz-Defizite <strong>in</strong> der Verg<strong>an</strong>genheit?
461.1 Wissenschaftlich kompetent für den Beruf qualifizieren1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 47• Welche neuen Herausforderungen stellen sich durch kulturellen,gesellschaftlichen, wirtschaftlichen <strong>und</strong> technologischen W<strong>an</strong>del?• Welches Umdenken erfordern <strong>die</strong> steigenden Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fänger- <strong>und</strong>Absolventenquoten, etwa im H<strong>in</strong>blick auf e<strong>in</strong>e Differenzierung imCharakter der Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>gebote?• Wieweit soll es beim <strong>Bachelor</strong>- <strong>und</strong> <strong>Master</strong>-Studium jeweils umspezifische Ebenen der Qualifizierung <strong>und</strong> um unterschiedlicheAkzentuierungen im Berufsbezug gehen?• Wie verändert sich der Berufsbezug unterschiedlicher Arten vonHochschulen (z.B. Universitäten <strong>und</strong> Fachhochschulen), wenn nichtmehr <strong>die</strong> Arten der Hochschulen das wichtigste Merkmal formalerDifferenzierung s<strong>in</strong>d, sondern <strong>die</strong> Ebenen von Stu<strong>die</strong>ngängen <strong>und</strong> -abschlüssen?Kompetenz-Defizite <strong>in</strong> der Verg<strong>an</strong>genheitDie <strong>in</strong>ternational vergleichende Stu<strong>die</strong> CHEERS zeigt, wie Absolventendeutscher Hochschulen, <strong>die</strong> e<strong>in</strong>ige Jahre vor der Bologna-Erklärung ihrStudium abgeschlossen hatten, ihre Kompetenzen beiHochschulabschluss e<strong>in</strong>ige Jahre später im Rückblick e<strong>in</strong>schätzten.D<strong>an</strong>ach waren• ausgewählte soziale Kompetenzen (Teamarbeit, Verh<strong>an</strong>deln, Führung,Anpassungsfähigkeit) unter dem europäischen Durchschnitt, nichtjedoch Kommunikationsfähigkeit,• auch ausgewählte Kompetenzen im H<strong>in</strong>blick auf <strong>die</strong>Arbeitorg<strong>an</strong>isation (z.B. Zeite<strong>in</strong>teilung) unterdurchschnittlich,• Problemlösungsfähigkeit im durchschnittlichen Bereich,• Zusatzqualifikationen (Fremdsprachen, EDV, ökonomischesVerständnis u.ä.) im durchschnittlichen Bereich oder darüber,• Fachwissen <strong>und</strong> <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äres Denken sehr hoch beurteilt.Diese Bef<strong>und</strong>e zeigen, dass <strong>die</strong> Idee <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d <strong>an</strong>gemessen war, beider nächsten Stu<strong>die</strong>nreformwelle – <strong>die</strong> sich nun im Bologna-Prozessereignet – etwas zur Stärkung von „Schlüsselqualifikationen“ zu tun.Allerd<strong>in</strong>gs werden unter <strong>die</strong>sem Begriff sehr unterschiedliche Kategorienvon Kompetenzen <strong>an</strong>gesprochen: Nicht <strong>in</strong> allen Bereichen sche<strong>in</strong>en <strong>in</strong>Deutschl<strong>an</strong>d <strong>in</strong> der Verg<strong>an</strong>genheit Defizite geherrscht zu haben.Schließlich ist es höchst diskussionswürdig, ob wichtige der obengen<strong>an</strong>nten Kategorien von Kompetenzen tatsächlich am besten durchgesonderte Schlüsselqualifikations-Kurse gefördert werden oder eher <strong>in</strong><strong>die</strong> Hauptbereiche der Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>gebote <strong>in</strong>tegriert werden sollten.<strong>Neue</strong> HerausforderungenDie Diskussion, <strong>die</strong> <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d augr<strong>und</strong> der Gestaltung vonStu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>geboten durch den Bologna-Prozess auf <strong>die</strong> Tagesordnunggebracht worden ist, ist natürlich e<strong>in</strong>e Gelegenheit, all <strong>die</strong>Herausforderungen aufzunehmen, <strong>die</strong> sich den Hochschulen ohneh<strong>in</strong>durch den W<strong>an</strong>del ihrer Umwelt stellen. In <strong>die</strong>sem Rahmen beobachtenwir, dass sich <strong>die</strong> Diskussion <strong>in</strong> den verschiedenen europäischen Ländernähnelt. Hier seien nur e<strong>in</strong>ige Themen stichwortartig gen<strong>an</strong>nt:• „Knowledge Society“: Expertokratie? Dezentralisierung von Wissen<strong>und</strong> Macht durch das Wissen von Vielen? Macht der Me<strong>die</strong>n?Veränderung von Wissen <strong>und</strong> Werten u.a.;• Bedeutungsgew<strong>in</strong>n von Sachgebieten mit <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>ärenAnsprüchen (Umwelt, Klima, Risiko, soziale Kohäsion <strong>und</strong> Exklusion,alternde Gesellschaft u.a.);• Wissensexplosion <strong>und</strong> Wissensverarbeitung;• „Internationalisierung“: Bedeutung wachsender Mobilität für <strong>die</strong>Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>gebote; wie „<strong>in</strong>ternationalisation at home“? usw.;• Wachsen kultureller Vielfalt: Was bedeutet das für <strong>die</strong> Hochschulen?Exp<strong>an</strong>sion der tertiären BildungDeutschl<strong>an</strong>d ist nach OECD-Statistiken <strong>in</strong> den Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fänger- <strong>und</strong>Absolventenquoten weit unter dem Durchschnitt der wirtschaftlichfortgeschrittenen Länder. Wenn wir <strong>die</strong>sen Durchschnitt zur Normerheben, d<strong>an</strong>n müssten wir über <strong>die</strong>sen Bef<strong>und</strong> stärker beunruhigt se<strong>in</strong>als über das jemals „schlechteste“ PISA-Ergebnis. Es ist <strong>in</strong>teress<strong>an</strong>t zusehen, welche Selektivität wir uns bei der Entscheidung leisten, überwelche Daten wir uns beunruhigen lassen wollen oder nicht.Insgesamt legt uns <strong>die</strong> Diskussion über <strong>die</strong> Exp<strong>an</strong>sion der tertiären Bildungdrei Themen nahe:• Wieweit haben wir stärker als <strong>in</strong> der Verg<strong>an</strong>genheit Zusammenhängezwischen Studium <strong>und</strong> Beruf im Bereich der Universitäten <strong>und</strong>
481.1 Wissenschaftlich kompetent für den Beruf qualifizieren1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 49Fachhochschulen sowie Studium <strong>und</strong> Beruf <strong>in</strong> den höheren Bereichendes beruflichen Ausbildungssystems zu bedenken, <strong>die</strong> <strong>in</strong> den<strong>in</strong>ternationalen Statistiken als Teil von „tertiary education“mitgerechnet werden?• Wieweit <strong>und</strong> wie sollen veränderte Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>gebote <strong>an</strong> denHochschulen durchlässiger werden für Personen, <strong>die</strong> aus derberuflichen Ausbildung kommen, <strong>und</strong> wieweit s<strong>in</strong>d Fragen <strong>die</strong>ser Artmit Fragen der Ch<strong>an</strong>cengerechtigkeit verb<strong>und</strong>en?• Wie stellen sich <strong>die</strong> Hochschulen <strong>in</strong>sgesamt darauf e<strong>in</strong>, dass mit derExp<strong>an</strong>sion e<strong>in</strong> Verbleib von Hochschulabsolventen „unterhalb“ dertraditionellen Akademiker-Positionen nicht mehr als Ausnahmegesehen werden k<strong>an</strong>n?Das <strong>Bachelor</strong>-<strong>Master</strong>-ModellFür den Zusammenh<strong>an</strong>g von Studium <strong>und</strong> Beruf nach E<strong>in</strong>führung des<strong>Bachelor</strong>-<strong>Master</strong>-Systems ist es wichtig zu wissen, welche Quoten vonAbsolventen wir auf welcher Ebene erwarten. Ende der neunziger Jahre,als <strong>die</strong> Bologna-Erklärung formuliert wurde, schlossen <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>detwa zehn Prozent e<strong>in</strong>es Jahrg<strong>an</strong>ges mit e<strong>in</strong>em universitären Abschlussab, etwa sechs Prozent mit e<strong>in</strong>em Fachhochschulabschluss <strong>und</strong> mehr alszehn Prozent mit e<strong>in</strong>er höheren beruflichen Ausbildung, <strong>die</strong> <strong>in</strong> den<strong>in</strong>ternationalen Statistiken auch unter tertiärer Bildung geführt werden.Zu <strong>die</strong>ser Zeit g<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> den USA, Großbrit<strong>an</strong>nien <strong>und</strong> Australien etwa 20Prozent e<strong>in</strong>es Jahrg<strong>an</strong>gs mit e<strong>in</strong>em <strong>Bachelor</strong> <strong>in</strong> das Beschäftigungssystemüber <strong>und</strong> etwas über zehn Prozent mit e<strong>in</strong>em <strong>Master</strong> oder e<strong>in</strong>emähnlichen Abschluss. Wenn wir uns <strong>in</strong> <strong>die</strong> Richtung <strong>die</strong>ser Länderbewegen sollten, so wäre es zum Beispiel normal gewesen <strong>an</strong>zunehmen,dass <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d drei Viertel der universitären <strong>und</strong> e<strong>in</strong> Viertel derfachhochschulischen <strong>Bachelor</strong>-Absolventen später e<strong>in</strong>en <strong>Master</strong>-Abschluss erwerben <strong>und</strong> dass <strong>die</strong> höhere berufliche Ausbildung sich zue<strong>in</strong>em <strong>an</strong>wendungsorientierten <strong>Bachelor</strong>-Studium weiterentwickelt.Tatsächlich wurden jedoch unfruchtbare Diskussionen über e<strong>in</strong>e strikteSelektion beim Zug<strong>an</strong>g zum <strong>Master</strong> <strong>und</strong> über „Sche<strong>in</strong>“-Veränderungendurch e<strong>in</strong>en „<strong>Bachelor</strong> (professional)“ geführt, ohnezukunftsversprechende Szenarien zu entwickeln.Für das <strong>Bachelor</strong>-Studium bleibt noch weiter zu präzisieren:• Wor<strong>in</strong> unterscheidet sich <strong>die</strong> Ebene der Kompetenzen beim Erreichendes <strong>Bachelor</strong> von der beim Erreichen des <strong>Master</strong>?• Welche Mischung von fachlicher Spezialisierung <strong>und</strong> Propädeutik füre<strong>in</strong>en <strong>Master</strong>-Abschluss ist <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen Fachrichtungen <strong>die</strong> besteLösung?Auch im H<strong>in</strong>blick auf das <strong>Master</strong>-Studium müssen wir nach der erstenPhase des trial <strong>an</strong>d error aussortieren:• Bieten sich <strong>an</strong>dere Typisierungen <strong>an</strong>, als sie zu Beg<strong>in</strong>n für <strong>die</strong>Akkreditierung kodifiziert worden s<strong>in</strong>d: z.B. nach dem Ausmaß derdiszipl<strong>in</strong>ären oder <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>ären Akzentuierung <strong>in</strong> Ergänzung zuden bereits bestehenden Unterscheidungen nach theoretischer <strong>und</strong><strong>an</strong>gew<strong>an</strong>dter Akzentuierung <strong>und</strong> nach zeitlicher Sequenz derStu<strong>die</strong>ngänge?• Ist es gut, dass m<strong>an</strong> unterschiedliche Typen von <strong>Master</strong>-Stu<strong>die</strong>ngängen schafft, <strong>die</strong> jeweils e<strong>in</strong>en Typus von Stu<strong>die</strong>nzielenverfolgen, oder wäre es nicht ertragreicher, e<strong>in</strong>e kreative Mischungvon Stu<strong>die</strong>renden mit unterschiedlichen Voraussetzungen <strong>und</strong>unterschiedlichen Zielen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Stu<strong>die</strong>nprogrammzusammenzuführen?Die Zukunft der Gliederung nach Universitäten <strong>und</strong>FachhochschulenDer Bologna-Prozess trägt zweifellos dazu bei, dass sich <strong>die</strong>Überschneidung der Funktionen von Universitäten <strong>und</strong> Fachhochschulenvergrößert. M<strong>an</strong>che kommen zu dem Schluss, dass e<strong>in</strong>e Aufgabe derZwei-Typen-Struktur nur e<strong>in</strong>e Frage der Zeit ist; Andere s<strong>in</strong>d der Ansicht,dass sich <strong>die</strong> beiden Typen mit ger<strong>in</strong>gerem Abst<strong>an</strong>d neu profilierenkönnen. Letzteres dürfte eher e<strong>in</strong>treten, wenn sich Universitäten <strong>und</strong>Fachhochschulen untere<strong>in</strong><strong>an</strong>der auf e<strong>in</strong> neues Leitbild verständigen: Wasbedeutet wissenschaftlich basiertes <strong>und</strong> beruflich relev<strong>an</strong>tes <strong>Bachelor</strong>bzw.<strong>Master</strong>-Studium unter den Bed<strong>in</strong>gungen von „Mass highereducation“ <strong>an</strong>d „Knowledge society“ für unseren Hochschultyp?Differenzierung des HochschulsystemsSeit Jahrzehnten nehmen Experten <strong>an</strong>, dass mit der Hochschulexp<strong>an</strong>sione<strong>in</strong>e Differenzierung des Hochschulsystems mehr oder weniger
501.1 Wissenschaftlich kompetent für den Beruf qualifizieren1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 51automatisch e<strong>in</strong>hergeht. Das ist erstens darauf zurückzuführen, dass <strong>die</strong>wachsende Zahl der Stu<strong>die</strong>renden <strong>in</strong> ihren Motiven, Befähigungen <strong>und</strong>Berufsperspektiven vielfältiger wird. Zweitens wird <strong>an</strong>genommen, dassForschung <strong>an</strong> Hochschulen nicht <strong>in</strong> dem gleichen Maße exp<strong>an</strong><strong>die</strong>rtwerden muss wie <strong>Lehre</strong> <strong>und</strong> Studium <strong>und</strong> dass auch <strong>in</strong>nerhalb derForschung Abstufungen <strong>in</strong> der Qualität <strong>und</strong> im Verhältnis vonwissenschaftlicher Gr<strong>und</strong>legung <strong>und</strong> Anwendung zunehmen.Sehr unterschiedlich s<strong>in</strong>d jedoch <strong>die</strong> Vorstellungen, welches Ausmaßhorizontaler Differenzierung (<strong>in</strong> den Sachprofilen) <strong>und</strong> vertikalerDifferenzierung (im wissenschaftlichen Niveau) wünschenswert <strong>und</strong>realisierbar ist. Diese Diskussion wird weltweit geführt, hat aber natürlich<strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d besonders hohe Aufmerksamkeit, weil Deutschl<strong>an</strong>d zuden Ländern gehört, <strong>in</strong> denen traditionell <strong>die</strong> Reputationshierarchie derUniversitäten <strong>und</strong> Fachbereiche besonders „flach“ ist.Offenk<strong>und</strong>ig gibt es <strong>in</strong> Europa deutliche Sp<strong>an</strong>nungen zwischen demDiskurs zum Bologna-Prozess (Europäischer Hochschulraum) <strong>und</strong> demDiskurs zum Lissabon-Prozess (Europäischer Forschungsraum). Imletzteren überwiegt <strong>die</strong> Sympathie für e<strong>in</strong>e stärkere Stratifizierung desHochschulsystems; im ersteren ist offene <strong>in</strong>tra-europäische Mobilität nurd<strong>an</strong>n zu verwirklichen, wenn sich <strong>die</strong> vertikalen Differenzen <strong>in</strong> Grenzenhalten: Nur d<strong>an</strong>n k<strong>an</strong>n es große „Zones of mutual trust“ geben, <strong>in</strong> denensich <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>renden bewegen können.In Deutschl<strong>an</strong>d ist bisher e<strong>in</strong>deutig festzustellen, dass <strong>die</strong> Begeisterungfür e<strong>in</strong>e Zunahme der vertikalen Stratifizierung wächst: So sche<strong>in</strong>t dasInteresse <strong>an</strong> „R<strong>an</strong>k<strong>in</strong>gs“ zu wachsen; am liebsten möchte m<strong>an</strong> für jedeFunktion der Hochschulen e<strong>in</strong>e „Exzellenz-Initative“; <strong>und</strong>Positionsverbesserungen auf R<strong>an</strong>glisten von „World class universities“stehen auch auf der Wunschliste. Gleichzeitig wird hier <strong>und</strong> da gepriesen,dass Deutschl<strong>an</strong>d doch den Vorteil habe, dass das Niveau derUniversitäten unterhalb der Top-Klasse besonders hoch sei.Für das Verhältnis von Studium <strong>und</strong> Beruf s<strong>in</strong>d zweifellos <strong>die</strong> folgendenFragen von Bedeutung:• Welches Ausmaß von vertikaler Stratifizierung des Niveaus vonStu<strong>die</strong>nabschlüssen ist im H<strong>in</strong>blick auf <strong>die</strong> spätere berufliche <strong>und</strong>außerberufliche Existenz wünschenswert?• Wieweit verbessert oder verschlechtert sich das Niveau derKompetenzen bei Stu<strong>die</strong>nabschluss <strong>in</strong>sgesamt als Folge von stärkererStratifizierung?• Welche Wirkungen haben Bemühungen um e<strong>in</strong>e stärkereStratifizierung für das Ausmaß horizontaler Homogenität bzw. für <strong>die</strong>Vielfalt der Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>gebote?Abschließende ÜberlegungenDer Bologna-Prozess betrifft <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie Fragen der Strukturen vonHochschulsystemen <strong>und</strong> der <strong>in</strong>ternationalen Mobilität von Stu<strong>die</strong>renden.Deshalb wird auch <strong>in</strong> den zentralen Dokumenten wenig über <strong>an</strong>dereThemen gesagt. Aber <strong>die</strong> Reformprozesse, <strong>die</strong> sich im Kontext desBologna-Prozesses ereignen, greifen weit darüber h<strong>in</strong>aus. Tatsächlichs<strong>in</strong>d Fragen der Beziehung von Studium <strong>und</strong> Beruf das dritte großeThema des Bologna-Prozesses geworden.Die Diskussion zu <strong>die</strong>sem dritten Thema lief unter dem Begriff„Employability“. Der Begriff ist irreführend, weil es nicht um großeBeschäftigungsprobleme geht <strong>und</strong> weil es nicht primär um <strong>die</strong>Beschäftigungsdimension geht, sondern um <strong>die</strong> Beziehungen vonStu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>geboten, Kompetenzen <strong>und</strong> beruflichen Tätigkeiten. Indeutscher Sprache ist es sicherlich <strong>an</strong>gemessen zu formulieren, dass esum Fragen der beruflichen Relev<strong>an</strong>z des Studiums geht.In der Bologna-Erklärung von 1999 wird lediglich gefordert, dass e<strong>in</strong><strong>Bachelor</strong>-Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>gebot <strong>an</strong> Universitäten nicht alle<strong>in</strong> als e<strong>in</strong>eDurchg<strong>an</strong>gsstation zum <strong>Master</strong>-Studium <strong>an</strong>gelegt werden soll. Aber derBologna-Prozess vollzieht sich im Rahmen e<strong>in</strong>es Zeitgeistes, für den derRuf nach höherer <strong>in</strong>strumenteller Ausrichtung der Hochschulen typischist. Natürlich gibt es auch Spötter, <strong>die</strong> sagen, dass nach der Abschaffungvon „Marxismus-Len<strong>in</strong>ismus“-Kursen <strong>in</strong> Mittel- <strong>und</strong> Osteuropa nunaufgerufen wird, Kurse zum Studium des „Kapitalistischen M<strong>an</strong>ifests“e<strong>in</strong>zuführen.Jenseits aller ideologischer Trittbrettfahrerei <strong>und</strong> Bedenkenträgerei stehtjedoch für <strong>die</strong> Hochschulen fraglos im Raum, dass sie <strong>die</strong> „Outcomes“ihres Tuns zu reflektieren <strong>und</strong> auf <strong>die</strong>ser Basis nach neuen Lösungen zusuchen haben. Wie weit sollen sie Kompetenzen ihrer Stu<strong>die</strong>renden über<strong>die</strong> Beherrschung des Faches h<strong>in</strong>aus fördern <strong>und</strong> auf welche Weise? Wie
521.1 Wissenschaftlich kompetent für den Beruf qualifizieren1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 53weit bereiten sie Stu<strong>die</strong>rende auf vorf<strong>in</strong>dliche Tätigkeiten vor oder auf <strong>die</strong>Überw<strong>in</strong>dung des Vorf<strong>in</strong>dlichen? Wieweit gibt es geme<strong>in</strong>same Aufgabenfür alle Hochschulen, <strong>und</strong> wieweit sollte e<strong>in</strong>e Differenzierung nach Niveau<strong>und</strong> Profil gehen? Das s<strong>in</strong>d <strong>die</strong> Fragen, <strong>die</strong> sich <strong>an</strong>gesichts derStu<strong>die</strong>nreformen stellen, <strong>die</strong> der Bologna-Prozess <strong>an</strong>getrieben hat. Diezentralen Dokumente des Bologna-Prozesses br<strong>in</strong>gen eher zum Ausdruck,dass es geme<strong>in</strong>same Herausforderungen <strong>und</strong> geme<strong>in</strong>same Fragen gibt.Die meisten Behauptungen jedoch, dass bestimmte Antworten sich ausBologna ergäben <strong>und</strong> <strong>an</strong>dere falsch seien, s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>teress<strong>an</strong>teLegitimationsspiele, aber <strong>in</strong> der Sache nicht ernst zu nehmen.1.2 Die Bologna-Reform als Harmonisierungvon Fragen <strong>an</strong> <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>ngängeDie Stu<strong>die</strong> „Die Curricula-Reform <strong>an</strong> Schweizer Hochschulen“Dr. Peter Tremp, Thomas Hildbr<strong>an</strong>d, Universität ZürichDie Bologna-Deklaration weist auf e<strong>in</strong>e Reihe von Fragen h<strong>in</strong>, welche nungeme<strong>in</strong>same Fragen der europäischen Hochschulen se<strong>in</strong> sollen. DieHarmonisierung der Fragen schärft umgekehrt auch den Blick fürunterschiedliche Realisierungsformen <strong>und</strong> macht auf den grossenGestaltungsraum sowie <strong>die</strong> Ver<strong>an</strong>twortung der e<strong>in</strong>zelnenBildungse<strong>in</strong>richtungen aufmerksam.Die Stu<strong>die</strong> «Die Curricula-Reform <strong>an</strong> Schweizer Hochschulen» 1 <strong>an</strong>alysiertausgewählte Stu<strong>die</strong>nprogramme <strong>und</strong> fragt, wie <strong>die</strong> verschiedenen«Bologna-Fragen» be<strong>an</strong>twortet werden.Datenbasis <strong>und</strong> ReichweiteDie Auswahl der Stu<strong>die</strong>ngänge erfolgte auf Gr<strong>und</strong> der Vergleichbarkeit mitder Stu<strong>die</strong> aus dem Jahr 2000 <strong>und</strong> mit Blick auf deren Repräsentativität für<strong>die</strong> Schweizer Hochschull<strong>an</strong>dschaft. Untersucht wurden 19Stu<strong>die</strong>nprogramme (meistens gleichzeitig Stu<strong>die</strong>ngänge) aus sechsFachrichtungen.Datenbasis s<strong>in</strong>d <strong>die</strong> allgeme<strong>in</strong> zugänglichen Unterlagen. Dies unterstütztden Vergleich mit der früheren Stu<strong>die</strong> <strong>und</strong> gibt H<strong>in</strong>weise auf <strong>die</strong>Umsetzung jener Zielsetzung der Bologna-Reform, nach der <strong>die</strong>Information sowohl für Stu<strong>die</strong>n<strong>in</strong>teressierte als auch für <strong>an</strong>dereZielgruppen wie etwa Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gsver<strong>an</strong>twortliche im europäischenHochschulraum zu verbessern ist.Mit <strong>die</strong>sem Vorgehen s<strong>in</strong>d E<strong>in</strong>schränkungen für <strong>die</strong> Interpretation derDaten verb<strong>und</strong>en:1Die Stu<strong>die</strong> wurde von der Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS) <strong>und</strong> derUniversität Zürich f<strong>in</strong><strong>an</strong>ziert <strong>und</strong> von e<strong>in</strong>em Wissenschaftlichen Beirat (Vorsitz: Prof. Dr.Philipp Gonon) begleitet. Die Stu<strong>die</strong> k<strong>an</strong>n bezogen werden unter www.lehre.uzh.ch oderwww.bolognareform.ch. Dort f<strong>in</strong>den sich auch alle Literaturverweise dokumentiert.
541.2 Die Bologna-Reform als Harmonisierung von Fragen <strong>an</strong> <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>ngänge1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 55• Stu<strong>die</strong>nreglemente beschreiben nicht <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>nrealität.• Stu<strong>die</strong>rbarkeit kommt nicht <strong>in</strong> den Blick.• Gr<strong>und</strong>überlegungen <strong>und</strong> Konzepte können – sofern nicht expliziert –nicht <strong>an</strong>alysiert werden.Die Kriterien der Analyse orientieren sich <strong>an</strong> den Referenzpunkten, <strong>die</strong> <strong>in</strong>den Gr<strong>und</strong>satzpapieren des Bologna-Prozesses (Kommuniqués derM<strong>in</strong>isterkonferenzen <strong>und</strong> der EUA, rechtliche Gr<strong>und</strong>lagen für SchweizerHochschulen etc.) dokumentiert s<strong>in</strong>d sowie <strong>an</strong> modellhaften Überlegungen<strong>und</strong> Erfahrungen Bologna naher Projekte (Tun<strong>in</strong>g-Projekt etc.)Betrachtet wurden strukturelle Aspekte (Modularisierung,Stu<strong>die</strong>ne<strong>in</strong>g<strong>an</strong>gsphase, Leistungsnachweise etc.) <strong>und</strong> <strong>in</strong>haltliche Aspekte(Überfachliche Kompetenzen, Employability, Europäische Dimension etc.),aber auch Fragen des Reformprozesses.Allgeme<strong>in</strong>e BeobachtungenDie Ergebnisse der Stu<strong>die</strong> münden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Reihe von Beobachtungen (vgl.Überblick am Schluss des Beitrags), <strong>die</strong> sich <strong>in</strong> drei allgeme<strong>in</strong>enFeststellungen zusammenfassen lassen, <strong>die</strong> <strong>in</strong>sgesamt jenen von <strong>an</strong>derennationalen <strong>und</strong> <strong>in</strong>ternationalen Analysen (beispielsweise Trend 5, Bolognawith Students Eyes) entsprechen.Bologna-Fragestellungen s<strong>in</strong>d bek<strong>an</strong>ntGr<strong>und</strong>sätzlich s<strong>in</strong>d <strong>die</strong> zentralen Strukturelemente (Stu<strong>die</strong>nstufen,akkumulatives Kreditpunktesystem) umgesetzt. Die erfolgreiche«Harmonisierung der Fragestellungen» zeigt sich auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er deutlichveränderten Begrifflichkeit, <strong>die</strong> sich <strong>in</strong> den letzten Jahren etabliert hat –wenn auch <strong>die</strong>se Begriffe noch une<strong>in</strong>heitlich verwendet werden. Sie wirdzudem bestätigt <strong>in</strong> veränderten org<strong>an</strong>isatorischen Strukturen: Es habensich neue Funktionen gebildet <strong>und</strong> etabliert (auf der Ebene derStu<strong>die</strong>nprogramme etwa <strong>die</strong> Funktion e<strong>in</strong>es Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gsver<strong>an</strong>twortlichen)– e<strong>in</strong>e wichtige Basis für <strong>die</strong> <strong>an</strong>stehenden nächsten Schritte.Umsetzung oft erst oberflächlichBei den <strong>in</strong>haltlichen Fragestellungen zeigt sich, dass <strong>die</strong>se wohl<strong>an</strong>gekommen s<strong>in</strong>d, <strong>die</strong> Antworten aber noch wenig versiert ausfallen. Zwarwerden <strong>die</strong> Bologna-Fragen als Verpflichtung zur Antwort verst<strong>an</strong>den. DieAntworten bleiben aber häufig rudimentär <strong>und</strong> wenig systematischumgesetzt, <strong>die</strong> Ch<strong>an</strong>cen des <strong>Neue</strong>n werden kaum erk<strong>an</strong>nt <strong>und</strong> seltengenutzt.Curricula-Konzeptionen vorwiegend traditionellDie Curricula-Konzeptionen orientieren sich erst vere<strong>in</strong>zelt systematisch <strong>an</strong>den Lernprozessen der Stu<strong>die</strong>renden <strong>und</strong> <strong>an</strong> den zu erwerbendenKompetenzen. Das Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>gebot wird noch kaum als Angebotbeschrieben, das Lernprozesse <strong>und</strong> damit den Erwerb bestimmterKompetenzen zielgerichtet unterstützt. Damit wird auch <strong>die</strong> <strong>an</strong>gestrebteVergleichbarkeit der Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>gebote <strong>in</strong> ihrerKompetenzvermittlungsfunktion erschwert.Insgesamt sche<strong>in</strong>t sich auch hier zu bestätigen, dass solche Curricula-Reformen kaum Innovationen hervorbr<strong>in</strong>gen, dass sich aber bereitsunternommene <strong>in</strong>novative Entwicklungen nun <strong>in</strong> den Stu<strong>die</strong>nplänen <strong>und</strong> -reglementen nachschreiben lassen.Die <strong>in</strong>sgesamt ger<strong>in</strong>ge <strong>in</strong>haltliche Innovation könnte aber auch damitzusammenhängen, dass <strong>die</strong> Trägerschaft der Stu<strong>die</strong>ngänge bei denherkömmlichen Instituten <strong>und</strong> Fakultäten liegt. Diese Zuständigkeit leisteteher e<strong>in</strong>er Input-orientierten Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gskonzeption Vorschub,woh<strong>in</strong>gegen bei e<strong>in</strong>em Output-orientierten Ansatz der Bologna-Reform <strong>die</strong>relev<strong>an</strong>ten org<strong>an</strong>isatorischen Ver<strong>an</strong>twortlichkeiten von den Zielsetzungen<strong>und</strong> Prozessen her abgeleitet würden.Konkretisierende BeispieleDie drei Feststellungen sollen hier <strong>an</strong> konkreten Beispielen kurz erläutertwerden: am Pr<strong>in</strong>zip der Modularisierung, <strong>an</strong> der Stu<strong>die</strong>ne<strong>in</strong>g<strong>an</strong>gsphase<strong>und</strong> <strong>an</strong> den Überfachlichen Kompetenzen.
561.2 Die Bologna-Reform als Harmonisierung von Fragen <strong>an</strong> <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>ngänge1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 57Beispiel ModularisierungModularisierung k<strong>an</strong>n als Pr<strong>in</strong>zip der Strukturierung <strong>und</strong> Sequenzierungvon Bildungs<strong>an</strong>geboten <strong>und</strong> Stu<strong>die</strong>ngängen beschrieben werden: Lernstoff<strong>und</strong> Zielsetzungen werden so portioniert, dass sie <strong>an</strong>gemessen lehr-, lern<strong>und</strong>prüfbar s<strong>in</strong>d. Module s<strong>in</strong>d d<strong>an</strong>n «Lerne<strong>in</strong>heiten», <strong>und</strong> <strong>die</strong>ses Lernenwird von den zu erreichenden Kompetenzen her org<strong>an</strong>isiert <strong>und</strong>beschrieben. Entsprechend s<strong>in</strong>d auch Leistungsnachweise – also <strong>die</strong>Nachweise der erworbenen Kompetenzen – zentrale Elementemodularisierter Stu<strong>die</strong>ngänge.Diese Ausrichtung <strong>an</strong> den zu erwerbenden (E<strong>in</strong>zel-)Kompetenzen lässt <strong>die</strong>Suche nach der optimalen <strong>in</strong>neren Ordnung der Stu<strong>die</strong>n<strong>in</strong>halte – e<strong>in</strong>zentrales Problem der traditionellen Lehrpl<strong>an</strong>entwicklung – <strong>in</strong> denH<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> treten. Dagegen rückt der <strong>an</strong>wendungs- bzw.h<strong>an</strong>dlungsbezogene Zweck <strong>in</strong> den Vordergr<strong>und</strong> <strong>und</strong> unterschiedlicheOrdnungskriterien können gleichzeitig realisiert <strong>und</strong> mite<strong>in</strong><strong>an</strong>derkomb<strong>in</strong>iert werden.Untersucht wurde nun, welche Konzepte von Modularisierung realisiert<strong>und</strong> wie <strong>die</strong> möglichen Vorteile e<strong>in</strong>er Modularisierung desStu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>gebotes genutzt werden. Welche Modulgrößen s<strong>in</strong>d vorgesehen?Welche Überlegungen bestimmen <strong>die</strong> Reihenfolge der Module? S<strong>in</strong>dModule zu größeren E<strong>in</strong>heiten verknüpft oder <strong>in</strong>haltlichenStu<strong>die</strong>nbereichen zugeordnet? Welche Flexibilität <strong>und</strong> welcheEntscheidungsräume s<strong>in</strong>d vorgesehen? S<strong>in</strong>d <strong>in</strong>dividuelleSchwerpunktsetzungen vorgesehen?Modularisierung f<strong>in</strong>det als Strukturierungspr<strong>in</strong>zip <strong>in</strong> allen <strong>an</strong>alysiertenStu<strong>die</strong>ngängen Anwendung. Allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>d <strong>die</strong> Modulkonzeptionenke<strong>in</strong>eswegs e<strong>in</strong>heitlich, <strong>und</strong> teilweise s<strong>in</strong>d widersprüchlicheInterpretationen sichtbar, beispielsweise wenn e<strong>in</strong> Modul nicht <strong>die</strong>hierarchisch unterste E<strong>in</strong>heit mit Kreditpunkten ist. Aber auchModulgrößen <strong>und</strong> Attribute der Module variieren von Hochschule zuHochschule deutlich. Bisweilen zeigt sich <strong>in</strong> der Modulkonzeption auche<strong>in</strong>e enge Verknüpfung von Ver<strong>an</strong>staltungsformaten <strong>und</strong> Kreditpunkten.Insgesamt ersche<strong>in</strong>en <strong>die</strong> Module nicht als «zentrale E<strong>in</strong>heiten e<strong>in</strong>esStu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gs», sondern als zusätzliche Beschreibungskategorie, <strong>die</strong> rechttraditionell mittels Pflicht- <strong>und</strong> Wahlpflicht-Charakteristika <strong>in</strong> <strong>die</strong> Curriculae<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en ist. Damit bleiben wesentliche Ch<strong>an</strong>cen (etwa <strong>die</strong>Flexibilisierung) ungenutzt.Beispiel Stu<strong>die</strong>ne<strong>in</strong>g<strong>an</strong>gsphaseDie «Stu<strong>die</strong>ne<strong>in</strong>g<strong>an</strong>gsphase» bezeichnet <strong>die</strong> erste Phase e<strong>in</strong>es Studiums.Sie gibt Antwort auf <strong>die</strong> Frage, wie der Beg<strong>in</strong>n e<strong>in</strong>es Studiums gestaltetse<strong>in</strong> soll, damit das Studium gel<strong>in</strong>gt. Insbesondere geht es um <strong>die</strong> Passungvon <strong>in</strong>dividuellen Voraussetzungen <strong>und</strong> <strong>in</strong>stitutionellen Erwartungen.Wir haben gefragt, ob e<strong>in</strong>e solche Stu<strong>die</strong>ne<strong>in</strong>g<strong>an</strong>gsphase vorgesehen ist<strong>und</strong> welche Funktion sie erfüllen soll, wie der Abschluss <strong>die</strong>ser Phasegestaltet ist <strong>und</strong> wie der Überg<strong>an</strong>g zur nächsten Stu<strong>die</strong>nphase realisiertwird?Tatsächlich s<strong>in</strong>d bei praktisch allen Stu<strong>die</strong>ngängen <strong>die</strong> ersten beidenSemester des <strong>Bachelor</strong>-Studiums als mehr oder weniger klar abgegrenzte,eigenständige Stu<strong>die</strong>nstufe konzipiert. Obwohl sie unterschiedlichbezeichnet werden («Assessmentstufe», «E<strong>in</strong>stiegssemester», «Basisjahr»,«Propädeutische Phase», «Erster Teil» etc.), liegt der Schwerpunkt bei derVermittlung von so gen<strong>an</strong>ntem Gr<strong>und</strong>lagenwissen.Die Stu<strong>die</strong>ne<strong>in</strong>g<strong>an</strong>gsphase k<strong>an</strong>n – wenn sie stark reglementiert ist – als«Makro-Modul» begriffen werden. Als solches unterläuft es aber eigentlichgewünschte Möglichkeiten der Modularisierung wie Zeitflexibilität oder<strong>in</strong>dividuelle <strong>in</strong>haltliche Schwerpunktsetzung; das Pr<strong>in</strong>zip derModularisierung wird durch e<strong>in</strong> Lehrg<strong>an</strong>gpr<strong>in</strong>zip überformt. Bei e<strong>in</strong>emLehrg<strong>an</strong>g s<strong>in</strong>d häufig alle Module Pflicht, ihre Reihenfolge ist weitgehendfestgelegt <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Gesamtprüfung zum Stufenabschluss vorgesehen.Beispiel Überfachliche KompetenzenDas Universitätsstudium ist als Fachstudium org<strong>an</strong>isiert. Gleichwohlbest<strong>an</strong>d immer schon der Anspruch, im Fachstudium e<strong>in</strong>e Reihe vonfachübergreifenden Kompetenzen zu erreichen, <strong>die</strong> – so <strong>die</strong> traditionelleFormulierung – zu e<strong>in</strong>em gebildeten Menschen gehören.Wissenschaftliches H<strong>an</strong>deln setzt entsprechende Kompetenzen voraus.Neben e<strong>in</strong>em elaborierten Fachwissen <strong>und</strong> -können s<strong>in</strong>d auchüberfachliche Kompetenzen notwendig. Nur so können komplexe
581.2 Die Bologna-Reform als Harmonisierung von Fragen <strong>an</strong> <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>ngänge1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 59<strong>Anforderungen</strong> bewältigt werden, nur so gel<strong>an</strong>gt Fachexpertise adäquatzur Anwendung. Insofern leisten Überfachliche Kompetenzen auch e<strong>in</strong>enBeitrag für <strong>die</strong> «Employability».In e<strong>in</strong>em Grossteil der <strong>an</strong>alysierten Stu<strong>die</strong>ngänge f<strong>in</strong>den sich vere<strong>in</strong>zelteH<strong>in</strong>weise auf Überfachliche Kompetenzen. Es zeigen sich auch hierbegriffliche Unterschiede, sowohl zwischen den Hochschulen als auch<strong>in</strong>nerhalb derselben Hochschule zwischen unterschiedlichenStu<strong>die</strong>nrichtungen.Insgesamt ist festzuhalten, dass es ke<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Vorstellung davongibt, was Überfachliche Kompetenzen s<strong>in</strong>d, <strong>und</strong> wie deren Erwerb s<strong>in</strong>nvoll<strong>in</strong> e<strong>in</strong> Universitätsstudium <strong>in</strong>tegriert wird.Konkretisierung auf Fachebene als EmpfehlungDie Stu<strong>die</strong> schliesst mit vier Empfehlungen zu den nächsten Schritten desReformprozesses (vgl. Überblick am Schluss des Beitrags). Besonderss<strong>in</strong>nvoll <strong>und</strong> notwendig erachten wir Weiterentwicklungen auf der Ebeneder e<strong>in</strong>zelnen Fächer (resp. Fachgruppen) bei gleichzeitighochschulübergreifendem Austausch.Damit wird <strong>die</strong> ausgeprägte Fachidentifikation von Hochschuldozierendenberücksichtigt wie auch <strong>die</strong> Tatsache, dass kohärente Lösungen, <strong>die</strong>verschiedene Elemente <strong>in</strong> <strong>an</strong>gemessener Art verb<strong>in</strong>den, am besten <strong>in</strong> derKonkretisierung für e<strong>in</strong>zelne Fächer sichtbar werden.Notwendig s<strong>in</strong>d <strong>an</strong>regende Illustrationen <strong>und</strong> Good Practice-Beispiele, <strong>und</strong>auch systematische Vergleiche <strong>und</strong> Vergleichskriterien. Wir vermuten, dasse<strong>in</strong> verstärkter Austausch <strong>in</strong>nerhalb der Stu<strong>die</strong>nfächer auch <strong>in</strong>novativeLösungen sichtbar <strong>und</strong> damit diskutierbar macht, Lösungen, <strong>die</strong> heutenoch kaum über <strong>die</strong> e<strong>in</strong>zelne Hochschule h<strong>in</strong>aus bek<strong>an</strong>nt s<strong>in</strong>d.Wenn wir den Erfolg der bisherigen Reformbemühungen dar<strong>in</strong> sehen, dass<strong>die</strong> «Bologna-Themen» bek<strong>an</strong>nt <strong>und</strong> präsent s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> sich <strong>die</strong>Harmonisierung also hauptsächlich <strong>in</strong> der Fragestellung zeigt, so ist <strong>die</strong>sbereits e<strong>in</strong>e beachtenswerte Leistung. Unterschiede zwischen denStu<strong>die</strong>ngängen sollen – <strong>die</strong>s sei hier ausdrücklich betont – weiterh<strong>in</strong>bestehen bleiben, <strong>die</strong> Antworten auf <strong>die</strong> «harmonisierten Fragen»unterschiedlich ausfallen.E<strong>in</strong>e konsequent Kompetenzenorientierte Stu<strong>die</strong>nreform, verb<strong>und</strong>en mitdem Willen zur Tr<strong>an</strong>sparenz, nutzt das <strong>in</strong> den Universitäten vorh<strong>an</strong>deneWissen besser – zu Gunsten der Stu<strong>die</strong>renden wie der Gesellschaft. Undgerade <strong>die</strong> gelungene Verb<strong>in</strong>dung von Modularisierung <strong>und</strong>Kompetenzorientierung vermag e<strong>in</strong>e zukunftsweisende Form universitärerBildung zu realisieren. In <strong>die</strong>sem S<strong>in</strong>ne wird <strong>die</strong> Universität als Idee <strong>und</strong>Realität autonomer <strong>und</strong> <strong>in</strong>novativer Denkfähigkeit nicht trotz, sondernwegen «Bologna» Best<strong>an</strong>d haben <strong>und</strong> gestärkt <strong>in</strong> <strong>die</strong> Zukunft wirken.Beobachtungen im ÜberblickBeobachtung 1: Die Bologna-Themen s<strong>in</strong>d <strong>an</strong> den Schweizer Hochschulenim S<strong>in</strong>ne von Zielgrössen bek<strong>an</strong>nt <strong>und</strong> <strong>die</strong> Basiselemente (Stu<strong>die</strong>nstufen,akkumulatives Kreditpunktesystem) s<strong>in</strong>d strukturell umgesetzt.Beobachtung 2: Über weite Strecken, aber noch nicht umfassend,verwenden <strong>die</strong> Schweizer Hochschulen e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Term<strong>in</strong>ologie; <strong>die</strong>Begriffe bezeichnen jedoch teilweise nicht genau das Gleiche.Beobachtung 3: Trotz allgeme<strong>in</strong>er Verwendung von Modul zurBezeichnung von Untere<strong>in</strong>heiten der Stu<strong>die</strong>ngänge wird Modularisierungweitgehend erst als oberflächiges Strukturierungspr<strong>in</strong>zip umgesetzt.Beobachtung 4: Die Modularisierung wird vielfach durch Mech<strong>an</strong>ismenüberformt, <strong>die</strong> den neuen Stu<strong>die</strong>ngängen e<strong>in</strong>en lehrg<strong>an</strong>gsartigen Charaktergeben; damit wird <strong>in</strong>sbesondere <strong>die</strong> <strong>an</strong>gestrebte Flexibilisierungunterlaufen.Beobachtung 5: Das Vollzeitstudium ist das dom<strong>in</strong>ierende Referenzmodellfür <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gskonzipierung; e<strong>in</strong> Teilzeitstudium wird als Ausnahmebetrachtet, für das ke<strong>in</strong>e besonderen Konzepte erforderlich s<strong>in</strong>d.Beobachtung 6: Die Stu<strong>die</strong>rbarkeit der neuen Stu<strong>die</strong>ngänge wird bei derKonzipierung nicht besonders berücksichtigt; sie sche<strong>in</strong>t vielmehr alle<strong>in</strong>durch <strong>die</strong> Möglichkeit zur Verlängerung der Stu<strong>die</strong>ndauer sichergestelltworden zu se<strong>in</strong>.
601.2 Die Bologna-Reform als Harmonisierung von Fragen <strong>an</strong> <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>ngänge1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 61Beobachtung 7: Ausg<strong>an</strong>gspunkt für <strong>die</strong> Gestaltung des Lehr-Lernprozessesist weiterh<strong>in</strong> <strong>die</strong> Präsenzzeit; das Selbststudium ist <strong>die</strong> Zeit, <strong>die</strong> d<strong>an</strong>ebenübrig bleibt.Beobachtung 8: Die zentrale Zielsetzung des Bologna-Prozesses, <strong>die</strong>Stu<strong>die</strong>ngänge nach e<strong>in</strong>em stu<strong>die</strong>rendenorientierten Modell umzugestalten,lässt sich als Leitidee der Stu<strong>die</strong>nreformen nicht erkennen.Beobachtung 9: Die Konzepte der Leistungsnachweise s<strong>in</strong>d noch kaum <strong>an</strong><strong>die</strong> <strong>Anforderungen</strong> e<strong>in</strong>es akkumulativen <strong>und</strong> modularisierten Lehr-Lern-Modells <strong>an</strong>gepasst worden.Beobachtung 10: Die <strong>Anforderungen</strong> <strong>an</strong> Stu<strong>die</strong>nabschluss <strong>und</strong>Abschlussarbeiten s<strong>in</strong>d unterschiedlich, auch <strong>in</strong>nerhalb des gleichenFachgebietes.Beobachtung 11: Die Zielsetzung e<strong>in</strong>er verstärkten Beachtung <strong>und</strong>Förderung der europäischen Dimension <strong>in</strong> den Curricula wird wenigbeachtet <strong>und</strong> vor allem als Sprachenfrage beh<strong>an</strong>delt.Beobachtung 12: Bei den Stu<strong>die</strong>ngängen ist Arbeitsmarktorientierung vorallem als Information zu zukünftigen Beschäftigungsfeldern derAbsolvent<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Absolventen fassbar.Beobachtung 13: Die kaum vorh<strong>an</strong>dene Kompetenzorientierung der neuenStu<strong>die</strong>ngänge erschwert <strong>die</strong> <strong>an</strong>gestrebte Vergleichbarkeit derStu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>gebote.Beobachtung 14: Die Mobilität wird durch <strong>die</strong> neuen Stu<strong>die</strong>ngänge <strong>und</strong>ihre Pr<strong>in</strong>zipien nicht besser gefördert als im früheren Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gssystem.Beobachtung 15: Die Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gskonzepte s<strong>in</strong>d noch weitgehend <strong>an</strong>gr<strong>und</strong>ständigen Bildungszielen (der Erstausbildung) <strong>und</strong> nicht <strong>an</strong> e<strong>in</strong>emModell des lebensbegleitenden Lernens (Lifelong Learn<strong>in</strong>g) orientiert.Beobachtung 16: Der Reformprozess wird <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie als <strong>in</strong>terneAufgabe der e<strong>in</strong>zelnen Hochschule <strong>und</strong> Fächer im Rahmen vongesamtschweizerischen Vorgaben verst<strong>an</strong>den. E<strong>in</strong>e fachbezogeneKoord<strong>in</strong>ation oder <strong>die</strong> Berücksichtigung von Aspekten derausseruniversitären Anspruchsgruppen hat ger<strong>in</strong>ge Priorität.Beobachtung 17: Institute <strong>und</strong> Fakultäten als nicht h<strong>in</strong>terfragte Träger derStu<strong>die</strong>ngänge leisten e<strong>in</strong>er Input-orientierten Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gskonzeptionVorschub. Der Output-orientierte Ansatz der Bologna-Reform wird <strong>in</strong><strong>die</strong>sen <strong>in</strong>stitutionellen Zusammenhängen wenig explizit gefördert.Empfehlungen im ÜberblickEmpfehlung 1: Die Rektorenkonferenzen der Universitäten, derFachhochschulen <strong>und</strong> der Pädagogischen Hochschulen priorisieren <strong>die</strong>Zielsetzungen <strong>und</strong> def<strong>in</strong>ieren <strong>die</strong> nächsten Entwicklungsschritte.Empfehlung 2: Konkretisierung von <strong>in</strong> umfassendem S<strong>in</strong>nbolognagerechten Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>geboten durch Koord<strong>in</strong>ation auf Fachebene.Empfehlung 3: Bereitstellen von Good Practice-Beispielen zu ausgewähltenFragestellungen der Bologna-Reform.Empfehlung 4: Vertiefende Analysen zu weiteren zentralen Aspekten derBologna-Reform.
62 1.3 HIS-Stu<strong>die</strong> zu Stu<strong>die</strong>nabbruchquoten von 20081.3 HIS-Stu<strong>die</strong> zu Stu<strong>die</strong>nabbruchquoten von2008Dr. Ulrich Heuble<strong>in</strong>, HIS Hochschul-Informations-System GmbHDie Entwicklung der Stu<strong>die</strong>nabbruchquote <strong>an</strong> den deutschen HochschulenErgebnisse e<strong>in</strong>er Berechnung des Stu<strong>die</strong>nabbruchs auf der Basis des Absolventenjahrg<strong>an</strong>gs2006Die Ausbildung der Stu<strong>die</strong>renden <strong>an</strong> den deutschen Hochschulen k<strong>an</strong>n sichnicht alle<strong>in</strong> auf e<strong>in</strong>e hohe fachliche <strong>und</strong> methodische Qualität der <strong>Lehre</strong>orientieren. Effizienz <strong>und</strong> sorgsamer Umg<strong>an</strong>g mit gesellschaftlichen wiepersönlichen Ressourcen s<strong>in</strong>d nicht weniger von Bedeutung. E<strong>in</strong> solchesVerständnis des Erwerbs von akademischen Qualifikationen verl<strong>an</strong>gt vonUniversitäten <strong>und</strong> Fachhochschulen, alle Bewerber, <strong>die</strong> zum Studium aufgenommenwerden <strong>und</strong> über <strong>die</strong> entsprechenden Voraussetzungen verfügen,auch zu e<strong>in</strong>em Hochschulabschluss zu führen. Die Quote des Stu<strong>die</strong>nerfolgsbzw. des Stu<strong>die</strong>nabbruchs wird damit zu e<strong>in</strong>em der zentralen Indikatorenfür <strong>die</strong> Ausbildungsleistungen im tertiären Bildungssektor.Zum vierten Mal <strong>in</strong> Folge legt HIS differenzierte Quoten zum Stu<strong>die</strong>nabbruchvor. Diese Werte s<strong>in</strong>d dabei auf der Basis e<strong>in</strong>es Jahrg<strong>an</strong>gs von Hochschulabsolventenermittelt worden. Nach den Stu<strong>die</strong>n zu den Absolventenjahrgängen1999, 2002 <strong>und</strong> 2004 können jetzt Ergebnisse unter Bezug auf<strong>die</strong> Absolventen 2006 dargestellt werden. Das Vorgehen bei <strong>die</strong>ser Analyseentspricht dabei völlig dem der vor<strong>an</strong>geg<strong>an</strong>genen Untersuchungen. Allebisher gültigen methodischen Prämissen <strong>und</strong> Berechnungsschritte des <strong>an</strong>gew<strong>an</strong>dtenVerfahrens s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>gehalten. Auf <strong>die</strong> Art <strong>und</strong> Weise ist <strong>die</strong> Vergleichbarkeitder ermittelten Stu<strong>die</strong>nabbruchquoten zu den verschiedenenStu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängerjahrgängen vollständig gewährleistet.Als Stu<strong>die</strong>nabbrecher s<strong>in</strong>d ehemalige Stu<strong>die</strong>rende zu verstehen, <strong>die</strong> zwardurch Immatrikulation e<strong>in</strong> Erststudium <strong>an</strong> e<strong>in</strong>er deutschen Hochschule aufgenommenhaben, d<strong>an</strong>n aber das Hochschulsystem endgültig ohne (erstes)Abschlussexamen verlassen. Nur Stu<strong>die</strong>rende, <strong>die</strong> e<strong>in</strong> Erststudium aufgeben,s<strong>in</strong>d deshalb als Stu<strong>die</strong>nabbrecher <strong>an</strong>zusehen. Dementsprechend wird<strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>nabbruchquote def<strong>in</strong>iert als der Anteil der Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fänger e<strong>in</strong>es1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 63Jahrg<strong>an</strong>gs, <strong>die</strong> ihr Erststudium beenden, ohne es mit e<strong>in</strong>em Examen abzuschließen.Ihre Berechnung erfolgt beim HIS-Verfahren über den Kohortenvergleiche<strong>in</strong>es Absolventen- mit dem korrespon<strong>die</strong>renden Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängerjahrg<strong>an</strong>g.Dazu werden Best<strong>an</strong>dsdaten der amtlichen Hochschulstatistikzu Absolventen <strong>und</strong> Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängern her<strong>an</strong>gezogen. Da aber <strong>die</strong> Absolventene<strong>in</strong>es Jahres aus verschiedenen Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängerjahrgängen stammen,wird bei den HIS-Berechnungen der ausgewählte Absolventenjahrg<strong>an</strong>gnicht nur mit e<strong>in</strong>em, sondern mit allen relev<strong>an</strong>ten Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängerjahrgängen<strong>in</strong>s Verhältnis gesetzt. Dazu bedarf es der "Neu"-Erstellung e<strong>in</strong>esentsprechenden korrespon<strong>die</strong>renden Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängerjahrg<strong>an</strong>gs, <strong>in</strong>dem alle <strong>in</strong> Frage kommenden Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängerjahrgänge mit dem Gewichte<strong>in</strong>gehen, der ihrem jeweiligen Anteil <strong>an</strong> den betrachteten Absolventen e<strong>in</strong>esJahres entspricht.Durch <strong>die</strong> E<strong>in</strong>beziehung bestimmter Korrekturfaktoren können sowohl <strong>die</strong>jährlichen Änderungen <strong>in</strong> den Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängerzahlen als auch <strong>in</strong> den Stu<strong>die</strong>nzeitenberücksichtigt werden. Die Beachtung des Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gs-, Fach<strong>und</strong>Hochschulwechsel der Stu<strong>die</strong>renden erlaubt differenzierte Berechnungender Stu<strong>die</strong>nabbruchquoten für ausgewählte Fächergruppen <strong>und</strong> Stu<strong>die</strong>nbereiche<strong>an</strong> Universitäten <strong>und</strong> Fachhochschulen sowie erstmals auch für<strong>Bachelor</strong>-Stu<strong>die</strong>ngänge. Das Ermitteln solcher spezifischer Werte setzt allerd<strong>in</strong>gsvoraus, dass Stu<strong>die</strong>rende, <strong>die</strong> e<strong>in</strong>en Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gs-, Fach- oderHochschulwechsel vorgenommen haben, wieder auf ihren ursprünglichenStu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>g bei Stu<strong>die</strong>naufnahme zurückgeführt werden. Damit beziehensich <strong>die</strong> ausgewiesenen Abbruchquoten immer auf <strong>die</strong>se Ursprungsgruppe.E<strong>in</strong> Stu<strong>die</strong>render, der von e<strong>in</strong>em Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>g <strong>in</strong> der Fächergruppe Wirtschaftswissenschaftenzu e<strong>in</strong>em <strong>in</strong> der Fächergruppe Mathematik/Naturwissenschaftenwechselt <strong>und</strong> dort se<strong>in</strong> Studium ohne Abschluss beendet,wird trotzdem als Stu<strong>die</strong>nabbrecher <strong>in</strong> Wirtschaftswissenschaften gewertet.Dieses Vorgehen gilt auch für <strong>die</strong> ausgewiesenen Quoten zu den <strong>Bachelor</strong>-Stu<strong>die</strong>ngängen. Stu<strong>die</strong>rende, <strong>die</strong> ihre <strong>an</strong>gestrebte Abschlussart gewechselthaben <strong>und</strong> ihr Studium im neuen Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>g aufgeben, werden unter denStu<strong>die</strong>nabbrechern mit dem ursprünglich <strong>an</strong>gestrebten Abschluss registriert.Unter den Absolventen 2006 s<strong>in</strong>d zu statistisch relev<strong>an</strong>ten Anteilen Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängeraus den Jahren 1993 bis 2005 vertreten. Dementsprechendwurde der neugebildete korrespon<strong>die</strong>rende Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängerjahrg<strong>an</strong>g auch
64 1.3 HIS-Stu<strong>die</strong> zu Stu<strong>die</strong>nabbruchquoten von 2008aus <strong>die</strong>sen Jahrgängen zusammengesetzt. Die größte Bedeutung kommtdabei den Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängern von 1999 bis 2001 zu. Sie stellen <strong>die</strong> Mehrzahlder e<strong>in</strong>bezogenen Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fänger. Aus <strong>die</strong>sem Gr<strong>und</strong> beziehen sich<strong>die</strong> auf der Basis der Absolventen 2006 ermittelten Stu<strong>die</strong>nabbruchwertevor allem auf <strong>die</strong>se Jahrgänge. E<strong>in</strong>e Ausnahme stellen lediglich <strong>die</strong> <strong>Bachelor</strong>-Stu<strong>die</strong>ngängedar. Hier kommt den Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängern von 2002 bis2004 <strong>die</strong> wichtigste Rolle zu, deshalb spiegelt <strong>die</strong> betreffende Abbruchquote<strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie deren Abbruchverhalten wider.Die Stu<strong>die</strong>nabbruchquote für <strong>die</strong> deutschen Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fänger hat sich gegenüberder letzten Berechnung um e<strong>in</strong>en Prozentpunkt verr<strong>in</strong>gert. Betrugsie für <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängerjahrgänge von Ende der neunziger Jahre überalle Fächergruppen <strong>und</strong> Hochschulen 22 %, so liegt sie jetzt für <strong>die</strong> Jahrgängevon Anf<strong>an</strong>g 2000 bei 21 % . Das bedeutet: Von e<strong>in</strong>em Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängerjahrg<strong>an</strong>gverlassen von 100 erstimmatrikulierten Stu<strong>die</strong>renden 21<strong>die</strong> Hochschule endgültig ohne Examen.Der ger<strong>in</strong>gfügige Rückg<strong>an</strong>g des Stu<strong>die</strong>nabbruchs ist nicht e<strong>in</strong>fach als Bestätigungbisheriger Abbruchwerte zu verstehen. H<strong>in</strong>ter der sche<strong>in</strong>bar unwesentlichenM<strong>in</strong>derung der Gesamtquote verbergen sich bestimmte, z. T.disparate Entwicklungen. Deutlich wird das schon <strong>an</strong> der Differenz zwischenden Stu<strong>die</strong>nabbruchquoten der Universitäten <strong>und</strong> der Fachhochschulen.Während <strong>an</strong> den Universitäten der Anteil der Stu<strong>die</strong>nabbrecher im Vergleichzur letzten Messung um vier Prozentpunkte auf 20 % zurückgeht,steigt er <strong>an</strong> den Fachhochschulen von 17 % auf e<strong>in</strong>en Wert von 22 %. DieseVeränderungen, <strong>die</strong> zum<strong>in</strong>dest partiell e<strong>in</strong>e Annäherung des Abbruchverhaltens<strong>in</strong> den beiden Hochschularten widerspiegeln, können aber nochnicht als sich fortsetzende Tendenz <strong>in</strong>terpretiert werden. An den Universitätenliefert <strong>die</strong> aktuell vorliegende Quote e<strong>in</strong>en ersten Wert, der aus der bisl<strong>an</strong>gdort vorherrschenden Konst<strong>an</strong>z beim Stu<strong>die</strong>nabbruch ausbricht. Aufe<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>zelnen Messwert lässt sich weder e<strong>in</strong> Trend noch <strong>die</strong> Sicherheitgründen, dass das jetzt errungene niedrige Abbruchniveau beibehaltenwird. Das beweist <strong>die</strong> Entwicklung <strong>an</strong> den Fachhochschulen. Die dort derzeitzu konstatierende Erhöhung des Stu<strong>die</strong>nabbruchs lässt sich auch alsRückkehr auf e<strong>in</strong> Abbruchniveau <strong>in</strong>terpretieren, das für <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängervon Anf<strong>an</strong>g <strong>und</strong> Mitte der neunziger Jahre charakteristisch war. Ke<strong>in</strong>esfallsk<strong>an</strong>n jetzt schon geschlussfolgert werden, dass sich der Stu<strong>die</strong>nabbruch<strong>an</strong> den Fachhochschulen weiter erhöhen wird.1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 65Den Veränderungen <strong>in</strong> der Stu<strong>die</strong>nabbruchquote <strong>an</strong> Universitäten <strong>und</strong>Fachhochschulen liegen fächergruppen- <strong>und</strong> stu<strong>die</strong>nbereichsspezifischeEntwicklungen zugr<strong>und</strong>e. Dabei hat auch <strong>die</strong> Situation <strong>in</strong> den <strong>Bachelor</strong>-Stu<strong>die</strong>ngängen zu den jeweiligen Abbruchwerten beigetragen.Der Umf<strong>an</strong>g des Stu<strong>die</strong>nabbruchs für <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fänger von 2000 bis2004 <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em <strong>Bachelor</strong>-Studium liegt über alle Hochschularten <strong>und</strong> Fächergruppenbei 30 %. Damit fällt <strong>die</strong>se Quote deutlich höher aus als <strong>die</strong>Abbruchrate <strong>in</strong>sgesamt. Für <strong>die</strong> Interpretation <strong>die</strong>ses Wertes ist allerd<strong>in</strong>gszu beachten, dass <strong>die</strong> <strong>Bachelor</strong>-Stu<strong>die</strong>ngänge für <strong>die</strong> betrachteten Jahrgängebei weitem noch nicht das gesamte Fächerprofil der Hochschulen widerspiegeln.Durch den sukzessiven Überg<strong>an</strong>g zu den <strong>Bachelor</strong>-<strong>Master</strong>-Strukturenhaben bestimmte Fachrichtungen <strong>die</strong>se Umstellung relativ schnellvorgenommen, <strong>an</strong>dere haben sich dagegen zögerlich verhalten. Das bedeutet,h<strong>in</strong>ter den betreffenden Quoten für <strong>Bachelor</strong> steht allemal nur e<strong>in</strong>ebestimmte Auswahl <strong>an</strong> Fächern mit jeweils unterschiedlichen Stu<strong>die</strong>nabbrecher<strong>an</strong>teilen.E<strong>in</strong> Vergleich etwa zwischen den Abbruchquoten der<strong>Bachelor</strong> <strong>und</strong> der Stu<strong>die</strong>renden <strong>in</strong>sgesamt würde deshalb auch fehlgehen.Dies trifft auch für <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>nabbruchquote <strong>in</strong> den <strong>Bachelor</strong>-Stu<strong>die</strong>ngängenverschiedener Hochschularten zu. Der Abbruchwert für das <strong>Bachelor</strong>-Studium <strong>an</strong> den Universitäten beträgt 25 %. Damit liegt er über den Durchschnittder Stu<strong>die</strong>naufgabe <strong>in</strong> <strong>die</strong>sen Hochschulen. Für <strong>die</strong> Bewertung <strong>die</strong>sesAnteils <strong>an</strong> Stu<strong>die</strong>nabbrechern ist allerd<strong>in</strong>gs zu beachten, dass <strong>die</strong> FächerHum<strong>an</strong>-, Zahn- <strong>und</strong> Veter<strong>in</strong>ärmediz<strong>in</strong> ke<strong>in</strong>e <strong>Bachelor</strong>-Stu<strong>die</strong>ngängeaufweisen. Ihre <strong>an</strong>haltend niedrigen Stu<strong>die</strong>nabbruchwerte gehen so <strong>in</strong> <strong>die</strong>Gesamtquote für Universitäten, aber nicht <strong>in</strong> <strong>die</strong> Quote für <strong>Bachelor</strong>-Stu<strong>die</strong>ngängemit e<strong>in</strong>. Ähnliches gilt für <strong>die</strong> Rechtswissenschaften <strong>und</strong> <strong>die</strong> Lehramts-Stu<strong>die</strong>ngänge.Sie zeichnen sich ebenfalls durch niedrigen Stu<strong>die</strong>nabbruchaus. E<strong>in</strong>e Reihe von Ländern hat <strong>die</strong>se Stu<strong>die</strong>ngänge nicht oder bisl<strong>an</strong>gnur zögerlich bzw. erst nach 2005 auf <strong>Bachelor</strong>-<strong>Master</strong>-Strukturenumgestellt, so dass <strong>die</strong> betreffenden Stu<strong>die</strong>renden für <strong>die</strong> aktuelle Berechnungdes Stu<strong>die</strong>nabbruchs im <strong>Bachelor</strong>-Studium noch ke<strong>in</strong>e wesentlicheRolle spielen. Verk<strong>an</strong>nt werden darf aber auch nicht, dass ebenfalls <strong>die</strong> Ingenieurwissenschaften<strong>an</strong> Universitäten erst <strong>in</strong> letzter Zeit vermehrt ihreStu<strong>die</strong>ngänge auf <strong>die</strong> neuen Stu<strong>die</strong>nstrukturen umstellen. Ihre <strong>an</strong>haltendhohen Stu<strong>die</strong>nabbruchquoten haben sich bei den vorliegenden Abbruchberechnungennicht auf <strong>die</strong> Werte für <strong>die</strong> <strong>Bachelor</strong>-Stu<strong>die</strong>ngänge ausgewirkt.
66 1.3 HIS-Stu<strong>die</strong> zu Stu<strong>die</strong>nabbruchquoten von 2008Die Stu<strong>die</strong>nabbruchquote im <strong>Bachelor</strong>-Studium <strong>an</strong> den Fachhochschulenfällt sehr hoch aus. Sie liegt bei 39%. Dah<strong>in</strong>ter stehen vor allem <strong>die</strong> entsprechendenStu<strong>die</strong>ngänge <strong>in</strong> den Wirtschafts- <strong>und</strong> Ingenieurwissenschaften,sie stellen den größten Teil der <strong>Bachelor</strong>-Stu<strong>die</strong>renden <strong>an</strong> Fachhochschulen.Angesichts der hohen Gesamtabbruchrate im <strong>Bachelor</strong>-Studium<strong>an</strong> Fachhochschulen ist mit Bestimmtheit davon auszugehen, dass der Anteilder Stu<strong>die</strong>nabbrecher <strong>in</strong> <strong>die</strong>sen beiden Fachrichtungen den allgeme<strong>in</strong>enDurchschnitt des Stu<strong>die</strong>nabbruchs <strong>in</strong> Wirtschafts- <strong>und</strong> Ingenieurwissenschaftendeutlich übersteigt.In den e<strong>in</strong>zelnen Fächergruppen <strong>an</strong> Universitäten zeigen sich folgende Entwicklungen:Die Fächergruppe Sprach-/Kulturwissenschaften/Sport weistzwar mit 27 % e<strong>in</strong>e relativ hohe Stu<strong>die</strong>nabbruchquote auf, aber <strong>die</strong>semWert liegt e<strong>in</strong>e deutliche Verr<strong>in</strong>gerung um fünf Prozentpunkte zugr<strong>und</strong>e.Diese Entwicklung ist entscheidend durch <strong>die</strong> Absenkung des Stu<strong>die</strong>nabbruchsim Stu<strong>die</strong>nbereich Sprach- <strong>und</strong> Kulturwissenschaften bed<strong>in</strong>gt. Warendort bisl<strong>an</strong>g immer Abbrecher<strong>an</strong>teile von über 40 % zu registrieren, sofällt jetzt zum ersten Mal <strong>die</strong> Abbruchquote unterhalb <strong>die</strong>ser Schwelle aufe<strong>in</strong>en Wert von 32 %. Es ist zu vermuten, dass <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>renden <strong>in</strong> den zugehörigen<strong>Bachelor</strong>-Stu<strong>die</strong>ngängen zu <strong>die</strong>ser Verr<strong>in</strong>gerung des Stu<strong>die</strong>nabbruchs<strong>in</strong> den Sprach- <strong>und</strong> Kulturwissenschaften beitragen. Ihr Anteil <strong>an</strong> allenStu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängern <strong>die</strong>ser Fächergruppe ist zwar noch nicht so groß,dass sie alle<strong>in</strong> e<strong>in</strong> solches Ergebnis bewirken können, aber würden sie besondersviele Stu<strong>die</strong>nabbrecher aufweisen, hätte es nicht zu <strong>die</strong>sem Rückg<strong>an</strong>gder Stu<strong>die</strong>naufgabe kommen können. In den herkömmlichen Diplom<strong>und</strong>Magister-Stu<strong>die</strong>ngängen der Sprach- <strong>und</strong> Kulturwissenschaften war<strong>die</strong> Situation bisher durch e<strong>in</strong>en sehr hohen Abbrecher<strong>an</strong>teil gekennzeichnet.Die Ursachen dafür lagen <strong>in</strong> fehlenden Orientierungen, nebulösen Stu<strong>die</strong>nmotivationen,une<strong>in</strong>gelösten Erwartungen, m<strong>an</strong>gelnden Berufsvorstellungen<strong>und</strong> schwierigen Arbeitsmarktlagen. Andere Bed<strong>in</strong>gungen könntensich dagegen <strong>in</strong> den <strong>Bachelor</strong>-Stu<strong>die</strong>ngängen abzeichnen. Durch e<strong>in</strong>e str<strong>in</strong>gentereStu<strong>die</strong>nstruktur gewähren sie den Stu<strong>die</strong>renden bessere Orientierungim Stu<strong>die</strong>nverlauf; auch <strong>die</strong> Ausrichtung auf bestimmte Berufsfelderist häufig <strong>in</strong> <strong>die</strong> Konstruktion der neuen Stu<strong>die</strong>ngänge mit aufgenommenworden. Noch e<strong>in</strong> weiterer Aspekt könnte e<strong>in</strong>e wichtige Rolle spielen: <strong>die</strong>Möglichkeit des <strong>Master</strong>-Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gs. E<strong>in</strong> sprach- oder kulturwissenschaftliches<strong>Bachelor</strong>-Studium, das mit falschen Erwartungen oder unzureichen-1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 67der Stu<strong>die</strong>nmotivation aufgenommen wird, bietet jetzt nicht nur <strong>die</strong> Perspektive,<strong>in</strong> relativ kurzer Zeit zu e<strong>in</strong>em berufsqualifizierenden Abschluss zukommen, sondern zusätzlich noch e<strong>in</strong>e mögliche teilweise Korrektur derStu<strong>die</strong>nentscheidung durch entsprechende Wahl e<strong>in</strong>es <strong>Master</strong>-Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gs.In der Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts- <strong>und</strong> Sozialwissenschaften beträgt<strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>nabbruchquote 19 %. Diesem Wert liegt e<strong>in</strong>e deutliche Verr<strong>in</strong>gerungdes Stu<strong>die</strong>nabbrecher<strong>an</strong>teils um sieben Prozentpunkte zugr<strong>und</strong>e.Allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>d nicht alle zugehörigen Stu<strong>die</strong>nbereiche im gleichen Maße<strong>an</strong> <strong>die</strong>ser Entwicklung beteiligt. Im Stu<strong>die</strong>nbereich Rechtswissenschaft, <strong>in</strong>dem schon unter den Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängern von Ende der neunziger Jahre e<strong>in</strong>niedriger Stu<strong>die</strong>nabbruchwert konstatiert werden konnte, ist e<strong>in</strong> weiteresZurückgehen der vorzeitigen Stu<strong>die</strong>naufgabe zu verzeichnen. Die entsprechendeQuote liegt jetzt bei 9 %. Offensichtlich haben sich <strong>die</strong> vielfältigenReform<strong>an</strong>strengungen <strong>in</strong> <strong>die</strong>sem Stu<strong>die</strong>nbereich, e<strong>in</strong>schließlich der flächendeckendenE<strong>in</strong>führung der "Freischussregelung" günstig auf den Stu<strong>die</strong>nerfolgausgewirkt. E<strong>in</strong>e besonders positive Entwicklung ist im Stu<strong>die</strong>nbereichSozialwissenschaften festzustellen. Die Stu<strong>die</strong>nabbruchrate hat sich vonüberdurchschnittlichen 27 % auf unterdurchschnittliche 10 % verr<strong>in</strong>gert.Angesichts der hohen Bedeutung, <strong>die</strong> den <strong>Bachelor</strong>-Stu<strong>die</strong>ngängen <strong>in</strong> <strong>die</strong>semBereich zukommt, k<strong>an</strong>n mit hoher Sicherheit davon ausgeg<strong>an</strong>gen werden,dass sie zu <strong>die</strong>ser sehr deutlichen Verbesserung <strong>in</strong> hohem Maße beigetragenhaben. Im Vergleich zu <strong>die</strong>sen beiden Stu<strong>die</strong>nbereichen bewegtsich der Stu<strong>die</strong>nabbruch <strong>in</strong> den Wirtschaftswissenschaften noch auf e<strong>in</strong>emhohen Niveau. Zwar ist auch hier e<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung der Quote von 31 %auf 27 % zu registrieren, sie liegt aber immer noch deutlich über dem universitärenDurchschnittswert.Durch e<strong>in</strong>en <strong>an</strong>haltend hohen Wert zeichnet sich der Stu<strong>die</strong>nabbrecher<strong>an</strong>teil<strong>in</strong> der Fächergruppe Mathematik/Naturwissenschaften aus. Wie bei denStu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängern von Ende der neunziger Jahre liegt er auch jetzt bei28 %. H<strong>in</strong>ter <strong>die</strong>ser Quote stehen aber zwei unterschiedliche Gruppen vonzugehörigen Stu<strong>die</strong>nbereichen. Zur ersten Gruppe s<strong>in</strong>d <strong>die</strong> Bereiche Mathematik,Informatik, Physik/Geowissenschaften <strong>und</strong> Chemie zu zählen. Für sieist e<strong>in</strong> hoher Stu<strong>die</strong>nabbruch von über 30 % kennzeichnend. Dabei ist es <strong>in</strong>Mathematik <strong>und</strong> Chemie zu e<strong>in</strong>er deutlichen Anhebung, <strong>in</strong> Informatik dagegenzu e<strong>in</strong>er Verr<strong>in</strong>gerung der Stu<strong>die</strong>naufgabe gekommen. Die Ursachen
68 1.3 HIS-Stu<strong>die</strong> zu Stu<strong>die</strong>nabbruchquoten von 2008für <strong>die</strong>se hohen Werte dürften nach wie vor <strong>in</strong> den hohen Leistungs<strong>an</strong>forderungen<strong>die</strong>ser Fächer sowie <strong>in</strong> den falschen Erwartungen der Stu<strong>die</strong>nbewerberzu suchen se<strong>in</strong>. An <strong>die</strong>ser Situation hat offensichtlich auch <strong>die</strong> Umstellungauf <strong>Bachelor</strong>- <strong>und</strong> <strong>Master</strong>-Stu<strong>die</strong>ngänge nichts geändert. Es ist davonauszugehen, dass auch im entsprechenden <strong>Bachelor</strong>-Studium solchehohen Abbruchquoten <strong>an</strong>zutreffen s<strong>in</strong>d. Die zweite Gruppe <strong>an</strong> Stu<strong>die</strong>nbereichen<strong>in</strong>nerhalb der Fächergruppe Mathematik/Naturwissenschaften wirdvon Biologie, Pharmazie <strong>und</strong> Geographie gebildet. Deren Abbruchwertefallen schon seit den Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängern von Anf<strong>an</strong>g der neunziger Jahre relativger<strong>in</strong>g aus; derzeit liegen sie bei 15 % <strong>und</strong> weniger.Der Stu<strong>die</strong>nabbruch <strong>in</strong> wichtigen Stu<strong>die</strong>nbereichen der Fächergruppe Ingenieurwissenschaftenverbleibt unverm<strong>in</strong>dert auf hohem Niveau. Zwar hatsich der Wert für <strong>die</strong> gesamte Fächergruppe weiter verr<strong>in</strong>gert, von 28 %auf 25 %, das ist aber ausschließlich der positiven Entwicklung im Bau<strong>in</strong>genieurwesen<strong>und</strong> <strong>in</strong> <strong>an</strong>deren Stu<strong>die</strong>nbereichen, <strong>die</strong> hier nicht abgebildetwerden können, zuzuschreiben. In den wichtigen Bereichen Masch<strong>in</strong>enbau<strong>und</strong> Elektrotechnik erreicht dagegen <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>nabbruchquote 34 % bzw.33 %. An <strong>die</strong>ser Entwicklung haben <strong>Bachelor</strong>-Stu<strong>die</strong>ngänge noch ke<strong>in</strong>enAnteil, da im betrachteten Zeitraum <strong>die</strong> E<strong>in</strong>führung <strong>die</strong>ser neuen Stu<strong>die</strong>nstrukturen<strong>in</strong> den Ingenieurwissenschaften <strong>an</strong> Universitäten erst sehr zurückhaltendbegonnen hat.E<strong>in</strong>e hohe Stu<strong>die</strong>nerfolgsrate ist nach wie vor <strong>in</strong> der Fächergruppe Mediz<strong>in</strong>festzustellen. Der Stu<strong>die</strong>nabbruch, der schon unter den Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängerjahrgängender neunziger Jahre sehr ger<strong>in</strong>g ausgefallen ist, hat sich nochweiter verm<strong>in</strong>dert. Lediglich 5 von 100 Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängern schaffen ke<strong>in</strong>enakademischen Abschluss. Offensichtlich tragen <strong>in</strong> <strong>die</strong>ser Fächergruppe Zulassungsbeschränkungen,tr<strong>an</strong>sparente Stu<strong>die</strong>nstrukturen, hohe Stu<strong>die</strong>nmotivation<strong>und</strong> klare Berufsvorstellungen dazu bei, dass es nur selten zurStu<strong>die</strong>naufgabe kommt. Enttäuschungen im Studium über <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>n<strong>in</strong>halte,<strong>die</strong> beruflichen Möglichkeiten <strong>und</strong> <strong>die</strong> eigenen Leistungsfähigkeitensche<strong>in</strong>en sich <strong>in</strong> Grenzen zu halten.Anhaltend niedrig fällt <strong>die</strong> vorzeitige Stu<strong>die</strong>naufgabe unter den Lehramts-Stu<strong>die</strong>renden aus. Lediglich 8 % der Erstimmatrikulierten <strong>die</strong>ser Fächergruppeabsolvieren ke<strong>in</strong> Examen. Dieser Anteil liegt noch fünf Prozentpunkteunter dem Wert der vor<strong>an</strong>geg<strong>an</strong>genen Stu<strong>die</strong>nabbruchuntersuchung.Die positive Entwicklung dürfte im Zusammenh<strong>an</strong>g mit günstigen1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 69Stu<strong>die</strong>nbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong> klaren beruflichen Vorstellungen stehen. Auche<strong>in</strong>e positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen B<strong>und</strong>esländernkönnte zur Erhöhung des Stu<strong>die</strong>nerfolgs beigetragen haben.An den Fachhochschulen ist <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen Fächergruppen folgende Entwicklungdes Stu<strong>die</strong>nabbruchs zu konstatieren: Die Stu<strong>die</strong>nabbruchquoteder Fächergruppe Wirtschaftswissenschaften/Sozialwesen bewegt sich aufe<strong>in</strong>em Niveau, das der Durchschnittsrate der Fachhochschulen entspricht.Insgesamt 19 % aller Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fänger von Anf<strong>an</strong>g 2000 können ke<strong>in</strong> erstesHochschulexamen vorweisen. Allerd<strong>in</strong>gs sche<strong>in</strong>t sich dah<strong>in</strong>ter e<strong>in</strong>e disparateSituation zu verbergen. Während es im Stu<strong>die</strong>nbereich Sozialwesenzu e<strong>in</strong>er Verr<strong>in</strong>gerung des Stu<strong>die</strong>nabbruchs gekommen ist, hat sich <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>naufgabe<strong>in</strong> den Wirtschaftswissenschaften wieder auf 24 % erhöht.Das s<strong>in</strong>d sieben Prozentpunkte über den zuletzt gemessenen Wert. Es ist<strong>an</strong>zunehmen, dass <strong>an</strong> <strong>die</strong>sem Anstieg <strong>die</strong> <strong>Bachelor</strong>-Stu<strong>die</strong>ngänge beteiligts<strong>in</strong>d.Die Fächergruppe Mathematik/Naturwissenschaften wird <strong>an</strong> den Fachhochschulensehr stark vom Stu<strong>die</strong>nbereich Informatik dom<strong>in</strong>iert. Dementsprechends<strong>in</strong>d völlig parallele Verläufe bei der Entwicklung des Stu<strong>die</strong>nabbruchszu beobachten. Von 100 Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängern <strong>in</strong> Informatik brechen25 ihr Studium ab. Das ist zwar immer noch e<strong>in</strong> überdurchschnittlich hoherAnteil, aber gleichzeitig auch der niedrigste Abbruchwert, der bisl<strong>an</strong>g <strong>in</strong><strong>die</strong>sem Stu<strong>die</strong>nbereich gemessen wurde. Damit setzt sich offensichtliche<strong>in</strong>e positive Entwicklung fort, <strong>die</strong> schon bei den Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängern vonEnde der neunziger Jahre e<strong>in</strong>setzte.E<strong>in</strong>e deutliche Erhöhung des Stu<strong>die</strong>nabbruchs ist <strong>in</strong> den Ingenieurwissenschaftenzu konstatieren. Über alle Stu<strong>die</strong>nbereiche steigt <strong>die</strong> Abbrecherrateum fünf Prozentpunkte auf 26 %. Diese Steigerung wird vor allem durchentsprechende Veränderungen <strong>in</strong> Masch<strong>in</strong>enbau <strong>und</strong> <strong>in</strong> Elektrotechnik hervorgerufen.Während der Anteil der Abbrecher im Bau<strong>in</strong>genieurwesen <strong>und</strong><strong>in</strong> weiteren Stu<strong>die</strong>nbereichen, <strong>die</strong> hier nicht ausgewiesen werden können,zurückgeht, steigt er <strong>in</strong> Masch<strong>in</strong>enbau <strong>und</strong> Elektrotechnik stark <strong>an</strong>. Mit32 % bzw. 36 % erreichen <strong>die</strong>se Stu<strong>die</strong>nbereiche <strong>die</strong> entsprechenden Abbruchwerte<strong>an</strong> den Universitäten. An <strong>die</strong>ser Entwicklung s<strong>in</strong>d <strong>die</strong> <strong>Bachelor</strong>-Stu<strong>die</strong>ngänge mit beteiligt. Der große Anteil <strong>an</strong> Stu<strong>die</strong>renden der Ingenieurwissenschaftenunter den <strong>Bachelor</strong>-Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>fängern <strong>und</strong> <strong>die</strong> hohe
70 1.3 HIS-Stu<strong>die</strong> zu Stu<strong>die</strong>nabbruchquoten von 2008Stu<strong>die</strong>nabbruchquote im <strong>Bachelor</strong>-Studium <strong>an</strong> Fachhochschulen weisendaraufh<strong>in</strong>.Die Ursache für <strong>die</strong>se problematische Situation könnte zum e<strong>in</strong>en <strong>in</strong> denerhöhten Leistungs<strong>an</strong>forderungen des <strong>in</strong>genieurwissenschaftlichen Studiumszu suchen se<strong>in</strong>. Große Stofffülle bei <strong>in</strong>haltlich hohen <strong>Anforderungen</strong>hat schon <strong>die</strong> herkömmlichen Stu<strong>die</strong>ngänge <strong>in</strong> <strong>die</strong>sen Bereichen ausgezeichnet<strong>und</strong> zu e<strong>in</strong>em beträchtlichen Stu<strong>die</strong>nabbruch geführt. Mit der Umstellungauf <strong>Bachelor</strong>-Stu<strong>die</strong>ngänge <strong>und</strong> der damit e<strong>in</strong>hergehenden Reduzierungder Stu<strong>die</strong>nzeit sche<strong>in</strong>t es weniger zu e<strong>in</strong>er Entschlackung des Studiumsals zu e<strong>in</strong>er Verdichtung gekommen zu se<strong>in</strong>. E<strong>in</strong> solches Vorgehenbei der Neugestaltung der Curricula stellt aber <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>rbarkeit e<strong>in</strong>es Masch<strong>in</strong>enbau-oder Elektrotechnik-Studiums <strong>in</strong> Frage. Zum <strong>an</strong>deren aber bewerbensich für <strong>die</strong> betreffenden Stu<strong>die</strong>ngänge <strong>an</strong> den Fachhochschulenbesonders häufig Stu<strong>die</strong>nberechtigte aus bildungsfernen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>kommensschwächerenElternhäusern. Sie fühlen sich zur F<strong>in</strong><strong>an</strong>zierung ihres Studiumsmeistens auf Erwerbstätigkeit mit <strong>an</strong>gewiesen. E<strong>in</strong>e subjektive E<strong>in</strong>schätzung,<strong>die</strong> durch e<strong>in</strong> höheres E<strong>in</strong>stiegsalter <strong>und</strong> vorausgehende Berufstätigkeitenmit entsprechenden Ver<strong>die</strong>nsten noch gefördert wird. Nicht wenigehaben e<strong>in</strong>e Berufsausbildung abgeschlossen. Diese Konstellation hatsich bisl<strong>an</strong>g schon <strong>in</strong> den Ingenieurwissenschaften abbruchsteigernd ausgewirkt.Die klare Strukturierung der <strong>Bachelor</strong>-Stu<strong>die</strong>ngänge <strong>und</strong> der engeStu<strong>die</strong>npl<strong>an</strong> erschweren e<strong>in</strong>e ausgedehntere Erwerbstätigkeit zum Zweckeder Stu<strong>die</strong>nf<strong>in</strong><strong>an</strong>zierung. Stu<strong>die</strong>rende, <strong>die</strong> nicht auf das Jobben verzichtenkönnen, werden so schnell Probleme haben, <strong>die</strong> <strong>Anforderungen</strong> des Studiumsmit denen der Erwerbstätigkeit zu vere<strong>in</strong>baren.1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 711.4 Arbeitsgruppen1.4.1 Vermittlung von Kompetenzen <strong>und</strong> Stu<strong>die</strong>rbarkeit(Formulierung von Lernergebnissen): Der Blick auf Modelle <strong>in</strong>EuropaDef<strong>in</strong><strong>in</strong>g <strong>an</strong>d Teach<strong>in</strong>g Learn<strong>in</strong>g OutcomesProf. Wendy Davies, Professor Emerita UCL, UK Bologna ExpertI am speak<strong>in</strong>g as a UK university teacher of long experience, not as <strong>an</strong>education policy person. I have noted your several adverse comments on'British' <strong>in</strong>fluence <strong>an</strong>d practice this morn<strong>in</strong>g <strong>an</strong>d hope I c<strong>an</strong> do someth<strong>in</strong>gto put the record straight. I need to expla<strong>in</strong> the national situation first, <strong>an</strong>dthen will go on to say someth<strong>in</strong>g about def<strong>in</strong><strong>in</strong>g Learn<strong>in</strong>g Outcomes, giveexamples, say someth<strong>in</strong>g about 'impart<strong>in</strong>g competences', <strong>an</strong>d refer you tosome guides. S<strong>in</strong>ce I am by academic tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g a histori<strong>an</strong>, I will take myexamples from History courses.The national situationIn the UK the requirement to def<strong>in</strong>e Learn<strong>in</strong>g Outcomes goes back to theQAA benchmark<strong>in</strong>g exercise, <strong>in</strong> operation from 1997. The QAA, the QualityAssur<strong>an</strong>ce Agency, has been <strong>in</strong> existence s<strong>in</strong>ce 1997, although there wereearlier versions of the agency <strong>in</strong> the preced<strong>in</strong>g ten years.QAA:• Introduction:http://www.qaa.ac.uk/aboutus/heGuide/guide.asp• 2006 review of reports:http://www.qaa.ac.uk/reviews/<strong>in</strong>stitutionalAudit/outcomes/Assessmentofstudents.asp• Example of report:http://www.qaa.ac.uk/reviews/reports/<strong>in</strong>stitutional/Oxford04/f<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gs.aspThe QAA is <strong>an</strong> <strong>in</strong>dependent body, f<strong>und</strong>ed from subscriptions from HigherEducation Institutions (HEIs) <strong>an</strong>d from contracts from UK HE f<strong>und</strong><strong>in</strong>gbo<strong>die</strong>s. (This mech<strong>an</strong>ism was not established by legislation because UK
721.4.1 Vermittlung von Kompetenzen <strong>und</strong> Stu<strong>die</strong>rbarkeit1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 73HEIs are legally autonomous bo<strong>die</strong>s; however, UK HEIs receive f<strong>und</strong>s from<strong>an</strong> '<strong>in</strong>dependent' f<strong>und</strong><strong>in</strong>g body, the Higher Education F<strong>und</strong><strong>in</strong>g Council,whose f<strong>und</strong>s come from government <strong>an</strong>d whose policy priorities aredef<strong>in</strong>ed by government. HEFCE (the f<strong>und</strong><strong>in</strong>g body for Engl<strong>an</strong>d) has a legalresponsibility to ensure quality of teach<strong>in</strong>g; HEFCE therefore contracts withthe QAA to deal with teach<strong>in</strong>g quality by review<strong>in</strong>g st<strong>an</strong>dards <strong>an</strong>dprovid<strong>in</strong>g reference po<strong>in</strong>ts.)The QAA m<strong>an</strong>ages Institutional Audit <strong>in</strong> Engl<strong>an</strong>d <strong>an</strong>d publishes reports foreach HEI, as well as a Code of Practice <strong>an</strong>d detailed guid<strong>an</strong>ce on the QAregime (which is called the Academic Infrastructure)QAA guid<strong>an</strong>ce:• Code of Practice section 7, precept 7:http://www.qaa.ac.uk/academic<strong>in</strong>frastructure/codeOfPractice/section7/default.asp#precepts• What are programme specifications?http://www.qaa.ac.uk/academic<strong>in</strong>frastructure/programSpec/guidel<strong>in</strong>es06.aspThe Code of Practice <strong>in</strong>cludes a number of 'Precepts', <strong>in</strong> other words keypr<strong>in</strong>ciples of Quality Assur<strong>an</strong>ce; these precepts <strong>in</strong>clude the fact that aProgramme Specification is desirable for each programme offered, eachProgramme Specification to <strong>in</strong>clude Learn<strong>in</strong>g Outcomes, methods ofachiev<strong>in</strong>g them <strong>an</strong>d assessment mech<strong>an</strong>isms.The QAA also issues national benchmark<strong>in</strong>g statements, by subject area.Subject benchmark statementshttp://www.qaa.ac.uk/academic<strong>in</strong>frastructure/benchmark/default.asp• History (2007):• http://www.qaa.ac.uk/academic<strong>in</strong>frastructure/benchmark/statements/History07.aspBenchmark<strong>in</strong>g statements <strong>in</strong>clude suggested Learn<strong>in</strong>g Outcomes persubject. This is not prescriptive, but it provides models from which HEIs c<strong>an</strong>select <strong>an</strong>d adapt. It is import<strong>an</strong>t to <strong>und</strong>erst<strong>an</strong>d that benchmark<strong>in</strong>gstatements were not imposed from above but devised by representatives ofthe different subject communities.QAA benchmark<strong>in</strong>g statements• devised by representatives of subject communities• bottom-up approach• large degree of consent• not prescriptive, but provide modelsFor example, the orig<strong>in</strong>al History p<strong>an</strong>el had 16 members, drawn from awide r<strong>an</strong>ge of <strong>in</strong>stitutions, <strong>in</strong> Engl<strong>an</strong>d, Scotl<strong>an</strong>d <strong>an</strong>d Wales; the 2007History review p<strong>an</strong>el had seven members, <strong>in</strong>clud<strong>in</strong>g the president of theRoyal Historical Society, the director of the Institute of Historical Research,<strong>an</strong>d three of the orig<strong>in</strong>al p<strong>an</strong>el. Feedback to proposals was sought from<strong>in</strong>dividual HEIs <strong>an</strong>d bo<strong>die</strong>s like the History at the Universities DefenceGroup (HUDG).Def<strong>in</strong><strong>in</strong>g Learn<strong>in</strong>g OutcomesThere are therefore models <strong>in</strong> existence, recently revised, <strong>an</strong>d those modelswere essentially established by consent of the subject community.History benchmark LOs• comm<strong>an</strong>d of a subst<strong>an</strong>tial body of historical knowledge• the ability to develop <strong>an</strong>d susta<strong>in</strong> historical arguments <strong>in</strong> a variety ofliterary forms, formulat<strong>in</strong>g appropriate questions <strong>an</strong>d utilis<strong>in</strong>g evidence(see paragraph 3.1)• <strong>an</strong> ability to read, <strong>an</strong>alyse <strong>an</strong>d reflect critically <strong>an</strong>d contextually uponcontemporary texts <strong>an</strong>d other primary sources, <strong>in</strong>clud<strong>in</strong>g visual <strong>an</strong>dmaterial sources like pa<strong>in</strong>t<strong>in</strong>gs, co<strong>in</strong>s, medals, cartoons, photographs…• the ability to gather <strong>an</strong>d deploy evidence <strong>an</strong>d data to f<strong>in</strong>d, retrieve, sort<strong>an</strong>d exch<strong>an</strong>ge new <strong>in</strong>formation (see paragraphs 3.3 <strong>an</strong>d 6.16)• a comm<strong>an</strong>d of comparative perspectives, which may <strong>in</strong>clude the abilityto compare the histories of different countries, societies, or cultures(see paragraph 4.3)• awareness of cont<strong>in</strong>uity <strong>an</strong>d ch<strong>an</strong>ge over extended time sp<strong>an</strong>s (seeparagraph 4.2)
741.4.1 Vermittlung von Kompetenzen <strong>und</strong> Stu<strong>die</strong>rbarkeit1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 75• …clarity, fluency, <strong>an</strong>d coherence <strong>in</strong> written expression (see paragraphs3.1, 3.3, 6.6, 6.7, 6.12 <strong>an</strong>d 6.16)• clarity, fluency, <strong>an</strong>d coherence <strong>in</strong> oral expression (see paragraphs 3.1,3.3, 6.5, 6.7 <strong>an</strong>d 6.15)• the ability to work collaboratively <strong>an</strong>d to participate <strong>in</strong> groupdiscussion (see paragraphs 6.5 <strong>an</strong>d 6.16)With<strong>in</strong> <strong>an</strong> HEI, nowadays, it is normal to specify <strong>an</strong>d publish Learn<strong>in</strong>gOutcomes by programme <strong>an</strong>d by module. For example, at UCL, my formeremploy<strong>in</strong>g <strong>in</strong>stitution, formal course <strong>an</strong>d module proposals requirestatements of Learn<strong>in</strong>g Outcomes, as has been the case for the last fiveyears. In practice these are written with<strong>in</strong> <strong>an</strong> academic department, by theteacher(s) concerned; then reviewed by a committee with<strong>in</strong> thedepartment, <strong>an</strong>d then by higher committees at Faculty <strong>an</strong>d <strong>in</strong>stitution level;<strong>an</strong>d f<strong>in</strong>ally approved, or not. Most universities also have provision forregular review <strong>an</strong>d update, for example every five years.How does a teacher write Learn<strong>in</strong>g Outcomes? Essentially by acomb<strong>in</strong>ation of borrow<strong>in</strong>g from models, th<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g what he or she w<strong>an</strong>tsstudents to be able to do by the end of the course, <strong>an</strong>d discuss<strong>in</strong>g withcolleagues. It does require serious thought about the po<strong>in</strong>t of theeducational process <strong>an</strong>d the place of a s<strong>in</strong>gle module <strong>in</strong> a wider world.A word on the term<strong>in</strong>ology of Learn<strong>in</strong>g Outcomes <strong>an</strong>d Competences: <strong>in</strong> theUK we use Learn<strong>in</strong>g Outcome as <strong>an</strong> all-purpose descriptor of what thestudent will know, <strong>und</strong>erst<strong>an</strong>d <strong>an</strong>d be able to do as a result of the teach<strong>in</strong>g<strong>an</strong>d learn<strong>in</strong>g process; <strong>an</strong>d we might use 'competence' <strong>in</strong> the course ofdef<strong>in</strong><strong>in</strong>g specific Learn<strong>in</strong>g Outcomes. Yesterday, <strong>in</strong> Brussels, a Scottishcolleague <strong>an</strong>d myself were denounced on the basis that m<strong>an</strong>y UKstatements of Learn<strong>in</strong>g Outcomes were really Competences. That appearsto be because the 'Tun<strong>in</strong>g' method appears to def<strong>in</strong>e Competences as thecomb<strong>in</strong>ation of knowledge, skills etc atta<strong>in</strong>ed by the student; <strong>an</strong>d def<strong>in</strong>esthe Learn<strong>in</strong>g Outcome as the statement of what the student will know, etc,at the same time express<strong>in</strong>g the level of competence. It seems to me thatargu<strong>in</strong>g about the words is po<strong>in</strong>tless, <strong>an</strong>d that a Learn<strong>in</strong>g Outcome isnecessarily a statement of competences; but you may like to bear thisdifference <strong>in</strong> approach <strong>in</strong> m<strong>in</strong>d when look<strong>in</strong>g at my examples. I wouldrem<strong>in</strong>d you that Professor Teichler, m<strong>an</strong>y of whose po<strong>in</strong>ts are directlyrelev<strong>an</strong>t to my talk, commented that there is no accepted concept ofcompetence. I would also add that there are issues of overall approachhere: if you work <strong>in</strong> <strong>an</strong> accreditation regime, such as is common <strong>in</strong> m<strong>an</strong>yparts of cont<strong>in</strong>ental Europe, you are likely to have a different approach todef<strong>in</strong>ition <strong>an</strong>d to what needs to be def<strong>in</strong>ed from the approach you wouldhave <strong>in</strong> a quality-enh<strong>an</strong>cement regime, such as is common <strong>in</strong> the UK. By'quality-enh<strong>an</strong>cement' I am referr<strong>in</strong>g to the process of regular, <strong>in</strong>ternalself-exam<strong>in</strong>ation that is now common <strong>in</strong> UK HEIs, with <strong>an</strong> emphasis on theidentification of good practice <strong>an</strong>d shared commitment to improvement.Examples:1. BA History, UCL• knowledge <strong>an</strong>d <strong>und</strong>erst<strong>an</strong>d<strong>in</strong>ge.g. ability to compare histories of different cultures• <strong>in</strong>tellectual skillse.g. ability to design, research <strong>an</strong>d present <strong>an</strong> extended piece ofhistorical writ<strong>in</strong>g, us<strong>in</strong>g orig<strong>in</strong>al sources• practical skillse.g. f<strong>in</strong>d, retrieve, sort <strong>an</strong>d exch<strong>an</strong>ge new <strong>in</strong>formation• tr<strong>an</strong>sferable skillse.g. work collaborativelym<strong>an</strong>age time <strong>an</strong>d work to deadl<strong>in</strong>es2. BA History module, UCLPeace, Law <strong>an</strong>d Hum<strong>an</strong> Rights: Middle Eastern Gifts to the UN (Dr KarenRadner):• knowledge of key Ancient Near Eastern text genres• knowledge of political <strong>an</strong>d ideological context <strong>in</strong> which texts used <strong>in</strong>Turkey, Ir<strong>an</strong>, Iraq <strong>in</strong> 1970s• ability to <strong>an</strong>alyse <strong>an</strong>d reflect critically on <strong>in</strong>terpretations of histori<strong>an</strong>s<strong>an</strong>d others
761.4.1 Vermittlung von Kompetenzen <strong>und</strong> Stu<strong>die</strong>rbarkeit1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 773. University of Nott<strong>in</strong>gham, 'Learn<strong>in</strong>g History', first-year corecourse for BA programmea. Knowledge <strong>an</strong>d <strong>und</strong>erst<strong>an</strong>d<strong>in</strong>g: through research<strong>in</strong>g <strong>an</strong>d present<strong>in</strong>g theresults of their group projects, students should be able to• expla<strong>in</strong> <strong>an</strong>d <strong>in</strong>terpret the motives, <strong>in</strong>terests <strong>an</strong>d ideologies which had<strong>an</strong> impact on the outcome of the events, historical sources or historical<strong>in</strong>terpretations on which their project focuses• evaluate the complex <strong>an</strong>d diverse nature of hum<strong>an</strong> societies <strong>in</strong> the past<strong>an</strong>d assess the <strong>in</strong>terplay between cont<strong>in</strong>uity <strong>an</strong>d ch<strong>an</strong>ge <strong>in</strong> their chosenperiod• demonstrate <strong>an</strong> awareness of the variety of perspectives adopted byhistori<strong>an</strong>s work<strong>in</strong>g <strong>in</strong> the relev<strong>an</strong>t field …c. Professional/practical skills: Students should have practised <strong>an</strong>dimproved their ability to• select, org<strong>an</strong>ize <strong>an</strong>d absorb <strong>in</strong>formation from a r<strong>an</strong>ge of sources• identify <strong>an</strong>d evaluate contrast<strong>in</strong>g or contradictory arguments• work together <strong>in</strong> a group to pl<strong>an</strong>, research <strong>an</strong>d write up a susta<strong>in</strong>edpiece of historical research• follow appropriate conventions <strong>in</strong> acknowledg<strong>in</strong>g their sources <strong>in</strong>footnotes <strong>an</strong>d bibliographies …University of Nott<strong>in</strong>gham, BA History moduleBy tak<strong>in</strong>g this module you should be able to:• work actively with other students on the module to research primary<strong>an</strong>d secondary sources• m<strong>an</strong>age large <strong>an</strong>d often <strong>in</strong>complete bo<strong>die</strong>s of <strong>in</strong>formation• develop your exist<strong>in</strong>g oral <strong>an</strong>d written communication skills• take responsibility for your own learn<strong>in</strong>g• respect the reasoned views of others• improve your IT skills <strong>in</strong> word process<strong>in</strong>g'Impart<strong>in</strong>g competences'• depends on the subject• focus is on what students will be able to do• mixed methods <strong>in</strong> Historywrit<strong>in</strong>g, + feedbackoral presentations, + feedbackdiscussiongroup workengag<strong>in</strong>g <strong>in</strong> researchregular assessment, + feedbackmoderation of assessment (2nd & External Exam<strong>in</strong>ers)The idea of 'impart<strong>in</strong>g' a competence very much depends on what you areteach<strong>in</strong>g, what is the level of the course, <strong>an</strong>d your own <strong>in</strong>dividual attitude.However, it is always import<strong>an</strong>t to th<strong>in</strong>k about what one w<strong>an</strong>ts thestudents to be able to do at the end of the course, rather th<strong>an</strong> simplyimpart<strong>in</strong>g a corpus of knowledge. In History teach<strong>in</strong>g, methods ofimpart<strong>in</strong>g competences are usually mixed. Students must read; they mustwrite <strong>an</strong>d get feedback; they must give oral presentations <strong>an</strong>d getfeedback, <strong>in</strong>clud<strong>in</strong>g from other students; they must discuss issues; theymust work <strong>in</strong> groups <strong>an</strong>d learn to respect each other; they must engage <strong>in</strong>research – f<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g out <strong>an</strong>d m<strong>an</strong>ag<strong>in</strong>g <strong>in</strong>formation; they must have regularassessment, <strong>an</strong>d feedback; <strong>an</strong>d assessment must be moderated – by theuse of second exam<strong>in</strong>ers <strong>an</strong>d external exam<strong>in</strong>ers. The University ofNott<strong>in</strong>gham's BA History evaluation sheets provide <strong>an</strong> idea of the k<strong>in</strong>d ofcriteria used <strong>in</strong> assessment.
78 1.4.1 Vermittlung von Kompetenzen <strong>und</strong> Stu<strong>die</strong>rbarkeit1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 79F<strong>in</strong>ally, as you will know, there are m<strong>an</strong>y published <strong>an</strong>d easily availableguides on def<strong>in</strong><strong>in</strong>g <strong>an</strong>d teach<strong>in</strong>g Learn<strong>in</strong>g Outcomes; here are a few.• D. Gosl<strong>in</strong>g <strong>an</strong>d J. Moon (2001) How to use Learn<strong>in</strong>g Outcomes <strong>an</strong>dAssessment Criteria• J. Moon: ‘L<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g Levels, Learn<strong>in</strong>g Outcomes <strong>an</strong>d Assessment Criteria’:http://www.bologna-bergen2005.no/EN/Bol_sem/Sem<strong>in</strong>ars/040701-02L<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g_Levels_plus_ass_crit-Moon.pdf• EUA Bologna H<strong>an</strong>dbook, e.g. B2.3• Bologna Sem<strong>in</strong>ar ‘Learn<strong>in</strong>g Outcomes based higher education’:http://www.ond.vla<strong>an</strong>deren.be/hogeronderwijs/bologna/BolognaSem<strong>in</strong>ars/Ed<strong>in</strong>burgh2008.htm
801.4.1 Vermittlung von Kompetenzen <strong>und</strong> Stu<strong>die</strong>rbarkeit1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 81Zusammenfassung AG 1: Vermittlung von Kompetenzen <strong>und</strong>Stu<strong>die</strong>rbarkeit (Formulierung von Lernergebnissen): Der Blick aufModelle <strong>in</strong> EuropaMar<strong>in</strong>a Ste<strong>in</strong>m<strong>an</strong>n, DAADDie Arbeitsgruppe hatte sich zum Ziel gesetzt, <strong>die</strong> Formulierung vonKompetenzen <strong>und</strong> Lernergebnissen <strong>an</strong>h<strong>an</strong>d von Beispielen darzustellen<strong>und</strong> <strong>die</strong> europäische Praxis zu vergleichen.Frau Prof. Dr. Wendy Davies, britische Bologna-Expert<strong>in</strong>, setzte <strong>in</strong> ihremImpulsreferat Learn<strong>in</strong>g Outcomes mit Kompetenzen gleich. Damitverzichtete sie bewusst auf e<strong>in</strong>e Differenzierung, wie sie z.B. im Kontextdes Tun<strong>in</strong>g-Projekts der EU üblich ist. Dort bedeutet "Kompetenz" e<strong>in</strong>eKomb<strong>in</strong>ation von Kompetenzen <strong>und</strong> Fertigkeiten, während "Lernergebnis"<strong>die</strong> Aussage darüber ist, was der Stu<strong>die</strong>rende wissen wird. Im Vere<strong>in</strong>igtenKönigreich s<strong>in</strong>d Lernergebnisse seit etwa zehn Jahren üblich. Sowohl beiden Beurteilungen der QAA als auch im Benchmark<strong>in</strong>g-Verfahren werden<strong>die</strong>se verwendet.Beim subject benchmark<strong>in</strong>g gibt es e<strong>in</strong>e fachliche Verständigung übervorgeschlagene (aber nicht vorgeschriebene!) Lernergebnisse. Durch <strong>die</strong>sektorweise Erarbeitung <strong>die</strong>ser Lernergebnisse durch e<strong>in</strong>schlägige Expertenwird e<strong>in</strong> breiter Konsens erzielt.Lernergebnisse werden durch <strong>die</strong> Fachbereiche e<strong>in</strong>erseits für Module,<strong>an</strong>dererseits für Stu<strong>die</strong>ngänge beschrieben. Dies erfolgt sowohl unterZuhilfenahme von Modellen wie z.B. den subject benchmarks, als auch<strong>an</strong>h<strong>an</strong>d eigener Überlegungen zu Fertigkeiten der Lernenden. D<strong>an</strong>achwerden <strong>die</strong> Lernergebnisse von der Fakultät oder <strong>an</strong>deren höherenfachfremden Ebenen (peers) bestätigt. Sie werden weiterh<strong>in</strong> e<strong>in</strong>erregelmäßigen Überprüfung unterzogen. E<strong>in</strong>e Qualitätsverbesserung wirdim Rahmen von Akkreditierungen überprüft.In bestimmten Fächern, <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> den Geisteswissenschaften, s<strong>in</strong>dLernergebnisse entscheidend, um <strong>die</strong> Bedeutung der Ausbildung für denArbeitsmarkt zu illustrieren. Für das Fach Geschichte beispielsweise wurdenzwölf Lernergebnisse vorgeschlagen, <strong>die</strong> sowohl wissenschaftlicher alsauch praktischer Art s<strong>in</strong>d. Dazu gehören Wissen <strong>und</strong> Verstehen,<strong>in</strong>tellektuelle, praktische <strong>und</strong> übertragbare Fähigkeiten. Konkrete Beispieles<strong>in</strong>d auch den Folien der Referent<strong>in</strong> zu entnehmen.Lehr- <strong>und</strong> Lernmethoden sowie <strong>die</strong> Überprüfung der erreichtenKompetenzen bauen auf den <strong>an</strong>gestrebten Lernergebnissen auf.Frau Drs. Jo<strong>die</strong>n Houwers, vom Bereich Internationalisierung <strong>und</strong>Weiterbildung berichtete im zweiten Impulsreferat, dass <strong>die</strong> UniversitätGron<strong>in</strong>gen sich <strong>an</strong> den Pr<strong>in</strong>zipien der Dubl<strong>in</strong>-Deskriptoren des Tun<strong>in</strong>g-Projekts orientiert. Das Institut für <strong>die</strong> Koord<strong>in</strong>ation von <strong>Lehre</strong> <strong>und</strong>Qualitätssicherung liefert das Beispiel aus der geisteswissenschaftlichenFakultät. In Gron<strong>in</strong>gen werden Lernergebnisse <strong>in</strong> Kenntnisse, Fertigkeiten<strong>und</strong> Kompetenzen e<strong>in</strong>geteilt <strong>und</strong> pro Stu<strong>die</strong>njahr beschrieben. Alle zweiJahre erfolgt e<strong>in</strong>e Befragung der Stu<strong>die</strong>renden. Monitor<strong>in</strong>g von nationalen<strong>und</strong> <strong>in</strong>ternationalen Alumni wird ebenfalls zur Qualitätssicherunge<strong>in</strong>gesetzt.Für <strong>die</strong> Verbesserung der Stu<strong>die</strong>rbarkeit wurde e<strong>in</strong>e g<strong>an</strong>ze Reihe vonMaßnahmen ergriffen. Dazu gehören z.B. <strong>die</strong> Umstellung von Trimesternauf Semester, <strong>die</strong> E<strong>in</strong>führung des Major-M<strong>in</strong>or-Modells, kle<strong>in</strong>eLerngruppen, Prüfungen nach jedem Block (drei pro Semester) oderausgeweitete Öffnungszeiten der Bibliothek.Für Module wurde e<strong>in</strong>e M<strong>in</strong>destumf<strong>an</strong>g von 5 ECTS credits def<strong>in</strong>iert <strong>und</strong><strong>die</strong> Modulbeschreibungen enthalten immer <strong>die</strong> Angabe von ECTS credits<strong>und</strong> Prüfungsform. Das Zentrum für <strong>die</strong> Entwicklung der <strong>Lehre</strong> sieht bei derÜberprüfung der Qualität von Stu<strong>die</strong>ngängen akademische Kenntnisse(Lernergebnisse) gr<strong>und</strong>sätzlich <strong>in</strong> Zusammenh<strong>an</strong>g mit Forschung.Ergebnis s<strong>in</strong>d besser durchdachte Stu<strong>die</strong>ngänge mit klarem Profil, e<strong>in</strong>erkennbarer Arbeitsmarktbezug sowie <strong>die</strong> Qualifizierung des Personals.Alle Stu<strong>die</strong>ngänge werden akkreditiert.An verschiedenen Beispielen war erkennbar, dass sich das britische <strong>und</strong>das niederländische Modell erheblich unterscheiden. Zum Beispiel wird <strong>die</strong>Arbeitsbelastung <strong>in</strong> Großbrit<strong>an</strong>nien für den <strong>Bachelor</strong> auf Gr<strong>und</strong>lage von 30Wochen spezifiziert. Dies liegt allerd<strong>in</strong>gs am F<strong>in</strong><strong>an</strong>zierungsmodell,tatsächlich wären 40 Wochen Arbeit <strong>an</strong>zusetzen. Die Angebote vonTeilzeitstu<strong>die</strong>ngängen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> Großbrit<strong>an</strong>nien recht zahlreich. In denNiederl<strong>an</strong>den werden 42 Wochen à 40 St<strong>und</strong>en zugr<strong>und</strong>egelegt, damitergibt sich e<strong>in</strong>e Arbeitsbelastung von 1.680 St<strong>und</strong>en, womit e<strong>in</strong> ECTS credit28 St<strong>und</strong>en entspricht. Anh<strong>an</strong>d der "Nestor-Überprüfung" konnte <strong>in</strong> den
821.4.1 Vermittlung von Kompetenzen <strong>und</strong> Stu<strong>die</strong>rbarkeit1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 83Niederl<strong>an</strong>den festgestellt werden, dass 8-10 St<strong>und</strong>en Erwerbstätigkeit proWoche neben dem Studium möglich s<strong>in</strong>d.In der Diskussion wurde noch e<strong>in</strong>mal deutlich, dass <strong>die</strong> Beziehungzwischen Begriffen <strong>und</strong> deren Bedeutung <strong>in</strong> den verschiedenen Ländernsehr unterschiedlich ist. Dieselben Begriffe (z.B. "Klausur" oder"Akkreditierung") können <strong>in</strong> Europa g<strong>an</strong>z verschiedene Bedeutung haben,<strong>an</strong>dererseits wird <strong>die</strong> gleiche Bedeutung nicht immer mit dem gleichenBegriff ausgedrückt. Beratung, Kommunikation <strong>und</strong> Feedback spielendeshalb für jede Hochschule, jedes L<strong>an</strong>d <strong>und</strong> jede Kooperation e<strong>in</strong>enzentrale Rolle.E<strong>in</strong> Bewusstse<strong>in</strong> für Kompetenzen ist entscheidend für alle Stu<strong>die</strong>ngänge.Dabei muss bedacht werden, dass "Kompetenz" ke<strong>in</strong>e Aussage zu Lernort<strong>und</strong> Lernform be<strong>in</strong>haltet (während "Qualifikation" h<strong>in</strong>gegen für e<strong>in</strong>enformalen Abschluss steht). Es wurde vorgeschlagen, "Lernergebnisse" <strong>in</strong>der Bedeutung der englischen "learn<strong>in</strong>g outcomes" als generellen Begrifffür "<strong>die</strong> Fähigkeit der Absolventen, etwas zu tun" zu verwenden.Lernergebnisse s<strong>in</strong>d auch <strong>die</strong> zentralen Elemente von nationalen <strong>und</strong>sektoralen Qualifikationsrahmen, <strong>die</strong> gleichermaßen für Tr<strong>an</strong>sparenzsorgen.Hochschulen bzw. Fachbereiche sollten <strong>die</strong> Ver<strong>an</strong>twortlichkeit für <strong>die</strong>Def<strong>in</strong>ition von Lernergebnissen erkennen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Bal<strong>an</strong>ce zwischenE<strong>in</strong>heit (Vergleichbarkeit) <strong>und</strong> Freiheit (Autonomie) f<strong>in</strong>den. Die Def<strong>in</strong>itionvon Lernergebnissen bietet d<strong>an</strong>n e<strong>in</strong>e gute Möglichkeit, e<strong>in</strong> spezifischesProfil zu def<strong>in</strong>ieren <strong>und</strong> <strong>an</strong>zubieten.1.4.2 Arbeitsgruppe 2: Zur Bedeutung <strong>und</strong> Umsetzung vonQualifikationsrahmen (fachlich, national, europäisch)Die Erhöhung von Freiheitsgraden für Forschung <strong>und</strong> <strong>Lehre</strong>Prof. Dr. Ulrich Bartosch, Katholische Universität EichstättGliederung:1. Die Aufgabe: Qualifikation <strong>in</strong> der Wissensgesellschaft2. Im Zentrum: Learn<strong>in</strong>g Outcomes als geme<strong>in</strong>same Sprache – der‚Bologna-Code’3. Die Bed<strong>in</strong>gungen: Hochschule als Produktionsort von <strong>Lehre</strong>, Forschung,Entwicklung4. Das Werkzeug <strong>und</strong> <strong>die</strong> Ziele: Qualifikationsrahmen <strong>und</strong> Tr<strong>an</strong>sparenzsowie Durchlässigkeit5. Die Konstruktion: Modul, Curriculum, Prüfung, Didaktik als Elementedes Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>ges6. Die Org<strong>an</strong>isation: Stu<strong>die</strong>ngänge als Querschnitts<strong>an</strong>gebot1. Die Aufgabe: Qualifikation <strong>in</strong> der WissensgesellschaftEs ist <strong>an</strong>gebracht, heute nach 10 Jahren <strong>an</strong> <strong>die</strong> Sorbonne Erklärung <strong>und</strong>damit <strong>an</strong> e<strong>in</strong>en Startpunkt des Bologna-Prozesses zu er<strong>in</strong>nern. Deren Zielewaren nicht auf Nützlichkeit <strong>und</strong> wirtschaftliche Verwertbarkeit beschränkt.E<strong>in</strong>e große politische Idee sollte zum Tragen kommen:„Der europäische Prozess ist <strong>in</strong> letzter Zeit um e<strong>in</strong>ige bedeutende Schritteweiter vor<strong>an</strong>getrieben worden. So wichtig <strong>die</strong>se auch se<strong>in</strong> mögen: m<strong>an</strong>sollte nicht vergessen, dass Europa nicht nur das Europa des Euro, derB<strong>an</strong>ken <strong>und</strong> der Wirtschaft ist; es muss auch e<strong>in</strong> Europa des Wissens se<strong>in</strong>.Wir müssen auf <strong>die</strong> <strong>in</strong>tellektuellen, kulturellen, sozialen <strong>und</strong> technischenDimensionen unseres Kont<strong>in</strong>ents bauen <strong>und</strong> sie stärken. Sie s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> großemMaße von ihren Universitäten geprägt worden, <strong>die</strong> weiterh<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e g<strong>an</strong>zentscheidende Rolle <strong>in</strong> deren Entwicklung spielen.“ 22Sorbonne Erklärung (1998), <strong>in</strong>: HRK (Hg.), Bologna Reader. Texte <strong>und</strong> Hilfestellungen zurUmsetzung der Ziele des Bologna-Prozesses <strong>an</strong> deutschen Hochschulen, 2. unv. Auflage,Bonn 2004, S. 273.
841.4.2 Bedeutung <strong>und</strong> Umsetzung von Qualifikationsrahmen1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 85In besonderer Deutlichkeit wurde gesagt, dass es e<strong>in</strong>e eigene Wertigkeit,e<strong>in</strong>e „entscheidende Rolle“ der Hochschulen für <strong>die</strong> maßgeblichenDimensionen „unseres Kont<strong>in</strong>ents“ gibt. Sie stellen auch <strong>in</strong> der späterenBologna-Erklärung e<strong>in</strong>e besondere Ressource zur Entwicklung e<strong>in</strong>es„Europa des Wissens“ 3 <strong>und</strong> damit e<strong>in</strong>e wesentliche Voraussetzung für <strong>die</strong>„...Festigung <strong>und</strong> Bereicherung der europäischen Bürgerschaft; <strong>die</strong>sesEuropa des Wissens k<strong>an</strong>n se<strong>in</strong>en Bürgern <strong>die</strong> notwendigen Kompetenzenfür <strong>die</strong> Herausforderungen des neuen Jahrtausends ebenso vermitteln wiee<strong>in</strong> Bewusstse<strong>in</strong> für geme<strong>in</strong>same Werte <strong>und</strong> e<strong>in</strong> Gefühl der Zugehörigkeitzu e<strong>in</strong>em geme<strong>in</strong>samen sozialen <strong>und</strong> kulturellen Raum“. 4 Es entspricht demGeist <strong>die</strong>ser Erklärungen <strong>und</strong> damit dem Geist des Bologna-Prozesses,wenn im folgenden Beitrag ‚<strong>die</strong> Qualifikation <strong>in</strong> der Wissensgesellschaft’als e<strong>in</strong>e vordr<strong>in</strong>gliche Aufgabe der Hochschulen vorausgesetzt wird. Und esist ebenso passend, wenn dabei weiterh<strong>in</strong> postuliert wird, dass„...Unabhängigkeit <strong>und</strong> Autonomie der Universitäten gewährleisten, dasssich <strong>die</strong> Hochschul- <strong>und</strong> Forschungssysteme den sich w<strong>an</strong>delndenErfordernissen, den gesellschaftlichen <strong>Anforderungen</strong> <strong>und</strong> denFortschritten <strong>in</strong> der Wissenschaft laufend <strong>an</strong>passen“. 5Für <strong>die</strong> Hochschulen ergibt sich e<strong>in</strong>e besondere Ver<strong>an</strong>twortung. Und alleihre Angehörigen s<strong>in</strong>d implizit aufgerufen, den Bologna-Prozess als e<strong>in</strong>eStärkung der genu<strong>in</strong>en Eigenschaften von Hochschule zu betreiben. Nurdurch <strong>die</strong>se Stärkung, k<strong>an</strong>n <strong>in</strong> <strong>die</strong> Entwicklung e<strong>in</strong>es „Europa des Wissens“jener spezifische Beitrag e<strong>in</strong>fließen, der nur – <strong>und</strong> zwar ausschließlich nur– von den Hochschulen als Orten verb<strong>und</strong>ener <strong>Lehre</strong>, Forschung <strong>und</strong>Entwicklung geleistet werden k<strong>an</strong>n <strong>und</strong> muss.Der Bologna-Prozess k<strong>an</strong>n <strong>und</strong> darf ke<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>schränkung <strong>und</strong>Beschneidung von Unabhängigkeit <strong>und</strong> Autonomie der Hochschulen se<strong>in</strong>oder werden. Er muss e<strong>in</strong>e Erhöhung der Freiheitsgrade für <strong>die</strong> Akteure desGeschehens bedeuten <strong>und</strong> erwirken:3Ebd.4Bologna-Erklärung (1999), <strong>in</strong>: HRK (Hg.), Bologna Reader. Texte <strong>und</strong> Hilfestellungen zurUmsetzung der Ziele des Bologna-Prozesses <strong>an</strong> deutschen Hochschulen, 2. unv. Auflage,Bonn 2004, S. 277.5Ebd. 278„Das Bologna-Modell verwirklicht – entgegen <strong>an</strong>ders lautenden Vorurteilen– gr<strong>und</strong>sätzlich Diversität.“ 6Und <strong>die</strong>ses Wort von Jürgen Kohler hat für alle Akteure Auswirkungen:Stu<strong>die</strong>rende, <strong>Lehre</strong>nde <strong>und</strong> Forschende, Verwaltung <strong>und</strong> Leitung. In <strong>die</strong>semVerständnis muss <strong>die</strong> Aufgabe ‚Qualifikation <strong>in</strong> der Wissensgesellschaft’verst<strong>an</strong>den <strong>und</strong> bewältigt werden. An der Erhöhung der Freiheitsgrade für<strong>die</strong> Akteure wird sich der gesamte Prozess <strong>und</strong> werden sich se<strong>in</strong>e Elementemessen lassen müssen. Dies gilt selbstverständlich auch für das ‚Werkzeug’Qualifikationsrahmen, das <strong>in</strong> <strong>die</strong>sem Beitrag im Mittelpunkt derAusführungen steht.2. Im Zentrum: Learn<strong>in</strong>g Outcomes als geme<strong>in</strong>same Sprache – der‚Bologna-Code’Der systematische Dreh- <strong>und</strong> Angelpunkt von Qualifikationsrahmen s<strong>in</strong>d<strong>die</strong> Deskriptoren für das Vorh<strong>an</strong>dense<strong>in</strong> e<strong>in</strong>es Qualifikationselementes. Sies<strong>in</strong>d als „Lernergebnisse“ (learn<strong>in</strong>g outcomes) formuliert <strong>und</strong> bedeutentatsächlich e<strong>in</strong>e vollständige Abkehr von der bisherigen Konzentration aufInhalt (content) <strong>und</strong> damit auf den zu vermittelnden Lernstoff (<strong>in</strong>put).Learn<strong>in</strong>g outcomes beschreiben, was jem<strong>an</strong>d <strong>in</strong> der Lage ist zu tun. Siebilden somit ständig e<strong>in</strong> Gelenk im Prozess des Lernens, <strong>in</strong>dem sie<strong>an</strong>zeigen, was erreicht wurde <strong>und</strong> nun gekonnt wird <strong>und</strong> was weiterh<strong>in</strong> alsVoraussetzung für weiteres Lernen vorliegt. Mit <strong>die</strong>sem ‚Bologna-Code’entwickelt sich derzeit e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Sprache für den europäischenHochschulraum (EHEA; Europe<strong>an</strong> Higher Education Area), <strong>die</strong> <strong>die</strong>Kommunikation untere<strong>in</strong><strong>an</strong>der spürbar verändern wird <strong>und</strong> nachhaltigerleichtern sollte. Wenn m<strong>an</strong> <strong>in</strong> der neuen Zentrierung um <strong>die</strong> Bel<strong>an</strong>ge derStu<strong>die</strong>renden (student centered approach) bisweilen <strong>die</strong> große Änderung(shift) durch den Bologna-Prozess sehen k<strong>an</strong>n, 7 so ist der tatsächliche Kernder ‚kopernik<strong>an</strong>ischen Wende’ vermutlich <strong>in</strong> <strong>die</strong>sem ‚Bologna-Code’Learn<strong>in</strong>g Outcomes auszumachen.6Jürgen Kohler, Bologna <strong>und</strong> <strong>die</strong> Folgen – nach der Konferenz von London, <strong>in</strong>: Benz, Kohler,Koch (Hg.), H<strong>an</strong>dbuch Qualität <strong>und</strong> <strong>Lehre</strong>, Berl<strong>in</strong> 2007, A 1.1, S. 1-31 (16).7Siehe Terence N. Mitchell, Integration von „Bologna“-<strong>Anforderungen</strong> als Elementaraspektder Curricularentwicklung, <strong>in</strong>: Benz, Kohler, Koch (Hg.), H<strong>an</strong>dbuch Qualität <strong>und</strong> <strong>Lehre</strong>,Berl<strong>in</strong> 2005, E 1.3, S. 1-18, (2f.)
861.4.2 Bedeutung <strong>und</strong> Umsetzung von Qualifikationsrahmen1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 87Learn<strong>in</strong>g Outcomes erhöhen <strong>die</strong> Freiheitsgrade der hochschulischenAkteure potentiell <strong>in</strong> mehrfacher H<strong>in</strong>sicht. Sie b<strong>in</strong>den <strong>die</strong> Prozessparameter<strong>an</strong> <strong>die</strong> Lernenden selbst <strong>und</strong> entlasten damit <strong>die</strong> <strong>in</strong>stitutionellen Orte desLernens von der vollen Ver<strong>an</strong>twortlichkeit für den je e<strong>in</strong>zelnen Lernprozess,<strong>in</strong>dem sie Teilprozesse entwickeln lassen, externe Lernergebnisse<strong>in</strong>tegrierbar gestalten, <strong>in</strong>haltliche Bauste<strong>in</strong>e flexibel machen usw. DieAnbieter formellen Lernens können sich mit ihren Lehr-/Lernarr<strong>an</strong>gements<strong>in</strong> ungeahnter Freiheit <strong>in</strong> e<strong>in</strong> formelles <strong>und</strong> <strong>in</strong>formelles lebensl<strong>an</strong>gesLerngeschehen e<strong>in</strong>b<strong>in</strong>den. Sie können Anschlüsse nach vielen neuenRichtungen aufbauen, <strong>die</strong> <strong>die</strong> gewohnte Ordnung von verregelten (<strong>und</strong>verriegelten) Zu- <strong>und</strong> Abgängen der Institutionen durche<strong>in</strong><strong>an</strong>derbr<strong>in</strong>gen.Aber der Verlust der starren Sicherheit wird belohnt durch höchsteFlexibilität <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es dynamischen Bildungsgeschehens mit stetsweiter werdenden Begrenzungen. Die Spielräume ergeben sich deshalb<strong>in</strong>haltlich, org<strong>an</strong>isatorisch <strong>und</strong> geographisch.„Schließlich ist auch <strong>die</strong> Bedeutung der kompetenzorientiertenLernergebnisorientierung für <strong>die</strong> <strong>in</strong>ternationale Anerkennung im formellen,rechtlichen S<strong>in</strong>ne selbstverständlich. Erst sie ermöglicht zuverlässig <strong>die</strong>Anwendung der Lissabonner Anerkennungskonvention imZusammenwirken mit dem Referenzrahmen, den <strong>die</strong> nationalen <strong>und</strong> <strong>die</strong>europäischen Qualifikationsrahmen schaffen.“ 8Die Kommunikation im Bologna Code bedarf neuer Kommunikationsmittel,da der bisherige Austausch über Qualifikationen durch Zertifikate erfolgte,deren Aussagekraft <strong>in</strong> der Identifizierbarkeit der Institution <strong>und</strong> der Inhaltesowie des Zeitbedarfs lag. Lediglich der letzte Aspekt ist im ECTS (Europe<strong>an</strong>Credit Tr<strong>an</strong>fer System) erneuert worden, nunmehr erfolgte <strong>die</strong>s aber <strong>in</strong>Anpassung <strong>an</strong> den student-centered-approach als kalkulierterZeitverbrauch der Lernenden für den Qualifikationserwerb.8Margret Schermutzki, Lernergebnisse – Begriffe, Zusammenhänge, Umsetzung <strong>und</strong>Erfolgsermittlung. Lernergebnisse <strong>und</strong> Kompetenzvermittlung als elementareOrientierungen des Bologna-Prozess, <strong>in</strong>: Benz, Kohler, Koch (Hg.), H<strong>an</strong>dbuch Qualität <strong>und</strong><strong>Lehre</strong>, Berl<strong>in</strong> 2007, E 3.3, S. 1-29 ( 9).E<strong>in</strong> genu<strong>in</strong> neues Kommunikationsmittel ist der Qualifikationsrahmen (QR),dessen Logik <strong>die</strong> learn<strong>in</strong>g outcomes als Deskriptoren reflektiert. Bevor <strong>die</strong>sgenauer <strong>an</strong>alysiert wird, sollen <strong>die</strong> Bed<strong>in</strong>gungen der Aufgabe‚Qualifikation’ für <strong>die</strong> Hochschulen rekonstruiert werden. Sie bilden denRahmen für den E<strong>in</strong>satz des QR <strong>und</strong> damit <strong>die</strong> Bed<strong>in</strong>gungen für Ausbauoder E<strong>in</strong>schränkung von Autonomie <strong>und</strong> Freiheit.3. Die Bed<strong>in</strong>gungen: Hochschule als Produktionsort von <strong>Lehre</strong>,Forschung, EntwicklungDie gegenwärtige Diskussion zur Veränderung <strong>an</strong> den Hochschulen ertöntstreckenweise als herzergreifendes Klagelied über den Verlust der e<strong>in</strong>zig‚wahren, schönen <strong>und</strong> guten’ Hochschulkultur <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d. Das Endevon Humboldt’scher Bildung <strong>und</strong> der Niederg<strong>an</strong>g von Forschung <strong>und</strong>echter universitärer <strong>Lehre</strong> wird beschworen. Wertvolle Professoren/<strong>in</strong>nenwürden zu <strong>Lehre</strong>rn degra<strong>die</strong>rt. Das Universitätsleben sei zum Schulbetriebgeschrumpft. 9Ohne Zweifel s<strong>in</strong>d viele Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gsentwicklungen <strong>und</strong>Hochschulorg<strong>an</strong>isationen durchaus Beispiele für derartige (zeitweise?)nachteilige Entwicklungen. Anwesenheitspflichten für Stu<strong>die</strong>rende wurdenextensiv durchgesetzt. Umfassende Prüfungspläne sichern <strong>die</strong> rigideAbfragemöglichkeit fast jedes Bruchteils von Lehr<strong>in</strong>halten. DasStu<strong>die</strong>nverhalten der Stu<strong>die</strong>renden wurde den optimierten Angebotsplänenvon Ver<strong>an</strong>staltungen <strong>an</strong>gepasst. Im Bedarfsfall konnte das gesamteStu<strong>die</strong>nprogramm e<strong>in</strong>er Hochschule z.B. den Zielvorstellungen e<strong>in</strong>er<strong>Lehre</strong>rprüfungsordnung unterworfen werden. Zynisch könnte m<strong>an</strong>bemerken, dass <strong>die</strong> ‚Allmachtsph<strong>an</strong>tasien’ jener <strong>Lehre</strong>nden, <strong>die</strong> schonimmer gerne jeden Studenten zur Präsenz <strong>und</strong> zum vollständigenRepetitorium des dargebotenen Stoffes gezwungen hätten, nunmehr zurRealität werden konnten. Aber auch <strong>die</strong> heimlichen Wünsche m<strong>an</strong>cherHochschulverwaltung wurden nunmehr erfüllbar. Die zeitlichenBe<strong>an</strong>spruchungen für <strong>Lehre</strong>nde konnten weiter ausgedehnt werden, <strong>in</strong>dempersönliche Vorlieben für Lehrzeiten im Pflichtprogramm vonUnterrichts<strong>an</strong>geboten nicht mehr <strong>in</strong> gewohnter Form berücksichtigt9Vgl. zur Kritik der Kritiker, W<strong>in</strong>fried Benz, Die Bedeutung der Wissenschaft für das Studium,<strong>in</strong>: Benz, Kohler, Koch (Hg.), H<strong>an</strong>dbuch Qualität <strong>und</strong> <strong>Lehre</strong>, Berl<strong>in</strong> 2007, D 2.4, S. 1-15 ( 2-4).
881.4.2 Bedeutung <strong>und</strong> Umsetzung von Qualifikationsrahmen1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 89werden können. Alle <strong>die</strong>se Entwicklungen werden nun als Begleitersche<strong>in</strong>ungendes Bologna-Prozesses identifiziert <strong>und</strong> gar mit den zentralenAnliegen der Hochschulreform gleichgesetzt. Sie ersche<strong>in</strong>en, bei näheremH<strong>in</strong>sehen, aber gar nicht aus Forderungen des Bologna-Prozess resultierenzu müssen. Vielmehr entpuppen sie sich als Folge e<strong>in</strong>er Reformumsetzung,<strong>die</strong> den eigentlichen Aufgaben der Hochschule zu wenig Rechnung trägt<strong>und</strong> Studium mit beruflicher Ausbildung (oder auch Beschäftigungsbefähigung;employability) nahezu gleichsetzt. Viele Hochschulen habenihre Stu<strong>die</strong>ngänge <strong>an</strong>alog zu beruflichen Ausbildungen konstruieren wollen<strong>und</strong> doch nur wenige Akteure haben für <strong>die</strong>se Form der Bildungsorg<strong>an</strong>isation<strong>die</strong> ausreichende Expertise.Hochschulen, <strong>die</strong> zu beruflichen Ausbildungsorten mutieren, verlierenjedoch ihren Charakter <strong>und</strong> ihre notwendige Funktion <strong>in</strong>nerhalb derWissensgesellschaft. Was kennzeichnet <strong>die</strong>sen Charakter? E<strong>in</strong>eorientierende Antwort f<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> den Thesen zur Hochschulerneuerungvon Karl Jaspers aus dem Jahre 1933:„Die für <strong>die</strong> Universität stets wiederholte Forderung der Unlösbarkeit vonFachschulung, Forschung <strong>und</strong> Bildung beruht darauf, dass jeder der dreiZwecke nicht ohne <strong>die</strong> <strong>an</strong>deren, vielmehr durch <strong>die</strong> <strong>an</strong>deren erreicht wird.Fachschulung gel<strong>in</strong>gt <strong>in</strong> geistigen Berufen nicht schon durch Übermittlung<strong>an</strong>wendbarer Kenntnisse <strong>und</strong> technischer Fertigkeiten, sondern durchEntfaltung der Org<strong>an</strong>e zu lebenslänglich fortzusetzendem forschendenVerhalten. Die Hochschule legt <strong>die</strong> Keime zu e<strong>in</strong>er im Leben sich ersterfüllenden Verwirklichung. Mit dem <strong>Lehre</strong>r <strong>in</strong> faktischer Forschung <strong>an</strong> denGrenzen des jeweils Wissbaren zu stehen <strong>und</strong> dadurch teilzunehmen <strong>an</strong> derBewegung macht erst alle Kenntnisse <strong>und</strong> Fertigkeiten s<strong>in</strong>nvoll, lässtWesentliches von Unwesentlichem unterschieden, S<strong>in</strong>n, Grenzen <strong>und</strong>Bedeutung jedes Wissens sicher erfassen. Nicht das Wissen hilft, sondern<strong>die</strong> Fähigkeit durch eigene Initiative sich überall methodisch daserforderliche Wissen zu erwerben vermöge der Fähigkeit, richtig fragen zukönnen.“ 10Fachliche Ausbildung <strong>und</strong> Teilhabe <strong>an</strong> Forschung verb<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> derVorstellung von Jaspers erst geme<strong>in</strong>sam zur hochschulischen, d.h. geistigenBildung. Folgt m<strong>an</strong> <strong>die</strong>ser E<strong>in</strong>sicht, d<strong>an</strong>n ist mit dem spezifischen Charaktervon Hochschulstudium auch zugleich e<strong>in</strong>e unabtretbare Ver<strong>an</strong>twortung derHochschule <strong>in</strong>nerhalb der Wissensgesellschaft verb<strong>und</strong>en. Nur sie k<strong>an</strong>n fürneues, wissenschaftlich gewonnenes Wissen sorgen <strong>und</strong> zugleich <strong>die</strong>Her<strong>an</strong>bildung forschender Persönlichkeiten bewirken. Freiheit ist deshalbke<strong>in</strong> Luxus, den m<strong>an</strong> sich leistet, sobald m<strong>an</strong> <strong>die</strong> Bedürfnisse „<strong>an</strong>dererInst<strong>an</strong>zen“ (Jaspers) – m<strong>an</strong> könnte heute sagen z.B. ‚der Wirtschaft’ –befriedigt hat. Sie ist vielmehr <strong>die</strong> conditio s<strong>in</strong>e qua non für <strong>die</strong>Bewältigung der Aufgabe:„Die seit alters geforderte Freiheit von Forschung <strong>und</strong> <strong>Lehre</strong> bedeutet, dass<strong>die</strong> Bewegung wissenschaftlicher Entfaltung ihre B<strong>in</strong>dung, ihre Zielsetzung<strong>und</strong> ihren Weg nur durch sich selbst aus dem geme<strong>in</strong>samen Gr<strong>und</strong>e desVolkes erhalten k<strong>an</strong>n, für den ke<strong>in</strong>e <strong>an</strong>dere Inst<strong>an</strong>z <strong>in</strong> der Welt ersche<strong>in</strong>enk<strong>an</strong>n, als <strong>die</strong> hervorgebrachte Helligkeit des wahren Wissens selbst.“ 11Vielleicht kl<strong>in</strong>gt das nun zu philosophisch im Rahmen e<strong>in</strong>er Erörterung zumBologna-Prozess. E<strong>in</strong>e Form von Hochschulrom<strong>an</strong>tik macht sich hier breit?Solcher Kritik sei aber <strong>die</strong> <strong>an</strong>fänglich zitierte Zielsetzung der SorbonneErklärung entgegen gehalten: „...m<strong>an</strong> sollte nicht vergessen, dass Europ<strong>an</strong>icht nur das Europa des Euro, der B<strong>an</strong>ken <strong>und</strong> der Wirtschaft ist; es mussauch e<strong>in</strong> Europa des Wissens se<strong>in</strong>.“Nüchtern betrachtet k<strong>an</strong>n festgestellt werden, dass Hochschulen e<strong>in</strong>enspezifischen Beitrag leisten können <strong>und</strong> müssen. Dieser ist mit der‚Erzeugung neuen wissenschaftlichen Wissens durch wissenschaftlicheMethoden’ untrennbar verb<strong>und</strong>en. Er ist gekennzeichnet als fachlicheAusbildung <strong>und</strong> Weiterbildung von Menschen für Beschäftigungen, <strong>die</strong>e<strong>in</strong>e forschende Persönlichkeit verl<strong>an</strong>gen. Damit ist <strong>die</strong>ser Beitrag ebenauch als Persönlichkeitsbildung zu fassen <strong>und</strong> zu realisieren. Er ist zugleich<strong>an</strong>gewiesen auf e<strong>in</strong>e forschende Tätigkeit der <strong>Lehre</strong>nden, <strong>die</strong> alsPersönlichkeiten vorbildlich ersche<strong>in</strong>en <strong>und</strong> <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>renden <strong>in</strong> <strong>die</strong> Realitätwissenschaftlicher Arbeit e<strong>in</strong>beziehen. Damit werden qualifikatorische10Karl Jaspers, Thesen zur Frage der Hochschulerneuerung, <strong>in</strong>: Richard Wisser/Leonard H.Ehrlich (Eds.), Karl Jaspers, Philosopher among Philosophers, Würzburg 1993, S. 294.11Ebd. S. 295.
901.4.2 Bedeutung <strong>und</strong> Umsetzung von Qualifikationsrahmen1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 91Bedürfnisse des Arbeitsmarktes be<strong>die</strong>nt <strong>und</strong> Innovationsfähigkeit vonWirtschaft <strong>und</strong> Gesellschaft durch wissenschaftliche Innovation erzeugt.Für e<strong>in</strong>e Fakultät bedeutet <strong>die</strong>s d<strong>an</strong>n g<strong>an</strong>z konkret: Ihr messbarer Erfolgentstehta) durch beste E<strong>in</strong>mündungsmöglichkeiten ihrer Absolventen/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> denArbeitsmarkt <strong>und</strong> erfolgreiche <strong>an</strong>schließende Tätigkeit <strong>und</strong>b) durch beste Forschungs- <strong>und</strong> Entwicklungsmöglichkeiten für <strong>Lehre</strong>nde<strong>und</strong> Stu<strong>die</strong>rende <strong>in</strong>nerhalb der Hochschule, <strong>die</strong> zu neuen Produkten,Dienstleistungen <strong>und</strong> Ideen führen.Diese beiden Zielsetzungen von Hochschule sollten sich alsorg<strong>an</strong>isatorische Achsen für Stu<strong>die</strong>n- <strong>und</strong> Forschungsbetrieb konkretisierenlassen, <strong>die</strong> der Gr<strong>und</strong>bed<strong>in</strong>gung ‚Freiheit <strong>und</strong> Autonomie’ genüge tun.Qualitätssicherung <strong>in</strong> der Hochschule wird <strong>die</strong>s berücksichtigen müssen.Qualifikationsprofile sollten d<strong>an</strong>n genau aus <strong>die</strong>ser Verb<strong>in</strong>dung herausentstehen. E<strong>in</strong> Qualifikationsrahmen sollte als Knotenpunkt derunterschiedlichen Interessenlagen e<strong>in</strong>e <strong>die</strong>nende Funktion für <strong>die</strong>Gr<strong>und</strong>bed<strong>in</strong>gung ‚Freiheit <strong>und</strong> Autonomie’ haben. Ist das möglich?auch zur schulischen Bildung. 12 Die großen Ziele für <strong>die</strong> europäischeBildungspolitik ändern sich dadurch nicht. M<strong>an</strong> will e<strong>in</strong>e verbesserteVergleichbarkeit <strong>und</strong> Anerkennungsmöglichkeit unterschiedlicherQualifikationselemente von <strong>in</strong>dividuellen Qualifikationsprofilen erreichen.Dadurch würde sich e<strong>in</strong>e stärkere horizontale (also regional gedachte) <strong>und</strong>vertikale (also <strong>in</strong>stitutionell gedachte) Bewegungsfreiheit <strong>und</strong>Durchlässigkeit für <strong>in</strong>dividuelle Bildungs- <strong>und</strong> Berufskarrieren <strong>in</strong> Europaergeben. Die Entwicklung des <strong>in</strong>dividuellen Lernprozesses soll imMittelpunkt des gesamten Bildungsgeschehens stehen. Menschen mit derBefähigung zu forschender <strong>und</strong> <strong>in</strong>novativer Tätigkeit werden <strong>an</strong>unterschiedlichen (Lern)Orten ihre Qualifikationen erwerben <strong>und</strong> ihr<strong>in</strong>dividuelles Qualifikationsprofil ausbauen. Bewegen sich solche gesuchtenAkteure <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Wirtschafts- <strong>und</strong> Bildungssystem, das hohe Mobilitäterlaubt, steigt <strong>die</strong> Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit, dass Wissensproduktion <strong>und</strong>Wissense<strong>in</strong>satz optimal gefördert werden können. Zugleich f<strong>in</strong>den <strong>die</strong>Lernenden größere Gestaltungsfreiheit für ihre <strong>in</strong>dividuellenQualifikationswege vor.4. Das Werkzeug <strong>und</strong> <strong>die</strong> Ziele: Qualifikationsrahmen <strong>und</strong>Tr<strong>an</strong>sparenz sowie DurchlässigkeitZur Zeit entsteht <strong>in</strong> Europa e<strong>in</strong> System von Qualifikationsrahmen dasunterschiedliche Qualifizierungsprov<strong>in</strong>zen mite<strong>in</strong><strong>an</strong>der <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dungbr<strong>in</strong>gt. Mit der Übersetzung des Europäischen Qualifikationsrahmen fürlebensl<strong>an</strong>ges Lernen (Europe<strong>an</strong> Qualificationsframework for lifelonglearn<strong>in</strong>g; EQF LLL) auf <strong>die</strong> nationalen Ebenen hat <strong>die</strong> Entwicklung <strong>und</strong> derE<strong>in</strong>satz von QRs als Instrumenten der bildungspolitischen Gestaltung <strong>in</strong>Europa e<strong>in</strong>e deutliche Beschleunigung erhalten. Dabei treffen auch zweiunterscheidbare Politikprozesse aufe<strong>in</strong><strong>an</strong>der <strong>und</strong> werden – zum<strong>in</strong>dest t.w.– vere<strong>in</strong>igt. E<strong>in</strong>erseits ist der Bologna-Prozess mit se<strong>in</strong>en zur Zeit 46beteiligten Ländern berührt <strong>und</strong> <strong>an</strong>dererseits ist es der Kopenhagen-Prozess (Lissabon-Strategie) mit se<strong>in</strong>er Reichweite auf Europarat <strong>und</strong>OECD. Somit entsteht e<strong>in</strong>e neue engere B<strong>in</strong>dung zwischen beruflicher Aus<strong>und</strong>Weiterbildung <strong>und</strong> hochschulischem Studium sowie darüber h<strong>in</strong>aus12Siehe hierzu umfassend: Thomas Walter, Der Bologna-Prozess. E<strong>in</strong> Wendepunkteuropäischer Hochschulpolitik?, Wiesbaden 2006, S. 181-192.
921.4.2 Bedeutung <strong>und</strong> Umsetzung von Qualifikationsrahmen1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 93BAMADRBAMADRSystem von QualifikationsrahmenQF_EHEABAMADRQR_DHEQRQR_SArbDQRUlrich Bartosch, Mitglied im Team Deutscher Bologna-ExpertenAbb. 1: System von Qualifikationsrahmen <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d. QF_EHEA(Qualificationsframework for the Europe<strong>an</strong> Higher Education Area); QR_DH(Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse); QR_SArb(Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit); DQR (Deutscher Qualifikationsrahmenfür lebensl<strong>an</strong>ges Lernen); EQR_LLL (Europe<strong>an</strong> Qualificationsframework forLifelong Learn<strong>in</strong>g). Mit Schraffur s<strong>in</strong>d Zertifikate <strong>an</strong>gezeigt: BA, MA, Dr. DieBalken symbolisieren <strong>die</strong> Qualifikationsprofile. BA, MA <strong>und</strong> Doktorat werdenvon EQR <strong>und</strong> DQR aufgenommen. Sie ersetzen aber <strong>die</strong> dortigen Stufen 6,7,8nicht vollständig. Umgekehrt entsprechen nicht alle Qualifikationselemente deroberen LLL QR Stufen den hochschulischen Erfordernissen.Bereits der „Bologna-Prozess“ folgt der skizzierten Logik nunmehr seit 10Jahren. Durch <strong>die</strong> Schaffung e<strong>in</strong>es harmonisierten EuropäischenHochschulraumes (Europe<strong>an</strong> Higher Education Area-EHEA) wurde <strong>und</strong> wird<strong>die</strong> – zunächst vor allem horizontale – Mobilität zwischen denHochschulen der 46 assoziierten Länder verstärkt. Die Stu<strong>die</strong>nstrukturenwurden <strong>an</strong>geglichen <strong>und</strong> Instrumente entwickelt, <strong>die</strong> z.B. <strong>die</strong> Tr<strong>an</strong>sparenz<strong>und</strong> Vergleichbarkeit von Stu<strong>die</strong>nleistungen <strong>und</strong> –<strong>an</strong>forderungenverbessern. 13 Hierzu gehören <strong>die</strong> Integration des bereits älterenKreditpunktesystems (Europe<strong>an</strong> Credit Tr<strong>an</strong>sfersystem – ECTS), e<strong>in</strong>e<strong>in</strong>heitlicher Anh<strong>an</strong>g zum Abschlusszeugnis (Diploma Supplement) <strong>und</strong> <strong>die</strong>13Vgl. hierzu gr<strong>und</strong>sätzlich: Thomas Hildebr<strong>an</strong>d, Peter Tremp/Désirée Jäger/S<strong>an</strong>draTückm<strong>an</strong>tel, Die Curricula-Reform <strong>an</strong> Schweizer Hochschulen. St<strong>an</strong>d <strong>und</strong> Perspektiven derUmsetzung der Bologna-Reform <strong>an</strong>h<strong>an</strong>d ausgewählter Aspekte, [Arbeitsberichte zurUmsetzung der Bologna-Deklaration <strong>in</strong> der Schweiz, Heft 13], Zürich 2008.Modularisierung von gestuften Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>geboten (<strong>Bachelor</strong>, <strong>Master</strong>,PhD/Dr.). 14 Gleichzeitig wurde der Gestaltungs- <strong>und</strong> Entwicklungsspielraumder Hochschulen erhöht, <strong>die</strong> ihre Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>gebote mit Blick aufAkkreditierungen durch Akkreditierungsagenturen <strong>und</strong> miteuropäischen/nationalen Vorgaben entwerfen. Die Rollenationaler/regionaler Behörden <strong>und</strong> M<strong>in</strong>isterien ist <strong>in</strong> <strong>die</strong>sen Fragenschwächer geworden. Zugleich übernehmen <strong>die</strong> Hochschulen aber auchmehr Ver<strong>an</strong>twortung dafür, dass <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>gebote für ihreAbsolventen/<strong>in</strong>nen erfolgreiche Entwicklungsch<strong>an</strong>cen erzeugen. Sie s<strong>in</strong>d<strong>an</strong>gehalten – u.a. <strong>in</strong> den Akkreditierungsverfahren – <strong>die</strong> bestehendeNachfrage des Arbeitsmarktes für <strong>die</strong> jeweiligen Abschlüsse nachzuweisen.Es ist daher s<strong>in</strong>nvoll, <strong>die</strong> <strong>an</strong>gestrebten Qualifikationsprofile u.a. mit denErwartungen der künftigen Arbeitgeber abzugleichen. Außerdem mussberücksichtigt werden, wie <strong>die</strong> Voraussetzung für <strong>an</strong>schließendeWeiterqualifizierungen aussehen müssen.Für den hochschulischen Bereich ist <strong>in</strong>sbesondere der e<strong>in</strong>heitlicheQualifikationsrahmen für den europäischen Hochschulraum (EQF EHEA)relev<strong>an</strong>t. 15 Er wurde <strong>in</strong> Bergen 2005 von der Bildungsm<strong>in</strong>isterkonferenzverabschiedet <strong>und</strong> besitzt für <strong>die</strong> 46 Bologna-Staaten Gültigkeit. MitReferenz auf <strong>die</strong>sen Rahmen <strong>und</strong> <strong>die</strong> Dubl<strong>in</strong> Descriptors von 2004 16 wurdeebenfalls 2005 der Qualifikationsrahmen für deutscheHochschulabschlüsse (QR DH)verabschiedet. 17 Er „...ermöglicht ...<strong>die</strong>Beschreibung [von Stu<strong>die</strong>nprogrammen; UB] <strong>an</strong>h<strong>an</strong>d der Qualifikationen,<strong>die</strong> der Absolvent nach e<strong>in</strong>em erfolgreich absolvierten Abschluss erworbenhaben soll. Dies spiegelt <strong>die</strong> Umorientierung von Input- zuOutputorientierung wieder <strong>und</strong> soll <strong>die</strong> Tr<strong>an</strong>sparenz des Bildungssystems14Siehe z.B.: Julia Gonzales/Robert Wagenaar, Der Beitrag der Hochschulen zum Bologna-Prozess. E<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>führung, TUNING Educational Structures <strong>in</strong> Europe, Deutsche Ausgabe,Bilbao [2006]; HRK (Hg.), Diploma Supplement. Funktion – Inhalte – Umsetzung, Bonn2005.15M<strong>in</strong>istry of Science, Technology <strong>an</strong>d Innovation, A Framework for Qualifications of theHigher Education Higher Education Aera, Bologna Work<strong>in</strong>g Group on QualificationsFrameworks, Copenhagen 2005.16Shares ‚Dubl<strong>in</strong>’ descriptors for Short Cycle, First Cycle, Second Cycle <strong>an</strong>d Third CycleAwards, A report from a Jo<strong>in</strong>t Quality Initiative <strong>in</strong> formal group, 18 October 2004, 5 pages.(<strong>in</strong>ternet document).17Vgl. , J<strong>an</strong> Rathjen, Qualifikationsrahmen – Ziele <strong>und</strong> Entwicklungen (HRK 2006), <strong>in</strong>: HRK(Hg.); Bologna Reader II. <strong>Neue</strong> Texte <strong>und</strong> Hilfestellungen zur Umsetzung der Ziele desBologna-Prozesses <strong>an</strong> deutschen Hochschulen, Bonn Februar 2007, S. 231-238, (231).
941.4.2 Bedeutung <strong>und</strong> Umsetzung von Qualifikationsrahmen1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 95fördern“. 18 Der QR DH ist <strong>in</strong> Akkreditierungsverfahren als verb<strong>in</strong>dlicheReferenz für den jeweiligen Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>g nachzuweisen. 19 Wiederum mitengstem Bezug zum QR DH wurden sektorale Qualifikationsrahmenentwickelt, <strong>die</strong> e<strong>in</strong>e fachliche Umsetzung der QR-Logik vornehmen. 20 AlsBeispiel für <strong>die</strong> weiteren Überlegungen <strong>die</strong>nt nun der QualifikationsrahmenSoziale Arbeit (QR SArb), der am 31. Mai 2006 vom FachbereichstagSoziale Arbeit beschlossen wurde. 21Die Fachbereiche der Stu<strong>die</strong>ngänge Soziale Arbeit mit dem QR SArbOrientierungs<strong>in</strong>strument zur Konstruktion von Stu<strong>die</strong>ngängen vere<strong>in</strong>bart.Es beschreibt durch <strong>die</strong> systematische Auflistung von Lernergebnissen(‚learn<strong>in</strong>g outcomes’) <strong>die</strong> Qualifikationsprofile der Absolventen/<strong>in</strong>nen vonStu<strong>die</strong>ngängen der Sozialen Arbeit auf BA- <strong>und</strong> MA-Niveau. Somitformuliert der QR SArb aus der Sicht der Hochschulen durch Deskriptorene<strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>es Ausbildungsversprechen <strong>an</strong> Stu<strong>die</strong>n<strong>in</strong>teressierte <strong>und</strong> <strong>an</strong>Arbeitgeber.Abb. 2: Konstruktionsschema des QR SArb 4.0 (hier für Schulsoziarbeitspezifieziert). Die Kategorien bilden horizontal <strong>die</strong> Elemente professionellenH<strong>an</strong>delns <strong>in</strong> der Sozialen Arbeit ab. Sie werden durch e<strong>in</strong>zelne Deskriptorengenauer operationalsiert. Die Level differenzieren zwischen denQualifikationsprofilen von BA <strong>und</strong> MA Absolventen/<strong>in</strong>nen, wobei das O-Level<strong>und</strong> <strong>die</strong> Kategorien F <strong>und</strong> G für alle Level gelten, also gr<strong>und</strong>sätzlicheQualifikationsmerkmale professioneller, akademisch gebildeter Sozialer Arbeitfestlegen sollen. 22Im System der hochschulischen QRs <strong>die</strong>nt der QR SArb der Vere<strong>in</strong>fachungvon Beschreibung, Vergleich <strong>und</strong> Anrechnung von Stu<strong>die</strong>nleistungen.18Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse (BMBF, KMK, HRK 2005), <strong>in</strong>: HRK(Hg.); Bologna Reader II. <strong>Neue</strong> Texte <strong>und</strong> Hilfestellungen zur Umsetzung der Ziele desBologna-Prozesses <strong>an</strong> deutschen Hochschulen, Bonn Februar 2007, S. 239-250, (240).Siehe auch: Achim Hopbach, Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse, <strong>in</strong>:Benz, Kohler, Koch (Hg.), H<strong>an</strong>dbuch Qualität <strong>und</strong> <strong>Lehre</strong>, Berl<strong>in</strong> 2007, D 1.5, S. 1-28.19Siehe: Akkreditierungsrat, Kriterien zur Akkreditierung von Stu<strong>die</strong>ngängen, <strong>in</strong>: HRK (Hg.);Bologna Reader II. <strong>Neue</strong> Texte <strong>und</strong> Hilfestellungen zur Umsetzung der Ziele des Bologna-Prozesses <strong>an</strong> deutschen Hochschulen, Bonn Februar 2007, S. 308-311, (309).20Vgl. gr<strong>und</strong>sätzlich: Volker Gehmlich, Die E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>es NationalenQualifikationsrahmens <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d – DQR – Untersuchung der Möglichkeiten für denBereich des formalen Lernens, Typoskript, Osnabrück 2008.21Ulrich Bartosch, Anita Maile, Christ<strong>in</strong>e Speth u.a., Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit. In:HRK (Hg.): Bologna-Reader II. <strong>Neue</strong> Texte <strong>und</strong> Hilfestellungen zur Umsetzung der Ziele desBologna-Prozesses <strong>an</strong> deutschen Hochschulen, Bonn 2007, S. 280-295.QRs unterscheiden sich gr<strong>und</strong>sätzlich von Rahmenstu<strong>die</strong>n- oderRahmenprüfungsordnungen, da sie <strong>die</strong> <strong>in</strong>haltliche, curriculare Ebene sowieAbläufe <strong>und</strong> Prüfungsgeschehen nicht festlegen. Vielmehr bilden sie imS<strong>in</strong>ne von M<strong>in</strong>destvoraussetzungen den kle<strong>in</strong>sten geme<strong>in</strong>samen Nenner füre<strong>in</strong> vere<strong>in</strong>bartes Qualifikationsprofil zwischen verschiedenen Partnern.Dabei nimmt der QR SArb nicht den R<strong>an</strong>g e<strong>in</strong>er Verordnung o.ä. e<strong>in</strong>,sondern erlaubt <strong>die</strong> geme<strong>in</strong>same Zuordnung von Qualifikationselementenvon unterschiedlichen Positionen aus. E<strong>in</strong> QR be<strong>an</strong>twortet nicht <strong>die</strong> Frage:Was wurde gelernt? Er beschreibt <strong>die</strong> Antwort auf <strong>die</strong> Frage: Was wirdgekonnt? In <strong>die</strong>sem S<strong>in</strong>ne erleichtern QRs <strong>die</strong> Entwicklung von22Siehe ebd.
961.4.2 Bedeutung <strong>und</strong> Umsetzung von Qualifikationsrahmen1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 97Stu<strong>die</strong>ngängen, Kerncurricula, didaktischen Konzeptionen oder auchPrüfungsmodalitäten <strong>und</strong> <strong>die</strong> Anrechnung von Qualifikationselementen,<strong>die</strong> außerhalb der Hochschule erworben wurden auf das Studium. DieKonstrukteure der Stu<strong>die</strong>ngänge werden <strong>an</strong>geleitet darzulegen, wie <strong>und</strong>wodurch <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>renden zu den beschriebenen Wissensbeständen,Kompetenzen, Fähigkeiten <strong>und</strong> Haltungen geführt werden <strong>und</strong> wie dererfolgreiche Lernprozess nachgewiesen wird.Abgleichsfunktionen von QualifikationsrahmenQR (sektoral)XYAbgleichQR (sektoral)ABDidaktik(Kern)CurriculumIntelligenteAllg. <strong>in</strong>haltlicheVermittlungs-strategien,St<strong>an</strong>dardskreative, flexibleLernstrategienPrüfungswesenModulh<strong>an</strong>dbuchAussagekräftiges,SpezifischesdiversifiziertesStu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gsprofilPrüfungswesenUlrich Bartosch, Mitglied im Team Deutscher Bologna-ExpertenAbb. 3: Abgleichsfunktionen von Qualifikationsrahmen. Beim Abgleich vonzwei sektoralen QRs werden über das Modulh<strong>an</strong>dbuch <strong>die</strong> Bed<strong>in</strong>gungen für<strong>die</strong> Herstellung von Qualifikationselementen rückverfolgbar <strong>und</strong> damit <strong>in</strong>Tr<strong>an</strong>sparenz vergleichbar. Hierfür müssen <strong>die</strong> QR-Elemente im Modulh<strong>an</strong>dbuchverortet se<strong>in</strong>.Der QR SArb orientiert sich horizontal <strong>an</strong> e<strong>in</strong>em Prozessmodellprofessioneller Tätigkeit <strong>in</strong> der Sozialen Arbeit (durch <strong>die</strong> KategorienWissen, Analyse, Konzeption, Forschung Org<strong>an</strong>isation/Evaluation) <strong>und</strong>differenziert vertikal durch den vertieften Anteil <strong>an</strong> der diszipl<strong>in</strong>ärenEntwicklung. E<strong>in</strong>e dritte Ebene des QR SArb, <strong>die</strong> das Profil des Doktorats<strong>an</strong>zeigt, ist zwischenzeitlich vorgelegt worden <strong>und</strong> wird vom FBTSdiskutiert. Gr<strong>und</strong>sätzlich ist <strong>die</strong> Diskussion um den QR SArb ist nichtabgeschlossen. Er ist als Instrument <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es ständigenÜberprüfungs- <strong>und</strong> Veränderungsprozesses <strong>an</strong>gelegt <strong>und</strong> sieht deshalb e<strong>in</strong>perm<strong>an</strong>entes Monitor<strong>in</strong>g durch den FBTS vor.Von besonderer Bedeutung im QR SArb ist <strong>die</strong> Kategorie D. Sie istfolgendermaßen formuliert:„D Recherche <strong>und</strong> Forschung <strong>in</strong> der Sozialen ArbeitAllgeme<strong>in</strong> gilt für Absolvent<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Absolventen der Sozialen Arbeit:D-0 Absolvent<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Absolventen sollten <strong>in</strong> der Lage se<strong>in</strong>, <strong>in</strong>Übere<strong>in</strong>stimmung mit ihrem professionellen Wissen <strong>und</strong> Verstehen unterAnwendung geeigneter Methoden, Forschungsfragen zu bearbeiten <strong>und</strong><strong>an</strong>dere Methoden fachlicher Informationsbeschaffung <strong>an</strong>zuwenden. DieInformationsbeschaffung k<strong>an</strong>n z.B. als Literaturauswertung, alsPraxisforschung mit qu<strong>an</strong>titativen <strong>und</strong>/oder qualitativen Methoden, alsInterpretation empirischer Daten oder als Recherche mit elektronischenMe<strong>die</strong>n gestaltet se<strong>in</strong>. Sie tragen Sorge, dass <strong>die</strong> erhobene Daten- <strong>und</strong>Faktenlage unter Wahrung der professionellen, fachlichen St<strong>an</strong>dards <strong>in</strong> derpraktischen Arbeit berücksichtigt wird.BA-Level- Absolvent<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> –Absolventen besitzen:D-BA-1 <strong>die</strong> Fähigkeit, über wissenschaftliche Recherche fachliche Literatur<strong>und</strong> Datenbestände zu identifizieren, <strong>in</strong>terpretieren <strong>und</strong> <strong>in</strong>tegrieren.D-BA-2 <strong>die</strong> Kenntnis von fachlichen Kompen<strong>die</strong>n, Periodika, Datenb<strong>an</strong>ken<strong>und</strong> Fachforen <strong>und</strong> <strong>die</strong> Fähigkeit, sich klassischer <strong>und</strong> modernerRechercheverfahren zu be<strong>die</strong>nen.D-BA-3 <strong>die</strong> Fähigkeit, <strong>an</strong>geleitete Praxisforschung zu betreiben <strong>und</strong> mitqualitativen <strong>und</strong> qu<strong>an</strong>titativen Methoden empirische Datenbestände zuerstellen <strong>und</strong> zu <strong>in</strong>terpretieren.MA-Level-Absolvent<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> -Absolventen besitzen:D-MA-1 <strong>die</strong> Fähigkeit, <strong>die</strong> benötigten Informationen <strong>und</strong> Daten zuidentifizieren, ihre Quellen zu bestimmen <strong>und</strong> sie zu erheben.D-MA-2 <strong>die</strong> Fähigkeit Forschungsdesigns zu entwickeln <strong>und</strong> (Praxis-)Forschung zu betreiben.D-MA-3 <strong>die</strong> Fähigkeit, zur kritischen Analyse <strong>und</strong> Bewertung eigener <strong>und</strong>fremder Forschungsergebnisse bzw. Informationen.
981.4.2 Bedeutung <strong>und</strong> Umsetzung von Qualifikationsrahmen1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 99D-MA-4 <strong>die</strong> Fähigkeit, <strong>in</strong>novative Methoden <strong>und</strong> Strategien auf der Basisvon wissenschaftlicher Analyse zu entwickeln.D-MA-5 <strong>die</strong> Fähigkeit, <strong>an</strong> der praktischen, methodischen <strong>und</strong>wissenschaftlichen, theoretischen Entwicklung des Faches teilzunehmen<strong>und</strong> <strong>die</strong>se zu verfolgen.“ 23Mit <strong>die</strong>sen Qualifikationselementen wird <strong>die</strong> Ausbildung zur Sozialen Arbeite<strong>in</strong>deutig dem hochschulischen Bereich zugeordnet <strong>und</strong> ist mit <strong>an</strong>derenDiszipl<strong>in</strong>en auf entsprechendem Level vergleichbar. Die Kategorie D weistzugleich das professionelle H<strong>an</strong>deln <strong>in</strong> der Sozialen Arbeit alsforschungsbasiert <strong>und</strong> forschungsorientiert aus <strong>und</strong> lässt damit ke<strong>in</strong>enZweifel <strong>an</strong> der akademischen Position der Sozialen Arbeit <strong>in</strong>sgesamt. DieAusbildung zur professionellen Sozialen Arbeit muss deshalb den obendiskutierten Charakteristika hochschulischen Studiums folgen. Durch <strong>die</strong>verm<strong>in</strong>derte E<strong>in</strong>wirkung von m<strong>in</strong>isterieller Seite liegt <strong>die</strong> Ver<strong>an</strong>twortung<strong>und</strong> <strong>die</strong> Freiheit zur Gestaltung von Stu<strong>die</strong>nprogrammen bei derHochschule, <strong>die</strong> <strong>die</strong>s – selbstverständlich mit Rücksicht auf <strong>die</strong>Akkreditierungsvorgaben - kreativ nützen k<strong>an</strong>n.5. Die Konstruktion: Modul, Curriculum, Prüfung, Didaktik alsElemente des Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gesLäßt sich der QR SArb nun als Knotenpunkt der unterschiedlichenInteressenlagen mit e<strong>in</strong>er <strong>die</strong>nenden Funktion für <strong>die</strong> Gr<strong>und</strong>bed<strong>in</strong>gung‚Freiheit <strong>und</strong> Autonomie’ des Lehr- <strong>und</strong> Forschungsbetriebes nützen? Dassollte gel<strong>in</strong>gen, wenn der QR <strong>die</strong> Freiheitsgrade derStu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gskonstruktion erhöht <strong>und</strong> <strong>die</strong> Qualifikationsnachfrage desArbeitsmarktes be<strong>die</strong>nen k<strong>an</strong>n. Hierfür muss m<strong>an</strong> <strong>die</strong> schrittweiseKonkretisierung von Stu<strong>die</strong>nprogrammen mit Referenz auf den QRbeachten.Die Deskriptoren des QR beschreiben Ergebnis <strong>und</strong> Ausg<strong>an</strong>gspunkt vonbisherigen <strong>und</strong> folgenden Qualifikationsprozessen gleichermaßen. Sielassen aber offen, wie <strong>die</strong>se Ergebnisse erreicht werden konnten.Allerd<strong>in</strong>gs erzeugen sie konkrete Fragen. Am obigen Beispiel lässt sich dasverdeutlichen.Nehmen wir folgenden Deskriptor:• D-MA-3 <strong>die</strong> Fähigkeit, zur kritischen Analyse <strong>und</strong> Bewertung eigener<strong>und</strong> fremder Forschungsergebnisse bzw. Informationen.Er erlaubt <strong>die</strong> überprüfenden Nachfragen:• In welchem Modul, welcher Lehr-/<strong>Lehre</strong><strong>in</strong>heit wird <strong>die</strong>sesQualifikationselement realisiert?• Welche Inhalte des vorliegenden Curriculums wurden dort <strong>an</strong>gebotenbzw. vermittelt?• Welche Didaktik wird e<strong>in</strong>gesetzt, um <strong>die</strong>se Qualifikation zu befördern?• Welche Prüfungsart/-form soll sichern, dass das Vorh<strong>an</strong>dense<strong>in</strong> desQualifikationselementes auch tatsächlich bestätigt werden k<strong>an</strong>n?• K<strong>an</strong>n <strong>die</strong>ses Qualifikationselement auch <strong>in</strong> <strong>an</strong>derer Weise/<strong>an</strong> <strong>an</strong>deremOrt erworben <strong>und</strong> e<strong>in</strong>gebracht werden?Angesichts der notwendigen Begutachtung des Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>gebotes imRahmen e<strong>in</strong>es Akkreditierungsverfahrens, können <strong>die</strong> Antwortenselbstverständlich nicht beliebig ausfallen. Sie werden vor der fachlichenBeurteilung der Peers bestehen müssen <strong>und</strong> müssen deshalb am ‚state ofthe art’ ausgerichtet se<strong>in</strong>. Damit ist e<strong>in</strong>e freie Gestaltung derStu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gskonstruktion allerd<strong>in</strong>gs weitgehend gesichert. DieÜberprüfung hat nicht zu fragen: Wird es so gemacht, wie <strong>an</strong> <strong>an</strong>dererStelle? Sondern es muss heißen: Wird es so gemacht, dass dasAusbildungsversprechen gehalten werden k<strong>an</strong>n? Auch <strong>die</strong>Anrechnungsmöglichkeit externer Qualifikationselemente wird somittr<strong>an</strong>sparent. Angerechnet werden können Lernprozesse, <strong>die</strong> nachweislich<strong>die</strong> adäquaten Lernergebnisse erzeugen konnten. 2423Ebd., S. 289f.24Siehe hierzu: Re<strong>in</strong>hard Schmidt, DEWBLAM, The social <strong>an</strong>d educational challenge of WorkBased Learn<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Europe<strong>an</strong> higher education <strong>an</strong>d tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g. Results of a pilot experience,Firence December 2006.
1001.4.2 Bedeutung <strong>und</strong> Umsetzung von Qualifikationsrahmen1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 101Der Qualifikationsrahmen ist also ke<strong>in</strong> zusätzliches Instrument, sonderntatsächlich e<strong>in</strong> synchronisierendes Übersetzungs<strong>in</strong>strument, das <strong>die</strong>Verschiedenheit von Angeboten überhaupt erst möglich macht, wenn m<strong>an</strong>gleichzeitig e<strong>in</strong>en größtmöglichen Austausch zwischen denunterscheidbaren Angeboten erreichen will, e<strong>in</strong> notwendiges Werkzeug zurErhöhung der Freiheitsgrade <strong>und</strong> der Autonomie für <strong>die</strong> h<strong>an</strong>delndenAkteure.Die Stu<strong>die</strong>nprogramme müssen explizit auf den QR Bezug nehmen <strong>und</strong> ihreElemente detailliert mit dem QR verknüpfen. Das ist <strong>die</strong> Voraussetzung für<strong>die</strong> beschriebene Funktionalität. Bezogen auf den Vergleich verschiedenerStu<strong>die</strong>nprogramme wird d<strong>an</strong>n <strong>die</strong> <strong>in</strong>dividuelle Positionsbestimmung vonLernenden (Z.B. Stu<strong>die</strong>nplatzwechslern) möglich se<strong>in</strong>. Über den Abgleichmit dem Qualifikationsrahmen wird ausweisbar, ob <strong>und</strong> welche learn<strong>in</strong>goutcomes vom Stu<strong>die</strong>renden bereits erreicht wurden. Im Detail wird d<strong>an</strong>nauch darstellbar, wie <strong>die</strong>se Lernergebnisse erreicht wurden <strong>und</strong> ob ggf. zurSicherung des weiteren Lernerfolges konkrete Anpassungsleistungen fürdas neue Stu<strong>die</strong>nprogramm erbracht werden müssen. Dies mag kompliziertkl<strong>in</strong>gen. Es ergibt sich aber als Konsequenz umfassender, gewünschterVielfalt von Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>geboten.Was ist <strong>die</strong> Alternative? E<strong>in</strong> starre Gestaltung von Ausbildung <strong>in</strong> gleicherWeise <strong>an</strong> jedem Ort würde den jederzeitigen Wechsel von Lernendenerlauben, da sie sich ja stets im gleichen System bewegen würden.Allerd<strong>in</strong>gs - von didaktischen Gestaltungsräumen abgesehen - so würdehochschulisches Studium durch schulische Ausbildung ersetzt. Die<strong>Lehre</strong>nden wären zur Exekution von vorgegeben Lehrplänen verpflichtet.E<strong>in</strong>e Veränderung von Forschungs<strong>in</strong>teressen oder –gebieten würde zue<strong>in</strong>er Parallelführung von Forschung <strong>und</strong> <strong>Lehre</strong> für <strong>die</strong> <strong>Lehre</strong>nden führenmüssen. E<strong>in</strong>e Beteiligung der Stu<strong>die</strong>renden <strong>an</strong> forschender Entwicklungkönnte nur mittelbar, bzw. didaktisch gespielt, durchgeführt werden. Mitdem E<strong>in</strong>satz von QRs k<strong>an</strong>n <strong>die</strong>se Verengung vermieden werden. Um <strong>die</strong>senFreiheitsgew<strong>in</strong>n zu erkennen, müssen <strong>die</strong> Perspektiven der Nachfrageseitenach Qualifikationen noch reflektiert werden.6. Die Org<strong>an</strong>isation: Stu<strong>die</strong>ngänge als Querschnitts<strong>an</strong>gebotDie allgeme<strong>in</strong>e Leitung von QRs: Wenn e<strong>in</strong> Aufgabenbereich durch <strong>die</strong>, fürse<strong>in</strong>e Bewältigung nötigen, Qualifikationselemente h<strong>in</strong>reichend def<strong>in</strong>iertist, d<strong>an</strong>n soll über den QR e<strong>in</strong> Abgleich der Passung verschiedenerQualifikationsprofile für <strong>die</strong>sen Aufgabenbereich möglich se<strong>in</strong>.Typen von QualifikationsprofilenUlrich Bartosch, Mitglied im Team Deutscher Bologna-ExpertenAbb. 4: Typen von Qualifikationsprofilen. In der Wissensgesellschaft werdenunterschiedliche Qualifikationsprofile erzeugt <strong>und</strong> benötigt. Typologischwerden hier <strong>in</strong> der Grafik bildhaft unterschieden:Tom Saywer mit „experiencedbased learnig“ über se<strong>in</strong>en Fre<strong>und</strong> Huck F<strong>in</strong>n; D<strong>an</strong>iel Düsentrieb mit„experiential learn<strong>in</strong>g“, das zu erstaunlichen Erf<strong>in</strong>dungen führt; Meister Eder,der methodisches vocational tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g durch work based learn<strong>in</strong>g <strong>in</strong>zuverlässige, auch <strong>in</strong>novative Entwicklung umsetzt; Wernher von Braun, derapplied sciences betreibt <strong>und</strong> Werner Heisenberg, der mit theoretischer Physikauf der Basis von Gr<strong>und</strong>lagenforschung <strong>die</strong> Welt verändert. Alle Typen leistenwertvolle Dienste <strong>und</strong> können nicht gegenseitig ersetzt werden. Sie müssenunterscheidbar bleiben <strong>und</strong> <strong>in</strong> ihrer jeweiligen Genese <strong>und</strong> Leistungsfähigkeit<strong>an</strong>erk<strong>an</strong>nt werden.
1021.4.2 Bedeutung <strong>und</strong> Umsetzung von Qualifikationsrahmen1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 103Wenn <strong>die</strong> Aufgabenbeschreibungen im ‚Bologna-Code’ verfasst s<strong>in</strong>d, fallenLernergebnis <strong>und</strong> Kompetenzzuweisung zusammen. Das Q-Profil weist <strong>die</strong>vorh<strong>an</strong>denen Befähigungen aus <strong>und</strong> welche Wissensbestände, welcheVer<strong>an</strong>twortlichkeit, welche Haltungen mit großer Sicherheit vorliegen.(knowledge, skills, competencies, attitudes).muss <strong>die</strong>s geschehen, da – nicht <strong>an</strong>ders als heute z.B. über Zeugnisnoten –durch e<strong>in</strong>e Zuordnung von Qualifikationsprofilen persönliche Zugängenoder H<strong>in</strong>dernisse zu Bildung <strong>und</strong> Arbeit künftig vollzogen werden.WissenschaftBELF2Leitung <strong>und</strong>M<strong>an</strong>agement (5)(3+2)BELF4M3/F7M2<strong>Bachelor</strong>thesis(15)BELF5BELF6/F9ArbeitsfeldschwerpunktProfilbereiche (5)(5)Funktionsweise von QR-SystemenWissenschaftliche Qualifikation <strong>und</strong> Ver<strong>an</strong>twortung(Budget, Personal, Fach)Fall Fallverständnis Analysierter Fall Konzept Forschung DurchführungA)B)C)D)E)E)Professionelles Wissen Beschreibung Pl<strong>an</strong>ung Recherche Org<strong>an</strong>isation EvaluationH<strong>an</strong>delnVerstehen Analyse Konzeption Forschung DurchführungBewertung0 LevelBFS-LevelFakS/FS LevelBA LevelHochschuleBELF2BELF1M4/F2M3Erziehen,BELF5Leitung <strong>und</strong>Ges<strong>und</strong>heit BELF6/F9NetzwerkarbeitBilden <strong>und</strong>Arbeitsfeldschwerpunkt(5)M<strong>an</strong>agement (5)<strong>und</strong> Ernährung Profilbereiche (5)(5)Betreuen II (5)(3+2)(5)Praktisches Stu<strong>die</strong>nsemester (30)InstitutionelleBELF1M5/F4M2 Erziehen, Lernen <strong>und</strong> Kommunikation BELF5Ver<strong>an</strong>kerungE<strong>in</strong>füh. rechtl. Bilden <strong>und</strong> <strong>Lehre</strong>n <strong>und</strong> Interaktion Arbeitsfeldschwerpunkt(5)von K<strong>in</strong>dheitGr<strong>und</strong>lagen (5) Betreuen I (5) (5)(5)(5)PsychologischeF5M2BELF1M5/F4M1 Perspektiven& mediz<strong>in</strong>ische BELF4M2/F7M1 BELF10 Erweiterung <strong>in</strong>E<strong>in</strong>füh. rechtl. der K<strong>in</strong>dheit /Gr<strong>und</strong>lagen der Methoden der Vertiefung Berufliches H<strong>an</strong>deln/ MethodenGr<strong>und</strong>lagen (5) K<strong>in</strong>derperspektivenDiagnostik von Praxisreflexion (5) Arbeitsfelder (5)(3+2)(5)K<strong>in</strong>dern (5)(5)Gr<strong>und</strong>lagenSomatische <strong>und</strong>BELF1M2/F2M1BELF1M1/F1M1F3M1B:konfessioneller,kognitive EntwicklungdesE<strong>in</strong>führungBELF10E<strong>in</strong>füh. menschl.E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong>Gr<strong>und</strong>lagen<strong>in</strong>terkulturellerEntwicklung, Verhalten,H<strong>an</strong>deln (5)legung (5)Gesellschaft (5)wiss. Gr<strong>und</strong>-Politik <strong>und</strong>& <strong>in</strong>terreligiöserK<strong>in</strong>desArbeitsfelder (5)Erziehung (5)(5)MA LevelDr. LevelF) Professionelle allgeme<strong>in</strong>e Fähigkeiten <strong>und</strong> Haltungen <strong>in</strong> der Bildung <strong>und</strong> Erziehung im LebenslaufG) Persönlichkeitsmerkmale <strong>und</strong> HaltungenCurriculaUnitsQualitätszirkel: Arbeitswelt/HochschuleDidaktikPrüfungAbb. 5: Funktionsweise von QR-Systemen. Über den Peilstab, der <strong>die</strong>e<strong>in</strong>heitliche Blickposition herstellt, können <strong>die</strong> geprüftenQualifikationselemente <strong>in</strong> das gesuchte Qualifikationsprofil e<strong>in</strong>getragenwerden. Die learn<strong>in</strong>g outcomes gar<strong>an</strong>tieren <strong>die</strong>se Blickposition. Der Peilstabentspricht dem Bologna-Code.Augenblicklich ist <strong>die</strong> Diskussion über <strong>die</strong> Formulierungsmöglichkeiten <strong>und</strong><strong>die</strong> Reichweite von Learn<strong>in</strong>g-Outcome Beschreibungen <strong>in</strong> vollem G<strong>an</strong>ge. Esstellt sich – natürlich, möchte m<strong>an</strong> sagen – heraus, dass <strong>die</strong> Beschreibungvon Lernergebnissen <strong>in</strong> hohem Maße von Sprache abhängig ist. Diesbetrifft sowohl <strong>die</strong> Zuweisung von Bedeutungen <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>erL<strong>an</strong>dessprache, als auch <strong>die</strong> gr<strong>und</strong>legende Schwierigkeiten derfremdsprachlichen Übersetzung. Es wird <strong>in</strong> <strong>die</strong>sem Bereich umfassendeEntwicklungs- <strong>und</strong> Forschungsarbeiten geben müssen, wenn m<strong>an</strong> <strong>die</strong>gig<strong>an</strong>tische Kluft zwischen Anspruch <strong>und</strong> Funktion der Learn<strong>in</strong>g Outcomes<strong>und</strong> ihrem sehr unverb<strong>in</strong>dlichen Gehalt überw<strong>in</strong>den will. Und zweifellosAbb. 6: Qualitätssicherung über e<strong>in</strong>en QR. Am Beispiel e<strong>in</strong>es QR fürElementarpädagogik zeigt <strong>die</strong> Grafik, dass durch e<strong>in</strong>e Veränderung der<strong>Anforderungen</strong> von außen, der QR <strong>an</strong>gepasst wird. Die Umsetzung geschiehtdurch <strong>die</strong> autonome Hochschule. Dabei bleiben <strong>die</strong> Verb<strong>in</strong>dungen vonNachfrage zur Umsetzung im Lehr- Lernarr<strong>an</strong>gement bis zur Unit (Lerne<strong>in</strong>heit)nachverfolgbar <strong>und</strong> somit im Akkreditierungsverfahren auch überprüfbar.Wenn e<strong>in</strong> funktionsfähiger Diskussionsprozess zwischen Hochschule <strong>und</strong>Arbeitswelt über <strong>die</strong> jeweiligen Qualifikationsbed<strong>in</strong>gungen der Arbeitswelt<strong>und</strong> der Wissenschaft <strong>in</strong>stalliert ist, 25 d<strong>an</strong>n k<strong>an</strong>n über den Qualifikationsrahmene<strong>in</strong> verändertes Qualifikationsprofil <strong>in</strong> <strong>die</strong> Hochschule als25Freilich muss e<strong>in</strong>e “frühzeitige Beteiligung der Arbeitgeber” empfohlen worden, wie <strong>die</strong>szB. Wex e<strong>in</strong>fordert: „bereits bei der ersten Frage, ob e<strong>in</strong> berufsqualifizierenderStu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>g e<strong>in</strong>zurichten ist“. Siehe Peter Wex, <strong>Bachelor</strong> <strong>und</strong> <strong>Master</strong>. Die Gr<strong>und</strong>lagen desneuen Stu<strong>die</strong>nsystems <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d, Berl<strong>in</strong> 2005, S. 199f.
1041.4.2 Bedeutung <strong>und</strong> Umsetzung von Qualifikationsrahmen1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 105Anforderung zur Umsetzung <strong>in</strong> das Stu<strong>die</strong>nprogramm e<strong>in</strong>gebrachtwerden. 26Im Rahmen e<strong>in</strong>er Matrixorg<strong>an</strong>isation können Stu<strong>die</strong>ngänge als„Produktl<strong>in</strong>ien“ der Hochschulen entwickelt werden, <strong>in</strong>dem <strong>die</strong>vorh<strong>an</strong>denen Module bezüglich der Passung ihrer learn<strong>in</strong>g outcomesgeprüft werden, oder neue <strong>in</strong> der Hochschule entwickelt werden oderpassende Module von externen Anbietern ‚e<strong>in</strong>gekauft’ werden. Damit wird<strong>die</strong> Anforderung der bedarfsgerechten Qualifikation <strong>in</strong> derWissensgesellschaft mit der Anforderung freier Forschungs- <strong>und</strong>Lehrgestaltung verknüpfbar.Erst über <strong>die</strong> formulierten <strong>Anforderungen</strong> e<strong>in</strong>es nachgefragtenQualifikationsprofils werden <strong>die</strong> verfügbaren <strong>Lehre</strong><strong>in</strong>heiten bzw.Forschungstätigkeiten der Fakultäten spezifisch identifizierbar <strong>und</strong> ihreMitwirkung möglich gemacht. Damit k<strong>an</strong>n <strong>die</strong> aktuelle Forschungssituation<strong>an</strong> der Hochschule von der Angebotssituation für Stu<strong>die</strong>ngänge entkoppeltwerden. Freilich ist auch hier ke<strong>in</strong>e Beliebigkeit geme<strong>in</strong>t. Aber immerh<strong>in</strong>können unterschiedliche Module für e<strong>in</strong> Qualifikationsprofil e<strong>in</strong>gesetztwerden, wenn das Curriculum z.B. exemplarische Lern<strong>in</strong>halte zulässt. Ob<strong>die</strong>s <strong>und</strong> w<strong>an</strong>n <strong>die</strong>s möglich ist, wäre wiederum durch <strong>die</strong>versprochenen/nachgefragten Lernergebnisse zu klären.FakultätenSozArb RelPäd SLF WiWi PPF MGFTheo.GGFStu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gxForschung<strong>Lehre</strong>Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gBELO1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8Abb. 7: Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gsorg<strong>an</strong>isation als Querschnittsaufgabe. VerschiedeneFakultäten br<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>die</strong>sen ‚BEL’-Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>g <strong>Lehre</strong><strong>in</strong>heiten (<strong>in</strong> Form vonModulen oder Units) e<strong>in</strong>. Zugleich werden fachlich zugehörigeForschungs<strong>in</strong>teressen <strong>und</strong> –aktivitäten auch dem Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>g zugeordnet.26Vgl. Ulrich Bartosch, Mitarbeiterqualifizierung als Steuerungs<strong>in</strong>strument. Die Kooperationvon Hochschulen <strong>und</strong> Arbeitgebern im Bologna-Prozess zwischen Ch<strong>an</strong>ce <strong>und</strong>Ver<strong>an</strong>twortung, <strong>in</strong>: Renate Oxenknecht-Witzsch (Hg.), Zukunft des kirchlichen Tarifrechts,Dokumentation der Fachtagung am 1. <strong>und</strong> 2.März 2004 <strong>in</strong> Eichstätt, DieMitarbeitervertretung ZMV, Sonderheft 2004, S. 61-68.Prof. Dr. Ulrich Bartosch, KU, Fakultät Soziale ArbeitAbb. 8: Beispielhafte Zuordnung von Qualifikationselementen des QR SArbzum EQF LLLQualifikationsrahmen könnten künftig also e<strong>in</strong> <strong>an</strong>gemessenes, wichtigesInstrument für moderne Hochschulorg<strong>an</strong>isation darstellen. Sie erlauben es,<strong>die</strong> Lernergebnisse von hochschulischer Forschung <strong>und</strong> <strong>Lehre</strong> soabzubilden, dass sie mit den <strong>Anforderungen</strong> des Arbeitsmarktesabgeglichen werden können <strong>und</strong> darüber h<strong>in</strong>aus <strong>die</strong> Qualifikationsprozesse
1061.4.2 Bedeutung <strong>und</strong> Umsetzung von Qualifikationsrahmen1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 107außerhalb der Hochschule mit dem Studium konstruktiv verb<strong>und</strong>en werdenkönnen. 27 Sie bergen zudem <strong>die</strong> Ch<strong>an</strong>ce, <strong>die</strong> Spezifika hochschulischenStudiums auszuweisen <strong>und</strong> <strong>die</strong> nötigen Differenzierungen vonQualifikationsprofilen <strong>und</strong> Qualifikationswegen <strong>in</strong> der Wissensgesellschaftzu erhalten <strong>und</strong> zu überbrücken.Der QF EHEA sollte im System europäischer Qualifikationsrahmen <strong>die</strong>Kompatibilität zur übrigen Bildungsl<strong>an</strong>dschaft sichern <strong>und</strong> zugleich <strong>die</strong>besonderen Qualitäten <strong>und</strong> Aufgaben der hochschulischen Bildung zurFörderung e<strong>in</strong>er forschenden Haltung <strong>und</strong> Befähigung für Lernende <strong>in</strong>Europa sichtbar machen.Zusammenfassung AG 2: Zur Bedeutung <strong>und</strong> Umsetzung vonQualifikationsrahmen (fachlich, national, europäisch):Dr. Achim Hopbach, AkkreditierungsratGr<strong>und</strong>lage der Diskussion im Workshop waren zwei e<strong>in</strong>leitende Vorträge,zum e<strong>in</strong>en von Dr. Birger Hendriks, Leiter der Abteilung Hochschulen imSchleswig-Holste<strong>in</strong>ischen M<strong>in</strong>isterium für Wissenschaft, Wirtschaft <strong>und</strong>Verkehr, gleichzeitig Bologna-Beauftragter der Länder <strong>und</strong> derzeitKoord<strong>in</strong>ator der Wissenschaftsm<strong>in</strong>isterien für <strong>die</strong> Arbeitsgruppe zurErstellung des Bildungsbereichsübergreifenden Qualifikationsrahmens <strong>in</strong>Deutschl<strong>an</strong>d. Zum <strong>an</strong>deren führte Professor Dr. Ulrich Bartosch von derUniversität Eichstätt e<strong>in</strong>, der als Vorsitzender der Dek<strong>an</strong>e-Konferenz„Soziale Arbeit“ maßgeblich <strong>an</strong> der Erarbeitung des sektoralenQualifikationsrahmens Soziale Arbeit wesentlich beteiligt war.Die augenblickliche Situation sowohl auf nationaler als auch aufeuropäischer Ebene ist durch <strong>die</strong> Koexistenz jeweils zweierQualifikationsrahmen gekennzeichnet, je e<strong>in</strong>en für den Hochschulbereich<strong>und</strong> je e<strong>in</strong>en bildungsbereichsübergreifenden. In Deutschl<strong>an</strong>d s<strong>in</strong>d <strong>die</strong>s der„Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse“ <strong>und</strong> der sich27Zur Frage der Anerkennung ‚externer Qualifikationsergebnisse’ siehe umfassend:Consuelo Corradi, Norm<strong>an</strong> Ev<strong>an</strong>s, Aune Valk (Eds.), Recognis<strong>in</strong>g Experiential Learn<strong>in</strong>g,Practices <strong>in</strong> Europe<strong>an</strong> Universities, Tartu 2006.noch <strong>in</strong> der Entwicklung bef<strong>in</strong>dliche „Deutsche Qualifikationsrahmen fürLebensl<strong>an</strong>ges Lernen“, auf europäischer Ebene s<strong>in</strong>d <strong>die</strong>s „The Frameworkfor Qualifications for the Europe<strong>an</strong> Higher Education Area“ <strong>und</strong> der„Europe<strong>an</strong> Qualificationsframework for Lifelong Learn<strong>in</strong>g“Wenngleich <strong>die</strong>se Qualifikationsrahmen jeweils weitgehend <strong>die</strong>selbenstrukturellen Merkmale besitzen <strong>und</strong> sämtlich kompetenzorientiert <strong>und</strong>h<strong>in</strong>sichtlich der jeweils ausgewiesenen Qualifikationsniveaus kompatibels<strong>in</strong>d, ist <strong>die</strong> Kommunikation zwischen den Bildungsbereichen durch <strong>die</strong>Anwendung unterschiedlicher Deskriptoren für Kompetenzen <strong>und</strong>Qualifikationen noch immer erschwert. Dennoch entfalten <strong>die</strong>Qualifikationsrahmen, <strong>in</strong>dem gerade sie den Paradigmenwechsel h<strong>in</strong> zurKompetenzorientierung bei der Beschreibung von Bildungsprogrammenvor<strong>an</strong>treiben, erhebliche positive Wirkungen, <strong>in</strong>ten<strong>die</strong>rte <strong>und</strong> nicht <strong>in</strong> ersterL<strong>in</strong>ie <strong>in</strong>ten<strong>die</strong>rte, h<strong>in</strong>sichtlich der Beschäftigungsorientierung <strong>und</strong> derTr<strong>an</strong>sparenz zur Förderung der Durchlässigkeit zwischen denBildungsbereichen.Die besondere Bedeutung der sektoralen Qualifikationsrahmen liegt <strong>in</strong>ihrer vom allgeme<strong>in</strong>en Qualifikationsrahmen zu unterscheidendenFunktion: Geht es bei dem Qualifikationsrahmen für deutscheHochschulabschlüsse vor allem um <strong>die</strong> Beschreibung von Qualifikationen,somit von Stu<strong>die</strong>nabschlüsse, so steht im Zentrum des sektoralenQualifikationsrahmens nicht der Abschluss sondern das Kompetenzprofilder Stu<strong>die</strong>renden oder Absolventen mit Blick auf mögliche beruflicheTätigkeitsfelder. Der Zweck e<strong>in</strong>es sektoralen Qualifikationsrahmens liegtdamit <strong>in</strong> der Beschreibung der Stu<strong>die</strong>ngänge h<strong>in</strong>sichtlich der Learn<strong>in</strong>gOutcomes. Daraus resultiert e<strong>in</strong>e erhebliche praktische Relev<strong>an</strong>z für <strong>die</strong>Curriculumentwicklung. Solche Qualifikationsrahmen erhöhen <strong>die</strong>Tr<strong>an</strong>sparenz im Curriculum im Allgeme<strong>in</strong>en <strong>und</strong> im Besonderen auch imPrüfungswesen <strong>und</strong> <strong>in</strong> der Didaktik. Der dadurch verbessertenMöglichkeiten zum Vergleich von Stu<strong>die</strong>ngängen gew<strong>in</strong>nen besonders<strong>an</strong>gesichts der zunehmenden Profilbildung der Stu<strong>die</strong>ngänge <strong>und</strong> derHochschulen zunehmend <strong>an</strong> Bedeutung.Kernfrage für <strong>die</strong> Beurteilung von Bedeutung von Qualifikationsrahmen ist<strong>die</strong> nach der Steuerungsfunktion: Welche Steuerungsfunktion ist
1081.4.2 Bedeutung <strong>und</strong> Umsetzung von Qualifikationsrahmen1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 109erwünscht? Untrennbar hiermit ist das Kernproblem der Verb<strong>in</strong>dlichkeitvon Qualifikationsrahmen verb<strong>und</strong>en. Sollen sie bei der Entwicklung vonStu<strong>die</strong>ngängen lediglich Orientierung bieten <strong>und</strong> somit <strong>die</strong> Funktion e<strong>in</strong>esReferenzrahmens besitzen? Oder geht es bei ihrer Anwendung umÜbere<strong>in</strong>stimmung, was e<strong>in</strong>en höheren Grad <strong>an</strong> Verb<strong>in</strong>dlichkeit bedeutenwürde? Welche Steuerungsfunktion soll e<strong>in</strong> Qualifikationsrahmen alsoentfalten? E<strong>in</strong>igkeit gibt es h<strong>in</strong>sichtlich der Steuerungsfunktion <strong>in</strong> Bezugauf das Qualifikationsniveau, da <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er verb<strong>in</strong>dlichen Regelung e<strong>in</strong>ewichtige Gr<strong>und</strong>lage für studentische Mobilität zu sehen ist.Sehr kritisch wird h<strong>in</strong>gegen beurteilt, ob h<strong>in</strong>sichtlich des <strong>in</strong>haltlichen Profilse<strong>in</strong>es Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gs e<strong>in</strong>e erhebliche Steuerungswirkung geben soll. DieDiskussion <strong>die</strong>ser Frage bewegt sich zwischen den Polen „Ne<strong>in</strong> zurRückkehr zur Rahmenprüfungsordnung“ <strong>und</strong> „Orientierung <strong>in</strong> denStu<strong>die</strong>ngängen <strong>in</strong> Zeiten zunehmender Profilbildung <strong>und</strong> zunehmenderProbleme <strong>in</strong> der studentischen Mobilität“.Auch wenn <strong>die</strong>se Debatte längst nicht zu Ende ist, best<strong>an</strong>d E<strong>in</strong>igkeit immehrfachen Nutzen von Qualifikationsrahmen <strong>in</strong> drei zentralen Punkten:1. Qualifikationsrahmen bieten wegen des gr<strong>und</strong>legenden Pr<strong>in</strong>zips derKompetenzorientierung den Hochschulen <strong>und</strong> den Stu<strong>die</strong>renden,potenziellen Arbeitgebern <strong>und</strong> der <strong>in</strong>teressierten Öffentlichkeit imAllgeme<strong>in</strong>en Orientierung h<strong>in</strong>sichtlich des Qualifikationsniveaus <strong>und</strong>Qualifikationsprofils der Absolvent<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Absolventen.Insbesondere ermöglicht <strong>die</strong> Kompetenzorientierung e<strong>in</strong>e verbesserteDarstellung unterschiedlicher Profile der Stu<strong>die</strong>ngänge, <strong>die</strong> zu e<strong>in</strong>ervergleichbaren oder ähnlichen Qualifikation führen.2. Qualifikationen fördern somit n erheblichem Maße <strong>die</strong> Tr<strong>an</strong>sparenz<strong>und</strong> fungieren als wichtiger Referenzpunkt für den Vergleich vonStu<strong>die</strong>ngängen, da auch unterschiedliche Profile leichter zue<strong>in</strong><strong>an</strong>der <strong>in</strong>Beziehung gesetzt werden können.3. Qualifikationsrahmen stärken <strong>die</strong> Position der Hochschulen bei derBeschreibung von Qualifikationen <strong>und</strong> Kompetenzen. Er fordert <strong>die</strong>Hochschulen hier auch heraus, <strong>die</strong>s gründlich <strong>und</strong> unter Beteiligungder Stu<strong>die</strong>renden <strong>und</strong> der „Abnehmerseite“ zu tun.Insgesamt verdeutlichte <strong>die</strong> Diskussion, dass e<strong>in</strong>e Herausforderung für alle<strong>an</strong> der Entwicklung von Qualifikationsrahmen beteiligten Institutionen <strong>und</strong>Personen dar<strong>in</strong> besteht, <strong>die</strong> Bal<strong>an</strong>ce zwischen Orientierung <strong>und</strong>Gestaltungsfreiheit bei der Entwicklung von Stu<strong>die</strong>ngängen zu wahren.1.4.3 Arbeitsgruppe 3: Kompetenzorientierter Leistungsnachweis:Anspruch <strong>und</strong> WirklichkeitKompetenzorientiertes Prüfen <strong>in</strong> der Hochschule: Eigentlich e<strong>in</strong>eSelbstverständlichkeit?Prof. Dr. Kar<strong>in</strong> Klepp<strong>in</strong>, Ruhr-Universität BochumDie bee<strong>in</strong>druckende Zahl der BA/MA Stu<strong>die</strong>ngänge <strong>an</strong> deutschenHochschulen suggeriert: Der Bologna-Prozess hat sich weitgehenddurchgesetzt; somit sollte das gesamte Unterrichtsgeschehen <strong>an</strong> derHochschule e<strong>in</strong>en Paradigmenwechsel erfahren haben. Das Schlagwort„the shift from teach<strong>in</strong>g to learn<strong>in</strong>g“ macht deutlich, dass <strong>Lehre</strong>nde sichvon der Stoffzentrierung der <strong>Lehre</strong> h<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>er Kompetenzorientierungwenden sollen. Sie sollen sich zu ‚Lerncoachs’ entwickeln, <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>rendenicht mehr zu e<strong>in</strong>er Akkumulierung von so gen<strong>an</strong>ntem ‚trägen Wissen’führen, sondern sie zum Selbststudium im S<strong>in</strong>ne selbstorg<strong>an</strong>isierendenLernens <strong>an</strong>regen (vgl. z. B. Berendt, Voss & Wildt, 2002; Knoll, 2001) <strong>und</strong>den Blick auf e<strong>in</strong>en Tr<strong>an</strong>sfer zur Anwendung öffnen. Diese Forderungstellte <strong>die</strong> Europäische Rektorenkonferenz schon vor mehr als 10 Jahrenauf (CRE/UNESCO-CEPES, 1997). Für <strong>die</strong> konkrete Unterrichtsgestaltungsowie für <strong>die</strong> begleitenden bzw. abschließenden Überprüfungen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong><strong>die</strong>sem veränderten Paradigma kont<strong>in</strong>uierlich z.B. folgende Fragen zustellen:• S<strong>in</strong>d <strong>die</strong> dem Workload entsprechenden, realistisch zu erreichendenKompetenzen für Stu<strong>die</strong>rende tr<strong>an</strong>sparent beschrieben (z.B. <strong>in</strong> Form vonK<strong>an</strong>n-Beschreibungen)?
1101.4.3 Kompetenzorientierter Leistungsnachweis1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 111• Werden <strong>die</strong> Unterrichtsmethoden dargestellt <strong>und</strong> ihrer Darstellungentsprechend auch e<strong>in</strong>gesetzt (z.B. Verb<strong>in</strong>dung von Input-Phasen <strong>und</strong>Projekten, von Präsenz- <strong>und</strong> Dist<strong>an</strong>zphasen)?• Werden <strong>die</strong> erwarteten Produkte (z.B. Portfolio, Projektergebnisse,empirische Untersuchungen, Hausarbeiten, Testergebnisse) beschrieben?• Werden <strong>die</strong> (stu<strong>die</strong>nbegleitenden) Test- <strong>und</strong> Prüfungsformene<strong>in</strong>schließlich der jeweiligen Bewertungskriterien tr<strong>an</strong>sparent gemacht?Ob mittlerweile Kompetenzorientierung <strong>in</strong> der konkretenUnterrichtssituation weitgehend von Stu<strong>die</strong>renden <strong>und</strong> <strong>Lehre</strong>nden verfolgtwird, sei dah<strong>in</strong>gestellt; Tests <strong>und</strong> Leistungsbewertungen s<strong>in</strong>d imHochschulkontext sicherlich nicht durchgängig auf <strong>die</strong> Überprüfung der <strong>in</strong>den Stu<strong>die</strong>ngängen beschriebenen Kompetenzen ausgerichtet.Prüfungen <strong>und</strong> Leistungsnachweise im Hochschulkontext: E<strong>in</strong>igeEssentialsFür <strong>die</strong> Erstellung, Durchführung <strong>und</strong> Bewertung von Prüfungen <strong>und</strong> Tests– ob stu<strong>die</strong>nbegleitende, Fach- oder Abschlussprüfungen sollten für denHochschulkontext spezifische Qualitäts- <strong>und</strong> Gütekriterien erarbeitetwerden (zur Org<strong>an</strong>isation s. z.B. B<strong>und</strong>-Länder-Kommission fürBildungspl<strong>an</strong>ung <strong>und</strong> Forschungsförderung 2002). Selbst wenn es sichnicht um st<strong>an</strong>dardisierte Testverfahren h<strong>an</strong>delt, so s<strong>in</strong>d doch – vor derErstellung jeglicher Prüfungen – zunächst e<strong>in</strong>e Reihe von Fragen zu klären<strong>und</strong> entsprechende Entscheidungen zu treffen:• Auf welche Art von Kompetenzen möchte m<strong>an</strong> Rückschlüsse ziehen?Interessiert m<strong>an</strong> sich z.B. dafür, ob e<strong>in</strong> Student <strong>die</strong> Fachliteraturverarbeitet hat <strong>und</strong> sie <strong>in</strong> se<strong>in</strong>e Argumentation e<strong>in</strong>beziehen k<strong>an</strong>n, ob ere<strong>in</strong> Verfahren verst<strong>an</strong>den hat <strong>und</strong> es nun e<strong>in</strong>setzen bzw. <strong>an</strong>wenden k<strong>an</strong>netc.? Hierbei h<strong>an</strong>delt es sich um <strong>die</strong> Def<strong>in</strong>ition des Prüfungs-/Testkonstruktes.• Für welches Prüfungs-/Testformat bzw. für welcheLeistungsnachweisform optiert m<strong>an</strong> auf der Gr<strong>und</strong>lage <strong>die</strong>sesKonstruktes? Wählt m<strong>an</strong> für schriftliche Prüfungen z.B. Auswahlformate(z.B. Multiple-Choice-Aufgaben), <strong>die</strong> e<strong>in</strong>facher <strong>und</strong> ökonomischerauswertbar s<strong>in</strong>d? Entscheidet m<strong>an</strong> sich für Konstruktionsformate, <strong>die</strong><strong>die</strong>sen Vorteil nicht gewährleisten, <strong>die</strong> jedoch authentischer s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> sich<strong>an</strong> realen Situationen orientieren (z.B. e<strong>in</strong>e komplexe Aufgabenstellung,<strong>die</strong> e<strong>in</strong>en argumentativen Text hervorrufen soll)? Oder s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>spezifischen Lehr-/Lernkontexten lernprozessbegleitende Verfahren wiez.B. e<strong>in</strong> Portfolio <strong>an</strong>gemessener?• Wie lassen sich bei Überprüfungen oder Leistungsnachweisentestspezifische Gütekriterien (vgl. z.B. Grotjahn, 2008) weitestgehendberücksichtigen, d.h. z.B. <strong>die</strong> Validität <strong>in</strong> Bezug auf <strong>die</strong> zu messendeKompetenz, <strong>die</strong> Reliabilität (Messgenauigkeit), <strong>die</strong> Fairness, <strong>die</strong>Objektivität, <strong>die</strong> Möglichkeit e<strong>in</strong>er positiven Rückwirkung (washback-Effekt) auf Unterricht <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung oder auch <strong>die</strong>Praktikabilität bei der Durchführung <strong>und</strong> der Bewertung? Wenn z.B.Prüfungen so erstellt <strong>und</strong> e<strong>in</strong>gesetzt werden, dass sie kaum Aussagenüber <strong>die</strong> zu testende Kompetenz erlauben oder wenn den Stu<strong>die</strong>rendenBewertungskriterien nicht tr<strong>an</strong>sparent gemacht werden, d<strong>an</strong>n besteht <strong>die</strong>Gefahr kurzfristiger unreflektierter Prüfungsvorbereitungen ohnenachhaltige Lernprozesse.• Welche Bewertungskriterien gelten? Wer entscheidet über <strong>die</strong> Kriterien?Denn dass klar umrissene <strong>und</strong> tr<strong>an</strong>sparent zu machendeBewertungskriterien <strong>an</strong> <strong>die</strong> Stelle der „traditionellen“ (z.B. <strong>an</strong> e<strong>in</strong>erBezugsgruppe orientierten) Kriterien <strong>und</strong> weitgehend auch <strong>an</strong> <strong>die</strong> Stellevon Bewertungen auf der Gr<strong>und</strong>lage von Vorerfahrungen mitStu<strong>die</strong>renden treten sollten, versteht sich – bei Kompetenzorientierungals Leitl<strong>in</strong>ie – von selbst. Noch ke<strong>in</strong>e (befriedigenden) Antwortenexistieren auf Fragen wie etwa, wie solche Bewertungskriterien zudef<strong>in</strong>ieren s<strong>in</strong>d, ob z.B. auch Deskriptoren <strong>in</strong> Form von K<strong>an</strong>n-Beschreibungen entwickelt werden <strong>und</strong> wie <strong>und</strong> ob e<strong>in</strong>e Gewichtung derKriterien erfolgen sollte.• Macht es S<strong>in</strong>n, bei der Entscheidung für bestimmte BewertungskriterienRückmeldungen durch Stu<strong>die</strong>rende mit e<strong>in</strong>zubeziehen <strong>und</strong> wie wäredabei vorzugehen? Sollten Stu<strong>die</strong>rende z.B. bei e<strong>in</strong>er Präsentation vonVornhere<strong>in</strong> <strong>die</strong> Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte lenken können,<strong>die</strong> sie evaluiert haben möchten? Wie können Formen derSelbstevaluation berücksichtigt werden? Könnten Stu<strong>die</strong>rende z.B. beie<strong>in</strong>er schriftlichen Arbeit von sich aus <strong>an</strong>geben, worauf sie besonders
1121.4.3 Kompetenzorientierter Leistungsnachweis1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 113geachtet haben? Wie können solche Fokussierungen <strong>in</strong> <strong>die</strong> Bewertunge<strong>in</strong>gehen?• Wie werden Prüfungen vorbereitet? Werden z.B. Prüfungssimulationen<strong>an</strong>geboten? Prüfungssimulationen können auch über Peer-Prüfungen mitBeobachtung <strong>in</strong> Sem<strong>in</strong>arsitzungen erfolgen, <strong>in</strong> denen d<strong>an</strong>n sowohl überdas eigene Prüferverhalten, als auch über das eigeneK<strong>an</strong>didatenverhalten reflektiert werden k<strong>an</strong>n <strong>und</strong> <strong>in</strong> denen s<strong>in</strong>nvolleStrategien für <strong>die</strong> Prüfungsvorbereitung <strong>und</strong> das Verhalten <strong>in</strong>Prüfungssituationen entwickelt werden etc. Damit ließe sich z.B. auch <strong>die</strong>Stu<strong>die</strong>rendenberatung entlasten, <strong>die</strong> bei dem großenPrüfungsaufkommen <strong>in</strong> den BA/MA-Stu<strong>die</strong>ngängen vielfach zu kurzkommt.• Welches Feedback erhalten Stu<strong>die</strong>rende nach der Prüfung? E<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>facheNennung der Note ist sicherlich nicht hilfreich. E<strong>in</strong>e Rückmeldung auf derBasis positiver K<strong>an</strong>n-Beschreibungen – wie <strong>die</strong>s z.B. fürfremdsprachliche Kompetenzen mittlerweile üblich ist (s. Europarat 2001)– sowie weitere hilfreiche Empfehlungen s<strong>in</strong>d zwar aufwendig, könntenaber zum<strong>in</strong>dest nach mündlichen Prüfungsformen geleistet werden.Im Folgenden werde ich auf der Gr<strong>und</strong>lage <strong>die</strong>ser Fragen kurz auf <strong>die</strong>Formate schriftlicher <strong>und</strong> mündlicher Leistungsfeststellung <strong>und</strong> -überprüfung im Hochschulkontext e<strong>in</strong>gehen.Zu schriftlichen Prüfungen <strong>und</strong> LeistungsnachweisenAuf der <strong>die</strong>sjährigen Jahrestagung des Bologna-Zentrums derHochschulrektorenkonferenz „<strong>Neue</strong> <strong>Anforderungen</strong> <strong>an</strong> <strong>die</strong> <strong>Lehre</strong>“ wurdekontrovers diskutiert, ob sich <strong>die</strong> <strong>an</strong> Hochschulen <strong>in</strong> vielen Ver<strong>an</strong>staltungenüblichen Klausuren überhaupt dazu eignen, <strong>die</strong> <strong>in</strong> den neuenStu<strong>die</strong>ngängen <strong>an</strong>visierten Kompetenzen zu überprüfen. Die Me<strong>in</strong>ungwurde geäußert, m<strong>an</strong> solle <strong>in</strong> Prüfungen eher aufgabenorientiert vorgehen<strong>und</strong> konkrete, reale Aufgaben lösen lassen. Vertreter aus Fächern mitgroßen Studentenzahlen h<strong>in</strong>gegen betonten, dass ihr hohesPrüfungsaufkommen mit solchen Prüfungsformaten nicht zu bewältigensei. M.E. muss ke<strong>in</strong>e gr<strong>und</strong>sätzliche Entscheidung für oder widerbestimmte Prüfungsformate getroffen werden, sondern begründete,sach<strong>an</strong>gemessene <strong>und</strong> zielgruppenorientierte Entscheidungen fürspezifische Lehr- <strong>und</strong> Lernkontexte. Solchermaßen flexible Entscheidungenmüssen allerd<strong>in</strong>gs für Stu<strong>die</strong>rende stets tr<strong>an</strong>sparent se<strong>in</strong>.Unterschiedliche – auch traditionelle - Formate könnten z.B. se<strong>in</strong>:• Tests <strong>und</strong> Klausuren sollten weitgehend Gütekriterien vonst<strong>an</strong>dardisierten Tests berücksichtigen; sie werden <strong>in</strong> der Regel vor Ort<strong>und</strong> bei gleichzeitiger Anwesenheit des Prüfers/der Prüfer durchgeführt.• Bei Lösungen von konkreten Aufgaben (z. B. <strong>in</strong> denIngenieurswissenschaften werden sich Beobachtungen <strong>an</strong> H<strong>an</strong>d vonspezifischen Bewertungskriterien <strong>an</strong>bieten.• Hausarbeiten, empirische Untersuchungen <strong>und</strong> Projekte werden wohleher <strong>in</strong>dividuell oder im Team <strong>und</strong> <strong>in</strong> der Regel nicht vor Ort <strong>und</strong> <strong>in</strong>Anwesenheit des Prüfers/der Prüfer durchgeführt.• Portfolios, <strong>in</strong> denen Selbstreflexionen, eigene Arbeiten,Prüfungsergebnisse etc. e<strong>in</strong>gefügt werden, s<strong>in</strong>d bereits seit Ende derachtziger Jahre <strong>in</strong> der Diskussion (vgl. z.B. Wildt 2003; Coyle 1996). Siekönnen als Gr<strong>und</strong>lage für <strong>die</strong> Bewilligung von Leistungsnachweisen<strong>die</strong>nen. Unterschiedliche Ausprägungen s<strong>in</strong>d möglich, wie etwa– weitgehend freie Portfolios, z.B. auf Sem<strong>in</strong>arsitzungen <strong>und</strong> Rubrikenbezogene schriftliche Ausarbeitungen (Z.B. Was war für den<strong>in</strong>dividuellen Stu<strong>die</strong>renden von Bedeutung, was k<strong>an</strong>n er nach derSitzung besser?).– aufgabengeleitete Portfolios (z.B. Recherchen, Befragungen,H<strong>in</strong>zuziehung von weiterer Fachliteratur, Selbstreflexionen zu eigenenPräsentationen, Selbstreflexionen zu Sem<strong>in</strong>arformen).– Ausbildungs- <strong>und</strong> Sem<strong>in</strong>arportfolios (für e<strong>in</strong> g<strong>an</strong>zes oder auch mehrereModule).Portfolios s<strong>in</strong>d auf Gr<strong>und</strong> der selbstreflektiven Anteile nicht leicht zubewerten. E<strong>in</strong>e tr<strong>an</strong>sparente <strong>und</strong> e<strong>in</strong>vernehmliche Absprache mitStu<strong>die</strong>renden über <strong>die</strong> Bewertungskriterien <strong>und</strong> Skalierung für <strong>die</strong>Notenvergabe ist m. E. jedoch möglich.
1141.4.3 Kompetenzorientierter Leistungsnachweis1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 115Zu mündlichen Prüfungen <strong>und</strong> LeitungsnachweisenAuch hier können eher traditionellen Formen neben aufgabenorientiertenFormen existieren:• Individuelle Prüfungen s<strong>in</strong>d der Regelfall für mündliche Prüfungen;gerade sie werden jedoch häufig nicht kompetenzorientiert durchgeführt.Dies zeigen u. a. noch immer existierende Protokollformulare, <strong>in</strong> denenBewertungsvorgaben wie <strong>die</strong> folgenden existieren: „u.b.“ (umfassendbe<strong>an</strong>twortet), „b.“ (be<strong>an</strong>twortet), „m.H.b.“ (mit Hilfe be<strong>an</strong>twortet),„m.g.H.b.“ (mit großer Hilfe be<strong>an</strong>twortet), „n.b.“ (nicht be<strong>an</strong>twortet).Diese Vorgaben verraten, welche Vorstellungen mit <strong>die</strong>sen Prüfungen(z.B. Abfrage trägen Wissens) verb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> welchePrüfungs<strong>in</strong>teraktionen zu erwarten s<strong>in</strong>d. In den Naturwissenschaftenbieten sich – wie oben schon erwähnt – reale Aufgabenstellungen als sogen<strong>an</strong>nte Perform<strong>an</strong>ztests <strong>an</strong>; doch auch <strong>in</strong> den Geisteswissenschaftensollte nicht vergessen werden, dass sich e<strong>in</strong>e Prüfung auchaufgabenorientiert <strong>und</strong> vor allem <strong>in</strong>teraktiv gestalten lässt. Somit werdenRückmeldesignale notwendig, <strong>die</strong> nicht sofortige Bewertung implizieren(z.B. Verstehens- oder Höflichkeitssignale). E<strong>in</strong> kompetenzorientiertesPrüfen sollte Kompetenzgrenzen ausloten <strong>und</strong> nicht nur auf dasAuff<strong>in</strong>den von Defiziten ausgerichtet se<strong>in</strong>. Über<strong>die</strong>s könnte über e<strong>in</strong>eabschließende Rückversicherungsfrage (“Jokerfrage“) herausgef<strong>und</strong>enwerden, ob der Prüfl<strong>in</strong>g aus se<strong>in</strong>er Sicht se<strong>in</strong>e Kompetenzen überhauptdarlegen konnte. Rückmeldungen nach der Prüfung können <strong>in</strong> Form vonpositiven K<strong>an</strong>n-Beschreibungen <strong>und</strong> weiteren Empfehlungen zuvorh<strong>an</strong>denen Defiziten erfolgen, damit <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>renden e<strong>in</strong>e für sietr<strong>an</strong>sparente <strong>und</strong> hilfreiche E<strong>in</strong>schätzung erhalten.• Kle<strong>in</strong>gruppenprüfungen eignen sich für das Lösen von Aufgaben imTeam, sie benötigen allerd<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> der Regel mehr als e<strong>in</strong>en Prüfer bzw.Beobachter, <strong>die</strong> auf der Basis e<strong>in</strong>es e<strong>in</strong>heitlichen Kriterienrasters zu e<strong>in</strong>ermöglichst übere<strong>in</strong>stimmenden Bewertung kommen sollten.• Präsentationen <strong>und</strong> Referate gelten häufig als Gr<strong>und</strong>lage für mündlicheLeistungsnachweise. Vor e<strong>in</strong>er gesamten Gruppe nache<strong>in</strong><strong>an</strong>dergehaltenen Referate oder Präsentationen bieten dem <strong>Lehre</strong>nden (<strong>und</strong>den <strong>an</strong>deren Stu<strong>die</strong>renden) zwar e<strong>in</strong>e Gr<strong>und</strong>lage für Bewertungen <strong>und</strong>geme<strong>in</strong>same Evaluationen. Bleiben sie jedoch auf <strong>die</strong>se Funktionbegrenzt, d<strong>an</strong>n bieten sie den „zuhörenden“ Stu<strong>die</strong>renden ke<strong>in</strong>e weiterenLern<strong>an</strong>reize. Parallel stattf<strong>in</strong>dende Präsentationen (z.B.Posterpräsentationen) h<strong>in</strong>gegen können eher zu (auch kurzen)Nachfragen <strong>und</strong> e<strong>in</strong>em Austausch <strong>an</strong>regen.• Sem<strong>in</strong>arvorbereitungen <strong>und</strong> -durchführungen durch Stu<strong>die</strong>rende fürStu<strong>die</strong>rende erlauben e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>bezug der didaktischen Ebene <strong>in</strong> denmündlichen Leistungsnachweis. Die vorbereitenden Stu<strong>die</strong>renden haltenke<strong>in</strong>e monologischen „wissensdarstellenden“ oder„wissensvermittelnden“ Referate, sondern beziehen über geeigneteAufgabenstellungen <strong>die</strong> Sem<strong>in</strong>argruppe e<strong>in</strong>. Sie können d<strong>an</strong>n auf derBasis vorher beschlossener Kriterien evaluiert werden. Abgesehen vonPräsentationstechniken, <strong>die</strong> ihren eigenen Wert für späteresprofessionelles H<strong>an</strong>deln haben, wird damit auch <strong>die</strong> Fähigkeit zurVerb<strong>in</strong>dung von s<strong>in</strong>nvoll <strong>an</strong>geordnetem Input mit Arbeitsaufgaben sowieAuswertungsphasen für <strong>die</strong> Kommilitonen geschult.• Peer-Prüfungen können ver<strong>an</strong>staltungsbegleitend oder auchabschließend e<strong>in</strong>gesetzt werden. Dabei bereiten alle Stu<strong>die</strong>rendenPrüfungsfragen zu e<strong>in</strong>em vere<strong>in</strong>barten Gebiet vor <strong>und</strong> simulieren d<strong>an</strong>n <strong>in</strong>Paararbeit <strong>und</strong> <strong>in</strong> wechselnden Rollen (Prüfer <strong>und</strong> Geprüfte) <strong>die</strong>Prüfungssituation. Die Dokumentation <strong>und</strong> <strong>die</strong> rollenorientierte Reflexionder Erfahrungen k<strong>an</strong>n <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Leistungsnachweis (Portfolio o. a.)e<strong>in</strong>gehen. So werden z.B. auch erste reflektierte Erfahrungen miteigenem Prüferverhalten möglich.Natürlich können mündliche <strong>und</strong> schriftliche Prüfungsformen mite<strong>in</strong><strong>an</strong>derkomb<strong>in</strong>iert werden, z.B. wenn Projektergebnisse, Ergebnisse ausempirischen Untersuchungen etc. <strong>in</strong> gegenseitig zugänglichePosterpräsentationen, “Messestände” oder <strong>in</strong> <strong>an</strong>dere Produkte (z.B.Aufgabenstellungen für <strong>die</strong> Kommilitonen) münden.Damit <strong>die</strong> Notenvergabe nicht willkürlich erfolgt, müssen <strong>in</strong> jedem Fall füralle Prüfungsformate <strong>und</strong> Leistungsnachweise Bewertungskriterien, z.B.auch <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es skalierten Rasters, vorliegen <strong>und</strong> den Stu<strong>die</strong>rendenbek<strong>an</strong>nt se<strong>in</strong>.
1161.4.3 Kompetenzorientierter Leistungsnachweis1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 117Zitierte LiteraturBerendt, B.; Voss, H.-P.; Wildt, J. (Hrsg.) (2002): <strong>Neue</strong>s H<strong>an</strong>dbuchHochschullehre. Neuauflage. Berl<strong>in</strong>.Coyle, D. (1996): Develop<strong>in</strong>g Student Reflective Skills <strong>in</strong> ITE 'Look<strong>in</strong>gforwards by look<strong>in</strong>g back'. In: Council of Europe (1996): Rapport onWorkshop 15B: The Initial Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g of Modern L<strong>an</strong>guage Teachers. Pol<strong>an</strong>d1-5-July 1996. Compiled by H. Komorowska & J. Zielínska. Strasbourg, 43-48.CRE/UNESCO-CEPES (Hrsg.) (1997): A Europe<strong>an</strong> Agenda for Ch<strong>an</strong>ge forHigher Education <strong>in</strong> the XXIst Century. Results of the Europe<strong>an</strong> RegionalForum. Palermo.Europarat (2001): Geme<strong>in</strong>samer europäischer Referenzrahmen fürSprachen: lernen, lehren, beurteilen. (Herausgegeben vom Goethe-InstitutInter Nationes, der Ständigen Konferenz der Kulturm<strong>in</strong>ister der Länder <strong>in</strong>der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschl<strong>an</strong>d (KMK), der Schweizerischen Konferenz derK<strong>an</strong>tonalen Erziehungsdirektoren (EDK) <strong>und</strong> dem österreichischenB<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium für Bildung, Wissenschaft <strong>und</strong> Kultur (BMBWK)). Berl<strong>in</strong>u.a.Grotjahn, Rüdiger (2008): Testen <strong>und</strong> Evaluieren fremdsprachlicherKompetenzen: E<strong>in</strong> Arbeitsbuch. Tüb<strong>in</strong>gen. [ersche<strong>in</strong>t].Knoll, J. (2001): Hochschuldidaktik. In: A. H<strong>an</strong>ft (Hrsg.): Gr<strong>und</strong>begriffe desHochschulm<strong>an</strong>agements. Neuwied/Kriftel, 155-158.Wildt, J. (2003): Thesen zu e<strong>in</strong>er modularisierten hochschuldidaktischenWeiterbildung. Qualifizierungsprogramme zwischen Marktsteuerung <strong>und</strong>Expertenkonstruktion. In U. Welbers (unter Mitarbeit von T. Korytko) (Hrsg.)(2003): Hochschuldidaktische Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung. Bielefeld, 117-129.B<strong>und</strong>-Länder-Kommission für Bildungspl<strong>an</strong>ung <strong>und</strong> Forschungsförderung(BLK) (Hrsg): Heft 101. Modularisierung <strong>in</strong> Hochschulen. H<strong>an</strong>dreichung zurModularisierung <strong>und</strong> E<strong>in</strong>führung von <strong>Bachelor</strong>- <strong>und</strong> <strong>Master</strong>-Stu<strong>die</strong>ngängen. Bonn 2002. Abrufbar unter http://www.blkbonn.de/papers/heft101.pdfKompetenzorientierte LeistungsnachweiseProf. Dr. M<strong>an</strong>fred Künzel, Université Fribourg, SchweizDer Schlüssel zur Umsetzung der Bologna Reform ist <strong>die</strong> Zielformulierungmit Kompetenzen. Gut gewählte Kompetenzen erlauben e<strong>in</strong>e hohe <strong>und</strong>zielgerichtete studentische Aktivität <strong>und</strong> geben valide Kriterien für <strong>die</strong>Leistungsbeurteilung.Module, Credits <strong>und</strong> KompetenzenModule werden bereits mit Kompetenzen gepl<strong>an</strong>t, aberLeistungsnachweise noch nicht.Die Bolognareform schlägt als Leitpl<strong>an</strong>ken für <strong>die</strong> Hochschulausbildungvor, <strong>in</strong> s<strong>in</strong>nhaften E<strong>in</strong>heiten zu arbeiten (Module), hohe studentischenAktivitäten zu stimulieren (e<strong>in</strong> Credit umfasst 30 St<strong>und</strong>en studentischeAktivität), zielgerichtet zu pl<strong>an</strong>en (Kompetenzen) <strong>und</strong> <strong>die</strong>Leistungsfähigkeit der Stu<strong>die</strong>renden am Ende des Moduls auch zubezeugen (Leistungsnachweis) [1]. E<strong>in</strong>e Kompetenz wird als fachlich <strong>und</strong>methodisch adäquates Bewältigen e<strong>in</strong>es Sets ähnlicher Aufgabenverst<strong>an</strong>den.Die meisten Universitäten benützen <strong>die</strong>se Bezeichnungen (viel benutztehaben grosse Häkchen <strong>in</strong> der Grafik), aber nur wenige setzen sies<strong>in</strong>ngemäss oder wirksam um (kle<strong>in</strong>ere Häkchen). Diese E<strong>in</strong>druck ausdeutschen Projekten wird auch <strong>in</strong> der Schweiz bestätigt [2]. Module s<strong>in</strong>dalso oft vorh<strong>an</strong>den, seltener s<strong>in</strong>d sie s<strong>in</strong>nhafte E<strong>in</strong>heiten gestaltet, eherwerden sie aus älteren Kursen zusammengesetzt. Der Kompetenzbegriffwird fast überall benützt, oft zu allgeme<strong>in</strong> um damit Prüfungen pl<strong>an</strong>en zukönnen. Die Leistungsnachweise selbst werden fast nie mitKompetenzkriterien ausgewertet.Trias: Pl<strong>an</strong>en - Methode wählen – prüfenKompetenzorientierte Leistungsnachweise s<strong>in</strong>d d<strong>an</strong>n s<strong>in</strong>nvoll <strong>und</strong> valide,wenn <strong>die</strong> Kompetenz erstens als Pl<strong>an</strong>ungsziel verwendet, zweitens alsArbeitsauftrag geübt <strong>und</strong> drittens als Beurteilungskriterium e<strong>in</strong>gesetztwird.
1181.4.3 Kompetenzorientierter Leistungsnachweis1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 119Die Pl<strong>an</strong>ung mit Kompetenzen statt mit Inhalten soll <strong>die</strong> Ausbildungsarbeiterleichtern. Gepl<strong>an</strong>t werden soll mit Zielkompetenzen pro Modul <strong>und</strong> derzur Verfügung stehenden studentischen Arbeitszeit. Das Modul mit derKompetenz <strong>und</strong> dem Titel „Historische Ereignisse fassen <strong>und</strong> untersuchen“k<strong>an</strong>n etwa mit 6 Credits oder 180 St<strong>und</strong>en studentischer Arbeit gepl<strong>an</strong>twerden.Der Auftrag <strong>an</strong> <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>renden k<strong>an</strong>n direkt aus der Kompetenz abgeleitetwerden <strong>und</strong> lautet „fasse e<strong>in</strong> historisches Ereignis (Fr<strong>an</strong>zösischeRevolution) <strong>und</strong> untersuche es“. Das heisst, <strong>die</strong> Kompetenz eignet sich alsArbeitsauftrag. Aus hochschuldidaktischer Sicht s<strong>in</strong>d gute Zielkompetenzenjene, <strong>die</strong> m<strong>an</strong> üben <strong>und</strong> <strong>an</strong>wenden k<strong>an</strong>n.Die Leistungsbeurteilung fusst ebenfalls auf der Zielkompetenz: Konnte derStudent fachlich <strong>und</strong> methodisch korrekt das historische Ereignisfr<strong>an</strong>zösische Revolution fassen <strong>und</strong> untersuchen?Beispiel GeschichteTeilkompetenzen s<strong>in</strong>d besser für e<strong>in</strong>zelne Aufträge geeignet. E<strong>in</strong>e könntese<strong>in</strong> „arbeiten Sie <strong>die</strong> Ereigniskette bis zur F<strong>in</strong><strong>an</strong>zkrise heraus“.Teilkompetenzen taugen ebenfalls als Kriterien, um am Ende des Moduls<strong>die</strong> Gesamtarbeit zu bewerten <strong>und</strong> den Stu<strong>die</strong>renden e<strong>in</strong> Feed-back zugeben, was sie schon können: Phasenunterscheidung begründet,Bedürfnisse <strong>und</strong> Strategien gegenübergestellt.Die Kompetenz „Historisches Ereignis fassen <strong>und</strong> untersuchen“ ist zu grob<strong>und</strong> zu umfassend um e<strong>in</strong>en machbaren Arbeitsauftrag für Stu<strong>die</strong>rende –vielleicht für Doktor<strong>an</strong>den - zu ergeben oder um <strong>die</strong> Arbeit im Detail zubeurteilen. Besser ist, <strong>die</strong>se Kompetenz <strong>in</strong> Teilkompetenzen zu fassen.• E<strong>in</strong> Ereignis <strong>in</strong> Phasen teilen <strong>und</strong> <strong>die</strong> Phasenunterscheidung begründen• Das Ereignis aus mehreren Beteiligten-Perspektiven darstellen• Bedürfnisse, Strategien <strong>und</strong> H<strong>an</strong>dlungen der Beteiligtengegenüberstellen• Ereignisketten herausarbeiten• Thesen formulieren <strong>und</strong> argumentieren („Das Zunftwesen schränkte <strong>die</strong>Freiheit e<strong>in</strong>, weil …“)Zug der Marktfrauen nach Versailles am 5./6. Oktober 1789, <strong>an</strong>onymRessourcen <strong>und</strong> WeiterentwicklungDie kompetenzbasierte Ausbildung <strong>und</strong> Prüfung <strong>in</strong> der Bologna-Reform e<strong>in</strong>dauernder Prozess der Weiterentwicklung [4] dessen wichtigste Ressourcenerstens <strong>die</strong> früheren Arbeiten <strong>und</strong> ihre professorale Bewertung, zweitens<strong>die</strong> Liste häufiger Fragen <strong>und</strong> Probleme s<strong>in</strong>d.Die Stu<strong>die</strong>renden benötigen Ressourcen, <strong>die</strong> ihnen helfen, <strong>die</strong> gewünschteKompetenz zu entwickeln. Hilfreich s<strong>in</strong>d Beispiele. Stu<strong>die</strong>rende lernen viel,wenn sie <strong>die</strong> besten Sem<strong>in</strong>ararbeiten der früheren Jahre erhalten, <strong>die</strong>historische Ereignisse untersucht haben. Wenn möglich stu<strong>die</strong>ren sie auch<strong>die</strong> Korrekturvorschläge <strong>und</strong> Bewertungen der Professoren „Das istgelungen, jenes k<strong>an</strong>n verbessert werden“. Die Stu<strong>die</strong>renden sehen also,welche Probleme im letzten Jahrg<strong>an</strong>g häufig auftraten, wie <strong>die</strong>se sich <strong>in</strong>den Arbeiten niederschlugen <strong>und</strong> erhalten gleichzeitig H<strong>in</strong>weise, wie sie<strong>die</strong>se Probleme besser bewältigen können. Die Aufforderung der
1201.4.3 Kompetenzorientierter Leistungsnachweis1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 121<strong>Lehre</strong>nden ist d<strong>an</strong>n: „schreibt e<strong>in</strong>e bessere Arbeit – wir zeigen euch, wasschwierig ist <strong>und</strong> wie m<strong>an</strong>’s macht“.Dieses Vorgehen heisst „lernende Org<strong>an</strong>isation“ [5] [6]. Dieses Konzeptwird <strong>in</strong> Betrieben gebraucht, um aus den Erfahrungen früherer Projekte<strong>und</strong> Produktionen zu lernen <strong>und</strong> <strong>die</strong> nächsten besser zu machen. TrotzWechsel der Belegschaft soll das Wissen im Betrieb bleiben <strong>und</strong> jede neueBelegschaft soll auf den Erfahrung der vorhergehenden aufbauen könnendamit sie bessere, konkurrenzfähigere Projekt- <strong>und</strong> Produktionsarbeitvollbr<strong>in</strong>gt. Dieses Ziel wollen auch <strong>die</strong> Universitäten verfolgen.Tr<strong>an</strong>sferierbarkeit geprüfter KompetenzenBologna Kompetenzen s<strong>in</strong>d spezifisch für e<strong>in</strong>e Diszipl<strong>in</strong>, sollen aber durch<strong>in</strong>tensives Üben auch generisch ausgeprägt <strong>und</strong> tr<strong>an</strong>sferierbar werden.RessourcenDie Stu<strong>die</strong>renden erhalten <strong>die</strong> bestenSem<strong>in</strong>ararbeiten des früheren Jahres.Auch <strong>die</strong> Rückmeldungen des Professors: „Dasist gelungen, <strong>die</strong>s k<strong>an</strong>n verbessert werden !“-----RessourcenDie Stu<strong>die</strong>renden werden aufgefordert „schreibte<strong>in</strong>e bessere Arbeit !“Und gefragt: „Was braucht ihr dazu?“Jährliche WeiterentwicklungDie obigen Kompetenzen s<strong>in</strong>d sehr spezifisch für e<strong>in</strong> Modul desGeschichtsstudiums erarbeitet worden. Es s<strong>in</strong>d aber gleichzeitig sehrallgeme<strong>in</strong>e akademische Kompetenzen. Wir können das gleiche Vorgehenwählen, um e<strong>in</strong> wirtschaftliches Ereignis, e<strong>in</strong> Geschehen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>emUnternehmen zu fassen <strong>und</strong> zu untersuchen. Wenn wir Geschichte <strong>in</strong>obigem Modul stu<strong>die</strong>rt haben, werden wird e<strong>in</strong> Ereignis <strong>in</strong> Phasen teilen,aus Perspektiven darstellen, Ereignisketten herausarbeiten <strong>und</strong> am SchlussThesen formulieren <strong>und</strong> argumentieren. Die Kompetenz lautet d<strong>an</strong>n „e<strong>in</strong>Ereignis fassen <strong>und</strong> untersuchen“.E<strong>in</strong> wichtiges Anliegen der Bologna-Reform ist es, <strong>die</strong> Tr<strong>an</strong>sferierbarkeit derHochschulbildung zu erhöhen. Dabei möchte m<strong>an</strong> ke<strong>in</strong>esfalls auf dasmethodische <strong>und</strong> fachliche Wissen der Diszipl<strong>in</strong>en verzichten. Deshalbwählte m<strong>an</strong> Kompetenzen als Zielformulierung. Die <strong>in</strong> <strong>die</strong>semGeschichtsmodul erworbenen Kompetenz „e<strong>in</strong> Ereignis fassen <strong>und</strong>untersuchen“ ist e<strong>in</strong>deutig sowohl spezifisch wie tr<strong>an</strong>sferierbar.ChecklisteWenn ich Stu<strong>die</strong>ngänge <strong>und</strong> Module beurteile, verwende ich e<strong>in</strong>eCheckliste um zu sehen, wie weit kompetenzorientierte Module <strong>und</strong>Prüfungen bereits entwickelt s<strong>in</strong>d. Was ist schon erfüllt, <strong>an</strong> was muss nochgearbeitet werden? Ich stelle fest, dass Ziele doch schonkompetenzorientiert geschrieben s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> den Stu<strong>die</strong>renden fachlicheGr<strong>und</strong>lagen vermittelt werden. Was fehlt, ist das <strong>die</strong> Aufgaben explizit auf<strong>die</strong> Kompetenzen ausgerichtet s<strong>in</strong>d oder das Beispiel zur Verfügung gestelltwerden. Feedbacks s<strong>in</strong>d meist <strong>in</strong>haltlich oder formal, aber kaumkompetenzorientiert.Kompetenzorientierte MetareflexionZum Kompetenzerwerb gehört auch <strong>die</strong> Reflexion über denAnwendungsbereich von Kompetenzen <strong>und</strong> Methoden <strong>und</strong> fachliche <strong>und</strong>methodische Probleme [7].Damit e<strong>in</strong>e Kompetenz <strong>an</strong>h<strong>an</strong>d verschiedener Prüfungsaufgaben gezeigtwerden k<strong>an</strong>n, muss sie flexibilisiert werden. E<strong>in</strong>e Kompetenz ist nicht nure<strong>in</strong>e <strong>an</strong>tra<strong>in</strong>ierte Abfolge von Tätigkeiten, sondern benötigt Reflexion <strong>und</strong>Flexibilisierung. Wichtige Metareflexionen zur Kompetenzförderung,welche von Professoren <strong>und</strong> Stu<strong>die</strong>renden geme<strong>in</strong>sam vollzogen werden,s<strong>in</strong>d:• E<strong>in</strong>ordnen von Methoden <strong>und</strong> Kompetenzen <strong>in</strong> grössereZusammenhänge: was k<strong>an</strong>n damit bewältigt werden?• Vergleichen e<strong>in</strong>es Repertoires <strong>an</strong> Methoden um den Nutzen fürbestimmte Aufträge zu beurteilen
1221.4.3 Kompetenzorientierter Leistungsnachweis1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 123• Untersuchen, wie Methoden oder methodisches Vorgehen aufAufgaben h<strong>in</strong> spezifiziert werden• Sammeln von häufige Probleme, <strong>die</strong> beim Anwenden von Methodenoder erledigen von Aufgaben auftreten<strong>Lehre</strong> wird durch Analyse der Leistungsnachweise verändertPrüfungen können <strong>an</strong>alysiert werden. Welche Kompetenzen werden imSchnitt gut erreicht, welche weniger? Damit übernimmt <strong>die</strong> <strong>Lehre</strong> nicht nur<strong>die</strong> Ver<strong>an</strong>twortung für das Vermitteln e<strong>in</strong>er Kompetenz, sondern auch fürdas Beherrschen. Der Leistungsnachweis am Ende e<strong>in</strong>es Moduls wird d<strong>an</strong>nzu e<strong>in</strong>em Zeugnis, das erklärt, das Stu<strong>die</strong>rende e<strong>in</strong>e bestimmte Kompetenzbeherrschen.Wer sich wirklich <strong>an</strong> Kompetenzen orientiert <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e LernendeOrg<strong>an</strong>isation e<strong>in</strong>führt, wird auch <strong>die</strong> <strong>Lehre</strong> verändern. Ich habe gesehen,wie Assistenten <strong>die</strong> Prüfungen nach häufigen Problemen untersuchen, e<strong>in</strong>eListe erstellen <strong>und</strong> <strong>die</strong>se der Professor<strong>in</strong> geben. Diese geht d<strong>an</strong>n <strong>in</strong> derVorlesung darauf e<strong>in</strong>. Damit entwickelt sich auch <strong>die</strong> Lehr-Lernkompetenzweiter: <strong>die</strong> <strong>Lehre</strong>nden sehen <strong>die</strong> Probleme, <strong>an</strong>alysieren sie <strong>und</strong> ergreifengeeignete Massnahmen. Der nächste Jahrg<strong>an</strong>g <strong>an</strong> Stu<strong>die</strong>renden wird mit<strong>die</strong>sen Problemen weniger kämpfen – aber fast sicher mit <strong>an</strong>deren – <strong>und</strong>e<strong>in</strong>e bessere Leistung abliefern. Mit der kompetenzbasierten Analyse derLeistungsnachweise fällt <strong>die</strong> Klage „<strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>renden haben seit Jahren <strong>die</strong>gleichen Probleme, ja werden gar schlechter“ zu e<strong>in</strong>em grossen Teil aufdas <strong>Lehre</strong>ndenteam zurück.WegeWichtig ist, dass auf allen Ebenen begonnen wird, Ziele der Ausbildung,Ausbildungsmethoden <strong>und</strong> <strong>die</strong> Leistungsbeurteilung aufe<strong>in</strong><strong>an</strong>derabzustimmen. Klar formulierte Kompetenzen helfen dabei.Wie weiter?Institutsleiter… org<strong>an</strong>isieren Workshops mit allen <strong>an</strong> der <strong>Lehre</strong> beteiligten, auch AssistentInnen. Themens<strong>in</strong>d Kompetenzformulierung, Betreuung, Aufgaben, Unterlagen, Prüfung, Rückmeldung,System zur Ausbildungsentwicklung (FAQ, häufige Probleme)Evaluations- <strong>und</strong> Akkreditierungsorg<strong>an</strong>e… verl<strong>an</strong>gen kompetenzorientiertes FeedbackFeedback Stu<strong>die</strong>rende -> <strong>Lehre</strong>nde (was brauchen wir für Kompetenzerwerb <strong>und</strong> Nachweis)Feedback <strong>Lehre</strong>nde -> Stu<strong>die</strong>renden (wo steht ihr beim Kompetenzerwerb)Stu<strong>die</strong>rende… sehen <strong>die</strong> Ch<strong>an</strong>cen der Kompetenzorientierung <strong>und</strong> kooperiert bewusst <strong>und</strong> synergisch.Sie werden <strong>in</strong>formiert <strong>und</strong> bei der Prüfungsauswertung e<strong>in</strong>bezogen.Beratungsteams… betreuen e<strong>in</strong>e systemische, nicht e<strong>in</strong>e punktuelle Umstellung <strong>und</strong> e<strong>in</strong>en jahrel<strong>an</strong>gen WegKompetenzformulierung – Unterlagen – Unterricht – Leistungsnachweis – Feedback –BeurteilungRektor<strong>in</strong>… vertritt den Anspruch <strong>und</strong> ver<strong>an</strong>lasst Überprüfungen. Idealerweise gibt sie den Instituten<strong>und</strong> Stu<strong>die</strong>ngängen Unterstützung durch gut geschulte <strong>und</strong> begleitete Beratungsteams,welche Erfahrung <strong>in</strong> kompetenzorientierter Hochschulbildung haben.Kompetenzorientierte Pl<strong>an</strong>ung <strong>und</strong> Durchführung [8] vonLehrver<strong>an</strong>staltungen sowie <strong>die</strong> Umstellung auf kompetenzorientierteLeistungsnachweise ist e<strong>in</strong> Ziel vieler Hochschulen. Es lohnt sich, <strong>die</strong>Erfahrungen zu bündeln <strong>und</strong> <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>ngänge durch Hochschuldidaktikeroder Bologna-Berater<strong>in</strong>nen bei den folgenden Massnahmen unterstützenzu lassen.Quellen1. González, J. <strong>an</strong>d R. Wagenaar, Tun<strong>in</strong>g educational structures <strong>in</strong> Europe.F<strong>in</strong>al Report Phase One. 2003, Universidad de Deusto: Bilbao.2. Hildbr<strong>an</strong>d, T., et al., Die Curricula-Reform <strong>an</strong> Schweizer Hochschulen:St<strong>an</strong> <strong>und</strong> Perspektiven der Umsetzung der Bologna-Reform <strong>an</strong>h<strong>an</strong>dausgewählter Aspekte. 2008, Universität Zürich <strong>und</strong> Rektorenkonferenzder Schweizer Universitäten: Zürich.3. <strong>an</strong>onym, Zug der Marktfrauen nach Versailles am 5./6. Oktober 1789.4. Graf, P., Die lernende Org<strong>an</strong>isation als Instrument zur Verbesserung derLehr- Lernorg<strong>an</strong>isation, <strong>in</strong> Aktive Stu<strong>die</strong>rende - kompetenzorientierteAusbildung. Fallbeispiele lernender <strong>Lehre</strong>nder, M. Künzel, Editor. 2007,Arbeitsstelle Hochschuldidaktik: Tüb<strong>in</strong>gen. p. 21 - 32.
1241.4.3 Kompetenzorientierter Leistungsnachweis1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 1255. Argyris, C. <strong>an</strong>d D.A. Schön, Die Lernende Org<strong>an</strong>isation. Gr<strong>und</strong>lagen,Methode, Praxis Klett-Cotta 2002, Stuttgart: Klett-Cotta.6. Schön, D., Educat<strong>in</strong>g the Reflective Practitioner. 1987, Jossey-Bass: S<strong>an</strong>Fr<strong>an</strong>cisco.7. McMull<strong>an</strong>, M. <strong>an</strong>d e. al., Portfolios <strong>an</strong>d assessment of competence: areview of the literature. Journal of Adv<strong>an</strong>ced Nurs<strong>in</strong>g, 2003. 41(3),283–294.8. Künzel, M. <strong>an</strong>d S. Gasser, Kompetenzorientiert studentische Arbeitenbetreuen <strong>und</strong> evaluieren <strong>in</strong> Hochschullehre - adressatengerecht <strong>und</strong>wirkungsvoll: Beiträge aus der hochschuldidaktischen Praxis, S. Wehr,Editor. 2006, Haupt: Bern.Zusammenfassung AG 3: Kompetenzorientierter Leistungsnachweis:Anspruch <strong>und</strong> WirklichkeitChrist<strong>in</strong>e Speth, Katholische Universität EichstättModeriert wurde <strong>die</strong> Arbeitsgruppe von Birgit Hennecke, UniversitätMünster, Referent<strong>in</strong> für <strong>Lehre</strong>, <strong>die</strong> zunächst <strong>die</strong> für sie gr<strong>und</strong>legendenFakten noch e<strong>in</strong>mal darstellte. E<strong>in</strong>e große Herausforderung für <strong>die</strong>Hochschule aber auch für den e<strong>in</strong>zelnen Professor ist, dass im Rahmen derStu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gsreform jedes Modul mit e<strong>in</strong>er Modulprüfung abgeschlossenwird. Bei der Entwicklung der Module wird besonders <strong>die</strong> Formulierungvon zu erwarteten Kompetenzen betont, was zur Folge hat, dass <strong>die</strong>sedurch geeignete Prüfungsformen nachgewiesen werden sollen. Fr.Hennecke stellte <strong>in</strong> Frage ob der Begriff „Prüfung“ noch treffend ist oderob nicht besser von „Leistungsnachweisen“ gesprochen werden sollte umdas zukünftige Prüfungsspektrum zu erweitern.Den ersten Impuls gab Prof. Dr. Kar<strong>in</strong> Klepp<strong>in</strong>, Ruhr-Universität Bochum.Zunächst wurden wichtige Elemente für e<strong>in</strong>en kompetenzorientiertenUnterricht vorgestellt. Beispiele dafür s<strong>in</strong>d: <strong>die</strong> Formulierung vonKompetenzen, Unterrichtsmethoden <strong>und</strong> der erwarteten Produkte.Besonders betonte sie dabei <strong>die</strong> Entwicklung <strong>und</strong> Def<strong>in</strong>ierung vontestspezifischen Gütekriterien.Nach der Darstellung von verschiedenen Prüfungsformen – schriftliche <strong>und</strong>mündliche Formen – betonte sie <strong>die</strong> Notwendigkeit, durch Selbstevaluation<strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>renden mit e<strong>in</strong>zubeziehen. Bei dem Vortrag wurde vor allem derBereich der Fachkompetenz besprochen, was aber nicht bedeutet, dass<strong>die</strong>s der e<strong>in</strong>zige Fokus ist. Ebenso gehört zum Portfolio Selbste<strong>in</strong>schätzung<strong>und</strong> Evaluation.Unmittelbare Rückfragen <strong>an</strong> Prof. Dr. Klepp<strong>in</strong> waren bezüglich derOrg<strong>an</strong>isation <strong>und</strong> Umsetzbarkeit:Bei der Nachfrage ob kriterienorientierte Prüfungen <strong>und</strong> Modulprüfungenvergleichbar wären betonte Prof. Dr. Klepp<strong>in</strong>, dass der Zeitaufw<strong>an</strong>d beikriterienorientierten Prüfungen nicht wesentlich höher ist. Wichtiger dabeiist eher, dass für den Erfolg e<strong>in</strong> Umdenken notwendig ist.Um <strong>in</strong>nerhalb der Modulh<strong>an</strong>dbücher e<strong>in</strong>e große Prüfungsvielfalt zuermöglichen wurde <strong>die</strong> Empfehlung ausgesprochen, e<strong>in</strong>ige Prüfungsformenzu benennen <strong>und</strong> d<strong>an</strong>n mit „<strong>und</strong> <strong>an</strong>dere“ zu öffnen. Dass <strong>die</strong>s im Rahmene<strong>in</strong>er Akkreditierung nicht immer genehmigt wird betonte jedoch e<strong>in</strong>Arbeitsgruppenmitglied. Ebenso wünschen <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>renden e<strong>in</strong>e klareZuordnung der Prüfung um sich dementsprechend vorbereiten zu können.Im Anschluss <strong>an</strong> <strong>die</strong> direkten Rück- <strong>und</strong> Verständnisfragen zum erstenImpulsreferat präsentierte Prof. Dr. M<strong>an</strong>fred Künzel von der UniversitätFriburg (Schweiz) zum E<strong>in</strong>stieg Begriffe aus dem Bologna-Prozess <strong>und</strong>deren wirkliche Umsetzung am Beispiel der Fächer „Geschichte“ <strong>und</strong>„Software<strong>in</strong>genieur“. Dabei verdeutlichte er, wie es zu e<strong>in</strong>erKompetenzorientierung kommen k<strong>an</strong>n.In der <strong>an</strong>schließenden Diskussion wurden e<strong>in</strong>ige Themenbereiche derVorträge aufgegriffen. Bedenken kamen beispielsweise bezüglich dersemesterbegleitenden Prüfungen <strong>und</strong> der Gefahr, dass <strong>die</strong>se von Studentennicht selbständig erstellt wurden. Zusätzlich wurde <strong>in</strong> Frage gestellt, obdurch hohe Studentenzahlen e<strong>in</strong>e kompetenzorientierte Prüfung überhauptrealisierbar ist.
1261.4.3 Kompetenzorientierter Leistungsnachweis1. Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen 127Prof. Dr. Klepp<strong>in</strong> betonte dazu, dass auch zukünftig Klausuren <strong>und</strong> Testsdurchgeführt werden können. Entscheidend für e<strong>in</strong>e kompetenzorientiertePrüfung wäre, dass bei der Formulierung der Prüfungsfragen <strong>und</strong> –aufgaben genau überlegt wird, welche Zielsetzung <strong>die</strong> Prüfung verfolgt<strong>und</strong> somit welche Kompetenzen überprüft werden sollen. Werden vone<strong>in</strong>em Großteil der Prüfl<strong>in</strong>ge Teilkompetenzen nicht erreicht, k<strong>an</strong>n <strong>die</strong>s e<strong>in</strong>eRückmeldung <strong>an</strong> <strong>die</strong> Lehr- <strong>und</strong> Prüfleistung se<strong>in</strong>. Es k<strong>an</strong>n bedeuten, dassfalsche Kompetenzen festgelegt oder unpassende Lehr- <strong>und</strong>Prüfungsformen genutzt wurden.In den von Prof. Dr. Klepp<strong>in</strong> vorgestellten Prüfungsformen was zum Teilunter dem Begriff „neues Prüfen“ geführt wurde, waren für <strong>die</strong>Arbeitsgruppenmitglieder folgenden Vorteile von Bedeutung. DieStu<strong>die</strong>renden:• „… k<strong>an</strong>n Folgendes…“,• „… hat Fachliteratur <strong>in</strong>tensiv bearbeitet…“Die beiden Referenten waren sich dar<strong>in</strong> e<strong>in</strong>ig, dass <strong>die</strong> E<strong>in</strong>führung neuerPrüfungsformen nur nach <strong>und</strong> nach erfolgreich se<strong>in</strong> k<strong>an</strong>n. Als hilfreichk<strong>an</strong>n sich herausstellen, dass <strong>an</strong>f<strong>an</strong>gs zwei Kollegen geme<strong>in</strong>sam <strong>die</strong> neuenPrüfungsformen durchführen, um sich dadurch zu unterstützen <strong>und</strong> vone<strong>in</strong><strong>an</strong>der lernen zu können.Das Fazit der Arbeitsgruppe war, dass alte <strong>und</strong> neue Prüfungsformennebene<strong>in</strong><strong>an</strong>der existieren <strong>und</strong> auch funktionieren werden. Zielfragen jederPrüfungspl<strong>an</strong>ung dabei muss se<strong>in</strong>: „Welche Kompetenz soll geprüftwerden!“ <strong>und</strong> „Wie k<strong>an</strong>n <strong>die</strong>s erfolgreich geprüft werden!“• erhalten Rückmeldung über vorh<strong>an</strong>dene Fehler bzw. Schwächen <strong>und</strong>können dadurch aktiv dar<strong>an</strong> arbeiten.• können durch e<strong>in</strong>gebaute Selbstevaluations<strong>in</strong>strumente e<strong>in</strong>epersönliche, eigene E<strong>in</strong>schätzung für sich aber auch <strong>die</strong> Passungverschiedener Prüfungsformen erreichen – „durch Fehlern lernen“.• erhalten Bewertungskriterien (im Vorfeld) <strong>und</strong> erhalten dadurchTr<strong>an</strong>sparenz der Prüfungsverfahren.E<strong>in</strong> Appell <strong>an</strong> <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>renden g<strong>in</strong>g im Zusammenh<strong>an</strong>g <strong>die</strong>ser Vorteile,dass sie Bewertungskriterien aktiv fordern <strong>und</strong> dadurch <strong>die</strong> <strong>Lehre</strong>nden <strong>in</strong><strong>die</strong> Pflicht nehmen Rückmeldung zu Lern- <strong>und</strong> Entwicklungsbedarfe zugeben.E<strong>in</strong> Teilnehmer der Arbeitsgruppe verwies darauf, dass <strong>die</strong> zum Teil sehrzeitaufwendigen kompetenzorientierten Prüfungen aufgr<strong>und</strong> des derzeitnoch bestehenden CNW nur durch „Selbstausbeutung“ möglich s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong>eausreichende Personalausstattung ist für <strong>die</strong> Realisierung unumgänglich.Da Bewertungskriterien relative Noten tr<strong>an</strong>sparent machen können wurdenach Formulierungsvorschlägen für Bewertungskriterien wurden folgendeBeispiele gegeben:
1282. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 1292. Arbeitsmarktbefähigung(Employability)
1302.1 Zur Vermittlung praxisrelev<strong>an</strong>ter Kompetenzen2.1 Tu felix Brit<strong>an</strong>nia? Zur Vermittlungpraxisrelev<strong>an</strong>ter Kompetenzen <strong>in</strong>geisteswissenschaftlichen FächernProf. Dr. Kai Brodersen, Universität Erfurt“Die Vermittlung praxisrelev<strong>an</strong>ter Kompetenzen <strong>in</strong>geisteswissenschaftlichen Fächern” ist mir von der HRK als Thema gestelltworden. Was aber impliziert <strong>die</strong> HRK mit <strong>die</strong>ser Themenstellung? Ist <strong>die</strong>“Vermittlung”, nicht etwa der Erwerb praxisrelev<strong>an</strong>ter Kompetenzen dasWesentliche? Stehen <strong>in</strong> den geisteswissenschaftlichen Fächern“praxisrelev<strong>an</strong>te” Kompetenzen im Gegensatz zu den sonst vermittelten?Und bedürfen speziell <strong>die</strong> geisteswissenschaftlichen Fächer derenVermittlung?Auch auf <strong>die</strong> Gefahr, mit den Initiator<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Initiatoren <strong>die</strong>ser Tagung<strong>in</strong> Konflikt zu geraten, will ich alle drei Implikationen <strong>in</strong> Zweifel ziehen <strong>und</strong>auf e<strong>in</strong>e europäische Alternative h<strong>in</strong>weisen. Beg<strong>in</strong>nen wir mit derletztgen<strong>an</strong>nten Frage:Bedürfen speziell <strong>die</strong> geisteswissenschaftlichen Fächer derVermittlung praxisrelev<strong>an</strong>ter Kompetenzen?Diese Frage sche<strong>in</strong>t mir <strong>in</strong> ihrer Verengung schlicht zu verne<strong>in</strong>en zu se<strong>in</strong>.Das Studium e<strong>in</strong>er Vielzahl wissenschaftlicher Fächer aller Diszipl<strong>in</strong>en istalles <strong>an</strong>dere als unmittelbar “praxisrelev<strong>an</strong>t” - das gilt für Gesellschaftsebensowie für Naturwissenschaften, etwa (worauf bei der HRK-Tagungwiederholt h<strong>in</strong>gewiesen wurde) für <strong>die</strong> Physik. (In der Diskussion bei derHRK-Tagung wurde auch deutlich, wie breit etwa das Fächerspektrum derAbsolvent<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Absolventen ist, <strong>die</strong> e<strong>in</strong>e Tätigkeit <strong>in</strong> der“Fluggastsonderkontrolle” am Fr<strong>an</strong>kfurter Flughafen aufgenommen haben- Theologie steht hier neben Geologie, Geographie neben Jura, Politologieneben Physik). Umgekehrt ist das Studium e<strong>in</strong>er Vielzahl geisteswissenschaftlicherFächer sogar direkt praxisrelev<strong>an</strong>t, <strong>in</strong>dem es nämlich direkt aufe<strong>in</strong>e Berufstätigkeit als <strong>Lehre</strong>r<strong>in</strong> oder <strong>Lehre</strong>r <strong>an</strong> vielerlei Schulformenausgerichtet ist <strong>und</strong> bemerkenswerter weise auch nicht mit e<strong>in</strong>emHochschulabschluss, sondern mit e<strong>in</strong>er Aufnahmeprüfung für denSchul<strong>die</strong>nst (“Staatsexamen”) abgeschlossen wird (wor<strong>an</strong> viele2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 131Schulm<strong>in</strong>isterien auch im Zeitalter der Modularisierung festhalten). Die“Vermittlung praxisrelev<strong>an</strong>ter Kompetenzen” ist dabei <strong>in</strong> den auf dasLehramt zielenden Fächern, zu denen viele geisteswissenschaftlichegehören, längst <strong>in</strong> <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>ngänge <strong>in</strong>tegriert.Stehen <strong>in</strong> den geisteswissenschaftlichen Fächern “praxisrelev<strong>an</strong>te”Kompetenzen im Gegensatz zu den sonst vermittelten?Auch <strong>die</strong>se Frage sche<strong>in</strong>t mir <strong>in</strong> ihrer Verengung auf “Praxisrelev<strong>an</strong>z”gegenüber <strong>an</strong>deren Kompetenzen zu verne<strong>in</strong>en zu se<strong>in</strong>, denn sie setztvoraus, dass es e<strong>in</strong>e def<strong>in</strong>ierbare oder gar def<strong>in</strong>ierte “Praxis” gibt, <strong>die</strong> vomInhalt des Studiums zu trennen ist. Dass <strong>die</strong>s <strong>in</strong> denLehramtsstu<strong>die</strong>ngängen nicht zutrifft, ist bereits gesagt. Außerhalb desLehramts wiederum ist das Tätigkeitsfeld der Absolvent<strong>in</strong>nen <strong>und</strong>Absolventen - übrigens nicht nur geisteswissenschaftlicher Fächer - sehrbreit <strong>und</strong> reicht von e<strong>in</strong>er Tätigkeit <strong>in</strong> der Erwachsenenbildung, <strong>in</strong> denMe<strong>die</strong>n <strong>und</strong> <strong>in</strong> der Wirtschaft über Selbständigkeit als Unternehmer bis zue<strong>in</strong>er bunten, öfter wechselnden Praxis-Biographie e<strong>in</strong>er zunehmendenZahl von Absolvent<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Absolventen (<strong>die</strong>s gilt ja auch für vieleHochschul- <strong>und</strong> Wissenschaftsm<strong>an</strong>ager, wie sie <strong>die</strong> Tagung der HRKversammelt): Werden unsere Stu<strong>die</strong>renden, gleich welcher Fächer, denn <strong>in</strong>der Mehrzahl wirklich noch e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>zigen “Lebensberuf” haben, den sievom Stu<strong>die</strong>nabschluss bis zum Ruhest<strong>an</strong>d ausüben? Muss sich„Praxisrelev<strong>an</strong>z” nicht vielmehr auf weit mehr als e<strong>in</strong>e “Kompetenz”beziehen?Ist “Vermittlung”, nicht etwa Erwerb praxisrelev<strong>an</strong>ter Kompetenzendas Wesentliche?In ihrer Verengung auf <strong>die</strong> “Vermittlung” sche<strong>in</strong>t mir <strong>die</strong>se Frage ebenfallsnicht glücklich gestellt zu se<strong>in</strong>. Sie entspricht natürlich dem, was <strong>an</strong> denHochschulen versucht wird: Neben das Fachstudium treten - oft ausStu<strong>die</strong>ngebühren f<strong>in</strong><strong>an</strong>zierte - durch Lehrkräfte abgehaltene Module, <strong>die</strong>“praxisrelev<strong>an</strong>ten Kompetenzen” “vermitteln” sollen, von“h<strong>an</strong>dwerklichen” Fertigkeiten <strong>in</strong> der Präsentationstechnik über me<strong>die</strong>n<strong>und</strong>unternehmensbezogene bis zu Angeboten zum “Selbst-M<strong>an</strong>agement”<strong>und</strong> Selbstreflexion. Diese - oft sehr gut gelungene - “Vermittlung” k<strong>an</strong>n,da es sich um Lehr<strong>an</strong>gebote h<strong>an</strong>delt, mit ECTS-Punkten belegt <strong>und</strong> benotetwerden - ehrenamtliche Tätigkeiten aber, etwa e<strong>in</strong> Engagement <strong>in</strong> AStA
1322.1 Zur Vermittlung praxisrelev<strong>an</strong>ter Kompetenzen2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 133oder StuRa oder <strong>in</strong> der Jugendorg<strong>an</strong>isation e<strong>in</strong>er politischen, karikativenoder kirchlichen, Gruppe gelten nicht als “Vermittlung” <strong>und</strong> fallen damitaus dem Frageraster heraus, obgleich gerade <strong>in</strong> <strong>die</strong>sem Bereich oft e<strong>in</strong>e fürspätere - zumal für “bunte” - Praxisbiographien entscheidendeKompetenzen erworben werden - nur eben ohne formale “Vermittlung”.Tu felix Brit<strong>an</strong>nia?Fragen wir also, ob es <strong>an</strong>dere Formen des Erwerbs praxisrelev<strong>an</strong>terKompetenzen gibt - <strong>und</strong> blicken wir dafür e<strong>in</strong>mal nach Großbrit<strong>an</strong>nien, woich <strong>in</strong> den letzten Jahren <strong>an</strong> den Universitäten Newcastle, St. Andrews,Royal Holloway <strong>und</strong> Oxford gelehrt habe, also aus eigener Erfahrungsprechen k<strong>an</strong>n. Vorab festzuhalten s<strong>in</strong>d <strong>die</strong> besondereRahmenbed<strong>in</strong>gungen: Britische Stu<strong>die</strong>rende s<strong>in</strong>d im Vergleich zu deutschensehr jung; nicht wenige s<strong>in</strong>d bei Aufnahme des Studiums noch nichtvolljährig <strong>und</strong> beim Abschluss des Studium <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Alter, <strong>in</strong> dem deutscheStu<strong>die</strong>rende nach Abitur <strong>und</strong> Dienst (etwa Zivil<strong>die</strong>nst) erst aufnehmen.Britische Stu<strong>die</strong>rende s<strong>in</strong>d folglich sehr viel offener, was e<strong>in</strong>e künftigeberufliche “Praxis” <strong>an</strong>geht: Absolvent<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Absolventen me<strong>in</strong>esFaches (Altertumswissenschaften) wechseln nach dem <strong>Bachelor</strong>-Abschlussentweder <strong>in</strong> Berufe wie Buchhaltung, Rechtspflege, Kr<strong>an</strong>kenversorgung,Militärwesen oder Behördentätigkeit, für <strong>die</strong> <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d e<strong>in</strong> Schul-,aber ke<strong>in</strong> Hochschulabschluss Voraussetzung ist. Andere streben noche<strong>in</strong>en (übrigens gegen alle Bologna-Erklärungen <strong>in</strong> der Regel auf 1 Jahrbeschränkten) <strong>Master</strong>-Abschluss <strong>an</strong> <strong>und</strong> wechseln d<strong>an</strong>n - nach 4 JahrenStudium - <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Berufstätigkeit, oder schließen e<strong>in</strong>e Ausbildung alsLehrkraft <strong>an</strong> e<strong>in</strong>er Art PH <strong>an</strong>. Wieder <strong>an</strong>dere wechseln nach dem erstenAbschluss das Fach <strong>und</strong> stu<strong>die</strong>ren - wohlgemerkt erst nach e<strong>in</strong>emAbschluss <strong>in</strong> Altertumswissenschaft - Jura, Mediz<strong>in</strong> oder BWL (wie übrigensauch umgekehrt). E<strong>in</strong>ige wenige verfolgen das Ziel e<strong>in</strong>er wissenschaftlichenTätigkeit; <strong>die</strong> dafür notwendigen E<strong>in</strong>führungskurse, <strong>die</strong> m<strong>an</strong> nach 3 JahrenFachstudium besucht, vermitteln erstmals das wissenschaftliche“H<strong>an</strong>dwerkszeug”, das m<strong>an</strong> für eigene Recherchen <strong>und</strong> künftigeForschungsarbeiten benötigt.All <strong>die</strong>sen Wegen ist geme<strong>in</strong>sam, dass am Ende e<strong>in</strong>e vergleichsweise hohe“employability” steht. Mit Bew<strong>und</strong>erung <strong>und</strong> e<strong>in</strong>em gewissen Neid blickenwir auf <strong>die</strong> Tatsache, dass e<strong>in</strong>e Absolvent<strong>in</strong> der Altertumswissenschaften <strong>in</strong>Großbrit<strong>an</strong>nien auf Anhieb Redakteur<strong>in</strong> bei der F<strong>in</strong><strong>an</strong>cial Times wird odere<strong>in</strong> Archäologie-Absolvent rasch Partner e<strong>in</strong>er weltweitenWirtschaftsberatung wird. Wie erklärt sich der beachtliche Erfolg britischerUniversitäten im Blick auf <strong>die</strong> “employability” ihrer Absolvent<strong>in</strong>nen <strong>und</strong>Absolventen?Me<strong>in</strong> E<strong>in</strong>druck ist, dass der Weg zum ersten Abschluss <strong>in</strong> großerKonsequenz auf den Erwerb von für e<strong>in</strong>e breite Praxis relev<strong>an</strong>terKompetenzen ausgerichtet ist. Um es arg vergröbert zu formulieren:Deutsche Universitäten versuchen auch im Bologna-Zeitalter, denStu<strong>die</strong>renden bereits beim ersten Abschluss (B.A.) als bestmögliche“Praxis” ihres Studiums e<strong>in</strong>e Tätigkeit <strong>in</strong> der Wissenschaft zu vermitteln.Unsere Stu<strong>die</strong>renden haben sich ja - so argumentieren wir implizit - gegene<strong>in</strong>e Tätigkeit <strong>in</strong> Buchhaltung, Rechtspflege, Kr<strong>an</strong>kenversorgung,Militärwesen oder Behörde entschieden, <strong>die</strong> ihnen ohne Studiumzugänglich gewesen wäre. Sie streben - so argumentieren wir - nach e<strong>in</strong>erwissenschaftlichen Tätigkeit, nicht nach irgende<strong>in</strong>er “Praxis”, <strong>und</strong> müssendeshalb von vornhere<strong>in</strong> <strong>in</strong>s wissenschaftliche Arbeiten e<strong>in</strong>geführt werden.In me<strong>in</strong>em Fach etwa s<strong>in</strong>d Kurse zum “Gr<strong>und</strong>wissen” (oft als“Faktenschleuderkurse” verhöhnt) ebenso verpönt wie “Lehrbücher”, weilsie suggerieren, dass es feststehende historische Tatsachen gebe, was jagerade im Studium problematisiert werden soll. Wir <strong>in</strong>vestieren <strong>die</strong> Zeitunserer Stu<strong>die</strong>renden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e gründliche wissenschaftliche Methodenlehre.Britische Universitäten h<strong>in</strong>gegen verlegen <strong>die</strong>se Propädeutik <strong>in</strong> <strong>die</strong> Phasenach dem ersten Stu<strong>die</strong>nabschluss, wenn der Wunsch nach e<strong>in</strong>erwissenschaftlichen Tätigkeit gefestigt ist. In der <strong>Bachelor</strong>-Ausbildungwerden h<strong>in</strong>gegen implizit e<strong>in</strong>e Vielzahl “praxisrelev<strong>an</strong>ter Kompetenzen”vermittelt. Betrachten wir g<strong>an</strong>z konkret, wie <strong>die</strong>s <strong>in</strong> me<strong>in</strong>em Fach <strong>an</strong> derUniversität Oxford geschieht (<strong>an</strong> der ich nun e<strong>in</strong> Jahr gelehrt habe). Me<strong>in</strong>eStu<strong>die</strong>renden hier s<strong>in</strong>d für drei Jahre e<strong>in</strong>geschrieben (nur <strong>in</strong> denStu<strong>die</strong>ngängen, <strong>die</strong> e<strong>in</strong>e Kenntnis der <strong>an</strong>tiken Sprachen voraussetzen, s<strong>in</strong>dvier Jahre vorgesehen); jedes Stu<strong>die</strong>njahr besteht aus 3 Trimestern mit je 8Wochen (<strong>in</strong> denen d<strong>an</strong>n ke<strong>in</strong>e Feiertage e<strong>in</strong>gehalten werden: Die 8Wochen wird “durchgearbeitet”), <strong>und</strong> <strong>in</strong> jeder Woche erhält jede jederStu<strong>die</strong>rende <strong>in</strong> zwei Fächern je e<strong>in</strong>e volle St<strong>und</strong>en (60 M<strong>in</strong>uten)E<strong>in</strong>zelunterricht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Tutorium (gelegentlich wird statt e<strong>in</strong>er
1342.1 Zur Vermittlung praxisrelev<strong>an</strong>ter Kompetenzen2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 135E<strong>in</strong>zelperson auch e<strong>in</strong>e Zweiergruppe unterrichtet). Jede <strong>die</strong>serUnterrichtsst<strong>und</strong>en hat e<strong>in</strong> Thema (etwa “Die Verfassung Athens <strong>in</strong> derKlassischen Zeit” oder “Die Rolle der Prov<strong>in</strong>zen im Römischen Reich”), überdas <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>renden genaue Angaben (mit Seitenzahlen oder auch gleichKopien) der zu lesenden Quellen <strong>und</strong> Forschungsliteratur erhalten <strong>und</strong> auf<strong>die</strong>ser Gr<strong>und</strong>lage e<strong>in</strong> Essay von 5-10 Seiten Umf<strong>an</strong>g schreiben, das sie vordem Tutorium e<strong>in</strong>reichen. Der Besuch von Vorlesungen <strong>und</strong> Sem<strong>in</strong>arenk<strong>an</strong>n für <strong>die</strong> Vor- <strong>und</strong> Nachbereitung der Tutorien nützlich se<strong>in</strong>, ist abernicht zw<strong>in</strong>gend; eigene, über das Lesepensum h<strong>in</strong>ausgehende Recherchender Stu<strong>die</strong>renden s<strong>in</strong>d h<strong>in</strong>gegen nicht vorgesehen - <strong>und</strong> wären <strong>an</strong>gesichtsdes Pensums (das für jedes Tutorium meist mehr als e<strong>in</strong> g<strong>an</strong>zes <strong>an</strong>tikesBuch <strong>und</strong> weit über 500 Seiten Forschungsliteratur umfasst) auch gar nichtzu bewältigen. Die Aufgabe der <strong>Lehre</strong>nden ist auch <strong>die</strong> kluge <strong>und</strong> präziseAuswahl des Pensums - <strong>und</strong> das ausführliche “Feedback” <strong>und</strong> <strong>die</strong>Diskussion des vom der oder dem Stu<strong>die</strong>renden vor dem Tutoriume<strong>in</strong>gereichten Essays während der E<strong>in</strong>zelunterrichtsst<strong>und</strong>e.Im Nachg<strong>an</strong>g zur HRK-Tagung schrieb mir e<strong>in</strong> Stu<strong>die</strong>nberater irritiert, dasse<strong>in</strong> solches Pensum nach ECTS überhaupt nicht zu bewältigen sei: Wennm<strong>an</strong> - wie üblich - für <strong>die</strong> Lektüre von 10 Seiten wissenschaftlicher Literature<strong>in</strong>e Zeitst<strong>und</strong>e ver<strong>an</strong>schlage, käme m<strong>an</strong> auf 75 St<strong>und</strong>en pro Woche <strong>und</strong>Fach, also auf 150 St<strong>und</strong>en “workload” pro Woche alle<strong>in</strong> für <strong>die</strong>Vorbereitung der Tutorien. So viel Zeit haben me<strong>in</strong>e britischenStu<strong>die</strong>renden bestimmt nicht! Was also lernen sie? Sie lernen, wie es derPersonalchef der F<strong>in</strong><strong>an</strong>cial Times me<strong>in</strong>er Student<strong>in</strong> <strong>und</strong> <strong>die</strong> Personalchef<strong>in</strong>der Wirtschaftsberatung me<strong>in</strong>em Studenten sagten, e<strong>in</strong> ihnen zuvorunbek<strong>an</strong>ntes, aber präzise umschriebenes Thema <strong>an</strong>h<strong>an</strong>d der relev<strong>an</strong>tenForschungsergebnisse rasch zu erfassen, verständlich darzustellen <strong>und</strong> ihnse<strong>in</strong>er Problematik zu verstehen - <strong>und</strong> genau das sei es, was <strong>die</strong> FT <strong>und</strong> <strong>die</strong>Wirtschaftsberatung brauchen. Es sei <strong>die</strong>se “praxisrelev<strong>an</strong>te”, <strong>in</strong> zweiFächern über 9 achtwöchige Trimester (2 x 9 x 8 = 144) selbst erworbene(nicht vermittelte) Fähigkeit konzentrierter <strong>und</strong> <strong>in</strong>telligenter Lektüre, auf <strong>die</strong>m<strong>an</strong> bei der FT <strong>und</strong> Wirtschaftsberatung Wert lege: Wer <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er halbenWoche <strong>die</strong> ihr oder ihm zuvor unbek<strong>an</strong>nte Verfassung Athens <strong>in</strong> derKlassischen Zeit so verst<strong>an</strong>den <strong>und</strong> so dargelegt hätte, dass e<strong>in</strong>wissenschaftlich ausgewiesener Tutor bee<strong>in</strong>druckt gewesen sei, könneauch <strong>die</strong> ihr oder ihm zuvor unbek<strong>an</strong>nte Bil<strong>an</strong>z e<strong>in</strong>es Unternehmens <strong>und</strong>dessen Probleme verstehen <strong>und</strong> verständlich erklären - <strong>und</strong> eben auch zu<strong>in</strong>telligenten Lösungen raten.Tu felix Brit<strong>an</strong>nia? Nicht <strong>die</strong> gesonderte “Vermittlung” von“praxisrelev<strong>an</strong>ter Kompetenz” speziell <strong>in</strong> den “geisteswissenschaftlichenFächern”, sondern <strong>die</strong> <strong>in</strong>tegrierte Praxisrelev<strong>an</strong>z bei der Anlage vielerStu<strong>die</strong>ngänge für den ersten Hochschul-Abschluss stehen für <strong>Lehre</strong>nde wieStu<strong>die</strong>rende im Zentrum. Wissenschaftliche Propädeutik, aber auch dasErlernen fachrelev<strong>an</strong>ter Sprachen, beg<strong>in</strong>nen für <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>renden erst,wenn sie sich - wohlgemerkt: im Alter von 20 oder 21 Jahren - für e<strong>in</strong>enweiteren Abschluss entschieden haben, der nicht notwendig <strong>in</strong> dem Gebietihres ersten Abschlusses liegen muss.Britische Universitäten bilden für den ersten Abschluss nicht “kle<strong>in</strong>eHochschullehrende” aus, sondern fördern bei ihren Stu<strong>die</strong>renden nicht nur<strong>in</strong> den geisteswissenschaftlichen Fächern vor allem den selbständigenErwerb von Kompetenzen, <strong>die</strong> e<strong>in</strong>e sich stets wechselnde Praxis nachfragt.E<strong>in</strong>e Übertragung <strong>die</strong>ses Stu<strong>die</strong>nmodells nach Deutschl<strong>an</strong>d widersprichtfreilich allen Traditionen, <strong>in</strong> denen deutsche Universitäten stehen, <strong>und</strong>widerspricht - wie <strong>die</strong> HRK-Tagung offenbarte - auch dem, was <strong>die</strong> “Praxis”<strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d fordert. Ob wir aber doch dar<strong>an</strong> gut täten, nicht nur über“<strong>die</strong> Vermittlung praxisrelev<strong>an</strong>ter Kompetenzen <strong>in</strong> geisteswissenschaftlichenFächern” nachzudenken?
1362.2 Wissenschafts- <strong>und</strong> Forschungskompetenz2.2 Wissenschafts- <strong>und</strong> Forschungskompetenzals Alle<strong>in</strong>stellungsmerkmalder hochschulischen Bildung?Dr. Fr<strong>an</strong>k Stef<strong>an</strong> Becker, Siemens AGUm <strong>die</strong>se Frage zu klären, sollte m<strong>an</strong> <strong>die</strong> beiden möglichenInterpretationen betrachten:• Nur <strong>die</strong>se Kompetenz – wie immer sie def<strong>in</strong>iert sei – ist Aufgabe derHochschulbildung?• Oder: Nur e<strong>in</strong>e Hochschulausbildung vermag <strong>die</strong>se Kompetenz zuvermitteln?Aus Sicht der Wirtschaft k<strong>an</strong>n zum<strong>in</strong>dest für <strong>die</strong> „<strong>in</strong>dustrierelev<strong>an</strong>ten“Stu<strong>die</strong>nrichtungen (z.B. IT-Fachleute, Ingenieure <strong>und</strong> Naturwissenschaftler)ke<strong>in</strong>e der beiden Alternativen befürwortet werden.E<strong>in</strong> nur auf „Wissenschaft“ ausgerichtetes Curriculum müsste auf das Zieldes „Erkenntnisgew<strong>in</strong>ns“ ausgerichtet se<strong>in</strong>, also <strong>die</strong> Fähigkeit tra<strong>in</strong>ieren,möglichst weit über das bereits Gesicherte h<strong>in</strong>aus zu denken <strong>und</strong>f<strong>und</strong>amental <strong>Neue</strong>s zu erforschen. Dieses Denken genießt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>emakademischen Umfeld zu recht hohe Anerkennung – ist aber genau nichtAufgabe e<strong>in</strong>es „F&E-Mitarbeiters“ <strong>in</strong> der Industrie, <strong>in</strong> der über 90% derAbsolventen technisch-naturwissenschaftlicher Fächer ihr Auskommenf<strong>in</strong>den werden. Von <strong>die</strong>sen arbeiten selbst <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>novativausgerichteten Großunternehmen wie Siemens, dessen Belegschaftweltweit zu 37 % e<strong>in</strong>en Hochschulabschluss hat, typischerweise wenigerals fünf Prozent <strong>in</strong> der zentralen „Forschungsabteilung“ (CorporateTechnology). Die übergroße Mehrheit widmet sich <strong>in</strong> den Sektoren derVerbesserung bereits existierender Produkte, Gesamtlösungen <strong>und</strong>Verfahren. Abgesehen von neuen Softwarelösungen, <strong>die</strong> auf bereitsverfügbarer Hardware basieren, gilt hier <strong>die</strong> Regel: Je <strong>in</strong>novativer derAnsatz, umso aufwändiger (Zeit, Geld) se<strong>in</strong>e Implementierung. E<strong>in</strong>Aufw<strong>an</strong>d, den sich <strong>die</strong> im harten <strong>in</strong>ternationalen Wettbewerb stehendenIndustriebereiche nur leisten können, wenn damit <strong>in</strong> überschaubarer Zeitim Markt deutliche Konkurrenzvorsprünge erzielbar s<strong>in</strong>d.2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 137In der Forschungsabteilung ist der Zeithorizont mit typischerweise 3-7Jahren zwar weiter, doch auch hier ist <strong>die</strong> F<strong>in</strong><strong>an</strong>zierung projektgeb<strong>und</strong>en,d.h am Ende müssen Innovationen stehen, <strong>die</strong> e<strong>in</strong> oder mehrere Bereicheerfolgreich am Markt durchsetzen können. Wie l<strong>an</strong>g hier der Weg se<strong>in</strong>k<strong>an</strong>n, mag das Beispiel der Hochtemperatur-Supraleitung verdeutlichen:Von IBM-Forschern 1986 <strong>in</strong> der Schweiz entdeckt <strong>und</strong> mit dem Nobelpreisbelohnt, hat <strong>die</strong>se Technologie bis heute allenfalls <strong>in</strong> Nischen Anwendunggef<strong>und</strong>en; seitens IBM ist mir ke<strong>in</strong> Produkt bek<strong>an</strong>nt.Von daher lautet <strong>die</strong> Botschaft der Industrie g<strong>an</strong>z klar: Zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> dentechnisch-naturwissenschaftlichen Fächern sollte das Curriculum <strong>und</strong> dasSelbstverständnis der Fakultäten den Realitäten des Arbeitsmarktesentsprechen. Dies soll nicht heißen, dass <strong>die</strong> geistige Ausbildung derStu<strong>die</strong>renden nicht <strong>an</strong> H<strong>an</strong>d von Forschungsthemen erfolgen k<strong>an</strong>n. Nursollte auch klar vermittelt werden, dass <strong>an</strong>schließend e<strong>in</strong>Paradigmenwechsel <strong>an</strong>steht, <strong>und</strong> dass für den Berufserfolg zusätzlicheKenntnisse <strong>und</strong> Fähigkeiten („Schlüsselqualifikationen“) benötigt werden.Hier s<strong>in</strong>d wir bereits bei der zweiten Interpretationsmöglichkeit <strong>an</strong>gel<strong>an</strong>gt,nämlich bei der Frage, ob nur e<strong>in</strong>e Hochschulausbildung„Forschungskompetenz“ zu vermitteln vermag. Abgesehen von demVerweis auf historische Gegenbeispiele ist aus Industriesicht zu fragen, wiesich <strong>die</strong>se Kompetenz def<strong>in</strong>iert. Da heutzutage immer mehr Innovationen<strong>an</strong> den Grenzgebieten der Diszipl<strong>in</strong>en entstehen, s<strong>in</strong>d wesentlicheErfolgsfaktoren solide Fachkenntnis, e<strong>in</strong> offener Blick über <strong>die</strong> Grenzen deseigenen Fachs, der Wunsch nach Wissensaustausch, <strong>die</strong> Fähigkeiten zurAnalyse komplexer Sachverhalte <strong>und</strong> zur verständlichen Kommunikation,Zähigkeit, strategisches Denken, Ph<strong>an</strong>tasie, Überzeugungsvermögen sowie<strong>die</strong> Bereitschaft, <strong>die</strong> eigene Position zu h<strong>in</strong>terfragen <strong>und</strong> sich auch mit demeigenen Fach fremden Gebieten <strong>in</strong>tensiv zu beschäftigen. DieseAufzählung – <strong>die</strong> ke<strong>in</strong>en Anspruch auf Vollständigkeit erhebt – enthältzweifellos Eigenschaften, <strong>die</strong> sehr gut <strong>an</strong> e<strong>in</strong>er Hochschule tra<strong>in</strong>iert werdenkönnen, ja <strong>die</strong> gr<strong>und</strong>legend für e<strong>in</strong>e akademische Ausbildung s<strong>in</strong>d.Genauso umfasst sie aber auch Persönlichkeitsmerkmale, <strong>die</strong> kaum lehrbars<strong>in</strong>d, ja <strong>die</strong> sogar besser <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Umfeld außerhalb desHochschuluniversums als wichtig erk<strong>an</strong>nt, e<strong>in</strong>geübt <strong>und</strong> vermittelt werdenkönnen.
1382.2 Wissenschafts- <strong>und</strong> Forschungskompetenz2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 139Von daher lautet me<strong>in</strong> Fazit: Die Vermittlung von Forschungskompetenz,d.h. e<strong>in</strong>es wissenschaftlich geschulten Denkens, muss e<strong>in</strong> wesentliches Zielder Hochschulausbildung se<strong>in</strong>, sie k<strong>an</strong>n dort sicher besonders gut tra<strong>in</strong>iertwerden. Sie bleibt jedoch Stückwerk, wenn im Curriculum nichtberücksichtigt wird, dass über 90% der Absolventen <strong>an</strong>schließend nichtmehr <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em akademisch geprägten Umfeld, sondern (zum<strong>in</strong>dest im Fallder Ingenieure <strong>und</strong> Naturwissenschaftler) <strong>in</strong> der Industrie arbeiten werden.Auf <strong>die</strong> dort für e<strong>in</strong>e „Berufsfähigkeit“ erforderlichen zusätzlichen<strong>Anforderungen</strong> vorzubereiten, sollte zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> Ansätzen bereits e<strong>in</strong> Zielder Hochschule se<strong>in</strong>.Vermittlung praxisrelev<strong>an</strong>ter Kompetenzen <strong>in</strong> geisteswissenschaftlichenFächern: Was s<strong>in</strong>d beschäftigungsbezogeneKompetenzen aus Sicht der Unternehmen?Da der allgeme<strong>in</strong>e Anforderungskatalog der Unternehmen <strong>an</strong> Absolventen<strong>in</strong> me<strong>in</strong>em Vortrags-pdf „Berufsfähigkeit“ dargestellt wird, möchte ich hiernur kurz auf den Aspekt der Bedeutung geisteswissenschaftlicher Elementeim Curriculum e<strong>in</strong>gehen. Dabei ersche<strong>in</strong>en mir besonders folgende Aspektewichtig:• S<strong>in</strong>nhaftigkeit: Die E<strong>in</strong>ordnung des eigenen Tuns <strong>in</strong>gesamtgesellschaftliche Ziele <strong>und</strong> Zusammenhänge• Ver<strong>an</strong>twortung: Die Ausrichtung des eigenen H<strong>an</strong>delns <strong>an</strong> Normen <strong>und</strong>Werten• Persönlichkeit: Bildung jenseits der „Zweckausbildung“ alswesentliches Element e<strong>in</strong>es erfüllten Lebens.S<strong>in</strong>nhaftigkeitMit <strong>die</strong>sem Wort möchte ich das Bestreben charakterisieren, den Beitragder eigenen Tätigkeit im Kontext der sozialen <strong>Anforderungen</strong> <strong>und</strong>Entwicklungen zu sehen. E<strong>in</strong> fachlich hoch qualifizierter Mitarbeiter, dersich jedoch nicht für gesellschaftliche Zusammenhänge <strong>in</strong>teressiert, wird esheute auch <strong>in</strong> der Industrie schwer haben, se<strong>in</strong>en Beitrag zum Erfolg desUnternehmens (<strong>und</strong> damit zur Sicherung se<strong>in</strong>es Arbeitsplatzes!) zu leisten.Wie soll jem<strong>an</strong>d <strong>die</strong> Mediz<strong>in</strong>technik der Zukunft pl<strong>an</strong>en, entwickeln <strong>und</strong> amMarkt e<strong>in</strong>führen, der sich nicht für Entwicklungen wie dendemographischen W<strong>an</strong>del <strong>in</strong>teressiert? Wie soll er/sie <strong>die</strong> Bedürfnisse,Vorbehalte oder Schwierigkeiten der K<strong>und</strong>en verstehen, auf <strong>die</strong>org<strong>an</strong>isatorischen <strong>und</strong> f<strong>in</strong><strong>an</strong>ziellen E<strong>in</strong>schränkungen desGes<strong>und</strong>heitssystems e<strong>in</strong>gehen?Wie k<strong>an</strong>n jem<strong>an</strong>d umweltgerechte, d.h. z.B. energiesparende, Ressourcenschonende <strong>und</strong> recycelbare Produkte entwickeln, der sich nicht fürUmweltschutz, für <strong>die</strong> Auswirkungen auf Natur <strong>und</strong> L<strong>an</strong>dschaft<strong>in</strong>teressiert?Wie k<strong>an</strong>n jem<strong>an</strong>d <strong>in</strong>novative Verkehrslösungen verwirklichen, der sich nichtmit „irrationalen“ Verhaltensweisen (Auto als Statussymbol), Vorbehalten,Unwissenheit <strong>und</strong> der Bedeutung falscher Vorbilder ause<strong>in</strong><strong>an</strong>dersetzt?Was nützt <strong>die</strong> beste neue Energietechnik, wenn sie wegen Ängsten,kurzsichtigem Egoismus oder m<strong>an</strong>gelnder Information ke<strong>in</strong>e Akzept<strong>an</strong>zf<strong>in</strong>det (so z.B. moderne Kohlekraftwerke oder neue Stromleitungen, <strong>die</strong>durch den E<strong>in</strong>satz erneuerbarer Energien notwendig werden)?In all <strong>die</strong>sen Fällen ist e<strong>in</strong>e von der eigenen Position losgelöste Sichtweisenotwendig, <strong>die</strong> bereit ist, sich <strong>an</strong> dem R<strong>in</strong>gen um gesamtgesellschaftlichakzeptierte Ziele <strong>und</strong> Prioritäten zu beteiligen. Die für e<strong>in</strong>e fun<strong>die</strong>rteMe<strong>in</strong>ungsäußerung notwendige Bildung stellt gerade bei höhererVer<strong>an</strong>twortung e<strong>in</strong>e Qualifikation von entscheidender Bedeutung dar, daWirtschaftsführer immer wieder gefordert s<strong>in</strong>d, auch <strong>in</strong> <strong>die</strong>ser Arenaaufzutreten.Ver<strong>an</strong>twortungDie Vorfälle <strong>und</strong> Sk<strong>an</strong>dale der letzten Jahre haben nur zu deutlich gemacht,zu welchen Ergebnissen e<strong>in</strong> re<strong>in</strong> auf das Erreichen von „Zahlenvorgaben“gerichtetes Denken führen k<strong>an</strong>n. Jetzt wird zwar versucht, solchemFehlverhalten durch umf<strong>an</strong>greiche, jedes mögliche „Schlupfloch“verstopfende Compli<strong>an</strong>ce-Regelungen vorzubeugen. Aber auch dasdetaillierteste Paragrafenwerk k<strong>an</strong>n (selbst wenn es alle Mitarbeiter lesen,verstehen <strong>und</strong> stets präsent haben würden) nicht eigenver<strong>an</strong>twortlichesH<strong>an</strong>deln ersetzen, das sich aus e<strong>in</strong>em gr<strong>und</strong>sätzlich <strong>in</strong> der Persönlichkeitver<strong>an</strong>kerten Werteverständnis speist. Dazu gehört nicht nur dasBewusstse<strong>in</strong>, was Recht <strong>und</strong> Unrecht ist, sondern auch <strong>die</strong> „Zivilcourage“,<strong>in</strong> kritischen Fällen auch persönliche Nachteile <strong>in</strong> Kauf zu nehmen, umFehlentwicklungen entgegen zu treten. Dass <strong>die</strong>se Zivilcourage oft fehlt,
1402.2 Wissenschafts- <strong>und</strong> Forschungskompetenzzeigt sich auch <strong>in</strong> vielen <strong>an</strong>deren Situationen, wenn z.B. Menschen lieberwegsehen, als e<strong>in</strong>zugreifen oder wenigstens <strong>die</strong> Behörden zu verständigen.PersönlichkeitDas Wissen um <strong>die</strong> Relativität materiellen Erfolgs, um <strong>die</strong> Bedeutungzwischenmenschlicher oder tr<strong>an</strong>szendentaler Werte ist <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er aufEffizienz, Leistung, Nützlichkeit <strong>und</strong> zur Schau stell barem Statusoptimierten Gesellschaft geschw<strong>und</strong>en. Es gilt, was schon Oscar Wildee<strong>in</strong>mal formuliert hat: „Es gibt Menschen, <strong>die</strong> von allem den Preis, abervon nichts den Wert kennen.“ Bei <strong>die</strong>ser E<strong>in</strong>stellung ist jedoch e<strong>in</strong>eS<strong>in</strong>nkrise programmiert – im eigenen Leben, falls <strong>die</strong> Karriere nicht mehrnur nach oben führt, aber genauso für e<strong>in</strong>e g<strong>an</strong>ze Gesellschaft, falls esnämlich nicht mehr ständig mehr zu verteilen gibt, sondern vielleichte<strong>in</strong>mal über e<strong>in</strong>en längeren Zeitraum sogar jedes Jahr weniger (e<strong>in</strong> <strong>in</strong> derMenschheitsgeschichte schon wiederholt e<strong>in</strong>getretener Zust<strong>an</strong>d). DieFähigkeit, sich <strong>an</strong> geistigen D<strong>in</strong>gen zu erfreuen, Kunst <strong>und</strong> Kultur zugenießen, sich für Geschichte oder fremde Kulturen zu <strong>in</strong>teressieren, k<strong>an</strong>nentscheidend zur Lebenszufriedenheit beitragen – <strong>und</strong> damit wiederumauch zur emotionalen Stabilität <strong>und</strong> zum beruflichen Erfolg. Nicht zuletztgilt auch hier das im ersten Abschnitt Gesagte: Je höher <strong>die</strong> Position ist,umso stärker erwartet m<strong>an</strong> von dem Inhaber e<strong>in</strong>e Vorbildfunktion, e<strong>in</strong>ePersönlichkeit <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Allgeme<strong>in</strong>bildung, <strong>die</strong> auch Themen jenseits deseigenen Berufsfeldes umfasst. Die Gr<strong>und</strong>lage dafür k<strong>an</strong>n gar nicht frühgenug gelegt werden – geisteswissenschaftliche Komponenten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<strong>an</strong>sonsten auf Nützlichkeit <strong>an</strong>gelegten Ausbildung können hier e<strong>in</strong>ewichtige Anregung bilden.2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 1412.3 Arbeitsgruppen2.3.1 Arbeitsgruppe 1: Wie k<strong>an</strong>n e<strong>in</strong> Konzept „Fit für denArbeitsmarkt“ <strong>in</strong> den Fächerkulturen umgesetzt werden?Erfahrungswerte e<strong>in</strong>er Privat-UniversitätProf. Dr. Hendrik Birus, Jacobs University, BremenEs mag <strong>die</strong> déformation professionelle e<strong>in</strong>es Komparatisten se<strong>in</strong>, gern mitVergleichen zu beg<strong>in</strong>nen: hier zwischen dem Magister-Studium im Fach„Allgeme<strong>in</strong>e <strong>und</strong> Vergleichende Literaturwissenschaft (Komparatistik)“ <strong>an</strong>der LMU München <strong>und</strong> dem dort vor sechs Jahren als erstemgeisteswissenschaftlichen <strong>Bachelor</strong>-Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>g e<strong>in</strong>geführten BA-Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>g „Komparatistik“ e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> <strong>an</strong>dererseits zwischenletzterem <strong>und</strong> den <strong>Bachelor</strong>-Stu<strong>die</strong>ngängen <strong>an</strong> der School of Hum<strong>an</strong>ities<strong>an</strong>d Social Sciences der privaten Jacobs University Bremen. Doch <strong>die</strong>s istme<strong>in</strong>e Erfahrungsbasis für unser heutiges Diskussionsthema.(1) Der Magister Artium „Komparatistik“ der LMU München konnte durche<strong>in</strong> Drei-Fächer-Studium <strong>in</strong> ca. 4 - 6 Jahren erworben werden <strong>und</strong> setzteaußerdem <strong>die</strong> flüssige Lektürefähigkeit <strong>in</strong> zwei Fremdsprachen sowie <strong>die</strong>Kenntnis e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>en g<strong>an</strong>zen Kulturkreis prägenden Sprache (wie Late<strong>in</strong>,Altgriechisch oder klassisches Ch<strong>in</strong>esisch) voraus. Vor allem d<strong>an</strong>k der durche<strong>in</strong> solches <strong>an</strong>spruchsvolles Fachstudium erworbenenSchlüsselqualifikationen, wie „Interdiszipl<strong>in</strong>arität“ <strong>und</strong> „<strong>in</strong>terkulturelleKompetenzen“, bot er gute Ch<strong>an</strong>cen auf dem Arbeitsmarkt – <strong>und</strong> <strong>die</strong>s weitüber den Me<strong>die</strong>nbereich h<strong>in</strong>aus.(2) Letzteres galt auch für den neue<strong>in</strong>geführten BA „Komparatistik“, derauf e<strong>in</strong> zweites Nebenfach verzichtete, dafür aber zusätzlich 20 %berufsqualifizierende Ver<strong>an</strong>staltungen (besonders IT <strong>und</strong> BWL, d<strong>an</strong>ebenBewerbungstra<strong>in</strong><strong>in</strong>g, Öffentlichkeitsarbeit, Market<strong>in</strong>g usw.) durch dasInstitut „Student <strong>und</strong> Arbeitsmarkt“ enthielt <strong>und</strong> 2 Praktika (davonm<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>es im Ausl<strong>an</strong>d) vorschrieb. D<strong>an</strong>k der großzügigen Förderungdurch das DAAD-Programm „Ausl<strong>an</strong>dsorientierte Stu<strong>die</strong>ngänge“ konntenalle Module des Gr<strong>und</strong>studiums auch auf Englisch <strong>an</strong>geboten werden <strong>und</strong>so bei strenger qualitativer Auswahl der Anteil ausländischer Stu<strong>die</strong>render
1422.3.1 Umsetzung des Konzeptes „Fit für den Arbeitsmarkt“2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 143auf m<strong>in</strong>destens 50 % gesteigert werden, was freilich mit e<strong>in</strong>emerheblichen Beratungs- <strong>und</strong> Betreuungsaufw<strong>an</strong>d verb<strong>und</strong>en war. Dasstraffe modularisierte Studium <strong>und</strong> der enge Zusammenhalt der jeweiligenKohorten führte dazu, dass <strong>die</strong> Absolventen nach e<strong>in</strong>er Regelstu<strong>die</strong>nzeitvon drei Jahren kaum h<strong>in</strong>ter ihren Magister-Kommilitonen zurückst<strong>an</strong>den –weder qualitativ noch gar h<strong>in</strong>sichtlich ihrer Ch<strong>an</strong>cen auf dem Arbeitsmarkt.(Vgl. hierzu den von Virg<strong>in</strong>ia Richter <strong>und</strong> mir verfassten <strong>und</strong> unter ders<strong>in</strong>nentstellenden Überschrift „Diese Schmalspur k<strong>an</strong>n m<strong>an</strong> gehen.<strong>Bachelor</strong> <strong>und</strong> <strong>Master</strong>: Ist ‘Bologna’ der Unterg<strong>an</strong>g des Abendl<strong>an</strong>des?“ <strong>in</strong>der Süddeutschen Zeitung vom 11. 1. 2005 erschienenen Bericht.)Der Tempuswechsel <strong>in</strong>s Präteritum ist allerd<strong>in</strong>gs ke<strong>in</strong>e sprachlicheSchlamperei, sondern vielmehr dem Umst<strong>an</strong>d geschuldet, dass mit derflächendeckenden E<strong>in</strong>führung der <strong>Bachelor</strong>-Stu<strong>die</strong>ngänge <strong>an</strong> der LMUerhebliche Abstriche <strong>an</strong> <strong>die</strong>sem – zugegebenermaßen <strong>an</strong>spruchsvollen <strong>und</strong>aufwendigen – Konzept verb<strong>und</strong>en s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> dass vor allem der Anspruche<strong>in</strong>es ‘berufsqualifizierenden’ Abschlusses auf se<strong>in</strong> formales M<strong>in</strong>imumreduziert wird: Es gibt nicht mehr <strong>die</strong> höchst erfolgreichen Praxiskurse desInstituts „Student <strong>und</strong> Arbeitsmarkt“, <strong>die</strong> Obligatorik der Praktika istabgeschafft, <strong>und</strong> Ausl<strong>an</strong>dsaufenthalte werden erheblich erschwert. kaumnoch <strong>die</strong> Fassade übriggeblieben ist. Die zu erwartenden negativen Folgenfür <strong>die</strong> ‘Employability’ <strong>die</strong>ser Stu<strong>die</strong>ngänge <strong>und</strong> ihre <strong>in</strong>ternationaleKonkurrenzfähigkeit waren für mich e<strong>in</strong> Hauptgr<strong>und</strong>, für me<strong>in</strong>eReform<strong>an</strong>strengungen nochmals e<strong>in</strong> g<strong>an</strong>z neues Feld zu suchen: das e<strong>in</strong>eramerik<strong>an</strong>isch strukturierten Privat-Universität.(3) An der kürzlich für weitere 10 Jahre vom Wissenschaftsratreakkreditierten Jacobs University Bremen beträgt der Anteil ausländischerStu<strong>die</strong>render aus 91 Ländern ca. 75 %; dabei gibt es derzeit viermal so vielBewerber wie Zulassungen, bei denen d<strong>an</strong>n ausschließlich qualitativeGesichtspunkte e<strong>in</strong>e Rolle spielen („need bl<strong>in</strong>d admission“) <strong>und</strong> <strong>die</strong>Stu<strong>die</strong>ngebühren im Bedarfsfall gest<strong>und</strong>et, reduziert oder g<strong>an</strong>z erlassenwerden. Obwohl Interdiszipl<strong>in</strong>arität <strong>in</strong> der Strukturierung des Studiumse<strong>in</strong>e überragende Rolle spielt <strong>und</strong> ca. e<strong>in</strong> Drittel der Lehrver<strong>an</strong>staltungen <strong>in</strong><strong>an</strong>deren Fächern, ja sogar <strong>in</strong> der <strong>an</strong>deren Fakultät („School of Hum<strong>an</strong>ities<strong>an</strong>d Social Sciences“ vs. „School of Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g <strong>an</strong>d Science“) zuabsolvieren ist, wird im <strong>Bachelor</strong>-Studium <strong>die</strong> Regelstu<strong>die</strong>nzeit von 3Jahren nur <strong>in</strong> begründeten Ausnahmefällen überschritten, <strong>die</strong>Abbruchquote beträgt weniger als 5 %. Das hängt sowohl mit demaufwendigen Zulassungsverfahren wie mit der günstigenBetreuungsrelation von 1:11, dem engmaschigen Beratungssystem <strong>und</strong> derdurchgängigen Unterbr<strong>in</strong>gung der Undergraduates <strong>in</strong> Colleges auf demCampus zusammen. So betrachten wir es als e<strong>in</strong>en Haupterfolg unsererbreiten liberal arts <strong>an</strong>d science education, dass unsere frischgebackenen<strong>Bachelor</strong>s sowohl ihr Studium <strong>an</strong> <strong>in</strong>ternationalen Spitzenuniversitäten ihrerWahl fortsetzen können als auch beste Ch<strong>an</strong>cen auf dem Arbeitsmarkthaben.Was nun <strong>die</strong> ‘Employability’ geisteswissenschaftlicher <strong>Bachelor</strong>s der JacobsUniversity <strong>an</strong>geht, so s<strong>in</strong>d <strong>die</strong> im Alumni Career Report 2007 für <strong>die</strong> vonmir geleitete School of Hum<strong>an</strong>ities <strong>an</strong>d Social Sciences erhobenen Zahlenvon vier Absolventen-Jahrgängen noch nicht statistisch belastbar <strong>und</strong>differenzieren über<strong>die</strong>s nicht zwischen Geistes- <strong>und</strong> Sozialwissenschaften.Sie lassen aber deutliche Trends erkennen, <strong>die</strong> auch für <strong>die</strong>Geisteswissenschaften relev<strong>an</strong>t s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> <strong>die</strong> durchaus mit me<strong>in</strong>enErfahrungen <strong>an</strong> der LMU München kompatibel s<strong>in</strong>d:Von unseren Absolventen leben gegenwärtig knapp 45 % <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d,wobei nur 24 % der Alumni aus Deutschl<strong>an</strong>d stammen; <strong>an</strong>dererseits s<strong>in</strong>dderzeit etwa 40 % der deutschen Absolventen <strong>in</strong>s Ausl<strong>an</strong>d geg<strong>an</strong>gen.Dagegen stammen nur 1 % aus Großbrit<strong>an</strong>nien, während sich 15 % derAlumni entscheiden, dort zu leben; abgeschwächt gilt <strong>die</strong>s auch für <strong>die</strong>USA, woher nur 2 % der Alumni stammen, während 10 % der Absolventendorth<strong>in</strong> gehen. Da <strong>die</strong> Unterrichtssprache <strong>an</strong> der Jacobs University Englischist, k<strong>an</strong>n <strong>die</strong>se Orientierung auf <strong>die</strong> <strong>an</strong>glo-amerik<strong>an</strong>ische Academia nichtüberraschen. Erfreulich ist aber, dass ungefähr 50 % der ausländischenStu<strong>die</strong>renden Deutsch auf e<strong>in</strong>em fortgeschrittenen Niveau spricht. ImÜbrigen besteht großes <strong>und</strong> erfolgsträchtiges Interesse <strong>an</strong> unserenSprachkursen <strong>in</strong> Fr<strong>an</strong>zösisch, Sp<strong>an</strong>isch <strong>und</strong> neuerd<strong>in</strong>gs Ch<strong>in</strong>esisch sowie <strong>an</strong>dem neue<strong>in</strong>gerichteten Sprachlabor.Aufschlussreich ist auch <strong>die</strong> Tendenz der Alumni, nicht gleich nach derGraduierung <strong>in</strong> ihr Heimatl<strong>an</strong>d zurückzukehren. So stammen 18 % derAlumni aus Bulgarien, doch nur 7 % leben gegenwärtig dort; <strong>und</strong> ausRumänien stammen 16 %, doch nur 5 % s<strong>in</strong>d bis jetzt dorth<strong>in</strong>zurückgekehrt. Ähnliches gilt für Länder wie In<strong>die</strong>n oder Litauen.Auf <strong>die</strong> Frage nach bevorzugten Arbeitsgebieten verwiesen von 349Antworten 76 auf „Research/Education“, 54 auf „Consult<strong>in</strong>g“, 49 auf„Industry“, 34 auf „NGO“, 31 auf „Government“, je 24 auf „Media“ bzw.
1442.3.1 Umsetzung des Konzeptes „Fit für den Arbeitsmarkt“2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 145„Software“ <strong>und</strong> 23 auf „Market<strong>in</strong>g“. Dabei zeigten nur 10 % der befragtenAlumni ke<strong>in</strong>erlei Interesse <strong>an</strong> ‘Entrepreneurship’. Und <strong>in</strong>teress<strong>an</strong>terweisearbeitet <strong>in</strong>zwischen e<strong>in</strong>e große Zahl von Alumni im Investment B<strong>an</strong>k<strong>in</strong>g,obwohl wir ke<strong>in</strong>en entsprechenden Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>g <strong>an</strong>bieten.Unter den Universitäten, <strong>an</strong> denen unsere Absolventen ihr Studiumfortsetzen, hat <strong>die</strong> Jacobs University mit 21 % den größten Anteil. Dieübrigen verteilen sich relativ gleichmäßig auf bek<strong>an</strong>nte Institutionen wieBrown University, Carnegie Mellon University, Cornell University, HarvardUniversity, LMU München, London School of Economics, MassachusettsInstitute of Technology, Pr<strong>in</strong>ceton University, RWTH Aachen, St<strong>an</strong>fordUniversity, Universität Bremen, Universität M<strong>an</strong>nheim, Universität St.Gallen, University of Amsterdam, University of Cambridge, University ofOxford, Yale University u.a.Erfreulicherweise hat sich <strong>die</strong> Gesamtzahl unserer Alumni <strong>in</strong> derGeschäftswelt deutlich erhöht. Bedeutende ‘global players’ s<strong>in</strong>d dabeiAirbus Bremen, Ba<strong>in</strong> & Co., B<strong>an</strong>k of Engl<strong>an</strong>d, Deloitte & Touche, E.ON AG,EADS Astrium, Goldm<strong>an</strong> Sachs, Google, Inf<strong>in</strong>eon Technologies, MerillLynch, Morg<strong>an</strong> St<strong>an</strong>ley, Philips, Procter & Gamble, Siemens, W<strong>in</strong>tershallu.a.So aufschlussreich <strong>die</strong>se Informationen im G<strong>an</strong>zen wie im E<strong>in</strong>zelnen se<strong>in</strong>mögen, so eignet sich <strong>die</strong> Jacobs University doch nicht für hastige Rezepte<strong>an</strong> <strong>die</strong> Adresse der staatlichen Universitäten <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d. Sondern ihrModellcharakter dürfte vor allem dar<strong>in</strong> bestehen zu zeigen, dass m<strong>an</strong>chessche<strong>in</strong>bar Unmögliche durchaus realisierbar ist – freilich auch, welchenPreis <strong>die</strong>s kostet. Ob m<strong>an</strong> bereit se<strong>in</strong> sollte, ihn zu zahlen, das wäre e<strong>in</strong>s<strong>in</strong>nvolles Thema e<strong>in</strong>er Hochschulreform-Diskussion, <strong>die</strong> ihren Namenver<strong>die</strong>nt.Employability: Kategorien, Kriterien, Kompetenzen aus Sicht derHypoVere<strong>in</strong>sb<strong>an</strong>kMart<strong>in</strong>a Bischof, HypoVere<strong>in</strong>sb<strong>an</strong>kGr<strong>und</strong>satzfragen e<strong>in</strong>es Arbeitgebers im Bologna-ProzessWas können eigentlich <strong>Bachelor</strong>-Absolventen? Welche Kompetenzenbr<strong>in</strong>gen <strong>Master</strong>absolventen mit? Wie unterscheiden sich <strong>die</strong> Absolventender neuen gestuften Stu<strong>die</strong>ngänge von denen, <strong>die</strong> Diplomstu<strong>die</strong>ngängebelegt haben (<strong>und</strong> <strong>die</strong> vielleicht, wie von Seiten der Wirtschaft oftbehauptet, zu l<strong>an</strong>ge, zu theoretisch, zu wenig zielgerichtet stu<strong>die</strong>rt haben)?Mit solchen Fragen beschäftigt sich <strong>die</strong> HypoVere<strong>in</strong>sb<strong>an</strong>k – als "deutschesGesicht" der europäischen Unicredit Group mit über 170 000 Mitarbeitern<strong>in</strong> 23 Ländern – <strong>in</strong>tensiv seit 2003. Auch wir wollen e<strong>in</strong>en Bologna-Prozesses mit vor<strong>an</strong>treiben, der nicht e<strong>in</strong>e Umetikettierung alter Curriculadarstellt, sondern strukturelle Reformen mit <strong>in</strong>haltlichen verb<strong>in</strong>det <strong>und</strong>berufsrelev<strong>an</strong>te Kompetenzen s<strong>in</strong>nvoll <strong>in</strong> den Stu<strong>die</strong>ngängen ver<strong>an</strong>kert.Es genügt für uns als Arbeitgeber ja nicht, den Slog<strong>an</strong> "<strong>Bachelor</strong> Welcome"zu erf<strong>in</strong>den (2003) <strong>und</strong> <strong>in</strong> Deklarationen mit <strong>an</strong>deren Unternehmen zuverbreiten (geschehen 2004 <strong>und</strong> 2006)! Vielmehr musste - über <strong>die</strong>gr<strong>und</strong>sätzliche Öffnung von Tra<strong>in</strong>eeprogrammen für <strong>Bachelor</strong>-Absolventenh<strong>in</strong>aus - geklärt werden, ob es Abschlussgrad-spezifischeQualifikationsprofile gibt <strong>und</strong> wo wir <strong>die</strong>se e<strong>in</strong>setzen. Zudem sorgtenatürlich <strong>die</strong> gestiegene Zahl von Abschlussgraden, <strong>die</strong> als Nebenwirkungdes Bologna-Prozesses entst<strong>an</strong>d, auch <strong>in</strong> unserem Haus fürUnübersichtlichkeit <strong>und</strong> für Unsicherheit <strong>in</strong> der Bewertung vonQualifikationen.Berufsbefähigung sichtbar machenE<strong>in</strong>en ersten Lösungsversuch unternahmen wir 2003 mit dem"Employability-Index": Wir entwickelten <strong>die</strong>ses Rat<strong>in</strong>g-Instrument, um <strong>die</strong>Passung von Bewerber-Qualifikation <strong>und</strong> Anforderungsprofilenunabhängig von re<strong>in</strong> formalen Parametern wie Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gstruktur,akademischem Titel oder Hochschultyp zu beurteilen. Wir führten <strong>die</strong>Kategorien "Academic Credit" <strong>und</strong> "Professional Credit" e<strong>in</strong>, um
1462.3.1 Umsetzung des Konzeptes „Fit für den Arbeitsmarkt“2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 147zugeordnete Indikatoren mit e<strong>in</strong>em Punktesystem zu bewerten, das sich <strong>an</strong>das ECTS-System <strong>an</strong>lehnt.Kategorien der Berufsbefähigung im Employability-Index Academic Credit (AC) Professional Credit (PC)Vom Employability-Index zum verb<strong>in</strong>dlichen Basis-AnforderungsprofilMittlerweile gehört der Index zu unserer <strong>in</strong>ternen "Hum<strong>an</strong>-Resources-Geschichte". Er lebt aber <strong>in</strong>haltlich fort <strong>in</strong> unserer Gr<strong>und</strong>auffassung davon,welche Kompetenzen Bewerber mitbr<strong>in</strong>gen müssen <strong>und</strong> im Basis-Anforderungsprofil, das alle zu uns passenden Berufse<strong>in</strong>steiger erfüllenmüssen: Pro Theorie-Semester 30 CPs(maximal x 10) Fachliche Passungdeutlich vorh<strong>an</strong>denpartiell vorh<strong>an</strong>den30 CPs15 CPs Berufsfeld-relev<strong>an</strong>te Praxis:pro Semester/5 Monate 30 CPspro Monat6 CPs Ausl<strong>an</strong>dsaufenthalt:pro Semester/5 Monate 15 CPspro Monat3 CPs(bei Relev<strong>an</strong>z fürs Berufsfeld: x 2) Methoden-/Sozialkompetenz:e<strong>in</strong>schlägig 30 CPsallgeme<strong>in</strong> 15 CPs2007: Basis-Anforderungsprofile für AbsolventenDie drei Basiskomponenten "Vertriebstalent", "Praxiserfahrung" <strong>und</strong> "Analysefähigkeit" gehörenzw<strong>in</strong>gend zum Anforderungsprofil aller Vertriebsdivisionen.4Mart<strong>in</strong>a BischofBildungspolitik HTC 5Hum<strong>an</strong> Resources M<strong>an</strong>agement 11.04.2008Mit dem jeweils errechneten Index konnten wir nachvollziehbar <strong>und</strong> klar<strong>die</strong> Frage be<strong>an</strong>tworten: "Employable for HVB or not?" <strong>und</strong> sogarGehaltsb<strong>an</strong>dbreiten zuordnen. Allerd<strong>in</strong>gs führte <strong>die</strong> Anwendung des "E-Index" zu stark erhöhtem Gebrauch der Gr<strong>und</strong>rechenarten bei unserenBewerbungs<strong>an</strong>alysten – <strong>und</strong> nicht immer zu erhöhter Begeisterung! Ausheutiger Sicht m<strong>an</strong>ifestierte sich hier vielleicht auch der Glaube derAnf<strong>an</strong>gsjahre dar<strong>an</strong>, dass der Bologna-Prozess maßgeblich durch korrekteAnwendung von Credit Po<strong>in</strong>ts zu bewältigen sei. Diese Betrachtungsweisehat sich mittlerweile <strong>in</strong> unserem Haus, aber auch bei vielen <strong>an</strong>derenAkteuren <strong>und</strong> Betroffenen des Prozesses gew<strong>an</strong>delt. Dennoch war derEmployability-Index e<strong>in</strong> gutes, weil strenges Instrument, um den Blick wegvom Formalen <strong>und</strong> h<strong>in</strong> zum Inhalt zu lenken.5Mart<strong>in</strong>a BischofBildungspolitik HTC 5Hum<strong>an</strong> Resources M<strong>an</strong>agement 11.04.2008• Die Basiskompetenzen s<strong>in</strong>d notwendige Voraussetzung für alleTra<strong>in</strong>eeprogramme.• Die farbigen Felder zeigen, welche Kompetenz <strong>in</strong> der jeweiligenDivision besonders wichtig ist.• Je nach Division ergänzen spezifische Kompetenzen unserAnforderungsprofil.• Mögliche akademische Abschlüsse für Tra<strong>in</strong>eebewerber:<strong>Bachelor</strong>, <strong>Master</strong>, Diplom.Was sich hier so e<strong>in</strong>fach darstellt, ist Ergebnis e<strong>in</strong>es <strong>in</strong>tensivenAustauschprozesses zwischen dem Talent Center (der Plattform fürNachwuchsentwicklung <strong>in</strong> der HypoVere<strong>in</strong>sb<strong>an</strong>k) <strong>und</strong> den
1482.3.1 Umsetzung des Konzeptes „Fit für den Arbeitsmarkt“2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 149Vertriebsdivisionen <strong>und</strong> Stäben (<strong>die</strong> sich auch untere<strong>in</strong><strong>an</strong>der austauschten).Dieser Prozess f<strong>an</strong>d 2007 im Rahmen des Projekts "AlaBaMa" statt. (DerName kommt von "à la <strong>Bachelor</strong> <strong>und</strong> <strong>Master</strong>"!) Ziel war, <strong>in</strong>nerhalb unseresstark divisionalisierten Unternehmens e<strong>in</strong>e übergreifende geme<strong>in</strong>sameBildungs- <strong>und</strong> Entwicklungspolitik zu def<strong>in</strong>ieren, <strong>die</strong> auf <strong>die</strong> Ch<strong>an</strong>cen <strong>und</strong>Ziele des Bologna-Prozesses ausgerichtet ist.Gesuchte Kompetenzen kommunizierenDie Def<strong>in</strong>ition e<strong>in</strong>es divisionsübergreifenden Anforderungsprofils fördertauch <strong>die</strong> externe Wahrnehmung der B<strong>an</strong>k als e<strong>in</strong> Arbeitgeber, der <strong>in</strong> allenDivisionen europaweit gleichwertige Entwicklungsch<strong>an</strong>cen bietet. Erst aufder Gr<strong>und</strong>lage e<strong>in</strong>es e<strong>in</strong>heitlichen <strong>und</strong> verb<strong>in</strong>dlichen Kompetenzprofils füralle Divisionen können wir als Arbeitgeber klare Aussagen im Hochschul<strong>und</strong>Bewerbermarkt machen. Deshalb kommunizieren wir auch auf unsererWebsite, dass nicht der Abschlussgrad, sondern e<strong>in</strong> Profil aus mehrerenFacetten entscheidend ist:Kompetenzfelder im AuswahlprozessBei unserer Bewerberauswahl betrachten wir nicht nur berufsbefähigendeFach- <strong>und</strong> Sozialkompetenzen, wie sie am Ende e<strong>in</strong>es Studiums mitPraxiserfahrung erwartet werden können, sondern auch <strong>die</strong> Personal- bzw.Hum<strong>an</strong>kompetenz von Bewerbern. Zu <strong>die</strong>sem Zweck haben wir das"Leadership Competency Model" unserer italienischen Konzernmutter fürunser Assessment Center adaptiert:KompetenzmodellLeadership Competency Model: adaptiert aus Italien, verwendetnicht nur <strong>in</strong> der FK-Entwicklung, sondern auch im Tra<strong>in</strong>ee-ACValuesIntegrity & Trustworth<strong>in</strong>essTeam Cult ureEm brace Diversit yMarket & Product KnowledgeCust om er FocusAnalytical Th<strong>in</strong>k<strong>in</strong>gLeadershipDiagnose des persönlichenStatus QuoThought Leadership / InfluenceExecution / Result Orientation / Energiz<strong>in</strong>gCh<strong>an</strong>ge OrientationPersonal TraitsCommitted to Learn<strong>in</strong>gDiagnose des persönlichenPotenzialsKommunikation des Kompetenzprofils8Mart<strong>in</strong>a BischofBildungspolitik HTC 5Hum<strong>an</strong> Resources M<strong>an</strong>agement 11.04.2008Ihr Profil hat immer zwei Seiten:Ihr akademisches Profil zeigt, dass Sie wissenschaftliche Gr<strong>und</strong>lagen,Methodenkompetenz <strong>und</strong> berufsfeldbezogene Qualifikationen mitbr<strong>in</strong>gen. Ihr Studiumhaben Sie als <strong>Bachelor</strong>, <strong>Master</strong>, mit dem Diplom oder auch dem 1./2. Staatsexamenabgeschlossen.Ihr persönliches Profil besteht immer aus drei Basiskomponenten:• Vertriebstalent• Analysefähigkeit• PraxiserfahrungIn jeder Division oder Competence L<strong>in</strong>e werden <strong>die</strong>se drei Basiskomponentenetwas <strong>an</strong>ders gewichtet. Darüber h<strong>in</strong>aus sollten Sie je nach Zielfunktion nochZusatzkompetenzen mitbr<strong>in</strong>gen. Mehr dazu erfahren Sie auf den Seiten zu unserenfünf verschiedenen Tra<strong>in</strong>eeprogrammen.7Mart<strong>in</strong>a BischofBildungspolitik HTC 5Hum<strong>an</strong> Resources M<strong>an</strong>agement 11.04.2008(Orig<strong>in</strong>al im Internet:http://www.hypovere<strong>in</strong>sb<strong>an</strong>k.de/portal?view=/jobboerse/186464.jsp)
1502.3.1 Umsetzung des Konzeptes „Fit für den Arbeitsmarkt“2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 151In das AC haben wir es so e<strong>in</strong>gepasst, dass es <strong>die</strong> Basiskomponentenunseres Anforderungsprofils ergänzt.9Matrix: Exercises – Competencies(aktuelle Verwendung im Auswahlverfahren der Division MIB)ExercisesCompetenciesMarket & Product KnowledgeCustomer FocusAnalytical Th<strong>in</strong>k<strong>in</strong>gValues(Integrity &Trustworth<strong>in</strong>ess,Team Culture, Embrace Diversity)LeadershipThought Leadership / InfluenceExecution / Result Orientation /Energiz<strong>in</strong>gCh<strong>an</strong>ge OrientationPersonal TraitsCommitted to Learn<strong>in</strong>gGroupdiscussion---XXX------XCustomerconversationMart<strong>in</strong>a BischofBildungspolitik HTC 5Hum<strong>an</strong> Resources M<strong>an</strong>agement 11.04.2008XX------X---XPresentation&disputeXX------X---XInterview------XX---XXAnalyticalTestBeide Kompetenztableaus zusammen schlagen sich d<strong>an</strong>n <strong>in</strong> den AC-Übungen nieder:Alle hier aufgeführten Kompetenzfelder werden im Laufe e<strong>in</strong>es Tages vongeschulten Führungskräften aus den Divisionen beobachtet <strong>und</strong> beurteilt.E<strong>in</strong> Gesamt-AC-Wert <strong>in</strong>nerhalb der B<strong>an</strong>dbreite von 1 – 5 wird gebildet. DerErwartungswert für e<strong>in</strong>e gute Eignung liegt bei 3; Abweichungen von 10%s<strong>in</strong>d möglich; das für den jeweils gepl<strong>an</strong>ten E<strong>in</strong>satzbereich entscheidendeKompetenzfeld muss den <strong>Anforderungen</strong> jedoch immer voll entsprechen.(Beispiel: Kompetenz "Analysefähigkeit" für <strong>die</strong> Division Firmen- <strong>und</strong>kommerzielle Immobilienk<strong>und</strong>en.)Wie m<strong>an</strong> bis hierher hoffentlich erkennen konnte, ist es mit e<strong>in</strong>iger Arbeitdoch gut möglich, e<strong>in</strong> Kompetenzprofil für Berufse<strong>in</strong>steiger zu entwerfen,das auf e<strong>in</strong>em fachspezifisch def<strong>in</strong>ierten Schwerpunkt aufbaut (z. B. derTätigkeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Division aufgr<strong>und</strong> e<strong>in</strong>schlägigen Fachwissens, das ergänztwird von nicht fachlich geb<strong>und</strong>enen Kompetenzen).---X---------------Nicht <strong>an</strong> Fachkulturen geb<strong>und</strong>ene KompetenzprofileSchwieriger wird es, wenn m<strong>an</strong> d<strong>an</strong>ach fragt, welche berufsbefähigendenKompetenzen denn nun gr<strong>und</strong>sätzlich im Rahmen e<strong>in</strong>es Studiumserworben werden sollten? Hier tobt <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d regelrecht e<strong>in</strong>e "Battlefor Competence" (<strong>an</strong>alog dem "War for Talent"), ausgelöst <strong>in</strong>sbesonderedurch das R<strong>in</strong>gen um e<strong>in</strong>en nationalen Qualifikationsrahmen, der mit dembereits verabschiedeten Europäischen Qualifikationsrahmen kompatibelse<strong>in</strong> soll. Auch <strong>die</strong> deutsche Besonderheit der (noch) klar getrenntenBereiche Berufsbildung versus Allgeme<strong>in</strong>- <strong>und</strong> Hochschulbildung äußertsich dar<strong>in</strong>. Es konkurrieren verschiedene Modelle: z. B. der eher kognitivorientierte Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse derKMK <strong>und</strong> den Kategorien "Wissen <strong>und</strong> Verstehen" <strong>und</strong> "Können"; dasModell EQF mit den sehr elastischen Kategorien "Kenntnisse/Knowledge"","Fertigkeiten/Skills" <strong>und</strong> "Kompetenz/Competence"; verschiedeneVorschläge für e<strong>in</strong>en Nationalen Qualifikationsrahmen, wo Kompetenz alsH<strong>an</strong>dlungsfähigkeit im Beruf beschrieben wird auf 5 bis 8 Niveaus, <strong>die</strong> sichdurch zunehmende Komplexität der Aufgaben <strong>und</strong> H<strong>an</strong>dlungsfelder sowiedas Ausmaß der Entscheidungsspielräume def<strong>in</strong>ieren (E<strong>in</strong>fluss der dualenBerufsausbildung!) Kategorien hier: Fach-/Methodenkompetenz,Sozialkompetenz, Individualkompetenz – um nur e<strong>in</strong>ige zu nennen, g<strong>an</strong>z zuschweigen von zahlreichen Stellungnahmen der unterschiedlichenInteressengruppen wie Wirtschaft oder Gewerkschaften. In der Diskussionum <strong>die</strong> Wertigkeit von beruflich oder akademisch erworbenenKompetenzen könnte <strong>die</strong> Aussage im Jahresgutachten des AktionsratsBildung 2008 hilfreich se<strong>in</strong> (S. 80), dass berufliche Ausbildungs<strong>in</strong>halte imErwerbsleben e<strong>in</strong>e statistisch nachweisbare Abschreibung erfahren, <strong>die</strong> imZeitverlauf zugenommen hat. Die Rate lag 1998/99 bei 15,2%. FürAkademiker konnte e<strong>in</strong> Abschreibung von Stu<strong>die</strong>n<strong>in</strong>halten imErwerbsverlauf h<strong>in</strong>gegen nicht nachgewiesen werden: "Die Ergebnisse<strong>die</strong>ser Untersuchung [i.e. Ludwig/Pfeiffer 2006] deuten darauf h<strong>in</strong>, dassallgeme<strong>in</strong>e Ausbildungs<strong>in</strong>halte <strong>in</strong> Zeiten der Globalisierung e<strong>in</strong>e höherel<strong>an</strong>gfristige Verwertbarkeit für das Erwerbsleben aufweisen als berufliche."Hier h<strong>an</strong>delt es sich zwar um e<strong>in</strong>e begründete Vermutung, nicht e<strong>in</strong>ebewiesene Tatsache. M<strong>an</strong> darf aber durchaus daraus schließen, dass <strong>die</strong>l<strong>an</strong>gfristige Verwertbarkeit von z. B. überfachlicher Methodenkompetenzhöher ist als hochspezialisiertes <strong>in</strong> Studium oder Berufsausbildung
1522.3.1 Umsetzung des Konzeptes „Fit für den Arbeitsmarkt“2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 153erworbenes Wissen. Im Bewusstse<strong>in</strong> der kurzen Halbwertzeit vonSpezialwissen <strong>und</strong> der Notwendigkeit des lebensl<strong>an</strong>gen Lernens darf alsopostuliert werden: Die Wichtigkeit von re<strong>in</strong>em Faktenwissen <strong>und</strong> hoherSpezialisierung muss zum<strong>in</strong>dest auf der <strong>Bachelor</strong>-Stufe zugunsten vonMethodenwissen zurücktreten! Dies ist eigentlich ke<strong>in</strong>e neue oder sehrorig<strong>in</strong>elle E<strong>in</strong>sicht – aber konsequent weitergedacht, müsste sie <strong>die</strong>"Employability" von Absolventen z. B. der Geistes- <strong>und</strong>Sozialwissenschaften deutlich erhöhen. Denngerade <strong>die</strong>se Fächer (sofern sie durchdachte <strong>und</strong> gut strukturierte Curriculaaufweisen) s<strong>in</strong>d berufen, sich um <strong>die</strong> Ausbildung solcherMethodenkompetenzen zu bemühen, <strong>die</strong> zur Orientierungs- H<strong>an</strong>dlungs<strong>und</strong>Entscheidungsfähigkeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er komplexen <strong>und</strong> sich schnellw<strong>an</strong>delnden (Berufs-) Welt beitragen.Fit für den globalen ArbeitsmarktFolgendes Zitat beschreibt <strong>die</strong> <strong>Anforderungen</strong> der globalen Berufswelt sehrgut:„...the job market as such...is gett<strong>in</strong>g closer to academia because it is moreth<strong>an</strong> ever geared towards typically academic qualities, such as: creativity,yet discipl<strong>in</strong>e <strong>an</strong>d speed <strong>in</strong> org<strong>an</strong>is<strong>in</strong>g concepts by me<strong>an</strong>s of methodical<strong>an</strong>d systematic approach, not to mention better self-org<strong>an</strong>isation;leadership by me<strong>an</strong>s of conv<strong>in</strong>c<strong>in</strong>g people, yet openm<strong>in</strong>dedness to<strong>in</strong>tegrat<strong>in</strong>g new ideas <strong>an</strong>d different perspectives on realitiy. Neitheracademia nor the labour market of the future is look<strong>in</strong>g for ready-made<strong>an</strong>swers or stereotypes, they are both look<strong>in</strong>g for a mobile yet org<strong>an</strong>isedm<strong>in</strong>d.“ (Prof. Jürgen Köhler, Universität Greifswald).Hier liegt me<strong>in</strong>es Erachtens <strong>die</strong> besondere Ch<strong>an</strong>ce derGeisteswissenschaften: Je weniger berufs(feld)spezifisch e<strong>in</strong> Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gausgerichtet ist, desto mehr k<strong>an</strong>n <strong>und</strong> muss er sich auf den Erwerb vonMethoden konzentrieren, <strong>die</strong> im Ergebnis zu der oben <strong>an</strong>gesprochenengeistigen Beweglichkeit <strong>und</strong> ged<strong>an</strong>klichen Strukturiertheit führen. DerVorschlag der HypoVere<strong>in</strong>sb<strong>an</strong>k für Curricula <strong>in</strong>sbesondere dergeisteswissenschaftlichen Stu<strong>die</strong>ngänge lautet deshalb, folgendeKompetenzen als learn<strong>in</strong>g outcome zu def<strong>in</strong>ieren:• souveräne schriftliche <strong>und</strong> mündliche Ausdrucksfähigkeit• Analysefähigkeit• Reflexionsfähigkeit <strong>und</strong> Wertebewusstse<strong>in</strong>• Urteilskraft auf der Basis von Wertebewusstse<strong>in</strong>, historischen,epistemologischen <strong>und</strong> methodischen Kenntnissen• Kreativität <strong>und</strong> InnovationsfähigkeitDie Integration von <strong>an</strong>wendungsorientierten Lehr- <strong>und</strong> Lernformen sowievon berufsfeldbezogenen Methodentra<strong>in</strong><strong>in</strong>gs müsste im Übrigen auch <strong>in</strong>geisteswissenschaftlichen Stu<strong>die</strong>ngängen e<strong>in</strong>e Selbstverständlichkeit se<strong>in</strong>.Und: "e<strong>in</strong> bisschen Geisteswissenschaften" im S<strong>in</strong>ne der hier aufgeführtenKompetenzen tut auch jedem naturwissenschaftlichen oderbetriebswirtschaftlichen Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>g gut – genauso wie auch jederGeisteswissenschaftler zum Dialog mit Ingenieuren, Naturwissenschaftlernoder Betriebswirten willens <strong>und</strong> fähig se<strong>in</strong> sollte. Nur so können komplexeProblemstellungen, <strong>an</strong> deren Lösung e<strong>in</strong>e g<strong>an</strong>ze Gesellschaft <strong>in</strong>teressiertist, mit Weitsicht <strong>und</strong> nachhaltig gelöst werden.Das KUBUS-Programm zur Berufsorientierung <strong>an</strong> der He<strong>in</strong>rich-He<strong>in</strong>e-Universität Düsseldorf. E<strong>in</strong> KurzporträtDr. Ulrich Welbers, Universität DüsseldorfFür e<strong>in</strong>e bessere Berufsorientierung des Studiums wird zur Zeit im Rahmene<strong>in</strong>er modularen Struktur <strong>an</strong> der Philosophischen Fakultät der He<strong>in</strong>rich-He<strong>in</strong>e-Universität Düsseldorf das Programm KUBUS e<strong>in</strong>gerichtet. Imfolgenden wird das Programm <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>es kurzen Porträts vorgestellt.Zunächst zu den Lehr-/Lernzielen. Diese s<strong>in</strong>d Praxis<strong>in</strong>formation(Informationen über den Arbeitsmarkt für Kultur-, Geistes- <strong>und</strong>Sozialwissenschaftler erhalten), Praxisqualifizierung (Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gs zuberufsrelev<strong>an</strong>ten Qualifikationen absolvieren <strong>und</strong> sich so besserqualifizieren), Praxiserfahrung (Praxis <strong>in</strong> der Form von Jobs, Engagement,Praktika usw. <strong>und</strong> dadurch Realabläufe kennen, verstehen <strong>und</strong> gestaltenlernen) <strong>und</strong> Praxisreflexion (se<strong>in</strong>e biographischen Erfahrungen auf e<strong>in</strong>e<strong>in</strong>dividuelle Karrierepl<strong>an</strong>ung beziehen <strong>und</strong> dafür nutzen können). Bezieht
1542.3.1 Umsetzung des Konzeptes „Fit für den Arbeitsmarkt“2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 155m<strong>an</strong> <strong>die</strong>se Lehr- <strong>und</strong> Lernziele nun auf konkrete Ver<strong>an</strong>staltungs- bzw.Umsetzungsformen, ergibt sich e<strong>in</strong>e Zuordnung, <strong>die</strong> sich <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>esWürfels ver<strong>an</strong>schaulichen lässt (Abb.1).Berufsorientierung: dasKUBUS-ModulDer Würfel:Orientierungsraum für<strong>die</strong> BerufsorientierungPraxis<strong>in</strong>formationLehr- <strong>und</strong> LernzieleRealisation / UmsetzungPraxiserfahrungPraxisfelderPraxisPraxistra<strong>in</strong><strong>in</strong>gPraxisqualifizierungPraxisforumPraxisreflexion21.02.04 © Welbers 2004 6Abbildung 1: Lehr- <strong>und</strong> LernzieleIn <strong>die</strong>sem dreidimensionalen Orientierungsraum, dem Kubus, gehört zumLernziel Praxis<strong>in</strong>formation <strong>die</strong> Ver<strong>an</strong>staltungsform ‚Praxisfelder’. Hierlernen Stu<strong>die</strong>rende zunächst Gr<strong>und</strong>lagen über <strong>die</strong> Beschäftigungsmöglichkeitenvon Kultur-, Geistes- <strong>und</strong> Sozialwissenschaftlern kennen,d<strong>an</strong>n aber mit der Hilfe von Referent<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Referenten vor allem <strong>die</strong>unterschiedlichsten Berufsfelder. Das Praktikum als e<strong>in</strong>e möglichePraxiserfahrung, um <strong>die</strong> sich <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>renden als Praxisübung stets selbstbemühen sollen, dauert d<strong>an</strong>n beispielsweise 4-6 Wochen <strong>und</strong> würde <strong>in</strong>e<strong>in</strong>er weiteren zweistündigen Ver<strong>an</strong>staltung, dem Praxisforum, geme<strong>in</strong>sammit den <strong>an</strong>deren Qualifizierungsaspekten Jobs, Engagement usw. reflektiert<strong>und</strong> ausgewertet. Im Praxisforum, das der Praxisreflexion <strong>die</strong>nt, wäre damite<strong>in</strong> – im weitesten S<strong>in</strong>ne ‚supervisorisches’ – Format gegeben, <strong>in</strong> dem <strong>die</strong>Stu<strong>die</strong>renden <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>en Gruppen beraten werden <strong>und</strong> vor allemvone<strong>in</strong><strong>an</strong>der lernen können. H<strong>in</strong>zu würde e<strong>in</strong> ebenfalls zweistündigesPraxistra<strong>in</strong><strong>in</strong>g treten (z.B. BWL), das <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>renden aus dem Angebotfrei wählen können <strong>und</strong> das das Lernziel Praxisqualifizierung unterstützt.Werden das Praxisfeldersem<strong>in</strong>ar zentral <strong>und</strong> <strong>die</strong> Praxistra<strong>in</strong><strong>in</strong>gs vonprofessionellen Ausbildern aus der freien Wirtschaft durchgeführt, ist dasPraxisforum Angelegenheit der e<strong>in</strong>zelnen Fächer bzw. Stu<strong>die</strong>ngänge, <strong>die</strong>hierfür Praxismoderatoren benennen. Diese Praxismoderatoren müssendafür eigens fortgebildet werden. Ist alles <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Stu<strong>die</strong>njahresabsolviert, erhalten <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>renden e<strong>in</strong> Zertifikat <strong>und</strong> haben darüberh<strong>in</strong>aus das Modul ‚Kultur-, geistes- <strong>und</strong> sozialwissenschaftlicheBerufsorientierung’ im S<strong>in</strong>ne der Stu<strong>die</strong>nordnung abgeschlossen (Abb. 2).Modulstruktur von KUBUS• Angebote von KUBUS +• Integration der Praxis =• Portfolio führt zur ZertifizierungPraxisfelderStu<strong>die</strong>rendenPRAXISPraxisforumPortfolio ZertifizierungPraxistra<strong>in</strong><strong>in</strong>gPraxistra<strong>in</strong><strong>in</strong>gPraxistra<strong>in</strong><strong>in</strong>g21.02.04 © Welbers 2004 7Abbildung 2: ModulstrukturEntscheidend ist hier vor allem der hochschuldidaktischePerspektivwechsel. Während viele Angebote <strong>an</strong> Hochschulen häufigvornehmlich auf <strong>die</strong> – sicherlich s<strong>in</strong>nvolle <strong>und</strong> nötige – Professionalisierungihrer Angebotsstruktur im Berufsqualifizierungs- bzw. Praxisbereich setzen,s<strong>in</strong>d im KUBUS-Modul <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>renden <strong>die</strong> eigentlichen Praktiker: Siesteuern weitgehend ihr eigenes Lernen, aus ihrer Sicht ist dasentsprechende Stu<strong>die</strong>nmodul aufgebaut, ihre Qualifizierungsbiographiebleibt der explizite Maßstab des konkreten Angebotes <strong>in</strong> der <strong>in</strong>dividuellenZusammenstellung; das Modul bietet (‚lediglich’) alles, damit <strong>die</strong>ses<strong>in</strong>dividuelle Engagement möglichst gut gel<strong>in</strong>gen k<strong>an</strong>n. Stichwort der der
1562.3.1 Umsetzung des Konzeptes „Fit für den Arbeitsmarkt“2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 157aktuellen hochschuldidaktischen Diskussion wäre hier der ‚Shift fromTeach<strong>in</strong>g to Learn<strong>in</strong>g’.Das KUBUS-Modul <strong>in</strong> Düsseldorf ist bewusst <strong>in</strong> e<strong>in</strong>emfächerübergreifenden Wahlbereich <strong>an</strong>gesiedelt. Andere Angebote bspw. zuden fachlich-fun<strong>die</strong>rten Schlüsselqualifikationen gibt es je nachBlickrichtung des spezifischen Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>ges entweder auch imFachstudium selbst oder eben als übergreifendes Angebot zum KUBUS-Programm ergänzend. Die Philosophische Fakultät <strong>in</strong> Düsseldorf versuchtbewusst, mit den fächerübergreifenden Angeboten St<strong>an</strong>dortstärkenauszuspielen <strong>und</strong> damit Profilbildung zu betreiben.Teil solcher Profilierung ist auch, dass z.B. für das KUBUS-Modul <strong>Lehre</strong>ndespezifisch fortgebildet werden. Nur so k<strong>an</strong>n e<strong>in</strong> hoher Qualitätsst<strong>an</strong>darddes Stu<strong>die</strong>n<strong>an</strong>gebotes dauerhaft gesichert werden. E<strong>in</strong> eigens entwickelteshochschuldidaktisches Fortbildungsmodul schult daher <strong>Lehre</strong>nde alsPraxismoderatoren. KUBUS qualifiziert für <strong>die</strong> <strong>an</strong>spruchsvolle Aufgabe alsPraxismoderator bzw. als Praxismoderator<strong>in</strong> <strong>in</strong> drei <strong>in</strong>haltlich aufe<strong>in</strong><strong>an</strong>deraufbauenden Schritten: Zunächst ist e<strong>in</strong> zweitägiges hochschuldidaktisches‚Gr<strong>und</strong>lagensem<strong>in</strong>ar <strong>Lehre</strong>n <strong>und</strong> Lernen’ <strong>an</strong> Hochschulen zu absolvieren.E<strong>in</strong>e weitere zweitägige Ver<strong>an</strong>staltung beschäftigt sich d<strong>an</strong>n explizit mitder ‚Berufsorientierung <strong>in</strong> Hochschulstu<strong>die</strong>ngängen’, dem nötigenFachwissen im berufsk<strong>und</strong>lichen Bereich <strong>und</strong> der Fragestellung derUmsetzung <strong>die</strong>ser Aspekte <strong>in</strong> Stu<strong>die</strong>ngängen. Das Fortbildungsprogrammwird komplettiert durch e<strong>in</strong>e ‚Moderierte Intervision’ zuQualifizierungsstrategien. Es ist e<strong>in</strong>e häufige Erfahrung, dass Lehr-/Lernformen vor allem auch d<strong>an</strong>n gut von <strong>Lehre</strong>nden umgesetzt werdenkönnen, wenn sie <strong>die</strong>se e<strong>in</strong>mal für sich selbst erlebt haben. Daher soll <strong>in</strong>e<strong>in</strong>em Semester e<strong>in</strong>e Ver<strong>an</strong>staltung zu Qualifizierungsstrategien derPraxismoderator<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Praxismoderatoren durchgeführt werden. Dasso gewonnene Know-how, das unter qualifizierter Anleitung erworbenwird, k<strong>an</strong>n d<strong>an</strong>n im Praxisforum für <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>renden produktiv e<strong>in</strong>gesetztwerden. Am Ende des Ausbildungsprogramms, das auf drei Semesterverteilt ist, erwerben <strong>die</strong> Praxismoderator<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> -moderatoren dasZertifikat ‚Praxismoderation im Fachbereich’ (Abb. 3).Fortbildung <strong>in</strong> KUBUS... qualifiziert für e<strong>in</strong>e <strong>an</strong>spruchsvolle Aufgabe <strong>in</strong> drei<strong>in</strong>haltlich aufe<strong>in</strong><strong>an</strong>der aufbauenden Schritten:<strong>Lehre</strong>n <strong>und</strong>Lernen <strong>an</strong>HochschulenBerufsorientierung<strong>in</strong> Hochschulstu<strong>die</strong>ngängenModerierteIntervision zuQualifizierungsstrategienPraxismoderation im FachbereichPraxismoderatoren werden so gezielt auf ihre neuen.Aufgaben <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em speziell entwickeltenHochschuldidaktischen Fortbildungsmodul vorbereitet.11.01.2005 © Welbers 2005 19Abbildung 3: Fortbildung für <strong>die</strong> PraxismoderationDas Programm ist mit entsprechenden Materialien ausführlich dargestellt<strong>in</strong> Welbers, Ulrich: „Das KUBUS-Programm: Berufsorientierung <strong>in</strong> denKultur-, Geistes- <strong>und</strong> Sozialwissenschaften“. In: Verf. (Hrsg.):Vermittlungswissenschaften. Wissenschaftsverständnis <strong>und</strong>Curriculumentwicklung. Düsseldorf 2003, S. 178-207. Information zumkonkreten Semester<strong>an</strong>gebot f<strong>in</strong>den sich unter: www.phil-fak.uniduesseldorf.de/studium/kubus/ueber-das-kubus-programm/
1582.3.1 Umsetzung des Konzeptes „Fit für den Arbeitsmarkt“2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 159Zusammenfassung AG 1: Wie k<strong>an</strong>n e<strong>in</strong> Konzept „Fit für denArbeitsmarkt“ <strong>in</strong> den Fächerkulturen umgesetzt werden?Dr. Volkmar L<strong>an</strong>ger, Berufsakademie Weserbergl<strong>an</strong>d, HamelnE<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> <strong>die</strong> ThematikBei der Umsetzung des Bologna-Prozesses gew<strong>in</strong>nt mit der Anforderung,dass <strong>Bachelor</strong>-Stu<strong>die</strong>ngänge berufsqualifizierend se<strong>in</strong> sollen, <strong>die</strong>berufsrelev<strong>an</strong>te Kompetenzentwicklung zunehmend <strong>an</strong> Bedeutung. Dabeigeht es aus Sicht der Wirtschaft <strong>in</strong> vielen Fällen neben der Fachkompetenzum überfachliche Kompetenzen, während <strong>die</strong> Hochschulen sich für ihreLehr-/Lernkonzepte überlegen müssen, wie e<strong>in</strong>e wohldef<strong>in</strong>ierte Bal<strong>an</strong>cezwischen Fachwissen <strong>und</strong> überfachlichem Wissen <strong>in</strong> den gr<strong>und</strong>ständigenStu<strong>die</strong>nprogrammen von 6 - 7 Semestern zu vermitteln ist.In der Arbeitsgruppe sollte dabei über das breite Spektrum derFächerkulturen h<strong>in</strong>weg diskutiert werden. Im Vordergr<strong>und</strong> st<strong>an</strong>den zumBeispiel Fragen wie: Was k<strong>an</strong>n über <strong>die</strong> Fächerkulturen für alle alsberufsrelev<strong>an</strong>t def<strong>in</strong>iert werden? Sollen überfachliche Kompetenzen<strong>in</strong>tegrativ oder separat gelernt werden? Wie sehen Lehr-/Lernszenarien aus,<strong>die</strong> berufsqualifizierende Kompetenzen fördern? Was können Hochschulenvon dem Beschäftigungssystem lernen? Warum werden <strong>an</strong> denHochschulen ke<strong>in</strong>e Instrumente zur Potenzial<strong>an</strong>alyse(Kompetenzmessungen) e<strong>in</strong>gesetzt, wie zum Beispiel bei der Auswahl vongeeigneten Mitarbeitern? Wie können Brücken zwischen Hochschule <strong>und</strong>Beschäftigungssystem entstehen?<strong>Anforderungen</strong> aus der WirtschaftAn zwei Beispielen aus der Wirtschaft, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,der KPMG Deutsche Treuh<strong>an</strong>d-Gesellschaft <strong>und</strong> der HypoVere<strong>in</strong>sb<strong>an</strong>k,UniCredit Group wurden <strong>Anforderungen</strong> <strong>und</strong> Erwartungen <strong>an</strong>Hochschulabsolventen aus Sicht von Personalentwicklern beschrieben.Aus den <strong>Anforderungen</strong> ihrer M<strong>an</strong>d<strong>an</strong>ten def<strong>in</strong>iert <strong>die</strong> KPMG ihre<strong>Anforderungen</strong> <strong>an</strong> Hochschulabsolventen. Im Zentrum steht dabei e<strong>in</strong>esolide Basis <strong>an</strong> Fachwissen, <strong>die</strong> durch gezielte Weiterbildung durch dasUnternehmen gefördert werden k<strong>an</strong>n. Das Anforderungsportfolio desUnternehmens be<strong>in</strong>haltet neben der Fachkompetenz unter <strong>an</strong>derenfolgende überfachliche Kompetenzen:• Problemlösungskompetenz• unternehmerisches Denken• Br<strong>an</strong>chenkenntnisse• Fremdsprachenkenntnisse• außerberufliche Interessen• Bereitschaft für <strong>Neue</strong>sProblemlösungskompetenz <strong>und</strong> unternehmerisches Denken s<strong>in</strong>dbr<strong>an</strong>chenübergreifende <strong>Anforderungen</strong> <strong>an</strong> Absolventen, <strong>die</strong> <strong>in</strong> derWirtschaft Fuß fassen möchten. Die Br<strong>an</strong>chenkenntnisse s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Regelso speziell, dass hier <strong>die</strong> Empfehlung ausgesprochen wird, sich möglichstim Rahmen e<strong>in</strong>es Praktikums mit den Br<strong>an</strong>chenspezifika zu befassen. ImBereich der Fremdsprachenkompetenz wird e<strong>in</strong>e solide Basis erwartet, dasBeherrschen von Fachterm<strong>in</strong>i k<strong>an</strong>n über <strong>die</strong> betriebliche Weiterbildungausgebaut werden.Im Bereich der K<strong>und</strong>enbetreuung s<strong>in</strong>d außerberufliche Interessen vongroßem Wert, denn <strong>in</strong> K<strong>und</strong>engesprächen geht es häufig darum, e<strong>in</strong>eförderliche, menschliche Gesprächsatmosphäre zu pflegen. Im Gegensatzdazu ist der re<strong>in</strong>e „Fachidiot“ nicht gefragt. Unter der „Bereitschaft für<strong>Neue</strong>s“ wird <strong>die</strong> Motivation zur persönlichen Weiterentwicklung <strong>und</strong> damitzum lebensl<strong>an</strong>gen Lernen verst<strong>an</strong>den. Weiterh<strong>in</strong> ist das Interesse <strong>an</strong>Interdiszipl<strong>in</strong>arität gefordert.Bei den E<strong>in</strong>stellungsgesprächen spielt darüber h<strong>in</strong>aus <strong>die</strong> Persönlichkeit<strong>und</strong> das Erfahrungswissen e<strong>in</strong>e entscheidende Rolle. Die KPMG hat zurzeitbei der Mehrzahl der E<strong>in</strong>stellungen <strong>Bachelor</strong>-Absolventen im Blick. Im<strong>Master</strong>bereich existiert e<strong>in</strong> Dialog zur Entwicklung geeigneter Programmemit verschiedenen Hochschulen. Insgesamt wird für <strong>die</strong> nächsten Jahre beider KPMG e<strong>in</strong> hoher Personalbedarf prognostiziert, das heißt, für <strong>die</strong>KPMG hat der „war for talents“ bereits begonnen.In großen Konzernen wie zum Beispiel der UniCredit Group, zu der auch<strong>die</strong> HypoVere<strong>in</strong>sb<strong>an</strong>k gehört, werden zur Vere<strong>in</strong>heitlichung derPersonalentwicklungsmaßnahmen verschiedene Instrumente derPersönlichkeits<strong>an</strong>alyse bereits im Rekrut<strong>in</strong>g <strong>und</strong> für <strong>die</strong>Personalentwicklung e<strong>in</strong>gesetzt.Zur E<strong>in</strong>ordnung der Profile von Hochschulabsolventen wurde beispielsweisee<strong>in</strong> Employability-Index („E-Index“) als Rat<strong>in</strong>g-Raster für e<strong>in</strong>en Auswahl-
1602.3.1 Umsetzung des Konzeptes „Fit für den Arbeitsmarkt“2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 161oder Entwicklungsprozess e<strong>in</strong>geführt. Ebenso wie bei dem Beispiel derKPMG gibt es neben der re<strong>in</strong>en Fachkompetenz, <strong>die</strong> über sogen<strong>an</strong>nte„Academic Credits“ bewertet wird, <strong>die</strong> außerfachlichen Kompetenzen, <strong>die</strong>über „Professional Credits“ bewertet werden. Ziel ist es mit Hilfe des E-Index e<strong>in</strong>fach <strong>und</strong> nachvollziehbar h<strong>in</strong>ter das Abschluss-Label (Diplom,<strong>Bachelor</strong> usw.) zu schauen. Damit soll <strong>die</strong> Passung zwischenBewerberqualifikation <strong>und</strong> Anforderungsprofil nach <strong>in</strong>haltlichen Kriterienbeurteilt werden, unabhängig von re<strong>in</strong> formalen Parametern.Zur Beurteilung der nichtfachlichen Kompetenzen wird <strong>die</strong> Berufsfeldrelev<strong>an</strong>tePraxis, <strong>die</strong> Dauer e<strong>in</strong>es Ausl<strong>an</strong>dsaufenthaltes sowie <strong>die</strong>Methoden- <strong>und</strong> Sozialkompetenz mit entsprechenden Credits bewertet. DieAuswertung erfolgt über e<strong>in</strong>e Anforderungsmatrix mit denBasiskomponenten „Vertriebstalent“, „Praxiserfahrung“ <strong>und</strong>„Analysefähigkeit“. Diese drei Basiskomponenten gehören zw<strong>in</strong>gend zumAnforderungsprofil aller Vertriebsdivisionen. Dazu kommen für <strong>die</strong>verschiedenen Geschäftsbereiche weitere spezifische <strong>Anforderungen</strong>. ZumBeispiel im Bereich von „Privat- <strong>und</strong> Geschäftsk<strong>und</strong>en“ e<strong>in</strong> sicheres,gew<strong>an</strong>dtes Auftreten <strong>und</strong> Führungspotenzial oder im Bereich „Markets &Investment B<strong>an</strong>k<strong>in</strong>g“ <strong>in</strong>ternationale Erfahrung <strong>und</strong> sehr gutes Englisch.Um <strong>die</strong>se <strong>Anforderungen</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> Hochschulausbildung zu übertragen, wurdegeme<strong>in</strong>sam mit der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der KUEichstätt-Ingolstadt e<strong>in</strong> berufs<strong>in</strong>tegrierender <strong>Bachelor</strong>stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>g„F<strong>in</strong><strong>an</strong>z<strong>die</strong>nstleistungsm<strong>an</strong>agement“ entwickelt. Die Integration vonpraxisorientierten Lehr- <strong>und</strong> Lernformen ist dabei e<strong>in</strong>eSelbstverständlichkeit. Durch das berufs<strong>in</strong>tegrierende Konzept s<strong>in</strong>dStudium <strong>und</strong> Beruf optimal aufe<strong>in</strong><strong>an</strong>der abgestimmt.Umsetzung <strong>in</strong> den HochschulenEbenfalls <strong>an</strong>h<strong>an</strong>d zweier Beispiele aus dem Hochschulbereich wurdenunterschiedliche Modelle zur Förderung berufsrelev<strong>an</strong>ter Kompetenzendargestellt: Zum ersten der <strong>in</strong>tegrative Erwerb von Schlüsselqualifikationenim Konzept der Jacobs University Bremen. Das zweite Beispiel stammt ausdem Programm zur Berufsorientierung <strong>in</strong> den Kultur-, Geistes- <strong>und</strong>Sozialwissenschaften der Philosophischen Fakultät der He<strong>in</strong>rich-He<strong>in</strong>e-Universität Düsseldorf.An der 1999 gegründeten Jacobs University wird auf <strong>in</strong>tegrativeVermittlung von Schlüsselqualifikationen gesetzt. So f<strong>in</strong>det im erstenStu<strong>die</strong>njahr im Bereich der Geistes- <strong>und</strong> Sozialwissenschaften ke<strong>in</strong>eDifferenzierung nach Fächerkulturen statt.Alle Stu<strong>die</strong>rende müssen <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äre Kurse belegen, <strong>an</strong>gef<strong>an</strong>gen mitThemenfeld wissenschaftliches Arbeiten, gefolgt von Vorträgen <strong>und</strong>Sem<strong>in</strong>aren über <strong>die</strong> Methoden der empirischen Forschung, Statistik,vergleichende Forschung, bis h<strong>in</strong> zu Kultur, Geschichte <strong>und</strong> Wirtschaft.D<strong>an</strong>eben werden zusätzlich etwa 20 % praxisrelev<strong>an</strong>te Ver<strong>an</strong>staltungen,zum Beispiel IT-Kurse, <strong>in</strong> das Curriculum <strong>in</strong>tegriert. SämtlicheLehrver<strong>an</strong>staltungen f<strong>in</strong>den <strong>in</strong> Englisch statt. Die Jacobs University hate<strong>in</strong>en sehr hohen Grad <strong>an</strong> Internationalisierung mit Stu<strong>die</strong>renden aus über90 Nationen.Das Konzept setzt <strong>in</strong>tensive Betreuung <strong>und</strong> Beratung <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>en Lehr-/Lerngruppenvoraus. Für <strong>die</strong> etwa 1100 Stu<strong>die</strong>renden s<strong>in</strong>d zurzeit 100Professoren <strong>und</strong> darüber h<strong>in</strong>aus ungefähr 180 wissenschaftlicheMitarbeiter zuständig, was e<strong>in</strong>e besonders gute Betreuungsrelation <strong>in</strong> derdeutschen Hochschull<strong>an</strong>dschaft darstellt. Die Sozialkompetenz derStu<strong>die</strong>renden wird <strong>an</strong> der Jacobs University über <strong>die</strong> traditionelleCampusidee besonders gefördert, das heißt, geme<strong>in</strong>sam lernen, wohnen<strong>und</strong> leben.An der Philosophischen Fakultät der He<strong>in</strong>rich-He<strong>in</strong>e-Universität Düsseldorfwurde für möglichst viele kultur-, geistes- <strong>und</strong> sozialwissenschaftlicheStu<strong>die</strong>ngänge e<strong>in</strong> Stu<strong>die</strong>nmodul mit der Bezeichnung KUBUS(Berufsorientierung <strong>in</strong> den Kultur-, Geistes- <strong>und</strong> Sozialwissenschaften)entwickelt, das <strong>die</strong> Praxisorientierung des Studiums unter demberufsqualifizierenden bzw. berufsorientierenden Aspekt fördert.Das KUBUS-Programm verfolgt vier primäre Lernziele: Als erstes sollen <strong>die</strong>Stu<strong>die</strong>renden möglichst gut über Struktur, Ch<strong>an</strong>cen <strong>und</strong>Beschäftigungsfelder des Arbeitsmarktes <strong>in</strong>formiert werden(Praxis<strong>in</strong>formation), so dass sie nach Abschluss des Moduls <strong>die</strong>notwendigen Kenntnisse <strong>und</strong> E<strong>in</strong>sichten gewonnen haben, um <strong>die</strong>Voraussetzungen ihres zukünftigen Berufsweges möglichst realistische<strong>in</strong>schätzen zu können.Als zweites Lernziel sollen <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>renden sich zu den im Studiumerworbenen Qualifikationen weitere berufsrelev<strong>an</strong>te Kenntnisse <strong>und</strong>Fertigkeiten <strong>an</strong>eignen (Praxisqualifizierung), zum Beispiel mit Hilfe e<strong>in</strong>erVer<strong>an</strong>staltung „BWL für Geisteswissenschaftler“.
1622.3.1 Umsetzung des Konzeptes „Fit für den Arbeitsmarkt“2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 163Darüber h<strong>in</strong>aus brauchen Stu<strong>die</strong>rende konkrete Praxiserfahrung, um ihrVerhalten, ihre Rolle <strong>und</strong> auch ihre Ch<strong>an</strong>cen im Arbeitsprozess besserbeurteilen zu können. Eigene Praxiserfahrungen sammeln, also Praxiskonkret <strong>an</strong>zugehen, ist daher der dritte Best<strong>an</strong>dteil des KUBUS-Programms.Als viertes Lernziel ist <strong>die</strong> Berufs- bzw. Praxisreflexion fest ver<strong>an</strong>kertworden. Die Bedeutung e<strong>in</strong>er zielgerichteten Reflexionsmöglichkeit imH<strong>in</strong>blick auf Berufsorientierung <strong>und</strong> Berufsqualifizierung hat <strong>in</strong> den letztenJahren stark zugenommen. Das KUBUS-Programm will auf <strong>die</strong>seEntwicklung reagieren <strong>und</strong> hat daher Praxisreflexion zu e<strong>in</strong>em zentralenAnliegen <strong>in</strong>nerhalb des Programmkonzepts gemacht.In der konkreten Umsetzung bedeutet <strong>die</strong>ses Programm e<strong>in</strong>e weitereProfessionalisierung der <strong>Lehre</strong>. Hier m<strong>an</strong>ifestiert sich derParadigmenwechsel <strong>in</strong> besonderer Form. Der Lerner gehört <strong>in</strong> denMittelpunkt des Geschehens. So wird das Lehr- <strong>und</strong> LernzielPraxis<strong>in</strong>formation wird im wesentlichen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Ver<strong>an</strong>staltung mit demTitel „Praxisfelder“ umgesetzt, e<strong>in</strong>e zusätzliche Praxisqualifizierung soll <strong>in</strong>spezifischen „Praxistra<strong>in</strong><strong>in</strong>gs“ ermöglicht werden. Praxiserfahrung k<strong>an</strong>n nur<strong>in</strong> der Praxis selbst erlebt beziehungsweise gesammelt werden, das heißt,<strong>an</strong> <strong>die</strong>sem Punkt f<strong>in</strong>det also <strong>die</strong> konkrete Praxis<strong>an</strong>b<strong>in</strong>dung des Moduls <strong>in</strong>Form von Praktika statt. Die abschließende Praxisreflexion wird <strong>in</strong> e<strong>in</strong>erVer<strong>an</strong>staltungsform mit dem Titel „Praxisforum“ umgesetzt <strong>und</strong> erfordertvon den Hochschullehrern <strong>die</strong> Kompetenz der „Praxismoderation“.Um <strong>die</strong> besonderen <strong>Anforderungen</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong>sem praxis<strong>in</strong>tegrierendenStu<strong>die</strong>nmodul erfüllen zu können, wird für <strong>die</strong> beteiligten Hochschullehrere<strong>in</strong> spezielles hochschuldidaktisches Fortbildungsmodul „Praxismoderationim Studium“ <strong>an</strong>geboten. Die Umsetzung <strong>die</strong>ses best-practice-Beispielserfordert von allen Beteiligten e<strong>in</strong> Umdenken mit dem Blick über deneigenen Tellerr<strong>an</strong>d <strong>und</strong> der konstruktiven Zusammenarbeit mit der Praxis.FazitDie Hochschulen müssen verstärkt überfachliche <strong>und</strong> berufsrelev<strong>an</strong>teKompetenzen <strong>in</strong> den Curricula ihrer gr<strong>und</strong>ständigen <strong>Bachelor</strong>stu<strong>die</strong>ngängeberücksichtigen, um <strong>in</strong> Zukunft <strong>die</strong> geforderte Berufsqualifizierung ihrerAbsolventen zu erreichen. Synergien aus der kooperativen Zusammenarbeitzwischen Hochschulen <strong>und</strong> Vertretern aus verschiedenenBeschäftigungsfeldern ergeben sich für beide Seiten. Hochschulen f<strong>in</strong>denUnternehmen für praxis<strong>in</strong>tegrierende Stu<strong>die</strong>nmodule <strong>und</strong> kompetentePartner zur Reflexion berufsqualifizierender Kompetenzen. Während <strong>die</strong>potenziellen Arbeitgeber das neue modulare Stu<strong>die</strong>nsystem, das ECTS <strong>und</strong>das Diploma-Supplement verstehen <strong>und</strong> nutzen lernen können. Darüberh<strong>in</strong>aus fließen Impulse aus dem Beschäftigungssystem zu berufsrelev<strong>an</strong>ten<strong>Anforderungen</strong> <strong>in</strong> <strong>die</strong> Lehr-/Lernprozesse der Hochschulen e<strong>in</strong>.In jedem Fall besteht für beide Seiten <strong>die</strong> Herausforderung zum Dialog.Denn der stetige W<strong>an</strong>del der <strong>Anforderungen</strong> heutiger <strong>und</strong> zukünftigerBerufsfelder verl<strong>an</strong>gt auch künftig kont<strong>in</strong>uierlichen Austausch zwischenden Hochschulen <strong>und</strong> dem Beschäftigungssystem. Das Bologna-Zentrumder HRK fungiert hierbei als ideale Kommunikationsbrücke zwischenHochschule <strong>und</strong> Wirtschaft.2.3.2 Arbeitsgruppe 2: Die Promotion als erste forschendeBerufstätigkeit?Employability - Die Promotion als erste forschende BerufstätigkeitDr. Hubert Detmer, Deutscher Hochschulverb<strong>an</strong>dWissenschaft ist nach wie vor e<strong>in</strong>e risk<strong>an</strong>te Berufskarriere. Dies verdeutlichtauch e<strong>in</strong> Blick <strong>in</strong> den B<strong>und</strong>esbericht zur Förderung des wissenschaftlichenNachwuchses (BuBiM).Zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> den meisten Fächern ist der erfolgreiche Abschluss derPromotionsphase e<strong>in</strong>e conditio s<strong>in</strong>e qua non für e<strong>in</strong>e wissenschaftlicheKarriere. Im <strong>in</strong>ternationalen Vergleich liegt Deutschl<strong>an</strong>d mit e<strong>in</strong>emÜberg<strong>an</strong>g der Absolventen e<strong>in</strong>es Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gs zur Promotion <strong>in</strong> Höhe von14,2 % auf e<strong>in</strong>er Spitzenposition. Trotz e<strong>in</strong>iger Ungereimtheiten dervorliegenden Zahlenwerke k<strong>an</strong>n im H<strong>in</strong>blick auf <strong>die</strong> Frage, wie <strong>in</strong>Deutschl<strong>an</strong>d promoviert wird, davon ausgeg<strong>an</strong>gen werden, dass ca. 60 %aller Doktor<strong>an</strong>den <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Beschäftigungsverhältnis zu e<strong>in</strong>er Universitätoder zu e<strong>in</strong>er universitären Forschungse<strong>in</strong>richtung stehen. Die restlichen
1642.3.2 Die Promotion als erste forschende Berufstätigkeit2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 16540 % verteilen sich relativ gleichberechtigt auf Stipen<strong>die</strong>n oder denSonderfall der sog. externen Promotion.Aktuelle Doktor<strong>an</strong>den-Befragungen haben ergeben, dass seitens derNachwuchswissenschaftler <strong>die</strong> Beratung <strong>und</strong> Betreuung während derPromotionsphase – <strong>in</strong>sbesondere durch Universitätsprofessoren – nicht nurals <strong>an</strong>gemessen, sondern <strong>in</strong>sgesamt als zufriedenstellend beurteilt wird.Die hier näher zu untersuchende Frage, ob <strong>die</strong> Promotionsphase e<strong>in</strong>eFortsetzung des Studiums oder aber doch e<strong>in</strong>e erste forschendeBerufstätigkeit ist, hängt mit der normativ vorgegebenen Def<strong>in</strong>itionzusammen, welchen Zweck <strong>die</strong> Promotion verfolgt. Analysiert m<strong>an</strong> <strong>in</strong><strong>die</strong>sem Zusammenh<strong>an</strong>g <strong>in</strong>sbesondere <strong>die</strong> Hochschulgesetze der Länder<strong>und</strong> <strong>die</strong> Promotionsordnungen der Universitäten, so wird regelmäßigdarauf abgestellt, dass durch <strong>die</strong> Promotion <strong>die</strong> Fähigkeit zur vertieftenwissenschaftlichen Arbeit am Beispiel der Bearbeitung e<strong>in</strong>esSpezialgebietes nachgewiesen werden soll. Schon <strong>in</strong>folge der juristischenVorgabe der Selbständigkeit h<strong>an</strong>delt es sich also um e<strong>in</strong>e erste –weisungsfreie – forschende Berufstätigkeit. Dies entspricht jedenfalls demIdealfall.Das Kernelement jeder Promotionsphase ist <strong>die</strong> Dissertation. Bei derDissertation h<strong>an</strong>delt es sich um e<strong>in</strong>e wissenschaftliche Forschungsarbeit,<strong>die</strong> eigenständige, auf neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen basierendeForschungsleistungen dokumentieren soll.Ist das Promotionsverfahren erfolgreich abgeschlossen, so entfaltet <strong>die</strong>Promotion für den öffentlichen Sektor (<strong>in</strong>sbesondere, aber beileibe nichtnur: <strong>die</strong> Universitäten) <strong>die</strong> Funktion e<strong>in</strong>er Regele<strong>in</strong>stellungsvoraussetzungfür wissenschaftliche Karrieren im engeren S<strong>in</strong>ne. Damit ist ihr Zweck abernur unzureichend erfasst. Unbestritten ist des weiteren, dass <strong>die</strong> Promotionauch außerhalb des öffentlichen Sektors höhere E<strong>in</strong>stiegsgehälter <strong>und</strong><strong>an</strong>dere (bessere) Karrierech<strong>an</strong>cen vermittelt. Durch <strong>die</strong> Hochschulprüfung„Promotion“ steigert sich regelmäßig der „Marktwert“ des Bewerbers.Festzuhalten bleibt, dass <strong>die</strong> Promotion mith<strong>in</strong> mehrere Funktionen erfüllt.Betrachtet m<strong>an</strong> <strong>die</strong> normativen Vorgaben, so ist darüber h<strong>in</strong>aus zukonstatieren, dass es sich bei der Promotion aber nicht nur im Idealfall ume<strong>in</strong>e erste forschende Berufstätigkeit h<strong>an</strong>delt, sondern auch um e<strong>in</strong>enprüfungsrechtlichen Vorg<strong>an</strong>g, der juristisch als zentrale Hochschulprüfungdem formellen <strong>und</strong> materiellen Prüfungsrecht unterliegen.Promotionskulturen: Für <strong>die</strong> gegenwärtig eng mit dem Bologna-Prozessverknüpfte hochschulpolitische Diskussion, wie <strong>die</strong> Promotionsphaseidealtypisch auszugestalten se<strong>in</strong> sollte, ist von besonderer Wichtigkeit, sichüber geographische Grenzen h<strong>in</strong>weg zu vergegenwärtigen, welchetatsächlichen Promotionskulturen es gibt. In der Realität wird hierbei e<strong>in</strong>eunendliche Modellvielfalt vorgef<strong>und</strong>en. Diese Modellvielfalt ist nichtgewohnheitsrechtlich oder gar unreflektiert entst<strong>an</strong>den, sondern hängtstark mit den wissenschafts- <strong>und</strong> forschungsimm<strong>an</strong>enten Aspekten derjeweiligen Fachdiszipl<strong>in</strong>en zusammen. So realisiert sich (nicht nur <strong>in</strong>Deutschl<strong>an</strong>d) <strong>die</strong> Promotionsphase <strong>in</strong> den geisteswissenschaftlichenFächern regelmäßig <strong>an</strong>ders als <strong>in</strong> naturwissenschaftlichen Arbeitsgruppen.In der Mediz<strong>in</strong> wiederum ist aufgr<strong>und</strong> der ärztlichen Ausbildung <strong>die</strong>Promotion zeitlich vorverlagert. Infolge der mit den fachlichen<strong>Anforderungen</strong> zusammenhängender <strong>an</strong>dersartigen Berufskarrieren stelltauch <strong>die</strong> Promotionsphase zum „Dr.-Ing.“ e<strong>in</strong>en realiter sich deutlich von<strong>an</strong>deren Promotionskulturen abhebenden Sonderfall dar.E<strong>in</strong>ige bek<strong>an</strong>nte Beispiele: Während der Jurist <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Promotionsphaseregelmäßig nicht auf e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>bettung <strong>in</strong> f<strong>in</strong><strong>an</strong>ziell gut ausgestatteteDrittmittelprojekte <strong>und</strong> auf aufwendige Datenerhebungen <strong>an</strong>gewiesen ist<strong>und</strong> mith<strong>in</strong> <strong>die</strong> Promotionsphase weitestgehend alle<strong>in</strong> bestreitet, ist denNaturwissenschaften <strong>die</strong> Verknüpfung zwischen forschender Tätigkeit <strong>in</strong>Arbeitsgruppen <strong>und</strong> der Erarbeitung unterschiedlicher Promotionsprojekteimm<strong>an</strong>ent. Der <strong>an</strong>gehende „Dr.-Ing.“ wird <strong>in</strong> der Promotionsphase, was imübrigen mit dem Selbstverständnis der <strong>in</strong>genieurwissenschaftlichenFakultätentage übere<strong>in</strong>stimmt, auch durch <strong>die</strong> Projektbezogenheit se<strong>in</strong>erArbeit <strong>und</strong> se<strong>in</strong>er gleichzeitigen E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung im Institut (Lehrstuhl) aufOrg<strong>an</strong>isations- <strong>und</strong> Führungsver<strong>an</strong>twortung <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em ersten <strong>in</strong>dustriellenArbeitsumfeld vorbereitet.
1662.3.2 Die Promotion als erste forschende Berufstätigkeit2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 167Die Unterschiedlichkeit der tief <strong>in</strong> der jeweiligen Diszipl<strong>in</strong> verwurzeltenVoraussetzungen s<strong>in</strong>d letztlich auch entscheidend dafür, ob e<strong>in</strong>e Promotionextern oder <strong>in</strong>tern, ob sie <strong>in</strong> Teilzeit oder im Zusammenh<strong>an</strong>g mit e<strong>in</strong>erhauptberuflichen Tätigkeit realisiert wird resp. realisiert werden muss.Insoweit dürfen Graduiertenkollegs u. ä. nicht verpflichtend se<strong>in</strong>. Dieexterne Promotion muss nach wie vor möglich se<strong>in</strong>.Auch <strong>die</strong> Intentionen der Doktor<strong>an</strong>den s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> <strong>die</strong>sem Zusammenh<strong>an</strong>g zuberücksichtigen. Wer ke<strong>in</strong>e wissenschaftliche Karriere <strong>an</strong>strebt <strong>und</strong> sichggf. darüber h<strong>in</strong>aus <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er ersten beruflichen Phase bef<strong>in</strong>det, wird <strong>die</strong>externe Promotion <strong>an</strong>streben. Demgegenüber bereitet <strong>die</strong> E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung desDoktor<strong>an</strong>den <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Lehrstuhl – wenn e<strong>in</strong>e wissenschaftliche Karriere <strong>an</strong>e<strong>in</strong>er Universität oder außeruniversitären Forschungse<strong>in</strong>richtung <strong>in</strong>ten<strong>die</strong>rtist – auf den dort vorgef<strong>und</strong>enen Alltag vor.Rechtliche Rahmenbed<strong>in</strong>gungen: Wie bereits dargelegt, realisiert sichder S<strong>in</strong>n <strong>und</strong> Zweck der Promotion <strong>in</strong> normativer H<strong>in</strong>sicht zum ersten alsElement der E<strong>in</strong>stellungsvoraussetzungen als Juniorprofessor oderProfessor, zum zweiten als Nachweis e<strong>in</strong>er besonderen –wissenschaftlichen– Qualifikation <strong>und</strong> zum dritten – aus Sicht der Prüfer <strong>und</strong> des Prüfl<strong>in</strong>gszugleich – als Hochschulprüfung. Dabei ist das ius promovendi, mith<strong>in</strong> das<strong>in</strong>stitutionelle Promotionsrecht, bis zum heutigen Tage den Universitätenvorbehalten. Im Rahmen ihrer Satzungsautonomie regeln <strong>die</strong> Universitätenresp. ihre Fakultäten <strong>in</strong> Promotionsordnungen <strong>die</strong> Ausgestaltung desPromotionsrechts.Die <strong>in</strong>soweit außerordentlich unterschiedlich ausgestaltetenPromotionsphasen s<strong>in</strong>d im Detail verbesserungswürdig <strong>und</strong> auch –fähig.Wenngleich gr<strong>und</strong>sätzlich der persönlichen Förderung <strong>an</strong>stelle e<strong>in</strong>erentpersonalisierten Zuweisung des Doktor<strong>an</strong>den <strong>an</strong> e<strong>in</strong>er Fakultät Vorzugzu geben ist, muss jedoch (gerade gegenüber der promovierendenFakultät) der Status des Doktor<strong>an</strong>den zu Beg<strong>in</strong>n des Verfahrens (nebense<strong>in</strong>er etwaigen Immatrikulation) dokumentiert werden. E<strong>in</strong>e solcheDokumentation muss gegenüber den Doktor<strong>an</strong>den e<strong>in</strong>e „Gar<strong>an</strong>tenstellung“der promovierenden Fakultät erzeugen.Insbesondere sollten zu Beg<strong>in</strong>n des dokumentiertenBetreuungsverhältnisses <strong>die</strong> Prozesse <strong>und</strong> Ver<strong>an</strong>twortlichkeiten möglichstschriftlich <strong>und</strong> verb<strong>in</strong>dlich geklärt werden. Schließlich ist der Aspekt derQualitätspflege <strong>in</strong> den universitären Promotionsordnungen normativ zuklären. Hierzu gehören u. a. Fragen wissenschaftlicher Redlichkeit,kont<strong>in</strong>uierliche Absprachen <strong>und</strong> verfahrensrechtliche Fristen.Vor <strong>die</strong>sem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> <strong>in</strong>ten<strong>die</strong>rt der Deutsche Hochschulverb<strong>an</strong>d,geme<strong>in</strong>sam mit dem Doktor<strong>an</strong>dennetzwerk „Thesis“ e<strong>in</strong> Best Practice-Papier zur Promotion zu erstellen.Politische Petita: Im europäischen Hochschulraum wird e<strong>in</strong> monolitischesPromotionsmodell nicht favorisiert. Vielmehr heißt es im LondonerKommunique:“Wir s<strong>in</strong>d uns des Werts der Entwicklung <strong>und</strong> Erhaltung e<strong>in</strong>er breitenVielfalt <strong>an</strong> Promotionswegen bewusst, <strong>die</strong> auf den übergreifendenQualifikationsrahmen für den EHR Bezug nehmen, wobei e<strong>in</strong>eÜberregulierung zu vermeiden ist. Gleichzeitig würdigen wir, dass <strong>die</strong>Verbesserung von Angeboten im dritten Zyklus <strong>und</strong> <strong>die</strong> Verbesserung desStatus, der Berufsaussichten <strong>und</strong> der F<strong>in</strong><strong>an</strong>zierung für denwissenschaftlichen Nachwuchs wesentliche Voraussetzungen dafür s<strong>in</strong>d,Europas Ziele des Ausbaus se<strong>in</strong>er Forschungskapazitäten <strong>und</strong> derVerbesserung der Qualität <strong>und</strong> Wettbewerbsfähigkeit se<strong>in</strong>erHochschulbildung zu erfüllen.Wir fordern daher <strong>die</strong> Hochschulen auf, ihre Anstrengungen zurVer<strong>an</strong>kerung der Promotion <strong>in</strong> ihren Strategien <strong>und</strong> Leitl<strong>in</strong>ien zu verstärken<strong>und</strong> geeignete Berufswege <strong>und</strong> Möglichkeiten für Doktor<strong>an</strong>d<strong>in</strong>nen <strong>und</strong>Doktor<strong>an</strong>den <strong>und</strong> wissenschaftlichen Nachwuchs zu entwickeln.Wir fordern <strong>die</strong> EUA auf, ihre Unterstützung für den Erfahrungsaustauschzwischen den Hochschulen über <strong>die</strong> sich <strong>in</strong> Europa entwickelnden<strong>in</strong>novativen Promotionswege sowie über <strong>an</strong>dere entscheidende Fragen wietr<strong>an</strong>sparente Zug<strong>an</strong>gsbed<strong>in</strong>gungen, Betreuung <strong>und</strong> Begutachtung, <strong>die</strong>Entwicklung überfachlicher Fähigkeiten <strong>und</strong> Fertigkeiten <strong>und</strong> Wege e<strong>in</strong>esVerbesserung der Beschäftigungsch<strong>an</strong>cen fortzusetzen.“Gleichwohl werden <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d divergente St<strong>an</strong>dpunkte zurAusgestaltung der Promotionsphase vertreten.
1682.3.2 Die Promotion als erste forschende Berufstätigkeit2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 169Aus Sicht der Fakultätentage <strong>und</strong> Fachgesellschaften werden dabeiregelmäßig der Qualifikationsnachweis, <strong>die</strong> Notwendigkeit von Vielfaltstatt Reglementierung (wider <strong>die</strong> Verschulung der Promotionsphase), derAspekt der Durchlässigkeit (Universität/Fachhochschule) statt derProfilverwischung zwischen den Hochschultypen, <strong>die</strong> Forderung, dasPromotionsrecht exklusiv den Universitäten vorzubehalten, <strong>die</strong> Stärkungdes persönlichen Betreuungsverhältnisses <strong>und</strong> nicht zuletzt <strong>die</strong>Vorbehaltlosigkeit des <strong>in</strong>stitutionellen Promotionsrechts (ke<strong>in</strong>e Befristung)hervorgehoben.Demgegenüber werden seitens weiter Kreise der Hochschulpolitik <strong>an</strong>dereAspekte fokussiert: Zu begrüßen ist, dass <strong>die</strong> Präsident<strong>in</strong> der DeutschenHochschulrektorenkonferenz, Frau Professor W<strong>in</strong>term<strong>an</strong>tel, bereits vor zweiJahren formuliert hat: „Die Diversität der Promotionswege <strong>in</strong> Europa ist <strong>die</strong>Stärke des Systems“. Vor <strong>die</strong>sem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> ist <strong>die</strong> Gleichstellung desDoktor<strong>an</strong>den mit dem „early stage researcher“ plausibel. E<strong>in</strong>ehochschulpolitische Forderung nach e<strong>in</strong>em Mehr <strong>an</strong> Interdiszipl<strong>in</strong>arität derForschungsvorhaben ersche<strong>in</strong>t jedoch irritierend. Interdiszipl<strong>in</strong>arität folgtaus wissenschaftlichen Prozessen. Sie k<strong>an</strong>n durch Strukturen allenfallsgefördert werden. Hierdurch wird sie jedoch nicht zu e<strong>in</strong>em absolutenMaßstab. Unschlüssig ersche<strong>in</strong>t wiederum der verme<strong>in</strong>tliche Gegensatzzwischen der eher despektierlich <strong>an</strong>mutenden Umschreibung derPromotionsphase als „Lehrl<strong>in</strong>gsmodell“ versus der Forderung nach e<strong>in</strong>erBetreuung der Doktor<strong>an</strong>den durch e<strong>in</strong> Team. Während <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igenFachdiszipl<strong>in</strong>en – wie bereits dargelegt – <strong>die</strong> Teamarbeitwissenschaftsimm<strong>an</strong>ent im Vordergr<strong>und</strong> stehen muss (ungeachtethochschulpolitischer Forderungen), verbietet sich <strong>die</strong> Teamarbeit geradezubei vielen <strong>an</strong>deren Promotionsvorhaben. Auch werden <strong>die</strong> Verfechterexklusiver Promotionsmodelle immer zu bedenken haben, dass <strong>die</strong>Promotion nicht ausschließlich <strong>die</strong> Funktion e<strong>in</strong>er Qualifikation für <strong>und</strong>e<strong>in</strong>es E<strong>in</strong>stieges <strong>in</strong> <strong>die</strong> Forschung erfüllen muss, sondern darüber h<strong>in</strong>aus –je nach Intention des Doktor<strong>an</strong>den – g<strong>an</strong>z <strong>an</strong>dere Zwecke verfolgen k<strong>an</strong>n.Für <strong>die</strong> Zukunft sche<strong>in</strong>t <strong>in</strong>sbesondere von Bedeutung, dass es gel<strong>in</strong>gt, zuBeg<strong>in</strong>n der Promotionsphase <strong>die</strong> <strong>in</strong>stitutionelle Ver<strong>an</strong>twortung derFakultät/der Universität für den Doktor<strong>an</strong>den verlässlich <strong>und</strong> e<strong>in</strong>deutig zudokumentieren.In qualitativer H<strong>in</strong>sicht sollte des Weiteren denjenigenNachwuchswissenschaftlern, <strong>die</strong> e<strong>in</strong>e wissenschaftliche Karriere <strong>an</strong> derHochschule <strong>in</strong>ten<strong>die</strong>ren, <strong>die</strong> Möglichkeit gegeben werden, sich <strong>in</strong> derPromotionsphase auch <strong>in</strong> der <strong>Lehre</strong> zu erproben.Ambivalent bleibt <strong>die</strong> häufig <strong>und</strong>ifferenziert vorgetragene Forderung, <strong>in</strong>der Promotionsphase vermehrt sog. soft skills vermitteln zu müssen. Zubeachten ist, dass <strong>die</strong>s <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen Promotionskulturen seit jehergeschieht (durch Führungsver<strong>an</strong>twortung, durch <strong>die</strong> E<strong>in</strong>bettung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>Forschungsprojekt, durch <strong>die</strong> Mitarbeit <strong>an</strong> e<strong>in</strong>em Institut). Demgegenüberwäre es negativ zu beurteilen, aus kapazitären Gründen <strong>die</strong>Promotionsphase mit forschungsfremden Sujets zu überfrachten.Resümee: Im Idealfall h<strong>an</strong>delt es sich bei der Promotion um e<strong>in</strong>e ersteforschende (Berufs-) Tätigkeit. Die Promotionsphase bedarf weitergehenderStrukturierung – <strong>in</strong>sbesondere was <strong>die</strong> Verlässlichkeit der rechtlichenBeziehung zwischen Doktor<strong>an</strong>d <strong>und</strong> Fakultät/Universität betrifft; es bedarfaber ke<strong>in</strong>er weiteren Verschulung der Promotionsphase. Insoweit sollte <strong>die</strong>Hochschulpolitik das folgende Zitat auch als Mahnung verstehen: „Es stehtzu befürchten, dass Teile der <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em gestrafften <strong>Bachelor</strong>- <strong>und</strong> <strong>Master</strong>-Studium nicht mehr unterzubr<strong>in</strong>genden Lehr<strong>in</strong>halte <strong>in</strong> <strong>die</strong> Promotionsphaseverschoben werden <strong>und</strong> dass Pflichtvorlesungen <strong>und</strong> Term<strong>in</strong>e aller Art zue<strong>in</strong>er Verschulung führen. Dies würde dem primären Anliegen derPromotionsphase widersprechen, Professionalität unter großemLeistungsdruck zu praktizieren.“ (K. Urb<strong>an</strong>, Vizepräsident der DPG).Promotion als erste forschende BerufstätigkeitDr.-Ing. Uwe Koser, AUDI AG, IngolstadtZusammenfassungDer Artikel beschreibt Promotionsprojekte, <strong>die</strong> <strong>in</strong> neuartiger Weise <strong>in</strong> derKooperation zwischen Industrie <strong>und</strong> Hochschulen durchgeführt werden.Die spezielle Form der Zusammenarbeit zwischen Industrie <strong>und</strong> Hochschule
1702.3.2 Die Promotion als erste forschende Berufstätigkeit2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 171schafft Freiräume, <strong>die</strong> den Promovenden e<strong>in</strong>e erste Berufstätigkeit mitforschendem Inhalt ermöglichen <strong>und</strong> ihre Problemlösungskompetenzfördern. Sie s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> praxisnahes Beispiel für Promotionen alsBerufstätigkeit.E<strong>in</strong>leitungAudi ist als Hersteller hochwertiger Fahrzeuge mit dem Anspruch„Vorsprung durch Technik“ bek<strong>an</strong>nt. Der Erfolg des Unternehmens ist nurmöglich, weil <strong>die</strong> Kernkompetenzen von Audi beständig auf höchstemNiveau gehalten werden. Hoch motivierte <strong>und</strong> sowohl fachlich, wie auchsozial <strong>und</strong> methodisch kompetente Mitarbeiter s<strong>in</strong>d der Schlüssel dazu.Durch Promotionsprogramme, <strong>die</strong> <strong>in</strong> der Kooperation mit Hochschulensystematisiert durchgeführt werden, werden <strong>die</strong>se Eigenschaften bei Audigezielt unterstützt. Die Promotionsprogramme tragen damit ihren Anteilsowohl zur Innovationsfähigkeit des Unternehmens als auch zur Sicherungdes Nachwuchses bei.Der folgende Beitrag soll exemplarisch den Status von Doktor<strong>an</strong>den miteigenständigen Forschungsaufgaben im Überg<strong>an</strong>g zwischen Akademia <strong>und</strong>Industrie beleuchten.Förderung von Promotionen bei Audi durch PromotionsprogrammeIm Folgenden werden sowohl das Vorgehen als auch der Nutzen e<strong>in</strong>erPromotion aus der Perspektive e<strong>in</strong>es Fahrzeugherstellers beschrieben. Eshat sich gezeigt, dass sich <strong>die</strong>se Sichtweise mit den Interessen derHochschulen <strong>und</strong> natürlich vorallem der Promovenden <strong>in</strong> Übere<strong>in</strong>stimmungbef<strong>in</strong>det.Charakteristisch für <strong>die</strong> Promotionsprogramme bei Audi ist <strong>die</strong> <strong>in</strong>rahmenverträgen fixierte enge Kooperation mit den Hochschulen <strong>an</strong> denjeweiligen Unternehmensst<strong>an</strong>dorten oder <strong>in</strong> deren unmittelbarer Nähe. Diehohe Dichte exzellenter Hochschulen <strong>und</strong> fachlich herausragenderLehrstühle im süddeutschen Raum begünstigt <strong>die</strong>ses Vorgehenentscheidend.Gr<strong>und</strong>lage der Audi Promotionsprogramme ist stets e<strong>in</strong>e zwischen derHochschule <strong>und</strong> Audi geme<strong>in</strong>sam fachlich def<strong>in</strong>ierte Aufgabe. Dieseorientiert sich <strong>an</strong> der Anforderung, durch <strong>die</strong> Promotion <strong>die</strong> Fähigkeit derPromovenden zur vertieften wissenschaftlichen Arbeit am Beispiel derBearbeitung e<strong>in</strong>es Spezialgebietes nachzuweisen.Die Audi Promotionsprogramme ermöglichen es den Hochschulen, ihreGr<strong>und</strong>lagenforschungserkenntnisse jeweils mit e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>dustrienahenPraxisbezug <strong>an</strong>zuwenden <strong>und</strong> damit wesentliche Impulse für Innovation –<strong>in</strong> der Wortbedeutung e<strong>in</strong>er „kommerziell erfolgreichen <strong>Neue</strong>rung“ - zugenerieren. Dies betrifft natürlich zuvorderst technische Inhalte aus demBereich der Fahrzeugtechnik <strong>und</strong> Fahrzeugproduktion. Aber auch <strong>in</strong>wirtschafts-, sozial- oder geisteswissenschaftlichen Themenstellungenwerden so <strong>die</strong> notwendigen Freiräume für e<strong>in</strong>e vertiefte praktischeAnwendung geschaffen.Die F<strong>in</strong><strong>an</strong>zierung der Promotionsprogramme erfolgt projektbezogen durch<strong>die</strong> AUDI AG. E<strong>in</strong> regelmäßig tagender Steuerungskreis aus Vertretern derHochschulleitungen <strong>und</strong> der Unternehmensleitung gar<strong>an</strong>tiert für <strong>die</strong>wissenschaftliche <strong>und</strong> unternehmensseitige Relev<strong>an</strong>z der Projekte. Diewissenschaftliche Aktualität <strong>und</strong> der <strong>in</strong>dustrielle Praxisbezug derFragestellungen werden damit ebenso gewährleistet, wie auch <strong>die</strong> Qualitätder Forschung gefördert wird.Jedes Promotionsprojekt wird mit dem Ziel, <strong>die</strong> vordef<strong>in</strong>ierte Aufgabe unterden vorgegebenen R<strong>an</strong>dbed<strong>in</strong>gungen zu erfüllen, e<strong>in</strong>zeln vertraglichvere<strong>in</strong>bart. Vertragspartner ist entweder der Doktor<strong>an</strong>d (bei Audi <strong>in</strong>ternenBeschäftigungsverhältnissen) oder der Lehrstuhl (bei externenProjektaufträgen). In jedem Fall erhält der Promovent e<strong>in</strong>en <strong>in</strong> der Regelauf drei Jahre befristeten Arbeitsvertrag. Dabei werden <strong>die</strong> Promovendengr<strong>und</strong>sätzlich mit e<strong>in</strong>er vollen Stelle nach den Tarifen des öffentlichenDiensts vergütet.Promotionen als Förderungs<strong>in</strong>strumentE<strong>in</strong> Ziel der Promotionsprogramme ist es, <strong>die</strong> Doktor<strong>an</strong>den bei ihrerEntwicklung von „Problemlösungskompetenz“ zu unterstützen. DiePromotion gilt dabei als e<strong>in</strong>e professionelle Herausforderung unterBed<strong>in</strong>gungen, wie sie dem beruflichen Alltag <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em
1722.3.2 Die Promotion als erste forschende Berufstätigkeit2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 173Industrieunternehmen <strong>an</strong>genähert ist. Den Promovenden bietet sich damit<strong>die</strong> Ch<strong>an</strong>ce, ihre im Studium erworbenen Kenntnisse praktisch<strong>an</strong>zuwenden.Die Promotionsordnung der jeweiligen Universität legt <strong>die</strong> formalenakademischen Voraussetzungen für den Promovenden fest. E<strong>in</strong>Bewerbungsgespräch gibt H<strong>in</strong>weise auf <strong>die</strong> fachliche <strong>und</strong> sozialeKompetenz des Bewerbers. Das Betreuungsverhältnis zwischenHochschule, Unternehmen <strong>und</strong> dem Promovenden wird im Vorfeld<strong>in</strong>dividuell <strong>und</strong> aufgabenbezogen festgelegt. Prozesse <strong>und</strong>Ver<strong>an</strong>twortlichkeiten s<strong>in</strong>d damit geklärt. Der Promovend k<strong>an</strong>n den ihmgegebenen Freiraum vollständig für <strong>die</strong> Erfüllung se<strong>in</strong>er Aufgabe nutzen.Die Gewähr für e<strong>in</strong>en erfolgreichen Abschluss <strong>und</strong> <strong>die</strong> <strong>an</strong>schließendeVerleihung der Doktorwürde durch <strong>die</strong> Universität ist damit natürlich nichtverb<strong>und</strong>en.Es wird darauf geachtet, dass <strong>die</strong> Arbeitszeit der Doktor<strong>an</strong>denausschließlich dem Projektfortschritt gewidmet <strong>und</strong> nicht mit fachfremdenAufgaben befrachtet wird. Die Integration <strong>in</strong> Lehraufgaben am Lehrstuhlbzw. <strong>die</strong> Übernahme von Entwicklungsaufgaben im Unternehmenvertragen sich durchaus mit <strong>die</strong>sem Pr<strong>in</strong>zip, sol<strong>an</strong>ge <strong>die</strong>s zumErkenntnisgew<strong>in</strong>n <strong>und</strong> zum Arbeitsfortschritt beiträgt.Darüber h<strong>in</strong>aus ist es selbstverständlich, dass sich der Promovend sowohlfachlich als auch überfachlich fortbildet. Fortbildungsprogramme werdensowohl von der Universität als auch vom Unternehmen <strong>an</strong>geboten bzw. <strong>die</strong>Teilnahme dar<strong>an</strong> ermöglicht. Sie <strong>die</strong>nen dem Herausbilden <strong>und</strong> Vertiefenaufgabenspezifischen Expertenwissens bzw. gehen auf <strong>die</strong> <strong>in</strong>dividuellenErfordernisse des Promovenden e<strong>in</strong>.Um den Arbeiten e<strong>in</strong>en <strong>in</strong>stitutionellen Rahmen zu geben, f<strong>in</strong>den <strong>die</strong>Kooperationsprojekte <strong>in</strong> regionalen Kompetenzzentren, Außenstellen derkooperierenden Hochschulen <strong>an</strong> den Audi St<strong>an</strong>dorten, statt. Audi stellt <strong>die</strong>für e<strong>in</strong>en erfolgreichen Abschluss der Arbeit notwendige Infrastruktur zurVerfügung.Promotionen für InnovationGegenst<strong>an</strong>d der Arbeiten ist <strong>die</strong> <strong>an</strong>wendungsorientierte Forschung, sofern<strong>die</strong>se als vor- oder außerwettbewerblich bezeichnet werden k<strong>an</strong>n. Dabeibilden <strong>die</strong> Hochschulkooperationen <strong>die</strong> vertragliche <strong>und</strong> org<strong>an</strong>isatorischeBasis für e<strong>in</strong>e erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den beteiligtenPartnern. Jeder Promovend wird gleichermaßen <strong>in</strong>tensiv sowohl vonse<strong>in</strong>em Lehrstuhl als auch von e<strong>in</strong>er Audi Fachabteilung betreut. Dasräumliche Konzept der Hochschulkooperationen erlaubt, dass <strong>die</strong>Doktor<strong>an</strong>den nur ger<strong>in</strong>gen Aufw<strong>an</strong>d <strong>in</strong> ihre Mobilität verwenden müssen.Sie können für <strong>die</strong> Bearbeitung ihrer Themenstellungen kurzfristig <strong>an</strong>beiden Orten präsent se<strong>in</strong>. Durch den perm<strong>an</strong>enten Wechsel zwischenWissenschaft <strong>und</strong> Wirtschaft wird der Wissenstr<strong>an</strong>sfer befördert. IntensiveBetreuung <strong>und</strong> räumliche Mobilität <strong>die</strong>nen dem Erfolg des Projekts. Eswerden "Schnittstellensituationen" geschaffen. Innovative <strong>und</strong>wissenschaftlich fun<strong>die</strong>rte Erkenntnisse für technische Aufgabenstellungens<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> für das automobile Produkt wesentliches <strong>und</strong> beabsichtigtesErgebnis.Gleichzeitig befördert <strong>die</strong> enge Zusammenarbeit den Auftrag derHochschulen zu moderner, <strong>in</strong>novativer <strong>und</strong> unternehmerischer Forschung.Für hochschulpolitische Fragestellungen ebenso wie zur weiterenOptimierung der Forschung <strong>und</strong> <strong>Lehre</strong> können aus <strong>die</strong>sen Kooperationendirekte Erkenntnisse gewonnen werden.Die Promotionsprojekte s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>är zusammengesetzt. Die aktuellforschenden Promovenden gehören den Fakultäten Elektrotechnik,Informatik, Luft- <strong>und</strong> Raumfahrtechnik, Masch<strong>in</strong>enwesen,Sozialwissenschaften <strong>und</strong> Wirtschaftswissenschaften der jeweiligenHochschulen <strong>an</strong>. Obwohl untere<strong>in</strong><strong>an</strong>der über <strong>die</strong> Themenschwerpunktevernetzt, sieht es das Konzept der Hochschulkooperationen jeweils vor,dass jeder der Mitarbeiter se<strong>in</strong> eigenständiges Projekt zur Promotion führt.Promotionen für NachwuchsDie enge Betreuung durch <strong>die</strong> Fachabteilung während der Promotionb<strong>in</strong>det <strong>die</strong> Doktor<strong>an</strong>den. Sie <strong>die</strong>nt <strong>in</strong>sbesondere der Orientierung
1742.3.2 Die Promotion als erste forschende Berufstätigkeit2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 175("Praxisschock") <strong>und</strong> bereitet auf e<strong>in</strong>e nahtlose E<strong>in</strong>setzbarkeit nachAbschluss der Arbeit vor.Nur ca. 5 % der akademischen E<strong>in</strong>steiger s<strong>in</strong>d promoviert. Dennoch bildetgerade <strong>die</strong>se Personengruppe e<strong>in</strong>en für Audi sehr <strong>in</strong>teress<strong>an</strong>tenNachwuchs, da sie Berufserfahrenen gleichgestellt werden können. Beientsprechend zielgerichteter Auswahl der Projekte haben <strong>die</strong> Doktor<strong>an</strong>denfachliche Schlüsselqualifikationen <strong>in</strong> Engpassbereichen erworben.BeispieleJe nach regionaler Ausprägung der Entwicklungsaktivitäten von Audiliegen <strong>die</strong> Arbeitsschwerpunkte auf den Gebieten derAggregateentwicklung, der Ergonomie, der Strömungsmech<strong>an</strong>ik, derKonstruktion, der Informatik <strong>und</strong> der Elektrotechnik sowie der <strong>Neue</strong>nWerkstoffe. Weitere Arbeitsschwerpunkte befassen sich mit derAutomobilproduktion mit dem Ziel der Optimierung derProduktionsverfahren <strong>und</strong> -prozesse. Darüber h<strong>in</strong>aus werden wesentlicheImpulse für <strong>die</strong> Zukunftsfähigkeit des Unternehmens auf Sozial- <strong>und</strong>Wirtschaftswissenschaftlichem Gebiet generiert. Die Aufgaben adressieren<strong>die</strong> Gebiete der Demographie <strong>und</strong> der Arbeitgeberattraktivität.Das Audi Engagement <strong>in</strong> kooperative Promotionsprojekte trägt damitse<strong>in</strong>en Teil zur St<strong>an</strong>dortsicherung <strong>und</strong> zum St<strong>an</strong>dortausbau bei. Es steigertsowohl <strong>die</strong> Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber wie auch se<strong>in</strong>eInnovationsfähigkeit <strong>und</strong> trägt zur Nachwuchssicherung bei.Zusammenfassung AG 2: Promotion als erste forschendeBerufstätigkeit?Dr. Priya Bondre-Beil, Deutsche Forschungsgeme<strong>in</strong>schaft, DFGIm Anschluss <strong>an</strong> <strong>die</strong> beiden Impulsreferate aus Sicht der Industrie (Koser/Audi) <strong>und</strong> des Hochschul- <strong>und</strong> Wissenschaftsrechts (Detmer/ DHV)entwickelte sich e<strong>in</strong>e zunehmend sp<strong>an</strong>nende Diskussion, <strong>an</strong> deren Endeh<strong>in</strong>ter dem Titel „Promotion als erste forschende Berufstätigkeit“ ke<strong>in</strong>Fragezeichen mehr st<strong>an</strong>d.Die Vielfalt der Promotionsmodelle (<strong>in</strong>dividuell bzw. <strong>in</strong> strukturiertenProgrammen) konvergiert dar<strong>in</strong>, dass <strong>die</strong> Promotion als selbständigeForschungstätigkeit nicht als <strong>an</strong>geleitetes „forschendes Lernen“, sondernals „Forschung als <strong>und</strong> im Beruf“ <strong>und</strong> somit als erste Berufstätigkeit gilt.Damit unterscheidet sich <strong>die</strong> Promotionsphase erstens von denStu<strong>die</strong>nphasen (<strong>Bachelor</strong>/<strong>Master</strong>) <strong>und</strong> ist zweitens mit rechtlichen <strong>und</strong>strukturellen Konsequenzen verb<strong>und</strong>en, <strong>die</strong> von der Arbeitsgruppe <strong>in</strong> dreiSchwerpunkten diskutiert wurden:1. Status der Doktor<strong>an</strong>d<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Doktor<strong>an</strong>den: Desiderate• (befristete) Beschäftigungsverhältnisse als Qualifikationsstellen- damit verb<strong>und</strong>en: E<strong>in</strong>stiegsvergütung, arbeitsrechtlicheAbsicherungen, ausländerrechtliche Konsequenzen2. Qualifikation, Kompetenzen der Doktor<strong>an</strong>den <strong>und</strong> Doktor<strong>an</strong>d<strong>in</strong>nen:• klare Aufteilung bestimmter Qualifikationen <strong>in</strong> <strong>Bachelor</strong>-/<strong>Master</strong>phase:- ke<strong>in</strong>e promotionsfremden bzw. kompensatorischeVerpflichtungen <strong>in</strong> Curricula- entscheidende Faktoren: Fächerkulturen <strong>und</strong> sich darausergebender Bedarf- Bereitstellung entsprechender Angebote• z.B. Projektm<strong>an</strong>agement, wissenschaftliches Publizieren,Gute Wissenschaftliche Praxis, Geistiges Eigentum• Karriereentwicklung, Doktor<strong>an</strong>dennetzwerke• Konzernb<strong>in</strong>dung durch Strukture<strong>in</strong>blicke
1762.3.2 Die Promotion als erste forschende Berufstätigkeit2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 177Im Sp<strong>an</strong>nungsverhältnis zwischen der Eigenständigkeit der Forschung <strong>und</strong>der Betreuung sowie zwischen Isolation vs. E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Umfeldergeben sich vorr<strong>an</strong>gig Aufgaben der Hochschule:3. Pflichten der Hochschule• Festlegung der Zuständigkeiten bei der Betreuung derDoktor<strong>an</strong>d<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Doktor<strong>an</strong>den• Festlegung der rechtlichen Verpflichtungen zu Beg<strong>in</strong>n <strong>und</strong> Endeder Promotion- Beratung, Betreuung, BegutachtungAls Fazit k<strong>an</strong>n festgehalten werden, dass <strong>die</strong> Dimension von Forschung alsBeruf den Beg<strong>in</strong>n der Promotion erfasst <strong>und</strong> somit <strong>die</strong> daraus ableitbarenlogischen Konsequenzen für den Status <strong>und</strong> <strong>die</strong> Qualifikation (1, 2) <strong>und</strong> <strong>die</strong>Institutionen (3) nicht als Optionen, sondern als Forderung erfüllt werdensollten.2.3.3 Arbeitsgruppe 3: Zur E<strong>in</strong>richtung von Career CenternStrategien für den erfolgreichen Aufbau <strong>und</strong> <strong>die</strong> Etablierung vonCareer Services <strong>an</strong> deutschen HochschulenAndreas Eimer, Universität MünsterStu<strong>die</strong>nbegleitende Berufsorientierung, <strong>die</strong> Ver<strong>an</strong>twortung der Hochschulenfür den Erfolg ihrer Absolventen auf dem Arbeitsmarkt, <strong>die</strong> Förderung der sogen<strong>an</strong>nten „Employability“ – all <strong>die</strong>s s<strong>in</strong>d Themen, <strong>die</strong> <strong>in</strong> den verg<strong>an</strong>genenzehn bis 15 Jahren <strong>an</strong> den deutschen Universitäten immer wieder diskutiertwurden. Insbesondere seitdem 1999 der Wissenschaftsrat <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Papier„Stellungnahme zum Verhältnis von Hochschulausbildung <strong>und</strong>Beschäftigungssystem“ unter <strong>an</strong>derem forderte, „Career Centers künftig <strong>an</strong>allen Hochschulen e<strong>in</strong>zurichten“, entst<strong>an</strong>den <strong>an</strong> zahlreichen deutschenUniversitäten <strong>und</strong> <strong>an</strong> e<strong>in</strong>igen Fachhochschulen derartige Beratungs- <strong>und</strong>Unterstützungs<strong>an</strong>gebote. Damit wurde nachgeholt, was etwa <strong>an</strong> englischen<strong>und</strong> amerik<strong>an</strong>ischen Hochschulen längst selbstverständlich war – <strong>und</strong> auch<strong>die</strong> Begrifflichkeit wurde häufig von dort übernommen: Die meistenE<strong>in</strong>richtungen gaben sich auch <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d <strong>die</strong> englische BezeichnungCareer Service.Damit endet <strong>in</strong> vielen Fällen allerd<strong>in</strong>gs bereits <strong>die</strong> Vergleichbarkeit. Schlossensich <strong>die</strong> Akteure – also Hochschulleitungen <strong>und</strong> Career-Service-Ver<strong>an</strong>twortliche – pauschal zwar noch der Ansicht <strong>an</strong>, es müsse etwas get<strong>an</strong>werden für den Brückenschlag zwischen Hochschule <strong>und</strong> Arbeitsmarkt, gabes ke<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same Strategie, wie e<strong>in</strong> solches Angebot zu entwickeln <strong>und</strong>zu etablieren sei. Vielmehr wurde <strong>die</strong>se Aufgabe <strong>in</strong> Fach- <strong>und</strong>Entscheiderkreisen der e<strong>in</strong>zelnen Universität <strong>und</strong> der e<strong>in</strong>zelnenFachhochschule zugewiesen – sehr oft mit dem H<strong>in</strong>weis darauf, <strong>die</strong>Situationen vor Ort seien jeweils sehr unterschiedlich, <strong>und</strong> <strong>die</strong> Lösungen vorOrt müssten <strong>die</strong>sen Unterschiedlichkeiten Rechnung tragen.So weit – so gut.Schaut m<strong>an</strong> sich heute – etwa zehn Jahre später – <strong>die</strong> Situation der „Career-Service-L<strong>an</strong>dschaft“ genauer <strong>an</strong>, drängen sich e<strong>in</strong>ige Fragen auf. Ausverhältnismäßig ähnlichen, sprich: bescheidenen, Startbed<strong>in</strong>gungen habensich <strong>an</strong> e<strong>in</strong>igen St<strong>an</strong>dorten sehr leistungsstarke <strong>und</strong> <strong>in</strong>tensiv genutzteE<strong>in</strong>richtungen entwickelt. Andere Career Services fristen e<strong>in</strong> nur leidlich
1782.3.3 Zur E<strong>in</strong>richtung von Career Centern2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 179beachtetes Schattendase<strong>in</strong>. E<strong>in</strong>ige Ansätze s<strong>in</strong>d sogar vollkommenverschw<strong>und</strong>en. Und <strong>die</strong>se unterschiedlichen Entwicklungen lassen sichhäufig nicht mit den vorgef<strong>und</strong>enen örtlichen Situationen erklären. Vielmehrdrängt sich der E<strong>in</strong>druck auf, dass es doch Bed<strong>in</strong>gungen, Weichenstellungenoder sogar Strategien gibt, <strong>die</strong> über Erfolg <strong>und</strong> Misserfolg der CareerServices entscheiden.Was der Verfasser <strong>in</strong> <strong>die</strong>sem Text formuliert, ist ke<strong>in</strong> Ergebnis e<strong>in</strong>erwissenschaftlichen Untersuchung. Andreas Eimer versucht vielmehr,E<strong>in</strong>drücke zu beschreiben <strong>und</strong> zu systematisieren, <strong>die</strong> er beim Aufbau <strong>und</strong>der Leitung des Career Service der Universität Münster während derverg<strong>an</strong>genen zehn Jahre <strong>und</strong> <strong>in</strong> sehr vielen Gesprächen mit Kolleg<strong>in</strong>nen <strong>und</strong>Kollegen deutscher <strong>und</strong> ausländischer Hochschulen gewonnen hat. Insofernist <strong>die</strong> Schilderung e<strong>in</strong>igermaßen subjektiv, k<strong>an</strong>n aber <strong>an</strong> der e<strong>in</strong>en oder<strong>an</strong>deren Stelle vielleicht doch als Anregung <strong>die</strong>nen.These 1: E<strong>in</strong> Career Service nimmt Daueraufgaben wahr – also: entwederg<strong>an</strong>z oder gar nicht.E<strong>in</strong> gr<strong>und</strong>sätzlicher Fehler wurde me<strong>in</strong>er Ansicht nach <strong>an</strong> e<strong>in</strong>igen St<strong>an</strong>dortendirekt am Anf<strong>an</strong>g gemacht: Bevor es e<strong>in</strong> <strong>in</strong>haltliches Konzept, e<strong>in</strong>eBedarfs<strong>an</strong>alyse <strong>und</strong> geeignete Mitarbeiter gab, wurden (m<strong>in</strong>isterielle)Fördertöpfe gesucht. Nach der Förderzusage wurde e<strong>in</strong> befristetes Projektetabliert – meist ohne perspektivische Idee. Der Pl<strong>an</strong>ungshorizont war aufe<strong>in</strong> oder zwei Jahre begrenzt, <strong>die</strong> Perspektive der Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen ebenfalls.Der Wunsch, e<strong>in</strong> Projekt-Impuls würde reichen, <strong>und</strong> durch „Synergien“ <strong>und</strong>d<strong>an</strong>n schnell zu erledigende Rout<strong>in</strong>en könnte e<strong>in</strong> Career Service nebenbeilaufen, erfüllten sich nicht. Was mitunter blieb, waren <strong>an</strong>gef<strong>an</strong>geneAufgaben <strong>und</strong> frustrierte Mitarbeiter. Die Zeit reichte gerade, bei denStu<strong>die</strong>renden <strong>und</strong> jungen Absolventen Erwartungen zu wecken, <strong>die</strong> d<strong>an</strong>nwieder <strong>in</strong>s Leere liefen.These 2: E<strong>in</strong>en Career Service gibt es nicht kostenlos – er bietet e<strong>in</strong> neuesAngebot, das von der Hochschule gr<strong>und</strong>f<strong>in</strong><strong>an</strong>ziert se<strong>in</strong> muss. E<strong>in</strong>zelneProjekte können durchaus aus Drittmitteln bestritten werden.Die Career Services hatten <strong>die</strong> Schwierigkeit, <strong>in</strong> Zeiten (fast) leerer Kassen <strong>an</strong>deutschen Hochschulen zu starten. Die Devise lautete: Die Idee ist gut, aber<strong>die</strong> Umsetzung darf (fast) nichts kosten. Engagierte Jung-Akademikermachten sich <strong>an</strong>s Werk, <strong>die</strong>se Herausforderung zu stemmen. Von ihnenwurden Erfolge <strong>und</strong> Ergebnisse erwartet – oft <strong>in</strong> höherem Maß als vonetablierten, personell deutlich besser ausgestatteten <strong>an</strong>deren E<strong>in</strong>richtungender Hochschulen. Denn <strong>in</strong> vielen Fällen mussten <strong>die</strong> Career Services nicht nurbillig se<strong>in</strong>, sondern <strong>in</strong> <strong>die</strong>ser Phase auch noch <strong>die</strong> Hochschulöffentlichkeitvon ihrem S<strong>in</strong>n <strong>und</strong> ihrer Effizienz überzeugen. Diese Rechnung konnte nichtaufgehen. Viele <strong>die</strong>ser Career Services agieren bis heute am R<strong>an</strong>de derBedeutungslosigkeit – trotz besten Willens der Beteiligten.These 3: Der Career Service ist e<strong>in</strong> hochschulstrategischer Akteur – <strong>in</strong>sofernmuss er <strong>in</strong> <strong>die</strong> Gremienarbeit e<strong>in</strong>bezogen se<strong>in</strong>.Er war <strong>in</strong> Kollegenkreisen schon fast e<strong>in</strong> „runn<strong>in</strong>g gag“: der Career Servicemit se<strong>in</strong>em Büro <strong>in</strong> der Besenkammer unter dem Treppenaufg<strong>an</strong>g im Keller.Dieses – zugegebenermaßen etwas zugespitzte Bild – symbolisiert, wiewenig viele Hochschulen wussten, wo e<strong>in</strong> Career Service se<strong>in</strong>en Platz hatte –natürlich nicht nur räumlich, sondern <strong>in</strong>besondere auch strukturell. DieAbsicht, ihre Stu<strong>die</strong>renden besonders gut <strong>in</strong> den Arbeitsmarkt zu begleiten,ist e<strong>in</strong> strategisches Ziel e<strong>in</strong>er Hochschule. Und <strong>in</strong> <strong>die</strong>sem Prozess ist derCareer Service e<strong>in</strong> wesentlicher Akteur. Insofern muss der Career Servicestrategisch e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> beteiligt se<strong>in</strong>. Aus me<strong>in</strong>er Sicht ist es dabeiweniger wichtig, ob <strong>die</strong> E<strong>in</strong>richtung Stabsstelle, Abteilung oder ZentraleE<strong>in</strong>heit ist. Jedoch muss <strong>die</strong> Career-Service-Leitung <strong>in</strong> <strong>die</strong> Gremienarbeite<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> bei strategischer Pl<strong>an</strong>ung e<strong>in</strong>bezogen se<strong>in</strong> <strong>und</strong> es solltee<strong>in</strong>en „kurzen Draht“ zur Hochschulleitung geben. Am R<strong>an</strong>de bemerkt: E<strong>in</strong>eHochschule<strong>in</strong>richtung mit großer Außenwirkung (z. B. Arbeitgeber-besuche)sollte zudem natürlich e<strong>in</strong>e akzeptable räumliche Situation haben.These 4: Aufgabenbeschreibung <strong>und</strong> St<strong>an</strong>dort des Career Service <strong>in</strong>nerhalbdes Beratungs- <strong>und</strong> Informationssystems e<strong>in</strong>er Hochschule müssen imoffenen Austausch klar bestimmt werden.Die Aufgabe, den Stu<strong>die</strong>renden stu<strong>die</strong>nbegleitend bei ihrer beruflichenOrientierung zu helfen, ist für <strong>die</strong> Hochschulen relativ neu. Dieses Feld wurde<strong>in</strong> der Verg<strong>an</strong>genheit kaum bestellt. Das hatte se<strong>in</strong>e Gründe im historischkulturellenSelbstbild <strong>in</strong>sbesondere der Universitäten <strong>und</strong> ist rückblickend
1802.3.3 Zur E<strong>in</strong>richtung von Career Centern2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 181<strong>in</strong>sofern ke<strong>in</strong> Makel. Dennoch wird <strong>in</strong>nerhalb der Hochschulen das Entstehene<strong>in</strong>es neuen Beratungs- <strong>und</strong> Service<strong>an</strong>gebotes bisweilen mit e<strong>in</strong> wenigArgwohn gesehen <strong>und</strong> teilweise (z.B. bei <strong>Lehre</strong>nden oder <strong>in</strong> <strong>an</strong>derenBeratungse<strong>in</strong>richtungen der Hochschule) als Kritik <strong>an</strong> der bisherigen Arbeitempf<strong>und</strong>en. Da wurden auch schon e<strong>in</strong>mal Nebelkerzen geworfen nach demMotto „Im Pr<strong>in</strong>zip haben wir <strong>die</strong>sen Service bisl<strong>an</strong>g schon geboten“.Zielführender ist dagegen, e<strong>in</strong>e wirklich solide Konzeption zu erarbeiten:Welche Angebote e<strong>in</strong>es Career Service s<strong>in</strong>d konkret notwendig? Welches s<strong>in</strong>d<strong>die</strong> Kernaufgaben, Kernkompetenzen <strong>und</strong> Alle<strong>in</strong>stellungsmerkmale e<strong>in</strong>esCareer Service? Wo hat der Career Service se<strong>in</strong>en Platz im Beratungs- <strong>und</strong>Informationssystem der Hochschule? Das heißt, es muss gerade imAufbauprozess e<strong>in</strong>es Career Service e<strong>in</strong>en <strong>in</strong>tensiven Dialog <strong>und</strong>Abstimmungsprozess mit den <strong>an</strong>deren Akteuren im Bereich von Beratung<strong>und</strong> Information geben. Das Ziel ist Ergänzung <strong>und</strong> Kooperation stattArgwohn <strong>und</strong> Doppelstrukturen. Die Herausforderungen s<strong>in</strong>d groß – <strong>und</strong> esist genug Arbeit für alle da!These 5: Um zu verh<strong>in</strong>dern, dass der Career Service <strong>in</strong> Revierkämpfenzerrieben wird, braucht <strong>die</strong> E<strong>in</strong>richtungsleitung e<strong>in</strong>en festen Status <strong>und</strong> klareKompetenzen <strong>in</strong>nerhalb der Hochschulstruktur.Hochschulen s<strong>in</strong>d, trotz aller erfreulichen Veränderungen, <strong>in</strong> vielen Bereichennach wie vor hierarchisch org<strong>an</strong>isiert. Dadurch besteht <strong>die</strong> Gefahr, dass e<strong>in</strong>neuer Aufgabenbereich nicht als <strong>in</strong>haltliche Bereicherung, sondern alsMöglichkeit gesehen wird, „Machtbereiche“ zu vergrößern. Das k<strong>an</strong>n dazuführen, dass z.B. auch e<strong>in</strong> neuer Career Service für <strong>an</strong>dere als <strong>die</strong> <strong>in</strong>haltlichwünschenswerten Zwecke <strong>in</strong>strumentalisiert wird. Solche Entwicklungenkosten Energie, <strong>die</strong> für <strong>die</strong> notwendige Arbeit d<strong>an</strong>n nicht mehr zurVerfügung steht. Das wird am ehesten dadurch verh<strong>in</strong>dert, dassKompetenzen <strong>und</strong> Aufgaben von vornhere<strong>in</strong> klar def<strong>in</strong>iert s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> <strong>die</strong>Leitung e<strong>in</strong>es Career Service auch das St<strong>an</strong>d<strong>in</strong>g <strong>und</strong> den Bewegungsraumhat, erfolgreich für <strong>die</strong> orig<strong>in</strong>äre Aufgabe agieren zu können.Um konzeptionell <strong>und</strong> operativ erfolgreich arbeiten zu können, braucht e<strong>in</strong>Career Service kompetente <strong>und</strong> qualifizierte Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen. Auch wenndas Berufsbild e<strong>in</strong>es Career Service Professional <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d noch rechtneu ist <strong>und</strong> es <strong>an</strong>ders als <strong>in</strong> <strong>an</strong>deren Ländern noch ke<strong>in</strong>e spezifischeAusbildung dafür gibt, sollten sich <strong>die</strong> Profile der Career-Service-Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen <strong>an</strong> den <strong>in</strong>haltlichen Erfordernissen ausrichten. Me<strong>in</strong>erAnsicht nach unverzichtbar s<strong>in</strong>d u.a. Kompetenzen <strong>in</strong> der Beratungsarbeit,didaktische Gr<strong>und</strong>kenntnisse, Fähigkeiten <strong>in</strong> der Org<strong>an</strong>isation <strong>und</strong>Durchführung von Ver<strong>an</strong>staltungen verschiedener Formate (vom Workshopbis zur Messe) <strong>und</strong> für <strong>die</strong> Leitung zusätzlich Erfahrungen <strong>und</strong> Kenntnisse <strong>in</strong>Aufbau <strong>und</strong> Führen e<strong>in</strong>er kle<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>richtung/e<strong>in</strong>es Teams. Zudem sollten <strong>in</strong>e<strong>in</strong>em Career-Service-Team unbed<strong>in</strong>gt auch Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen mitaußerhochschulischer Berufserfahrung tätig se<strong>in</strong>. Längerfristig solltenCareer-Service-Akteure sich berufsbegleitend e<strong>in</strong> auf <strong>die</strong> Career-Service-Arbeit spezifisch ausgerichtetes Berufsprofil <strong>an</strong>eignen.These 7: E<strong>in</strong> Career Service muss se<strong>in</strong> Kernziel <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e Kernzielgruppe klardef<strong>in</strong>ieren. Market<strong>in</strong>g, F<strong>und</strong>rais<strong>in</strong>g <strong>und</strong> Gew<strong>in</strong>nerwirtschaftung s<strong>in</strong>d nichtse<strong>in</strong>e primären Funktionen. E<strong>in</strong> Career Service k<strong>an</strong>n aber dazu beitragen.Es ist wichtig, dass <strong>die</strong> Career Services ihr Kernziel formulieren: Das ist ausme<strong>in</strong>er Sicht, Stu<strong>die</strong>renden beim Aufbau ihres persönlichen <strong>und</strong> beruflichenProfils <strong>und</strong> beim Überg<strong>an</strong>g <strong>in</strong> den Arbeitsmarkt zu helfen. E<strong>in</strong> Career Serviceist primär ke<strong>in</strong> Market<strong>in</strong>g<strong>in</strong>strument – k<strong>an</strong>n aber durch gute Leistungen e<strong>in</strong>eFunktion im so gen<strong>an</strong>nten Sek<strong>und</strong>ärmarket<strong>in</strong>g übernehmen. Das heißt: GuteArbeit, gute Leistungen können natürlich im Market<strong>in</strong>g sichtbar werden.Auch ist der Career Service primär ke<strong>in</strong> Instrument des F<strong>und</strong>rais<strong>in</strong>g.Allerd<strong>in</strong>gs können <strong>die</strong> guten Kontakte des Career Service z.B. zuUnternehmen den universitären F<strong>und</strong>raisern nützlich se<strong>in</strong>. Zudem ist e<strong>in</strong>Career Service ke<strong>in</strong> Profitcenter. Se<strong>in</strong>e Leistungen kosten <strong>die</strong> Universitätzunächst e<strong>in</strong>mal Geld, es sei denn, der Career Service arbeitet mit hohenTeilnehmergebühren, was aber auch rechtlich nicht unproblematisch ist.These 6: Career Services s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>e Verwaltungse<strong>in</strong>heit – daher müssen <strong>die</strong>Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen dort <strong>an</strong>dere, sehr spezifische Qualifikationen e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen,um professionell arbeiten zu können.These 8: Career Services s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>e ausgelagerten Dienstleister fürUnternehmen. Career Services werden von den Hochschulen bezahlt <strong>und</strong>sollten für deren Bel<strong>an</strong>ge arbeiten.
1822.3.3 Zur E<strong>in</strong>richtung von Career Centern2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 183Hat e<strong>in</strong> Career Service se<strong>in</strong> Kernziel <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e Hauptzielgruppe klar def<strong>in</strong>iert,wird auch deutlich, wo <strong>die</strong> geme<strong>in</strong>samen Interessen von Career Services <strong>und</strong>Unternehmen bzw. Arbeitgebern liegen. Me<strong>in</strong>es Erachtens ist dasÜberschnittfeld kle<strong>in</strong>er als m<strong>an</strong> geme<strong>in</strong>h<strong>in</strong> <strong>an</strong>nehmen könnte. Es machtke<strong>in</strong>en S<strong>in</strong>n, dass sich e<strong>in</strong> Career Service als Dienstleister für Unternehmens-Personalabteilungen versteht, zum<strong>in</strong>dest nicht, wenn se<strong>in</strong> Fokus aufstudentischen Interessen liegt. In der Regel laufen selbst Zahlungen vonUnternehmen für gewisse Dienstleistungen (z.B. Vor-Selektion vonBewerbungsunterlagen) am Ende bestenfalls auf e<strong>in</strong> Nullsummen-Spielh<strong>in</strong>aus. Career-Service-Mitarbeiter sollten ihre Arbeitszeit für ihr Kernziele<strong>in</strong>setzen <strong>und</strong> für <strong>die</strong> Institution, <strong>die</strong> sie bezahlt, also für <strong>die</strong> Hochschulen.Es gibt <strong>in</strong> den deutschen Hochschulen erst seit e<strong>in</strong>igen Jahren Erfahrungenmit Career Services. Das führt dazu, dass ihnen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Hochschulen kaumetwas zugetraut, <strong>an</strong> <strong>an</strong>deren Orten von <strong>die</strong>sen E<strong>in</strong>richtungen aberaußerordentlich viel erwartet wird. Das bedeutet für <strong>die</strong> Career Servicesselbst, offensiv ihre Mitarbeit <strong>an</strong>zubieten, aber auch nur solche Aufgaben zuübernehmen, <strong>die</strong> machbar <strong>und</strong> realistisch s<strong>in</strong>d. Diese Haltung führt zu e<strong>in</strong>ersoliden Arbeit <strong>und</strong> vermeidet falsche Erwartungen <strong>und</strong> verh<strong>in</strong>dert auch, e<strong>in</strong>eFeigenblatt-Funktion zu erfüllen bei Themen, <strong>an</strong> <strong>die</strong> sich <strong>die</strong> Hochschulenicht wirklich her<strong>an</strong>wagt. Um Aufgaben mit Aussicht auf Erfolg übernehmenzu können, muss e<strong>in</strong> Career Service auch e<strong>in</strong>e personelle <strong>und</strong> f<strong>in</strong><strong>an</strong>zielleM<strong>in</strong>destausstattung e<strong>in</strong>fordern.These 9: Die Arbeit der Career Services mit Arbeitgebern/Unternehmen wirdumso e<strong>in</strong>facher, je klarer <strong>und</strong> selbstbewusster e<strong>in</strong>e Hochschule ihre Rolle <strong>und</strong>ihren Auftrag gegenüber der außerhochschulischen Welt formulieren k<strong>an</strong>n.Erst d<strong>an</strong>n lassen sich geme<strong>in</strong>same, aber auch unterschiedliche Interessenumreißen.Die Frage, wie gleichberechtigt <strong>und</strong> konstruktiv Career Services <strong>und</strong>Arbeitgeber/Unternehmen kooperieren, hängt sehr stark davon ab, ob dasVerhältnis von Hochschulen zu Arbeitgebern/Unternehmen <strong>in</strong>sgesamt geklärtist. Je selbstbewusster <strong>und</strong> klarer <strong>in</strong> Rolle <strong>und</strong> Auftrag Hochschulen mitArbeitgebern kommunizieren, umso leichter fällt es beiden Seiten,geme<strong>in</strong>same Interessen zu def<strong>in</strong>ieren. In der Verg<strong>an</strong>genheit war dasVerhältnis der Hochschulen zur Arbeitswelt zu oft durch von Unsicherheitgekennzeichnete Extreme geprägt: Entweder lehnten <strong>die</strong> Hochschulen denKontakt gänzlich ab oder biederten sich förmlich <strong>an</strong>, wenn das Pendelzeitgeistig <strong>in</strong> <strong>die</strong> <strong>an</strong>dere Richtung ausschlug. Gr<strong>und</strong>sätzlich sollten CareerServices m.E. darauf achten, dass Unternehmen <strong>in</strong> der Kooperation alspotentielle Arbeitgeber <strong>und</strong> nicht als Anbieter von Waren <strong>und</strong>Dienstleistungen agieren.These 10: Um Energien effizient e<strong>in</strong>setzen <strong>und</strong> erfolgreich arbeiten zukönnen, sollten Career Services-Ver<strong>an</strong>twortliche nur Aufgaben übernehmen,deren Bewältigung sie auch für machbar halten.These 11: Prekär beschäftigte Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> Career Services s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>überzeugendes Aushängeschild für gute Arbeitsmarktperspektiven vonHochschulabsolvent/en/<strong>in</strong>nen.Die Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Leiter/<strong>in</strong>nen von Career Services haben meiste<strong>in</strong>en Stu<strong>die</strong>nabschluss. Somit s<strong>in</strong>d sie (für <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>renden) selbst e<strong>in</strong>Beispiel für Akademiker/<strong>in</strong>nen, <strong>die</strong> den Überg<strong>an</strong>g vom Studium <strong>in</strong> den Berufgemeistert haben. Es ist m<strong>an</strong>chmal nicht vermeidbar, aber dennoch nichtglücklich: Wenn Career-Service-Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen selbst <strong>in</strong> prekärenBeschäftigungsverhältnissen stehen (Befristung, Wiss. Hilfskräfte usw.), k<strong>an</strong>nsich das auch auf deren Ausstrahlung auswirken. SelbstbewussteLaufbahnberatung zu machen, während m<strong>an</strong> selbst von Arbeitslosigkeitbedroht wird, ist nicht e<strong>in</strong>fach. Und Hochschulen, <strong>die</strong> ihre eigenenAbsolventen prekär beschäftigen, können nicht eben leicht vonaußeruniversitären Arbeitgebern <strong>an</strong>gemessene Beschäftigungssituationene<strong>in</strong>fordern.These 12: Der Career Service muss <strong>die</strong> Fachbereiche davon überzeugen, dassbeide Seiten auf unterschiedlichen Ebenen für den beruflichen Erfolg derStu<strong>die</strong>renden arbeiten – <strong>und</strong> dass sie <strong>die</strong>s am besten <strong>in</strong> gegenseitigerUnterstützung tun.Career Services sollten nicht nur <strong>in</strong> zentralen Gremien aktiv se<strong>in</strong>, sondernnatürlich auch <strong>in</strong> <strong>die</strong> Fachbereiche h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> wirken. Hier braucht der CareerService dr<strong>in</strong>gend Kooperationspartner. Dafür muss er se<strong>in</strong>e Rolle gegenüber
1842.3.3 Zur E<strong>in</strong>richtung von Career Centern2. Arbeitsmarktbefähigung (Employability) 185den Fachbereichen deutlich machen: Aus me<strong>in</strong>er Sicht darf e<strong>in</strong> Career Serviceke<strong>in</strong> „Pragmatisierer des Studiums“ se<strong>in</strong> <strong>und</strong> sollte auch nicht versuchen, <strong>in</strong>Stu<strong>die</strong>n<strong>in</strong>halte h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>zupfuschen. Der Career Service hilft den Stu<strong>die</strong>rendenbei der Entwicklung von Orientierungswissen <strong>und</strong> Tr<strong>an</strong>sferfähigkeiten, damitsie ihr Fachwissen auf dem Arbeitsmarkt nutzen können. Gerade Stu<strong>die</strong>rendetheorieorientierter <strong>und</strong> praxisferner Stu<strong>die</strong>ngänge profitieren davon,teilweise auch durch stu<strong>die</strong>n<strong>in</strong>tegrierte Angebote des Career Service.Zusammenfassung AG 3: Zur E<strong>in</strong>richtung von Career CenternKar<strong>in</strong> Rehn, WHU – Otto Beisheim School of M<strong>an</strong>agementViele deutsche Hochschulen verfügen heute über e<strong>in</strong> Career Center bzw.denken über <strong>die</strong> E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>er solchen Abteilung nach. Ziel derArbeitsgruppe „Zur E<strong>in</strong>richtung von Career Centern“ war es, praktischeAnsätze bei der E<strong>in</strong>richtung <strong>und</strong> Tipps zu den Aktivitäten von Career Centernzu liefern.E<strong>in</strong>e Frage zu Beg<strong>in</strong>n des Workshops ergab, dass fast alle Teilnehmerzunächst e<strong>in</strong>en gr<strong>und</strong>legenden Informationsbedarf zu <strong>die</strong>sem Thema hatten.Die Referenten Andreas Eimer, Leiter des Career Centers der UniversitätMünster, <strong>und</strong> Barbara Texter, Leiter<strong>in</strong> des Career Service der Hertie School ofGovern<strong>an</strong>ce konnten den großen Informationsbedarf aufgr<strong>und</strong> ihrerl<strong>an</strong>gjährigen Erfahrung im Bereich Career Service mit <strong>an</strong>schaulichenBeispielen <strong>und</strong> klaren Strategie<strong>an</strong>sätzen sehr gut decken.In e<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>führenden Vortrag führte Andreas Eimer e<strong>in</strong>ige Punkte auf, <strong>die</strong>Voraussetzung für <strong>die</strong> erfolgreiche Arbeit e<strong>in</strong>es Career Centers s<strong>in</strong>d.E<strong>in</strong> Career Center k<strong>an</strong>n vielfältige Aufgabenstellungen übernehmen<strong>an</strong>gef<strong>an</strong>gen von der Karriereberatung der Stu<strong>die</strong>renden, der Mittlerpositionzu Unternehmen bis h<strong>in</strong> zu Market<strong>in</strong>g <strong>und</strong> F<strong>und</strong>rais<strong>in</strong>g für <strong>die</strong> Hochschule.Allgeme<strong>in</strong> werden jedoch als <strong>die</strong> wichtigsten Aufgaben Beratung <strong>und</strong>Coach<strong>in</strong>g von Stu<strong>die</strong>renden, das Anbieten von Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsprogrammen fürStu<strong>die</strong>rende sowie das Schaffen e<strong>in</strong>er Kommunikationsplattform zwischenStu<strong>die</strong>renden <strong>und</strong> Unternehmen <strong>an</strong>gesehen. Die Stu<strong>die</strong>renden sehr gut <strong>in</strong>den Arbeitsmarkt zu begleiten, gehört mittlerweile – m<strong>an</strong> denke nur <strong>an</strong> dasStichwort Employability - zum Core Bus<strong>in</strong>ess e<strong>in</strong>er Hochschule.Es ist also als erstes zu klären, welche Aufgaben das Career Centerübernehmen soll. E<strong>in</strong>e klare strategische Positionierung hilft bei derAbgrenzung <strong>und</strong> Aufteilung der Zuständigkeiten gegenüber <strong>an</strong>derenAbteilungen wie z.B. der Stu<strong>die</strong>nberatung, wobei e<strong>in</strong> offener Austauschzwischen den e<strong>in</strong>zelnen Abteilungen notwendig ist, um denInformationsfluss zu gewährleisten <strong>und</strong> Missverständnissen vorzubeugen.Äußerst wichtig ist vor allem <strong>die</strong> Unterstützung durch <strong>die</strong> Hochschulleitung,<strong>die</strong> Rückhalt <strong>und</strong> Akzept<strong>an</strong>z <strong>in</strong>nerhalb der Hochschule gewährleistet. DerLeiter e<strong>in</strong>es Career Centers muss <strong>in</strong> <strong>die</strong> Gremienarbeit e<strong>in</strong>er Hochschulee<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en se<strong>in</strong>, denn se<strong>in</strong>e Abteilung ist e<strong>in</strong>er der hochschulstrategischenAkteure. Die Mitarbeit <strong>in</strong> den verschiedenen Gremien trägt ebenfalls dazubei, <strong>die</strong> Akzept<strong>an</strong>z <strong>in</strong>nerhalb der Hochschule weiter zu erhöhen.Wenn sich e<strong>in</strong>e Hochschule zur E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>es Career Centers entschließt,d<strong>an</strong>n muss sie sich darüber im Klaren se<strong>in</strong>, dass es sich hier nicht um e<strong>in</strong>zeitlich begrenztes Projekt, sondern um e<strong>in</strong>e Daueraufgabe h<strong>an</strong>delt. E<strong>in</strong>Career Center nur als Projekt zu <strong>in</strong>stitutionalisieren, ist äußerstproblematisch. Nicht nur, dass sich <strong>die</strong> Mitarbeiter <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er prekärenSituation bef<strong>in</strong>den <strong>und</strong> sich Ged<strong>an</strong>ken um ihre eigene Zukunft machenmüssen. Es ist auch sehr frustrierend für Stu<strong>die</strong>rende <strong>und</strong> Absolventen, bei<strong>die</strong>sen Erwartungen zu wecken, <strong>die</strong> bald wieder <strong>in</strong>s Leer laufen. Dasbedeutet aber auch, dass e<strong>in</strong> Career Center gr<strong>und</strong>f<strong>in</strong><strong>an</strong>ziert se<strong>in</strong> muss.Drittmittel können natürlich das Budget ergänzen, aber <strong>die</strong> Abteilung darfdavon nicht abhängig se<strong>in</strong>, um je nach Bedarf h<strong>an</strong>dlungsfähig se<strong>in</strong> zukönnen. Die Hochschule sollte selbstbewusst gegenüber den Unternehmenauftreten <strong>und</strong> klar <strong>die</strong> eigenen Positionen <strong>und</strong> Wünsche kommunizieren. E<strong>in</strong>offener Dialog zwischen Hochschule <strong>und</strong> Unternehmen ist Voraussetzung füre<strong>in</strong>e effektive <strong>und</strong> erfolgreiche Zusammenarbeit.Die <strong>Anforderungen</strong> <strong>an</strong> <strong>die</strong> Mitarbeiter e<strong>in</strong>es Career Centers, das alsSchnittstelle zwischen den verschiedenen Akteuren wie Stu<strong>die</strong>renden,Unternehmen <strong>und</strong> Hochschule fungiert, s<strong>in</strong>d vielfältig <strong>und</strong> gehen weit über<strong>die</strong> Aufgaben e<strong>in</strong>es klassischen Verwaltungsbereiches h<strong>in</strong>aus. DieMitarbeiter müssen <strong>in</strong> der Lage se<strong>in</strong>, alle Akteure auf e<strong>in</strong>er vertrauensvollenBasis e<strong>in</strong>zub<strong>in</strong>den. Stu<strong>die</strong>rende können z.B. durch <strong>die</strong> Beteiligung bei derOrg<strong>an</strong>isation von Messen <strong>in</strong> <strong>die</strong> Arbeit e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en werden. Somit erhältm<strong>an</strong> e<strong>in</strong>en direkten Kontakt zu den Stu<strong>die</strong>renden. Bei der Pl<strong>an</strong>ung vonUnternehmenspräsentationen ist es wichtig, <strong>die</strong> Firmen beratend zuunterstützen, um e<strong>in</strong>e möglichst erfolgreiche Präsentation zu erreichen.
1862.3.3 Zur E<strong>in</strong>richtung von Career CenternAndererseits k<strong>an</strong>n e<strong>in</strong> Career Center auch den Lehrstühlen Ansprechpartner<strong>in</strong> Unternehmen vermitteln, um Vorlesungs<strong>in</strong>halte zu optimieren oder durchden direkten Kontakt zu den Unternehmen Anregungen <strong>und</strong> Input zurGestaltung e<strong>in</strong>es Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>ges liefern.Bisher gibt es <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d ke<strong>in</strong>e spezielle Ausbildung für Mitarbeiter e<strong>in</strong>esCareer Centers. Die Mitarbeiter kommen vielmehr aus denunterschiedlichsten Bereichen, s<strong>in</strong>d also gewissermaßen Quere<strong>in</strong>steiger <strong>und</strong>vertiefen <strong>in</strong> der Regel ihre Kenntnisse gewissermaßen im on-the-job Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g.In Großbrit<strong>an</strong>nien h<strong>in</strong>gegen gibt es für solche Bereiche e<strong>in</strong>en speziellenStu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>g. Auch <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>d werden Überlegungen <strong>in</strong> <strong>die</strong>se Richtung<strong>an</strong>gestellt. Barbara Texter berichtete <strong>in</strong> ihrer zweiten Funktion alsVorsitzende des Career Service Netzwerk Deutschl<strong>an</strong>d (csnd), e<strong>in</strong> Ziel desNetzwerkes sei <strong>die</strong> Professionalisierung von Career Centern. Dazu gehöre vorallem auch <strong>die</strong> Fortbildung der Mitarbeiter, was wiederum zurQualitätssicherung beitrage. Das csnd bildet <strong>die</strong> Plattform für Career Center<strong>und</strong> deren Mitarbeiter.Fazit ist, dass <strong>die</strong> E<strong>in</strong>richtung e<strong>in</strong>es Career Centers e<strong>in</strong>e Hochschule vorgroße Herausforderungen stellt. E<strong>in</strong> Career Center ist vor allem d<strong>an</strong>nerfolgreich, wenn es e<strong>in</strong>e klare Positionierung <strong>und</strong> e<strong>in</strong> klares Aufgabenfeldgibt, alle Akteure e<strong>in</strong>geb<strong>und</strong>en werden <strong>und</strong> e<strong>in</strong> eigenes Budget zurVerfügung steht. Wenn e<strong>in</strong>e Hochschule <strong>die</strong>se Herausforderungen <strong>an</strong>nimmt,k<strong>an</strong>n sie mittelfristig <strong>in</strong> vielfältiger Weise davon profitieren. Die Stu<strong>die</strong>rendenz.B. fühlen sich <strong>an</strong> ihrer Alma Mater gut betreut <strong>und</strong> s<strong>in</strong>d somit viel eherbereit, Alumni zu werden. Unternehmen arbeiten enger mit den Hochschulenzusammen <strong>und</strong> <strong>die</strong> Hochschule wiederum erhält E<strong>in</strong>blicke <strong>in</strong> <strong>die</strong> Praxis <strong>und</strong>u.U. auch Drittmittel. Wenn m<strong>an</strong> es etwas abstrakter sehen möchte, trägt e<strong>in</strong>Career Center <strong>in</strong> <strong>die</strong>sem S<strong>in</strong>ne auch zum Market<strong>in</strong>g e<strong>in</strong>er Hochschule bei. E<strong>in</strong>Potenzial, dass m<strong>an</strong> nicht unterschätzen sollte.3. Der St<strong>an</strong>d der E<strong>in</strong>führung des Diploma Supplements 1873. Der St<strong>an</strong>d der E<strong>in</strong>führung desDiploma SupplementsErgebnisse e<strong>in</strong>er Umfrage des Bologna-Zentrums 2007Monika Schröder, HochschulrektorenkonferenzDie Themen der ersten Jahrestagung des Bologna-Zentrums warenKompetenzerwerb, Qualifikationsrahmen <strong>und</strong> Arbeitsmarktrelev<strong>an</strong>z derneuen <strong>Bachelor</strong>- <strong>und</strong> <strong>Master</strong>-Stu<strong>die</strong>ngänge.Das Diploma Supplement ist hierbei <strong>die</strong> Schnittstelle, <strong>die</strong> <strong>die</strong> Kompetenzen<strong>und</strong> Qualifikationen der Absolventen e<strong>in</strong>es bestimmten Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gsdokumentiert <strong>und</strong> lesbar macht.Diese Lesbarkeit ist e<strong>in</strong>erseits wichtig bei e<strong>in</strong>er Bewerbung für e<strong>in</strong> zweitesStudium, vor allem aber erklärt das Diploma Supplement <strong>die</strong> Qualifikatione<strong>in</strong>es Hochschulabsolventen für <strong>die</strong> Bewerbung auf dem Arbeitsmarkt <strong>und</strong>dokumentiert e<strong>in</strong>en akademischen Abschluss für <strong>die</strong> Lebens- <strong>und</strong>Arbeitsbiografie im S<strong>in</strong>ne des lebensl<strong>an</strong>gen Lernens. Mit dem DiplomaSupplement haben Absolvent<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Absolventen e<strong>in</strong> Instrument <strong>in</strong> derH<strong>an</strong>d, das sie dabei unterstützt, <strong>die</strong> Stelle zu f<strong>in</strong>den, <strong>die</strong> ihren oder se<strong>in</strong>enKenntnissen, Fähigkeiten <strong>und</strong> Kompetenzen entspricht. Dadurch, dass das es<strong>in</strong> Englisch ausgestellt wird, ist es besonders bei Bewerbungen auf dem<strong>in</strong>ternationalen Arbeits- <strong>und</strong> Bildungsmarkt e<strong>in</strong> wichtiges Dokument.Um zu sehen, wie der St<strong>an</strong>d der E<strong>in</strong>führung des Diploma Supplements <strong>an</strong>deutschen Hochschulen vor<strong>an</strong>schreitet, hat das Bologna-Zentrum der HRK imNovember 2007 e<strong>in</strong>e Umfrage durchgeführt. Die wichtigsten Ergebnissewerden hier zusammenfassend dargestellt, mit dem St<strong>an</strong>d der E<strong>in</strong>führung imJahr 2004 <strong>und</strong> mit der Pl<strong>an</strong>ung der Hochschulen für das Jahr 2010verglichen.
1883. Der St<strong>an</strong>d der E<strong>in</strong>führung des Diploma Supplements 1891. Der St<strong>an</strong>d der E<strong>in</strong>führung des Diploma SupplementsKnapp 13 % der Hochschulen hatten im Jahre 2004 das DiplomaSupplement hochschulweit e<strong>in</strong>geführt (siehe Abb. 1), im Jahr 2007 hat sich<strong>die</strong>se Zahl mit fast 29 % aller Hochschulen mehr als verdoppelt (siehe Abb.2). Für 2010 pl<strong>an</strong>en ca. 81 % der Hochschulen das DS für alle Stu<strong>die</strong>ngängee<strong>in</strong>geführt zu haben (siehe Abb. 3).100,090,080,070,060,050,080,8 %40,0100,030,090,020,080,070,010,00,09,8 %3,1 %0,9%0,0 %4,4 %0,9 %60,050,040,034,4 %30,027,8 %20,012,6 %10,07,7%5,4 %7,7 %4,3 %0,0Abb. 1 : St<strong>an</strong>d der E<strong>in</strong>führung des Diploma Supplements <strong>in</strong> 2004100,090,080,070,0Abb. 3: Pl<strong>an</strong>ung der E<strong>in</strong>führung des Diploma Supplements 2010.Hochschulen stellen Diploma Supplements aus:hochschulweit für alle Stu<strong>die</strong>ngängefür ca. 75 % ihrer Stu<strong>die</strong>ngängefür ca. 50 % ihrer Stu<strong>die</strong>ngängefür ca. 25 % aller Stu<strong>die</strong>ngängefür unter 25 % aller Stu<strong>die</strong>ngängenur für E<strong>in</strong>zelfälleHS stellen ke<strong>in</strong>e DS aus60,050,040,030,020,010,00,028,7%17,4%8,1%8,5%11,7%11,3%14,2%2. Probleme bei der E<strong>in</strong>führung des Diploma SupplementsGefragt nach den Gründen für e<strong>in</strong>e verzögerte E<strong>in</strong>führung des DiplomaSupplement, haben <strong>die</strong> Hochschulen überwiegend M<strong>an</strong>gel <strong>an</strong> Personal <strong>und</strong>M<strong>an</strong>gel <strong>an</strong> Geld, um mehr Personal e<strong>in</strong>stellen zu können, gen<strong>an</strong>nt. D<strong>an</strong>achr<strong>an</strong>gieren <strong>in</strong>haltliche Gründe bei der Erstellung des Diploma Supplement <strong>und</strong>org<strong>an</strong>isatorische <strong>und</strong> technische Probleme folgen (siehe Abb. 4).Abb. 2: St<strong>an</strong>d der E<strong>in</strong>führung des Diploma Supplements 2007
190115,8%16,3%18,8%19,2%20,2%23,6%24,0%3. Der St<strong>an</strong>d der E<strong>in</strong>führung des Diploma Supplements 1913. Förderung der Ausstellung des Diploma SupplementsE<strong>in</strong> weiterer Teil der Befragung widmete sich den Möglichkeiten, wie <strong>die</strong>E<strong>in</strong>führung des Diploma Supplement gefördert werden könnte. Hierersche<strong>in</strong>t der Wunsch nach mehr Personal mit über 50 % als häufigsteNennung der Hochschulen. Über 35 % der Hochschulen geben <strong>an</strong>, dass siee<strong>in</strong> besseres IT System als wesentliche Hilfe <strong>an</strong>sähen. Jeweils ca. 26 % derHochschulen zählen mehr Aufklärung <strong>und</strong> Information, bessere f<strong>in</strong><strong>an</strong>zielleAusstattung <strong>und</strong> besser funktionierende Schnittstellen der Verwaltungen zuden förderlichen Maßnahmen (siehe Abb. 5).25,6%31,1%35,1%0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%Abb. 4: Top Ten der Gründe für e<strong>in</strong>e verzögerte E<strong>in</strong>führung des DiplomaSupplementsM<strong>an</strong>gel <strong>an</strong> Personal im VerwaltungsbereichM<strong>an</strong>gel <strong>an</strong> Personal zur Datenpflege im IT BereichProbleme bei der Erstellung der Inhalte (z. B. Formulierung derStu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gsbeschreibungen)Probleme mit der Erstellung des Tr<strong>an</strong>script of Records/derDatenabschriftDaten s<strong>in</strong>d nicht auf Englisch verfügbarProbleme bei der Absprache zwischen Verwaltung <strong>und</strong> <strong>Lehre</strong>Technische Voraussetzungen für <strong>die</strong> automatische Ausstellung s<strong>in</strong>dnicht vorh<strong>an</strong>denProbleme der fachbereichs-/fakultätsübergreifenden Prüfungsverwaltung(z. B. bei fachbereichs-/fakultätsübergreifendenLehr<strong>an</strong>geboten/Modulen)Probleme mit der Software<strong>an</strong>b<strong>in</strong>dung der Prüfungsverwaltung
1923. Der St<strong>an</strong>d der E<strong>in</strong>führung des Diploma Supplements 19315,5%8,5%12,1%14,5%18,2%26,1%26,1%4. Fazit der UmfrageDer Bologna-Prozess ist e<strong>in</strong>e Herausforderung, <strong>die</strong> sich als größer erwiesenhat, als sie vorab gedacht werden konnte. Der Blick auf e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelnesInstrument, das Diploma Supplement, zeigt, dass <strong>die</strong> Hochschulen <strong>die</strong> Arbeit<strong>an</strong> der Stu<strong>die</strong>nreform nach eigenen Schwerpunkten <strong>und</strong> mit verschiedenenHer<strong>an</strong>gehensweisen bewältigen. E<strong>in</strong> von vielen Hochschulen gewählter Wegist, mit der Ausstellung der Diploma Supplements erst für <strong>die</strong> neuenStu<strong>die</strong>ngänge zu beg<strong>in</strong>nen. Deshalb ist der Abschluss der Überg<strong>an</strong>gsphasevon den traditionellen Diplom- <strong>und</strong> Magisterstu<strong>die</strong>ngängen auf <strong>die</strong> gestufteStruktur oft e<strong>in</strong>e Voraussetzung der flächendeckenden E<strong>in</strong>führung.26,1%35,2%50,9%Gr<strong>und</strong>sätzlich fördernde Faktoren für e<strong>in</strong>e flächendeckende automatischeAusstellung s<strong>in</strong>d <strong>die</strong> Ausf<strong>in</strong><strong>an</strong>zierung des Bologna-Prozesses, mehr Personal<strong>und</strong> e<strong>in</strong> gut funktionierendes IT System mit erfolgreichen Schnittstellen.0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%Abb.5: Fördernde Maßnahmen für <strong>die</strong> Ausstellung des Diploma SupplementsMehr PersonalBesseres IT-SystemMehr Aufklärung <strong>und</strong> Informationen über Diploma SupplementMehr f<strong>in</strong><strong>an</strong>zielle MittelBessere Schnittstellen zwischen Stu<strong>die</strong>renden-, Prüfungs- <strong>und</strong>ModulverwaltungBessere Zusammenarbeit der Fachbereiche/Fakultäten/InstituteRechtliche Verb<strong>in</strong>dlichkeit der Ausstellung des Diploma Supplementsdurch L<strong>an</strong>desgesetzeHöhere Priorisierung durch <strong>die</strong> HochschulleitungRechtliche Verb<strong>in</strong>dlichkeit der Ausstellung des DiplomaSupplements durch hochschul<strong>in</strong>terne RegelungenSonstigesE<strong>in</strong> Diploma Supplement muss vergleichbar, verständlich <strong>und</strong> aussagekräftigse<strong>in</strong>. Es enthält <strong>die</strong> wesentlichen Qualifikationen, <strong>die</strong> e<strong>in</strong> Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>g se<strong>in</strong>enAbsolventen <strong>und</strong> Absolvent<strong>in</strong>nen vermittelt. Die Aussagen müssenInformationen zu Wissen, Fähigkeiten <strong>und</strong> Kenntnissen umfassen <strong>und</strong> dasPotenzial der Absolvent<strong>in</strong> oder des Absolventen muss <strong>in</strong> Kompetenzendargestellt werde, <strong>die</strong> e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>schätzung zulassen, welche Erwartungen <strong>die</strong>Bewerber<strong>in</strong> oder der Bewerber erfüllen wird.E<strong>in</strong> aussagekräftiges Diploma Supplement schlägt e<strong>in</strong>e erfolgreiche Brückezur Bildungs- <strong>und</strong> Arbeitsbiografie der Inhaber<strong>in</strong> oder des Inhabers.
1944. Resümee 1954. ResümeeVizepräsident derHochschulrektorenkonferenzProf. Dr. Wilfried MüllerIch möchte Ihnen vorschlagen, am Ende <strong>die</strong>ser Ver<strong>an</strong>staltung wieder auf<strong>die</strong> Themen des Anf<strong>an</strong>gs zurück zu kommen. Wir sollten genau überlegen,<strong>an</strong> welchen Aspekten wir <strong>in</strong> den nächsten Jahren weiter arbeiten wollen.Vor <strong>die</strong>sem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> liefere ich Ihnen ke<strong>in</strong>e Zusammenfassung derTagungsergebnisse, sondern biete Ihnen eher <strong>die</strong> Gr<strong>und</strong>elemente e<strong>in</strong>es„nach vorne gerichteten Blicks“.Diese Ver<strong>an</strong>staltung hat bewusst den Titel „Kompetenzvermittlung,Qualifikationsrahmen <strong>und</strong> Employability“ erhalten. Und vor <strong>die</strong>semH<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> haben <strong>die</strong> Ver<strong>an</strong>stalter bewusst Prof. Dr. Teichler gebeten, dase<strong>in</strong>leitende Referat zu halten. Und <strong>die</strong>ser hat mit <strong>in</strong>tellektueller Brill<strong>an</strong>zmehrere Aspekte hervorgehoben, <strong>die</strong> so deutlich schon l<strong>an</strong>ge nicht gesagtworden s<strong>in</strong>d: z.B. der Begriff „Employability“ hat direkt mit der Tagung <strong>in</strong>Bologna (1999) nichts zu tun; erst auf den Folgekonferenzen <strong>in</strong> Prag 2001<strong>und</strong> Berl<strong>in</strong> 2003 hat „Employability“ e<strong>in</strong>e gewisse Bedeutung erhalten. Ingewisser Weise sche<strong>in</strong>t <strong>die</strong>ser Begriff e<strong>in</strong>e britische Antwort auf dasProblem der eigenen Hochschulen zu se<strong>in</strong>, das nämlich akademischeAusbildung <strong>in</strong> Großbrit<strong>an</strong>nien, gerade <strong>in</strong> Engl<strong>an</strong>d, sehr starkpersönlichkeitsbildenden Charakter haben soll <strong>und</strong> <strong>in</strong> Teilbereichen desHochschulwesens unzureichend arbeitsmarktrelev<strong>an</strong>te Qualifikationenvermittelt. Employability ist ursprünglich als Perspektive fürAusbildungsprogramme von Jugendlichen formuliert worden, <strong>die</strong> auf ihremspezifischen Arbeitsmarkt schwer zu vermitteln s<strong>in</strong>d.Im deutschsprachigen Raum gibt es verschiedene Übersetzungen: In derSchweiz <strong>und</strong> <strong>in</strong> Österreich wird Employability mit Arbeitsmarktbefähigungbzw. Arbeitsmarktfähigkeit übersetzt. Die deutsche ÜbersetzungBerufsbefähigung be<strong>in</strong>haltet e<strong>in</strong>e Verengung (von Arbeitsmarkt auf Beruf),denn Beruf – wenn wir ihn <strong>in</strong>haltlich abgrenzen von Job – be<strong>in</strong>haltet e<strong>in</strong>festes Berufsbild beziehungsweise e<strong>in</strong>e Berufsordnung oder <strong>an</strong>derweitig
196Prof. Dr. Wilfried Müller4. Resümee 197gesellschaftlich akzeptierte Qualifikationsmuster. Offensichtlich k<strong>an</strong>n dasaber nur für e<strong>in</strong>en Teil der Absolventen deutscher Hochschulen gelten. DieForderung Teichlers besteht dar<strong>in</strong>, dass das Entscheidende imZusammenh<strong>an</strong>g mit der Entwicklung von <strong>Bachelor</strong>-Programmen dasverb<strong>in</strong>dliche Interesse der jeweiligen Hochschulen <strong>an</strong> den beruflichen <strong>und</strong>gesellschaftlichen Wirkungen ihrer Absolventen se<strong>in</strong> soll. Vor <strong>die</strong>semH<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> schlägt er vor, lediglich von der „beruflichen Relev<strong>an</strong>z“akademischer Kompetenzen zu sprechen. Ohne <strong>die</strong>se Nachdenklichkeitgegenüber vorschnellen Übersetzungen des Begriffes Employability seheich <strong>die</strong> Gefahr, dass M<strong>in</strong>isterien <strong>und</strong> Akkreditierungsagenturen <strong>und</strong>vielleicht auch Hochschulen lediglich nach dem kurzfristigen Erfolg derAbsolventen auf dem Arbeitsmarkt fragen. Dieses wäre jedoch fatal, weilneue Qualifikations- <strong>und</strong> Kompetenzmuster sich erst nach vielen Jahren aufdem Arbeitsmarkt durchsetzen.Zweitens haben <strong>die</strong> Ver<strong>an</strong>stalter sich darum bemüht, Wissenschaftler <strong>und</strong>Wissenschaftler<strong>in</strong>nen aus <strong>an</strong>deren europäischen Ländern zu bitten,darzustellen wie sie mit der Umstellung <strong>in</strong> der Perspektive der Bologna-Struktur umgehen. Dabei zeigen sich hoch<strong>in</strong>teress<strong>an</strong>te Unterschiede. Sohat <strong>die</strong> Schweiz ähnliche Probleme wie wir, erlaubt sich aber mit mehrSelbstbewusstse<strong>in</strong> als <strong>die</strong> deutschen Universitäten mit <strong>die</strong>sem Problemumzugehen <strong>und</strong> ihren Hochschulen bewusst e<strong>in</strong>e experimentellen Umg<strong>an</strong>gmit der Bologna-Struktur zu empfehlen, ohne dass <strong>die</strong>se immer gleich <strong>die</strong>Sorgen haben müssen, dass sie von irgende<strong>in</strong>er Inst<strong>an</strong>z daraufh<strong>in</strong>gewiesen werden, sie könnte den falschen Weg e<strong>in</strong>geschlagen haben.Auch <strong>die</strong> Referate aus dem Vere<strong>in</strong>igten Königreich <strong>und</strong> den Niederl<strong>an</strong>denbelegen <strong>die</strong> These, dass der Umg<strong>an</strong>g mit dem Bologna-Prozess <strong>in</strong> Europadurch Vielfalt charakterisiert ist. Während <strong>in</strong> Großbrit<strong>an</strong>nien <strong>die</strong><strong>Anforderungen</strong> <strong>an</strong> den „learn<strong>in</strong>g outcome“ sich auf <strong>die</strong> <strong>in</strong>haltliche Füllungdes Begriffes Kompetenz beziehen, leiten <strong>in</strong> den niederländischenHochschulen <strong>die</strong> Hochschulleitungen <strong>und</strong> <strong>an</strong>schließend <strong>die</strong>Fachgeme<strong>in</strong>schaften aus dem nationalen Qualifikationsrahmen <strong>die</strong>erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten <strong>und</strong> Kompetenzen der Absolventender e<strong>in</strong>zelnen Fächer <strong>und</strong> Stu<strong>die</strong>nprogramme ab. Vor <strong>die</strong>sem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong>besteht <strong>in</strong> den Niederl<strong>an</strong>den e<strong>in</strong>e relativ klare Trennung zwischenforschungsnahen Kompetenzen <strong>und</strong> direkt auf den Arbeitsmarkth<strong>in</strong>führenden professionellen Kompetenzen. Diese Berichte aus den<strong>an</strong>deren europäischen Ländern zeigen sehr deutlich, dass es gerade auchfür das Selbstbewusstse<strong>in</strong> für <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>renden sehr wichtig ist, dass <strong>die</strong>sewissen, was sie gelernt haben; <strong>und</strong> dass ihnen dabei nicht nur ihreWissensbestände bek<strong>an</strong>nt s<strong>in</strong>d, sondern vor allem auch allgeme<strong>in</strong>etr<strong>an</strong>sferierbare Kompetenzen.Die Situation <strong>an</strong> den deutschen Hochschulen ist gegenwärtig schwer zubewerten, denn wir s<strong>in</strong>d mitten <strong>in</strong> der größten Umstellung derStu<strong>die</strong>ngänge seit dem Zweiten Weltkrieg. Vor <strong>die</strong>sem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> s<strong>in</strong>dnur e<strong>in</strong> paar H<strong>in</strong>weise auf den Entwicklungst<strong>an</strong>d möglich: Wir haben ausder neuen HIS-Stu<strong>die</strong> erfahren, dass es Bereiche mit e<strong>in</strong>er Vergrößerungder Abbruchrate <strong>und</strong> solche mit e<strong>in</strong>er deutlichen Verr<strong>in</strong>gerung derAbbruchrate gibt. Offensichtlich haben <strong>die</strong> Hochschulen beziehungsweisefachwissenschaftlichen Geme<strong>in</strong>schaften, <strong>die</strong> den Versuch unternommenhaben, achtsemestrige Programme <strong>in</strong> sechssemestrige zu pressen, „<strong>die</strong>Rechnung ohne den Wirt“, das heißt ohne ihre Stu<strong>die</strong>rende gemacht. Dieses<strong>in</strong>d offensichtlich überfordert, mit den <strong>Anforderungen</strong> produktivumzugehen. Hier müssen <strong>die</strong> betroffenen Fächer e<strong>in</strong>en <strong>an</strong>deren Wege<strong>in</strong>schlagen. Ansonsten haben wir viele H<strong>in</strong>weise darauf, dass es auf derBasis e<strong>in</strong>er soliden fachwissenschaftlich geprägten Ausbildung durchausallgeme<strong>in</strong>e methodische <strong>und</strong> soziale Kompetenzen mit beruflicher Relev<strong>an</strong>zzu vermitteln s<strong>in</strong>d – ob nun gegenüber dem fachwissenschaftlichenAusbildungsbest<strong>an</strong>dteilen additiv oder <strong>in</strong>tegriert. Es ist offensichtlichmöglich, den <strong>Bachelor</strong>-Programmen <strong>und</strong> den darüber geschaffenenKompetenzen der Stu<strong>die</strong>renden e<strong>in</strong>e hohe berufliche Relev<strong>an</strong>z zu geben.Bisher ist zu wenig über den Zusammenh<strong>an</strong>g von Kompetenzvermittlung<strong>und</strong> Prüfungsformen diskutiert <strong>und</strong> geforscht worden. Die deutschenHochschulen müssen sorgfältiger <strong>und</strong> verb<strong>in</strong>dlicher über <strong>die</strong> Auswahl derPrüfungsformen nachdenken. Es ist nicht zielführend, auf der e<strong>in</strong>en Seite<strong>an</strong>spruchsvolle Kompetenzen vermitteln zu wollen, auf der <strong>an</strong>deren Seitesich für Prüfungsformen zu entscheiden, <strong>die</strong> mit möglichst wenig Arbeit für<strong>die</strong> Hochschullehrer/<strong>in</strong>nen verb<strong>und</strong>en s<strong>in</strong>d. In <strong>die</strong>sem S<strong>in</strong>ne ist <strong>die</strong>seTagung auch e<strong>in</strong> Plädoyer dafür, sich sorgfältiger als bisher mit denPrüfungsformen im Bologna-Prozess zu beschäftigen.
198Prof. Dr. Wilfried MüllerE<strong>in</strong> letzter H<strong>in</strong>weis: Viele Rektoren <strong>und</strong> Präsidenten, aber auch Dek<strong>an</strong>e <strong>und</strong>Fachbereichssprecher so wie Fachwissenschaftler neigen dazu, derAuse<strong>in</strong><strong>an</strong>dersetzung mit den nationalen <strong>und</strong> den europäischenQualifikationsrahmen auszuweichen. Die e<strong>in</strong>en befürchten neueRahmenordnungen, <strong>und</strong> <strong>die</strong> <strong>an</strong>deren gehen davon aus, irgendw<strong>an</strong>n gehe<strong>an</strong> ihnen <strong>die</strong>ser Kelch vorbei. Es ist aber im Interesse der Hochschulen,<strong>in</strong>sbesondere ihrer <strong>Bachelor</strong>-Absolventen notwendig, sich mit demQualifikationsrahmen <strong>in</strong>tensiv zu befassen <strong>und</strong> ihn für <strong>die</strong>wissenschaftlichen Qualifikationen mit Leben zu füllen, weil wir <strong>an</strong>sonstennicht <strong>in</strong> der Lage se<strong>in</strong> werden darzustellen, welche besonderen Fähigkeitenunsere Absolventen im Verhältnis zu denen des beruflichen Systemsbesitzen. Bisher s<strong>in</strong>d <strong>die</strong> Hochschulen <strong>in</strong> der Beschreibung derKompetenzen ihrer <strong>Bachelor</strong>-Absolventen gegenüber dem beruflichenSystem ausgesprochen defensiv gewesen. Das muss sich ändern!Zum Abschluss möchte ich Ihnen für Ihre engagierten Debatten <strong>und</strong> Ihre<strong>an</strong>regenden Diskussionsbeiträge im Namen derHochschulrektorenkonferenz d<strong>an</strong>ken.Teilnehmerverzeichnis 199TeilnehmerverzeichnisChristoph Affeld, ACQUIN Akkreditierungs-, Certifizierungs- <strong>und</strong>Qualitätssicherungs<strong>in</strong>stitut e. V.Prof. Dr. Carsten Ahrens, FachhochschuleOldenburg/Ostfriesl<strong>an</strong>d/WilhelmshavenHilke Anhalt, Genossenschaftsverb<strong>an</strong>d Norddeutschl<strong>an</strong>d e. V. ,Berufsakademie für B<strong>an</strong>kwirtschaftProf. Dr. -Ing. Detmar Arlt, Fachhochschule DüsseldorfDr. Gudrun Bachm<strong>an</strong>n, Universität BaselMatthias Baderschneider, Universität RegensburgBirgit Bargm<strong>an</strong>n-Re<strong>in</strong>eke, Leibniz Universität H<strong>an</strong>noverVera Bart, Universität BayreuthHeidemarie Barthold, Joh<strong>an</strong>n Wolfg<strong>an</strong>g Goethe-Universität Fr<strong>an</strong>kfurt amMa<strong>in</strong>Prof. Dr. Ulrich Bartosch, Katholische Universität Eichstätt-IngolstadtDr. Andreas Barz, Universität HeidelbergS<strong>an</strong>t<strong>in</strong>a Battaglia, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im BreisgauAndrea Bauhus, Bergische Universität WuppertalGregor Bechtold, Hochschule DarmstadtDr. rer. nat. Fr<strong>an</strong>k Stef<strong>an</strong> Becker, Siemens AGAstrid Bernek, Hochschule für Künste BremenProf. Dr. Hilke Bertelsm<strong>an</strong>n, Fachhochschule der DiakonieDipl.-Psych. Krist<strong>in</strong>a Biebricher, Universität HeidelbergProf. Dr. Hendrik Birus, Jacobs University BremenMart<strong>in</strong>a Bischof, Hypovere<strong>in</strong>sb<strong>an</strong>k AGProf. Dr. rer. cur. Claudia Bischoff-W<strong>an</strong>ner, Hochschule Essl<strong>in</strong>genDr. H<strong>an</strong>s-Jürgen Bl<strong>in</strong>n, M<strong>in</strong>isterium für Bildung, Wissenschaft, Jugend <strong>und</strong>KulturDr. Priya Bondre-Beil, Deutsche Forschungsgeme<strong>in</strong>schaftBeate Booß, WHU - Otto Beisheim School of M<strong>an</strong>agementProf. Dr. Kai Brodersen,Christoph Bruns, Pädagogische Hochschule FreiburgImke Buß, freier zusammenschluss der studentInnenschaften (fzs)Prof. Dr. Angelos Ch<strong>an</strong>iotis, All Souls College OxfordPeter Christ, WHU - Otto Beisheim School of M<strong>an</strong>agement
200Prof. Dr. I<strong>an</strong> Cloete, International University <strong>in</strong> Germ<strong>an</strong>yNad<strong>in</strong>e Csonka, Technische Universität Berl<strong>in</strong>Véronique Czáka, Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS)Malgorzata Anna Czerniak, RWTH AachenNicole Dah<strong>in</strong>den, Universität BernDr. Claudia Dahnken, Universität Bonn, BALLIris D<strong>an</strong>owski, HochschulrektorenkonferenzProf. Wendy Davies, University College LondonProf. Dr. Ulrich Deller, Katholische Hochschule Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen -Catholic University of Applied SciencesDr. jur. Hubert Detmer, Deutscher Hochschulverb<strong>an</strong>dHenn<strong>in</strong>g Dettleff, B<strong>und</strong>esvere<strong>in</strong>igung der Deutschen ArbeitgeberverbändeAndre Dorenbusch, Allgeme<strong>in</strong>er Stu<strong>die</strong>rendenausschuss (AStA)Petra Droste, Universität BremenDr. Gerhard Duda, HochschulrektorenkonferenzAnnette Eh<strong>in</strong>ger, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im BreisgauFr<strong>an</strong>k Ehn<strong>in</strong>ger, Universität OsnabrückAndreas Eimer, Universität MünsterVirna Engl<strong>in</strong>g, Universität H<strong>an</strong>noverDi<strong>an</strong>a Esser, Fachhochschule DüsseldorfChristi<strong>an</strong> Fäth, Universität M<strong>an</strong>nheimProf. Dr. Michael Felleisen, Hochschule PforzheimDr. Basti<strong>an</strong> Filaretow, Universität PaderbornDr. Barbara F<strong>in</strong>ke, Hertie School of Govern<strong>an</strong>ceDipl.-Psych. Sab<strong>in</strong>e Fischer, Westfälische Wilhelms-Universität MünsterChristoph Fischer, Deutsche Sporthochschule KölnMichaela Fr<strong>an</strong>a, FHTW Berl<strong>in</strong>Dr. Andrea Fr<strong>an</strong>k, Universität BielefeldSibylle Frers, Leibniz Universität H<strong>an</strong>noverDr. Agnes Friedel, Leuph<strong>an</strong>a Universität LüneburgDr. Ute Fries, Hochschule für Musik <strong>und</strong> Theater "Felix MendelssohnBartholdy" LeipzigDipl.-Verwaltungsw. Joh<strong>an</strong>nes Gabriel, Berufsakademie SachsenS<strong>an</strong>dra Gad<strong>in</strong>ger, Folkw<strong>an</strong>g HochschuleDr. Christi<strong>an</strong>e Gaehtgens, HochschulrektorenkonferenzSteph<strong>an</strong> Geifes, Deutsch-Fr<strong>an</strong>zösische HochschuleChristoph Geppert, Universität M<strong>an</strong>nheimTeilnehmerverzeichnis 201Dr. Angela Gies, J.W. Goethe-Universität Fr<strong>an</strong>kfurtElena Golofast, Georg-August-Universität Gött<strong>in</strong>genSab<strong>in</strong>e Görges-Dey, Universität BremenBett<strong>in</strong>a Gräv<strong>in</strong>gholt, Universität BonnMarkus Grebe, Universität des Saarl<strong>an</strong>desM<strong>in</strong>isterialdirigent Peter Greisler, Federal M<strong>in</strong>istry of Education <strong>an</strong>dResearchChrista Greshake-Ebd<strong>in</strong>g, Witten/Annen Institut für Waldorf-PädagogikMart<strong>in</strong> Grev<strong>in</strong>g, IT Beratung <strong>und</strong> Entwicklung c/o Fachhochschule TrierTabea Grimm, Technische Universität BraunschweigFlori<strong>an</strong> Gröbl<strong>in</strong>ghoff, Nomos Verlagsgesellschaft mbh & Co. KGPetra Gruner, Pädagogische Hochschule HeidelbergDr. Thomas Grünewald, Universität PotsdamDr. med. Annette Güntert, B<strong>und</strong>esärztekammerProf. Dr. Andreas H. Guse, Universitätskl<strong>in</strong>ikum Hamburg-EppendorfAndreas Gutm<strong>an</strong>n, Fachhochschule AnsbachKar<strong>in</strong>a Haberm<strong>an</strong>n, Fachhochschule Ma<strong>in</strong>zDr. Monika Hädelt, E.-M.-A.-Universität GreifswaldProf. Dr. Sigurd Hebenstreit, Ev<strong>an</strong>gelische Fachhochschule Rhe<strong>in</strong>l<strong>an</strong>d-Westfalen-LippeNicole Rom<strong>an</strong>a Heigl, Pädagogische Hochschule KarlsruheProf. Dr. Michael He<strong>in</strong>e, FHTW Berl<strong>in</strong>M<strong>in</strong>isterialdirigentDr. Birger Hendriks, M<strong>in</strong>istry of Science, EconomicAffairs <strong>an</strong>d Tr<strong>an</strong>sport Schleswig-Holste<strong>in</strong>Birgit Hennecke, Westfälische Wilhelms-Universität MünsterChrist<strong>in</strong>e Herker, Technische Universität Berl<strong>in</strong>Prof. Dr.-Ing. Wolfg<strong>an</strong>g Hess, Universität BonnDr. Silke Hetzer, Leuph<strong>an</strong>a Universität LüneburgDr. Ulrich Heuble<strong>in</strong>, HIS-Außenstelle <strong>an</strong> der Universität LeipzigChristoph Heum<strong>an</strong>n, ASIIN e. V.Gisa Heuser, Universität LüneburgKlar<strong>in</strong>a Hirschka, FSK Ruprecht-Karls-Universität HeidelbergStef<strong>an</strong> Hofbeck, Universität Dortm<strong>und</strong>Klaus Höhm<strong>an</strong>n, Amt für <strong>Lehre</strong>rbildung Hessen - Abt. I-Dr. Achim Hopbach, AkkreditierungsratMal<strong>in</strong> Houben, AStA Universität Bielefeld
202Drs. Jo<strong>die</strong>n D. Houwers, Rijksuniversiteit Gron<strong>in</strong>genProf. Dr. Wilfried Huber, Zentral<strong>in</strong>stitut für <strong>Lehre</strong>rbildung <strong>und</strong><strong>Lehre</strong>rfortbildung der TU MünchenProf. Dr. Albrecht Hummel, Technische Universität ChemnitzErnst Hunkel, Merkur Internationale Fachhochschule KarlsruheM<strong>in</strong>isterialratHerm<strong>an</strong>n Jaekel, Sächsisches Staatsm<strong>in</strong>isterium fürWissenschaft <strong>und</strong> KunstAnnette J<strong>an</strong>der, Technische Fachhochschule Berl<strong>in</strong>Dr. Nathalie J<strong>an</strong>z, Université de Laus<strong>an</strong>nePetra Jauk, Fachhochschule JenaDr. Karl Kälble, AHPGS e. V.Prof. Dr. Uwe Kamenz, Fachhochschule Dortm<strong>und</strong>Prof. Dr. Peter Kammerer, Hochschule für <strong>an</strong>gew<strong>an</strong>dte Wissenschaften -Fachhochschule MünchenProf. Dr. Maria-Eleonora Karsten, Leuph<strong>an</strong>a Universität LüneburgAlex<strong>an</strong>der Katzer, fzs freier zusammenschluss von studentInnenschaftenBenedict Kaufm<strong>an</strong>n, HRK Projekt Qualitätsm<strong>an</strong>agementGerd Kellerm<strong>an</strong>n, Witten/Annen Institut für Waldorf-PädagogikProf. Dr. Sebasti<strong>an</strong> Kempgen, Universität BambergMargit Kießlich, Universität LüneburgMichael K<strong>in</strong>dt, Projektträger im DLR - HochschulforschungDr. Ljuba Kirjuch<strong>in</strong>a, Universität PotsdamElvira Klausm<strong>an</strong>n, AHPGS e. V.Prof. Dr. Kar<strong>in</strong> Klepp<strong>in</strong>, Ruhr-Universität BochumJ<strong>an</strong>a Knott, Universität Ma<strong>in</strong>zJoachim Koch-B<strong>an</strong>tz, Deutscher Gewerkschaftsb<strong>und</strong>Katja Kohrs, Niedersächsisches M<strong>in</strong>isterium für Wissenschaft <strong>und</strong> KulturDipl. Ing. oec. Uwe König, Fachhochschule SchmalkaldenMart<strong>in</strong>a Kopf, Universität Ma<strong>in</strong>zDr.-Ing. Uwe Koser, Audi AGProf. Dr. Edgar Kösler, Katholische Fachhochschule Freiburg - staatlich<strong>an</strong>erk<strong>an</strong>nt -Britta Krahn, UNIVERSITY PARTNERS GmbHMichael Krall, KPMG AuditProf. Dr. H<strong>an</strong>s-Joachim Krause, Fachhochschule DüsseldorfDr. Gaby Krekeler, Universität OsnabrückKerst<strong>in</strong> Krüger-Bunny, Universität LüneburgTeilnehmerverzeichnis 203T<strong>an</strong>ja Kruse, Universität H<strong>an</strong>noverKathar<strong>in</strong>a Kulike, BVMD- B<strong>und</strong>esVertretung der Mediz<strong>in</strong>stu<strong>die</strong>renden <strong>in</strong>Deutschl<strong>an</strong>dDipl.-Betriebswirt<strong>in</strong> H<strong>an</strong>na Kümmerle, Ste<strong>in</strong>beis-Hochschule Berl<strong>in</strong>Dr. Fr<strong>an</strong>ziska Kunz, UNIVERSITY PARTNERS GmbHProf. Dr. M<strong>an</strong>fred Künzel, Université de FribourgDr. Mart<strong>in</strong> Kurz, Europäische Fernhochschule HamburgDr. Volkmar L<strong>an</strong>ger, Berufsakademie Weserbergl<strong>an</strong>d e. V.H<strong>an</strong>no L<strong>an</strong>gfelder, TU MünchenDr. Bärbel Last, Fachhochschule Strals<strong>und</strong>Robert Lauch, B<strong>und</strong>esvertretung der Mediz<strong>in</strong>stu<strong>die</strong>renden <strong>in</strong> Deutschl<strong>an</strong>de. V. (bvmd)Prorektor Prof. Dr. Markus Lehm<strong>an</strong>n, Hochschule Albstadt-Sigmar<strong>in</strong>genJustus Lenz,Tobias Lipper, Zeppel<strong>in</strong> University GmbHBirgit Lißke, Fachhochschule PotsdamAnita Maile, Hochschule Bayern e.V.Dr. Christoph Markert, Universität LeipzigKatr<strong>in</strong> Mayer, Ludwig-Maximili<strong>an</strong>s-Universität MünchenProf. Dr. rer. nat. Albrecht Meißner, Leuph<strong>an</strong>a Universität LüneburgVizepräsident<strong>in</strong>Prof. Dr. Dorothee Meister, Universität PaderbornDr. Norbert Meyer, BASF AGAndrea Micheler, Fachhochschule Braunschweig/WolfenbüttelMart<strong>in</strong>a Mickisch, Universität BonnAnna Mikulcová, Universität PotsdamDaisuke Motoki, FIBAA Fo<strong>und</strong>ation for International Bus<strong>in</strong>essAdm<strong>in</strong>istration AccreditationKerst<strong>in</strong> Mucke, B<strong>und</strong>es<strong>in</strong>stitut für Berufsbildung (BIBB)Prof. Dr. Wilfried Müller, Universität BremenMarcus Müller, Thesis e.V.Dr. Werner Müller-Pelzer, Fachhochschule Dortm<strong>und</strong>Dr. Klaus Murm<strong>an</strong>n, Universität UlmFr<strong>an</strong>z Muschol, Ludwig-Maximili<strong>an</strong>s-Universität MünchenRA Patrick Neuhaus, HochschulrektorenkonferenzFriedrich Neum<strong>an</strong>n, DLR - Projektträger <strong>Neue</strong> Me<strong>die</strong>n <strong>in</strong> der BildungLydia Niewerth, Deutscher Richterb<strong>und</strong>
204Prof. Dr. R. Peter Nippert, Mediz<strong>in</strong>ischer FakultätentagProf. Dr.-Ing. Alphonso P. Noronha, Georg-Simon-Ohm FachhochschuleNürnbergSus<strong>an</strong>ne Obermayer, CRUS - Rektorenkonferenz der SchweizerUniversitätenProf. Dr. Georg Obieglo, Hochschule Reutl<strong>in</strong>genRegierungsrat Jens Orth, Universität WürzburgPD Dr. Alois Palmetshofer, Universität WürzburgRoswitha Perret, Fachhochschule Fr<strong>an</strong>kfurt am Ma<strong>in</strong>Dr. Rolf Peter, HochschulrektorenkonferenzM<strong>in</strong>isterProf. Dr. Andreas P<strong>in</strong>kwart, M<strong>in</strong>isterium für Innovation,Wissenschaft, Forschung <strong>und</strong> Technologie des L<strong>an</strong>des Nordrhe<strong>in</strong>-WestfalenDr. Stef<strong>an</strong> Plasa, Universität des Saarl<strong>an</strong>desProf. Dipl.-Ing. Karl Plastrotm<strong>an</strong>n, Fachhochschule LausitzStef<strong>an</strong> Pr<strong>an</strong>ge, Justus-Liebig-Universität GießenProf. Dr. H<strong>an</strong>s Paul Prümm, Fachhochschule für Verwaltung <strong>und</strong>Rechtspflege Berl<strong>in</strong>J<strong>an</strong> Rathjen, HochschulrektorenkonferenzDr. Cornelia Raue, Technische Universität Berl<strong>in</strong>Kar<strong>in</strong> Rehn, WHU - Otto Beisheim School of M<strong>an</strong>agementMatthias Reiber, Julius-Maximili<strong>an</strong>s-Universität WürzburgMarkus Rempe, Fachhochschule des Mittelst<strong>an</strong>ds Bielefeld (FHM)Georg Reschauer, AHPGS FreiburgHerm<strong>an</strong>n Reuke, Zentrale Evaluations- <strong>und</strong> AkkreditierungsagenturH<strong>an</strong>noverKar<strong>in</strong> Reuschenbach-Cout<strong>in</strong>ho, Internationale Fachhochschule BadHonnef-BonnUniv.-Prof. Dr. jur. Lutz R. Reuter, Helmut-Schmidt-Universität/Universitätder B<strong>und</strong>eswehrDr. phil. Rüdiger Rhe<strong>in</strong>, Universität H<strong>an</strong>noverSus<strong>an</strong>ne Richter, Leibniz Universität H<strong>an</strong>noverDr. Marion Rieken, Hochschule VechtaDr. Christi<strong>an</strong> Rietz, UNIVERSITY PARTNERS GmbHWiebke Röber, Leuph<strong>an</strong>a Universität LüneburgSilvia Rosenberger, Muthesius KunsthochschuleProf. Dr. Steffen Rößler, Private FernfachHochschule SachsenInga-Dorothee Rost, Leibniz Universität H<strong>an</strong>noverTeilnehmerverzeichnis 205Prof. Dr. Gustav Rückem<strong>an</strong>n, SRH Hochschule Heidelberg - Staatlich<strong>an</strong>erk<strong>an</strong>nte FachhochschuleDorothee Rückert, Universität SiegenS<strong>an</strong>dra Rüdebusch, Carl von Ossietzky Universität OldenburgKatja Rumpf, Thür<strong>in</strong>ger Kultusm<strong>in</strong>isteriumDr. Sylvia Rusch<strong>in</strong>, Universität Dortm<strong>und</strong>Dr. Anne Sachs, Universität KasselDr. Joachim Sailer, Ste<strong>in</strong>beis-Hochschule Berl<strong>in</strong>Dr. phil. Bett<strong>in</strong>a S<strong>an</strong>dt, Otto-von-Guericke-Universität MagdeburgBett<strong>in</strong>a Satory, Technische Universität Berl<strong>in</strong>Uwe Scharlock, Fachhochschule JenaPatrick Schauff, Europäische Fachhochschule Rhe<strong>in</strong> / Erft GmbHDr. Britta Scheideler, Universität OsnabrückWolfg<strong>an</strong>g Scherer, Fraport AGJoachim Scheurer, Macromedia Fachhochschule der Me<strong>die</strong>nProf. Dr. H<strong>an</strong>s-Jochen Schiewer, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg imBreisgauProf. Dr. Georg Schild, Universität Tüb<strong>in</strong>genKar<strong>in</strong> Sch<strong>in</strong>dler, Thür<strong>in</strong>ger Kultusm<strong>in</strong>isteriumProf. Dr. Michael Schlöm<strong>an</strong>n, TU Bergakademie FreibergDr. Georg-Andreas Schmidt, Hochschule der Sparkassen-F<strong>in</strong><strong>an</strong>zgruppeHeike Schmitt, Fakultätentage der Ingenieurwissenschaften <strong>und</strong> derInformatik <strong>an</strong> Universitäten e.V.Mira Schneider, AStA Uni BielefeldKurt Schobel, Hochschule für Musik "H<strong>an</strong>ns Eisler"Doris Schorge, Philipps-Universität MarburgProf. Dr. Ing. Ralf Schottke, Leuph<strong>an</strong>a Universität LüneburgMonika Schröder, HochschulrektorenkonferenzKrist<strong>in</strong> Schubert, Hochschule für <strong>an</strong>gew<strong>an</strong>dte WissenschaftenClaud<strong>in</strong>e J. Schulz, Fachhochschule AachenKar<strong>in</strong> Schulz-Sommer, Universität FlensburgRosmarie Schwartz-Jaroß, Humboldt-Universität zu Berl<strong>in</strong>Dr. Michael Schween, Philipps-Universität MarburgProf. Dr. Wolfg<strong>an</strong>g Söhnchen, Hochschule MerseburgJulia Sosna, Freie Universität Berl<strong>in</strong>Karol<strong>in</strong>e Spelsberg, Folkw<strong>an</strong>g-Hochschule Essen
206Christ<strong>in</strong>e Speth, Audi AGProf. Dr. Sascha Spoun, Universität LüneburgProf. Dr.-Ing. Jörg Ste<strong>in</strong>bach, Technische Universität Berl<strong>in</strong>Dr.-Ing. Karl-He<strong>in</strong>rich Ste<strong>in</strong>heimer, ver.di-B<strong>und</strong>esvorst<strong>an</strong>dMar<strong>in</strong>a Ste<strong>in</strong>m<strong>an</strong>n, Deutscher Akademischer Austausch<strong>die</strong>nstPD Dr. Matthias Stickler, Universität WürzburgGerhard Stocker, Witten/Annen Institut für Waldorf-PädagogikJ<strong>an</strong>osch Stratem<strong>an</strong>n, AStA BielefeldSilvia Stud<strong>in</strong>ger, Staatssekretariat für Bildung <strong>und</strong> Forschung SBFProf. Dr. Dr. h.c. Ulrich Teichler, Universität KasselDr. Sab<strong>in</strong>e Teichm<strong>an</strong>n, Universität RostockDoris Ternes, Fachhochschule KoblenzBarbara Texter, Hertie School of Govern<strong>an</strong>ceDr. Patrick Thuri<strong>an</strong>, Technische Universität Berl<strong>in</strong>Dr. Peter Tremp, Universität ZürichDr. Friedrich Uffelm<strong>an</strong>n, Fachhochschule B<strong>in</strong>genDr. Birgit v<strong>an</strong> Meegen, Agentur für Arbeit AachenSteffen Voigt, Hochschule für Bildende Künste HamburgDr. Beate Volke, Mediz<strong>in</strong>ische Hochschule H<strong>an</strong>noverRechts<strong>an</strong>wält<strong>in</strong> Anabel von Preuschen, B<strong>und</strong>esrechts<strong>an</strong>waltskammerDagmar Vöss<strong>in</strong>g, Universität des Saarl<strong>an</strong>desPeter Wagner, Mart<strong>in</strong>-Luther-Universität Halle-WittenbergAndreas We<strong>in</strong>er, Leibnitz Universität H<strong>an</strong>noverPD Dr. Ulrich Welbers, Universität DüsseldorfBarbara Welterm<strong>an</strong>n, Westfälische Wilhelms-Universität MünsterJörg Wendel, FIBAA Fo<strong>und</strong>ation for International Bus<strong>in</strong>ess Adm<strong>in</strong>istrationAccreditationMarco Westkemper, B<strong>und</strong>esvertretung der Mediz<strong>in</strong>stu<strong>die</strong>renden <strong>in</strong>Deutschl<strong>an</strong>d e. V. (bvmd)Elisabeth Westphal, Österreichische UniversitätskonferenzDr. Birgit Wilhelm, Universität Karlsruhe (TH)Katja W<strong>in</strong>ckelm<strong>an</strong>n-Schlieper, Fachhochschule AachenDr. Gabriele Witter, Hochschule BremenPräsident<strong>in</strong>Elke Kathar<strong>in</strong>a Wittich, AMD Akademie Mode DesignProf. Dr. Margit Wittm<strong>an</strong>n, Fachhochschule SüdwestfalenClaudia Wolf, Fachhochschule Dortm<strong>und</strong>Dr. Güls<strong>an</strong> Yalc<strong>in</strong>, Technische Universität BraunschweigTeilnehmerverzeichnis 207Dr. Amrit Zahir, Universität BaselDr. Nikolaus Zahnen, Universität Konst<strong>an</strong>zDr. Stef<strong>an</strong> Zauner, Universität Tüb<strong>in</strong>genORR Volker Zehle, Otto-von-Guericke-Universität MagdeburgSus<strong>an</strong>ne Zemene, Universität HamburgProf. Dr. Michael Zerr, Merkur Internationale Fachhochschule KarlsruheDr. Peter A. Zervakis, Hochschulrektorenkonferenz
208Programm der Tagung 209Programm der TagungDonnerstag, 10. April 2008:Kompetenzorientierung <strong>und</strong> Qualifikationsrahmen09.30 Uhr –10.15 UhrBegrüßungProf. Dr. Wilfried Müller, Vizepräsident der HRK, Universität BremenProf. Dr. Andreas P<strong>in</strong>kwart, M<strong>in</strong>ister für Innovation, Wissenschaft,Forschung <strong>und</strong> Technologie NRWM<strong>in</strong>isterialdirigent Peter Greisler, Abteilungsleiter HochschulenB<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>ister<strong>in</strong> für Bildung <strong>und</strong> Forschung10.15 Uhr –11.00 UhrWissenschaftlich kompetent für den Beruf qualifizieren - Altes<strong>und</strong> <strong>Neue</strong>s im Bologna-Prozess aus Sicht derHochschulforschungProf. Dr. Dr. h.c. Ulrich Teichler, ehem. Geschäftsführender Direktordes Internationalen Zentrums für Hochschulforschung –UniversitätKasselKommentar:Prof. Dr. Wilfried Müller, Vizepräsident der HRK, Universität Bremen
210Programm der Tagung 21111.30 Uhr –Podiumsdiskussion:15.00 Uhr –Parallele Arbeitsgruppen:13.00 UhrWissenschafts- <strong>und</strong> Forschungskompetenz alsAlle<strong>in</strong>stellungsmerkmal der hochschulischen Bildung?!Dr. Fr<strong>an</strong>k Stef<strong>an</strong> Becker, Siemens AG17.00 Uhr1. Vermittlung von Kompetenzen <strong>und</strong> Stu<strong>die</strong>rbarkeit(Formulierung von Lernergebnissen): Der Blick aufModelle <strong>in</strong> EuropaImke Buß, Stu<strong>die</strong>rendenvertreter<strong>in</strong>, Georg-August-UniversitätGött<strong>in</strong>gen <strong>und</strong> Vorst<strong>an</strong>d des fzsProf. Dr. Angelos Ch<strong>an</strong>iotis, All Souls College OxfordImpulse:- Prof. Dr. Wendy Davies, UK Bologna Expert <strong>an</strong>d ProfessorEmerita at University College London- Drs. Jo<strong>die</strong>n D. Houwers, Rijksuniversiteit Gron<strong>in</strong>genProf. Dr. Wilfried Müller, Vizepräsident der HRK, Universität BremenModeration: Dr. Peter Zervakis , HochschulrektorenkonferenzRapporteur<strong>in</strong>: Mar<strong>in</strong>a Ste<strong>in</strong>m<strong>an</strong>n, DAADProf. Dr. Sascha Spoun, Präsident der Leuph<strong>an</strong>a UniversitätLüneburgProf. Dr. Jörg Ste<strong>in</strong>bach, 1. Vizepräsident der TechnischenUniversität Berl<strong>in</strong>Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Teichler, ehem. Geschäftsführender Direktordes Internationalen Zentrums für Hochschulforschung –UniversitätKasselModeration:Dr. Christi<strong>an</strong>e Gaehtgens, Generalsekretär<strong>in</strong> derHochschulrektorenkonferenz2. Zur Bedeutung <strong>und</strong> Umsetzung von Qualifikationsrahmen(fachlich, national, europäisch)Impulse:- Prof. Dr. Ulrich Bartosch, KU Eichstätt- Dr. Birger Hendriks, Bologna-Beauftragter der LänderModeration: J<strong>an</strong> Rathjen, Referatsleiter Studium <strong>und</strong> <strong>Lehre</strong>,HochschulrektorenkonferenzRapporteur: Dr. Achim Hopbach, Geschäftsführer desAkkreditierungsrats14.00 Uhr –15.00 UhrStu<strong>die</strong> "Die Curricula-Reform <strong>an</strong> Schweizer Hochschulen -St<strong>an</strong>d <strong>und</strong> Perspektiven der Umsetzung der Bologna-Reform<strong>an</strong>h<strong>an</strong>d ausgewählter Aspekte" im Auftrag von CRUS <strong>und</strong>Universität ZürichDr. Peter Tremp, Leiter Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik derUniversität ZürichHIS-Stu<strong>die</strong> zu Stu<strong>die</strong>nabbruchquoten von 20083. Kompetenzorientierter Leistungsnachweis: Anspruch <strong>und</strong>WirklichkeitImpulse:- Prof. Dr. Kar<strong>in</strong> Klepp<strong>in</strong>, Ruhr-Universität Bochum- Prof. Dr. M<strong>an</strong>fred Künzel, Université Fribourg, SchweizModeration: Birgit Hennecke, Universität MünsterRapporteur<strong>in</strong>: Christ<strong>in</strong>e Speth, KU EichstättDr. Ulrich Heuble<strong>in</strong>, HIS Hochschul-Informations-System GmbH,LeipzigModeration:Dr. Peter Zervakis, Leiter Bologna-Zentrum,Hochschulrektorenkonferenz17.00 Uhr –18.00 UhrBerichte aus den ArbeitsgruppenModeration:Monika Schröder, Bologna-Zentrum, Hochschulrektorenkonferenz
212Freitag, 11. April 2008:Employability08.30 Uhr –10.00 UhrVortrag: Vermittlung praxisrelev<strong>an</strong>ter Kompetenzen <strong>in</strong>geisteswissenschaftlichen FächernProf. Dr. Kai Brodersen, des. Präsident der Universität ErfurtKommentar: Was s<strong>in</strong>d beschäftigungsbezogene Kompetenzenaus Sicht der Unternehmen?Dr. Fr<strong>an</strong>k Stef<strong>an</strong> Becker, Siemens AGProgramm der Tagung 2132. Die Promotion als erste forschende Berufstätigkeit?Impulse:- Dr. Hubert Detmer, stellv. Geschäftsführer des DeutschenHochschulverb<strong>an</strong>ds- Dr.-Ing. Uwe Koser; Wissenschaftsprojekte, AUDI AG,IngolstadtModeration: Dr. Gerhard Duda, Referatsleiter EuropäischeForschungs<strong>an</strong>gelegenheiten, HochschulrektorenkonferenzRapporteur<strong>in</strong>: Dr. Priya Bondre-Beil, Programmdirektor<strong>in</strong> DFGOrg<strong>an</strong>isationse<strong>in</strong>heit Graduiertenkollegs, Graduiertenschulen,Nachwuchsförderung10.00 Uhr –10:30 Uhr11.00 Uhr –12.30 UhrModeration: Prof. Dr. Wilfried Müller, Vizepräsident der HRK,Universität BremenVorstellung e<strong>in</strong>er neuen HRK-Umfrage zur Verwendung desDiploma-Supplements <strong>an</strong> deutschen HochschulenMonika Schröder, Bologna-Zentrum, HochschulrektorenkonferenzParallele Arbeitsgruppen:1. Wie k<strong>an</strong>n e<strong>in</strong> Konzept „Fit für den Arbeitsmarkt“ <strong>in</strong> denFächerkulturen umgesetzt werden?Impulse:- Prof. Dr. Hendrik Birus, Vice-President der Jacobs UniversityBremen- Mart<strong>in</strong>a Bischof, HypoVere<strong>in</strong>sb<strong>an</strong>k, Hum<strong>an</strong> ResourcesM<strong>an</strong>agement- Michael Krall, KPMG- PD Dr. Ulrich Welbers, Leiter des Stu<strong>die</strong>nreformbürosGerm<strong>an</strong>istik, He<strong>in</strong>rich-He<strong>in</strong>e-Universität DüsseldorfModeration: Dr. Peter Zervakis, Leiter Bologna-Zentrum,HochschulrektorenkonferenzRapporteur: Dr. Volkmar L<strong>an</strong>ger, Akademieleiter,Berufsakademie Weserbergl<strong>an</strong>d, Hameln12.45 Uhr –13.45 Uhr3. Zur E<strong>in</strong>richtung von Career CenternImpulse:- Andreas Eimer, Leiter des Career Service der Universität Münster- Barbara Texter, Head Career Services & Alumni Relations derHertie School of Govern<strong>an</strong>ceModeration: RA Patrick A. Neuhaus, Bologna-Zentrum,HochschulrektorenkonferenzRapporteur<strong>in</strong>: Kar<strong>in</strong> Rehn, WHU - Otto Beisheim School ofM<strong>an</strong>agement, VallendarBerichte aus den Arbeitsgruppen <strong>und</strong> ResümeeProf. Dr. Wilfried Müller, Vizepräsident der HRK, Universität Bremen13.45 Uhr ENDE DER VERANSTALTUNG
214Beschreibungen der Arbeitsgruppen am 10. April 2008:Arbeitsgruppe 1: Vermittlung von Kompetenzen <strong>und</strong> Stu<strong>die</strong>rbarkeit(Formulierung von Lernergebnissen): Der Blick auf Modelle <strong>in</strong>EuropaKompetenzorientierung <strong>und</strong> Lernergebnisse repräsentieren am deutlichstenden Paradigmenwechsel von e<strong>in</strong>er ‚<strong>in</strong>put’- zu e<strong>in</strong>er <strong>an</strong> Lernergebnissenorientierten Perspektive <strong>in</strong> der akademischen <strong>Lehre</strong>. Sie haben <strong>die</strong> Funktione<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>samen <strong>und</strong> vergleichbaren ‚Sprache’ zwischen denverschiedenen Akteuren (<strong>Lehre</strong>nde, Stu<strong>die</strong>n<strong>in</strong>teressierte, Arbeitgeber etc.),helfen bei der Curriculumspl<strong>an</strong>ung, sichern <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>rbarkeit <strong>und</strong> stellenzudem <strong>die</strong> Verb<strong>in</strong>dung zwischen Qualitätssicherung <strong>und</strong>Qualifikationsrahmen her. Die Erfahrungen mit der Formulierung vonKompetenzen s<strong>in</strong>d traditionell sehr unterschiedlich <strong>in</strong> den verschiedeneneuropäischen Ländern. Mit den Expert/<strong>in</strong>nen besteht <strong>die</strong> Möglichkeit,englische, deutsche <strong>und</strong> niederländische Erfahrungen auszutauschen <strong>und</strong>von den <strong>an</strong>deren Konzepten zu lernen.Arbeitsgruppe 2: Zur Bedeutung <strong>und</strong> Umsetzung vonQualifikationsrahmen (fachlich, national, europäisch)Qualifikationsrahmen können Schlüssel<strong>in</strong>strumente für <strong>die</strong> Erreichungzentraler Ziele des Bologna-Prozesses se<strong>in</strong>. Sie <strong>die</strong>nen als Referenzrahmenzur E<strong>in</strong>ordnung von Qualifikationen <strong>und</strong> Kompetenzen zwischen Ländern,Fächern <strong>und</strong> Bildungs-e<strong>in</strong>richtungen, aber auch als Referenz für <strong>die</strong>Entwicklung <strong>und</strong> Qualitätssicherung von Stu<strong>die</strong>ngängen. Im Workshopwird diskutiert, wie fächerübergreifende <strong>und</strong> fachspezifischeQualifikationsrahmen gestaltet werden sollen, um den Zielen des Bologna-Prozesses - Tr<strong>an</strong>sparenz der Hochschulsysteme, Verständlichkeit derAbschlüsse, Anerkennung von Stu<strong>die</strong>n- <strong>und</strong> Prüfungsleistungen <strong>und</strong>Mobilität der Stu<strong>die</strong>renden - gerecht zu werden <strong>und</strong> gleichzeitig auf e<strong>in</strong>ermehr oder weniger abstrakten Ebene durch <strong>die</strong> Beschreibung der Lernziele<strong>und</strong> Kompetenzen <strong>die</strong> Entwicklung von Curricula zu unterstützen.Programm der Tagung 215Arbeitsgruppe 3: Kompetenzorientierter Leistungsnachweis:Anspruch <strong>und</strong> WirklichkeitDie Ausrichtung <strong>an</strong> Kompetenzen ist der rote Faden, der sich durch <strong>die</strong>Stu<strong>die</strong>ng<strong>an</strong>gsentwicklung der <strong>Bachelor</strong>- <strong>und</strong> <strong>Master</strong>stu<strong>die</strong>ngänge zieht <strong>und</strong>unmittelbare Konsequenzen für <strong>die</strong> Kultur des Prüfens <strong>und</strong> desLeistungsnachweises nach sich zieht. Die Form des Leistungsnachweiseshängt direkt mit der Darstellung spezifischer Kompetenzen zusammen <strong>und</strong>sollte auch den gewählten Lehr- <strong>und</strong> Lernformen gerecht werden. DasLernverhalten der Stu<strong>die</strong>renden wird zudem durch <strong>die</strong> Art desLeistungsnachweises bee<strong>in</strong>flusst.In der Arbeitsgruppe werden im Überblick <strong>und</strong> am Beispiel Konzeptevorgestellt <strong>und</strong> Kriterien entwickelt, <strong>die</strong> zeigen, wie e<strong>in</strong> solcherZusammenh<strong>an</strong>g stärker <strong>in</strong> das Blickfeld rücken k<strong>an</strong>n <strong>und</strong> welche ‚neuen’Prüfungsformen <strong>und</strong> Herausforderungen sich dadurch ergeben. Zudem sollder Frage nachgeg<strong>an</strong>gen werden, wie solche Prüfungsverfahren nachhaltig<strong>in</strong> <strong>die</strong> Stu<strong>die</strong>ngänge <strong>in</strong>tegriert werden können.Beschreibungen der Arbeitsgruppen am 11. April 2008:Arbeitsgruppe 1: Wie k<strong>an</strong>n e<strong>in</strong> Konzept „Fit für den Arbeitsmarkt“<strong>in</strong> den Fächerkulturen umgesetzt werden?Durch <strong>die</strong> Umsetzung der Stu<strong>die</strong>nreform gew<strong>in</strong>nt das Themaarbeitsmarktbezogener Kompetenzen große Bedeutung. In vielenFächerkulturen, <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> den Geisteswissenschaften, stellt <strong>die</strong>Umsetzung e<strong>in</strong>es Konzepts „Fit für den Arbeitsmarkt“ jedoch noch e<strong>in</strong>egroße Herausforderung dar. Ziel der Arbeitsgruppe ist es daher, sowohl ausSicht der Hochschulen wie auch aus der Sicht der Wirtschaft <strong>die</strong>seProblematik zu beleuchten <strong>und</strong> geme<strong>in</strong>sam mit den TeilnehmernLösungs<strong>an</strong>sätze zu entwickeln.Arbeitsgruppe 2: Die Promotion als erste forschende BerufstätigkeitDie Promotionsphase ist <strong>in</strong> Europa im Umbruch. Um den Kern der vomPromovenden zu erbr<strong>in</strong>genden eigenständigen Forschungsleistung r<strong>an</strong>kensich verschiedenartige Forderungen, <strong>die</strong> e<strong>in</strong>e Stärkung der fachspezifischen<strong>und</strong> <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>ären, aber auch der für den außerakademischen
216Arbeitsmarkt nützlichen Qualifikationen <strong>an</strong>streben. Ziel der Arbeitsgruppeist es, <strong>die</strong> Frage des Status der Doktor<strong>an</strong>den im Sp<strong>an</strong>nungsfeld zwischenAusbildung <strong>und</strong> eigenständiger Forschung <strong>und</strong> zwischen akademischen<strong>und</strong> außerakademischen Arbeitsmärkten zu diskutieren <strong>und</strong> auch <strong>die</strong>europäische Entwicklung dabei zu berücksichtigen.Arbeitsgruppe 3: Zur E<strong>in</strong>richtung von Career CenternIn Deutschl<strong>an</strong>d führte <strong>die</strong> <strong>in</strong> <strong>an</strong>gelsächsischen Ländern längst üblicheBetreuung der (künftigen) Absolventen durch <strong>die</strong> Hochschulen l<strong>an</strong>ge e<strong>in</strong>Schattendase<strong>in</strong>. Im S<strong>in</strong>ne der Stu<strong>die</strong>renden kommen <strong>die</strong> deutschenHochschulen <strong>an</strong>gesichts der zunehmenden Hochschulautonomie <strong>und</strong>Profilbildung mittlerweile auch hierzul<strong>an</strong>de nicht mehr <strong>an</strong> der E<strong>in</strong>richtungvon solchen professionellen Career Centern vorbei. In der Arbeitsgruppesollen daher gute Beispiele bereits existierender Career Center vorgestellt<strong>und</strong> im gegenseitigen Austausch mit den Teilnehmer/<strong>in</strong>nen praktischeUnterstützung bei ihrer E<strong>in</strong>richtung <strong>und</strong> ihren Aktivitäten <strong>an</strong>gebotenwerden.Autorenverzeichnis 217AutorenverzeichnisProf. Dr. Ulrich BartoschKatholische Universität EichstättDr. Fr<strong>an</strong>k Stef<strong>an</strong> BeckerSenior Consult<strong>an</strong>tSiemens AGProf. Dr. Hendrik BirusVizepräsident der Jacobs University BremenMart<strong>in</strong>a BischofHum<strong>an</strong> Resources M<strong>an</strong>agementHypoVere<strong>in</strong>sb<strong>an</strong>kDr. Priya Bondre-BeilProgrammdirektor<strong>in</strong>Deutsche Forschungs-Geme<strong>in</strong>schaft (DFG)Prof. Dr. Kai BrodersenPräsident der Universität ErfurtProf. Dr. Wendy DaviesUK Bologna Expert <strong>an</strong>d Professor EmeritaUniversity College LondonDr. Hubert DetmerJustitiar <strong>und</strong> zweiter Geschäftsführer des Deutschen Hochschulverb<strong>an</strong>desAndreas EimerLeiter des Career ServiceUniversität Münster
218Autorenverzeichnis 219Dr. Ulrich Heuble<strong>in</strong>ProjektleiterHIS Hochschul-Informations-System GmbHThomas Hildbr<strong>an</strong>dGeschäftsführer Bereich <strong>Lehre</strong>Universität ZürichDr. Achim HopbachGeschäftsführerAkkreditierungsratProf. Dr. Kar<strong>in</strong> Klepp<strong>in</strong>Wissenschaftliche Leiter<strong>in</strong> des Zentrums für Fremdsprachenausbildung(ZFA)Ruhr-Universität BochumDr.-Ing. Uwe KoserLeiter WissenschaftsprojekteAUDI AGProf. Dr. M<strong>an</strong>fred KünzelUniversität Bern <strong>und</strong> Zentrum für Hochschuldidaktik der UniversitätFribourgMonika SchröderBologna-ZentrumHochschulrektorenkonferenz (HRK)Christ<strong>in</strong>e SpethKatholische Universität EichstättJetzt: Personalmarket<strong>in</strong>g/BildungspolitikAudi AGMar<strong>in</strong>a Ste<strong>in</strong>m<strong>an</strong>nLeiter<strong>in</strong> Arbeitsbereich Bologna-ProzessDAADProf. Dr. Dr. h.c. Ulrich TeichlerEhem. Geschäftsführender Direktor des Internationalen Zentrums fürHochschulforschung, Universität KasselDr. Peter TrempLeiter Arbeitsstelle für HochschuldidaktikUniversität ZürichPD Dr. Ulrich WelbersLeiter des Stu<strong>die</strong>nreformbüros Germ<strong>an</strong>istikHe<strong>in</strong>rich-He<strong>in</strong>e-Universität DüsseldorfDr. Volkmar L<strong>an</strong>gerAkademieleiterBerufsakademie Weserbergl<strong>an</strong>d, HamelnProf. Dr. Wilfried MüllerVizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK)Universität BremenKar<strong>in</strong> RehnCareer ServiceWHU – Otto Beisheim School of M<strong>an</strong>agement, Vallendar