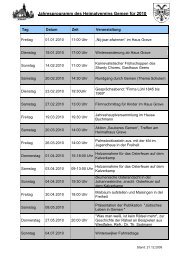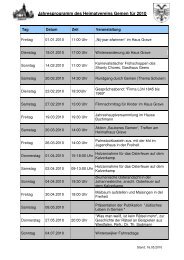HEIMATBRIEF - beim Heimatverein Gemen eV
HEIMATBRIEF - beim Heimatverein Gemen eV
HEIMATBRIEF - beim Heimatverein Gemen eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>HEIMATBRIEF</strong><br />
Nr. 202 September / Oktober 2008<br />
Erstmals gemeinsames Heimattreffen der<br />
Bundesheimatgruppen Breslau-Land und Bolkenhainer Burgenland in Borken<br />
Borken. Am 16. und 17. August 2008 fand in der Borkener Stadthalle Vennehof erstmals ein gemeinsames<br />
Heimattreffen der Mitglieder der Bundesheimatgruppen Breslau-Land und Bolkenhainer Burgenland statt. Bisher<br />
hatte jede Bundesheimatgruppe alle zwei Jahre ihre eigene Zusammenkunft in der Kreisstadt Borken durchgeführt.<br />
An dem Treffen nahmen mehrere hundert Gäste aus ganz Deutschland und außerdem Vertreter der deutschen<br />
Minderheit in Polen teil. Nach getrennten verbandsinternen Versammlungen der Bundesheimatgruppen fand dann<br />
am ersten Veranstaltungstag der öffentliche „Bunte schlesische Nachmittag“ großen Zuspruch.<br />
Über dieses Heimattreffen hat der Vorsitzende der Bundesheimatgruppe Bolkenhainer Burgenland, Hans-Jochen<br />
Meier aus Borken der Redaktion folgenden Bericht eingereicht:<br />
Borken (jm). Das zweitägige gemeinsame Bundesheimattreffen der Bundesheimatgruppen „Breslau – Land“ und<br />
„Bolkenhainer Burgenland“ kann man ohne Übertreibung als großen Erfolg bewerten. Erfreulich gut besucht war<br />
der Schlesische Heimatabend am späten Samstagnachmittag (16. August 2008) in der Borkener Stadthalle im<br />
Vennehof in Borken. Darüber freuten sich sichtlich die beiden Vorsitzenden Hans-Jochen Meier und Leo Quade,<br />
die Organisatoren der Veranstaltung und ihre Vorstandsmitglieder.<br />
Vorsitzender Hans-Jochen Meier überreicht den Lyrikband mit schlesischen Mundartgedichten den drei Töchtern von Rektor A. Tost<br />
Rektor Meier verwies auf das vom Team der Bolkenhainer Heimatstube frisch herausgegebene Mundartbuch mit<br />
80 Gedichten von Rektor Alfred Tost mit dem Titel „Durt bin ich ju derrheeme!“ Die ersten Exemplare konnte er den<br />
drei Töchtern des Dichters überreichen, die sich sehr freuten über den auch äußerlich und mit vielen historischen<br />
Kurz informiert<br />
• 15.11.2008 - Seminar „Einführung in die Namenkunde“ der Gesellschaft für historische Landeskunde des<br />
westl. Münsterlandes in Vreden, Landeskundliches Institut Westmünsterland<br />
• 30.12.2008 - Mittwinterabend in Erve Kots, Lievelde/NL,Thema: Van Huus un Gaorden & Planten und Bloomen<br />
• 09.05.2009 - Westfalentag m.d. Mitgliederversammlg des Westf. Heimatbundes in Paderborn-Schloss Neuhaus
2 <strong>HEIMATBRIEF</strong> Nr 202 / September/Oktober 2008<br />
INHALT<br />
AKTUELLES .......................................................... 5<br />
JAHRESBERICHTE - TAGUNGEN ....................... 8<br />
VEREINSNACHRICHTEN ................................... 11<br />
BUCHTIPPS ........................................................ 19<br />
BLICK IN ZEITSCHRIFTEN ................................ 22<br />
WAS - WANN – WO – AUSSTELLUNGEN - ...... 26<br />
PLATTDÜTSKE VERTÄLLKES ETC................... 28<br />
IMPRESSUM ....................................................... 28<br />
Bilden aus dem „Bolkenhainer Bildarchiv“ ausgestatteten Lyrikband. (siehe hierzu auch die Buchbeschreibung von Frau<br />
Schwack auf Seite 19 dieses Heimatbriefes).<br />
An diesem Abend gab es zahlreiche Gedichte aus dem neuen Buch und Anekdoten aus dem Burgenland, vorgetragen<br />
von Mundartsprechern der Heimatgruppen. Die Musik von der Gruppe Brigitte und Martin Eichholz mit<br />
den Gebrüdern Sattelmaier und die Tänze der Brauchtumsgruppe „Jonathan“ aus Neuss kamen <strong>beim</strong> Publikum gut<br />
an. Insbesondere bei den schlesischen Liedern sangen viele Gäste gerne mit.<br />
Die Brauchtumsgruppe „Jonathan“ aus Neuss erfreute mit ihren Tänzen in schlesischer Tracht. Foto: jm<br />
Nach dem Einlass um 10.00 Uhr am Sonnabendmorgen füllte sich der Saal bis zur Mittagszeit, so dass nur wenige<br />
der 400 aufgestellten Plätze frei blieben. Die Zeit bis zum Schlesischen Heimatnachmittag nutzten die Besucher<br />
zu ausgiebigen Gesprächen mit Freunden, Bekannten, Nachbarn und Verwandten.
Nr. 202 / September/Oktober 2008 <strong>HEIMATBRIEF</strong> 3<br />
Am Sonnabend war die Stadthalle <strong>beim</strong> 20. Heimattreffen gut besucht Foto: jm<br />
Bei der Feierstunde am Sonntagvormittag begrüßten Hans-Jochen Meier und Leo Quade die Gäste und Ehrengäste,<br />
darunter Landtagsabgeordnete und die Bundestagsabgeordneten Bernhard Tenhumberg (CDU) und Christoph<br />
Pries (SPD). Eine besondere Ehrung gab es für den Pressesprecher des Kreises Borken, Karl-Heinz Gördes,<br />
der zugleich zuständig ist für Patenschaftsangelegenheiten. Er erhielt für seine Unterstützung der Bundesheimatgruppe<br />
„Breslau – Land“ aus den Händen von Leo Quade die Ehrennadel in Gold mit Urkunde überreicht.<br />
Borkens Bürgermeister Rolf Lührmann erinnerte an die Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat<br />
verlassen mussten und meinte, dass auch die Vorgeschichte der Vertreibung nicht ausgeblendet werden dürfe.<br />
Aber auch derjenige verstoße gegen die unteilbare Menschlichkeit, der die Nachgeschichte, die völkerrechtswidrige<br />
Vertreibung und die Verbrechen in der Zeit von 1945/46 ausblende. Lührmann bezog sich auf eine Aussage<br />
Ralph Giordanos, das er im Vertreibungsbuch von Jochen Meier gefunden habe. Er rief dazu auf, Schlesien, das<br />
Land mit den vielen Schönheiten und Sehenswürdigkeiten auch als Reiseland wieder zu entdecken.<br />
Der Landrat des Kreises Borken, Gerd Wiesmann, freute sich, dass nun beide Heimatgruppen die Treffen gemeinsam<br />
veranstalten. Er begrüßte die Kooperation ausdrücklich. Wiesmann erinnerte daran, dass gerade im<br />
Kreis Borken viele Schlesier lebten, die hier aktiv und engagiert das gesellschaftliche Leben bereicherten. „Auf<br />
vielen Gebieten hat sich durch die Kreispartnerschaft mit dem Landkreis Breslau ein reger Austausch entwickelt“,<br />
so der Landrat.
4 <strong>HEIMATBRIEF</strong> Nr. 202 / September/Oktober 2008<br />
Bildzeile v.l.n.r.: Die Vorsitzenden der Bundesheimatgruppen Hans-Jochen Meier (Bolkenhain) und Leo Quade (Breslau),<br />
Borkens Bürgermeister Rolf Lührmann, Landrat Gerd Wiesmann, Karlheinz Gördes (<strong>beim</strong> Kreis zuständig für die Patenschaftsarbeit)<br />
und Gerd Hilbing (bis zu seiner Pensionierung Patenschaftsbeauftragter der Kreisverwaltung) Foto: Gehling/BZ<br />
In seinem Festvortrag plädierte Privatdozent Dr. Winfried Halder, Direktor der Stiftung „Gerhart-Hauptmann-<br />
Haus“ und Vorsitzender der AG ostdeutsche Museen, Heimatstuben und Sammlungen, für den Erhalt und die Pflege<br />
ostdeutschen Kulturgutes. Seiner Meinung nach müssten die ostdeutschen Heimatstuben und Museen in der<br />
Fläche als geschichtliche „Stolpersteine“ erhalten bleiben. Denn nahezu jeder vierte Einwohner Nordrhein-<br />
Westfalens habe schlesische Wurzeln.<br />
Martin Eichholz mit seiner Frau Brigitte und den Brüdern Sattelmaier gestaltete die Festveranstaltung im ersten<br />
Teil musikalisch. Der zweite Teil war der Borkener Musikschulgruppe für alte Musik, „Saltarello“ mit ihrer Leiterin<br />
Claudia Senft vorbehalten. Die jungen Musiker spielten ausnahmslos auf mittelalterlichen Instrumenten und beherrschten<br />
diese souverän.<br />
Am Ende der Feierstunde sangen die Teilnehmer mit Unterstützung der Musikgruppen die deutsche Nationalhymne.<br />
Zum Hintergrund:<br />
Bereits seit 1965 besteht die Patenschaft der Stadt Borken mit der Bundesheimatgruppe Bolkenhainer Burgenland,<br />
in der sich die ehemaligen deutschen Bewohner Bolkenhains und der umliegenden Landgemeinden zusammengeschlossen<br />
haben. Der Kreis Borken hält seit 1987 die Patenschaft über die Bundesheimatgruppe Breslau-<br />
Land, die von Bürgern des alten deutschen Landkreises um die schlesische Metropole 1962 in Aachen gegründet<br />
worden war und zunächst vom dortigen Kreis betreut wurde. Aus beiden Patenschaftsinitiativen kam später dann<br />
auch die Anregung zu Partnerschaften mit den heutigen – polnischen – Gebietskörperschaften. So pflegt die Stadt<br />
Borken eine Partnerschaft mit Bolkow/Bolkenhain und der Kreis Borken mit dem Landkreis Wroclaw/Breslau. An<br />
den vielfältigen Begegnungsmaßnahmen im Rahmen der Partnerschaften wirken die beiden Bundesheimatgruppen<br />
von Anfang an intensiv mit.
5 <strong>HEIMATBRIEF</strong> Nr 202 / September/Oktober 2008<br />
AKTUELLES<br />
Paulusplakette für eine "engagierte Bürgerin":<br />
Ruth Betz erhielt hohe Auszeichnung<br />
Münster. Inzwischen sind es Monate her, dass<br />
Oberbürgermeister Dr. Berthold Tillmann und Ruth<br />
Betz, die Stadtheimatpflegerin der Stadt Münster, auf<br />
einem Empfang beieinander standen. Damals kündigte<br />
er ihr augenzwinkernd die Einladung zu einem<br />
„kleinen Überfall“ an. Spätestens am Sonntagmorgen<br />
(07.09.2008) wusste sie, was sich hinter der Bemerkung<br />
verbarg.<br />
Im Mühlenhof, eingebunden in die Auftaktveranstaltung<br />
der 30. Niederdeutschen Tage, bekam Betz<br />
feierlich die Paulusplakette überreicht - immerhin die<br />
zweithöchste Auszeichnung, die Münster zu vergeben<br />
hat. In der Laudatio stellte Tillmann die herausragenden<br />
Leistungen einer „engagierten Bürgerin" heraus.<br />
Sie habe sich nicht nur die Stadt und deren Ortsteile<br />
„vertraut gemacht“, sondern spüre für deren Belange<br />
zugleich intensive Verantwortung.<br />
Sympathieträgerin<br />
Als Beispiele nannte er Mitarbeit in Klassenpflegschaften,<br />
Nachbarschaftsrunden, Gesprächskreisen<br />
und Pfarrgemeinderäten. Darüber hinaus war Betz<br />
eine der Ersten, die den „Stammtisch Kinderhaus“<br />
konstituierten. Gleiches galt für die Gründung der<br />
„Bürgervereinigung Kinderhaus“. Im Jahr 1991 wurde<br />
sie von der hiesigen Arbeitsgemeinschaft der in der<br />
Heimatpflege tätigen Organisationen zur Sprecherin<br />
gewählt, drei Jahre danach trat die Sympathieträgerin<br />
ihr jetziges Amt an.<br />
Dass sie sich gerade um Tradition und Brauchtum<br />
große Verdienste erwarb, blieb nicht unerwähnt. „Mit<br />
dieser Verleihung“, unterstrich Tillmann, „verbinden<br />
Rat und Verwaltung auch eine besondere Würdigung<br />
der Arbeit aller Vereine, Zusammenschlüsse, Gruppen<br />
und Initiativen“, die sich in ähnlicher Weise dem<br />
Gemeinwohl verpflichtet fühlen würden. „Deshalb<br />
habe ich mich entschlossen, die Ehrung hier und heute,<br />
vor großer Kulisse, <strong>beim</strong> diesjährigen Familientreffen<br />
der <strong>Heimatverein</strong>e vorzunehmen.“<br />
Goldenes Buch<br />
Sodann bat er die Hauptperson nach vorne, überreichte<br />
ihr zusammen mit einem dicken Blumenstrauß<br />
das Schatzkästchen mitsamt der Plakette, fügte aber<br />
noch einen zweiten Wunsch hinzu: die Unterschrift in<br />
das bereits aufgeschlagene Goldene Buch. Nach<br />
vollzogener Zeremonie ergriff Betz ihrerseits das<br />
Wort. „Alles, was ich tue, tue ich gerne – für Münster“,<br />
sagte sie, sichtlich berührt, mit leiser Stimme.<br />
Foto:<br />
Urkunde, Blumenstrauß und die Schatulle mit der Paulusplakette:<br />
Stadtheimatpflegerin Ruth Betz wurde von OB<br />
Tillmann mit der zweithöchsten Auszeichnung der Kommune<br />
geehrt. [Foto: Halberscheidt]<br />
Dass die Stadt mit der „besonderen westfälischen<br />
Seele“ durch derlei Tatkraft nur profitieren könne,<br />
hatte Tillmann schon zu Beginn seiner Begrüßung<br />
ausdrücklich betont. Gäbe es den beständigen Einsatz<br />
der Zuhörerschar nicht, wäre das Format der<br />
Kommune ein anderes – es wäre eins mit weniger<br />
Gespür für die eigene Historie, mit weniger Beachtung<br />
dessen, was emotionales und mentales „Wir-<br />
Bewusstsein“ bedeute.<br />
Dankesworte<br />
Indem aber Geschichte, Kultur, Lebensweisen immer<br />
wieder aufs Neue in den Fokus gerückt würden,<br />
ergäbe sich ein Platz, in dem Spitzenforschung und<br />
bäuerlicher Alltag, modernste Architektur und barocke<br />
Symmetrie, Kreativkai und Freilichtmuseum sowie<br />
junge Leute und alte Familien einander begegneten.<br />
„Für das und vieles mehr möchte ich allen danken.“<br />
Dieser Artikel und das Foto von Wolfgang Halberscheidt<br />
erschienen am 07.09.2008 in echomuenster.de<br />
– Das Online-Stadtmagazin.<br />
Ferdi Butenweg erhielt Verdienstmedaille des<br />
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland<br />
„De müt ok watt för Marbeck dohn"<br />
Marbeck (wen). Ferdinand Butenweg aus Marbeck<br />
ist Anfang September 2008 mit der Verdienstmedaille<br />
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland<br />
ausgezeichnet worden. Er habe sich durch sein langjähriges<br />
Engagement vor allem im kommunalpolitischen<br />
Bereich ausgezeichnet, heißt es in der Begründung<br />
zur Verleihung. Landrat Gerd Wiesmann betonte
6 <strong>HEIMATBRIEF</strong> Nr. 202 / September/Oktober 2008<br />
dabei gestern während einer Feierstunde im Rathaus<br />
der Stadt Borken: "Ferdinand Butenweg hat sich uneigennützig<br />
in den Dienst der Gesellschaft gestellt."<br />
Sein Engagement sei von hohem Pflichtgefühl geprägt<br />
gewesen.<br />
"Du praktizierst Bürgersinn und Solidarität", sagte<br />
die stellvertretende Bürgermeisterin Marie-Luise Ebbing.<br />
Butenweg war von 1979 bis 1999 Mitglied des<br />
Rates der Stadt Borken und engagierte sich in verschiedenen<br />
Ausschüssen. 1979 wurde der Maurermeister<br />
zum Ortsvorsteher von Marbeck gewählt; er<br />
übt dieses Amt nach fünf Wiederwahlen bis heute<br />
aus. Während seiner Amtszeit seien neue Baugebiete<br />
erschlossen, der Kindergarten Bruchbach eröffnet und<br />
Radwege angelegt worden.<br />
1992 gehörte Ferdinand Butenweg zu den Gründungsmitgliedern<br />
des <strong>Heimatverein</strong>s Marbeck, dessen<br />
Ziele er seither tatkräftig unterstützt. Mit großer Überzeugungskraft<br />
gelang es ihm auch mit seinem kernigen<br />
"De müt ok watt för Marbeck dohn", dass die<br />
Stadt Borken dem <strong>Heimatverein</strong> 1996 ein Grundstück<br />
für die Errichtung eines Heimathauses überließ. Beim<br />
Bau des Heimathauses, das in Eigenleistung des<br />
Vereins errichtet wurde, brachte Butenweg sich stark<br />
ein, mauerte und fugte selbst mit. Der Ortsvorsteher<br />
setzte sich auch für die Erhaltung der plattdeutschen<br />
Sprache und des plattdeutschen Liedgutes ein.<br />
1998 wirkte Butenweg bei der Renovierung der<br />
ehemaligen Pfarrkirche St. Michael in Marbeck maßgeblich<br />
mit. Immer wieder sei es ihm gelungen, andere<br />
Marbecker zur Mitarbeit zu motivieren. Butenweg<br />
ist seit über 50 Jahren Mitglied des Schützenvereins<br />
St. Michael Marbeck, in dem er bis Ende der 1970er<br />
Jahre insgesamt rund 15 Jahre im Vorstand mitarbeitete.<br />
Er initiierte die Renovierung des Kriegerehrenmals,<br />
organisierte die Pflasterung, stellte eigene<br />
Fahrzeuge zur Verfügung und legte auch selbst kräftig<br />
Hand an. Ebenso habe er <strong>beim</strong> Ausbau des neuen<br />
Festplatzes geholfen.<br />
Dieser Artikel von Gregor Wenzel erschien am 10.<br />
September 2008 in der Borkener Zeitung.<br />
Manfred Töns, Vorsitzender des<br />
Eper <strong>Heimatverein</strong>s, verstorben<br />
Engagement in Beruf und Ehrenamt<br />
Gronau-Epe. Der Tod kam einen Tag nach seinem<br />
69. Geburtstag: Nach langer schwerer Krankheit starb<br />
am 5. September der Vorsitzende des Eper <strong>Heimatverein</strong>s,<br />
Manfred Töns. 1939 in Epe geboren, begann<br />
Töns nach der Schule eine Ausbildung zum Weber<br />
bei der Eper Niederlassung der Ochtruper Textilfirma<br />
Gebrüder Laurenz. Nach Besuch des Ausbildungswerkes<br />
Gronau und Absolvierung verschiedener Refa-<br />
Lehrgänge wurde Töns 1964 als Zeitnehmer in der<br />
Refaabteilung beschäftigt. 1969 wechselte er als Leiter<br />
der Arbeitsstudienabteilung in ein Emsdettener<br />
Unternehmen, ab 1971 war er in dieser Funktion bei<br />
M. van Delden Gronau tätig. 1977 wurde er Hauptabteilungsleiter<br />
und übernahm zusätzliche Aufgaben im<br />
Produktplanung und Disposition der Werke Gronau<br />
und Ochtrup. Die Ernennung zum stellvertretenden<br />
Geschäftsbereichsleiter Technik folgte 1979, ehe<br />
Töns 1980 Technischer Leiter der Werke I und II in<br />
Ochtrup wurde. Im selben Jahr erfolgte die Ernennung<br />
zum Mitglied des Vorstandes. Als die Van-Delden-AG<br />
1998 in eine GmbH umfirmiert wurde, wurde Manfred<br />
Töns Geschäftsführer, ehe er 1999 ausschied.<br />
In den zurückliegenden Jahren bis unmittelbar vor<br />
seinem Tod widmete sich Töns mit großer Leidenschaft<br />
dem Eper <strong>Heimatverein</strong>, dessen Mitglied er seit<br />
1994 war. 2003 in den Vorstand des Vereins gewählt,<br />
übernahm er 2004 als Nachfolger von Wilm Leefken<br />
das Amt des Vorsitzenden. Mit Durchsetzungsvermögen<br />
und nachhaltig seine Standpunkte vertretend,<br />
leitete Töns den <strong>Heimatverein</strong>, der durch ihn viele<br />
neue Impulse erhielt. Zahlreiche Projekte des <strong>Heimatverein</strong>s<br />
wurden von ihm oder mit seiner tatkräftigen<br />
Unterstützung auf den Weg gebracht – so etwa die<br />
Errichtung des Torfstecher-Denkmals, die Restaurierung<br />
des Wolberts-Kreuzes und die Aufstellung der<br />
Eper „Schaufenster“ mit historischen Fotografien.<br />
Auch die besonders gestalteten Ortseingangstafeln<br />
gehen auf seine Initiative zurück.<br />
Als Folge der Errichtung des „Torfstechers“ entstanden<br />
nach einem Konzept von Töns ein Vennlehrpfad<br />
und die Anbindung des Naturraumes Gronau-Epe an<br />
die „Flamingoroute“. Engagiert war Töns zudem im<br />
Förderverein Landesgartenschau, zu dessen Gründungsmitgliedern<br />
er 1999 zählte und dessen stellvertretender<br />
Vorsitzender er war. Auch in der Nachfolgeorganisation<br />
(Bürgerverein „Dinkelaue“) engagierte er<br />
sich und trug zum Gelingen vieler Projekte maßgeblich<br />
bei. So zeigte bei der Landesgartenschau die<br />
Ausstellung „Am Anfang war die nackte Haut“, die<br />
sich mit der Textilgeschichte befasste, unter anderem<br />
seine Handschrift. Und auch an der Planung des Textildenkmals<br />
(Delden-Büste, Industrie-Relief) auf dem<br />
LAGA-Gelände war er beteiligt.<br />
Dieser Artikel erschien am 11. September 2008 in<br />
den Westfälischen Nachrichten (Gronau)
Nr. 202 / September/Oktober 2008 <strong>HEIMATBRIEF</strong> 7<br />
Zweisprachige Ortsschilder<br />
in der Wojewodschaft Oppeln<br />
(sc). In einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen<br />
Zeitung vom 13. September 2008 steht, dass jetzt<br />
nach dreijährign Verhandlungen in der Wojewodschaft<br />
Oppeln in einigen Gemeinden zweisprachige Ortsschilder<br />
erlaubt werden. Sie sind bereits aufgestellt<br />
worden.<br />
Aus dem Artikel geht hervor, dass im Südwesten<br />
Polens der größte Teil der deutschen Minderheit lebt.<br />
In der Volkszählung im Jahre 2002 bezeichneten sich<br />
153 000 Menschen als Deutsche. Weitere 173 000<br />
gaben als Nationalität „Schlesier“ an.<br />
Berichtet wird, dass in den 71 Gemeinden in diesem<br />
Gebiet 26 Ortschaften einen Anteil von 20 Prozent<br />
Deutschen haben. Damit ist die gesetzlich festgelegte<br />
Voraussetzung geschaffen für zweisprachige Ortsschilder.<br />
Neuer Chefarchäologe<br />
Professor Dr. Michael Maria Rind für Westfalen<br />
(sc). Nach 34jähriger Tätigkeit ist Dr. Gabriele Isenberg<br />
als Direktorin der Archäologie für Westfalen in<br />
den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Ihr Nachfolger<br />
wird ab dem 1. Januar 2009 der gebürtige<br />
Duisburger Professor Dr. Michael Maria Rind .Dieser<br />
hat in Münster Ur- und Frühgeschichte, Archäologie,<br />
Kunstgeschichte und Volkskunde studiert. Nach verschiedenen<br />
Tätigkeiten in Bayern, jetzt als Kreisarchäologe<br />
<strong>beim</strong> bayerischen Landkreis Kelheim, ist<br />
er seit 2006 auch als außerplanmäßiger Professor an<br />
der Universität in Regensburg tätig. Der Landschaftsverband<br />
Westfalen-Lippe hat seine Tätigkeit zunächst<br />
auf sechs Jahre befristet. In der Archäologie für Westfalen<br />
sind 90 Mitarbeiter beschäftigt.<br />
Aktivitäten im Glockenmonat Oktober 2008<br />
(ws.) Der Initiator des Glockentages im Kreis Borken,<br />
Herr Franz-Josef Menker, hätte gern eine Übersicht<br />
über die Aktivitäten der <strong>Heimatverein</strong>e im Glockenmonat<br />
Oktober 2008. Lediglich der <strong>Heimatverein</strong><br />
Rhede hat sich gemeldet und das Sondergeläut zum<br />
Angelus-Gebet dem Westf. Glockenmuseum bekanntgegeben.<br />
Ihm sei zudem bekannt, dass auch in Südlohn<br />
die Glocken geläutet haben.<br />
Deshalb bittet er alle <strong>Heimatverein</strong>e, ihre Aktivitäten<br />
an die Geschäftsstelle der Heimatpflege des<br />
Kreises Borken (Adresse siehe im Impressum) zu<br />
melden. Dafür möchte er sich an dieser Stelle bei<br />
allen <strong>Heimatverein</strong>en recht herzlich bedanken.<br />
Seminar „Einführung in die Namenkunde“<br />
der Gesellschaft für historische Landeskunde des<br />
westfälischen Münsterlandes in Vreden<br />
Die Gesellschaft für historische Landeskunde des<br />
westlichen Münsterlandes e.V. bietet für alle Interessierten<br />
am 15.11.2008 eine Einführung in die Namenkunde<br />
an.<br />
Woher kommt mein Name? Was war seine ursprüngliche<br />
Bedeutung? - Namen verraten etwas über<br />
die geografische Herkunft, die Berufe oder Eigenschaften<br />
unserer Vorfahren und sind, im Falle der<br />
Vornamen, unsere ganz aktuelle "Visitenkarte."<br />
Warum beschäftigen sich Wissenschaftler mit der<br />
Namenkunde, der Onomastik? Nicht bei allen Namen<br />
ist die Herkunft so leicht ersichtlich wie bei Müller,<br />
Schmidt oder Gerber. Vielmehr bleibt uns oft der Sinn<br />
auf den ersten Blick verschlossen. Wir wissen zwar,<br />
dass Berlin oder Leipzig, Borken oder Coesfeld Städtenamen<br />
sind, aber was sie bedeuten, wissen wir<br />
eben nicht.<br />
Das Geheimnis solcher Namen ist meist deshalb<br />
schwer zu erschließen, weil sie sehr alt sind. Ein Familienname<br />
ist 600, 700 Jahre alt, ein Ortsname kann<br />
1.500 Jahre, ein Flussname 4.000 Jahre alt sein. Das<br />
heißt, in ihnen stecken Wörter, die wir heute gar nicht<br />
mehr kennen. Und Namen verändern sich im Laufe<br />
der Zeit, ihre Schreibweise ist erst in den letzten 100<br />
Jahren einigermaßen stabil, wie jeder Familienforscher<br />
zu seinem Leidwesen feststellen kann.<br />
Die Bedeutung zu entschlüsseln, die jeder Name<br />
einmal hatte, aber auch die Verbreitung oder Verwendung<br />
bestimmter Namen ist Gegenstand und Aufgabe<br />
der Namenforschung. Dabei spielt besonders die regionale<br />
Verbreitung von Namen eine Rolle, schließlich<br />
stehen einige Namen in Verbindung mit ganz bestimmten<br />
Gebieten: Namen wie Ebbing oder Temminghoff,<br />
Schulze Brockhoff oder Kleine Wesselmann<br />
wird zum Beispiel jeder mit Westfalen in Verbindung<br />
bringen.<br />
Das Seminar "Einführung in die Namenkunde" will<br />
sich mit solchen und ähnlichen Fragen beschäftigen.<br />
Es findet an zwei Samstagen von 10 bis 16 Uhr statt;<br />
im ersten Teil am 15. November geht es hauptsächlich<br />
um Personennamen, an einem zweiten, noch<br />
festzulegenden Samstag im Dezember oder Januar<br />
werden vor allem geographische Namen (Flur-, Straßen-,<br />
Orts-, Ländernamen usw.) behandelt.
8 <strong>HEIMATBRIEF</strong> Nr. 202 / September/Oktober 2008<br />
Die Leitung des Seminars hat Prof. Dr. Ludger Kremer<br />
(Universität Antwerpen), Ort: Vreden, Landeskundliches<br />
Institut Westmünsterland (im Hamalandmuseum),<br />
Teilnahmegebühr: 15,-- EUR. Anmeldung<br />
erbeten per E-Mail (info@ghl-westmünsterland) oder<br />
telefonisch: 02564-39.18.20 (nur donnerstags 14-18<br />
Uhr).<br />
(ws.) Desweiteren möchte ich auf die Mitteilungen<br />
(Ausgabe Nr. 5 – Herbst 2008) der Gesellschaft für<br />
historische Landeskunde hinweisen. Diese enthält<br />
u.a. das Jahresprogramm 2009. Die Gesellschaft ist<br />
im Internet auf einer eigenen Homepage vertreten.<br />
Die vorstehenden Mitteilungen, das Jahresprogramm<br />
2009 sowie alles Wissenswerte über die Gesellschaft<br />
finden Sie unter www.ghl-westmuensterland.de.<br />
JAHRESBERICHTE - TAGUNGEN<br />
(ws.) Wie in den vergangenen Jahren trafen sich die<br />
drei <strong>Heimatverein</strong>sbereiche im Kreis Borken unter der<br />
jeweiligen Leitung des Kreisheimatpflegers Wolfgang<br />
Feldhege bzw. der stellvertretenden Kreisheimatpfleger<br />
Alois Mensing und Alfred Janning zu ihren Herbsttagungen.<br />
<strong>Heimatverein</strong>e des Bereichs Bocholt<br />
Zu dieser Tagung erschien am 27.09.2008 im Bocholter-Borkener<br />
Volksblatt folgenden Artikel:<br />
Bocholt (tt). Bei Kaffee und belegten Brötchen<br />
stärkten sich im Suderwicker Pfarrheim St. Michael<br />
die rund 30 Teilnehmer des Herbsttreffens der <strong>Heimatverein</strong>svorstände<br />
aus Bocholt und Umgebung.<br />
Kreisheimatpfleger Wolfgang Feldhege hatte zu dem<br />
jährlichen Treffen eingeladen, das diesmal an der<br />
deutsch-niederländischen Grenze stattfand. Geführt<br />
von Johannes Hoven, Vorsitzender des Suderwicker<br />
<strong>Heimatverein</strong>s, spazierten die Besucher durch Suderwick<br />
und schauten auch im Dinxperloer Grenzlandmuseum<br />
und das Dr.-Jenny-Woon-Zorgcentrum<br />
vorbei.<br />
Im Pfarrheim St. Michael, wo das Herbsttreffen anschließend<br />
fortgesetzt wurde, ging es auch um das<br />
sogenannte Glockenprojekt anlässlich des 360. Jahrestages<br />
des Westfälischen Friedens, der am 24.<br />
Oktober 1648 in Münster und Osnabrück geschlossen<br />
wurde und der den Dreißigjährigen Krieg beendete.<br />
Zur Erinnerung an dieses Ereignis planen die <strong>Heimatverein</strong>e<br />
im westlichen Münsterland zum 24. Oktober<br />
eine gemeinsame Aktion. Vorgesehen ist an diesem<br />
Tag in möglichst allen Kirchen ein Gedenkgeläut,<br />
verbunden mit der Möglichkeit, die Kirchtürme zu besteigen.<br />
Vorgeschlagen wurde, zur Erinnerung an den<br />
westfälischen Friedensvertrag die Kirchenglocken<br />
mittags, kurz nach dem Angelus-Geläut um 12 Uhr,<br />
läuten zu lassen. Das Projekt wollen die am Suderwicker<br />
Herbsttreffen beteiligten Vertreter der <strong>Heimatverein</strong>e<br />
mit den Kirchengemeinden in ihren Heimatgemeinden<br />
absprechen. Geplant sei auch, das „Glockenprojekt“<br />
in den nächsten Jahren fortzuführen,<br />
teilte Feldhege mit.<br />
Johannes Hoven informierte die Vorstände der<br />
<strong>Heimatverein</strong>e über das Leader-Programm und seine<br />
Möglichkeiten zur Finanzierung von Maßnahmen der<br />
integrierten ländlichen Entwicklung. Das nächste<br />
Herbsttreffen findet im Jahr 2009 wahrscheinlich in<br />
Bocholt statt.<br />
<strong>Heimatverein</strong>e des Bereichs Borken<br />
(ws). Die Herbsttagung der <strong>Heimatverein</strong>e des Bereichs<br />
Borken fand Ende September d.J. im Heimathaus<br />
des <strong>Heimatverein</strong>s Marbeck statt. Die Teilnehmer<br />
wurden vom Kiepenkerl des <strong>Heimatverein</strong>s, Hubert<br />
Hadder, mit einem Korn bzw. Anis empfangen.<br />
Anschließend richtete die Vorsitzende des Vereins,<br />
Maria Schwane, herzliche Grußworte an die Teilnehmer<br />
und lud vor Eintritt in die Tagesordnung alle zur<br />
Besichtigung des Heimathauses, der Backstube, des<br />
Geräteschuppens sowie der Außenanlagen ein.<br />
Im schön gedeckten Tennenraum des Heimathauses<br />
bedankte sich der stellvertretende Kreisheimatpfleger,<br />
Alois Mensing, bei der Vorsitzenden Maria<br />
Schwane für die herzliche Aufnahme, die Bewirtung<br />
mit Schnittchen und Getränken sowie die intensive<br />
Führung.<br />
Rückblickend berichteten Teilnehmer über den<br />
Grenzüberschreitenden Heimattag am 06. September<br />
2008 in Losser/NL sowie über den Denkmaltag am<br />
13. und 14. September 2008 im hiesigen Bereich. Da<br />
die Vorträge in Losser überwiegend auf niederländisch<br />
gehalten wurden, bitten die Teilnehmer, diese<br />
Vorträge übersetzt einem der nächsten Heimatbriefe<br />
beizufügen.<br />
Der Vorsitzende des <strong>Heimatverein</strong>s Borken, Alfons<br />
Thesing, war sehr darüber erfreut, dass sich am<br />
Denkmaltag mehrere hundert Besucher über die Aus-
Nr. 202 / September/Oktober 2008 <strong>HEIMATBRIEF</strong> 9<br />
grabungen im westlichen Bereich von Borken informierten.<br />
Danach hat der stellvertretenden Kreisheimatpfleger<br />
Alois Mensing nochmals den Vorschlag des Chefredakteurs<br />
des WMW, Rainer Mannheims, vorgetragen,<br />
dass Vertreter der <strong>Heimatverein</strong>e alle zwei Wochen<br />
einen kurzen Bericht über das Wochengeschehen in<br />
Platt sprechen. Die <strong>Heimatverein</strong>e möchten auch<br />
plattdeutsche Laienspielgruppen ansprechen, ergänzt<br />
Günter Inhester von der Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege<br />
und bittet alle <strong>Heimatverein</strong>e, kurzfristig<br />
bis Ende November 2008 der Geschäftsstelle<br />
„Sprecher“ zu benennen.<br />
Desweiteren stellte Alois Mensing die Aufkleber „Ick<br />
proat platt“ etc. in verschiedenen Varianten vor und<br />
benannte auch die Kosten eines ersten Angebotes.<br />
Diese Aufkleber sollen in Kürze beschafft werden. Die<br />
Geschäftsstelle des Kreises wird sich in den nächsten<br />
Wochen mit den <strong>Heimatverein</strong>en in Verbindung setzen,<br />
damit diese Aufkleber noch vor Weihnachten<br />
ausgeliefert werden können.<br />
Nochmals bat er alle Vertreter der <strong>Heimatverein</strong>e,<br />
aktiv für das Glockenläuten ab 24. Oktober 2008 aus<br />
Anlass der 360. Wiederkehr des Westfälischen Friedens<br />
zu werben.<br />
Abschließend berichteten verschiedene Vertreter<br />
der <strong>Heimatverein</strong>e über die Aktivitäten in ihrem Verein.<br />
So berichtete Klaus Werner vom <strong>Heimatverein</strong><br />
Erle, das zwischenzeitlich die 11. Geschichtstafel im<br />
Ort aufgestellt wurde, was allgemein als sehr nachahmenswert<br />
angesehen wurde. Zudem werde in<br />
Erle wieder zum Jahreswechsel der „Silvester-Ritt“<br />
durchgeführt.<br />
Alfons Thesing stellte die Planungen für die Umgestaltung<br />
des Borkener Markplatzes vor, Helgard Möller<br />
vom <strong>Heimatverein</strong> Velen nannte die Absicht, im<br />
Bereich des Schlosses Velen wieder ein Glockenspiel<br />
zu installieren. Richard Sühling vom <strong>Heimatverein</strong><br />
Raesfeld bat alle <strong>Heimatverein</strong>e, sich auch mit der<br />
Auswanderung und Aufnahme der Flüchtlinge in ihren<br />
Bereichen, insbesondere aus Ostpreußen und Schlesien<br />
auseinander zu setzen.<br />
Ein Vertreter des <strong>Heimatverein</strong>s Hochmoor berichtete<br />
über die Rückschneideaktionen im Bereich der<br />
örtlichen Naturschutzgebiete und der Rundwanderwege<br />
und der Anlage sogenannter Schaulöcher, die<br />
vom Verein NABU aus Bocholt fachmännisch durchgeführt<br />
wurden.<br />
Mit dem Dank an die Vertreter des <strong>Heimatverein</strong>s<br />
Weseke, die die Frühjahrstagung 2009 ausrichten<br />
werden, schloss Alois Mensing die Herbsttagung.<br />
<strong>Heimatverein</strong>e des Bereichs Ahaus<br />
Ahaus-Ottenstein: „Wo bleibt unser Geld“, diese<br />
Frage der <strong>Heimatverein</strong>e aus dem Altkreis Ahaus<br />
hatte nichts mit der aktuellen Bankenkrise zu tun. Sie<br />
richtet sich vielmehr an den Westfälischen Heimatbund,<br />
der einen Teil der Mitgliedsbeiträge der <strong>Heimatverein</strong>e<br />
erhält. Dr. Edeltraud Klueting, Geschäftsführerin<br />
des Westfälischen Heimatbundes und Gastrednerin<br />
auf der Herbsttagung der <strong>Heimatverein</strong>e in Ottenstein,<br />
stellte die vielfältigen Aufgaben des Dachverbandes<br />
der rund 530 <strong>Heimatverein</strong>e vor. Als 1/3 Anteil<br />
des Sachetats kämen die Vereinsgelder unmittelbar<br />
den <strong>Heimatverein</strong>en direkt wieder zugute, so Klueting.<br />
Mustersatzungen für <strong>Heimatverein</strong>e, Rechtsberatung<br />
in Haftungs- und Unfallversicherungsfragen, Präsenzbibliothek,<br />
Pflege der 2.400 Kilometer Wanderwege,<br />
Westfalenkarte, Jugendförderung in Vlotho sowie<br />
Archivierung der Jahresberichte der <strong>Heimatverein</strong>e<br />
nannte sie viele kostenträchtige Beispiele.<br />
Stellvertretender Kreisheimatpfleger Alfred Janning,<br />
der zur Tagung in Ottenstein eingeladen hatte, forderte<br />
die Teilnehmer auf, die Angebote des Dachverbandes<br />
stärker zu nutzen.<br />
Zu Beginn des Treffens stellte Ortsvorsteher Bernhard<br />
Schnell die Entwicklung des 716 Jahre alten<br />
Ortes Ottenstein vor. 3800 Einwohner seien in 40<br />
Vereinen organisiert, lenkte Schnell den Blick auf das<br />
ehrenamtliche Engagement.<br />
Mit der Instandhaltung der Bildstöcke, der Reaktivierung<br />
der Hörsteloer Heide und dem Einstieg in die<br />
Ahnenforschung stellte Hugo Nolte, derzeitige Arbeitsschwerpunkte<br />
des <strong>Heimatverein</strong>s vor, dessen<br />
Vorsitzender er ist. Abplaggen, das Abtragen der oberen<br />
Waldbodenschicht, Brombeersträucher und Birkenaufschlag<br />
entfernen, den Wald roden um den jahrelang<br />
im Waldboden ruhenden Wacholdersamen<br />
zum Wachsen zu bringen: Mit viel Herzblut demonstrierte<br />
Biologe Dr. Christoph Lünterbusch das seit<br />
2004 laufende Projekt zur Rettung der Hörsteloer<br />
Wacholderheide.
10 <strong>HEIMATBRIEF</strong> Nr. 202 / September/Oktober 2008<br />
Vorstände aller <strong>Heimatverein</strong>e aus dem Altkreis Ahaus trafen sich<br />
in Ottenstein zur Herbsttagung.<br />
Zuschüsse für die kleine private Denkmalförderung<br />
könnten zukünftig nicht mehr gewährt werden, da die<br />
Bezirksregierung keine Mittel mehr zur Verfügung<br />
stelle, so Kreisverwaltungsdirektor Bernhard Grote,<br />
zuständig für den Kulturbereich im Kreis Borken.<br />
Durch eine Drittelförderung (Kreis, Gemeinde, Denkmalbesitzer<br />
oder Vereine) konnten in der Vergangenheit<br />
viele kleine Denkmalobjekte renoviert werden.<br />
Alfred Janning erinnerte abschließend an das Projekt<br />
„Glocken erinnern an das Ende des 30-jährigen<br />
Krieges“. Demnach sollen am Freitag, 24.10.08 im<br />
Anschluss an das mittägliche Angelus-Läuten mit<br />
einem 15minütigen festlichen Geläut aller Kirchenglocken<br />
an den europäischen Friedensschluss von<br />
Münster und Osnabrück erinnert werden.<br />
v.l.: Walter Schwane, Redakteur des Heimatbriefes, Alfred Janning,<br />
stellvertretender Kreisheimatpfleger; Dr. Edeltraud Klueting,<br />
Geschäftsführerin Westf. Heimatbund; Bernhard Grote, Fachbereichsleiter<br />
Schule, Bildung, Kultur und Sport <strong>beim</strong> Kreis Borken,<br />
Hugo Nolte, Vorsitzender <strong>Heimatverein</strong> Ottenstein.<br />
Dieser Artikel und die Fotos wurden von Frau Maria<br />
Pier-Bohne vom <strong>Heimatverein</strong> Asbeck eingereicht.<br />
Informationen zum<br />
Westfälischen Heimatbund<br />
Der Westfälische Heimatbund nimmt<br />
als Dachverband der ca. 530 örtlichen<br />
<strong>Heimatverein</strong>e und der ca. 650 ehrenamtlichen<br />
Heimatpfleger in Westfalen Aufgaben<br />
der regionalen Heimat- und Kulturpflege<br />
wahr. Sein Sitz ist in Münster.<br />
Er vertritt einen Personenkreis von ca.<br />
130.000 heimatverbundenen Menschen in<br />
Westfalen. Er wurde 1915 für das Gebiet der damaligen<br />
Provinz Westfalen gegründet. Heute umfasst<br />
sein Tätigkeitsbereich den Landesteil Westfalen<br />
von Nordrhein-Westfalen.<br />
Er gibt die Zeitschrift „Heimatpflege in Westfalen“<br />
heraus.<br />
Die Geschäftsführerin ist Dr. Edeltraud Klueting.<br />
Weitere Informationen über der Westfälischen<br />
Heimatbund können über das Internet unter der<br />
Adresse http://www.lwl.org/LWL/Kultur/whb/ abgerufen<br />
werden.<br />
In der letzten Ausgabe Nr. 5/2008 der „Heimatpflege<br />
in Westfalen“ wird das neue geograhischlandes-kundliche<br />
Dokumentationssystem über<br />
Westfalen für Öffentlichkeit und Schule vorgestellt.<br />
Umfangreiche Informationen sind über die<br />
Internet-Seite: www.westfalen-regional.de abrufbar.<br />
AG Genealogie seit 2006 in Gescher<br />
Die 55. Tagung der Arbeitsgemeinschaft Genealogie<br />
des Kreises Borken fand jetzt im Rathaussaal in<br />
Gescher statt. Seit 2006 gibt es auch im <strong>Heimatverein</strong><br />
Gescher e.V. eine solche Gruppe, in der Rudolf Pierk<br />
und Alfons Haar ehrenamtlich tätig sind.<br />
Elmar Rotherm, Vorsitzender des <strong>Heimatverein</strong>s<br />
freute sich, 65 Ahnenforscher aus dem Kreisgebiet<br />
und dem benachbarten niederländischen Achterhook<br />
begrüßen zu können.<br />
Alfons Nubbenholt, Sprecher der kreisweiten AG<br />
Genealogie, sagte, die Änderung des Personenstandsgesetzes<br />
zum Beginn des Jahres 2009 bringe die<br />
Genealogie einen großen Schritt voran. Es würde die<br />
eigene Forschung in Archiven möglich, Register würden<br />
an zentralen Orten gelagert und vereinfachten die<br />
ortsübergreifende Forschung. Einsehbar würden auch<br />
die Kirchenbücher ab 1874.<br />
Stadtarchivar Willi Wiemold zeigte seine eigene Forschung<br />
seiner mütterlichen Vorfahren den Tagungsteilnehmern<br />
auf. Er konnte 15 Generationen belegen
Nr. 202 / September/Oktober 2008 <strong>HEIMATBRIEF</strong> 11<br />
über einen Zeitraum von 500 Jahren. Mittels einer<br />
Großleinwand stellte er den Zuhörern die einzelnen<br />
Generationen mit Namen vor. Auszüge aus Tauf- und<br />
Heiratsregistern ergänzten seine Erläuterungen.<br />
Ohne die Computertechnik geht es bei der Ahnenforschung<br />
nicht. Auf die Einzelheiten zum neuen Personenstandsgesetz<br />
warte man noch, sagte Alfons<br />
Nubbenholt. Das Aufgabengebiet der Genealogie<br />
umfasse in den <strong>Heimatverein</strong>en auch die neugebildeten<br />
Gruppen, die sich mit Totenzetteln befasse. Hier<br />
ergeben sich ebenfalls zahlreiche Anhaltspunkte für<br />
die örtliche Familienforschung.<br />
Während dieser Zusammenkunft ergab sich umfangreicher<br />
Gesprächsstoff. Ein pensionierter niederländischer<br />
Gymnasiallehrer aus Winterswijk berichtete,<br />
dass er bei seiner Familienforschung ein großes<br />
Stück weiter gekommen sei, als er auf den Namen<br />
van Üüm gestoßen sei.<br />
Die nächsten Treffen der Genealogen finden im<br />
Frühjahr 2009 in Bocholt und im Herbst in Ramsdorf<br />
statt, gibt Bernhard Voßkühler, stellvertretender Vorsitzender<br />
des <strong>Heimatverein</strong>s Hochmoor, an Interessierte<br />
weiter.<br />
AG Genealogie:<br />
Alfons Nubbenholt, Heinrichstraße 26, 48683 Ahaus,<br />
Telefonnr. 02561/67261<br />
E-Mail: d.giersig.@t-online.de<br />
www.genealogie-kreis-borken.de<br />
VEREINSNACHRICHTEN<br />
Beim Heimat- und Folkloretag des<br />
<strong>Heimatverein</strong>s <strong>Gemen</strong> wurde viel aufgeboten<br />
<strong>Gemen</strong> (mge). Wann haben Sie zuletzt den markanten<br />
Pfiff einer Dampflok gehört? Was den Älteren<br />
noch die Vision von Reisen und einer anderen Zeit in<br />
Erinnerung ruft, ist für Jüngere völlig jenseits aller<br />
Erfahrungen. Und doch war zwar keine Dampflok aber<br />
eine alte Hentschel Dampfwalze aus dem Baujahr<br />
1952, von Klaus Stewering liebevoll restauriert, eine<br />
der Attraktionen <strong>beim</strong> Heimat- und Folkloretag des<br />
<strong>Gemen</strong>er <strong>Heimatverein</strong>s.<br />
Es konnte sich sehen lassen, was die Heimatfreunde<br />
aufgefahren hatten. Der aromatische Kohlenrauch<br />
mischte sich mit dem Duft von Ärpelpannekoken. Musikalisch<br />
wurde Einiges geboten und auch Brauchtum<br />
kam nicht zu kurz. <strong>Heimatverein</strong>svorsitzender Albert<br />
Rentmeister begrüßte zahlreiche Gäste, nachdem der<br />
Spielmannszug <strong>Gemen</strong> den Aktionstag eröffnet hatte.<br />
Rentmeister erinnerte daran, dass so ein Folkloretag<br />
in <strong>Gemen</strong> eine Tradition ist, die in regelmäßigen<br />
Abständen auflebt. "Dies ist eine gute Gelegenheit,<br />
den <strong>Heimatverein</strong>, seine Gruppierungen und die Aktivitäten<br />
einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren",<br />
so der Vorsitzende.<br />
Ortsvorsteherin Ursula Zurhausen begrüßte ebenfalls<br />
die Gäste und dann stand auch schon der Shanty-Chor<br />
auf der Bühne, um mit maritimen Liedern<br />
Stimmung zu machen.<br />
Da sich die eigene Tanzgruppe aufgrund eines<br />
Trauerfalls auf die Gastgeberrolle beschränkte, übernahmen<br />
die Tänzerinnen und Tänzer aus Lippramsdorf<br />
deren Part, später auch die Tanzgruppe aus Ostendorf.<br />
Musikalische Einsprengsel lieferten neben dem<br />
Shanty-Chor die Harmonikaclubs aus Rhede und<br />
Aalten sowie die Jagdhornbläser des Hegerings Borken.<br />
"Hast du deinen alten Mähdrescher aus Lembeck<br />
mitgebracht?", frotzelte Bernhard Schemmer mit dem<br />
Vorsitzenden. Dem war zwar nicht so, dennoch waren<br />
die alten landwirtschaftlichen Maschinen bei Alt und<br />
Jung von großem Interesse.<br />
Gleiches gilt für die lange Reihe historischer Oldtimer.<br />
Die Feuerwehr war diesmal nicht in Löschaktion,<br />
sondern hielt die hölzernen Laufräder in Bewegung.<br />
Dass Folklore nicht auf die engere Heimat beschränkt<br />
ist, bewiesen Ilse Maria Montes de Oca Willerer und<br />
Melanie Wächter mit ihren schwungvollen mexikanischen<br />
Tänzen eine bunte Bereicherung des Programms.<br />
"Wir freuen uns besonders, dass vor allem auch<br />
jüngere Leute sich für historische Dinge interessieren",<br />
meinte der Vorsitzende.
12 <strong>HEIMATBRIEF</strong> Nr. 202 / September/Oktober 2008<br />
Dazu zählte auch wohl der Auftritt von Uli Heßling<br />
und Hendrik Böing, die mit buntem Hut und Stock als<br />
Gästebidder die Leute zur Hochzeit von Claudia und<br />
Jürgen zu Christi Himmelfahrt einluden. Jetzt wird<br />
wohl in <strong>Gemen</strong> heftig gerätselt, wer die beiden sind.<br />
Dieser Artikel und das Foto von Herrn Hubert Gehling<br />
erschienen am 22.09.2008 in der Borkener Zeitung.<br />
Seit fast 30 Jahren ist der Zweifel beseitigt<br />
<strong>Heimatverein</strong> Raesfeld und die Isselquelle<br />
Raesfeld (jü). Vor 25 Jahren kaufte die Gemeinde<br />
Raesfeld das Quellgelände der Issel. Der <strong>Heimatverein</strong><br />
übernahm die Pflege des Areals, das Jahr für Jahr<br />
zahlreiche Interessierte besuchen. Aus Anlass des<br />
Jubiläums hatten die Heimatfreunde nun zum Kaffeetrinken<br />
an der Isselquelle eingeladen.<br />
Werner Hansen trug Wissenswertes zur Entstehung<br />
der Quelle vor. "Die Isselquelle entspringt schon seit<br />
Menschengedenken hier in Raesfeld, am Vennekenweg<br />
in Hoffjanns Garten", erzählte er. Das heutige<br />
Isseltal sei eigentlich ein uraltes Urstromtal aus der<br />
Saale-Eiszeit (vor 260.000 bis 125.000 Jahren), durch<br />
das Schmelzwasser des zu der Zeit etwa 200 Meter<br />
mächtigen Gletschereises abgeflossen sei. Später sei<br />
das stark ausgeprägte Urstromtal mit Flugdecksanden<br />
bis auf eine relativ flache Mulde, dem heutigen Isseltal,<br />
wieder zugeweht worden. Im Jahr 1960 habe der<br />
Raesfelder Bürgermeister und Heimatforscher Johann<br />
Löchteken den Ursprung der Issel öffentlich angezweifelt,<br />
mit der Begründung, die Quelle falle immer<br />
wieder trocken.<br />
Werner Hansen referierte an der Isselquelle.<br />
(Foto: Bosse)<br />
Löchteken behauptete, dass der Anfang der Möllmanns<br />
Becke oder die Wellbrockquelle die eigentliche<br />
Isselquelle seien oder beide Bäche zusammen die<br />
Issel bildeten. Weitere Auseinandersetzungen habe<br />
es zwischen Löchteken und niederländischen Isselfreunden<br />
gegeben. Die Holländer seien 1978 mit der<br />
Bitte um die Feststellung der tatsächlichen Lage der<br />
Quelle an den <strong>Heimatverein</strong> Raesfeld herangetreten.<br />
Die geologischen und hydrogeologischen Untersuchungen<br />
habe er, Werner Hansen, 1978/79 vorgenommen.<br />
Ergebnis: "Die Quelle der Issel liegt hier in<br />
Hoffjanns Garten." Auch Johann Böckenhoff habe<br />
dies durch Höfe- und Flurforschungen bestätigt.<br />
Im Jahr 1980 habe der Hauptausschuss des Gemeinderats<br />
beantragt, die Isselquelle wieder sichtbar<br />
zu machen. 1983 sei die alte Isselquelle ausgebaut<br />
worden. Das neu gestaltete Areal weihte der damalige<br />
Bürgermeister Paß offiziell ein. "Der Issel-Ursprung<br />
als Quelle der Freundschaft", so stand es damals in<br />
der BZ geschrieben. Bei der Jubiläumsfeier waren<br />
viele Heimatfreunde aus der Umgebung sowie aus<br />
den Niederlanden anwesend, die sich freundschaftlich<br />
untereinander austauschten.<br />
Dieser Artikel von (jü.) und das Foto von Bosse erschienenen<br />
am 28.09.2008 in der Borkener Zeitung.<br />
<strong>Heimatverein</strong> Gronau auf Tagesfahrt<br />
Juwel unter den Schlössern<br />
Gronau. „Ein Juwel unter den Schlössern ist zweifellos<br />
das Schloss Ippenburg in Lockhausen bei Bad<br />
Essen.“ Das schreibt der <strong>Heimatverein</strong> Gronau in<br />
einer Pressemitteilung, denn das Schloss war das Ziel<br />
einer Reisegruppe des <strong>Heimatverein</strong>s. Ein besonderer<br />
Anlass für diese Reise war das herbstliche Gartenfestival<br />
im Schlossgarten als Schlussveranstaltung in<br />
diesem Jahr.<br />
Der Adelssitz liegt eingebettet in eine Wiesen- und<br />
Parklandschaft. Die Familie des Philip Freiherr von<br />
dem Bussche besitzt das prächtige Anwesen seit<br />
mehr als 600 Jahren. Der neugotische Bau verfügt<br />
über 100 Zimmer mit noch viel mehr Fenstern. Drei<br />
Generationen bewohnen das Schloss. Zum Betrieb<br />
gehören 300 Hektar Ackerflächen und 330 Hektar<br />
Wald. Der Gartenbereich ist die Domäne der Schlossherrin<br />
Viktoria von dem Bussche. Nach englischem<br />
Vorbild organisiert sie seit 1998 im Frühjahr, Sommer<br />
und Herbst Gartenfestivals. Über dreißig Schaugärten<br />
boten den Besuchern einen Einblick in die vielfältige<br />
Gartengestaltung. Neben der herbstlichen Blumenpracht<br />
überwogen noch die Rosengewächse. Gartenskulpturen<br />
– von Künstlerhand geschaffen – ergänzten<br />
die Landschaft. Aussteller boten rund um das
Nr. 202 / September/Oktober 2008 <strong>HEIMATBRIEF</strong> 13<br />
Schloss Pflanzen, Garten- und Landhausaccessoires<br />
sowie ländliche Produkte zum Verkauf an.<br />
Dieser Artikel erschien am 16. September 2008 in<br />
den Westfälischen Nachrichten (Gronau).<br />
Von Vespertied und Ärpelspannkook<br />
Erzählabend in <strong>Heimatverein</strong> Reken<br />
Reken (pd). "Kartoffelferien": Mit diesem Thema befasste<br />
sich die Proaloawendrunde des Rekener <strong>Heimatverein</strong>s<br />
im Heimathaus Uphave. Vorsitzender<br />
Bernd Hensel gab den Heimatfreunden einen Abriss<br />
über die Geschichte der Kartoffel. Spanische und<br />
englische Seefahrer hatten die Kartoffel im 16. Jahrhundert<br />
von Südamerika nach Europa gebracht. In<br />
den hiesigen Regionen war die Kartoffelpflanze zunächst<br />
nur eine botanische Rarität, die wegen ihrer<br />
Blüte als Topfpflanze die Gärten von Geistlichen,<br />
Fürsten und Gelehrten schmückte. Erst 200 Jahre<br />
später schaffte die Knolle als Agrarfrucht ihren Durchbruch.<br />
Der preußische König<br />
Friedrich der Große musste<br />
um 1770 seine misstrauischen<br />
Bauern zwingen,<br />
die fremden Kartoffeln<br />
anzubauen. Man<br />
stellte fest, dass die Kartoffel<br />
auch auf kargen<br />
Böden anzubauen war,<br />
Wild und weidendes Vieh<br />
fügten dem giftigen Kartoffelkraut<br />
keinen Scha-<br />
Hermann Benning bei<br />
seinem Vortrag über die<br />
Kartoffelernte in früherer<br />
Zeit (Foto: pd)<br />
den zu, und schließlich<br />
war der wichtigste Vorteil<br />
der anderthalbfache Flächenertrag<br />
im Vergleich<br />
zum Anbau von Getreide.<br />
Zum Schluss war auch die häusliche Zubereitung<br />
einfacher als <strong>beim</strong> Getreide: Kartoffeln musste man<br />
weder dreschen, noch malen, noch zu Brot backen.<br />
Die Kartoffelernte im September und Oktober war<br />
eine Plackerei. Der Hülstener Landwirt Hermann Benning<br />
berichtete über die Ernte früher. Mühselig mit der<br />
Hand in den Boden wühlen, mit einer Forke vorsichtig<br />
die Kartoffelnester ausheben und die Knollen einsammeln.<br />
Beim "Kartoffelsuchen" wurde jede Hand<br />
gebraucht. Auch die Schüler mussten anpacken, bis<br />
in die 60er Jahre. Auf dem Lande hießen aus diesem<br />
Grunde auch die Herbstferien immer nur "Kartoffelferien".<br />
Der verstorbene Rekener Heimatforscher Dr. med.<br />
Johann Benson hat es so beschrieben: "Geerntet<br />
wurden die Kartoffeln in der Zeit der großen Herbstferien,<br />
die damals vom 2. September bis 15. Oktober<br />
dauerten. Diese waren wohl eigens in diese Zeit gelegt<br />
worden, damit die Kinder bei der Ernte helfen<br />
konnten. Allenthalben konnte man die fleißigen Kinderhände<br />
bei Auflesen ("Garrern") antreffen. Truppweise<br />
trafen sie sich nachmittags bei Bauern. Zeitweise<br />
hatten sie sich organisiert und wurde von einem<br />
älteren Jungen den einzelnen Arbeitskräftesuchenden<br />
zugeteilt. Um 1900 herum erhielten die Kinder durchschnittlich<br />
50 Pfennig. Um die "Vespertied" und zum<br />
Abendessen, wo es meisten Kartoffelpfannkuchen<br />
("Ärpelspannkook") gab, entwickelten sie einen regen<br />
Appetit."<br />
Mit der Erfindung des Kartoffelroders, zunächst von<br />
Pferden gezogen, wurde die Kartoffelernte leichter.<br />
Dabei drehte sich eine Spindel und schleuderte die<br />
Kartoffeln zur Seite. Um 1900 gab es in Reken nur<br />
eine Kartoffelsorte, die "rote Kepperbäste". Später<br />
kamen "Blauaugen" und "Bona" dazu. Heute gebe es<br />
mehr als 100 Sorten, berichtete Benning. Jede Familie<br />
war damals darauf bedacht, ihren eigenen Bedarf<br />
an Kartoffeln zu decken. Die Bauern bestellten zwei<br />
Morgen ihrer Anbauflächen mit Kartoffeln.<br />
Heute, so schloss Benning, seien fast nur noch<br />
"Vollernter" im Einsatz. In einem Arbeitsvorgang nehmen<br />
sie mehrere Kartoffelreihen auf, sammeln die<br />
Knollen ein und werfen Ranken und Erde zurück auf<br />
den Acker.<br />
Auch der Kartoffelkäfer als Verursacher von Missernten<br />
und letztlich die traditionellen Kartoffelfeuer<br />
nach Abschluss der Erntearbeiten kamen <strong>beim</strong> jetzigen<br />
Erzählabend des <strong>Heimatverein</strong>s zur Sprache.<br />
Bei einem zünftigen Kartoffelessen, das Frauen des<br />
<strong>Heimatverein</strong>s vorbereitet hatten, konnten die Proaloawendbesucher<br />
ihre Erlebnisse austauschen.<br />
Dieser Artikel mit Foto von pd. erschien in der Borkener<br />
Zeitung.<br />
<strong>Heimatverein</strong> Borken auf großer Fahrt<br />
Münster, Herbstlaub und Flammkuchen<br />
Borken (pd). Die schon traditionelle Jahresfahrt des<br />
<strong>Heimatverein</strong>s Borken führte Mitglieder und Gäste in<br />
den Ortenaukreis und von dort nach Straßburg und<br />
ins Elsass. Gleich nach der Ankunft in Oberkirch, der
14 <strong>HEIMATBRIEF</strong> Nr. 202 / September/Oktober 2008<br />
am Fuße des Schwarzwaldes gelegenen Stadt des<br />
Weines, wurden die Besucher auf einem Rundgang<br />
von den malerischen Altstadtwinkeln mit ihren restaurierten<br />
Fachwerkhäusern fasziniert. Gemütliche Weinlokale<br />
luden ein.<br />
Am nächsten Morgen besuchte die Gruppe unter<br />
Leitung eines Reiseführers Straßburg. Das erste Ziel<br />
waren die Gebäude des Europarlaments. Ein Vortrag<br />
informierte über die Aufgabe und Arbeitsweise des<br />
Parlaments. Zahlreiche Fragen zeigten das Interesse<br />
an dieser wichtigen Einrichtung der EU. Es schlossen<br />
sich eine Stadtrundfahrt und ein Rundgang durch die<br />
historische Altstadt an. Besonders reizvoll war das<br />
Gerberviertel am Ufer der Ill mit ihren kleinen Gassen<br />
und den typischen Dachgauben an den malerischen<br />
Fachwerkhäusern. Auch der Besuch des Straßburger<br />
Münsters mit dem beeindruckenden Westportal fehlte<br />
nicht. Die anschließende Schiffsrundfahrt führte an<br />
den Plätzen und Gebäuden aus den verschiedenen<br />
Epochen vorbei.<br />
Ein weiterer Höhepunkt war die Fahrt nach Colmar.<br />
Auf der Elsässer Weinstraße führte der Weg durch<br />
malerische Kleinstädte mit ihren Blumen geschmückten<br />
Fachwerkhäusern und engen Stadttoren sowie an<br />
Weinbergen vorbei, auf denen die Lese voll im Gange<br />
war. Begeistert war die Gruppe von Riquewihr (Reichenweier),<br />
das wegen seines seit dem Mittelalter<br />
unverändert gebliebenen Ortsbildes zu den schönsten<br />
Dörfern Frankreichs gehört. Selbstverständlich gab es<br />
auch den obligatorischen elsässischen Flammkuchen.<br />
Auch Colmar hat sein mittelalterliches Stadtbild mit<br />
zahlreichen Bürgerhäusern erhalten können. Zu Fuß<br />
oder mit der kleinen Stadtbahn haben sich die Besucher<br />
die reizvollen Plätze und Winkel erschlossen.<br />
Einige Kunstliebhaber bewunderten im Museum Unterlinden<br />
den Isenheimer Altar von Matthias Grünewald.<br />
Den Abschluss der viertägigen Fahrt bildete der Besuch<br />
Baden-Badens mit dem Kurhaus und dem Casino<br />
sowie den Thermen und römischen Badruinen in<br />
der Altstadt. In seinem Rückblick konnte der Vorsitzende<br />
des <strong>Heimatverein</strong>s, Alfons Thesing, feststellen,<br />
dass es wieder eine Reise mit vielen Erlebnissen und<br />
Eindrücken war, die noch lange in Erinnerung bleiben<br />
wird. Den besonderen Dank sprach er Edmund und<br />
Annegret Spickers für die Organisation der gelungenen<br />
Jahresfahrt aus, heißt es in einem Pressetext.<br />
Dieser Artikel erschien am 15. Oktober 2008 in der<br />
Borkener Zeitung.<br />
Freut Euch des Lebens" im Stundentakt<br />
In der Nähe des Schlosses in Velen soll das historische<br />
Glockenspiel wieder aufgestellt werden<br />
Velen. "Viele ältere Mitbürger kennen noch das alte<br />
Glockenspiel, das stündlich die Melodie Freut Euch<br />
des Lebens erklingen ließ". So eröffnete Alfons Wellermann,<br />
Vorsitzender des <strong>Heimatverein</strong>s, ein erstes<br />
Treffen, bei dem es um die Frage ging, ob Velen<br />
demnächst ein neues Glockenspiel erhält. Zu dieser<br />
Gesprächsrunde hatte der <strong>Heimatverein</strong> laut Mitteilung<br />
aus dem Rathaus neben Dieter Graf Landsberg-<br />
Velen auch Vertreter der St. Andreas-Schützenbruderschaft<br />
und der Gemeinde Velen eingeladen.<br />
Bürger hätten immer wieder gefragt, ob es nicht<br />
möglich sei, das <strong>beim</strong> Schlossbrand im Jahre 1931<br />
zerstörte historische Glockenspiel zu rekonstruieren,<br />
erklärte Wellermann. Der <strong>Heimatverein</strong> habe den<br />
Gedanken gerne aufgegriffen. "Es wäre schön, wenn<br />
dieses besondere Stück von Alt-Velen wieder zurückgewonnen<br />
werden könnte", unterstützt Bürgermeister<br />
Ralf Groß-Holtick die Idee.<br />
Auch Graf Landsberg-Velen begrüßte die Initiative:<br />
"Für mich ist das alte Glockenspiel des Schlosses<br />
untrennbar mit Velen und der direkten Umgebung des<br />
Schlosses verbunden. Hier sollte daher auch ein<br />
neues Glockenspiel seinen Standort haben."Das historische<br />
Musikinstrument, dessen 37 Glocken 1739/40<br />
durch den Glockengießer Peter van den Gheyn in<br />
Löwen gefertigt worden waren, befand sich in der<br />
Haube des Kapellenturmes. Dorthin kann es aber<br />
nicht zurück. Grund: Nach der Zerstörung war die<br />
Turmhaube in kleinerer Form wieder aufgebaut worden."Vielleicht<br />
lässt sich ein Standort für das Glockenspiel<br />
in einem Träger in der Achse zwischen<br />
Pfarrkirche und Schloss finden. Dann würden Besucher<br />
und Einheimische es nicht nur hören, sondern<br />
auch sehen können", schlug Hoteldirektor Jürgen<br />
Georg vor. Möglichkeiten dazu biete die geplante<br />
Neugestaltung des Kirchumfeldes.<br />
Werner Peters und Christian Schulze Pellengahr<br />
präsentierten Beispiele von mehreren Glockenspielstandorten.<br />
Die Anregungen sollen nun konkretisiert<br />
werden, nachdem die Umsetzung des Projektes<br />
grundsätzlich breite Zustimmung fand. Die Kosten<br />
betragen schätzungsweise 70.000 Euro. Das Geld will<br />
der <strong>Heimatverein</strong> durch Spendenaktionen aufbringen.
Nr. 202 / September/Oktober 2008 <strong>HEIMATBRIEF</strong> 15<br />
Diese Herren sind sich einig: In Velen soll nach historischem<br />
Vorbild in Zukunft wieder ein Glockenspiel erklingen.<br />
Das historische Glockenspiel hatte vor fast 270 Jahren<br />
bereits 2862 Taler gekostet. Alfons Wellermann:<br />
"Reizvoll wäre es sicher, das Glockenspiel in seinem<br />
alten Umfang mit 37 Glocken zu rekonstruieren." Damit<br />
zählte das alte Velener Glockenspiel vor dem<br />
Zweiten Weltkrieg Krieg neben denen der Potsdamer<br />
Garnisonkirche und der Danziger Katharinenkirche zu<br />
den größten Exemplaren im deutschsprachigen<br />
Raum. Allerdings, so Wellermann, sei dies eine Frage<br />
der Finanzen. "Wir wären auch mit einer kleineren<br />
Ausführung zufrieden und hoffen auf eine tatkräftige<br />
Unterstützung aus der Bürgerschaft." Eine erste größere<br />
Spendenzusage liege bereits vor.<br />
Dieser Artikel erschien am 10. Oktober in der Borkener<br />
Zeitung.<br />
<strong>Heimatverein</strong> Schöppingen will<br />
„Altes bewahren“<br />
Schöppingen. Das müssen herrliche Zeiten gewesen<br />
sein: Eigenes Schöppinger Bier, ständig ganz<br />
frisch in der Vechtegemeinde gebraut. Vor einigen<br />
Jahrzehnten gab es so etwas noch, und ein schönes<br />
kleines Eichenfass der Brauerei Müller von 1908<br />
zeugt bis in die heutige Zeit davon. Das kleine Fässchen<br />
liegt mit zwei weiteren Exemplaren auf einem<br />
unteren Regal und teilt sich die liebevoll hergerichtete<br />
Museums-Scheune mit Hunderten von Exponaten:<br />
vom großen, himmelblauen Lanz Bulldog anno 1935,<br />
über eine aufwendig restaurierte Transmission hoch<br />
an der Wand bis hin zu vielen kleinen Stücken, wie<br />
einer handbetriebenen Miele-Waschmaschine.<br />
Wir wollen einfach die Gegenstände, die unsere<br />
Vorfahren ihr Leben lang begleitet haben, aufbewah<br />
ren“, erklärt Hubert Roosmann vom Schöppinger<br />
<strong>Heimatverein</strong>. Die Museumsscheune, die im<br />
hinteren Bereich des Künstlerdorfes liegt, wurde<br />
vor gut fünf Jahren von der Gemeinde restauriert,<br />
und seit etwa zwei Jahren arbeiten sechs<br />
ältere Herren vom <strong>Heimatverein</strong> daran, die<br />
Scheune zu einem kleinen Museum umzubauen.<br />
Dabei haben die Männer um Roosmann<br />
schon einiges in Angriff genommen: Einen geschenkten<br />
Eichenstamm haben sie in Zusammenarbeit<br />
mit lokalen Unternehmen so zu<br />
Recht geschnitten, dass er jetzt in großen Planken<br />
als Regal dient. Viele alte Schätzchen, die<br />
in früheren Zeiten die beschwerliche Landarbeit<br />
erleichterten, wurden mit Liebe wieder aufgemöbelt,<br />
und stets melden sich Bürger, die noch wertvolle Gegenstände<br />
zu Hause haben. Die begutachten die die<br />
Museumsfreunde dann und schaffen sie dann auch<br />
heran: „Jede Woche ruft einer bei uns an“, freut sich<br />
Roosmann über reges Interesse der Bevölkerung. So<br />
wächst die Sammlung stetig.<br />
Doch ein ganz großes Projekt schwebt den Museumsbauern<br />
noch vor: „Mein Traum ist es, hier noch<br />
eine kleine Kochecke einzubauen. Die Küche war<br />
schließlich über Jahrhunderte der Lebensmittelpunkt.“<br />
Ein alter Herd ist da, große Sandsteinplatten sollen<br />
noch besorgt und die Wände stilecht gekalkt werden.<br />
Doch der eigentlich Clou ist: „Wir wollen noch ein<br />
zweites Stockwerk einziehen, sodass die Küche auch<br />
die typisch niedrigen Wände hat.“ Dafür haben die<br />
Museumsleute schon ein eignes Fachwerk gesichert.<br />
Noch lehnen die großen Balken in einer Ecke der<br />
Scheune aus dem 19. Jahrhundert. „Wir müssen das<br />
natürlich mit dem Künstlerdorf und der Gemeinde<br />
absprechen. Außerdem brauchen wir natürlich noch<br />
eine Baugenehmigung – schließlich wollen wir einen<br />
Teil unserer Exponate auf der so entstandenen zweiten<br />
Etage ausstellen.“<br />
Bisher besuchen vor allem Grundschüler im Sachunterricht<br />
die alte Museumsscheune und die kleine<br />
Remise, in der die größeren Landmaschinen untergebracht<br />
sind. Wann das zweite Stockwerk eingezogen<br />
werden kann, weiß Roosmann noch nicht genau.<br />
Aber er und seine Kollegen gehen die Arbeit in der<br />
Scheune auch langsam an: „Wir treffen uns alle vier<br />
Wochen. Und ich glaube nicht, dass wir so schnell<br />
fertig mit der Scheune sind. Für uns ist das eine langfristige<br />
Idee.“<br />
Dieser Artikel von –bel- erschien am 05. September<br />
2008 in den Westfälischen Nachrichten (Schöppingen)
16 <strong>HEIMATBRIEF</strong> Nr. 202 / September/Oktober 2008<br />
<strong>Heimatverein</strong> Südlohn auf Herbstfahrradtour<br />
Alte Altarbilder begutachtet<br />
Südlohn. Viele Radler waren jüngst mit dem <strong>Heimatverein</strong><br />
unterwegs, und alle konnten dabei ihrem<br />
Interesse frönen. Die Kunstinteressierten <strong>beim</strong> Archivar<br />
Ulrich Söbbing, der in seinem Büro in Stadtlohn<br />
den Südlohner Heimatfreunden Fragmente des neugotischen<br />
Hauptaltars von 1881 aus St. Vitus vorstellte.<br />
Die Altarfragmente wurden seinerzeit <strong>beim</strong> Abbruch<br />
des Hauptaltares vor der Vernichtung gerettet.<br />
Der <strong>Heimatverein</strong> will sich dafür einsetzen, dass die<br />
Altarbilder-Reste an einer exponierten Stelle in Südlohn<br />
platziert werden, um sie für die Öffentlichkeit<br />
zugänglich zu halten.<br />
Die Ausstellung "Schlacht im Lohner Bruch", die Ulrich<br />
Söbbing am Eichenhof in Stadtlohn vorstellte,<br />
fand das Interesse vieler geschichtsinteressierter Besucher.<br />
Auf der Weiterfahrt rasteten die Teilnehmer am früheren<br />
Schlachtfeld, wo 1623 der Kampf zwischen<br />
Johann Tserclaes Graf von Tilly und Christian von<br />
Braunschweigs Heerscharen stattfand. Die Naturfreunde<br />
waren begeistert, wie Hermann Gehling die<br />
Radlergruppe über verschlungene und bisher nicht<br />
gekannte Pättkes durch Wald und Flur führte.<br />
Mehrtagesfahrt des<br />
<strong>Heimatverein</strong>s Wessum in den Spreewald<br />
Wessum. Zum zweiten Mal führte die Mehrtagesfahrt<br />
des <strong>Heimatverein</strong>s Wessum in die neuen Bundesländer.<br />
Ziel in diesem Jahr war das Seehotel Burg<br />
im Spreewald. Gleich bei der Anreise wurde es auch<br />
sehr nachdenklich, als man eine Pause am ehemaligen<br />
Grenzübergang Helmstedt/Marienborn machte.<br />
Dabei wurde nachvollzogen, wie die Kontrollen zu<br />
Zeiten des geteilten Deutschlands waren.<br />
Politik und Geschichte gab es auch am zweiten Tag<br />
der Reise, als eine Besichtigung Berlins auf dem<br />
Programm stand. Nach dem Besuch des Regierungsviertels<br />
mit dem Reichstagsgebäude und dem Bundeskanzleramt<br />
gab es eine Stadtrundfahrt. Ziele waren<br />
u. a. der Potsdamer Platz, das Brandenburger Tor<br />
und die Gedächtniskirche, der Gendarmen-Markt, der<br />
Französisch-Deutsche Dom, die Straße Unter den<br />
Linden sowie der Verlauf der Mauer.<br />
Am nächsten Tag drehte sich alles um die Spreewald-Gurke.<br />
Zunächst besuchten die Heimatfreunde<br />
einen Gemüsehof, auf dem 2.000 Erntehelfer dafür<br />
sorgten, dass die Gurke vom Feld ins Glas kommt. In<br />
einem weiteren Betrieb gab es viele verschiedene<br />
Kostproben für die Münsterländer.<br />
Ein weiteres Ausflugsziel war die Slawenburg Raddusch,<br />
ein Bodendenkmal in der Niederlausitz mit<br />
einer ringförmigen Burganlage aus dem 9. Jahrhundert<br />
und einer der faszinierendsten Archäologie-<br />
Ausstellungen Deutschlands. Der Abschluss des Tages<br />
war eine Kahnfahrt.<br />
Weiter durch den Spreewald ging es am darauf folgenden<br />
Tag mit einer Rundfahrt. Besucht wurde die<br />
Stadt Cottbus und das Branitzer Schloss mit seinem<br />
Park, wo der Gartenkünstler Hermann Fürst von<br />
Pückler-Muskau unter einer Pyramide begraben liegt.<br />
Danach ging es zum Braunkohletageabbau in Jänschwalde.<br />
Dort wird nach dem überwältigen Abbau<br />
ein See in einer Größe von 15 qkm entstehen.<br />
Am Abreisetag machte die Gruppe einen Zwischenstopp<br />
in Potsdam, wo sie von den Eheleuten<br />
Schwarte durch die Stadt geführt wurden. Ziele waren<br />
u. a. das Schloss Sanssouci mit den wunderschönen<br />
Parkanlagen, das Holländische Viertel und die Russische<br />
Kolonie.<br />
Am Ende resümierten die Heimatfreunde eine interessante<br />
Fahrt mit vielen erlebnisreichen Eindrücken<br />
und einer sehr harmonischen Atmosphäre – im Blick<br />
schon wieder die Planungen für die Reise im kommenden<br />
Jahr.<br />
Die Reisegruppe vor dem Bismarckturm<br />
Dieser Artikel und das Foto wurden am 11. September<br />
2008 von Beatrix Wantia vom <strong>Heimatverein</strong> Wessum<br />
eingesandt.
Nr. 202 / September/Oktober 2008 <strong>HEIMATBRIEF</strong> 17<br />
Lokalkolorit ist in vielen Bildern zu entdecken<br />
Borken (wen). "Wir möchten als <strong>Heimatverein</strong> dafür<br />
sorgen, dass das Werk von Julia Schily-Koppers bekannter<br />
wird", sagt Vorsitzender Alfons Thesing. Nach<br />
der im Oktober vergangenen Jahres im Stadtmuseum<br />
eröffneten Ausstellung zu Leben und Werk der Malerin<br />
aus Borken haben Ernst Benien, Rudolf Koormann<br />
und Margret Schwack für den <strong>Heimatverein</strong> jetzt einen<br />
Kalender erarbeitet, der ab sofort zu erwerben ist.<br />
Die zwölf Abbildungen von Reinhard G. Nießing fotografiert<br />
zeigen Motive, die immer wieder auch Bezug<br />
auf den Wechsel der Jahreszeiten nehmen. Das<br />
Deckblatt ziert das Werk "Gelegenheit macht Diebe",<br />
das bekannteste Werk der Malerin, die 1855 geboren<br />
worden ist.<br />
Genauso<br />
interessant<br />
aus Borkener<br />
Sicht sind die<br />
Natur- und<br />
Genrebilder,<br />
in denen die<br />
Malerin ihre<br />
Heimat eingefangen<br />
hat.<br />
Etwa die Studie<br />
"Brücke<br />
und Gatt vor<br />
einem<br />
Bauernhaus"<br />
oder das be-<br />
„Gelegenheit macht Diebe“. Das Motiv,<br />
das Kaiser Wilhelm I. ankaufen<br />
ließ, schmückt das Deckblatt des Kalenders. <br />
kannte Bild<br />
der Tremsenfeier.<br />
Der<br />
Malerin gelang<br />
es dabei,<br />
typisches Lokalkolorit in ihre Werke mit einfließen zu<br />
lassen. Unter der Tremse nehmen Kinder und Jugendliche<br />
an einer langen Tafel Platz, feiern den<br />
Frühling. Die "Gartenansicht des Elternhauses an der<br />
Vennestraße" lässt noch einmal erkennen, wie "malerisch"<br />
sich die eng bebaute Kleinstadt im vorigen<br />
Jahrhundert an einigen Stellen zeigte. Dieses, wie<br />
auch andere Bilder, stammen aus Privatbesitz.<br />
"Wir haben für den Katalog eine große Unterstützung<br />
durch Sammler erfahren", berichtet Rudolf<br />
Koormann. Derzeit arbeitet die Kunsthistorikerin Daniele<br />
Schmidt das Werk der Malerin wissenschaftlich<br />
auf. Sie kann dabei auf den Nachlass der Malerin<br />
zurückgreifen, der im Besitz des <strong>Heimatverein</strong>s ist.<br />
Der Katalog ist zum Preis von zehn Euro im Stadtmu-<br />
seum von Dienstag bis Samstag in der Zeit von 15 bis<br />
18 Uhr zu erwerben. Am Sonntag hat die Kasse von<br />
10.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet.<br />
Gartenansicht<br />
des Elternhauses<br />
an der<br />
Vennestraße.<br />
Das Motiv für<br />
den Monat<br />
Juli im neuen<br />
Kalender<br />
Dieser Artikel von Gregor Wenzel erschien am 14.<br />
Oktober 2008 in der Borkener Zeitung.<br />
1968: Schicksalsjahr für <strong>Gemen</strong><br />
Heimatfreunde erinnern sich im Haus Grave<br />
<strong>Gemen</strong>. "Erinnern Sie sich?", war die Frage am<br />
Donnerstagabend im Haus Grave. Ein klares "Ja" war<br />
den Reaktionen des kleinen, interessierten Kreises<br />
der Heimatfreunde zu entnehmen. Klaus Bergsdorf<br />
blickte 40 Jahre zurück und zitierte aus Berichten der<br />
Borkener Zeitung über teilweise einschneidende<br />
Ereignisse.<br />
Klaus Bergsdorf zitierte aus Berichten der Borkener Zeitung.<br />
Schlagzeilen machte vor 40 Jahren vor allem die<br />
Gebietsreform. (Foto: Buß)
18 <strong>HEIMATBRIEF</strong> Nr. 202 / September/Oktober 2008<br />
"Langsam geht uns das Material aus.", deutete der<br />
70-Jährige aus den Vorstandsreihen auf die "Gebietsreform<br />
des Schicksalsjahres 1968" hin. Immer wieder<br />
war von "Abwehrreaktionen aus <strong>Gemen</strong>-Weseke" zu<br />
hören und davon, dass <strong>Gemen</strong> "die härteste Nuss"<br />
darstellte und dass Amtsdirektor Ernst Schülingkamp<br />
eine Bildung des Amtes Borken vorschlug. Schließlich<br />
stand die gemeindliche Existenz auf dem Spiel. Später<br />
titelte die BZ: "Es bleibt dabei, <strong>Gemen</strong> zu Borken.",<br />
und es hieß: "Vor einer fälligen Entscheidung kann<br />
man nicht weglaufen."<br />
"Ist das schon so lange her?" wunderten sich die<br />
Gäste über Begebenheiten, die bis heute nicht in Vergessenheit<br />
geraten sind. So die Geistesgegenwart<br />
von Maurer Walter Stoffers, der eine Dame aus dem<br />
Altenheim, die in die reißende Aa gerutscht war, vor<br />
dem Ertrinken rettete. Tragisch endete dagegen die<br />
Rettungsaktion des vierjährigen Walter Strotmann, der<br />
<strong>beim</strong> Spielen in die kalte Aa fiel und ertrank.<br />
Seit vier Jahrzehnten gilt nun schon die Einbahnstraßen-Regelung<br />
für die Neustraße, die seither nicht<br />
mehr von der Hagenstiege her zu befahren ist. 6.625<br />
DM habe der Kreis als Beihilfe für Geräte zugesteuert,<br />
wovon auch neue Straßenlaternen für die Hagenstiege<br />
angeschafft worden seien. Ein Stück "Altgemen"<br />
fiel dem Abbruchhammer zum Opfer. Gegenüber der<br />
Mühle in der Freiheit wurden vier alte Häuser, die<br />
zusammen mehr als 1000 Jahre alt waren, abgerissen.<br />
Großes Interesse seitens der Bevölkerung bestand<br />
an der Erhaltung der Schulen. Doch es habe sich<br />
ergeben, "dass aufgrund der vorliegenden gesetzlichen<br />
Bestimmungen und Informationen die evangelische<br />
Volksschule <strong>Gemen</strong> und die katholische<br />
Volksschule <strong>Gemen</strong>wirthe aufzulösen sind, da die<br />
geordneten Voraussetzungen eines geordneten<br />
Schulbetriebes im Sinne von § 16a des Schulverordnungsgesetzes<br />
nicht vorliegen.<br />
"Amüsiert nahm man die Meldungen von der Eröffnung<br />
der Poststelle in den neuen Räumen an der<br />
Neustraße auf. War doch von der "modernsten Poststelle<br />
im Bundesgebiet, da die Schalteranlage mit<br />
kugelsicherem Glas" versehen war, die Rede. Dieses<br />
war damals vor allem bei den Rentenauszahlungen<br />
von Bedeutung.<br />
Unzählige Berichte vom Vereinsleben in <strong>Gemen</strong>, ob<br />
vom Männergesangverein, der freiwilligen Feuerwehr,<br />
KLJB, Westfalia <strong>Gemen</strong>, KAB, den Schützen und<br />
nicht zuletzt dem <strong>Heimatverein</strong> boten unter anderem<br />
interessanten Stoff für angeregte Unterhaltungen.<br />
Dieser Artikel und das Foto von (bus) erschienen<br />
am 18. Oktober 2008 in der Borkener Zeitung<br />
Modenschau des <strong>Heimatverein</strong>s Wessum<br />
auf der herbstlich dekorierten Bauerntenne<br />
Wessum. Auf eine große Resonanz und eine große<br />
Begeisterung stieß die zurückliegende Modenschau<br />
des <strong>Heimatverein</strong>s Wessum am 20. und 21. September<br />
2008. Gleiche Modenschauen wurden bereits in<br />
den Jahren 2004 und 2006 durchgeführt.<br />
Der Nachmittag begann mit einer Kaffeetafel und<br />
frischem Weggen. Die herbstlich dekorierte Bauerntenne<br />
sorgte für das passende Ambiente. Anschließend<br />
gaben Strahler und ein Laufsteg der Modenschau<br />
den professionellen Touch. Models aus Wessum<br />
präsentierten mit gekonnten Bewegungen die<br />
aktuelle Mode für Kinder, Damen und Herren für alle<br />
Altersgruppen. Dabei reichte das Angebot von sportlicher<br />
Kleidung bis hin zur festlichen Garderobe. Das<br />
Textilhaus Niewerth, das Schuhhaus Vöcking und das<br />
Schmuckgeschäft Banken zeigten dabei eine große<br />
Palette an tragbarer Mode.<br />
In der Pause gab es Interessantes und Wissenswertes<br />
zum Umgang mit Kleidung und Wäsche vor vielen<br />
Jahren. So ist es heute nicht mehr denkbar, dass nur<br />
alle drei bis vier Wochen gewaschen wurde – und das<br />
im Veehpott in der Pottkamer. Es war keine Seltenheit,<br />
dass Kinder nur ein Paar Söckchen besaßen, die<br />
erst dann gestopft oder gewaschen werden konnten,<br />
wenn die Kinder im Bett waren. Nach der Wäsche<br />
wurde das Wasser noch weiter benutzt, um damit die<br />
Küche zu wischen oder Toiletten zu reinigen. Körperlich<br />
harte Arbeit war das Bürsten und Scheuern von<br />
Wäsche und oftmals rieben sich die Hausfrauen die<br />
Handballen wund. Aber mit der Wäsche wurde sehr<br />
pfleglich umgegangen und wer nicht sorgfältig wusch,<br />
stärkte, Wäsche bleichte, sie später nicht ordentlich<br />
auf hängte oder bügelte, der beging eine „hauswirtschaftliche<br />
Todsünde“.<br />
Schließlich belohnten die gut gelaunten Zuhörer und<br />
Zuschauer die Vorstellungen mit viel Applaus.<br />
Dieser Bericht wurde von Beatrix Wantia vom <strong>Heimatverein</strong><br />
Wessum eingereicht.<br />
Erles Geburtsstunde weiterhin unklar<br />
11. Geschichtstafel gibt Einblick<br />
in die Dorfgeschichte<br />
Erle. Unter zahlreicher Anteilnahme der Erler Bürger<br />
wurde am Sonntagnachmittag an der "Kastanienallee"<br />
die elfte Geschichts-Station enthüllt. Neugierige,<br />
die vorher schon einmal einen Blick auf die Tafel werfen<br />
wollten, hatten keine Chance. Sie war verhüllt,<br />
und es hieß: Abwarten, "bis alle geredet haben", er-
Nr. 202 / September/Oktober 2008 <strong>HEIMATBRIEF</strong> 19<br />
klärte der Vorsitzende des <strong>Heimatverein</strong>s, Klaus Werner.<br />
Er bedankte sich bei allen Aktiven, die das Werk<br />
erstellt haben, denn das sei gar nicht so einfach gewesen,<br />
wie sich zeigte. Karlo Behler berichtete, dass<br />
diese Tafel am Ekhornsloh sich von den bisher aufgestellten<br />
unterscheide. "Diese Tafel erzählt die Geschichte<br />
unseres Ortes", so Behler. Dabei habe der<br />
Arbeitskreis sich überlegen müssen, was denn den<br />
Lesenden interessiere, auch unter Berücksichtigung<br />
der Tatsache, dass dieser nicht unbedingt geschichtsinteressiert<br />
sei und auch keine tiefgründigen Geschichtskenntnisse<br />
habe.<br />
Das ist recht gut gelungen, wie sich herausstellte.<br />
Unter fünf Punkten der Ursprung Erle, der Schultenhof,<br />
Erle in der Herrlichkeit Lembeck, die politische<br />
Gemeinde Erle und Erle heute erfährt der Leser Wissenswertes,<br />
aufs Wesentliche komprimiert, rund um<br />
das kleine Dorf im Münsterland. "Mit dem Aufstellen<br />
dieser Tafel möchte der <strong>Heimatverein</strong> vor allem daran<br />
erinnern, das Erle zwar ein Ortsteil von Raesfeld, aber<br />
auch ein Dorf mit einer langen Vergangenheit ist", so<br />
Klaus Werner in seiner kurzen Ansprache.<br />
Das tatsächliche Alter des Dorfes bleibe dabei wohl<br />
verborgen, denn nirgends stehe ein Wort über ein<br />
Gründungsjahr. Aber: "Ich behaupte mit strotzendem<br />
Selbstbewusstsein, dass seit dem Ausgang der letzten<br />
Eiszeit hier Menschen gelebt haben", so der Vorsitzende.<br />
Denn der Ort sei von der mittleren Steinzeit<br />
über die Bronzezeit hinaus bis in die frühgeschichtliche<br />
Zeit ununterbrochen besiedelt gewesen. Das<br />
zeigten die zahlreichen archäologischen Funde in der<br />
Östrich und der Westrich. Als Pfarrort sei das Dorf<br />
erst im 13. Jahrhundert erwähnt, und mit Geschichten<br />
über die uralte Eiche ließen sich viele Bücher füllen.<br />
Festgestellt wurde auch, dass das eigentliche Wappen<br />
von Erle ein Andreaskreuz sei und nicht die Eichhörnchen,<br />
die das heutige Ortswappen von Raesfeld<br />
zieren.<br />
Dieser Artikel von (geg) erschien am 22. Oktober<br />
2008 in der Borkener Zeitung.<br />
Intensive Nachbarschaftspflege in Gescher<br />
Die ältesten Hookgemeinschaften können in der Glockenstadt<br />
Gescher auf über 200 Jahre zurückblicken.<br />
Alle Bewohner bemühen sich um ein gutes Mit- und<br />
Füreinanderdasein. Zahlreiche Veranstaltungen sind<br />
inzwischen Tradition mit einer guten Beteiligung.<br />
Jetzt feierte die Bürgerschaft gemeinsam mit einem<br />
Wortgottesdienst zum neunten Mal Erntedank. Diesen<br />
ökumenischen Gottesdienst bereiteten Pfarrer Hermann<br />
Roling von St. Pankratius und St. Marien und<br />
der evangelische Pfarrer Rüdiger Jung gemeinsam<br />
mit Texten und Liedern auf dem Gelände des Heimathauses<br />
vor.<br />
Etwa 200 Gescheraner nahmen daran teil. Über 20<br />
Fahnenabordnungen von verschiedenen Vereinen<br />
verliehen dem Gottesdienst eine bunte Vielfalt.<br />
Der <strong>Heimatverein</strong> lud nach dem Wortgottesdienst zu<br />
Kaffee und Kuchen ein.<br />
Fürstenkuhle – ein bedeutendes<br />
Naturschutzgebiet in NRW<br />
Naturschutz und Landschaftspflege sind Aufgaben,<br />
um die sich zahlreiche Bürger in unterschiedlichster<br />
Weise gemeinsam mit <strong>Heimatverein</strong>en, den Naturschutzvereinen<br />
und Pfadfindergruppen kümmern.<br />
Ohne die Pflege dieser Gebiete geht es nicht. Zugewachsene<br />
Wege müssen vom zu üppigen Bewuchs<br />
befreit werden. Unter fachkundiger Anleitung durch<br />
den Kreis Borken sind jetzt wieder über einen längeren<br />
Zeitraum zahlreiche Helfer in der Fürstenkuhle<br />
tätig, eines der herausragendsten Naturschutzgebiete<br />
am Ortsrand von Hochmoor, in Nordrhein - Westfalen<br />
gelegen. Dieses Gebiet hat eine Größe von 88 Hektar.<br />
Hier wächst eine Vielzahl von Pflanzen. Für viele<br />
Tiere gibt es einen ausreichenden Lebensraum. In<br />
jedem Winterhalbjahr sind an den Samstagen engagierte<br />
Naturfreunde und die hier tätigen Landschaftswarte<br />
bemüht, den Wildbewuchs zu beseitigen.<br />
Die Fürstenkuhle ist ein beliebtes Ziel für Wanderer,<br />
schreibt der stellvertretende Vorsitzende Bernhard<br />
Voßkühler des <strong>Heimatverein</strong>s in seinem Bericht für<br />
den Heimatbrief.<br />
BUCHTIPPS<br />
Durt bin ich ju derrheeme<br />
(sc). Die Heimatgruppe Bolkenhainer Burgenland<br />
in Borken hat einen Lyrikband in niederschlesischer<br />
Mundart herausgegeben. Aus dem Nachlass des<br />
ehemaligen Leiters der evangelischen Volksschule in<br />
Bolkenhain Alfred Tost sind in dem Buch 80 Gedichte<br />
und Geschichten veröffentlicht worden.<br />
Zu deutschen Zeiten in Niederschlesien sind viele<br />
Beiträge, Märchen, Mundartgedichte und Sinnsprüche,<br />
dieses schlesischen Heimatdichters im Breslauer<br />
Rundfunk gesendet worden.
20 <strong>HEIMATBRIEF</strong> Nr. 202 / September/Oktober 2008<br />
Aus dem Nachlass ihres Vaters hat die Tochter<br />
Gislind Rupprecht die Lyrikarbeiten zur Verfügung<br />
gestellt.<br />
Dem Buch ist eine CD beigefügt, auf der sieben<br />
Mundartsprecher in einem Tonstudio die Gedichte in<br />
dem niederschlesischen Dialekt wiedergegeben haben.<br />
Einige der Geschichte spricht der Heimatdichter<br />
selbst. Dies war durch die heutige moderne Tontechnik<br />
möglich von im Nachlass vorhandenen Tonträgern<br />
die gesprochenen Gedichte auf zu nehmen.<br />
Dem Vorstand der Bolkenhainer Heimatstube ist<br />
es damit gelungen, die niederschlesische Mundart zu<br />
konservieren und für die Nachwelt zu erhalten. Es ist<br />
davon auszugehen, dass diese Sprache mit der Erlebnisgeneration<br />
aussterben wird.<br />
Übersetzt trägt das Buch den Titel „Dort bin ich<br />
zuhause“.<br />
Der Lebensweg von Alfred<br />
Tost vollzog sich vom 28.<br />
März 1895 bis zum 3. April<br />
1986. In dem Buch wird sein<br />
Berufsweg als Pädagoge in<br />
Schlesien beschrieben. Als<br />
Offizier bei der Infanterie hat<br />
er an beiden Weltkriegen teilgenommen.<br />
Nach der Vertreibung<br />
aus Bolkenhain fand sich<br />
seine Familie in Neumarkt in<br />
der bayrischen Oberpfalz wieder. 1951 ging er als<br />
Konrektor an eine Schule in der Stadt Wanne-Eikel.<br />
Gründer der Kreisgruppe Bolkenhainer Burgenland<br />
Alfred Tost fühlte sich seiner niederschlesischen<br />
Heimat mit ihrer Natur und Landschaft und den Menschen<br />
mit tiefer Liebe verbunden. Mit Bolkenhainern,<br />
die in Borken nach der Vertreibung ein neues Zuhause<br />
fanden, gründete er die „Kreisgruppe Bolkenhainer<br />
Burgenland“ und war viele Jahre der Vorsitzende. Er<br />
war es auch, der es erreichte, dass die Stadt Borken<br />
im Jahr 1965 die Patenschaft über die ehemaligen<br />
Bewohner Bolkenhains und der Landgemeinden des<br />
Altkreises übernahm. Unter seinem Vorsitz wurde die<br />
„Bolkenhainer Heimatstube“ eingerichtet, in der wertvolle<br />
Exponate und Ausstellungsstücke aus der verlorenen<br />
schlesischen Heimat ausgestellt und bewahrt<br />
werden. Der musealen Heimatstube ist ein Dokumentationsraum<br />
angegliedert, in dem alle wichtigen Unterlagen<br />
zu finden sind, die auf die 700jährige Geschich-<br />
te der niederschlesischen<br />
Stadt Bolkenhainhinweisen.<br />
Hier hat<br />
sich der Heimatdichter<br />
in<br />
verdienstvoller<br />
Weise mit<br />
ganzer Kraft<br />
eingesetzt<br />
und dafür<br />
gesorgt, dass<br />
diese Jahrhundert<br />
dauernde<br />
Geschichte<br />
nicht verloren<br />
geht. Nach<br />
sieben Umzügen<br />
in Bor-<br />
Niederlauben in Bolkenhain<br />
ken haben<br />
diese beiden<br />
Räume seit einigen Jahren im Stadtmuseum Borken<br />
einen neuen Platz gefunden.<br />
Wenige Tage nach seinem 91. Geburtstag ist er in<br />
Neumarkt gestorben und auf dem dortigen Friedhof<br />
beerdigt worden. Ein Leben voller Zuwendung gegenüber<br />
seiner Familie und die Liebe zu seiner unvergessenen<br />
schlesischen Heimat hatte seine Vollendung<br />
gefunden.<br />
Bewahrung des niederschlesischen<br />
Mundartkulturgutes<br />
Hans-Jochen Meier, der jetzige Vorsitzende des<br />
Bolkenhainer Burgenlandes und Schriftleiter dieses<br />
Lyrikbandes schreibt auf dem Klappentext zu dem<br />
Versuch der Bolkenhainer Heimatgruppe, die niederschlesische<br />
Mundart an die kommenden Generationen<br />
weiter zu vermitteln: „Die niederschlesische Mundart<br />
ist ein Kulturgut, das in Jahrhunderten gewachsen<br />
war. Mit der Vertreibung der deutschen Bevölkerung<br />
wurde diese ländliche Sprache mit der Bevölkerung<br />
auch in alle westlichen Länder verpflanzt. Sie<br />
verkümmerte, weil die schlesischen Ansprechpartner<br />
zur Kommunikation fehlten. Eine Renaissance erlebte<br />
die Mundart durch die Ortstreffen der ehemaligen<br />
Bewohner der niederschlesischen Städte und Dörfer<br />
in den westdeutschen Patenstädten. Mit dem Ableben<br />
der Erlebnisgeneration von Flucht und Vertreibung<br />
wird auch diese Mundart vergehen. Dem will dieses
Nr. 202 / September/Oktober 2008 <strong>HEIMATBRIEF</strong> 21<br />
Buch entgegenwirken. Es ist sowohl für die Nachfahren<br />
wie auch die Sprachwissenschaftler interessant zu<br />
lesen und zu hören, wie das Niederschlesische von<br />
Mundartdichtern aufgeschrieben wurde und wie es<br />
klingen muß.“<br />
Für die Bolkenhainer ist die Zurverfügungstellung<br />
der Werke des Heimatdichters aus dem Nachlass ein<br />
„Glücksfall“. Das hat den Vorstand veranlasst, dieses<br />
Buch zu veröffentlichen. Das fast 100 Seiten umfassende<br />
Buch beinhaltet nicht nur Gedichte, Geschichten<br />
und Lebensweisheiten von Alfred Tost, sondern<br />
auch mittels schwarz-weiss Fotografien ein Wiedersehen<br />
mit der Kreisstadt Bolkenhain. Alle Fotos<br />
stammen aus dem Archiv der Heimatstube.<br />
Jochen Meier erinnert in seinem Vorwort an einige<br />
schlesische Dichter, wie Andreas Gryphius, Carl von<br />
Holtei, Gerhart Hauptmann, Paul Keller, H. Stehr, W.<br />
E. Peuckert bis zu Fedor Sommer und Ernst Schenke.<br />
Detlev von Liliencron bezeichnete Schlesien als das<br />
Land der 666 Dichter.<br />
Der Lyrikband kostet 15.- Euro. In der Bolkenhainer<br />
Heimatstube ist er zu kaufen. ISBN 978-9808307-<br />
9-9<br />
Die katholische Pfarrkirche<br />
St. Remigius in Borken<br />
(sc). „Die in vielen Jahrhunderten gewachsene<br />
Kirche ist mit ihrem hohen Turm Mittel- und Orientierungspunkt<br />
auch der heutigen Stadt Borken“ schreiben<br />
Kunsthistoriker Dr. Ulrich Reinke aus Münster<br />
und Ursula Brebaum aus Borken in der neuen Auflage<br />
des Heftes Nr. 107 „Westfälische Kunststätten“. Herausgeber<br />
ist der Westfälische Heimatbund Münster in<br />
Verbindung mit dem Amt für Heimatpflege, zugehörig<br />
dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Münster.<br />
Auf 24 Seiten<br />
wird das Gotteshaus<br />
in Texten und Fotografien<br />
in seinem<br />
Wechsel von Architektur,<br />
Erweiterung,<br />
Zerstörung, Wiederaufbau<br />
und Gestaltung<br />
des Inneren im<br />
Lauf der Jahrhunderte<br />
beschrieben.<br />
Die Kirche besteht<br />
in diesem Jahr<br />
Romanischer Taufstein in der<br />
St. Remigius Kirche<br />
1.225 Jahre. Dieses Jubiläum ist in vielfältiger Weise<br />
gefeiert worden mit Gottesdiensten, pfarrlichen Veranstaltungen<br />
und der sehr gelungenen Ausstellung<br />
„Spiegel des Glaubens - Kunstschätze der Propsteigemeinde<br />
St. Remigius Borken“ im Stadtmuseum<br />
Borken Gleichzeitig fand eine Ausstellung mit fotografischen<br />
Reflexionen von Bernhard Winkler mit dem<br />
Titel „katholisch“ statt. Vom 30. September. bis zum<br />
14. Dezember ist die vom <strong>Heimatverein</strong> Borken e.V.<br />
gemeinsam mit der Archäologin und Ausgrabungsleiterin<br />
Elisabeth Dickmann M.A. aus Münster gestaltete<br />
Ausstellung im Foyer des Stadtmuseums unter dem<br />
Titel „Zeichen des Glaubens“ hinzugefügt worden.<br />
Diese weist auf außergewöhnliche Funde hin, die<br />
während der archäologischen Ausgrabungen in Borken-Südwest<br />
gefunden worden sind. Gezeigt werden<br />
vier Fundstücke mit christlichen Symbolen. Es sind<br />
seltene schmuckartige Gewandschließen, eine Doppelkreuzfibel<br />
aus dem 10./11. Jahrhundert, eine Taubenfibel,<br />
frühes 9. Jahrhundert, ein Kreuzanhänger<br />
aus dem 19. Jahrhundert und eine Agnus – Dei - Fibel<br />
um 1000 nach Christi.<br />
Kelch des Vikars Wilhelm v. Raesfeld, Jugendstil,<br />
1900
22 <strong>HEIMATBRIEF</strong> Nr. 202 / September/Oktober 2008<br />
Die bauliche Geschichte des Gotteshauses wird in<br />
der Veröffentlichung trotz der Kürze sehr gut dargestellt.<br />
Sie reicht für eine Orientierung von den Anfängen<br />
der Urkirche bis zur jetzigen Propsteikirche mit den<br />
ausgewählten meist farbigen Fotografien aus.<br />
BLICK IN ZEITSCHRIFTEN<br />
Neueste Nachrichten aus Alstätte<br />
(sc). Mit lyrischen Gedanken an einen Feldweg<br />
und einer entsprechenden Zeichnung erfreut das „Alstätter<br />
Heimatblatt“ in seiner Herbstausgabe seine<br />
Bezieher. Das Redaktionsteam hat, wie stets, zahlreiche<br />
Nachrichten aus dem Dorf zusammengestellt.<br />
Berichtet wird über Veranstaltungen, Jubiläen,<br />
Ausflugsfahrten, Aktivitäten des <strong>Heimatverein</strong>s, über<br />
örtliche Traditionen, zum Beispiel die „Brutlachsnörgers“,<br />
die zur „Grünen Hochzeit“ oder zur Silberhochzeit“<br />
auftreten und Geld für einen guten Zweck sammeln.<br />
Fotoberichte geben den Ablauf vom Pfarrfest,<br />
den Sommerfesten im Dorf und Schmäinghook und<br />
über das 50jährige Bestehen des Angelsportvereins<br />
wieder. Ein Blick in das Leben im Dorf im Jahre 2025<br />
wirft Manfred Ibing. Hingewiesen wird auf den kommenden<br />
Nikolaustag am 6. Dezember. Ein Interview<br />
mit dem Heiligen erklärt unter anderem auch den Unterschied<br />
zum „Weihnachtsmann“. Dieser neue Begriff<br />
wird insbesondere von der Geschäftswelt benutzt, hat<br />
aber mit St. Nikolaus nichts zu tun.<br />
Wiedergegeben werden Standesamtsnachrichten.<br />
Tradition ist es, zu schauen, wer im Jahr 1908 im<br />
Standesamt Ahaus, Wessum und in Alstätte getraut<br />
worden ist. Festgehalten hat diesen Personenkreis im<br />
Mai 1991 Heinrich Harpering. Abgebildet sind vier<br />
Gebetszettel aus dem Jahr 1893. Sie geben Einblicke<br />
in die damalige Volksfrömmigkeit.<br />
Im Monat Oktober fand die sechste Alstätter Sternennacht<br />
statt. Der Kirmessonntag am 19. Oktober<br />
war ein Anziehungsdatum für zahlreiche Besucher.<br />
Finanziert wird die Zeitschrift durch viele Anzeigen<br />
aus der örtlichen Geschäfts- und Firmenwelt.<br />
Nao Kääwela – 275 Jahre Fußprozession<br />
1733 – 2008<br />
(sc). Im Heft 1 – 2 „Unser Bocholt“ ist über das<br />
100jährige Bestehen des Vereins für Heimatpflege<br />
Bocholt e. V. ausführlich berichtet worden. Über ein<br />
weiteres Jubiläum, nämlich „275 Jahre Fußprozession<br />
Bocholt – Kevelaer, 1733 bis 2008“ wird im Text und<br />
mit zahlreichen Fotografien in der Ausgabe Nr. 3 ein<br />
Rückblick und eine Prognose für die künftige Entwicklung<br />
ebenfalls sehr ausführlich geschrieben.<br />
Die seit vielen Jahren an dieser Fußprozession<br />
Teilnehmenden – es gibt auch eine Teilnahme mit<br />
dem Fahrrad – finden sich in dem weitausholenden<br />
Bericht von Ludger Mertens wieder. Er gehört mit<br />
Peter Mertens, Norbert Bauhaus und Bernd te Uhle<br />
zum engeren Vorstand, der die Wallfahrten mit vorbereitet.<br />
Der Autor Ludger Mertens geht in seinem Rückblick<br />
auf die letzten 25 Jahre der Fußwallfahrt auf die<br />
Festschrift der früheren Stadtarchivarin Dr. Elisabeth<br />
Bröker zum 250. Jubiläum im Jahre 1983 ein. Den<br />
Aufbau der damaligen Festschrift der Stadtarchivarin<br />
will er beibehalten und fortsetzen, schreibt er in seinem<br />
Vorwort.<br />
Vorgestellt werden der gesamte Vorstand und die<br />
Kreuzträger, die alle mit einer blauen Schärpe versehen<br />
sind und einen Stab tragen. Sie begleiten die<br />
Pilger und sorgen für Ordnung.<br />
In dem Rückblick werden die Fußwallfahrten „heute<br />
und gestern“ in zahlreichen Fotos gezeigt. Es hat<br />
sich vieles verändert, insbesondere hinsichtlich der<br />
begleitenden Fahrzeuge und der vor einigen Jahren<br />
noch vorhandenen Gastwirtschaften. Vom einfachen,<br />
früher üblichen Pferd und Wagen, ging es dann zum<br />
Trecker als Zugmaschine vor den mitgeführten notwendigen<br />
Fahrzeugen, die das Gepäck aufnehmen<br />
oder als Sanitätsstation eingerichtet sind. Viele der<br />
Fahrzeuge werden seit Jahrzehnten von denselben<br />
Familien zur Verfügung gestellt. Sie sitzen auch am<br />
Steuer. Heute werden auch Automobile kostenlos als<br />
Begleitfahrzeuge ausgeliehen.<br />
Aus dem Bericht von Ludger Mertens kann man<br />
die Vielseitigkeit der Vorbereitungen einer Wallfahrt<br />
entnehmen. Seit einigen Jahren ist die notwendige<br />
Verpflegung der Pilger ein besonderes Thema, weil<br />
zahlreiche Gastwirtschaften inzwischen geschlossen<br />
sind. Ein weiteres Thema sind notwendige sanitäre<br />
Einrichtungen, die durch die Schließung von Gasthäusern<br />
fehlen, aber unbedingt notwendig sind.
Nr. 202 / September/Oktober 2008 <strong>HEIMATBRIEF</strong> 23<br />
Maria zu Dir kommen wir<br />
Ludger Mertens schildert ebenso eingehend die<br />
eigentliche Wallfahrt vor Ort in Kevelaer mit dem<br />
Kreuzweg, den Messopfern, Gebeten und Liedern,<br />
das Kerzenopfer und die besondere Freude, wenn<br />
kirchliche Würdenträger aus Münster oder gar Bischof<br />
Dr. Reinhard Lettmann mit den Pilgern in die Basilika<br />
einziehen und die heilige Messe feiern. Auch in diese<br />
Berichte sind zahlreiche Fotografien eingestreut. Sie<br />
zeigen die Freude der Bocholter Pilger, von denen<br />
zahlreiche für ihre jahrelange Teilnahme geehrt worden<br />
sind.<br />
In die Aufzeichnungen sind auch die Bahn- Busund<br />
Fahrradwallfahrer vermerkt und die Behindertenund<br />
Seniorenwallfahrten des Malteser Hilfsdienstes.<br />
Interesse an diesen Wallfahrten haben natürlich auch<br />
die verschiedenen Medien, von den Zeitungen über<br />
den Rundfunk und das Fernsehen.<br />
Erzählt wird auch die Entstehung des Wallfahrtsortes<br />
Kevelaer und der erste Bau eines Heiligenhäuschens<br />
zur Ehre der Gottesmutter, der Trösterin der<br />
Betrübten.<br />
Das Gnadenbild, ein schlichter Kupferstich ist inzwischen<br />
stark vergilbt. Die Bocholter Künstlerin Lucy<br />
Vollbrecht-Büschlepp hat einen neuen Kupferdruck<br />
geschaffen. Beide Drucke sind in der Zeitschrift veröffentlicht.<br />
Gebete, Lieder in plattdeutscher Sprache<br />
und Messtexte sind ebenfalls wiedergegeben.<br />
Die Wallfahrt-Tradition von Bocholt nach Kevelaer<br />
seit 275 Jahren ist ein Zeichen für den Glauben an die<br />
Fürsprache und Hilfe der Gottesmutter. Es gibt viele<br />
Anlässe, persönliche<br />
Sorgen und<br />
auch Danksagungen,<br />
mit denen die<br />
Pilger sich auf den<br />
auch beschwerlichen<br />
Fußweg<br />
begeben.<br />
Das neue Wegekreuz,<br />
eine Edelstahltafel<br />
mit aufgesetzten<br />
Kreuzen,<br />
sowie Abb. von<br />
„Start u. Ziel“ mit<br />
den Schriftzügen<br />
BOCHOLT und<br />
Kevelaer sowie<br />
dem Text „Fussprozession<br />
1733 –<br />
2008“<br />
Informationen aus Bocholts Geschichte<br />
Dem Beitrag über „275 Jahre Fußwallfahrt Bocholt<br />
– Kevelaer“ folgen Informationen aus der weiteren<br />
Geschichte von Bocholt.<br />
Anlässlich des 100jährigen Bestehens des Vereins<br />
für Heimatpflege Bocholt e.V. fand in der Kirche St.<br />
Georg am 23. April 2008 ein Gottesdienst mit plattdeutschen<br />
Texten statt.<br />
gestaltet von Hermann (Manes) Schlatt, Bocholt<br />
Mitglieder des Plattdeutschen Krings hatten ihn<br />
vorbereitet. Die Texte der Gebete und Lieder sind in<br />
dem Jubiläumsheft veröffentlicht.<br />
Über die „Suderwicker Hausstättenschatzung von<br />
1663“ schreibt Norbert Henze.<br />
Professor Dr. Diethard Aschoff aus Münster stellt<br />
die „Juden im Kreis Borken in salmischer Zeit von<br />
1802 bis 1810“ in einem mehrseitigen Artikel dar. Im<br />
Gesprächskreis „Bocholter Geschichte“ hielt er über<br />
dieses Thema am 6. Mai 2008 einen Vortrag.<br />
Herausgeber der Zeitschrift „Unser Bocholt“ ist der<br />
Verein für Heimatpflege Bocholt e. V. Verlagsanschrift:<br />
Stadtarchiv Bocholt, Münsterstraße 76, 46397<br />
Bocholt. Telefonnr. 02871 / 953- 349, Telefax: 02871/<br />
953 – 347.
24 <strong>HEIMATBRIEF</strong> Nr. 202 / September/Oktober 2008<br />
Gestaltung der Zukunft<br />
aus der Kraft der Tradition<br />
(sc). In dem Heimatbrief der Katholiken aus dem<br />
Erzbistum Breslau „Schlesien in Kirche und Welt“, Nr.<br />
3 September 2008, 35. Jahrgang, wird auf eine neue<br />
Veröffentlichung in der Schriftenreise der Visitatur<br />
Breslau hingewiesen. Als Band 9 ist das 92 Seiten<br />
umfassende Buch „Gestaltung der Zukunft aus der<br />
Kraft der Tradition“ erschienen, das die Zeit „25 Jahre<br />
Visitator Winfried König zum Inhalt hat. Herausgeber<br />
ist der Visitator Franz Jung für die Grafschaft Glatz,<br />
der für ein Jahr zusätzlich jetzt auch für Breslau zuständig<br />
ist.<br />
In seiner Betrachtung zu dieser Veröffentlichung<br />
schreibt Dr. Michael Hirschfeld, dass dieses Buch auf<br />
die segensreiche Zeit der Tätigkeit von Winfried König<br />
als Visitator in 25 Jahren und auf das Bestehen der<br />
Visitatur seit 35 Jahren eingeht. Einen großen Teil<br />
nimmt in Texten und Bildern die Verabschiedung von<br />
Winfried König am 23. Februar 2008 im Hohen Dom<br />
zu Münster mit einem Pontifikalamt und dem anschließenden<br />
Empfang im Fürstenberghaus ein, an<br />
denen zahlreiche Schlesier, geistliche Würdenträger<br />
und Politiker teilnahmen.<br />
Aufgenommen sind die Grußworte von Konsistorialdekan<br />
Prälat Professor Dr. Hubertus Drobner, die<br />
Predigt des emeritierten Münsterschen Bischofs Dr.<br />
Reinhard Lettmann und der Festvortrag von dem Oppelner<br />
Weihbischof und Kirchenhistorikers Professor<br />
Dr. Jan Kopiec. Zu lesen sind die Ansprache von Regierungspräsident<br />
Dr. Peter Paziorek, Weihbischof<br />
Gerhard Pieschl aus Limburg und Professor Dr. Josef<br />
Joachim Menzel aus Mainz.<br />
Diakon Johannes Gröger hat einen Rückblick auf<br />
die 25 Jahre von Winfried König als Apostolischer<br />
Visitator geschrieben, das als ein Dokument der Zeitgeschichte<br />
eingeordnet werden kann.<br />
Über die Feierlichkeiten zur Verabschiedung von<br />
Prälat Winfried König ist im Heimatbrief der Katholiken<br />
aus dem Erzbistum Breslau Nr. 2/Mai/Juni berichtet<br />
worden.<br />
Während der Jahrestagung des Schlesischen<br />
Priesterwerkes e.V. Ende Juli in Würzburg ist darauf<br />
gedrängt worden, für die Visitatur Breslau baldmöglichst<br />
einen ständigen Nachfolger zu bestimmen.<br />
Weitere Beiträge widmen sich Persönlichkeiten in<br />
kirchlichen und öffentlichen Ämtern, die während ihrer<br />
Tätigkeiten vor und nach dem Zweiten Weltkrieg wegen<br />
ihrer Haltung zu Gefangenschaft oder zum Tode<br />
verurteilt wurden, schwere Schicksale erlebt haben.<br />
Dr. Michael Hirschfeld, Historiker an der Universität<br />
Vechta und der Visitatur Breslau eng verbunden,<br />
ist zum Ritter vom Heiligen Grab in Jerusalem ernannt<br />
worden. Der 36jährige war viele Jahre Vorsitzender<br />
der „ Gemeinschaft für deutsch-polnische Verständigung<br />
(gdpv).<br />
Das Buch „Gestaltung der Zukunft aus der Kraft<br />
der Tradition“ kostet 5.- Euro und 3.95 Euro Versandkosten.<br />
Es ist unter ISBN 3-932970-18-7 in der Visitatur<br />
für Priester und Gläubige aus dem Erzbistum Breslau,<br />
Ermlandweg 22, 48159 Münster zu bestellen.<br />
Telefon 0251/511132, Fax: 0251/42012<br />
Niederschlesische Informationen<br />
Januar – Juli 2008<br />
(sc). Die Zeitschrift der Deutschen Sozial-<br />
Kulturellen Gesellschaft Breslau konnte wegen finanzieller<br />
Probleme über einen längeren Zeitraum nicht<br />
erscheinen. Jetzt ist ein neuer Weg gefunden worden.<br />
In der Nummer 1/2008 Ausgabe von Januar bis Juli<br />
wird berichtet, dass die „Niederschlesische Information“<br />
in einer kleinere Auflage halbjährlich erscheint.<br />
Im Heimatbrief des Kreises Borken Nr.198 / Januar-Februar<br />
2008 ist über das 50jährige Bestehen<br />
der Deutschen Sozial - Kulturellen Gesellschaft in<br />
Waldenburg berichtet worden. In Breslau entstand<br />
zunächst eine Ortsgruppe. Im Jahr 1991 wurde sie<br />
eine sich selbständig tragende Gesellschaft. Zu diesem<br />
Jubiläum erschien das Buch „Gestern, Heute,<br />
Morgen. 50 Jahre Deutsche Sozial-Kulturelle Gesellschaft<br />
Niederschlesien“.<br />
Friedrich Petrach war viele Jahre in Breslau der<br />
Vorsitzende. Mit dem Kreis Borken pflegte er enge<br />
Kontakte im Rahmen der Patenschaft zu dem Landkreis<br />
Breslau (Wroclaw). Zu den Patenschaftstreffen<br />
kam er mit einer Delegation in die Kreisstadt Borken.<br />
Die zahlreichen Studienfahrten nach Niederschlesien<br />
und Breslau, organisiert vom Patenschaftsbüro in<br />
der Kreisverwaltung profitierten durch seine Ortskenntnisse,<br />
seine begleitenden Führungen und Empfänge<br />
im Haus der Gesellschaft in Breslau. Alle Besucher,<br />
die sich auf eine solche Studienreise begaben, erinnern<br />
sich gerne an diese Gastfreundschaft.<br />
Neue Vorsitzende der Gesellschaft ist nun Renata<br />
Zajaczkowska. Als ihr Stellvertreter wurde Jakub Turanski<br />
gewählt. Ein weiteres Vorstandsmitglied ist die<br />
Geschichtsstudentin Katarzyna Cwikla.
Nr. 202 / September/Oktober 2008 <strong>HEIMATBRIEF</strong> 25<br />
Während der Jubiläumsfeier im Dezember 2007 in<br />
Breslau wurden für ihren Arbeitseinsatz Renata Zajaczkoska<br />
und Edith Pischczan mit dem polnischen<br />
Goldenen Verdienstkreuz ausgezeichnet. Mit dem<br />
Gloria Artis Orden wurden Ewa Maria Jakubek und<br />
Irene Lipman geehrt.<br />
In der Zeitschrift wird über die zahlreichen Aktivitäten<br />
und Veranstaltungen in der Gesellschaft berichtet.<br />
Auf der Internetseite gibt es jetzt Nachrichten in<br />
deutscher Sprache unter ntkswroclaw.vdg.pl.<br />
Landeskundliche Notizen aus<br />
Schlesien<br />
Auf jeweils vier Seiten mit<br />
Farbfotos sind der Zeitschrift<br />
„Landeskundliche Notizen“<br />
hinzugefügt. Diesmal werden<br />
das Kloster Leubus und die Stadt Bad Salzbrunn ausführlich<br />
von Hans Knoppik und Joachim Lukas beschrieben.<br />
Herausgeber sind die Deutsche Sozial-Kulturelle<br />
Gesellschaft Breslau, die Landsmannschaft Schlesien,<br />
der Landesverband Bayern und der Bezirk Mittelfranken.<br />
Zur Einführung heißt es: „Wir möchten das<br />
reiche kulturelle Erbe dieses ‚zehnmal interessanten<br />
Landes’ wie es Goethe nannte, in Bild und Text vorstellen.<br />
Geschichte, Landschaften, Klöster, Burgen<br />
und Schlösser, Heilbäder, Wallfahrtsorte, Städtebilder<br />
und vieles mehr möchten wir den Lesern nahe bringen.“<br />
Lebendige Museen in Ramsdorf und Velen<br />
(sc). In der Zeitschrift „Heimatpflege in Westfalen“<br />
Nr. 4/2008, herausgegeben vom Westfälischen Heimatbund<br />
in Münster berichtet Christian Schulze Pellengahr,<br />
Erster Beigeordneter der Gemeinde Velen,<br />
über die Eröffnungsfeier „Lebendige Museen“ am 26.<br />
Juni 2008, die an fünf verschiedenen Standorten in<br />
Ramsdorf und Velen eingerichtet worden sind. An<br />
diesen Orten ist landwirtschaftliche Technikgeschichte<br />
zu betrachten und abzulesen.<br />
Bereits vor 17 Jahren begannen die Planungs- und<br />
Aufbauarbeiten. Hier darf man die „Doskerkerls“ nennen,<br />
die historische landwirtschaftliche Gerätschaften<br />
vom Trecker bis zur Heugabel gesammelt haben. Die<br />
Geräte wurden wieder so instandgesetzt, dass ihr<br />
Einsatz bei Vorführungen während verschiedener<br />
Veranstaltungen gezeigt werden kann, wie sie früher<br />
in der Landwirtschaft genutzt wurden.<br />
Die Standorte der Museen liegen in den beiden<br />
verwaltungstechnisch zusammen geführten Gemeinden<br />
Ramsdorf und Velen. An einer ausgewiesenen<br />
Radroute von etwa 21 Kilometern. In Velen ist die<br />
Gemeindeverwaltung.<br />
In der Gemeinde Ramsdorf liegt die Burg Ramsdorf,<br />
in der bereits im Jahr 1931 ein ortsgeschichtliches<br />
Heimatmuseum seinen Platz gefunden hat. Von<br />
dort geht es auf der Radroute zu der Schmiede<br />
Beckmann. Sie beherbergte einst im frühen 19. Jahrhundert<br />
den Stall für den jeweiligen Ramsdorfer Pfarrer.<br />
Die Schmiede wird immer wieder von der<br />
„Schmiedeinnung“ des örtlichen <strong>Heimatverein</strong>s genutzt.<br />
Die Restauratoren der Akademie des Handwerks<br />
in Raesfeld haben für diese denkmalgeschützten<br />
Gebäude Vorschläge erarbeitet, wie eine Instandsetzung<br />
erfolgen könnte. Das ist ihnen vorzüglich<br />
gelungen, indem von Lüdinghausen aus die Schmiede<br />
des vor 30 Jahren verstorbenen Schlossermeisters<br />
Heinrich Beckmann nach Ramsdorf durch die Vermittlung<br />
seiner Tochter ermöglicht wurde.<br />
Auf dem Hof der Familie Tenk-Dröning in Ramsdorf<br />
ist ein Dorfgemeinschaftshaus eingerichtet worden.<br />
Hier haben die von den „Doskerkerls“ gesammelten<br />
Geräte, die früher in der Landwirtschaft für den<br />
Kartoffelanbau gebraucht wurden, ausreichend Platz<br />
gefunden. Ein gemütliches Café lädt zum Verweilen<br />
ein.<br />
Auf dem nicht mehr landwirtschaftlich genutzten<br />
Hof Picker-Warnsing in Velen - Waldvelen befindet<br />
sich der „Doskerschoppen“ mit landwirtschaftlichen<br />
Geräten, die für die Getreideanbau und die Ernte einst<br />
im Gebrauch waren.<br />
Die Radroute führt dann in den Tiergarten nahe<br />
dem Schloß Velen, der ein Waldgebiet von 55 Hektar<br />
umfasst. In den letzten Jahren ist der Tiergarten in<br />
sein ursprüngliches historisches Vorbild behutsam zu<br />
einem Naherholungsgebiet umgestaltet worden. Die<br />
frühere Fasanerie, von dem Barockbaumeister Conrad<br />
Schlaun aus Münster entworfen, ist zu einem Café<br />
umgestaltet worden.<br />
Das ehemalige Gut Roß hat Graf Dr. iur. Max von<br />
Landsberg-Velen in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts<br />
als landwirtschaftliches Mustergut mit einer<br />
Sägemühle anlegen lassen. Die Gebäude sind ebenfalls<br />
gründlich restauriert worden. Die Sägemühle, die<br />
durch eine Turbine angetrieben wird, ist wieder funktionstüchtig.
26 <strong>HEIMATBRIEF</strong> Nr. 202 / September/Oktober 2008<br />
Die fünf Standorte der „Lebendigen Museen“ sind<br />
mit großem ehrenamtlichen Arbeitseinsatz von Mitgliedern<br />
der <strong>Heimatverein</strong>e Ramsdorf und Velen und<br />
weiteren Helfern begleitet worden. Finanzielle Unterstützung<br />
leisteten die Europäische Union, das Land<br />
Nordrhein-Westfalen, der Landschaftsverband Westfalen-Lippe,<br />
der Kreis Borken und die Gemeinde Velen-Ramsdorf.<br />
Seinem ausführlichen Artikel zu der Übergabe der<br />
„Lebendigen Museen“ hat der Autor Christian Schulze<br />
Pellengahr als Anhang zahlreiche Hinweise auf Veröffentlichungen<br />
hinzugefügt, aus denen sich der an der<br />
Ortsgeschichte Interessierte noch weiter informieren<br />
kann.<br />
Eingefügt sind Fotografien von den Persönlichkeiten,<br />
die an der Eröffnungsfeier teilgenommen haben<br />
und ein Blick auf die Karte der Radroute und einige<br />
Museen.<br />
WAS - WANN – WO – AUSSTELLUNGEN -<br />
Punsch, Plätzchen und Kunsthandwerk<br />
im Textilmuseum Bocholt<br />
Adventsmarkt lockt wieder mit vielen Angeboten<br />
Bocholt (lwl). Gerade hat der Herbst begonnen, da<br />
geben Lebkuchen und Spekulatius in den Supermarktregalen<br />
schon einen Vorgeschmack auf die<br />
Weihnachtszeit. Auch im Textilmuseum in Bocholt<br />
laufen die Vorbereitungen für den traditionellen Adventsmarkt<br />
an. Von Dienstag, 25. November, bis<br />
Sonntag, 30. November, lädt der Landschaftsverband<br />
Westfalen-Lippe (LWL) zu Punsch, Plätzchen<br />
und Kunsthandwerk in sein Industriemuseum nach<br />
Bocholt ein. Im historischen Ambiente des Textilmuseums<br />
finden Besucher alles, was zu Advent und<br />
Weihnachten passt. Der Eintritt ist frei.<br />
Bereits zum 13. Mal bauen Hobbykünstler ihre<br />
Stände im Websaal und auf dem Hof des LWL-<br />
Industriemuseums auf, wo sie ihre handgefertigten<br />
Kunstgegenstände präsentieren und verkaufen. Das<br />
Angebot reicht von Teddybären über Krippenfiguren<br />
und Schmuck bis hin zu handgeschöpften Papieren.<br />
Besonders umfangreich ist das Angebot an Kreativem<br />
aus Stoff und Faden, darunter Puppenkleider, Tücher<br />
in Seidenmalerei, Klöppelarbeiten und Patchwork-<br />
Kissen.<br />
Jeweils von 10 bis<br />
18 Uhr können die<br />
Besucher an den<br />
festlich geschmückten<br />
Ständen stöbern.<br />
Vielleicht ist<br />
bei dem breiten<br />
Angebot an Kunstgewerbe<br />
ja schon<br />
das richtige Weihnachtsgeschenk<br />
dabei. Ansonsten<br />
dürfen die Besucher<br />
gleich selbst kreativ<br />
werden. Von Dienstag<br />
(25.11.) bis Freitag<br />
(28.11.) jeweils<br />
von 15 bis 17 Uhr<br />
können Kinder im<br />
Alter von 6 bis 12<br />
Jahren unter Anleitung<br />
basteln (Kosten<br />
3 €). Anschließend werden in der gemütlichen<br />
Wohnküche des Arbeiterhauses Märchen erzählt. Die<br />
Erwachsenen haben am Mittwoch (26.11.) und Donnerstag<br />
(27.11.) von 18.30 bis 20.30 Uhr die Möglichkeit,<br />
Stoffe mit dem traditionellen Blaudruck zu gestalten<br />
(Kosten: 10 € plus Material). Eine Anmeldung<br />
sowohl fürs Basteln als auch für den Stoffdruck ist<br />
erforderlich unter Tel. 02871 21611-0.<br />
Natürlich darf der Nikolaus nicht fehlen. Er kommt<br />
am ersten Adventssonntag (30.11.) um 15 Uhr ins<br />
LWL-Industriemuseum und verteilt Überraschungen<br />
an die kleinen Besucher.
Nr. 202 / September/Oktober 2008 <strong>HEIMATBRIEF</strong> 27<br />
In der Festwoche lädt das Museumsrestaurant<br />
„Schiffchen“ täglich zum gemütlichen Adventskaffee<br />
ein. Vom Bäcker, Metzger und Imker gibt es Kleinigkeiten<br />
für den Hunger zwischendurch. Das Textilmuseum<br />
verkauft dazu Glühwein, Kinderpunsch und<br />
Saft.<br />
Im Rahmen des Adventsmarktes wird es außerdem<br />
eine Tombola geben, deren Erlös für einen guten<br />
Zweck bestimmt ist.<br />
13. Krippenausstellung im Heimathaus Noldes<br />
im historischen Dorfkring Ammeloe in der Stadt<br />
Vreden<br />
Vreden-Ammeloe. Nach 12 sehr gut angenommenen<br />
Krippenausstellungen wird am Totensonntag,<br />
23. 11. 2008, im Heimathaus Noldes im historischen<br />
Dorfkring Ammeloe in der Stadt Vreden die nunmehr<br />
13. Ausstellung eröffnet. Sie ist dann 3 Wochen lang<br />
täglich von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr zu sehen.<br />
Weihnachtskrippen und adventliches Brauchtum ist<br />
das diesjährige Thema. Mittelpunkt der Ausstellung ist<br />
die Kirchenkrippe aus der Gemeinde St. Georg Ottenstein,<br />
die von Gemeindemitgliedern noch in jüngerer<br />
Zeit gespendet wurde. Eine große Vielfalt insbesondere<br />
von Familienkrippen aus dem Kreis Borken<br />
und darüber hinaus scharen sich um die Hauptkrippe.<br />
Personen, die in der Vorweihnachtszeit abseits vom<br />
großen Weihnachtstrubel einen besinnlichen Nachmittag<br />
erleben möchten, werden nicht enttäuscht.<br />
Besuchergruppen werden gebeten, sich möglichst<br />
vorab anzumelden unter den Ruf-Nr. 02564/6670 Anni<br />
Huning bzw. 02564/1038 Maria Noldes. In der adventlichen<br />
Atmosphäre des Heimathauses bieten Frauen<br />
Kaffee und selbstgebackenen Kuchen an. Der Eintritt<br />
beträgt 1,50 Euro.<br />
Selbstverständlich kann auch die Dauerausstellung<br />
in der Heimatscheune mit ca. 800 Exponaten aus<br />
Handwerk, Landwirtschaft und vieles mehr besichtigt<br />
werden.<br />
Die Strickgruppe der Ammeloer Seniorengemeinschaft<br />
hält im alten Kaufmannsladen von 1880 ihre<br />
neuesten Artikel zum Verkauf bereit; der Erlös geht an<br />
eine karitative Einrichtung.<br />
Pressemitteilung des Vorsitzenden des <strong>Heimatverein</strong>s<br />
Vreden-Ammeloe, Bernhard Rolvering.<br />
Grenzenloser Glaube<br />
Neue Ausstellung über Zwillbrock und<br />
die Missionsstationen an der Grenze<br />
am Sonntag, 26. Oktober<br />
im Hamaland-Museum in Vreden eröffnet<br />
Kreis Borken/Vreden. Kurz nach dem Dreißigjährigen<br />
Krieg, zur Zeit von Reformation und Gegenreformation,<br />
hatte der katholische Glaube in den Niederlanden<br />
einen schweren Stand. Um die Katholiken im<br />
Nachbarland zu unterstützen, richtete das Bistum<br />
Münster direkt an der Grenze mehrere Klöster und<br />
Missionsstationen ein, bis heute ist Zwillbrock die<br />
bekannteste. Die historischen Hintergründe und die<br />
Geschichte der Stationen zwischen Anholt und Glane,<br />
zu denen auch einige auf niederländischen Boden<br />
gehören, beleuchtet die Ausstellung „Grenzenlos –<br />
Zwillbrock und die Missionsstationen an der Grenze“,<br />
die seit Sonntag, 26. Oktober, im kreiseigenen Hamaland-Museum<br />
in Vreden zu sehen ist.<br />
Als zentrales Beispiel steht das Kloster Bethlehem in<br />
Zwillbrock im Mittelpunkt der Ausstellung. „Durch seine<br />
Lage unmittelbar an der Grenze und seine Größe<br />
nahm es eine besondere Stellung ein“, erklärt die<br />
Leiterin des Hamaland-Museums, Dr. Annette Menke.<br />
Sie hat die Ausstellung konzipiert. Den Anstoß gaben<br />
Bruder Hubert Müller, Seelsorger in Zwillbrock, und<br />
der Freundeskreis Barockkirche Zwillbrock, die auch<br />
viel Fachwissen in die Schau eingebracht haben.<br />
Zahlreiche Exponate führen den Besucherinnen und<br />
Besuchern der Ausstellung die Geschichte des Zwillbrocker<br />
Klosters vor Augen. Dabei reicht die Zeitspanne<br />
von der berühmten Mitternachtsmesse Weihnachten<br />
1651 unter freiem Himmel über die Gründer<br />
der Pfarrei im Jahre 1858 bis zu Bildern von der Restaurierung<br />
der „Barockperle“ des Münsterlandes in<br />
den Jahren 1958 bis 1960. Weitere Missionsstationen<br />
entlang der Grenze befanden sich in Anholt, Schüttenstein,<br />
Suderwick, Mussum, Emsing, in der Kreuzkapelle<br />
Hemden, in Bocholt, Oeding, Vreden, Oldenkott,<br />
Niekerk, Rietmolen, Herker-Orthaus und Glane.<br />
Zur Eröffnung der Ausstellung waren rund 130 Gäste<br />
im Hamaland-Museum anwesend. Nach der Begrüßung<br />
durch Dr. Annette Menke sprach der Vorsitzende<br />
des Freundeskreises Barockkirche Zwillbrock,<br />
Frits J.A. Oostrik. Die Einführung in die Ausstellung,<br />
die bis zum 11. Januar 2009 zu sehen sein wird,<br />
übernahm Bruder Hubert Müller.<br />
Der Restaurator Edgar Jetter, der auch wiederholt in<br />
Zwillbrock gearbeitet hat, lässt sich während der Ausstellung<br />
zwei Mal über die Schulter schauen. Am<br />
Sonntag, 23. November, zeigt er von 14 bis 17 Uhr,
28 <strong>HEIMATBRIEF</strong> Nr. 202 / September/Oktober 2008<br />
welche Arbeitsschritte <strong>beim</strong> Vergolden erforderlich<br />
sind. Am Samstag, 3. Januar, erklärt er anhand einiger<br />
Beispiele die Restaurierung von Gemälden.<br />
Begleitend zur Ausstellung gibt der Freundeskreis<br />
der Barockkirche Zwillbrock ein Buch heraus, das die<br />
Hintergründe und die Entwicklung der Klöster im<br />
Grenzgebiet des Bistums Münster sowie der Missionsstationen<br />
anschaulich erläutert. Auch hier nimmt<br />
die Barockkirche in Zwillbrock, deren Geschichte bis<br />
in die Gegenwart aufgezeigt wird, einen besonderen<br />
Stellenwert ein. Bisher unveröffentlichtes Fotomaterial<br />
über die Restaurierung der Kirche vor 50 Jahren<br />
durch Edgar Jetter illustriert die Bedeutung der Innenausstattung<br />
der barocken Kirche. Das Buch mit dem<br />
Titel „GRENZENLOS – Zwillbrock und die Missionsstationen<br />
an der Grenze“ umfasst 148 Seiten, 85 Abbildungen<br />
und historische Urkarten. Es ist zum Preis<br />
von 12 Euro erhältlich im Hamaland-Museum, im<br />
Pfarrhaus der Barockkirche Zwillbrock und <strong>beim</strong> Kreis<br />
Borken, Fachabteilung Kultur der Kreisverwaltung,<br />
Tel.: 02861/82-1350 oder kulturamt@kreis-borken.de,<br />
sowie im Buchhandel. ISBN 10: 3-937432-25-6; ISBN<br />
13: 978-3-937432-25-0<br />
Das Hamaland-Museum in Vreden ist dienstags bis<br />
sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet<br />
für Erwachsene zwei Euro, Schüler und Studenten<br />
zahlen einen Euro, Familien vier Euro. Führungen<br />
sind auf Anfrage möglich. Nähere Informationen zur<br />
neuen Ausstellung gibt es im Museum unter der Telefonnummer<br />
02564/39180 oder per Mail: hamalandmuseum@kreis-borken.de.<br />
PLATTDÜTSKE VERTÄLLKES ETC.<br />
(ws.) In jedem Heimatbrief soll weiterhin das Plattdeutsche<br />
in jeglicher Form wiedergegeben werden.<br />
Soweit kleine Vertällkes, Gedichte etc. aus unserem<br />
Kreisgebiet veröffentlicht werden sollen, bitte ich alle<br />
<strong>Heimatverein</strong>e um Zusendung entsprechender Vorlagen.<br />
Reiner Mako<br />
entnommen dem Büchlein<br />
DE KLUMPEN KLAPPERT...<br />
von Dr. Hugo von Oy<br />
IMPRESSUM<br />
Bi Kapps, den dicken Brüggenwirt,<br />
hat sick ne Jüngling inquartiert.<br />
He drunk un att, watt eene kann,<br />
un Kapps schraäw alles naättkes an.<br />
As he äm no de Räknung brägg,<br />
doar was de Kunde oak all´ wägg:<br />
„No ist de Kirl mi stuwen gaohn,<br />
ick könn mi vör de Blaässe schlaohn,<br />
weet sienen Namen nich, un nicks“.<br />
Doar sägg dat Staowenmaiken fix:<br />
„Ick häbb den Kirl soforts nich trut,<br />
ick häbb oak sienen Namen rut,<br />
sien Underbucks an´ Bäddepost,<br />
de häw äm sien Geheimnis kost,<br />
ick sägg mi, Däerne waäss gescheit,<br />
doar steht sien Nam´ jao inn`eneiht,<br />
Maät Reiner fing de Name an –<br />
Reiner Mako hätt den Mann.“<br />
Herausgeber:<br />
Der Heimatpfleger des Kreises Borken<br />
Redaktion:<br />
Walter Schwane, Ahnenkamp 21a, 46325 Borken,<br />
Tel.: 02861/1798 (ws.)<br />
E-Mail: familieschwane@versanet.de,<br />
dienstlich: Tel.: 02861/82-1217,<br />
E-Mail: w.schwane@kreis-borken.de<br />
Buchtipps, Blick in Zeitschriften, etc.:<br />
Margret Schwack, Bahnhofstraße 9, 46325 Borken<br />
Tel.: 02861/1352 (sc.)<br />
Kreisverwaltung Borken: Fax: 02861/82-1365<br />
Der Heimatbrief kann auch im Internet nachgelesen<br />
werden bei:<br />
http://www.kreis-borken.de/kreisverwaltung/<br />
aufgabenbereiche/kultur/heimatpflege/heimatbrief.<br />
html<br />
Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet!<br />
Einsendungen bitte an die Redaktion (siehe oben)<br />
oder an die Geschäftsstelle der Kreisheimatpflege,<br />
Burloer Str. 93, 46325 Borken, Tel.: 02861/82-1350<br />
oder 82-1348.
29 <strong>HEIMATBRIEF</strong> Nr 202 / September/Oktober 2008
30 <strong>HEIMATBRIEF</strong> Nr. 202 / September/Oktober 2008
Nr. 202 / September/Oktober 2008 <strong>HEIMATBRIEF</strong> 31<br />
Neue Publikationen des Kreises Borken 2007 / 2008<br />
___ Exemplare „Westmünsterland / Das Jahrbuch des Kreises Borken 2009“<br />
Interessantes Lesebuch mit über 60 Aufsätzen aus allen Städten und Gemeinden zu regionalen<br />
u. westmünsterländischen Themen, Chronik wichtiger Ereignisse, Übersicht neuer Heimatliteratur.<br />
320 Seiten 16,5 x 23 cm, ca. 130 Farbfotos, Fadenheftung, fester Einband, (erscheint Ende November 2008)<br />
Preis: 7,50 € (ISBN 10: 3-937432-26-4 / ISBN 13: 978-3-937432-26-7)<br />
___ Exemplare „Gartenreich(es) Westmünsterland“<br />
- Gärten und Parks in den Kreisen Borken und Coesfeld. Regionaler Reiseführer durch die Parklandschaft.<br />
Insgesamt werden aus beiden Kreisen je 20 Gärten und Parkanlagen vorgestellt.<br />
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Eva Henze und Hartmut Kalle (Hrsg.)<br />
240 S., 15 x 27 cm, viele Abbildungen, Einzelkarten, ausklappbare Übersichtskarte, kartoniert<br />
Preis: 19,80 € (ISBN 13: 078-3-939172-25-3)<br />
___ Exemplare „Deutsch-Niederländisches Anlauthaus für den bilingualen Unterricht“<br />
Lose-Blatt-Sammlung (DIN-A 4) & Wandkarte. Herausgegeben vom Schulamt für den Kreis Borken, 2008<br />
Elisabeth Wantia-Kolff / Margret Busse (Konzept), Margret Busse (Gestaltung)<br />
Lose-Blatt-Sammlung in Einlegemappe: 52 farbige Buchstabentafeln, beidseitig bedruckt; 5 farbige Tischvorlagen, 6 Seiten<br />
Arbeitshinweise, 16 Seiten Kopiervorlagen, schwarz/weiß<br />
Farbige Wandkarte: 120 x 100 cm,<br />
Preis: 14,00 € (ISBN 10: 3-937432-22-1)<br />
___ Exemplare „Sagen und Geschichten aus Schöppingen“<br />
- Erlebnisbuch zu einem begleitenden Schul – und Kulturprogramm der Kardinal-von-Galen-Schule in Zusammenarbeit<br />
mit Stiftung Künstlerdorf Schöppingen zur Skulptur-Biennale Münsterland –Kreis Borken 2005,<br />
Josef Spiegel, Stiftung Künstlerdorf Schöppingen (Hrsg.), 2006<br />
35 Seiten, 21,5 x 30 cm, Farbholzschnitte, Fotos, Klebebindung, fester Einband<br />
Preis: 7,95 € (ISBN 10: 3-937828-11-7)<br />
___ Exemplare „Kunst-Naober-Shop“<br />
- Ein grenzüberschreitendes Projekt für junge Künstler in der EUREGIO / een grensoverschrijdende Project voor jonge kunstenaars<br />
in der EUREGIO -Katalog mit allen Wettbewerbsbeiträgen, deutsch/niederländisch, 2007<br />
120 Seiten, 22 x 22 cm, 40 farbige Abbildungen, Klebebindung, kartoniert<br />
Preis: 10,00 € (ISBN 10: 3-937432-17-5 / ISBN 13: 978-3-937432-17-5)<br />
___ Exemplare „Skulptur-Biennale Münsterland Kreis Borken - Latente Historie“<br />
15 zeitgenössische Künstler setzen sich mit der verborgenen oder nur noch in Spuren vorhandener Geschichte der Region, der<br />
latenten Historie, auseinander.<br />
173 S., 26 x 21 cm, 80 meist farbige Abbildungen von Boris Becker, Köln, Fadenheftung, kartoniert<br />
Preis: 20,00 € (vorher 28,90 €))<br />
___ Exemplare „Grenzenlos“ / Zwillbrock und die Missionsstationen an der Grenze<br />
Die Aufsatzsammlung wurde herausgegeben vom Freundeskreis Barockkirche Zwillbrock e.V., 2008<br />
Erläutert werden historische Hintergründe, Geschichte und Entwicklung der Klöster Bocholt, Vreden, Zwillbrock und deren<br />
Missionsstationen Mussum, Anholt, Suderwick, Schüttenstein, Emsing, Kreuzkapelle, Oeding, Oldenkott, Niekerk, Herker-<br />
Orthaus, Rietmolen (NL).<br />
Begleitendes Buch zur Sonderausstellung im Hamaland-Museum Vreden (26.10.08-11.01.09)<br />
148 Seiten, 15 x 21 cm, 75 meist farbige Abb. einschließlich historischer Urkarten, Fadenheftung, fester Einband<br />
Preis: 12,00 € (ISBN 10: 3-937432-25-6 / ISBN 13: 978-3-937432-25-0)<br />
___ Exemplare „Tausend Jahre. Vreden 1933 – 1945“<br />
- Herausgegeben im Auftrage der Stadt Vreden von Ingeborg Höting und Timothy Sodmann,<br />
Landeskundliches Institut Westmünsterland - Quellen & Studien, Band 15, Vreden 2008<br />
3 Bände, insgesamt 1.640.Seiten, 16,5 x 23 cm, zahlreiche s/w Abbildungen, Fadenheftung, fester Einband<br />
Preis: 39,00 € (ISBN 10: 3-937432-10-8 / ISBN 13: 978-3-937432-10-6)<br />
___ Exemplare „Die Edelherren von Ahaus“<br />
- Ein Beitrag zur Geschichte des westfälischen Adels im Mittelalter, Volker Tschuschke,<br />
Landeskundliches Institut Westmünsterland - Quellen & Studien, Band 16, Vreden 2007<br />
632 Seiten, 16x 24,5 cm, Farbtafel u. s/w Abbildungen, Fadenheftung, fester Einband<br />
Preis: 26,00 € (ISBN 10: 3-937432-12-4 / ISBN 13: 978-3-937432-12-0)
32 <strong>HEIMATBRIEF</strong> Nr. 202 / September/Oktober 2008<br />
___ Exemplare „Dialektschwund im Westmünsterland“<br />
- Zum Verlauf des Niederdeutsch-hochdeutschen Sprachwechsels im 20. Jh., L. Kremer/ Veerle van Caeneghem,<br />
Landeskundliches Institut Westmünsterland - Quellen & Studien, Band 17, Vreden 2007,<br />
156 Seiten, Karten und Tabellen, 17 x 24,5 cm, Fadenheftung, fester Einband<br />
Preis: 15,00 € (ISBN 10: 3-937432-15-9 / ISBN 13: 978-3-937432-15-1)<br />
___ Exemplare „Westfälisch-Münsterländische Heidengräber“(Jodocus Hermann Nünning)<br />
- Aus dem Lateinischen übersetzt von Engelbert Hüsing. Neu herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Timothy<br />
Sodmann, Landeskundliches Institut Westmünsterland - Quellen & Studien, Band 18, Vreden, 2008,<br />
XVI Seiten Einleitung, 75 Textseiten, 7 Seiten s/w-Abbildungen, 17 x 24,5 cm, Fadenheftung, fester Einband<br />
Preis: 12,00 € (ISBN 10: 3-937432-21-3 / ISBN 13: 978-3-937432-21-2)<br />
__ Exemplare „Historisch-landeskundliche Forschung im Westmünsterland“<br />
- Ein Überblick von den Anfängen bis zur Gegenwart, (erscheint Dezember 2008))<br />
Herausgegeben von Werner Haßenkamp, Ludger Kremer und Winfried Semmelmann,<br />
Landeskundliches Institut Westmünsterland - Quellen & Studien, Band 19, Vreden 2008;<br />
Beiträge von W. Haßenkamp, L. Kremer, W. Semmelmann, Thomas Ridder, Ingeborg Höting, Erhard Mietzner,<br />
220 S.,17 x 24 cm, Fadenheftung, fester Einband, Preis: ca. 12,50 € (ISBN 10: 3-937432-24-8)<br />
___ Exemplare „Jodocus-Hermann-Nünning-Preis 2006“<br />
- Berichte u. Dokumentationen aus dem Landeskundlichen Institut Westmünsterland, Heft 6, Vreden 2008, Vorträge zur Verleihung<br />
des Nünning-Preises an Dr. Volker Tschuschke, Vreden; Timothy Sodmann (Hrsg.)<br />
74 Seiten, 15 x 21 cm, s/w Abbildungen, kartoniert ; Preis: 1,50 € (ISBN 10: 3-937432-14-0 )<br />
__________________________________________________________________________________<br />
Das komplette Verzeichnis der lieferbaren Publikationen finden Sie als pdf-Datei im Internet unter www.kreisborken.de<br />
(Kreisverwaltung/Aufgabenbereiche/Kultur/Publikationen). Bestellungen sind telefonisch, schriftlich oder<br />
per eMail möglich. Preise incl. MWST.<br />
Der Versand erfolgt mit Rechnung zzgl. Versandkosten. (Stand:10.10.2008)<br />
BESTELLUNG:<br />
Name / Vorname: ______________________________________________________<br />
Straße: ______________________________________________________<br />
PLZ / Ort: ______________________________________________________<br />
Datum: _________________Unterschrift: ___________________________<br />
Kreis Borken<br />
Fachabteilung Kultur<br />
Burloer Str. 93<br />
46325 Borken<br />
Informationen und Auskünfte:<br />
Antonius Böing, Thomas Wigger<br />
Tel.: 0 28 61/82-13 50<br />
Fax: 0 28 61/82-13 65<br />
eMail: t.wigger@kreis-borken.de