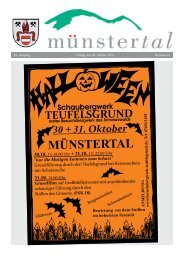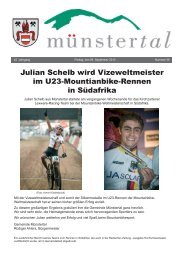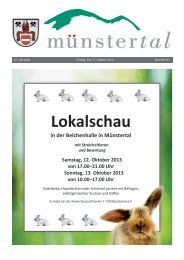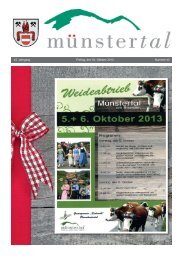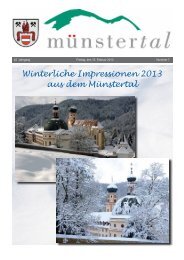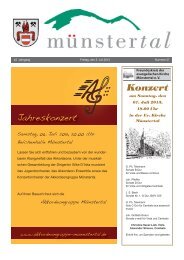Aktion Essen auf Rädern Lazerus Hilfsdienst e.V. - Münstertal
Aktion Essen auf Rädern Lazerus Hilfsdienst e.V. - Münstertal
Aktion Essen auf Rädern Lazerus Hilfsdienst e.V. - Münstertal
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Freitag, den 16. Dezember 2011<br />
KonradRuh:Das<strong>Münstertal</strong>in<br />
den ersten Nachkriegsjahren<br />
(11)<br />
Viele Münstertäler sind (fast)<br />
lebensmittelautark<br />
Trotz der deutschlandweit schwierigen Ernährungslage<br />
in den ersten Nachkriegsjahren<br />
konnte in beiden Gemeinden des <strong>Münstertal</strong>s<br />
nicht von einer Hungersnot gesprochen<br />
werden. Viele Münstertäler Familien<br />
waren zum größten Teil Selbstversorger.<br />
Fast alles, was zum täglichen Leben notwendig<br />
war, konnten sie selbst erzeugen. Gek<strong>auf</strong>t<br />
wurde nur, was unbedingt notwendig<br />
war, wie beispielsweise Salz und Zucker.<br />
Übrigens: Der Begriff „Müll“ war noch ein<br />
Fremdwort. Abfall entstand so gut wie keiner.<br />
Es gab einen Misth<strong>auf</strong>en, ein Schwein und<br />
einen Ofen.<br />
In beiden Talgemeinden wurde jede landwirtschaftlich<br />
nutzbare Fläche von den Landwirten<br />
bewirtschaftet. Die Kahlflächen, die<br />
durch die „Franzosenhiebe“ entstanden waren,<br />
wurden jetzt als Weideflächen genutzt.<br />
Weideflächen hingegen wurden in ertragreichere<br />
Mähwiesen umgewandelt. Die kargen<br />
Weideflächen gingen in Untermünstertal von<br />
405 ha (im Jahre 1940) <strong>auf</strong> 350 ha zurück,<br />
die Fläche der intensiv bewirtschafteten Wiesen<br />
hingegen erhöhte sich im gleichen<br />
Zeitraum um 100 ha <strong>auf</strong> 510 ha.<br />
Obwohl die naturgeographischen Bedingungen<br />
für den Ackerbau im <strong>Münstertal</strong> alles andere<br />
als günstig sind, erhöhte sich auch hier<br />
die Nutzfläche in Untermünstertal <strong>auf</strong> knapp<br />
100 ha.<br />
Die Ackerflächen reichten oft bis an die<br />
Waldgrenze hin<strong>auf</strong>. Auf diesen Feldern<br />
konnte vor allem Kartoffeln, aber auch Gerste<br />
und Hafer angebaut werden. In günstigen<br />
Südhanglagen gediehen sogar Flachs und<br />
Raps, deren ölhaltige Samen zur Herstellung<br />
von Lein- und Rapsöl verwendet wurden.<br />
Im Vergleich zu Städten und auch anderen<br />
Schwarzwaldgemeinden war das <strong>Münstertal</strong><br />
-was das Nahrungsmittelangebot betraf- fast<br />
autark. Dies gilt vor allem für das untere<br />
<strong>Münstertal</strong>. So besaßen 168 landwirtschaftliche<br />
Betriebe des Untertals im Jahre 1948<br />
insgesamt 129 ha Wiesen- und Ackerland in<br />
verschiedenen Gemeinden der St<strong>auf</strong>ener<br />
Bucht, in Grunern (65 ha), in St<strong>auf</strong>en (44 ha)<br />
und weitere Betriebsflächen in Bad Krozingen,<br />
Gallenweiler und Tunsel. Neben den<br />
Kartoffeln konnten die Münstertäler hier <strong>auf</strong>grund<br />
der klimatisch günstigeren Bedingungen<br />
in der Rheinebene auch Weizen als<br />
wichtigstes Brotgetreide anbauen.<br />
Darüber hinaus wandelten viele Münstertäler<br />
Familien Teilbereiche ihrer Hausgrundstücke<br />
in Gärten um und bauten dar<strong>auf</strong> alles<br />
an, was es sonst nirgends zu k<strong>auf</strong>en gab.<br />
Auch die Obstbäume in den Hausgärten waren<br />
wichtige Nahrungsmittel-Lieferanten.<br />
Aufgrund der topographischen und klimatischen<br />
Gegebenheiten fehlten den Münstertälern<br />
vor allem Öl und Mehl. Viele Frauen<br />
fuhren deshalb mit ihren Handleiterwagen<br />
„<strong>auf</strong>s Land“ und versuchten durch Tausch,<br />
das begehrte Getreide oder Mehl zu<br />
erhalten.<br />
Die Schätze der Natur ergänzen das landwirtschaftliche<br />
Nahrungsangebot<br />
Stark verbreitet war im <strong>Münstertal</strong> das Sammeln<br />
von Bucheckern. Zentnerweise sammelten<br />
Mütter mit ihren Kindern diese im<br />
<strong>Münstertal</strong> zahlreich vorkommenden ölhaltigen<br />
Früchte der Buche. Die Bucheckern,<br />
aber auch Walnüsse von eigenen Bäumen<br />
brachten sie in die Mühlen von Heitersheim<br />
oder Kirchhofen und erhielten dafür das dringend<br />
benötigte Öl. Für vier Kilo Bucheckern<br />
oder vier Pfund Walnüsse erhielt man im<br />
Jahre 1946 noch einen Liter Öl. Leider war<br />
die letzte Münstertäler Ölmühle in der Rotte<br />
Münster (s`Ölers) nicht mehr in Betrieb. Sie<br />
wurde im Jahre 1936 vom letzten Ölmüller<br />
Josef Ortlieb <strong>auf</strong>grund der damals geringe<br />
Nachfrage stillgelegt.<br />
Darüber hinaus sammelten die Familien alles,<br />
was Mutter Natur an Nahrhaftem bot. Es<br />
waren vor allem die Waldfrüchte (Heidelbeere,<br />
Himbeere, Brombeere). Sie wurden überwiegend<br />
zu Marmelade verarbeitet. Die Plätze<br />
(„Schläge“), an denen es bestimmte Beerensorten<br />
gab, wurden oft als Geheimnis gehütet,<br />
um mögliche Konkurrenz abzuhalten.<br />
Da in den Jahren 1946/47 auch viele Sammler<br />
aus den Landgemeinden im <strong>Münstertal</strong><br />
<strong>auf</strong> Beerensuche gingen, erlaubte die Gemeinde<br />
Untermünstertal dies nur über einen<br />
„Erlaubnisschein“, der für drei Mark <strong>auf</strong> dem<br />
Rathaus oder über die Förster erworben<br />
werden musste.<br />
Aus vielen heimischen Wiesenkräutern wurde<br />
Tee zubereitet. Eicheln dienten als Futter<br />
für die Schweine. In manchen Familien wurden<br />
sie aber auch geröstet und als Kaffee-Ersatz<br />
(„Muckefuck“) verwendet. Aus<br />
„Tannschösslingen“, den jungen Trieben der<br />
Fichte, die man im Frühjahr sammelte,<br />
machte man den „Tannschössle-Honig“.<br />
Dem Zuckermangel begegneten viele Familien<br />
mit dem Anbau von Zuckerrüben. Aus<br />
den geschnetzelten Rüben (im Waschkessel<br />
oder Topf erhitzt) gewann man den Zuckerrübensirup,<br />
einen dunkelbrauen, zähflüssigen<br />
Saft. Anstelle von Zucker diente er zum<br />
Süßen von Speisen.<br />
Angebaut wurden auch verschiedene Krautund<br />
Rübensorten. Weißkraut wurde zu Sauerkraut<br />
verarbeitet. Gelbe und rote Rüben („Rahnen“),<br />
Bohnen und Erbsen sowie jahreszeitlich<br />
verschiedeneSalatewarenwichtigeGrundnahrungsmittel.<br />
Während Kartoffeln und Äpfel in<br />
den Kellern überwinterten, bildete ein Erdloch<br />
im Garten das „Kühlfach“ für die verschiedenen<br />
Rübensorten. Apfelwein und aus Rosinen hergestellter<br />
Beerenwein lagerten im Keller neben<br />
„Sauerkrautstanden“, „Kartoffelhurten“ und „Apfelsteigen“.<br />
8<br />
Obwohl die klimatischen Bedingungen vor allem<br />
im oberen <strong>Münstertal</strong> im Vergleich zur Vorbergzone<br />
für den Obstanbau nicht sonderlich<br />
günstig sind, erstaunt die Zahl der offiziell gemeldeten<br />
und genutzten Obstbäume.<br />
Die Obstbaumzählung des Jahres 1946 listet<br />
in der Gemeinde Obermünstertal insgesamt<br />
722 Apfelbäume, 234 Birnbäume, 166<br />
Kirschbäume, 280 Zwetschgen- und Pflaumenbäume<br />
und 146 Walnussbäume <strong>auf</strong>.<br />
Für Familien, die über keinen eigenen Garten<br />
verfügten, ließ die Gemeinde Untermünstertal<br />
<strong>auf</strong> dem Sportplatz Kleingärten<br />
anlegen, die verpachtet wurden.<br />
Fleisch war im <strong>Münstertal</strong> auch keine ausgesprochene<br />
Mangelware. Zwar war die Menge<br />
des abzuliefernden Fleisches sehr hoch,<br />
zwar mussten alle Privatschlachtungen der<br />
Militärverwaltung gemeldet werden. Dennoch<br />
nahm die Zahl der „Schwarzschlachtungen“<br />
in den Notjahren 1946/47 erheblich<br />
zu. Es wurde auch „schwarz“ gemahlen und<br />
gebrannt.<br />
Unter den Nahrungsmitteln nahm die Kartoffel<br />
den wichtigsten Platz ein.<br />
Doch breitete sich zu allem Unglück der Kartoffelkäfer<br />
seit 1944 epidemieartig aus.<br />
Da es 1945 noch keine Schädlingsbekämpfungsmittel<br />
gab, (der größte Teil der chemischen<br />
Industrie war zerstört oder demontiert)<br />
mussten die Käfer „von Hand“ abgelesen<br />
bzw. die Larven zwischen den Blättern zerdrückt<br />
werden. Familien, ja ganze Schulklassen<br />
rückten aus, um dieser bedrohlichen<br />
Kartoffelkäferplage Herr zu werden.<br />
In den ersten Nachkriegsjahren nahm die<br />
Kartoffelkäferplage noch zu. Die Bürgermeister<br />
waren für die Bekämpfung zuständig.<br />
Sie mussten alle verfügbaren Einwohner<br />
-unabhängig von eigenem Besitz- mobilisieren<br />
und zum Sammeln der Käfer verpflichten.<br />
Sie bestimmten den Personenkreis. Wer<br />
sich weigerte, wurde von der Militärregierung<br />
bestraft. Die Käferbekämpfung hatte Vorrang<br />
vor allen anderen Arbeiten. Soweit<br />
Spritzgeräte und Spritzmittel (Kalkarsen) ab<br />
1946 zur Verfügung standen, wurden diese<br />
eingesetzt. Mit Hilfe der chemischen Bekämpfungsmittel<br />
konnte man der Käferplage<br />
nach 1948 allmählich Herr werden, doch<br />
ganz eindämmen konnte man sie erst in den<br />
1950er-Jahren.<br />
Neben der „Nahrungsnot“ auch<br />
„Kleidernot“<br />
Neben der Nahrungsmittelknappheit waren<br />
die ersten Nachkriegsjahre auch „Jahre der<br />
Kleidernot“. Die Bevölkerung trug die „alten<br />
Kleider“ so lange wie möglich aus. Bei den<br />
Männern wirkten die Vorkriegsanzüge <strong>auf</strong>grund<br />
der Unterernährung „sehr weit“. Ansonsten<br />
galt der Grundsatz „Aus alt mach<br />
neu“. Alte Wehrmachtsuniformen wurden<br />
<strong>auf</strong>getrennt, eingefärbt und zu neuen Kleidungsstücken<br />
für die ganze Familie verarbeitet.<br />
Knappstes Gut waren <strong>auf</strong>grund des