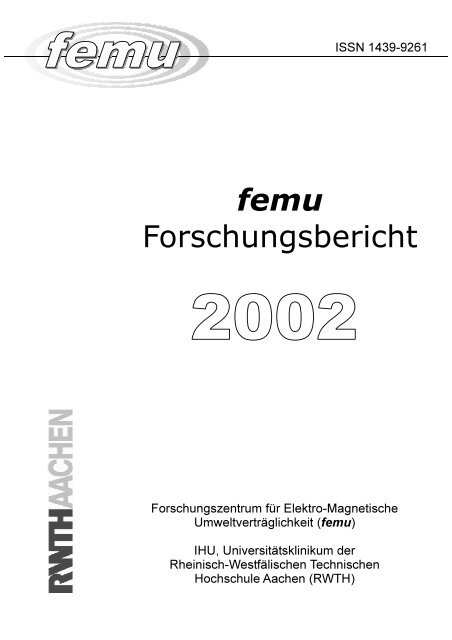Online-Ausgabe im pdf-Format - Institut für Arbeits- & Sozialmedizin ...
Online-Ausgabe im pdf-Format - Institut für Arbeits- & Sozialmedizin ...
Online-Ausgabe im pdf-Format - Institut für Arbeits- & Sozialmedizin ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ISSN 1439-9261femuForschungsberichtForschungszentrum für Elektro-MagnetischeUmweltverträglichkeit (femu)IHU, Universitätsklinikum derRheinisch-Westfälischen TechnischenHochschule Aachen (RWTH)
Inhaltsverzeichnis1 Jahresüberblick 62 Forschungsprojekte 112.1 Einfluss eines 50 Hz-Magnetfeldes auf das DNA-Reparaturvermögenverschiedener Zellarten in Gehirn und Niere . . . . . . 112.1.1 Stand der Forschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.1.2 Material und Methoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.1.3 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.1.4 Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.2 Niederfrequente magnetische Wechselfelder: Auswirkungen aufChondrozyten in vitro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.2.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.2.2 Material und Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.2.3 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.2.4 Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192.3 Einfluss starker elektrischer Felder auf die anti- und prothrombotischeAktivität von humanen Endothelzellen (HUVEC) . . . 212.3.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.3.2 Methode und Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.3.3 Ergebnisse und Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . 222.4 Wahrnehmung elektrischer, sinusförmiger und nicht sinusförmigerStröme durch die Sinnesrezeptoren der Haut . . . . 252.4.1 Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.4.2 Methode und Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.4.3 Wahrnehmbarkeit nicht sinusförmiger Ströme . . . . . . 262.4.4 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
42.5 Wirkung niederfrequenter magnetischer Felder auf den visuellenKanal: Magnetophosphene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292.5.1 Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292.5.2 Modellierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302.5.3 Numerische Berechnung und Ergebnisse . . . . . . . . . 312.6 Gleichrichtung der Felder des UMTS-Mobilfunks in Muskeln undNerven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332.6.1 Motivation und Zielsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . 332.6.2 GSM- und UMTS-Felder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332.6.3 Methoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352.6.4 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372.7 Herzschrittmacherpatienten in niederfrequenten elektromagnetischenFeldern unter Hochspannungsfreileitungen . . . . . . . . . 412.7.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412.7.2 Elektromagnetische Felder unter HSFLen . . . . . . . . . 422.7.3 Szenario auf Basis der ermittelten individuellen Einflussfaktoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442.7.4 Abschätzung der Möglichkeit einer Störung . . . . . . . . 462.8 Ausbau und Pflege der Wissensbasierten Literaturdatenbank(WBLDB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492.8.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492.8.2 Ziele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492.8.3 Methoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502.8.4 Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512.9 Internet Portal und Informationssystem über biologische WirkungenElektro-Magnetischer Felder ‘EMF-Portal’ . . . . . . . . 592.9.1 Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592.9.2 Ausgangsproblematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602.9.3 Bedarfsabschätzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612.9.4 Architektur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622.9.5 Datenbank der <strong>im</strong> Alltag auftretenden Felder . . . . . . 652.9.6 Inferenzmaschine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662.9.7 Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692.10 Elektrische Messung gastrointestinaler Motilität . . . . . . . . . 702.10.1 Problematik und Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . 70
52.10.2 Gastroösophagealer Reflux bei Säuglingen . . . . . . . . 702.10.3 Duodeno-gastroösophageale Refluxe bei Erwachsenen . . 712.10.4 Einfluss von Sedativa auf die Motilität des Magens —Tierexper<strong>im</strong>entelle Untersuchungen . . . . . . . . . . . . 722.10.5 Diskussion und Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733 Präsentationen 743.1 Erschienene Publikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743.2 Eingereichte Publikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753.3 Publizierte Kurzfassungen, Abstracts, Poster . . . . . . . . . . . 763.4 Vorträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793.5 Sonstige Aktivitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804 Anhang 834.1 Mitarbeiter des femu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834.2 femu-Förderer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854.3 Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Kapitel 1JahresüberblickDie <strong>im</strong> Berichtsjahr 2002 <strong>im</strong> Forschungszentrum für Elektro-Magnetische Umweltverträglichkeit(femu) bearbeiteten Projekte lassen sich in die folgendenvier Kategorien einteilen:ˆ Recherche und Auswertung von Literatur zur Wirkung elektromagnetischerFelder auf den Menschen, Bewertung des aktuellen Kenntnisstandesfür Experten sowie für die Öffentlichkeitˆ Erforschung von grundlegenden elektromagnetischen Wechselwirkungen<strong>im</strong> Organismus mittels in vivo- und in vitro-Untersuchungenˆ Abschätzung von Schwellen möglicher Beeinträchtigungen durch unterschiedlicheelektromagnetische Felder des Alltags bei Gesunden wie auchbei Implantatsträgernˆ diagnostische und therapeutische Anwendung elektromagnetischer Felder.Die Begründung und die Motivation für die Bearbeitung der ersten dreiProjektgruppen resultieren aus der rasanten Entwicklung und Markteinführungneuer Technologien und Techniken, die zusätzliche und zum Teil neuartige elektromagnetischeFelder in allen Aufenthaltsbereichen des Menschen erzeugen undeinen allgemeinen Anstieg der Gesamt<strong>im</strong>mission <strong>im</strong> Alltag verursachen. BekannteBeispiele wie der Mobilfunk der Dritten Generation (UMTS), die <strong>im</strong>merpopulärer werdenden Elemente mit Funkverbindungen bei Telefon, Computerund HiFi-Anlagen (WLAN, Bluetooth) oder auch induktive Kochplatten zeigen,dass sich diese Tendenz nicht nur auf spezielle industrielle Bereiche beschränkt,6
7sondern auch auf den Alltag erstreckt. In diesem Zusammenhang werden Fragennach eventuellen Auswirkungen dieser Felder auf die Gesundheit bzw. nachden noch verbleibenden Sicherheitsabständen für Gesunde und Kranke gestellt.Die Sorgen und Ängste vieler Bürger vor den Folgen elektromagnetischer Felderhaben eine politische Diskussion über eine Senkung der in Deutschlandgesetzlich verankerten Sicherheitsgrenzwerte ausgelöst. Eine Umsetzung wärezwangsläufig mit Folgekosten verbunden. So werden z.B. für eine diskutierteSenkung der Grenzwerte um einen Faktor 10 allein <strong>im</strong> niederfrequenten BereichFolgekosten in Höhe von ca. 30 Milliarden Euro geschätzt. Diese volkswirtschaftlichenD<strong>im</strong>ensionen mahnen dazu, solche Schritte nur dann zu unternehmen,wenn nachteilige gesundheitliche Effekte in den jeweiligen Feldern wissenschaftlicheindeutig nachgewiesen sind. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, dieForschung auf diesem Gebiet voranzutreiben und den aktuellen Wissensstandperiodisch zu bewerten.Unter Bezugnahme auf die weltweite Literatur wurden <strong>im</strong> femu in diesemJahr Studien des gegenwärtigen Wissensstandes über die Wirkungen hochfrequenterund niederfrequenter Felder auf den Organismus erarbeitet. Die <strong>im</strong> femuentwickelte, über Jahre gepflegte und laufend mit neuer Literatur ergänzteWissensbasierte Literaturdatenbank (WBLDB) (siehe Abschnitt 2.8) bietet diegeeignete Grundlage für derartige Bewertungen.Die hohe Rate von durchschnittlich 29.000 Internet-Zugriffen pro Woche aufdie WBLDB mit inzwischen mehr als 6.000 gesammelten Publikationen zumThema zeugt darüber hinaus von einem hohen Informationsbedarf bei Politikern,Ärzten, Juristen, Fachleuten und interessierten Bürgern. Diese Feststellungwird auch von den <strong>im</strong> Berichtsjahr bisher über 600 an das femu adressiertenund beantworteten Anfragen zu praktischen Problemen der elektromagnetischenUmweltverträglichkeit unterstrichen.In der WBLDB ist die Literatur in der gesamten interdisziplinären Breitedes Gebietes in englischer Sprache dargestellt. Für viele Nichtexperten ist es daherschwierig, die Inhalte der WBLDB zur Meinungsbildung heranzuziehen. Fürdiese <strong>im</strong>mer größer werdende Gruppe in der Bevölkerung wird <strong>im</strong> femu ein Informationsportal(siehe Abschnitt 2.9) entwickelt, das praktische Fragen ohne vorausgesetzteDetailkenntnisse der Materie in deutscher Sprache aufnehmen undbeantworten soll. Dabei wird auf das Basiswissen der WBLDB zurückgegriffen.Darüber hinaus wird das Portal mit einer illustrierten Darstellung der grund-
8legenden Zusammenhänge der elektromagnetischen Umweltverträglichkeit, miteinem Glossar der speziellen medizinischen und technischen Terminologie sowiemit einer Datenbank der Feldcharakteristika von in der Praxis vorkommendenExpositionsquellen ergänzt. Die ersten Testläufe des Portals sind <strong>im</strong> Gange, eineUmsetzung ins Internet wird Anfang des Jahres 2003 folgen.Die Bewertung und der Vergleich der weltweit publizierten Literatur zeigtzahlreiche Wissenslücken und Widersprüche bezüglich möglicher Wirkungenelektromagnetischer Felder <strong>im</strong> Organismus auf. Dabei ist insbesondere die krebspromovierendeWirkung niederfrequenter und hochfrequenter Felder <strong>im</strong> Alltagstark umstritten. Mit der in Abschnitt 2.1 präsentierten in vivo-Untersuchungzur Beeinflussung der DNA-Reparaturmechanismen bei Mäusen unter Langzeiteinwirkungeines starken magnetischen 50 Hz-Feldes wird ein Beitrag zudieser Diskussion geliefert. Mit neuartigen und hochempfindlichen Verfahrenkonnten zellartspezifische DNA-Schädigungen nachgewiesen werden. Allerdingssind die verwendeten Expositionen etwa 1000-fach stärker als sie <strong>im</strong> Alltag auftreten.Es bedarf einer weiteren Überprüfung der Existenz und der Reversibilitätdieses Effektes bei niedrigen Feldstärken, bevor die Frage einer eventuellenÜbertragbarkeit der Resultate auf den Menschen überhaupt diskutiert werdenkann.Niederfrequente magnetische Wechselfelder werden in der Orthopädie unterdem Begriff ‘Magnetfeldtherapie’ zur Behandlung degenerativer Gelenkerkrankungeneingesetzt, obwohl der therapeutische Effekt unbestätigt ist. ImRahmen der Überprüfung der häufig präsentierten hypothetischen Wirkungsmechanismensind in Abschnitt 2.2 Ergebnisse einer in vitro-Studie über denEinfluss magnetischer Felder auf den Metabolismus und die Proliferation vonhumanen Knorpelzellen dargelegt. Die Resultate bestätigen nicht die in der Literaturmehrfach angeführte Steigerung des Zellmetabolismus unter Einwirkungvon Magnetfeldern.Die Literatur wie auch eigene Untersuchungen (Abschnitt 2.2) weisen aufdie Epithelzellen als einen möglichen Ort zellspezifischer Wirkungen elektromagnetischerFelder hin. Die Epithelzellen der Blutgefäße sind ebenfalls involviertbei der Thromboseerkrankung, die häufig nach elektrischen Unfällen auftritt. In<strong>im</strong>munhistochemischen und enzym<strong>im</strong>munologischen Untersuchungen humanerNabelschnur-Endothelzellen (Abschnitt 2.3) wurde der Wirkung starker elektrischerFelder mit kurzer Einwirkdauer nachgegangen. Die deutlichsten Reak-
9tionen auf die Exposition zeigen sich in erhöhter Tissue Faktor-Konzentrationund erhöhter Freisetzung der Heat Shock-Proteine HSP-60 und HSP-70.Die Ermittlung der Reizschwellen niederfrequenter nichtsinusförmiger elektrischerStröme in den Sinnesrezeptoren steht in Abschnitt 2.4 <strong>im</strong> Vordergrund.Derartige Spannungs- und Stromformen kommen in der Praxis zur stufenlosenRegelung elektrischer Geräte <strong>im</strong>mer häufiger zur Anwendung und werden alsFehlströme bei einer Berührung mit der Haut wirksam. Die geltenden Sicherheitsvorschriftensind aus Exper<strong>im</strong>enten mit sinusförmigen Strömen abgeleitet,für die nichtsinusförmigen Ströme ist eine neuerliche Überprüfung der Wahrnehmungsschwellenerforderlich. Die Ergebnisse zeigen, dass die Wahrnehmungsschwellenicht nur vom zeitlichen Verlauf des Stromes, sondern auch von einerReihe individueller Faktoren abhängt.Die magnetischen Phosphene sind Effekte niederfrequenter magnetischer Felder<strong>im</strong> Organismus mit der niedrigsten Schwelle (oberhalb etwa 2 mT bei 50 Hz)aller belegter Wirkungen. Obwohl sie sich nur als harmlose Flickerwahrnehmung<strong>im</strong> Sehfeld bemerkbar machen, ist die bisher unbeantwortete Frage nach demOrt der Entstehung und den zu Grunde liegenden Mechanismen unbefriedigend.In Abschnitt 2.5 wird eine numerische S<strong>im</strong>ulation präsentiert, die den hypothetischenEntstehungsort der Phosphene, die Retina, und die Ursache der Reizungdurch die magnetisch induzierten elektrischen Wirbelfelder bestätigt.Die flächendeckende Einführung des UMTS-Mobilfunks wird die Immissiondurch Mikrowellen nur in geringem Umfang erhöhen, thermische Effekte <strong>im</strong> Organismusdurch diese Felder bleiben unwahrscheinlich. Da die UMTS-Felder <strong>im</strong>Vergleich mit dem heutigen GSM-Mobilfunk eine abweichende Kodierung derzu übertragenden Information aufweisen, ist eine Überprüfung der diskutiertenathermischen Wirkungen der UMTS-Felder <strong>im</strong> Organismus erforderlich. DerBeitrag in Abschnitt 2.6 setzt sich mit dem Nachweis der postulierten Gleichrichtereffektein der Zellmembran der Muskelzellen auseinander, die die Reizleitungin Muskeln beeinflussen. Die durchgeführten Untersuchungen bestätigendie Existenz solcher Effekte in den UMTS-/Mobilfunk-Mikrowellen nicht.Dem höchsten Risiko einer Beeinträchtigung durch die heutigen elektromagnetischenFelder sind die Träger von elektronischen Implantaten ausgesetzt.Trotzdem sind die Umstände von Störungen der Implantate nicht ausreichenderforscht; zudem gibt es keine Verordnungen zum Schutz dieser Patientengruppe.Als ein zu lösender Fall wird in Abschnitt 2.7 die Möglichkeit einer Störung
10von <strong>im</strong>plantierten Herzschrittmachern unter einer Hochspannungsfreileitung betrachtet.Auf der Grundlage von theoretischen S<strong>im</strong>ulationen und exper<strong>im</strong>entellenUntersuchungen lässt sich unter worst case-Bedingungen eine Störung vonHerzschrittmachern in diesem Bereich nicht ausschließen. Die Wahrscheinlichkeiteiner Gefahr in der Praxis ist jedoch nur anhand von Untersuchungen mitProbanden und Patienten zu best<strong>im</strong>men. Derartige Studien sind für das kommendeJahr geplant.Klinische Untersuchungen zur Validierung elektrischer Verfahren zur Charakterisierungder Motilität und Peristaltik <strong>im</strong> Gastrointestinaltrakt <strong>im</strong> physiologischenwie <strong>im</strong> pathologischen Fall wurden, wie in Abschnitt 2.10 skizziert, mitKliniken in Deutschland und in benachbarten Ländern fortgesetzt. Im Vordergrundsteht die Erforschung und Diagnostik des duodeno-gastroösophagealenRefluxes und der Clearance bei Kindern und Erwachsenen. Hier entwickelt sichdas Impedanzverfahren zu einem neuen weltweiten Standard. Aber auch alleanderen Ansätze der Untersuchungen <strong>im</strong> Bereich des Magens oder des DünnundDickdarms sind vielversprechend, jedoch wegen der größeren funktionellenKomplexität dieser Organe mit höherem exper<strong>im</strong>entellen Aufwand verbunden.Die folgenden Beiträge geben lediglich einen Einblick in die jeweiligen Projekte,ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Detaillierte Daten sindden in der Anlage aufgeführten Publikationen zu entnehmen.Aachen, <strong>im</strong> Dezember 2002Prof. Dr. J. Silny
Kapitel 2Forschungsprojekte2.1 Einfluss eines 50 Hz-Magnetfeldes aufdas DNA-Reparaturvermögen verschiedenerZellarten in Gehirn und NiereC. Schmitz 1 , H. Korr 1 , J. Silny2.1.1 Stand der ForschungDie Frage, ob durch eine 50- oder 60-Hz Magnetfeld [MF]-Exposition DNA-Schäden hervorgerufen werden können, ist seit den Publikationen von Lai &Singh (Bioelectromagnetics 18:156, 1997; Mutat. Res. 400: 313, 1998) sowie Svedenstalet al. (In vitro 13: 507 und 551, 1999) nach wie vor aktuell, zumal dieseArbeiten wegen methodischer Probleme nicht unumstritten sind (vgl. McNameeet al.: Mutat. Res. 513: 121, 2002). Wie schon in früheren Forschungsberichtenerwähnt (femu-Forschungsberichte 1999-2001), haben wir die interessierendeProblematik aufgegriffen und einen Pilotversuch an der adulten Maus untereinem starken (1 mT) und lang einwirkenden MF (8 Wochen) durchgeführt.Allerdings haben wir ganz andere Messmethoden als bisher üblich angewendet.Unsere Methoden zeichnen sich generell dadurch aus, dass mit Hilfe der quantitativenAutoradiographie zellartspezifische Ergebnisse in situ erhalten werden.Mittels der ersten von uns angewandten Methode haben wir das zellartspezi-1 Lehr- und Forschungsgebiet Anatomie und Zellbiologie, Universitätsklinikum der RWTHAachen11
12fische DNA-Reparaturvermögen best<strong>im</strong>mt. Dabei wird ausgenutzt, dass einerDNA-Reparatur stets ein DNA-Schaden vorangeht. Die DNA-Reparatur wirdüber einen essenziellen Teilschnitt dieses komplexen Geschehens best<strong>im</strong>mt, d.h.über den Einbau von appliziertem 3 H-Thymidin während der so genannten ‘UnscheduledDNA Synthesis’ (UDS). Gleichzeitig liefert ein derartiger Versuchdurch Auswertung der Cytoplasma-Markierung auch Hinweise auf das Ausmaßder mitochondrialen [mt] DNA-Syntheserate und damit über temporärveränderte metabolische Gegebenheiten in der Zelle (siehe Schmitz et al.: J.Alzhe<strong>im</strong>ers Dis. 1: 387, 1999).Die zweite von uns angewandte Methode war die so genannte ‘in situ nicktranslatio’ (ISNT; vgl. Korr et al.: Int. J. Radiat. Biol. 77: 567, 2001), mit dersich in Kombination mit der Autoradiographie der relative Gehalt an unrepariertenDNA-Einzelstrangbrüchen <strong>im</strong> fixierten Schnittpräparat messen lässt. DieseMethode kann auch an Nachbarschnitten einer UDS-Untersuchung zur Anwendungkommen, d.h. eine Vormarkierung mit 3 H-Thymidin stört nicht. Mit denbeiden angeführten Methoden, die voneinander unabhängig sind, wurden nichtnur verschiedene Zellarten <strong>im</strong> Gehirn, sondern auch in der Niere der Maus untersucht,um durch den Vergleich von Zellen mit unterschiedlicher metabolischerAktivität evtl. Rückschlüsse auf die Prinzipien zu erhalten, die zu DNA-Schädennach MF-Expositionen führen — falls es derartige Schäden überhaupt gibt.2.1.2 Material und MethodenZu den Details von Tierhaltung, Magnetfeld-Exposition und 3 H-Thymidin-Injektion siehe femu-Forschungsberichte 1999-2001. Ebenfalls wurde die Herstellungder Autoradiogramme zur Analyse von UDS und mtDNA-Syntheseratebereits <strong>im</strong> Detail beschrieben (femu-Forschungsbericht 2000, S. 16-18). DieISNT-Untersuchungen, die <strong>im</strong> Rahmen einer medizinischen Dissertation durchHerrn T. Freuding durchgeführt wurden, erfolgten an entparaffinierten Schnittennach spezifischer Inkubation mit DNA-Polymerase I unter Zusatz von 3 H-dTTP (Details siehe Korr et al., Int. J. Radiat. Biol. 77: 567, 2001). Die Belichtungszeitdieser Autoradiogramme betrug sechs Tage. Analog zu den Untersuchungenzu UDS und mtDNA-Synthese (Dissertation Frau E. Keller) wurdenpro Tier und Zellart jeweils 100 Zellen ausgewertet.
132.1.3 ErgebnisseDie mikroskopischen Auswertungen an Zellarten in Cortex (Pyramidenzellen derSchicht V; Gliazellen, Endothelzellen), Hippocampus (Granularzellen <strong>im</strong> Gyrusdentatus; Pyramidenzellen der Areale CA1-2 und CA3), Cerebellum (Purkinjezellen,Granularzellen), Plexus choroideus des IV. Ventrikels sowie Epithelzellender Niere (prox<strong>im</strong>aler gewundener Tubulus, distaler gewundener Tubulus,Sammelrohre) führten zusammengefasst zu folgenden Ergebnissen (Details sieheSchmitz et al.: Radiat. Res. submitted): Alleine für die Epithelzellen des Plexuschoroideus fand sich nach MF-Exposition eine signifikante (p < 0.05) Erhöhungsowohl der Werte für UDS als auch für ISNT. Diese Erhöhung gegenüber denKontrolltieren betrug ca. 25%, und zwar gleichartig für beide Untersuchungsverfahren.Eine signifikante Erhöhung der mtDNA-Syntheserate fand sich ausschließlichin Epithelzellen der Niere, und zwar in Zellen der distal gewundenenTubuli und der Sammelrohre. Über eine Analyse der Silberkornverteilung derZellkernmarkierungen bei den ISNT-Untersuchungen konnten artifizielle Ergebnisse(einschließlich einem Hypoxie-Ereignis unmittelbar vor dem Tode, das zueiner auffälligen Rechtsverschiebung der betroffenen Zellart geführt hätte) zuverlässigerkannt und von den weiteren Auswertungen ausgeschlossen werden(Abb. 2.1).2.1.4 DiskussionDie Ergebnisse der hier vorgestellten Untersuchungen bestätigen prinzipiellfrühere Studien, in denen DNA-Schäden in Zellen des Zentralnervensystemsals Konsequenz einer MF-Exposition gezeigt wurden. Völlig neu ist jedochder Nachweis, dass das Ausmaß dieser DNA-Schädigung zellartspezifisch unterschiedlichausfällt und nicht alle Zellen des Zentralnervensystems (bzw. desOrganismus) in gleichem Ausmaß betrifft. Darüber hinaus gelang erstmals derNachweis, dass nicht-neuronale Zellen (in diesem Fall Plexus-Epithelzellen)empfindlicher auf MF-Exposition reagieren als neuronale Zellen. Dass es sichdabei gerade um die Plexuszellen handelt, mag damit zusammenhängen, dassdiese Zellen essenziell in den Eisen-Transport vom Blut ins Gehirn eingebundensind. Bei diesem Prozess entstehen vorübergehend Fe 2+ -Ionen, die bekanntlichDNA-schädigende freie Radikale freisetzen. Eine MF-Exposition scheint dabeidie Freisetzung freier Radikale zu erhöhen. Die genauen zellulären und mole-
14kularen Mechanismen sind gegenwärtig jedoch unbekannt. Daher sind weitereStudien notwendig — initial vor allem zu Dosis-Wirkungs-Effekten —, bevorSchlussfolgerungen, insbesondere zu potenziellen Auswirkungen von MF-Expositionen be<strong>im</strong> Menschen, gezogen werden können.Abbildung 2.1: Kumulative relative Häufigkeitsverteilung (CRF) der Silberkornzahlenpro Zellkernprojektionsfläche verschiedener Zellarten in Gehirn (A-F)und Niere (G-M) adulter Mäuse <strong>im</strong> ISNT-Versuch mit (MF exposed an<strong>im</strong>als;rechte Spalte) und ohne (unexposed an<strong>im</strong>als; linke Spalte) Magnetfeldexposition(50 Hz, 1 mT) über acht Wochen. A, B: Gliazellen des Cortex; C, D:Purkinjezellen <strong>im</strong> Kleinhirn; E, F: Epithelzellen des Plexus choroideus; G, H:Epithelzellen des Tubulus contortus prox<strong>im</strong>alis; I, K: Epithelzellen des Tubuluscontortus distalis; L, M: Epithelzellen der Sammelrohre. Für die Nierenzellen einerMF-exponierten Maus (Pfeil) fand sich eine auffällige Linksverschiebung derHäufigkeitsverteilungen aller drei untersuchten Zellarten; das deutet auf ein Artefaktbei der ISNT-Inkubation hin und führte zum Ausschluss der Werte diesesTieres für die weiteren Berechnungen. Alleine <strong>im</strong> Fall der Plexus-Epithelzellen(E, F) ist eine deutliche Rechtsverschiebung der Häufigkeitsverteilungen allerMF-exponierten Tiere festzustellen.
2.2 Niederfrequente magnetische Wechselfelder:Auswirkungen auf Chondrozyten invitroB. Schmidt-Rohlfing 1 , F. U. Niethard 1 , J. Silny152.2.1 EinleitungNur in wenigen Studien wurde bislang die Wirkung von magnetischen Wechselfeldernauf den Metabolismus und die Zellproliferation von Knorpelzellenuntersucht. Hierzu wurden teils Gewebekulturen (z.B. ausgestanzte Knorpelzylinder),teils auch Zellkulturen sowohl in Form von Monolayer-Kulturen alsauch in Form von 3D-Kulturen verwendet. Einige dieser Studien konnten eineSteigerung des Zellmetabolismus von Chondrozyten nachweisen. Allerdingsist bislang ein eindeutiger Wirkmechanismus von magnetischen Wechselfeldern<strong>im</strong> niederfrequenten Bereich nicht belegt. Ziel der folgenden Studie war es, dieWirkungen von magnetischen Wechselfeldern auf den Zellmetabolismus und dieZellproliferation von humanen Chondrozyten in einer 3D-Matrix (Kollagen-IMatrix) zu untersuchen. Auf zellulärer Ebene sind mögliche Effekte durch magnetischeWechselfelder leichter nachzuweisen als etwa in klinischen Studien.Wir haben deshalb ein in vitro-Modell verwendet. Hierdurch konnte zumindestein Hinweis darauf erhalten werden, ob durch den Einsatz von Magnetfeldernprinzipiell ein therapeutischer Nutzen erwartet werden kann.2.2.2 Material und MethodeHumane Chondrozyten wurden aus Knorpelgewebe gewonnen, das bei Patientenanfiel, die sich einem totalendoprothetischen Oberflächenersatz des Kniegelenkesbei fortgeschrittener Gonarthrose unterzogen. In einem ersten Schritt wurdedas Gewebe unter sterilen Bedingungen mechanisch in etwa 1 mm 3 große Stückezerkleinert und anschließend dem enzymatischen Verdau mit Kollagenase unterworfen.Anschließend wurden die Zellen in Monolayer-Kulturen über einen Zeitraumvon einer Woche amplifiziert, bevor sie mittels Trypsin von dem Boden1 Orthopädische Klinik des Universitätsklinikum der RWTH Aachen
16der Petrischalen abgelöst wurden; die Zellzahl wurde best<strong>im</strong>mt und anschließendin einer definierten Konzentration (2 x 105 Zellen/ml) in das Kollagen-IGel eingebracht. Das Kollagen-I Gel wies den Vorteil auf, dass es zum Zeitpunktder Durchmischung mit den Zellen flüssig war, was eine gleichmäßigeVerteilung zwischen Zellen und Matrix ermöglichte. Erst nach Erwärmen derProben auf Raumtemperatur kam es zu einem Aushärten der Matrix. Zuvorwurde das Zell-Matrix-Gemisch in Petrischalen mit 3.5 cm Durchmesser in definierterMenge gegossen. Hierbei wurden konstante Volumina verwendet, so dassdie Probenhöhe stets 4 mm betrug.Die Magnetspulen waren mit einem Innendurchmesser von 3.7 cm konstruiertworden, so dass dementsprechend die Petrischalen (3.5 cm Durchmesser)konzentrisch in den Spulen positioniert werden konnten. Die Spulen (vgl. Abb.2.2) wurden von einem elektrischen Wechselstrom mit einer Frequenz von 50 Hzdurchflossen, so dass <strong>im</strong> Zentrum der Spulen eine magnetische Flussdichtevon 2 mT gemessen werden konnte. In Vorversuchen wurde eine Temperaturerhöhungdurch kontinuierliche Messung mit einer Thermo-Sonde ausgeschlossen.Die Kultivierung <strong>im</strong> magnetischen Wechselfeld erfolgte über definierteZeiträume bis max<strong>im</strong>al 6 Wochen. Sowohl die Proben für die Behandlungsgruppeals auch für die Kontrollgruppe wurden <strong>im</strong> Inkubator unter standardisiertenBedingungen (37 o C, 5% CO 2 ) kultiviert. Während der Kultivierungwurde alle 2-3 Tage ein Mediumwechsel (DMEM + 10% fötales Kälberserum)durchgeführt. Nach Beendigung der Exposition wurden die Proben zunächstbiomechanisch untersucht, bevor sie teils in Formalin, teils in flüssigem Stickstoffaufbewahrt wurden, bis die weitere Aufarbeitung (Histologie, Immunhistochemie,Molekularbiologie) erfolgte. Die molekularbiologischen Untersuchungen zurquantitativen Messung von Gen-Expressionen erfolgten mit dem Light-Cycler(Fa. Roche). Insgesamt 46 Präparate wurden den magnetischen Wechselfeldernunter identischen Bedingungen ausgesetzt. Eine gleiche Anzahl von 46 Probenwurde als Kontrollgruppe mitgeführt.2.2.3 ErgebnisseIm Rahmen von Vorversuchen erfolgte zunächst der Nachweis der Vitalität derZellen in der Kollagen Typ-I Matrix während der Kultivierungsdauer von 6
17Abbildung 2.2: Darstellung der Spulen mit den konzentrisch positionierten PetrischalenWochen mittels Trypan-Blau-Färbungen. Hierbei kam es weder in der Kontrollgruppenoch in der Behandlungsgruppe zu einer Anfärbung der Zellen, wodurchdie Vitalität der Zellen aufgezeigt werden konnte. Makroskopisch konnten wirnach einer Kultivierungs- und Expositionsdauer von bis zu 6 Wochen keineUnterschiede zwischen Behandlungs- und Kontrollgruppe finden. Sowohl diePräparate der Kontrollgruppe als auch die der Behandlungsgruppe zeigten inAbhängigkeit der Kultivierungsdauer eine Abnahme der Höhe von bis zu 20%.Mikroskopisch kam es nach einer Kultivierungsdauer von über zwei Wochenzu einer partiellen Dedifferenzierung der humanen Chondrozyten mit einer Entrundungder Zellen, die zumindest teilweise eine fibroblastäre Form annahmen.Diese zelluläre Dedifferenzierung war gleichermaßen sowohl in der Verum- alsauch in der Kontrollgruppe zu beobachten (vgl. Abb. 2.3). Umgekehrt kam esauch zu keiner Redifferenzierung der Zellen.Die Färbung mit dem Kollagen-II Antikörper ließ eine Zunahme von KollagenTyp-II nach 2 Wochen erkennen (vgl. Abb. 2.4). Aus den nachfolgen-
18Abbildung 2.3: HE-Färbungen, Kultivierungsdauer 2 Wochen; zu diesem Zeitpunktwies die Mehrzahl der Zellen eine entrundete Form auf (links: befeldeteProben; rechts: Kontrollgruppe)den Abbildungen wird ersichtlich, dass es zu einer vermehrten Anfärbung perizellulärkam. Wiederum konnte mikroskopisch kein Unterschied zwischen derBehandlungs- und der Kontrollgruppe festgestellt werden.Die TUNEL-Färbungen ließen sowohl in der Verum- als auch in der Kontrollgruppenur ganz vereinzelte Apoptosen erkennen. Die Zellproliferation — gemessenmit den Ki-67 Färbungen — zeigte gleichfalls keine wesentlichen Unterschiedezwischen Behandlungs- und Kontrollgruppe. Die Ergebnisse der quantitativenPCR für das Expressionsverhalten von Aggrecan und Kollagen Typ-IIzeigten gleichfalls keine signifikanten Unterschiede. Hinsichtlich der Aggrecan-Expression kam es nach dem siebten Tag zu einem deutlichen Abfallen derWerte, bei der Kolagen-II Expression wurde ein Abfallen der Werte nach dem14. Tag gefunden.
19Abbildung 2.4: Immunhistochemische Kollagen-II Färbungen nach einer Kultivierungsdauervon 4 Tagen (obere Reihe) und 2 Wochen (untere Reihe); es fandsich sowohl in der Behandlungs- (links) als auch in der Kontrollgruppe (rechts)eine Zunahme von Kollagen-II perizellulär2.2.4 DiskussionIn der 3D-Matrix wurden die Zellen magnetischen Wechselfeldern bis zu einemZeitraum von max<strong>im</strong>al 6 Wochen ausgesetzt. Eine zelluläre Dedifferenzierungder Chondrozyten wurde nach einer Kultivierungsdauer von 2 Wochen sowohlin der Behandlungsgruppe als auch in der Kontrollgruppe gleichermaßen beobachtet,indem die Zellen eine zunehmende fibroblastäre Form annahmen; eineRedifferenzierung konnte nicht festgestellt werden. Allerdings kam es keineswegszu einer völligen Dedifferenzierung; sowohl <strong>im</strong>munhistochemisch als auchmolekularbiologisch konnte Kollagen-II, das als kennzeichnendes Protein für Gelenkknorpelgilt, während des gesamten Kultivierungszeitraumes nachgewiesenwerden. Die histologische und <strong>im</strong>munhistochemische Auswertung, die quantitativnicht möglich war, erbrachte keine fassbaren Unterschiede zwischen den
20Proben der Behandlungs- und der Kontrollgruppe. Auch innerhalb der einzelnenGruppen fanden sich keine wesentlichen Schwankungen. Sowohl hinsichtlich derAggrecan- als auch der Kollagen-II-Expression zeigten die Proben der Behandlungsgruppedurchschnittlich etwas höhere Werte als die der Kontrollgruppe.Allerdings waren diese Unterschiede nicht statistisch signifikant.Unsere Ergebnisse stehen <strong>im</strong> Widerspruch zu einigen Arbeiten, in denen Effektedurch niederfrequente magnetische Wechselfelder auf Chondrozyten in vitrobeobachtet wurden. In diesen Studien konnte eine Änderung bzw. Steigerungdes Zellmetabolismus durch die Applikation von magnetischen Wechselfeldernaufgezeigt werden. Allerdings wurden diese Untersuchungen mit unterschiedlichenphysikalischen Parametern und unterschiedlichen Zellen durchgeführt. Inden meisten der bisherigen Studien wurden nicht-humane Chondrozyten verwendet.Zudem wurde in einer Reihe von Versuchen auf embryonale bzw. nichtadulteZellen zurückgegriffen, die eine andere Biologie aufweisen als Chondrozytenaus arthrotischen Gelenken. In keinem Fall wurden zur Überprüfung derWirksamkeit von Magnetfeldern bislang Zellen aus degenerativ geschädigtenGelenken (in vitro) untersucht. Für einen therapeutischen Effekt ist aber dieFrage wichtig, ob magnetische Wechselfelder auch einen Effekt auf arthrotischveränderte Zellen haben. Der mögliche klinische Anwendungsbereich betrifft insbesonderedegenerativ geschädigte Gelenke. Grundsätzlich konnten wir durchunsere Studie einen Effekt auf humane Chondrozyten (die aus arthrotischen Gelenkengewonnen wurden) durch magnetische Wechselfelder nicht nachweisen.Allerdings können wir einen sehr schwachen Effekt auch nicht sicher ausschließen,dazu müssten sehr viele Untersuchungen durchgeführt werden. Denkbarwäre es etwa, dass Wirkungen auf den Zellmetabolismus durch stärkere magnetischeFlussdichten zu erzielen wären. Der Vergleich mit anderen Studienspricht dafür, dass nicht-adulte Chondrozyten evtl. einen veränderten Metabolismusnach Exposition mit magnetischen Wechselfeldern aufweisen. Weiterhinist auch nicht bekannt, welchen Einfluss die zelluläre Dedifferenzierung (in derKollagen-I Matrix) auf die Effekte von Wechselfeldern hat.
2.3 Einfluss starker elektrischer Felder auf dieanti- und prothrombotische Aktivität vonhumanen Endothelzellen (HUVEC)D. Ulrich 1 , B. Hafemann 1 , N. Pallua 1 , J. Silny212.3.1 EinleitungPatienten, die eine schwere Stromverbrennung erlitten haben, zeigen häufig eineprogrediente Gewebeschädigung und Thrombose von Blutgefäßen auch fern derEin- und Austrittsstelle des Stromes. Es besteht die offene Frage, ob es hierbeizu einer Schädigung des Endothels mit veränderter anti- oder prothrombotischerAktivität kommt. Vorangegangene in vitro-Untersuchungen (femu-Forschungsbericht 2001) mit humanen Nabelschnur-Endothelzellen unter einerKurzeinwirkung elektrischer 50 Hz-Felder mit Feldstärken bis zu 60 V/cm haben24 Stunden nach der Exposition einen hoch signifikanten Anstieg des TissueType-Plasminogenaktivators (t-PA) ergeben. In Fortsetzung der Studie werdenweitergehende Untersuchungen zum hämostaseologischen Gleichgewicht und zurFreisetzung von Heat Shock-Proteinen (HSP) durchgeführt. HSP-Proteine sindubiquitäre Proteine, die in Zellen aller Organismen vorkommen. Sie sind wichtigfür die dreid<strong>im</strong>ensionale Faltung neu gebildeter Proteine in der Zelle, wirkenzudem bei der Reparation von denaturierten Proteinen mit und beschleunigenihren Abbau nach Stress oder Verletzung. Verschiedene Arten von Stress wiethermisches Trauma, Hypoxie, Ischämie oder virale Infektionen führen zu ihrerFreisetzung. Bislang ist die Freisetzung von HSPs zum Schutz von Endothelzellen<strong>im</strong> Rahmen von Stromverletzungen noch unklar.2.3.2 Methode und MaterialZur Untersuchung einer möglichen Veränderung des hämostaseologischenGleichgewichtes durch Stromschädigung von Endothelzellen werden Prostacyclin,Prostaglandin E2 und F2 und Tissue Factor in vitro <strong>im</strong> Zellkulturüberstandvon konfluierend wachsenden humanen Nabelschnur-Endothelzellen (HUVEC),1 Klinik für Plastische Chirurgie, Hand- und Verbrennungschirurgie, UniversitätsklinikumAachen
22die definiert und einheitlich hohen Feldstärken eines 50 Hz-Feldes mit unterschiedlicherDauer ausgesetzt waren, mittels ELISA-Technik best<strong>im</strong>mt. Zudemwurden die HUVEC <strong>im</strong>munhistochemisch auf Thrombomodulin untersucht. DieBest<strong>im</strong>mung der verschiedenen Eikosanoide <strong>im</strong> Zellkulturüberstand erfolgte mitenzym<strong>im</strong>munologischen Tests der Fa. R & D Systems, Wiesbaden, die des TissueFactors mit einem Test der Fa. American Diagnostika (Imubind ® TissueFactor). Thrombomodulin wurde nach der APAAP-Methode mit monoklonalenAntikörpern der Fa. American Diagnostica best<strong>im</strong>mt. Die HUVEC wurden beiinsgesamt fünf Versuchsreihen auf insgesamt fünf Kulturschalen pro Versuchsreiheausgesät. Eine Schale diente jeweils als Kontrolle und unterlag nicht einerStromzufuhr. In vier Schalen wurden Feldstärken bis zu 60 V/cm appliziert.Die Dauer der Strompakete betrug dabei 1, 2, 3 oder 4 Sekunden. Die ersteProbenentnahme erfolgte unmittelbar nach Stromapplikation, weitere nach 1,2, 4, 8 und 24 Stunden. Die statistische Auswertung erfolgte mittels Wilcoxon-Test für Paardifferenzen. Die Signifikanz wurde auf dem 5%-Niveau (p < 0.05)berechnet.Zur Untersuchung einer möglichen Freisetzung der Stressproteine HSP-60und -70 in vitro <strong>im</strong> Zellkulturüberstand von konfluierend wachsenden humanenNabelschnur-Endothelzellen (HUVEC) wird die ELISA-Technik eingesetzt.Zudem erfolgt eine <strong>im</strong>munhistochemische Untersuchung der HUVEC auf HSP-27, -60 und -70. Die Best<strong>im</strong>mung von HSP-60 und -70 <strong>im</strong> Zellkulturüberstanderfolgte mit enzym<strong>im</strong>munologischen Tests der Fa. Stressgen, die <strong>im</strong>munhistochemischenUntersuchungen wurden mit monoklonalen Antikörpern der Fa. Biomoldurchgeführt.2.3.3 Ergebnisse und DiskussionIn den Versuchsgruppen der Feldapplikation mit Feldstärke bis zu 60 V/cmzeigten sich bei der unterschiedlichen Anzahl von 50 Hz-Perioden keine signifikantenKonzentrationsunterschiede von Prostacyclin, Prostaglandin E2 und F2.Der Tissue Factor stieg <strong>im</strong> Medium der HUVEC, die mit 60 V/cm über einenZeitraum von 3 und 4 Sekunden behandelt wurden, nach 8 Stunden signifikantan und blieb bis zur 48. Stunde signifikant erhöht. Immunhistochemisch zeigtesich bei HUVEC, die für 2, 3, und 4 Sekunden einem Stromdurchfluss unterlagen,eine deutliche Abnahme der Farbreaktion. Die <strong>im</strong> Zellkulturüberstand
23Abbildung 2.5: links: HSP-27 Kontrollgruppe; rechts: HSP-27 nach 48 h (Stromeinwirkung4 s)von HUVEC, die einer Feldstärke von 60 V/cm bei einer Dauer von 3 und 4Sekunden ausgesetzt waren, zeigt sich ab der 8. Stunde erhöhte Tissue Factor-Konzentration. Sie führt bei gleichbleibender Konzentration von Prostacyclin,Prostaglandin E2 und F2 zu einer Störung des hämostaseologischen Gleichgewichtesund kann möglicherweise die klinische Beobachtung einer progressivenThrombosierung der Gefäße nach einem Elektrotrauma erklären. Die zu beobachtendeAbnahme des antithrombogen wirkenden Thrombomodulins nacheiner Durchströmung von 2, 3 und 4 Sekunden trägt ebenfalls zur vermehrtenProthrombogenität bei. In den vier Expositionsgruppen mit einer Feldstärkevon bis zu 60 V/cm zeigten sich bei der unterschiedlichen Dauer von 50 Hz-Feldern innerhalb der ersten 2 Stunden keine wesentlichen Unterschiede in derKonzentration von HSP-60. Nach 8 Stunden kam es jedoch zu einer signifikantenKonzentrationszunahme <strong>im</strong> Medium der HUVEC, die mit 60 V/cm über einenZeitraum von 3 und 4 Sekunden behandelt wurden. Nach 24 Stunden kam esgegenüber den anderen Gruppen zu einem weiteren signifikanten Anstieg.Die HSP-70-Konzentration stieg <strong>im</strong> Medium der HUVEC, die über einenZeitraum von 3 und 4 Sekunden dem elektrischen Feld ausgesetzt waren, bereitsunmittelbar nach Stromapplikation signifikant an und blieb bis zur 48. Stundesignifikant erhöht. Immunhistochemisch zeigte sich bei der Kontrollgruppe einegeringe Anfärbung von HSP-27. 4 Stunden nach Stromapplikation zeigten dieHUVEC, die für 1 Sekunde behandelt wurden, eine deutliche, die anderen einestarke <strong>im</strong>munhistochemische Reaktion, die noch nach 24 und 48 Stunden weiterzunahm (Abb. 2.5). HSP-60 und -70 ließen sich hingegen bei den Kontrollzellen
24Abbildung 2.6: links: HSP-60 Kontrollgruppe; rechts: HSP-60 nach 48 h (Stromeinwirkung4 s)Abbildung 2.7: links: HSP-70 Kontrollgruppe; rechts: HSP-70 nach 48 h (Stromeinwirkung4 s)nicht darstellen (Abb. 2.6 links und 2.7 links). Lediglich Zellen, die für 3 und 4Sekunden einem Stromdurchfluss unterlagen, zeigten eine deutliche Reaktion fürHSP-60 nach 24 und 48 Stunden (Abb. 2.6 rechts), für HSP-70 nach 4, 24 und48 Stunden (Abb. 2.7 rechts). Die Ergebnisse zeigen, dass eine strominduzierteFreisetzung von HSP-27, -60 und -70 aus HUVEC <strong>im</strong> elektrischen Feld auftritt.Während HSP-27 bereits in ungestressten Zellen gebildet wird, werden HSP-60und -70 nur <strong>im</strong> Verlauf einer länger andauernden Stromapplikation zum Schutzder Endothelzellen gebildet und freigesetzt.
2.4 Wahrnehmung elektrischer, sinusförmigerund nicht sinusförmiger Ströme durch dieSinnesrezeptoren der HautG. Lindenblatt, J. Silny252.4.1 MotivationElektrische Ströme können be<strong>im</strong> Menschen <strong>im</strong> Gebiet des Stromeintritts einenicht adäquate Reizung der Hautsinnesrezeptoren bewirken. Diese äußert sichals die Wahrnehmung eines Kribbelns oder Vibrierens, welches sich mit anwachsenderStromstärke über ein Brennen bis hin zum Schmerz steigert. Einwichtiges <strong>Arbeits</strong>organ des Menschen, das mit solchen Strömen in Kontakt kommenkann, ist die Hand. Die Fingerkuppe ist hoch innerviert, daher wurde dieFingerkuppe betrachtet.Unter Berücksichtigung dieser nicht adäquaten Erregbarkeit der Hautsinnesrezeptorenwurden die Grenzwerte unter anderem für max<strong>im</strong>al zulässigeGerätefehlströme und Berührungsspannungen festgelegt. Denn diese Stromwahrnehmungist nicht nur unangenehm, sie kann — vor allem bei plötzlichemAuftreten — zu Schreckreaktionen mit Unfallfolge führen.Die bisherigen, in der Literatur dargelegten Best<strong>im</strong>mungen zur Wahrnehmbarkeitvon elektrischen Strömen beziehen sich zumeist auf sinusförmige Ströme,da die Sinuswelle die <strong>im</strong> Alltagsleben am häufigsten vorkommende Wellenformist; fast alle Vorschriften zur Vermeidung elektrischer Unfälle basieren darauf.Für die <strong>im</strong>mer häufiger benutzten nicht sinusförmigen Wellenformen, die beispielsweiseaus den Phasenan- und Phasenabschnittsteuerungen resultieren, liegenkeine exper<strong>im</strong>entellen Daten vor. Darüber hinaus wurde bei bisherigen Untersuchungennur unzureichend berücksichtigt, dass die Wahrnehmbarkeit nebenden technischen Parametern Stromstärke, Wellenform und Frequenz von einerVielzahl weiterer Parameter abhängt.2.4.2 Methode und MaterialIn den präsentierten Untersuchungen mit Probanden wurden daher dieAbhängigkeiten von weiteren Variablen einbezogen, damit die Wahrnehmbar-
26keitsgrenze sinusförmiger Ströme und nicht sinusförmiger Verläufe verglichenwerden kann.ˆ Stromstärke, Wellenform und Frequenzˆ Einwirkdauerˆ Temperaturˆ Hautfeuchtigkeitˆ Elektrodenfläche und -lageˆ durchströmtes Hautarealˆ individuelle Bewertung durch den ProbandenDie Angabe einer Wahrnehmung durch den Probanden während einer Untersuchungerfolgt subjektiv, so dass die angegebenen Schwellen in einem starkenMaß von dem aktuellen Befinden des Probanden abhängen. Wie bereits <strong>im</strong> femu-Forschungsbericht2001 ausgeführt, wurde in der Signal Detection Theory(SDT) eine geeignete theoretische Beschreibung dieser Problematik gefunden.Aus dieser Theorie wurden Methoden entwickelt, welche es ermöglichen, diesubjektive Beurteilung der Versuchsperson zu ermitteln und so bei der Auswertungeine von individuellen Beurteilungen bereinigte Wahrnehmbarkeitsgrenzeder Ströme anzugeben.2.4.3 Wahrnehmbarkeit nicht sinusförmiger StrömeNeben den Sinusströmen finden aber nicht sinusförmige Wellenformen <strong>im</strong>merstärker Verwendung, insbesondere als sogenannte geschaltete Ströme zur Laststeuerungin Phasenabschnitt- und Phasenanschnitt-Steuerungen. Jedoch nurdie Rechteckströme wurden bisher gleichfalls in Hinblick auf ihre Wahrnehmbarkeituntersucht. Die Rechteckwelle wird vor allem bei physiologischen Untersuchungenverwendet. Rechteckströme werden zur St<strong>im</strong>ulation von Muskelngenutzt, zum Beispiel bei der physikalischen Therapie oder in der neurologischenDiagnostik. Die Irritation der Haut ist dabei ein eher unerwünschter Nebeneffekt.Es galt daher, die Untersuchungen auf nicht sinusförmige Ströme zu erweitern;als wichtigste Wellenformen wurden untersucht:
27Abbildung 2.8: Zur Positionierung der Elektroden <strong>im</strong> Probandenversuchˆ Rechteckwelleˆ Dreieckwelleˆ Sinuswelle mit Phasenanschnittˆ Sinuswelle mit PhasenabschnittUm wie bei den Sinusströmen wieder eine von der individuellen Probandenbeurteilungunabhängige Wahrnehmungsschwelle zu erhalten und eine absoluteGrenze der Wahrnehmbarkeit zu finden, hätte für jede Wellenform eine Untersuchungsreihegemäß Signal Detection Theory erfolgen müssen. Diese Artder Absolutbest<strong>im</strong>mung ist aber sehr aufwändig und Zeit intensiv, vgl. femu-Forschungsbericht 2001.Statt dessen wurde daher die relative Änderung der Schwelle der nicht sinusförmigenWelle <strong>im</strong> Vergleich zur sinusförmigen Welle mittels der forcedchoice-Methodeermittelt und, ausgehend von den bekannten Wahrnehmungsgrenzender Sinusströme, die absolute Wahrnehmbarkeit für alle anderen Wellenformenbest<strong>im</strong>mt.2.4.4 ErgebnisseAus den Untersuchungen zur Muskelerregung ist bekannt, dass bei den‘physiologischen’ Rechteckpulsen oder -wellen niedrigere Schwellen erreichtwerden als mit einer Sinuswelle. Dies ergibt sich bei den Hautrezeptorenüberraschenderweise nicht: die Schwelle für rechteckförmige Ströme liegt höher.
28Abbildung 2.9: Relative Schwellenänderung in Abhängigkeit von der Wellenformin Bezug zur Sinuswelle.Abbildung 2.9 zeigt die Übersicht für alle untersuchten Stromformen. Alle Untersuchungenerfolgten für die Anregungsfrequenz 50 Hz, die europäische Netzfrequenz.Es zeigt sich für die geschalteten Stromformen, Phasenanschnitt und Phasenabschnitt,eine höhere Empfindlichkeit, die zu einem Absinken der Schwelleum 20% führt. Zukünftige Sicherheitsbest<strong>im</strong>mungen müssen diese neuen technischenStröme daher gesondert berücksichtigen. Sie stellen sogar den ‘worstcase’ aller untersuchten Stromformen dar.Diese Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass die Hautrezeptoren weniger aufdie Änderung des Ladungsflusses reagieren, als vielmehr auf die Ladungsmenge.Auch in der theoretischen Betrachtung muss daher eine deutliche Unterscheidungzwischen den Reizschwellen der Nerven- und Muskelzellen einerseits undder Sinnesrezeptorzellen andererseits gemacht werden.
2.5 Wirkung niederfrequenter magnetischerFelder auf den visuellen Kanal: MagnetophospheneG. Lindenblatt, J. Silny292.5.1 MotivationDer Begriff ‘Phosphen’ bezeichnet die Wahrnehmung eines Lichtreizes aufgrundeiner nicht adäquaten Reizung des visuellen Kanals. Elektrische Ströme und magnetischeFelder <strong>im</strong> Niederfrequenzbereich können so genannte Elektro- und Magnetophospheneauslösen. Aufgrund grober Schätzungen ging man bisher davonaus, dass die körperinterne Stromdichteschwelle für diese Phosphene die niedrigste<strong>im</strong> gesamten menschlichen Körper sei, das Auge mithin das empfindlichsteOrgan in Bezug auf eine nicht adäquate Reizung durch äußere Felder sein müsse.Durch detailgetreue numerische Modellierung konnte gezeigt werden, dass dieErregungsschwelle für die Elektrophosphene deutlich höher liegt als bisher angenommen1 , was vor allem auf eine starke inhomogene Leitfähigkeitsverteilungzurückzuführen ist 2 . Es ist nahe liegend, ein solches Verhalten auch bei denMagnetophosphenen zu vermuten.Die in den bisherigen Publikationen genannten magnetischen Flussdichten,welche zur Auslösung von Magnetophosphenen benötigt werden, sind qualitativfür die Praxis nur eingeschränkt verwendbar. Silny 3 beschreibt den Aufbaumit einem Helmholtz-Spulen-Paar, das ein zur Körperachse parallel verlaufendesFeld erzeugt. Lövsund et al. 4 studierten auch die Frequenzabhängigkeit derMagnetophosphen-Schwelle. Es lässt sich zusammenfassen, dass ein Magnetophosphenbei der Netzfrequenz von 50 Hz von äußeren Feldern ab einer Stärkevon ca. 5 mT magnetischer Flussdichte ausgelöst werden kann.1 G. Lindenblatt, J. Silny: Electrical Phosphenes : On the Influence of Conductivity Inhomogeneitiesand Small-Scale Structures of the Orbita on the Current Density Threshold ofExcitation. Med Biol Eng Comp 40 (3), S. 354-359, Mai 2002.2 G. Lindenblatt, J. Silny: A model of the electrical volume conductor in the region of theeye in the ELF range. Phys Med Biol 46 (11) 3051-3059, November 2001.3 J. Silny: Changes in VEP caused by strong magnetic fields. In: Evoked Potentials II,Hrsg.: Richard H. Nodar, Colin Barber. Butterworth Publisher, Stoneham, 1982.4 P. Lövsund, P. A. Öberg, S. E. G. Nilsson: Magnetophosphenes : a quantitative analysisof thresholds. Med Biol Eng Comp (18), S. 326-334, Mai 1980
30Abbildung 2.10: Ansicht des Kopfmodells in der Helmholtz-Spulen-AnordnungEs existieren nach unserem Wissen bisher keine Arbeiten zur s<strong>im</strong>ulationstechnischenBest<strong>im</strong>mung der körperinternen Stromdichteschwelle von Magnetophosphenen.2.5.2 ModellierungZur Berechnung der körperinternen Stromdichteschwelle für Magnetophosphenereicht es nicht mehr, allein die Orbita zu modellieren, wie bei den Elektrophosphenengeschehen: die Einkopplung des äußeren Feldes wird <strong>im</strong> gesamten Kopferfolgen und hier Ströme induzieren, die eine komplexe Stromdichteverteilungzur Folge haben werden. Es musste daher ein Modell des gesamten Kopfes geschaffenwerden.
31Als Vorlage der computertechnischen Modellierung wurde der von Silny 5verwendete Aufbau gewählt, vgl. Abbildung 2.10. Ähnlich wie be<strong>im</strong> Orbita-Modell für die Elektrophosphene wurden be<strong>im</strong> Kopf-Modell alle physiologischrelevanten Gewebetypen berücksichtigt; insbesondere der Raum um die Orbitaherum mit seiner Vielzahl an Cavitates wurde sorgsam konstruiert.2.5.3 Numerische Berechnung und ErgebnisseParallel zum detailgetreuen Kopfmodell mit einer inhomogenenLeitfähigkeitsverteilung, die den physiologischen Gegebenheiten entspricht,wurde auch ein Modell mit einer homogenen Leitfähigkeit berechnet. Abbildung2.11 zeigt die Stromdichteverteilung auf der Oberfläche beider Modelle,wie sie für ein anregendes Feld einer magnetische Flussdichte von 1 T berechnetwurde. Im Bereich der Orbita erhöht sich die Stromdichte, was <strong>im</strong> wesentlichenauf die unteren Cavitates zurückzuführen ist. Aufgrund der Anatomie findetsich somit ein großräumiger Anstieg der Stromdichte.Entscheidend für die Phosphenauslösung ist aber die Stromdichte am Ortder Phosphenentstehung, also <strong>im</strong> Bereich der Retina. In den nächsten Schrittenwird daher die <strong>im</strong> Schädelmodell gefundene Stromdichteverteilung auf dashoch detaillierte Orbita-Modell übertragen werden, mit dem sich die Phosphenauslösende Stromdichte berechnen läßt.5 a. a. O.
32Abbildung 2.11: Stomdichteverteilung in den Kopfmodellen mit homogenerLeitfähigkeit und mit inhomogener Leitfähigkeitsverteilung. Im letzteren Modellbilden sich <strong>im</strong> Bereich der Orbita höhere Stromdichten aus.
2.6 Gleichrichtung der Felder des UMTS-Mobilfunks in Muskeln und NervenTh. Sinning, J. Silny332.6.1 Motivation und ZielsetzungMit dem Beginn der Einführung der Dritten Generation des Mobilfunks, demso genannten UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), das nebenTelefonaten auch große Datenmengen und bewegte Bilder übertragen kann,stellt sich die Frage nach eventuellen gesundheitsrelevanten Auswirkungen dieserneuartigen elektromagnetischen Felder <strong>im</strong> Organismus. Eine Überprüfungist auch deshalb erforderlich, weil die von UMTS emittierten Felder <strong>im</strong> Vergleichzu dem heutigen GSM-Mobilfunk (D- und E-Netze) stark abweichendeCharakteristika aufweisen. Im Zusammenhang mit der in allen Lebensbereichenvorhandenen Exposition der Bevölkerung durch GSM-Mobilfunkfelder wird hypothetisch<strong>im</strong>mer wieder auf die Möglichkeit einer besonderen Wirkung durchniederfrequente pulsmodulierte Felder hingewiesen. Die Wirkung solcher Anteilevon GSM-Signalen könnte nur durch das Vorhandensein von Gewebeeigenschaftenzustande kommen, die die Mikrowellen <strong>im</strong> Körper gleichrichten. Obwohlderartige Effekte bisher in GSM-Mobilfunkfeldern nicht belegt werden konnten,muss diese Überprüfung für die digital modulierten UMTS-Felder ebenfallsdurchgeführt werden.2.6.2 GSM- und UMTS-FelderBei dem GSM-Standard wird das Nutzsignal über einen logischen Kanal unteranderem <strong>im</strong> Zeitmultiplex-Verfahren (TDMA) gesendet. Der Funkkanal wirddazu in acht Zeitschlitze unterteilt, um acht logische Kanäle pro Funkkanalübertragen zu können. Ein Zeitschlitz, auch Burst genannt, hat eine Länge von0.577 ms. Acht Zeitschlitze werden zu einem Rahmen zusammengefasst (Abb.2.12). Die Rahmen werden zyklisch nacheinander auf einem Funkkanal ausgesendet,mit einer Periode von 8 · 0.577 ms = 4.616 ms entsprechend einer Wiederholratevon 1/4.616 = 217 Hz. Dieses Kanalbündel wird mit einer Frequenzvon 900 MHz (D-Netz) bzw. 1800 MHz (E-Netz) ausgesendet. Die Leistung der
34Burst-Ausstrahlung ist bei Mobiltelefonen auf 2 Watt, bei Basisstationen auf 8Watt begrenzt.1GSM Leistungsdichte vs. Zeit0.90.80.7normierte Leistungdichte0.60.50.40.30.20.100 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20Zeit in msAbbildung 2.12: Normierte Leistungsdichte eines Modell-GSM-Sendesignals mitZeitmultiplex bei einem Teilnehmer. Deutlich zu sehen sind die Sendezeitschlitze,die sich mit einer Periode von 4.615 ms wiederholen.Bei UMTS wird das Nutzsignal eines Teilnehmers ebenfalls auf einem logischenKanal übertragen. Im Gegensatz zum GSM wurde das Zeitmultiplex-Verfahren hier durch das Codemultiplex-Verfahren (CDMA) ersetzt. Die logischenKanäle werden anhand des Einsatzes von verschiedenen Codes und derAuswahl der Signalstreuung getrennt. Vorteilhaft ist, dass keine burstartigenSignalverläufe auftreten. UMTS verfügt über eine schnelle Leistungsregelung,die die Sendeleistung der Basisstation und des Mobilteils alle 0.67 ms verändernkann, mit einer Dynamik von bis zu 83 dB. Im Falle der vorliegenden Messreihenwurde von einer Leistungsregelung ausgegangen, die zyklisch die Sendeleistungdes CDMA-Signals mit 8 Hz bei einer Dynamik von 30 dB verändert. Die-
35se Werte sind als typisch für das so genannte Flatterfading bei einer mobilenNutzung eines UMTS-Endgeräts sowohl in städtischer Umgebung mit hohemReflektionsgrad, als auch bei Autobahnfahrten anzusehen. (Abb. 2.13)1UMTS Leistungsdichte vs. Zeit0.90.80.7normierte Leistungdichte0.60.50.40.30.20.100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000Zeit in msAbbildung 2.13: Normierte Leistungsdichte eines Modell-Sendesignals unterEinsatz des Codemultiplex-Verfahrens (CDMA)2.6.3 MethodenDer Versuchsaufbau dient zur Ermittlung der Erregungsschwelle und ihrerVeränderung durch die Applikation elektromagnetischer Felder in den Körpervon Probanden. Dabei wird getestet, inwieweit sich die von einem kathodischenelektrischen Puls in peripheren Nerven oder Skelettmuskeln erreichte supramin<strong>im</strong>alebis supramax<strong>im</strong>ale Schwelle einer überschwelligen Erregung durch seineKonditionierung mit dem UMTS-Signal verändert. Das hochfrequente elektromagnetischeFeld und ein kathodischer Reiz<strong>im</strong>puls werden gemeinsam über eine
36Abbildung 2.14: Blockschaltbild zur Applikation am M. bicepsKoaxialelektrode in das Gewebe eingespeist. Als elektrophysiologische Reaktiondes neuromuskulären Systems wurde das Elektromyogramm (EMG) aufgenommen.Im Fall der Reizung des M. biceps (Oberarmmuskel) wurde das EMGdifferenziell am unteren Ende des Muskels aufgenommen (Abb. 2.14). DieReizung erfolgte mit einem zusammengesetzten Signal (Abb. 2.15) aus einerTrägerfrequenz von 1900 MHz mit einer Amplitudenmodulation mit der Frequenz8 Hz bei einem Hub von 30 dB und einer digitalen Modulation mitCDMA gemäß dem UMTS-Standard bei Einwirkdauern in 5 Stufen von 1000,500, 100, 10 und 5 Millisekunden; synchron dazu wurde am Ende der UMTS-Konditionierung ein kathodischer Strom<strong>im</strong>puls von 1 ms Dauer mit einer eingestelltenReizstärke in das Gewebe injiziert. Jede Messung wurde zehnmal wiederholt,zehn EMG-Antworten bilden gemittelt eine repräsentative Antwort.Die Leistung des UMTS-Signals betrug 20 dBm, 30 dBm, 40 dBm und50 dBm, entsprechend 0.1, 1, 10 und 100 Watt. Die elektromagnetischen Felderwerden vom menschlichen Gewebe teilweise reflektiert oder absorbiert, teilweisedurchdringen diese Felder das Gewebe. Die Eindringtiefe der elektromagnetischenFelder ist von der Frequenz abhängig und liegt <strong>im</strong> betrachteten Frequenzbereichvon 1900 MHz bei etwa 28 mm. Die elektrophysiologischen Wechselwirkungenwurden in vitro bei Probanden gemessen. Am Anfang und am Ende
37UMTS−KonditionierungssignalEMG−Antwort0 2 4 6 8 10 12Zeit in msAbbildung 2.15: Zusammensetzung des Reizsignals und EMG-Antwortder Versuchsreihe wurden Kontrollmessungen ohne Einspeisung eines UMTS-Signals durchgeführt. Durch dieses Vorgehen können thermische Effekte oderdie Veränderung der Durchblutung <strong>im</strong> Gewebe, die die Erregungsschwelle beeinflussen,berücksichtigt werden.2.6.4 ErgebnisseDie Applikation eines UMTS-Konditionierungspaketes mit abschließendemStrom<strong>im</strong>puls über eine Koaxialelektrode in den M. biceps mit Ableitung amgleichen Muskel erbrachte individuell gut reproduzierbare Ergebnisse. Die intraindividuellenErgebnisse hängen stark von der Hautbeschaffenheit, dem Zustandder Muskulatur und dem Fettgehalt <strong>im</strong> Gewebe der Unterhaut ab. Durch
3844mV20mV20−20 5 10 15 20Referenz ohne UMTS−Feld vor Versuchsreihe, t in ms4−20 5 10 15 2010ms und 100W, t in ms422mV0mV0−20 5 10 15 2010ms und 10W, t in ms4−20 5 10 15 2010ms und 1W, t in ms4mV20mV20−20 5 10 15 2010ms und 100mW, t in ms−20 5 10 15 20Referenz ohne UMTS−Feld nach Messreihe, t in msAbbildung 2.16: Messreihe mit 10 ms UMTS-Konditionierungdauer und denSendeleistungen 100 mW, 1 W, 10 W, 100 W.das Abdecken der Haut mit einer Koaxialelektrode und durch das Eindringender elektromagnetischen Felder in das Gewebe ergeben sich thermische Effekte,die Bewegung des jeweiligen Muskels und die Reizung des Gewebes durchden kathodischen Gleichstrom<strong>im</strong>puls bewirken eine Erhöhung der Durchblutungund dadurch eine Veränderung der elektrischen Leitfähigkeit der Hautund des Gewebes. Der Hautwiderstand sinkt bei besserer Durchblutung, weilBlut eine hohe elektrische Leitfähigkeit besitzt. Die elektrischen Reize werdenhierdurch besser übertragen und der Muskel stärker gereizt. Dies bewirkt eineVeränderung des EMGs, die auch bei den Referenzmessungen ohne die Einwirkungeines elektromagnetischen Feldes zu beobachten ist. Die thermischeWirkung ist in den Messungen wegen der kurzen Einwirkdauer von wenigenMillisekunden bis zu einer Sekunde, der begrenzten Eindringtiefe und der gutenWärmeleitung des Gewebes gegenüber den Veränderungen durch die stärkere
3944mV20mV20−20 5 10 15 201W und 5ms, t in ms4−20 5 10 15 201W und 1s, t in ms4mV20mV20−20 5 10 15 201W und 500ms, t in ms4−20 5 10 15 201W und 100ms, t in ms4mV20mV20−20 5 10 15 201W und 10ms, t in ms−20 5 10 15 20Referenz ohne UMTS−Feld,t in msAbbildung 2.17: Messreihe mit 1 Watt Sendeleistung und der UMTS-Konditionierung mit Dauer von 5 ms, 10 ms, 100 ms, 1 s.Durchblutung <strong>im</strong> Ablauf der Messreihen zu vernachlässigen, wie man anhandder Messreihen der Referenzmessungen ohne Einwirkung von UMTS-Feldernbelegen kann. Abgesehen von den bekannten temperaturbedingten Änderungenkann keine Veränderung des EMG in den Zellen des Muskelgewebes festgestelltwerden. Es treten weder Effekte der Veränderung der Reizleitung des Gewebesnoch der Veränderung der Erregungsschwelle des Muskelgewebes auf, wie diesbei Auftreten eines Gleichrichteffektes zu beobachten wäre. Eine Veränderungder Erregungsschwelle konnte weder bei den Versuchsreihen in Zusammenhangmit der Variation der Konditionierungsdauer, noch mit der Variation der Leistungder Konditionierung belegt werden.Aufgrund der Ergebnisse dieser Messreihen (Abb. 2.16, 2.17) kann keineathermische Beeinflussung des Muskelzellgewebes durch UMTS-Felder festgestelltwerden. Dies deutet darauf hin, dass <strong>im</strong> Frequenzbereich um 1900 MHz
40keine relevanten Gleichrichtereffekte in den betrachteten Muskelzellen auftreten.Eine signifikante Wirkung auf die Erregungsschwelle und Erregungsgeschwindigkeitvon Muskelzellen, die ursächlich auf die Exposition mit elektromagnetischenFeldern des UMTS-Dienstes zurückzuführen wäre, kann durch die Ergebnissenicht nachgewiesen werden.
2.7 Herzschrittmacherpatienten in niederfrequentenelektromagnetischen Feldern unterHochspannungsfreileitungen41A. Scholten, J. Silny, C. Stellbrink 12.7.1 EinleitungElektronische Implantate, wie z.B. Herzschrittmacher (HSM), können durchtechnische elektrische, magnetische und kombinierte elektromagnetische Felder(EMF) <strong>im</strong> nieder- und hochfrequenten Bereich in ihrer Funktion beeinträchtigtwerden. Sowohl <strong>im</strong> Alltag als auch <strong>im</strong> Beruf kann ein Implantatpatient auf zahlreichetechnische niederfrequente Felder treffen. Beispiele für derartige Quellenmit stärkeren elektromagnetischen Feldern <strong>im</strong> Alltag sind Hochspannungsfreileitungen(HSFLen) oder Oberleitungen der Deutschen Bahn AG, für Quellenmagnetischer Felder sind es Diebstahlsicherungsanlagen (EAS-Systeme). DieFelder und teilweise auch ihre Quellen sind für den Patienten nicht sichtbar, sodass er sich der Feldexposition u.U. nicht bewusst ist. Die elektrischen und magnetischenFeldkomponenten, die von Quelle zu Quelle sehr unterschiedlich ausfallen,dringen unabhängig voneinander und in unterschiedlicher Weise in denmenschlichen Körper ein. Aus diesem Grunde werden bei unserer Betrachtungdie von beiden Feldkomponenten <strong>im</strong> menschlichen Körper erzeugten elektrischenFelder zunächst getrennt voneinander betrachtet, um in einem weiterenSchritt entsprechend der jeweiligen Feldzusammensetzung einer Quelle Rechnungzu tragen. Zur Abschätzung des Störpotenzials von niederfrequenten Feldernfür Herzschrittmacherpatienten wurden bereits <strong>im</strong> Forschungsbericht 2000die Ergebnisse bezüglich des elektrischen, <strong>im</strong> Forschungsbericht 2001 des magnetischenWechselfeldes präsentiert. Im vorliegenden Beitrag wird überprüft,inwieweit die spezifischen elektrischen und magnetischen Felder unter Hochspannungsfreileitungenfür die Herzschrittmacherträger eine Gefahr darstellenkönnen. Bislang ist zu dieser Problematik mit ihren mannigfaltigen Einflussgrößenund Teilaspekten keine allgemein akzeptierte Beurteilung erarbeitet. Die1 Medizinische Klinik I der RWTH Aachen
42folgende Abhandlung beschreibt die zu berücksichtigenden Faktoren und gibteine realistische Abschätzung der aktuellen Situation.2.7.2 Elektromagnetische Felder unter HSFLenDas elektromagnetische Feld unter einer Hochspannungsfreileitung setzt sichzusammen aus ihrem magnetischen und ihrem elektrischen Gesamtfeld. Daselektrische Gesamtfeld findet seine Ursprünge in den elektrischen Spannungen,das magnetische Gesamtfeld in den elektrischen Strömen der einzelnen Leiterseile.Drei Leiterseile stellen jeweils ein Dreiphasensystem dar (vgl. Abbildung2.18). Innerhalb eines Dreiphasensystems sind sowohl die Ströme als auch dieelektrischen Spannungen der Leiterseile auf der Zeitachase um 120 ◦ gegeneinanderphasenverschoben. Diese Phasenverschiebung bleibt in den elektrischen undmagnetischen Teilfeldern der einzelnen Leiterseile erhalten. Somit gehen sowohlelektrisches als auch magnetisches Gesamtfeld unter Hochspannungsfreileitungenaus der Superposition von sinusförmigen Teilfeldern mit gleicher Frequenz,aber unterschiedlicher Phasenlage hervor. Zudem verfügen, wie in Abbildung2.18 erkennbar, alle Teilfelder über eine räumliche Beschränkung, d.h., sie sindortsabhängig. Folglich sind auch das resultierende elektrische und magnetischeGesamtfeld ortsabhängig.In Abbildung 2.18 sind die Verhältnisse beispielhaft für die elektrischen Teilfelder(dünne, unterbrochene Linien) und das resultierende elektrische Gesamtfeld(fette, durchgezogene Linie) dargestellt. Auf eine separate Darstellung dermagnetischen Teilfelder und des resultierenden Gesamtfeldes wird hier verzichtet,da ihre Superposition der der elektrischen Felder sehr ähnlich ist.Es sind nicht nur die Amplituden der elektrischen und magnetischen Teilfelderortsabhängig, sondern auch ihr Einfluss auf die Phasenlage des resultierendenelektrischen bzw. magnetischen Gesamtfeldes. Abbildung 2.19 verdeutlichtdiese Tatsache. Es sind die Phasenlagen des elektrischen und des magnetischenGesamtfeldes (bzgl. der R-Phase) in Abhängigkeit von der Position unterhalbder Beispiel-HSFL aus Abbildung 2.18 quer zum Spannfeld zu erkennen. Zudemstellt die fette Linie in Abbildung 2.19 die Subtraktion der beiden Phasenlagen,also die Phasendifferenz, dar. Es wird deutlich, dass die ortsabhängigen Phasenlagendes elektrischen und des magnetischen Feldes zwar ähnlich, aber nichtidentisch sind.
43Abbildung 2.18: Die elektrischen Teilfelder der einzelnen Leiterseile und dasresultierende Gesamtfeld unter einer beispielhaften Hochspannungsfreileitung.Nur an den Positionen x = ± 11, 5 m sind das elektrische und das magnetischeGesamtfeld in Phase. An allen übrigen Positionen treten Phasendifferenzen≠ 0 ◦ auf. Wo jedoch <strong>im</strong> Realfall das elektrische und das magnetische Gesamtfeldin Phase sind, und damit die phasengleiche Überlagerung der influenziertenund der induzierten Spannung am HSM-Eingang auftritt, lässt sich aufgrundweiterer Einflussfaktoren nicht vorhersagen. Nicht berücksichtigt sind in Abbildung2.19 u.a. Phasenverschiebungen zwischen den Strömen und Spannungender Teilleiter, die sich beispielsweise durch nicht rein ohmsche Belastungen derFreileitung ergeben können. Außerdem möglich sind unterschiedliche Anordnungender drei Phasen innerhalb des Dreiphasensystems (vgl. Abbildung 2.18:RST-RTS), unterschiedliche Bauformen der Masten oder eine unterschiedlicheAnzahl von Stromkreisen, die die HSFL trägt.Als weiterer, die Phasenlage der beiden Spannungen am HSM-Eingang beeinflussenderFaktor müssen Unterschiede zwischen kapazitiver Einkopplung(elektrisches Feld; influenzierte Spannung) und induktiver Einkopplung (magnetischesFeld; induzierte Spannung) in die Überlegung einbezogen werden.
44Abbildung 2.19: Die ortsabhängigen Phasenlagen des elektrischen und des magnetischenGesamtfeldes sowie ihre Differenz.Während bei der kapazitiven Einkopplung die hervorgerufene Phasenverschiebungzwischen der influenzierten Spannung am HSM-Eingang und dem erzeugendenäußeren elektrischen Feld <strong>im</strong>mer konstant −90 ◦ ist, variiert sie bei derinduktiven Einkopplung zwischen ±90 ◦ . Das Vorzeichen der Phasenverschiebungist dabei abhängig von der Orientierung des HSM-Patienten relativ zummagnetischen Feld.2.7.3 Szenario auf Basis der ermittelten individuellenEinflussfaktorenZusätzlich zu den <strong>im</strong> vorangegangenen Abschnitt beschriebenen technischenEinflussgrößen seitens der Elektrizitätsübertragung müssen auch bei der Untersuchungder Störbeeinflussung von HSMn durch EMF die bei der kapazitivenund der induktiven Einkopplung in den menschlichen Körper auftretenden Variablenberücksichtigt werden. Hier haben sich die folgenden Variablen herausgestellt(vgl. Forschungsberichte 2000 und 2001). Der jeweilige ‘worst case’ ist
45fett gedruckt:ˆ Implantationslage (rechtspektoral, linkspektoral)ˆ Art der HSM-Elektrode (bipolar, unipolar)ˆ Erdungszustand (‘mit Schuhen’, perfekt geerdet)ˆ Ort der Wahrnehmung der Herzaktivitätˆ Programmierte Empfindlichkeit des HSMsˆ HSM-Modell und -Hersteller (z.B. breiter Inhibitionsbereich)ˆ Induktionsschleife unter HSM-Gehäuse (addierend gewickelt)ˆ Körpergeometrie und -haltung (groß, schmal, erhobener Arm)ˆ Atmungszustand der Lunge (eingeatmet, ausgeatmet)ˆ Anatomie (?)ˆ Orientierung/Bewegung <strong>im</strong> Feld (schnelle Bewegung=Modulation)Zur Abschätzung des Störpotenzials von EMF unter HSFLen für HSM-Patienten ist nun aus diesen verschiedenartigen Einflussfaktoren die Konstruktioneines sinnvollen Szenarios erforderlich. Es werden der ‘worst-case’- und der‘real-case’-Patient gewählt, die bereits <strong>im</strong> Forschungsbericht 2000 herangezogenwurden. Der ‘worst-case’-Patient ist 200 cm groß, perfekt geerdet und verfügtüber einen erhobenen linken Arm. Der ‘real-case’-Patient hat Schuhe an seinenFüßen, gesenkte Arme und eine Körpergröße von 180 cm. Beide Personenhaben ein linkspektoral <strong>im</strong>plantiertes, ventrikulär gesteuertes, unipolares HSM-System und eine eingeatmete Lunge. Die durch die HSM-Elektrode gebildetezusätzliche Induktionsschleife unterhalb des HSM-Gehäuses wird als ‘addierendgewickelt’ vereinbart. Es wird angenommen, dass sich beide Patienten nicht bewegen,sondern nur ihre Orientierung zum Magnetfeld variieren. Der gewählteHerzschrittmacher hat zwar eine vergleichsweise hohe Störschwelle (positiverAspekt), jedoch ein breites Inhibitionsband (negativer Aspekt). Seine Empfindlichkeitist auf einen Wert von 2 mV programmiert.
462.7.4 Abschätzung der Möglichkeit einer StörungZur Abschätzung des Störpotenzials von der von HSFLen ausgehenden EMFfür den HSM-Patienten müssen zunächst auch bzgl. der Freileitung Annahmengetroffen werden. Es fällt die Wahl auf einen sehr üblichen Donaumast, derzwei Stromkreise der Spannungsebene 380 kV trägt, wie es in Abbildung 2.18zu erkennen ist. Beide Stromkreise werden identisch und rein ohmsch belastetund führen einen Strom mit einer (hohen) Stromstärke von 2, 2 kA, der einemagnetische Flussdichte von ca. 50 µT in einer Höhe von ca. 170 cm hervorruft.Die Betrachtung findet in Spannfeldmitte bei einer (sehr niedrigen) Seilhöhevon 7, 8 m statt. Es wird ferner angenommen, dass das elektrische und das magnetischeFeld über den gesamten betrachteten Bereich in Phase sind. DieserFall ist der ‘worst case’, der <strong>im</strong> Realfall nicht an jeder Position unterhalb einerHSFL eintritt (vgl. Abbildung 2.19).Abbildung 2.20 zeigt das Ergebnis für das beschriebene Szenario. Es ist derVerlauf der superponierten Spannung u eb am HSM-Eingang, die sich aus derÜberlagerung der (elektrisch) influenzierten und der (magnetisch) induziertenSpannungen am Eingang des virtuellen HSMs ergibt, für fixe Positionen querzum Spannfeld unterhalb der HSFL zu erkennen. Der Verlauf der Summation istam Beipiel des ‘worst-case’-Patienten in Abbildung 2.20 als ‘max’, der Differenzals ‘min’ gekennzeichnet. Der Bereich zwischen ‘max’ und ‘min’ charakterisierteine veränderte Orientierung des ‘worst-case’- bzw. des ‘real-case’-Patienten relativzum Magnetfeld.Der durchgezogene Balken parallel zur Abszisse stellt den Inhibitionsbereichdes Herzschrittmachers dar, der sich bei den durchgeführten Benchmark-Testsdurch ein breites Inhibitionsband auszeichnete. Unterhalb des Inhibitionsbandesbefindet sich der HSM <strong>im</strong> ‘Normalbetrieb’, oberhalb des Inhibitionsbandes <strong>im</strong>(asynchronen) Störmodus. Nur dann, wenn sich die Amplitude der überlagerteninfluenzierten und induzierten Spannung am HSM-Eingang (u eb ) innerhalb desdurch den Balken begrenzten Bereiches bewegt, wird der lebensgefährlicheStörzustand ‘Inhibition durch ein elektromagnetisches Feld’ ausgelöst. Aus Abbildung2.20 ist zu erkennen, dass dieser gefährliche Zustand äußerst seltenerreicht wird. Be<strong>im</strong> ‘real-case’-Patienten bewegt sich die überlagerte Spannungam HSM-Eingang hauptsächlich unterhalb des Inhibitionsbereiches. Bei den als‘1’ und ‘2’ markierten Inhibitionsbereichen ist eine feste Orientierung des vir-
47Abbildung 2.20: Verlauf der Summe aus (elektrisch) influenzierter und (magnetisch)induzierter Störspannung am HSM-Eingang für den ‘worst-case’- und den‘real-case’-Patienten in Abhängigkeit von der Position unter der HSFL. Annahmen:I) Elektrisches und magnetisches Gesamtfeld über den gesamten Bereichin Phase II) Donaumast III) Spannungsebene 380 kV IV) Spannfeldmitte beiSeilhöhe 7, 8 m V) Stromstärke 2, 2 kAtuellen Patienten relativ zum Spannfeld vorausgesetzt, was be<strong>im</strong> Unterquereneiner Freileitung als realistischer Fall angesehen werden kann. Um in den als ‘3’markierten, breiten Inhibitionsbereich zu geraten, müsste der ‘real-case’-Patientkontinuierlich unterhalb der HSFL seine Orientierung ändern.Die überlagerte Spannung u eb befindet sich <strong>im</strong> Falle des ‘worst-case’-Patienten in dem in Abbildung 2.20 dargestellten Szenario fast ausschließlichoberhalb des Inhibitionsbereiches <strong>im</strong> asynchronen Störbetrieb. Lediglich innerhalbdes schmalen Bereiches ‘4’ ist eine Inhibition denkbar, wobei dieser einekontinuierlichen Bewegung des Oberkörpers (=Variation der Orientierung) voraussetzt.
48Somit gilt für Hochspannungsfreileitungen, dass durch die von ihnen emittiertenFelder die Störung von HSM-Implantaten nicht ausgeschlossen werdenkann, die Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer solchen Störung jedoch ausgesprochengering ist. Die endgültige Antwort, ob und wann das best<strong>im</strong>mte HSM-System eines best<strong>im</strong>mten Patienten durch das spezielle Feld einer best<strong>im</strong>mtenQuelle in seiner Funktion beeinträchtigt werden, können jedoch nur Provokationsstudienmit Herzschrittmacherträgern liefern. Diese müssen auf Grundlageder festgestellten variablen Einflussgrößen und des ‘worst case’ projektiert,durchgeführt und dokumentiert werden.Um die in Abbildung 2.20 für die Quelle ‘HSFL’ dargestellten Ergebnisse fürandere Quellen niederfrequenter elektrischer, magnetischer oder elektromagnetischerFelder zu erhalten, muss eine ähnliche Betrachtung ihrer speziellen Felder<strong>im</strong> Zusammenhang mit allen individuellen Einflussgrößen stattfinden. Beispielefür weitere zu untersuchende Quellen sind z.B. auch Diebstahlsicherungsanlagen(EAS-Systeme, Frequenz 218 Hz) oder Einrichtungen der Bahnversorgung(Frequenz 16, 66 Hz).
2.8 Ausbau und Pflege der WissensbasiertenLiteraturdatenbank (WBLDB)F. Klubertz, R. Wienert, M. Vassileva, H. Siegmar, A. Raza, Th. Marquardt,J. Silny sowie externe Experten492.8.1 EinführungMit dem laufenden Projekt ‘Wissensbasierte Literaturdatenbank über die Wechselwirkungenelektromagnetischer Felder mit dem Organismus’ (WBLDB) bautdas femu kontinuierlich die Wissensbasis auf seinem Forschungsgebiet mit derZielsetzung aus, die medizinischen und technischen Inhalte der relevanten wissenschaftlichenVeröffentlichungen auf dem interdisziplinären Themengebiet derbiologischen Wirkungen Elektro-Magnetischer Felder (EMF) detailliert zu erfassen,auszuwerten und die gewonnenen Informationen einem interessierten Nutzerkreisuneingeschränkt zugänglich zu machen. Diese mittels zugeschnittenerDatenbank- und Internet-Werkzeuge erhobenen Daten können als Grundlagefür die Beantwortung konkreter und dringlicher Fragestellungen, für eine fundierteEinschätzung des aktuellen Wissensstands sowie für die Formulierung desnoch bestehenden Forschungsbedarfs auf diesem Gebiet dienen. Überdies stellendie Datenbank-Inhalte der WBLDB die Basis für das Projekt ‘EMF-Portal’ dar(vgl. Kapitel 2.9).2.8.2 ZieleAuf dem interdisziplinären Wissensgebiet der Wirkungen hoch- und niederfrequenterelektromagnetischer Felder auf den Organismus sollen die bisherveröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten möglichst vollständig recherchiertund gesammelt werden. Die in den erfassten Publikationen enthaltenen wichtigstenexpositionstechnischen, physikalischen und medizinisch-biologischenDaten sollen nach standardisierten Kriterien durch Experten extrahiert unddie Qualität der einzelnen Veröffentlichungen durch entsprechende Fachleutebewertet werden. Die auf diese Weise gewonnenen Informationen sollenwiederum der wissenschaftlichen Gemeinschaft via Internet-Datenbankzugriffvollständig und unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Soweit qualita-
50tive Mindeststandards eingehalten werden, für die beispielsweise das ‘peerreview’-Verfahren seriöser wissenschaftlicher Zeitschriften bürgt, soll es bei derDatensammlung keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der behandelten Themenoder der berücksichtigten Quellen geben. Weitere Ziele sind umfassendeTransparenz und Nachvollziehbarkeit sowohl bei der Auswahl als auch bei derExtraktion der Daten und dem individuellen Rating der Veröffentlichungen.Da die zeitnahe Abbildung des jeweils aktuellen Wissenstands beabsichtigt ist,werden die Publikationen jüngeren Datums zuerst aufgenommen und die früherpublizierten Veröffentlichungen nach und nach in die WBLDB eingefügt.2.8.3 MethodenNachfolgend werden kurz die notwendigen Verfahrensschritte zusammengefasst,die zur Abbildung des aktuellen Wissenstandes auf dem Gebiet der EMF-Forschung laufend durchgeführt werden (vgl. Abb. 2.21).Abbildung 2.21: Ablaufdiagramm der Verfahrensschritte be<strong>im</strong> Ausbau derWBLDBAm Anfang steht die Recherche in Bibliotheken, <strong>Online</strong>-Katalogen, Datenbankensowie in den ‘reference lists’ des bereits vorhandenen Literaturbestands.Die erfassten Publikationen werden als Papierkopie oder digitales Dokumentbeschafft, nach inhaltlichen Kriterien in eine der drei Hauptkategorien‘medizinisch-biologische’, ‘technisch-dos<strong>im</strong>etrische’ oder ‘epidemiologische’Publikationen vorsortiert und in der femu-Bibliothek archiviert. Innerhalb der
51Hauptkategorie ‘medizinisch-biologisch’ findet eine weitere Unterteilung nachthematischen Gesichtspunkten statt, mit der inhaltlich eng verwandte Arbeitenin einem sogenannten ‘Profil’ zusammengefasst werden. Diese Einteilungerleichtert sowohl die Suche der Nutzer nach Arbeiten zu einem best<strong>im</strong>mtenThemenbereich als auch die späteren Verfahrensschritte bei der weiteren Verarbeitung.Anschließend werden die so behandelten Artikel mit ihren bibliographischenAngaben als Datensätze in die WBLDB <strong>im</strong>portiert, wo sie nunmehronline erscheinen und dem Nutzer zur Ansicht und für einfache Suchvorgängezur Verfügung stehen. Im nächsten <strong>Arbeits</strong>gang werden die Expositionscharakteristikader <strong>im</strong>portierten Artikel extrahiert und in eine eigens vom femuentwickelte Expositionsdatenbank eingetragen. Sobald die Expositionsangabenzu den Publikationen vorliegen, kann eine Anzahl von Artikeln aus demselbenThemenbereich zusammengefasst und als Datenpaket exportiert werden;dieses wird dann an den entsprechenden Experten für dieses Fachgebiet versandtund von ihm offline bearbeitet. Die Bearbeitung durch die Expertenumfasst die strukturierte Extraktion der medizinisch-biologischen Inhalte derArtikel sowie die Bewertung der Qualität der individuellen Artikel mittels einesRating-Formulars, das die ‘Benotung’ der einzelnen <strong>Arbeits</strong>schritte erlaubt.Hat der jeweilige Experte seine Bearbeitung abgeschlossen, wird das betreffendeDatenpaket wieder in die WBLDB zurück<strong>im</strong>portiert. Für den Nutzer stehendann vollständige ‘<strong>Online</strong>-Reports’ zur Verfügung, die ihm auf der Datenbank-Webseite <strong>im</strong> Internet zur Ansicht oder zum Ausdruck bereitgestellt werden.Dank der nunmehr vorliegenden ‘kritischen Besprechungen’ der Publikationenkann sich der Datenbankbenutzer ein Bild von ihren Inhalten und ihrer Qualitätmachen, ohne dass ihm der Originaltext zur Verfügung zu stehen braucht. Dabeiwerden Struktur und Methodik der Datenbank ständig an die sich <strong>im</strong> Laufeder Zeit und aufgrund der gemachten Erfahrungen wandelnden Bedürfnisse derNutzer angepasst.2.8.4 StatusLiteraturBis zum Redaktionsschluss des vorliegenden Beitrags (ca. drei Wochen vor Endedes Berichtszeitraums), waren in der WBLDB ca. 6.100 Publikationen datentechnischerfasst. Davon sind ca 5.900 bereits nach ihren inhaltlichen Schwer-
52punkten kategorisiert, in die thematisch zutreffenden ‘Profile’ verteilt und stehendem Nutzer somit online zur Verfügung. Die Anzahl der exper<strong>im</strong>entellen Arbeitenan diesem Literaturbestand beträgt z. Zt. rund 3.400 Stück. Im Laufe desJahres sind bisher ca. 770 Publikationen neu hinzugekommen, so dass der für dasJahr 2002 erwartete Zuwachs von 1.000 bisher noch nicht erreicht wurde; hier istanzumerken, dass die Beschaffung der Originaltexte zunehmend schwieriger undkostspieliger wird. Die allerorten seitens der öffentlichen Hand verhängten Sparmaßnahmenhaben u.a. zur Folge, dass die Ausführung von Fernleihbestellungen<strong>im</strong>mer länger dauert und dass auch große Universitätsbibliotheken und selbstdie Zentralbibliothek für Medizin zuvor <strong>im</strong> Bestand vorhandene, aber seltennachgefragte Zeitschriften aus Kostengründen nicht weiterführen. Überdies lässtsich be<strong>im</strong> wissenschaftlichen Publizieren zunehmend eine Tendenz zur <strong>Online</strong>-Veröffentlichung feststellen. Das bedeutet <strong>im</strong> Ergebnis, dass die entsprechendePublikation einerseits zwar nicht mehr den gesamten Herstellungs- und Distributionswegeines Druckerzeugnisses nehmen muss und in digitaler Form eventuellfrüher vorliegt, dass man andererseits aber in vielen Fällen Subskribent der entsprechendenZeitschrift sein muss, um Zugriff zum Volltext zu haben, was be<strong>im</strong>ehreren Hundert relevanten Zeitschriften unverhältnismäßig teuer ist. Auchdie Alternative, jeden Aufsatz einzeln per Internet be<strong>im</strong> Verlag zu bestellenund per Kreditkarte zu bezahlen, belastet die finanziellen und administrativenMöglichkeiten des Projekts stark.Von den in 2002 etwa 770 neu aufgenommenen Veröffentlichungen sind bisherca. 270 Arbeiten dem HF-Bereich (1 MHz - 300 GHz; gesamt: 1.850) und230 dem NF-Bereich (0 - 1 MHz; gesamt: 2.650) zugeordnet worden. Die restlichenbereits recherchierten Artikel befinden sich zur Zeit noch <strong>im</strong> Beschaffungsbzw.Kategorisierungsprozess. Unter ihnen sind noch mindestens weitere 70 HF-Arbeiten, so dass die gesetzte Zielmarke von 300 zusätzlichen HF-Arbeiten fürdas Jahr 2002 übertroffen werden wird.Die rund 5.900 zum jetzigen Zeitpunkt bereits verfügbaren Publikationensind innerhalb der drei Hauptkategorien ‘medizinisch-biologisch’, ‘technischdos<strong>im</strong>etrisch’und ‘epidemiologisch’ den vorhandenen inhaltlichen Profilen wieaus Abbildung 2.22 ersichtlich zugeordnet.Der derzeitige Literaturbestand nach Erscheinungsjahrgang geht aus Abbildung2.23 hervor. Hier ist anzumerken, dass von den Publikationen, die sichderzeit <strong>im</strong> Bearbeitungsprozess befinden, ca. 40 aus dem laufenden Jahr stam-
Abbildung 2.22: Erfasste Literatur nach inhaltlichen Profilen53
54men. Damit liegt das tatsächliche Aufkommen an neuen Publikationen aus demErscheinungsjahr 2002 bei etwa 280 Stück.Die Anzahl der Zeitschriften, die auf relevante Artikel zur Thematik hindurchsucht werden, hat sich <strong>im</strong> vergangenen Jahr auf jetzt 920 (Vorjahr 845)erhöht. ‘Bioelectromagnetics’, das Journal, in dem nach wie vor die meisten undwichtigsten themenspezifischen Beiträge veröffentlicht werden, ist mit einemBestand von mehr als 1.200 Publikationen praktisch komplett in der WBLDBabgebildet. Dementsprechend liegt ‘Bioelectromagnetics’ auch weiterhin an derSpitze der 20 wichtigsten Zeitschriften, die mit zusammen rund 2.800 Artikeln(Vorjahr 2.550) fast die Hälfte der bisher erfassten Publikationen enthalten.Die WBLDB verzeichnet inzwischen insgesamt etwa 12.000 Autoren (Vorjahr10.300), von denen 3.717 Erstautoren sind. Die ‘Top Ten’ dieser Erstautorenhaben zusammengenommen etwa 370 eigene Artikel verfasst und waren an544 weiteren Publikationen als Ko-Autoren beteiligt. Dies bedeutet, dass rund16 Prozent aller bisher gesammelten Studien von nur 10 Autoren verfasst bzw.mitverfasst wurden.Am Auswertungs- und Ratingprozess des Publikationsbestands haben sich<strong>im</strong> Jahr 2002 sechs Experten aktiv beteiligt. Sie haben bis zum Redaktionsschluss515 Publikationen fertig gestellt und zur Zeit weitere 61 in Bearbeitung:davon stammen 317 (+ 47 in Arbeit) aus dem Hochfrequenzbereich. Damitliegen zur Zeit insgesamt rund 1.210 Bewertungen mit ca. 1.800 Einzeluntersuchungenin der Datenbank vor und stehen dem Nutzer in der Form von<strong>Online</strong>-Reports zur Verfügung. Von mehr als 1.320 Publikationen sind bisher diedetaillierten Expositionsparameter erhoben und stehen auf der Webseite nachAnklicken des ‘Info’-Piktogramms zur Einsicht bereit. Diese Arbeiten sind esauch, die bei der neu <strong>im</strong>plementierten exakten Frequenz- bzw. Frequenzbereichs-Suche berücksichtigt werden.NutzungAuf Grund vielfacher Anfragen aus dem Nutzerkreis wurde die bislang erforderlicheRegistrierung als Nutzer abgeschafft, so dass die WBLDB nunmehrkomplett öffentlich zugänglich ist. Die zuvor notwendige Anmeldung stellte zwarkeine Nutzungseinschränkung dar, sondern diente ebenso wie zwei online durchgeführteUser-Umfragen allein der besseren Einschätzung der unterschiedlichen
Abbildung 2.23: Literaturbestand nach Erscheinungsjahrgang55
56Nutzerkreise und der laufenden Anpassung des Angebots an deren Bedürfnisse.Dennoch bestand allgemein der Wunsch nach völlig ‘ungehindertem’ Zugangzur WBLDB; die Zahl der Teilnehmer an der <strong>Online</strong>-Umfrage der WBLDB-Nutzer nach beruflicher Herkunft bzw. Selbsteinschätzung des Vorwissens istauf rund 2.700 Personen (Vorjahr: 1.850) angestiegen. Die Reihenfolge unter denhäufigsten Nutzern ist mit ‘Beruf <strong>im</strong> Umfeld der EMVU’, gefolgt von ‘Wissenschaftlerund Ärzte’ und schließlich ‘informierte Laien’ in etwa gleich gebliebenwie <strong>im</strong> vergangenen Jahr.Die Jahreszugriffsstatistik zeigt, dass das Angebot der WBLDB weiterhinzunehmend genutzt wird. Mit einem Spitzenwert von 47.000 (Vorjahr 38.000)und einem Durchschnitt von rund 29.000 (Vorjahr 26.000) ist die Zahl der summiertenZugriffe pro Woche <strong>im</strong> Vergleich mit dem Vorjahr noch einmal gestiegen(siehe Abb. 2.24).Dabei stammen rund zwei Drittel der Zugriffe aus Deutschland, das übrigeDrittel verteilt sich <strong>im</strong> wesentlichen auf Europa (Österreich, Schweiz, Belgien,Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Schweden), die USA und Australien(siehe Abb. 2.25).Das Volumen der <strong>im</strong> Berichtszeitraum über den Server übertragenen Datenbeträgt wie <strong>im</strong> Vorjahr rund 9 GigaByte, was ca. 1,5 Mio. A4-Seiten entspricht.Eine weitere Geschwindigkeitsverbesserung bei der Datenübertragung ist mitden vorhandenen Mitteln kaum noch möglich. Der Datenbank- und Webserverdes femu ist inzwischen fünf Jahre alt und war quasi ununterbrochen online;leider waren <strong>im</strong> Laufe des zweiten Halbjahres bereits gelegentlich Hardware-Ausfälle zu verzeichnen, so dass einige Server-Komponenten in absehbarer Zeitdringend ersetzt bzw. erneuert werden müssen. Eine Erweiterung der Datenkapazitätauf 240 GB Speicherplatz war <strong>im</strong> Berichtszeitraum noch möglich, eineweitere Auf- oder Nachrüstung wird jedoch nicht mehr möglich sein, da dieHardware und die Technologie von Anfang 1998 stammen und sich Prozessor-,RAM- und Bustaktgeschwindigkeit seither <strong>im</strong> Durchschnitt verfünffacht haben.AusblickUm den unmittelbaren praktischen Nutzen der WBLDB nicht nur für Fachleute,sondern auch für allgemeiner interessierte Nutzer schnell zu vergrößern,ist beabsichtigt, <strong>im</strong> kommenden Jahr zusätzlich die wichtigsten Daten jeder
57Hits18.11.20015000045000400003500030000250002000015000100005000002.12.200116.12.200130.12.200113.01.200227.01.200210.02.200224.02.200210.03.200224.03.200207.04.200221.04.200205.05.200219.05.200202.06.200216.06.2002Webserver Zugriffe 2002Datum30.06.200214.07.200228.07.200211.08.200225.08.200208.09.200222.09.200206.10.200220.10.200203.11.2002Abbildung 2.24: Zugriffstatistik <strong>im</strong> Jahresverlauf
58Abbildung 2.25: Verteilung der Zugriffe nach HerkunftsländernPublikation in einer neuen Tabelle zusammenzutragen und den Nutzern derWBLDB für eine schnelle Übersicht anzubieten. Dieses Informationsangebotder am häufigsten nachgefragten Deskriptoren kommt auch dem EMF-Portalzugute, das ebenfalls <strong>im</strong> kommenden Jahr online gehen wird. Was die weiterhinangebotenen kompletten Reports betrifft, so ist geplant, dem Nutzer beider vorgesehenen dynamischen Generierung eines Reports ‘auf Knopfdruck’ dieMöglichkeit anzubieten, selbst den Detailgrad zu best<strong>im</strong>men.
2.9 Internet Portal und Informationssystemüber biologische Wirkungen Elektro-Magnetischer Felder ‘EMF-Portal’R. Wienert, D. Dechent, F. Klubertz, C. Spreckelsen 1 , J. Silny592.9.1 ÜbersichtWie in allen Forschungsbereichen wachsen auch auf dem Themengebiet ‘biologischeWirkungen nicht-ionisierender Felder’ die nicht nur durch das Internetzur Verfügung gestellten Informationen rapide an; problematischerweise zeigtsich zudem, dass die Informationskluft zwischen Experten und Nichtexperten<strong>im</strong>mer stärker divergiert. Auf der einen Seite haben Experten die Möglichkeit,sich mit Hilfe von wissenschaftlichen Publikationen und der ‘WissensbasiertenLiteraturdatenbank über die Wirkungen Elektro-Magnetischer Felder auf denOrganismus’ (WBLDB) einen fundierten Überblick über den derzeitigen Wissensstandzu verschaffen; interessierte Bürger auf der anderen Seite haben jedochoft nur die Möglichkeit, sich mit Hilfe von Artikeln der Boulevardpresseund Übersichtsarbeiten zu informieren, die leider allzu oft nicht die objektivenInformationen wissenschaftlicher Meldungen vermitteln. Für den normalenInternet-Nutzer sind zudem wissenschaftliche Publikationen oft weder einsehbarnoch überhaupt verständlich — die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Untersuchungkönnen vom Laien in den seltensten Fällen ohne Hilfsmittel nachvollzogenwerden. Bis heute existieren keine universellen Hilfen, wissenschaftlicheForschung in eine allgemein verständliche Sprache zu übersetzen und so auchfür Nicht-Experten direkt erschließbar zu machen. Um sich ein klares und objektivesBild über den Stand der Forschung bezüglich potenzieller Wirkungenelektromagnetischer Felder zu machen, ist ein solches Hilfsangebot aber unerlässlich— nur so kann die bislang oft viel zu reißerisch geführte Diskussion inobjektivere Bahnen gelenkt werden. Hierzu soll das in Entwicklung befindlicheProjekt ‘EMF-Portal’ einen Ansatz liefern: nicht nur Hilfsangebote zum besserenVerständnis der Thematik werden zur Verfügung gestellt, sondern auchkonkrete wissenschaftliche Untersuchungen und Publikationen sollen (automa-1 <strong>Institut</strong> für Medizinische Informatik des Universitätsklinikum der RWTH Aachen
60tisch) so aufbereitet werden, dass sie auch für den Nicht-Experten verständlichund nachvollziehbar werden.2.9.2 AusgangsproblematikMit der WBLDB (Abschnitt 2.8) existiert bereits eine Datenbank, die die Informationswünscheder Fachleute weitgehend erfüllen kann, jedoch auf einer sehrhohen Abstraktionsebene und mit sehr hohem Detailgrad. Obwohl dieses Informationsangebotüber das Internet von jedermann kostenlos und frei zugänglichgenutzt werden darf, wird der durchschnittliche Benutzer mit den enthaltenenDaten ohne weitere Hilfestellung nur bedingt verständliche Antworten auf seineFragen erhalten — was u.U. zu Fehlinterpretationen führen kann. FolgendeProbleme treten bei der Nutzung der WBLDB durch Nicht-Fachleute generellauf:ˆ Beinahe alle relevanten wissenschaftlichen Arbeiten werden in englischerSprache publiziert; dies schließt von vornherein alle Nutzer aus, die derenglischen Sprache nicht mächtig sind.ˆ Das veröffentlichte Material ist interdisziplinär: es besteht meist aus einermedizinisch/biologischen Komponente (Wirkungen auf den Organismusetc.) und einer technischen Komponenten (Feld, Expositionsart etc.).ˆ Sogar Fachleute haben nicht selten Probleme durch die Interdisziplinarität,da die meisten Experten entweder aus dem Bereich der Medizin/Biologieoder dem Bereich der Technik kommen.ˆ Grundlegendes Verständnis über die Entstehung, Ausbreitung und Wirkungelektromagnetischer Felder und der Fachterminologie muss vorausgesetztwerden können, um eine wissenschaftliche Publikation — selbstdurch Hilfsangebote ergänzt — überhaupt erst nachvollziehbar aufbereitenzu können.ˆ Um gewünschte Informationen in den erfassten Daten der WBLDB findenzu können, muss derzeit die Datenbankabfrage durch eine genau spezifizierteFrage getriggert werden (Beispiel: Der Nutzer sucht alle Publikationenzum Thema ‘Krebs’ — die Datenbank würde ohne weitereErgänzungen/Erweiterungen nur die Publikationen liefern, in denen das
61Wort ‘Krebs’ explizit erwähnt ist; eine Arbeit über ‘Leukämie’ würde beispielsweisenicht gefunden — zudem trifft auch hier das grundsätzlicheProblem der Übersetzung auf: die Publikationsdaten sind englisch, derSuchende gibt hingegen einen deutschen Suchbegriff ein.Diese wesentlichen Probleme müssen zunächst gelöst werden, wenn eine Schnittstellefür verschiedene Nutzergruppen zur Verfügung gestellt und etabliert werdensoll.2.9.3 BedarfsabschätzungZunächst wurden die Wünsche und verschiedenen Kenntnisstände derzukünftigen Nutzer ermittelt; nur auf diese Weise konnte gewährleistet werden,dass sich die Projektierung und Entwicklung des EMF-Portals am tatsächlichenBedarf orientiert. Eine umfassende und detaillierte Umfrage auf der Website desfemu, die bereits von über 300 Interessenten ausgefüllt wurde, hat die Annahmegestützt, dass durch die Interdisziplinarität das Thema als sehr komplex undschwer zu verstehen gesehen wird. Die meisten Besucher der Website kommenzwar aus einem der verwandten Themengebiete, haben jedoch meist Problememit dem globalen Verständnis des gesamten Themenkomplexes. Oft sind wichtigeBegriffe, die zum Verständnis der Materie vorausgesetzt werden müssen,nicht bekannt oder werden nicht <strong>im</strong> richtigen Zusammenhang gesehen. Medizinierund Biologen beispielsweise haben zwar keinerlei Probleme, biologischeEffekte zu verstehen, aber schon bei der wichtigen Differenzierung von Emmissionenund Immissionen verschiedener Quellen in hoch- oder niederfrequentenBereichen treten deutliche Probleme zu Tage. Bei der Auswertung der Umfragewurden die bereits <strong>im</strong> Absatz ‘Ausgangsproblematik’ (2.9.2) geschildertenProbleme grundsätzlich verifiziert. Somit konnte nicht der ursprünglich angedachteAnsatz realisiert werden, nur die <strong>Ausgabe</strong>daten zu filtern, d.h. die für dasVerständnis einer Publikation weniger wichtigen Informationen für den unversiertenNutzer zu verstecken. Im Gegenteil, es werden zusätzliche Hilfsangebotebenötigt, welche die bereits vorhandenen Daten verständlich aufbereiten undzusammenfassen.
62Abbildung 2.26: Architektur und Nutzeranbindung des EMF-Portals2.9.4 ArchitekturDas EMF-Portal besteht aus mehreren verschiedenen Modulen, die jeweils separatgenutzt werden können. Durch eine intelligente Vernetzung untereinanderund zur WBLDB können diese Module nicht nur einfache Abfragen wahrnehmen,sondern auch eine konkrete Hilfestellung bei frei definierbaren Fragestellungen(Übersetzung einer allgemeinen Frage in eine spezifische Datenbankabfrage)geben und zum Verständnis der von der WBLDB gegebenen Antworten(Aufbereitung der Datenbankergebnisses in eine verständliche, auch für den unversiertenNutzer nachvollziehbare Antwort) beitragen. Abbildung 2.26 zeigtdie interne Struktur und Nutzungsmöglichkeiten des EMF-Portals. Der Nutzerkann die Module direkt über das Internet ansprechen (das ‘Glossar’ und die‘Datenbank der <strong>im</strong> Alltag auftretenen Felder’), kann aber auch zusätzlich komplexeFragen stellen, die von der ‘Inferenzmaschine’ mit Hilfe des Glossars, derzusätzlichen Felder-Datenbank und der WBLDB beantwortet werden können.Zur Erklärung der <strong>Arbeits</strong>weise des EMF-Portals werden zunächst die einzelnenHilfsmodule und deren Strukturen erläutert.
63GrundlagenAuf Basis der vom femu erarbeiteten Broschüre ‘Elektromagnetische Felder<strong>im</strong> Alltag’ (Herausgeber: ‘Landesanstalt für Umweltschutz des Landes Baden-Württemberg’) wurde eine Einführung in die verschiedenen Aspekte der Thematikerstellt und auf das Medium Internet angepasst (vgl. Abbildung 2.27).Diese grundsätzliche Einführung ist notwendig, um die entscheidenden Informationender wissenschaftlichen Literatur, die das Portal vermitteln soll, auch fürvöllige Laien verständlich zu machen. Es werden folgende Themen behandelt:ˆ Physikalische Grundlagenˆ Elektromagnetische Felder in der Umwelt des Menschenˆ Biologische Wirkungen hoch- und niederfrequenter Felderˆ GrenzwerteUm das Angebot tagesaktuell zu machen und die Nutzer zu einem regelmäßigenBesuch des Portals zu an<strong>im</strong>ieren, trägt ein sog. ‘News-Robot’ zusätzlich dieMeldungen der wichtigsten deutsch- und englischsprachigen Nachrichtendiensteüber elektromagnetische Umweltverträglichkeit zusammen und stellt dieÜberschriften und Adressen der Originalnachricht zusammen.GlossarDas interdisziplinäre Glossar wird als Lexikon für Fachbegriffe aus dem Gebietder elektromagnetischen Umweltverträglichkeit aufgebaut und ist wichtigsterBestandteil des EMF-Portals. Da die Forschung über elektromagnetischeUmweltverträglichkeit ein mannigfaltiges Spektrum von Fachgebieten wie z.B.Neurophysiologie, Molekularbiologie, Genetik, Epidemiologie, Onkologie, Medizintechnikund Kommunikationstechnologie umfasst, wird mit dem Glossar eineMöglichkeit angeboten, rasch einen nicht geläufigen Begriff nachzuschlagen. Umden Zugang zu der fast nur englischsprachigen Fachliteratur zu erleichtern, existierenzu jedem Terminus und seiner Beschreibung Einträge in Deutsch undEnglisch. Darüber hinaus werden zu jedem Begriff die jeweiligen Synonyme,Abkürzungen und Akronyme aufgenommen. Die Begriffserläuterungen werden
64Abbildung 2.27: Screenshot eines Eintrags des Hilfsangebots ‘ElektromagnetischeFelder <strong>im</strong> Alltag’in Fachlexika, Standardwerken der Teildisziplinen sowie <strong>im</strong> Internet recherchiert.Die Termini werden aus Artikeln in der Wissensbasierten Literaturdatenbanksowie Übersichtsarbeiten gesammelt. Um die Orientierung in dem komplexenGlossar zu erleichtern und die Funktionalität der Inferenzmaschine (s. u.)überhaupt zu ermöglichen, kann jeder Eintrag eine Gruppenzugehörigkeit aufweisen;<strong>im</strong> Endzustand entspricht die Hierarchie einer so genannten Baumstruktur.Dies wird mit folgendem Beispiel veranschaulicht: ‘CLL’ weist als Akronymauf ‘Chronische lymphatische Leukämie’ (Englisch ‘chronic lymphatic leukaemia’),dies gehört zur Gruppe ‘Leukämie’ (das Synonym ‘Blutkrebs’, Englisch‘leukaemia’), dies ist wiederum enthalten in der Gruppe ‘Krebs’ (Englisch ‘cancer’)und dies wiederum gehört zur Gruppe ‘Krankheit’.Diese Datensammlung wird sowohl ‘stand-alone’ als Lexikon zur Verfügungstehen, als auch die Bewertungen und Extraktionen (Reports) der Publikationen
65Abbildung 2.28: Glossareintrag für den Begriff ‘Leukämie’aus der WBLDB erläutern und erklären; zudem werden alle Fachbegriffe inden Reports mit den Begriffen <strong>im</strong> Glossar per Hyperlink verknüpft, d.h. esöffnet sich bei Bedarf ein zusätzliches Fenster mit den Einträgen zum jeweiligenGlossarterminus.Durch die modulare Bauweise kann das Glossar, das derzeit in Deutsch undEnglisch <strong>im</strong>plementiert ist, ohne weitere Anpassungen um weitere Sprachenergänzt werden.2.9.5 Datenbank der <strong>im</strong> Alltag auftretenden FelderIn dieser Datenbank werden alle wichtigen Parameter der Expositionsquellenerfasst, die <strong>im</strong> Alltag auftreten können. Durch den Vergleich der einzelnen Charakteristikaergibt sich die Möglichkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede deraufgeführten Expositionsquellen automatisch darzustellen, sie zudem mit internationalenGrenzwerten zu vergleichen, und eine Gegenüberstellung mit den inverschiedenen Exper<strong>im</strong>enten beschriebenen Feldern vorzunehmen. Abbildung2.29 zeigt <strong>im</strong> Eintrag ‘E-Netz Sendemast’ beispielsweise grafisch die Frequenzeingetragen über das gesamte Frequenzspektrum.
66Abbildung 2.29: <strong>Ausgabe</strong> der Feldparameter eines E-Netz Sendemastes2.9.6 InferenzmaschineDie Inferenzmaschine kombiniert alle Module und versucht auf eine normalerweisesehr ungenau gestellte Frage des Nutzers eine verständliche und korrekteAntwort zu geben. Um die vielschichtige <strong>Arbeits</strong>weise der Inferenzmaschineverständlich darzustellen, soll <strong>im</strong> folgenden der Weg von der Frage zurAntwort anhand eines Beispiels detailliert erläutert werden. Frage: ‘Kann eineHochspannungsfreileitung Blutkrebs hervorrufen’ (Abbildung 2.30). Der Nutzerstellt seine Frage über das Internet direkt an die Inferenzmaschine, die das Problemzunächst in eine medizinisch/biologische Fragestellung (Blutkrebs) undeine technische Fragestellung (Hochspannungsfreileitung) aufteilt. Ziel dieserAufteilung ist eine möglichst umfassende Datenbankabfrage, die alle Publikationender WBLDB zurückliefert, die sich mit der Fragestellung befasst haben.In Abbildung 2.31 ist zu erkennen, wie die medizinisch/biologische Komponenteder Abfrage erzeugt wird. Mit Hilfe des Glossars wird der Begriff ‘Blutkrebs’in die englische Sprache übersetzt (‘blood cancer’). Zudem werden alle Synonymeund Acronyme in die Abfrage eingebunden (hier: ‘leukaemia’) und alleuntergeordneten Begriffe, Synonyme und Acronyme, die ihrerseits auf den Begriff‘blood cancer’ verweisen (hier: ‘ALL’, ‘acute lymphatic leukaemia’, ‘AML’,
67Abbildung 2.30: Analyse einer beispielhaften Fragestellung durch die Inferenzmaschine‘acute myeloid leukaemia’, und schließlich ‘CLL’ ‘chronic lymphatic leukaemia’).In der ‘Datenbank der <strong>im</strong> Alltag auftretenden Felder’ werden die wichtigstenFeldcharakteristika der Hochspannungsfreileitung (f = 50 Hz, B max = 60 µT,E max = 10 kV ) zusammengetragen und für die weitere Bearbeitung aufbereitet.mMit dem Ergebnis der beiden o. g. Datenbanken wird nun schließlich eine Abfragean die WBLDB generiert und geschickt, die aus allen in der Datenbankvorhandenen Publikationen diejenigen ermittelt, die auf die ursprüngliche Fragestellungzutreffen, d.h. in denen einer der Begriffe ‘blood cancer’, ‘ALL’, ‘acuteAbbildung 2.31: Suchstrategie für den Begriff ‘Blutkrebs’
68Abbildung 2.32: Aufbereitung des Ergebnisseslymphatic leukaemia’, ‘AML’, ‘acute myeloid leukaemia’, ‘CLL’ oder ‘chroniclymphatic leukaemia’ als geschriebener Ausdruck existiert. Aus den gefundenenPublikationen werden zusätzlich noch diejenigen herausgefiltert, deren Expositionsangabenmit den wichtigsten Charakteristika (f = 50 Hz, B max = 60 µT,E max = 10 kV ) der Hochspannungsfreileitung übereinst<strong>im</strong>men. Das Ergebnismder WBLDB ist zunächst nur eine Liste aller Publikationen, auf welche die o. g.Parameter zutreffen. Diese Aufstellung wird nun (Abbildung 2.32) wiederumvon der Inferenzmaschine in eine übersichtliche und für den Laien verständlicheForm gebracht. Der Nutzer erhält eine Statistik und einen Querschnitt überalle gefundenen wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit seiner Fragestellungauseinander gesetzt haben:ˆ Die Anzahl (wenn gewünscht, auch Auflistung) der Publikationen, die sichmit dem Thema beschäftigt haben,ˆ die Anzahl und (wenn gewünscht, auch Auflistung) der Publikationen, dieeine Wirkung nachgewiesen haben und schließlichˆ die Anzahl und (wenn gewünscht, auch Auflistung) der Publikationen mitnachgewiesenem Effekt, die zudem übertragbar auf den Menschen sind.
69Hierbei wird es auch möglich sein, jede in der Ergebnismenge enthaltene Publikationmit allen ihren in die Statistik einfließenden Daten als einzelnen Report(falls vorhanden) einzusehen — auf diese Weise ist die bestmögliche Transparenzgewährleistet und kann dem Nutzer zeigen, dass das Ergebnis objektiv aufGrundlage der wissenschaftlichen Publikationen basiert und keine zusätzlichesubjektive Interpretation in das Resultat einfließt.2.9.7 AusblickDie zugrundeliegende Struktur, das Glossar und die Datenbank der Expositionsquellensind bereits <strong>im</strong>plementiert und werden <strong>im</strong> Frühjahr 2003 nach einerausführlichen Testphase öffentlich zugänglich gemacht werden. Sowohl das Glossar,der News-Robot als auch die Felder-Datenbank bedürfen ständiger redaktionellerBetreuung, so dass das Projekt ständig weiter entwickelt werden muss.Bei Bedarf ist es zudem jederzeit möglich, das Projekt um weitere Sprachen zuergänzen — bei der Entwicklung der Struktur wurde dies bereits berücksichtigt.
702.10 Elektrische Messung gastrointestinalerMotilität2.10.1 Problematik und MotivationDie Diagnostik der funktionellen Störungen der Motilität <strong>im</strong> Gastrointestinaltrakt(GIT) steckt noch in den Kinderschuhen, da weder die physiologischenAbläufe noch die Ursachen und Formen unterschiedlicher Erkrankungen bisherausreichend verstanden werden. Ein wesentlicher Grund für diesen unbefriedigendenWissensstand sind die vorhandenen unzureichenden Untersuchungstechniken.Als allgemein akzeptierter Standard für die Aufnahme der GIT-Motilitätstehen nur die beiden katheterbezogenen Verfahren der Manometrie und derpH-Metrie zur Verfügung. Diese Verfahren können aber nur wenige der Charakteristikader Motilität beschreiben (siehe femu-Forschungsbericht 2001). Dasvon uns eingeführte Impedanzverfahren liefert eine Reihe von weiteren Kennwertender GIT-Motilität. Ihre Bedeutung für die Diagnostik verschiedener Erkrankungenmuss in klinischen Studien mit gastroenterologischen Kliniken verifiziertwerden. Dabei werden häufig Standardverfahren als Referenz, zumindestfür einige Charakteristika der Motilität, herangezogen. Je nach Fragestellungund Zielorgan werden <strong>im</strong> femu zugeschnittene Messsysteme und Katheter entwickeltund der Partnerklinik unter direkter Betreuung zur Verfügung gestellt.Einige der verfolgten Fragestellungen sind <strong>im</strong> folgenden Abschnitt beispielhaftskizziert.2.10.2 Gastroösophagealer Reflux bei SäuglingenT. Wenzl 1 , G. He<strong>im</strong>ann 1 , Ch. Peter 2 , Ch. Poets 2 , J. SilnyGastroösophagealer Reflux gehört zu den verbreiteten Erkrankungen mit unterschiedlichenUrsachen und Konsequenzen bei Frühgeborenen und Säuglingen.Deshalb wird in klinischen Studien versucht, möglichst umfassend die Peristaltiksowie das Refluxgeschehen über mehrere Fütterungsphasen aufzunehmen.Neben der Häufigkeit von Refluxen sind auch die Azidität des Refluxes so-1 Kinderklinik des Universitätsklinikums der RWTH Aachen2 Klinik für Kinderheilkunde-Neonatologie und pädiatrische Pulmonologie der UniversitätHannover
71wie die Volumen- und chemische Clearance Gegenstand der Untersuchungen.Das herkömmliche Verfahren der pH-Metrie reagiert nicht auf nichtsaure Refluxeund lässt nur den Zeitpunkt der chemischen Clearance erkennen. DasImpedanz-Verfahren misst u. a. auch diese Kennwerte und stellt damit einewichtige Ergänzung zur pH-Metrie dar. Darüber hinaus erlauben die Impedanz-Katheter mit sechs bis acht Messsegmenten die Erkennung der Reflux-Höhe <strong>im</strong>Ösophagus.Die bisher durchgeführten Studien zeigen, dass bei Säuglingen mit durchschnittlich72 Refluxen innerhalb von 24 Stunden gerechnet werden muss, wobeidie Mehrheit (> 75%) nichtsaure Refluxe (pH > 4) sind. Der direkte Zusammenhangzwischen Refluxen und Apnoen bleibt nach wie vor ungeklärt. Die klinischeBedeutung der beobachteten Variationen der Refluxcharakteristika wiez.B. der Häufigkeit und Höhe der Refluxe und Volumen- und chemischer Clearancekann erst anhand größerer Untersuchungskollektive, die durch laufendeStudien angestrebt sind, beurteilt werden.2.10.3 Duodeno-gastroösophageale Refluxe bei ErwachsenenD. Sifr<strong>im</strong> 3 , K. Jannssens 3 , R. Winograd 4 , S. Matern 4 , B. Dreuw 5 , N. Ponschek 5 ,V. Schumpelick 5 , B. Weusten 6 , L. Akkermanns 6Es ist allgemein anerkannt, dass Säure eine entscheidende Rolle bei derEntwicklung der duodeno-gastroösophagealen Reflux-Erkrankungen (DGÖR)spielt. Trotzdem fehlt eine eindeutige Bestätigung der Korrelation zwischen denSymptomen, dem Schweregrad des Schadens der Schle<strong>im</strong>haut und der Expositiondurch die Säure. Weiterhin zeigt sich, dass bei einigen DGÖR-Patientendie heute angewandte säuresuppresive Therapie versagt. Dies bedeutet, dassandere Faktoren wie z.B. der Gas-Reflux während des Schluckaufs nichtsaurengastrischen Inhalts oder Pepsine einer neutralen Nahrung für die Schäden undSymptome mit verantwortlich sein müssen. Zur Klärung dieser Zusammenhängewerden klinische Langzeitstudien z. T. ambulant unter Verwendung von Stan-3 Department of Gastroenterology / Faculty of Medicine, University of Leuven, Belgien4 Medizinische Klinik III des Universitätsklinikums Aachen5 Chirurgische Klinik des Universitätsklinikums Aachen6 Gastrointestinal Research Unit, University Medical Center Utrecht, Niederlande
72dardmethoden und des Impedanzverfahrens durchgeführt. Das Impedanzverfahrenliefert dabei eine Reihe von zusätzlichen Kennwerten über die Beschaffenheitund den Ablauf des Reflux-Geschehens. In klinischen Studien bei Patientenmit Erkrankungen unbekannter Ätiologie wie z.B. milder Ösophagitis undRefluxösophagitis werden Impedanz- und Manometrieverfahren s<strong>im</strong>ultan eingesetzt,wobei bei der Manometrie die Drücke des unteren Ösophagussphinkters<strong>im</strong> Vordergrund stehen. Untersuchungen mit Probanden zeigen, dass beide, saureRefluxe wie auch Gas-Refluxe, die Relaxation des unteren Sphinkters ähnlichbeeinflussen. Aus kombinierten Untersuchungen mit pH-Metrie, ösophagealerSzintigraphie, Bilitec- und Impedanzverfahren ist ersichtlich, dass saure Refluxeunabhängig von neutraler Nahrung oder Galle auftreten können. Daraus wirddie Hypothese einer inkompletten Mischung der Inhalte <strong>im</strong> Magen abgeleitet,die Gegenstand weiterer Untersuchungen sein wird.2.10.4 Einfluss von Sedativa auf die Motilität des Magens— Tierexper<strong>im</strong>entelle UntersuchungenJ. Schnoor 7 , J. K. Unger 7 , T. Küpper 7 , M. Kremer 7 , R. Rossaint 7 , J. SilnyDer Einfluss von Analgesie mit Propofol auf die Motilität des Magens wurdein Tierexper<strong>im</strong>enten mit Schweinen mittels eines zugeschnittenen Impedanzverfahrensuntersucht. Zur Bewertung wurden aus den Aufzeichnungen off-line dieMagen-Motilitätsrate (MMR=Anzahl von Kontraktionen pro Stunde) herangezogen.Fünf männliche Tiere wurden ein bis fünf Tage lang an den Käfiggewöhnt, worauf am sechsten bis neunten Tag eine Trainingsphase folgte. Nachder Instrumentation am zehnten Tag wurde die Messung an unbehandeltenTieren (Tag 11) und am Tag 12 bei sedierten Tieren jeweils acht Stunden langdurchgeführt. Bei unbehandelten Tieren n<strong>im</strong>mt die MMR über die gesamteUntersuchungsperiode langsam (von 249/h auf 200/h) ab, die intermittierendeNahrungszufuhr in den Magen unterbricht diese Tendenz. Die Behandlung mitPropofol führt zu einer signifikanten Absenkung der MMR auf 213/h in der erstenStunde nach der Applikation der Sedativa. Im Gegensatz zu unbehandeltenTieren führt eine Nahrungszufuhr zu einem Anstieg der MMR innerhalb vonzwei Stunden von 166/h auf 184/h.7 Klinik für Anästhesiologie des Universitätsklinikums Aachen
732.10.5 Diskussion und AusblickDie klinischen Untersuchungen unter Anwendung des Impedanzverfahrens konzentriertensich bisher vor allem auf die Erforschung der physiologischen undpathologischen Abläufe der Motilität <strong>im</strong> Ösophagus. Insbesondere bei der Diagnoseder Reflux-Erkrankungen zeigt das Impedanzverfahren deutliche Vorzügegegenüber den herkömmlichen Methoden. Weltweit wird dieses Verfahren vonführenden Gastroenterologen als neuer Standard für die Beurteilung des Reflux-Geschehens eingestuft. Die Eignung des Impedanzverfahrens für die Diagnostikanderer ösophagealer Erkrankungen wie z.B. Achalasie wird in laufenden Studienebenfalls geprüft. Eine viel versprechende Anwendung dieses elektrischenMessverfahrens zeigt sich auch in anderen Organen des GITs wie z.B. <strong>im</strong> Magen,Dünn- und Dickdarm. Initiale Schritte der Instrumentierung und ersteUntersuchungen der anorektalen Physiologie sind in Zusammenhang mit derMedizinischen Klinik III des Universitätsklinikums Aachen bereits erfolgt. DasZiel ist eine Verbesserung der Diagnostik von Erkrankungen wie z.B. der fäkalenInkontinenz oder der Hirschsprung-Erkrankung (Megakolon).
Kapitel 3Präsentationen3.1 Erschienene Publikationen1. B. Schmidt-Rohlfing, N. Ihme, J. Silny (2002): Elektrische Felder <strong>im</strong> Kniegelenkdurch externe Magnetfelder: Ergebnisse einer exper<strong>im</strong>entellen Untersuchung.Z Orthop Ihre Grenzgeb, pp. 538-543, Vol. 140, Issue 5 (ISSN0044-3220)2. T. Kowalski, J. Silny, H. Buchner (2002): Current density threshold forthe st<strong>im</strong>ulation of neurons in the motor cortex area. Bioelectromagnetics,pp. 421-428, Vol. 23, Issue 6 (pISSN 0197-8462 eISSN 1521-186X)3. A. Scholten (2002): Zur Abschätzung des Einflusses niederfrequenter elektromagnetischerFelder auf Herzschrittmacher<strong>im</strong>plantate unter besondererBerücksichtigung von Hochspannungsfreileitungen. Dissertation RWTHAachen; Klinkenberg-Verlag, Aachen, 123 S. (ISBN 3-934318-38-X)4. J. Silny (2002): Nichtionisierende elektromagnetische Felder und Strahlen.In: Dott, Merk, Neuser, Osieka (Hg.) Lehrbuch der Umweltmedizin,Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, pp. 275-290 (Kap. C 10)(ISBN 3-8047-1816-7)5. C.S. Peter, C. Wiechers , B. Bohnhorst, J. Silny, C.F. Poets (2002): Influenceof nasogastric tubes on gastroesophageal reflux in preterm infants: Amultiple intraluminal <strong>im</strong>pedance study. J Pediatr, pp. 277-279, Vol. 141,Issue 2 (ISSN 0022-3476)74
756. G. Lindenblatt, J. Silny (2002): Electrical phosphenes: On the influenceof conductivity inhomogeneities and small-scale structures of the orbitaon the current density threshold of excitation. Medical & Biological Engineering& Computing, pp. 354-358, Vol. 40, Issue 3 (ISSN 0140-0118)7. J. Silny (2002): Elektromagnetische Felder <strong>im</strong> Alltag. Landesanstalt fürUmweltschutz Baden-Württemberg, 82 S., 1. Aufl. 2002 (ISSN 0949-0820)8. T.G. Wenzl, C. Moroder, M. Trachterna, M. Thomson, J. Silny, G. He<strong>im</strong>ann,H. Skopnik (2002): Esophageal pH monitoring and <strong>im</strong>pedance measurement:A comparison of two diagnostic tests for gastroesophageal reflux:J Pediatr Gastroenterol Nutr, pp. 519-523, Vol. 34, Issue 5 (ISSN0277-2116)9. B. Schmidt-Rohlfing, U. Schneider, H.J. Goost, J. Silny (2002): Mechanicallyinduced electrical potentials of articular cartilage: Journal of Biomechanics,pp. 475-482, Vol. 35, Issue 4 (ISSN 0021-9290)10. J. Silny (2002): Effekte und gesundheitsrelevante Wirkungen hochfrequenterelektromagnetischer Felder des Mobilfunks und anderer neuer Kommunikationssysteme.Literaturstudie <strong>im</strong> Auftrag des VDE, Frankfurt/Main,26 S. (ISSN 0949-0820)11. C.S. Peter, N. Sprodowski, B. Bohnhorst, J. Silny, C.F. Poets (2002): Gastroesophagealreflux and apnea of prematurity: no temporal relationship:Pediatrics, pp. 8-11, Vol. 109, Issue 1 (ISSN 0031-4005)12. J. Silny et al. (2001): femu-Forschungsbericht 2001. Jahresberichte ausdem Forschungszentrum für Elektro-Magnetische Umweltverträglichkeitan der RWTH Aachen, 89 S., Bd. 3, 3. Jahrgang 2001 (pISSN 1439-4812,eISSN 1439-9261 [<strong>Online</strong>-<strong>Ausgabe</strong>])3.2 Eingereichte Publikationen1. C. Schmitz, E. Keller, T. Freuding, J. Silny, H. Korr: 50 Hz magneticfield exposure influences DNA repair and mitochondrial DNA synthesis ofdistinct cell types in brain and kidney of adult mice. Radiation Research
762. M. S<strong>im</strong>rén, J. Silny, R. Holloway, J. Tack, J. Janssens, D. Sifr<strong>im</strong>: Relevanceof ineffective esophageal motility during esophageal acid clearance.Assessment of volume and chemical clearance with pH-metry and intraluminalelectrical <strong>im</strong>pedance. GUT3. H.N. Nguyen, G.R. Domingues, R. Winograd, P. Koppitz, F. Lammert, J.Silny, S. Matern: Impedance characteristics of normal esophageal motorfunction. European Journal of Gastroenterology and Hepatology4. J. Schnoor, S. Bartz, B. Klosterhalfen, W. Küpper, R. Rossaint, J. K.Unger: A long term porcine model for measurement of gastroduodenalmotility. Lab An<strong>im</strong>.5. J. Schnoor, J.K. Unger, T. Kuepper, M. Kremer, J. Silny, R. Rossaint:Effects of propofol on gastric motility rate in pig. Lab An<strong>im</strong>.6. J. Schnoor, J.K. Unger, T. Kuepper, S. Haaf-v Below, J. Silny, R. Rossaint:Effects of anaesthetics on gastric fed pattern in conscious unrestrainedpigs. Acta Anestesiol Scand.7. T. Kuepper, J. Schnoor, M. Kremer, J. Silny, R. Rossaint, J.K. Unger: Anew method for measurement of gastroduodenal motility rate in unrestrained,moving pigs. Lab An<strong>im</strong>.3.3 Publizierte Kurzfassungen, Abstracts, Poster1. G. Lindenblatt, G. Schell, J. Silny (2002): Electrocutaneous sensations:Thresholds of perception, adaptation, and tissue-internal fields. BEMSAbstract Book 2002, 24th Annual Meeting Bioelectromagnetics Society,p. 113-114 (Session 16-5)2. A. Scholten, J. Silny (2002): Interference Assessment of cardiac pacemakersin ELF magnetic fields. BEMS Abstract Book 2002, 24th AnnualMeeting Bioelectromagnetics Society, p. 103 (Session 15-2)3. J. Silny, K. Martin, V. Hombach (2002): Contribution of GSM-signals ofdifferent frequencies to the interference threshold of cardiac pacemakers.
77BEMS Abstract Book 2002, 24th Annual Meeting BioelectromagneticsSociety, pp. 58-59 (Session 9-2)4. H. Korr, E. Keller, T. Freuding, J. Silny, C. Schmitz (2002): DNA damagein mouse choroid plexus cells induced by 50 Hz magnetic field exposure.Joint Meeting of the Belgian, Dutch and German Societies of Neuropathology,Aachen University Hospital, 9-12 October 20025. R. Winograd, G.R. Domingues, F. Lammert, J. Silny, E. Purucker, S. Matern,H.N. Nguyen: Impedance characteristics as complementary criteriafor diagnosis of achalasia. DDW, 2002 (Abstr.), M17176. G.R. Domingues, R. Winograd, P. Koppitz, F. Lammert, J. Silny, S. Matern,H.N. Nguyen: Concurrent Esophageal Impedancometry and ManometryRevealed Esophageal Motility disorders in patients with mild esophagitis.DDW, 2002 (Abstr.), S12487. D. Sifr<strong>im</strong>, J. Tack, R. Holloway, J. Silny, J. Janssens (2002): Heartburnduring ambulatory 24-hs pH-<strong>im</strong>pedance recordings in patients with refluxdisease ‘off’ medication. Gastroenteroogy 122 (4):432, Suppl.1 APR 20028. D. Sifr<strong>im</strong>, R. Holloway, J. Silny, X. Zhang, J. Tack, J. Janssens (2002):Patients with gastroesophageal reflux disease have a selective increase ofacid reflux when they have their habitual meals during 24-hr ambulatorypH-<strong>im</strong>pedance recordings. Gastroenterology 122 (4): T1127, Suppl. 1 APR20029. C. Fierens, X. Zhang, R. Holloway, J. Silny, J. Tack, J. Janssens, D. Sifr<strong>im</strong>(2002): Correlation between patterns of postprandial gastro-esophagealreflux (acid and non-acid) and meal-induced neutralization of gastric contentsin patients with GERD. Gastroenterology 122 (4): T1126, Suppl. 1APR 200210. G. R. Domingues, R. Winograd, P. Koppitz, F. Lammert, J. Silny, S. Matern,H.N. Nguyen: Kombinierte Impedanzmessung und Manometrie beiPatienten mit milder Refluxösophagitis. Zeitschrift für Gastroenterologie2002 (8), 688 (Abstr.167); DGVS 2002
7811. R. Winograd, G.R. Domingues, P. Koppitz, F. Lammert, J. Silny, S. Matern,H.N. Nguyen: Korrelation von Bolustransit und peristaltischer Aktivität<strong>im</strong> Ösophagus — Untersuchung mittels kombinierter Impedanzmessungund Manometrie. Zeitschrift für Gastroenterologie 2002 (8), 688(Abstr. 169); DGVS 200212. G.R. Domingues, P. Koppitz, R. Winograd, F. Lammert, J. Silny, S. Matern,H.N. Nguyen: Zusammenhang von Bolustransit und Relaxation desunteren Ösophagussphinkters (LES) untersucht mittels kombinierter Impedanzmessungund Manometrie. Zeitschrift für Gastroenterologie 2002(8), 688 (Abstr.168); DGVS 200213. G.R. Domingues, R. Winograd, P. Koppitz, F. Lammert, J. Silny, S. Matern,H.N. Nguyen: Relationship between bolus transit and lower esophagealsphincter relaxation determined by concurrent <strong>im</strong>pedancometry andmanometry. Neurogastroenterology and Motility 2002, 14 (5), 585 (Abstr.44); XI European Symposium on Neurogastroenterology and Motility14. R. Winograd, G.R. Domingues, P. Koppitz, F. Lammert, J. Silny, S. Matern,H.N. Nguyen: Concurrent <strong>im</strong>pedancometry and manometry for esophagealfunction testing. Neurogastroenterology and Motility 2002, 14 (5),580 (Abstr. 45); XI European Symposium on Neurogastroenterology andMotility15. G.R. Domingues, R. Winograd, P. Koppitz, F. Lammert, J. Silny, S. Matern,H.N. Nguyen: Impact of concurrent esophageal <strong>im</strong>pedancometry andmanometry on the evaluation of patients with low-grade reflux esophagitis.Neurogastroenterology and Motility 2002, 14 (5), 585 (Abstr. 61); XIEuropean Symposium on Neurogastroenterology and Motility16. J. Schnoor, J.K. Unger, T. Kuepper, M. Kremer, J. Silny, R. Rossaint: Effectsof propofol on gastric motility rate in pigs. Poster FELASA, Aachen200217. J. Schnoor, J.K. Unger, T. Kuepper, S. Haaf-v Below, J. Silny, R. Rossaint:A new method for measurement of gastroduodenal motility rate inunrestrained, moving pigs. Poster FELASA, Aachen 2002
7918. T.G. Wenzel, K. Fleischer, T. Peschges, J. Silny, G. He<strong>im</strong>ann, H. Skopnik:Schlafstadien und gastroösophagealer Reflux <strong>im</strong> Säuglingsalter. MonatsschrKinderheilkd 2002, 150: 39419. T.G. Wenzel, K. Fleischer, T. Peschges, J. Silny, G. He<strong>im</strong>ann, H. Skopnik:Sleep stages and gastroesophageal reflux in infants. J Pediatr GastroenterolNutr 2002, 34: 4633.4 Vorträge1. D. Ulrich, B. Hafemann, N. Pallua, J. Silny: In vitro-Einfluss verschiedenerFeldstärken auf die anti- und prothrombotische Aktivität von humanenNabelschnur-Endothelzellen <strong>im</strong> elektrischen Feld. Jahrestagungder Deutschsprachigen <strong>Arbeits</strong>gemeinschaft für Verbrennungsbehandlung(DAV), Sils/Schweiz, 01.20022. J. Silny: Störung elektronischer Implantate durch elektromagnetische Felder.Vortrag anlässlich der VDEW-Sitzung : ‘Ärzte in Kernkraftwerken’,Grafenrheinfeld, 01.02.20023. J. Silny: Wirkung hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf den Organismus.VDE-Pressekonferenz, Berlin, 11.03.20024. J. Silny: Plenarvortrag: Elektrosmog — Fakten und Fiktionen. InternationaleFachmesse und Kongress für Elektromagnetische VerträglichkeitEMV 2002, Düsseldorf, 09.04.20025. J. Silny: Mobilfunk und Gesundheit. Tagung ‘UMTS — Erfolgsfaktorfür den Wirtschaftsstandort’, Bezirksregierung Düsseldorf, Düsseldorf,22.04.20026. J. Silny: Schaden elektromagnetische Felder unserer Umwelt? Kolloquium‘Mobilfunk — ein Risiko?’ Forschungszentrum Jülich, 27.05.20027. A. Scholten, J. Silny: Interference assessment of cardiac pacemakers inELF magnetic fields. The Bioelectromagnetics Society’s 24th Annual Meeting,June 24-27, 2002, Québec City, Québec, Canada
808. G. Lindenblatt, G. Schell, J. Silny: Electrocutaneous sensation: Thresholdsof perception, adaption, and tissue-internal fields. The BioelectromagneticsSociety’s 24th Annual Meeting, June 24-27, 2002, Québec City,Québec, Canada9. J. Silny, K. Martin, V. Hombach: Contribution of GSM-signals of differentfrequencies to the interference threshold of cardiac Pacemakers. TheBioelectromagnetics Society’s 24th Annual Meeting, June 24-27, 2002,Québec City, Québec, Canada10. J. Silny: Vorsorgeprinzipien für die Mobilkommunikation. 3. KoordinierungstreffenMiniWatt BMBF/DLR, München, 04.07.200211. J. Silny: Elektrosmog — Gefahr oder Einbildung. Informationsveranstaltungzum Thema Elektrosmog. Landesumweltamt NRW & Umweltamtder Stadt Düsseldorf, Düsseldorf, 01.08.200212. J. Silny: The interference of electronic <strong>im</strong>plants in low frequency electromagneticfields. Workshop: Electromagnetic Fields, Cardiac Pacemakersand Defibrillators, French Radiation Protection Society and French CardiologySociety, Paris, 25.10.20023.5 Sonstige Aktivitäten1. J. Silny: Berufenes Mitglied des Ausschusses ‘Nichtionisierende Strahlen’der Strahlenschutzkommission (SSK) be<strong>im</strong> Bundesministerium für Umwelt,Naturschutz und Reaktorsicherheit, Bonn. Berufung durch das Bundesministeriumfür Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berufungzum 01.01.19972. J. Silny: Leitung der <strong>Arbeits</strong>gruppe ‘Neue Technologien und ihre Konsequenzenfür die Umwelt’ des Ausschusses ‘Nichtionisierende Strahlen’ derStrahlenschutzkommission (SSK) be<strong>im</strong> Bundesministerium für Umwelt,Naturschutz und Reaktorsicherheit, Bonn. Berufung durch das Bundesministeriumfür Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berufungzum 08.06.2000
813. J. Silny: Mitglied der Task Force ‘Gesundheitliche Risiken in EMF’.VDE/DGBT4. J. Silny: Mitglied des <strong>Arbeits</strong>kreises ‘Diagnostik in der klinischen Umweltmedizin’des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer5. J. Silny: Mitarbeit in der Deutschen Elektrotechnischen Kommission <strong>im</strong>DIN und VDE (DKE)ˆ AK 764.0.3 Gefährdung von Personen durch elektromagnetische Felderˆ UK 764.1 Elektrische und magnetische Felder <strong>im</strong> Frequenzbereichvon 0 – 10 kHz6. J. Silny: Vorlesungen:ˆ Technische elektromagnetische Felder in unserer Umwelt — Entstehung,Umweltverträglichkeit und Folgekosten (V2, WS 2002/2003)(Ringvorlesung gemeinsam mit W. Dott, H. Ebel, H. J. Haubrich, B.Rembold, A. Wiesmüller)ˆ Biomedizinische Technik I und II (je V2, WS/SS)(gemeinsam mit G. Rau)(für Informatiker mit Nebenfach Medizin, seit 1980)ˆ Physikalische Noxen. Vorlesung Umweltmedizin, 11.11.2002ˆ Technische elektromagnetische Felder in unserer Umwelt, 13.11.2002(Ringvorlesung: Faszination Technik)7. J. Silny: Gutachtertätigkeit für folgende Fachzeitschriften:ˆ Bioelectromagnetics (USA)ˆ Biomedical Engineering (GB)ˆ Gastrointestinal Motility (GB)ˆ Neurogastroenterology and Motility (GB)ˆ Medizinische Physik (D)ˆ Umweltmedizin in Forschung und Praxis (D)
828. J. Silny: Gutachtertätigkeit fürˆ Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)ˆ Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Kapitel 4Anhang4.1 Mitarbeiter des femuName Titel/Grad <strong>Arbeits</strong>gebiet/FunktionSilny, J. Prof. Dr.-Ing. habil. med. LeiterKober, R.SekretariatBenien, Ch.Stud. HilfskraftDechent, D. Dipl.-Biol. Wiss. MitarbeiterinDobel, M.Stud. HilfskraftFaust, G.TechnikerFrindt, Ch.AuszubildenderGierke, G.AuszubildenderGroten, Th.AuszubildenderGöttgens, Th.Stud. HilfskraftKlubertz, F. M.A. Wiss. MitarbeiterKühn, R.E-TechnikerLaven, G.Biologie-LaborantLindenblatt, G. Dipl.-Phys. Wiss. MitarbeiterMarquardt, Th. Cand. med. Stud. HilfskraftRaza, A. Cand. Ing. Stud. HilfskraftRütgers, O.E-TechnikerScholten, A. Dr.-Ing. Wiss. MitarbeiterSiegmar, S. Dipl.-Ing. Wiss. Hilfskraft83
84Sinning, T. Dipl.-Ing. Wiss. MitarbeiterVassileva, M. Cand. med. dent. Stud. HilfskraftWermeester, G.E-Techniker/AusbilderWienert, R. Dipl.-Ing. Wiss. MitarbeiterZillekens, A.E-TechnikerExterne Mitarbeiter an der WBLDB:NameBartsch, H.Bartsch, Ch.Hinrichs, H.Holtkamp-Rötzler, E.Schüz, J.Thalau, P.Titel/GradDr. rer. nat.PD Dr. rer. nat.Prof. Dr.-Ing.Dr. rer. nat.Dr. rer. physiol.Dr. rer. nat.
854.2 femu-Fördererˆ Bundesland Nordrhein-Westfalenˆ Bundesamt für Strahlenschutzˆ Deutsche Bundesstiftung Umweltˆ Forschungsstelle für Elektropathologieˆ RWE NET AGˆ Forschungsgemeinschaft Funk e.V.ˆ T-Mobile Deutschland GmbHˆ Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik
864.3 Impressumfemu-ForschungsberichtISSN 1439-4812 (Print); ISSN 1439-9261 (Internet)aus dem Forschungszentrumfür Elektro-Magnetische Umweltverträglichkeit (femu)IHU, Universitätsklinikum der Rheinisch-WestfälischenTechnischen Hochschule Aachen (RWTH)4. Jahrgang 2002Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. habil. med. J. SilnyRedaktion: Dipl.-Ing. R. WienertErscheinungsweise: 1× jährlich zum Jahresende<strong>Online</strong>-<strong>Ausgabe</strong> zum Download aus dem Internet <strong>im</strong> <strong>pdf</strong>-<strong>Format</strong>Verlagsort: Aachen, DeutschlandAnschrift:femu – RWTH AachenPauwelsstraße 2052074 AachenE-Mail: redaktion@femu.rwth-aachen.deInternet: http://www.femu.rwth-aachen.deTelefon: ++49 (0) 241/80-87287Telefax: ++49 (0) 241/80-82636