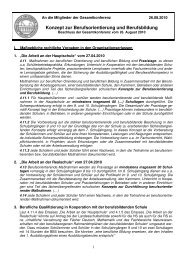Führungsteam - Schule Am Dobrock
Führungsteam - Schule Am Dobrock
Führungsteam - Schule Am Dobrock
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
STEUERGRUPPE DER SCHULE AM DOBROCK 12.12.2011<br />
Konzept für eine Schülerfirma<br />
an der <strong>Schule</strong> <strong>Am</strong> <strong>Dobrock</strong><br />
1. Ziele und Grundlagen der Schülerfirma<br />
1.1. Die besondere Bedeutung von Schülerfirmen für Hauptschülerinnen und -schüler<br />
1.2. Projektplanung und -entwicklung in unserer Schülerfirma<br />
1.3. Die Rolle der Lehrkräfte<br />
1.4 Bedeutung der Schülerfirma für die Lehrkraft und die <strong>Schule</strong><br />
2. Rechtsstatus und Schulverein<br />
3. Rahmenbedingungen zur Umsetzung<br />
4. Firmenstruktur<br />
4.1. Abteilungen mit Teamleitung<br />
4.1.1. Verwaltung<br />
4.1.2. Produktion und Verkauf<br />
4.1.3. Mögliche Geschäftsfelder<br />
4.2. <strong>Führungsteam</strong><br />
4.3. Erweitertes <strong>Führungsteam</strong><br />
5. Organisation<br />
5.1. Grundlagenvertrag<br />
5.2. Bewerbung<br />
5.3. Arbeitsvertrag<br />
5.4. Abmahnung und Kündigung<br />
5.5. Arbeitszeugnis<br />
5.6. Aufgaben in der Arbeitszeit<br />
5.7. Finanzen<br />
5.8. Zusammenarbeit mit externen Firmen/Stellen<br />
6. Praktische Hinweise<br />
7. Anhang<br />
A - Zeitlicher Ablauf der Einführung der Schülerfirma<br />
B - Modellhafter Ablauf eines Schuljahres<br />
C - Vereinbarung mit der Schulleitung zur Gründung einer Schülerfirma<br />
D – Arbeitsvertrag<br />
E - Organisationsplan der Abteilungen und Inventarliste<br />
F – Organisationsstruktur<br />
G - Entwurf eines Organigramms<br />
H – Einbindungsmöglichkeiten der verschiedenen Fächer<br />
I – Übersicht<br />
J – Quellen<br />
- 1 -
1. Ziele und Grundlagen der Schülerfirma<br />
Die Schülerfirma ist zentraler Bestandteil der berufsorientierenden Maßnahmen der <strong>Schule</strong> <strong>Am</strong> <strong>Dobrock</strong> und des<br />
hierzu gehörenden Konzeptes „Betriebs- und Praxistage". Ihre zentralen Zielsetzungen sind<br />
• praxis- und handlungsorientiertes Lernen<br />
• Verankerung berufsorientierender Inhalte im Unterricht<br />
• Ausbildungsvorbereitung und Unterstützung bei der Berufswahlentscheidung<br />
• Persönlichkeitsentwicklung (Förderung von Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Eigeninitiative,<br />
Verantwortungsübernahme, ....)<br />
• Ausbildung von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen bei den Schülern<br />
• Wirtschaftliche Bildung durch betriebswirtschaftlichen Denken am praktischen Beispiel<br />
• Motivation der Schüler aufgrund spezifischer Merkmale der Lernform<br />
• lnitiierung von Kooperationen mit außerschulischen Partnern – „Öffnung von <strong>Schule</strong>“<br />
• Erwirtschaftung von Eigenmitteln für die <strong>Schule</strong><br />
Die gesamtgesellschaftlichen Veränderungen verlangen von der <strong>Schule</strong> die Öffnung für eine andere Arbeitsweise. Dies<br />
erscheint aus zwei Gründen unumgänglich:<br />
• Orientierungswissen im Feld der beruflichen Entwicklungen und Perspektiven kann nicht als Schulfach, auch nicht als<br />
Fach „Arbeitslehre" entwickelt werden. Orientierung wird nur möglich, wenn Zusammenhänge selbst entdeckt und<br />
erkannt werden. Fächergrenzen schränken diese Lernprozesse ein. <strong>Schule</strong> ist also hier gefordert, sich zu öffnen und<br />
ihre traditionellen Arbeitsstrukturen zu erweitern. 1<br />
• Das eigene und das selbstverantwortete Handeln von Schülerinnen und Schülern ist die Basis jeden beruflichen<br />
Orientierungswissens.<br />
1.1. Die besondere Bedeutung von Schülerfirmen für Hauptschülerinnen und -schüler<br />
Für Hauptschülerinnen und -schüler ist der Zugang zum Arbeitsmarkt besonders schwierig. Neben allgemein bildenden<br />
Qualifikationen sind für diese Schüler eine verantwortliche Einstellung zur eigenen Arbeit, Kommunikations- und<br />
Teamfähigkeit, Verständnis für wirtschaftliche und betriebliche Abläufe und ein daraus erwachsendes persönliches<br />
Engagement ausschlaggebend für eine berufliche Entwicklungsmöglichkeit. Mit dem Erwerb dieser<br />
Schlüsselqualifikationen entscheidet sich letztlich, ob eine reale Vermittlungschance in Ausbildung und Beruf besteht<br />
und in wieweit nachschulische Qualifizierungsmaßnahmen Erfolg haben. Die Persönlichkeitsqualifikation erweitert<br />
und vertieft die fachliche Qualifikation. Für viele dieser Schülerinnen und Schüler besteht auf Grund ihres Umfeldes<br />
außerhalb der <strong>Schule</strong> kaum eine Chance, diese Schlüsselqualifikationen zu erwerben. Die Erfahrungen an anderen<br />
<strong>Schule</strong>n zeigen, dass das Projektlernen in Schülerfirmen die Möglichkeit eröffnet, der schulischen Demotivation, Schul-<br />
und Lernverweigerung die aus der Wahrnehmung der Perspektivlosigkeit entsteht, entgegen zu wirken.<br />
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Schlüsselqualifikationen und setzen sie in persönliche Haltungen um, die den<br />
Erfolg in Maßnahmen der Jugendberufshilfe und die Übergange in Ausbildungsberufe deutlich erhöhen:<br />
• In Schülerfirmen werden Qualifikationen wie Verantwortungsbewusstsein, Durchhaltevermögen oder<br />
Kommunikations- und Teamfähigkeit direkt von der gemeinsamen Firma eingefordert. Ohne sie ist eine<br />
erfolgreiche Firmentätigkeit gar nicht vorstellbar.<br />
• Der Umgang mit technischen Vorgängen ist ein wesentlicher Teil des Lernens in produzierenden<br />
Schülerfirmen. In Auseinandersetzung mit den Anforderungen, die die Handhabung und Beherrschung der<br />
jeweiligen Technik an sie stellt, wird nicht nur latente Technikfeindlichkeit überwunden, sondern die<br />
Schülerinnen und Schüler erfahren, selbst etwas zu bewirken, indem sie Produkte herstellen oder Leistungen<br />
erbringen, die für andere auch außerhalb der <strong>Schule</strong>, wertvoll sind.<br />
1 Anlage H<br />
- 2 -
• Die Schülerinnen und Schüler treten in Kontakt mit Menschen außerhalb der <strong>Schule</strong>. Sie führen<br />
Kundengespräche mit den Käufern ihrer Produkte oder mit den Abnehmern ihrer Dienstleistungen. Sie treten<br />
in Kontakt zu Fachleuten in gewerblichen Betrieben, von denen sie benötigte Fertigkeiten vermittelt<br />
bekommen. Sie erfahren, dass ihre Tätigkeit auch außerhalb pädagogischer Schonräume etwas wert ist. Diese<br />
Anerkennung ist zusammen mit dem Bewusstsein der eigenen Leistung im Projekt und deren Qualität eine<br />
wesentliche Ursache dafür, dass diese Schüler Vertrauen in die eigene Entwicklungsfähigkeit gewinnen<br />
können, ihre Persönlichkeit stabilisiert wird.<br />
• Darüber hinaus können durch außerschulischen Kontakte des Projekts die Vermittlung der Schülerinnen und<br />
Schüler in ein Ausbildungsverhältnis erleichtern, weil sie und ihre <strong>Schule</strong> den Ausbildern persönlich bekannt<br />
sind.<br />
1.2. Projektplanung und -entwicklung in unserer Schülerfirma<br />
Trotz aller Realitätsnähe und aller Orientierung auf Wirtschaftlichkeit muss eine Schülerfirma letztendlich immer ein<br />
Stück Simulation bleiben und darf sich nicht im Geldverdienen, selbst wenn es für die <strong>Schule</strong> ist, erschöpfen. Der<br />
wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens kann nicht der alleinige Zweck des Projektes sein, sondern ist hier eher als<br />
didaktisches Instrument zu sehen.<br />
Ebenso wichtig für die beteiligten Schülerinnen und Schüler ist, dass sie<br />
• den wirtschaftlichen und unternehmerischen Gesamtverlauf des Unternehmens kennen und lernen, ihre<br />
eigene Rolle in diesem Ablauf zu überdenken. Dies kann z. B. dadurch geschehen, dass die Funktionen<br />
innerhalb des Unternehmens von den Schülern während des Projekts gewechselt werden.<br />
• erfahren, welche Verbindung zwischen Arbeit in der Firma und schulischem Lernen besteht, indem fachliche<br />
Inhalte des Schulunterrichts (Deutsch, Mathematik, Biologie, Kunst usw.) bei der Tätigkeit in der Firma<br />
angewendet werden müssen und bewusst gemacht werden. 2<br />
• die unternehmerische Erfahrung der Verantwortung für Gewinn und Risiko machen können und ein<br />
realistisches Bild des Wirtschaftens gewinnen. Dazu gehört auch, dass die unternehmerische Erfahrung<br />
ernsthaft und die Erfahrung des Scheiterns möglich ist. So ist es nicht wünschenswert, den Schulkiosk als<br />
Schülerfirma ohne eine Kalkulation, Warenwirtschaft und Verwaltung und ohne eine mögliche Konkurrenz<br />
betreiben zu lassen, da sonst unternehmerische Risiken nicht bewältigt werden müssen.<br />
Die Strukturen des Schülerfirmen-Projektes müssen eindeutig sein, damit die Verantwortlichkeit jedes einzelnen<br />
beteiligten Schülers transparent wird. Nur so können die oben genannten Lerneffekte auf der Ebene der<br />
Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht werden.<br />
Dazu ist es erforderlich, dass<br />
• der Gesamtaufbau der Firma und ihre innere Organisation mit allen beteiligten Schülerinnen und Schülern<br />
immer wieder neu nachvollzogen wird und beide Bereiche über Vollversammlungen ihnen immer wieder<br />
transparent gemacht werden und ihren Entscheidungen zugänglich sind. Das Prinzip der Verantwortlichkeit,<br />
das für alle gelten muss, kann nur so durchgehalten werden.<br />
• möglichst alle Teilbereiche eines Unternehmens - Leitung, Personalabteilung, Verkauf, Entwurf und Planung,<br />
Produktion, Buchhaltung, Werbung usw. - in der Schülerfirma eingerichtet und von den Schülerinnen und<br />
Schülern selbstverantwortlich organisiert werden. Die Firma darf sich nicht auf Produktion und Verkauf<br />
beschränken. Wesentliche Effekte des Lernens in Schülerfirmen ergeben sich erst aus dem Zusammenwirken<br />
der Abteilungen, der Erfahrung der wechselseitigen Abhängigkeit und der geteilten Verantwortung für das<br />
Ganze.<br />
• die Schülerinnen und Schüler mit allen Risiken Selbstständigkeit erfahren. Erst wenn sie so in ihrer „Firma"<br />
tätig sind, stellen sich die beschriebenen Effekte der Selbsterfahrung wie auch die Entwicklung der<br />
angesprochenen Schlüsselqualifikationen ein.<br />
2 Anlage H<br />
- 3 -
1.3. Die Rolle der Lehrkräfte<br />
Damit ändert sich ein Stück weit die gewohnte Rolle der Lehrkräfte in Richtung des Projektlernens. Einerseits müssen<br />
sie die Sachzusammenhänge gut kennen und hinsichtlich der Belange der Firma auch über den Dingen stehen, um für<br />
Fragen und eingeforderte Hilfestellungen gerüstet zu sein. Andererseits dürfen sie aber nicht vorgreifend oder<br />
stellvertretend für die Schüler handeln. Weil es sich nicht um eine „Lehrerfirma" handeln darf, können sie erst in der<br />
Reflexion der Abläufe selbst tätig werden und müssen in der Lage sein, Irrwege und Fehlentscheidungen der Schüler<br />
bewusst zuzulassen.<br />
Diese Balance zu halten ist ein wesentliches Moment der Unterrichtsarbeit.<br />
Das stellt sowohl von der Breite des Wissens wie von der Persönlichkeit her hohe Anforderungen an die Qualifikation<br />
der Lehrkräfte, die sie zum Teil auch erst mit der Entwicklung des Projektes und mit der Durchführung über mehrere<br />
Schuljahre hinweg erwerben werden. Deshalb kann es vorteilhaft sein, schon in der Entwicklungsphase den Kontakt<br />
mit Lehrerinnen und Lehrern aus ähnlichen Projekten herzustellen und auch die Unterstützung durch außerschulische<br />
Partner zu suchen. Darüber hinaus steht die Steuergruppe grundsätzlich zur Beratung besonders im konzeptionellen<br />
Bereich zur Verfügung. Oft können so technische und organisatorische Schwierigkeiten schnell gelöst werden, die aus<br />
der Sicht der Einzelschule und des einzelnen Projektes unüberwindbar erscheinen. Dennoch bleibt die Tatsache der<br />
deutlich höheren Belastung der mit dem Projekt befassten Lehrerinnen und Lehrer bestehen, die erst im<br />
Zusammenhang mit den positiven Auswirkungen auf die <strong>Schule</strong>ntwicklung verständlich und verantwortbar wird.<br />
1.4. Bedeutung der Schülerfirma für die Lehrkraft und die <strong>Schule</strong><br />
Lehrkräfte kennen ihre Schülerinnen und Schüler jetzt nicht nur aus dem Unterricht, sondern sie haben die Chance<br />
gehabt, in der Firma an ihnen auch Seiten und besondere Fähigkeiten zu entdecken, die im Unterricht ihres Faches<br />
zwangsläufig nicht auftauchen konnten. Schülerinnen und Schüler haben die Chance, ihre Lehrkräfte anders als im<br />
Unterricht zu erfahren und entwickeln deshalb mehr Vertrauen und Gesprächsbereitschaft. So kann die Schülerfirma<br />
wegen ihrer Vielschichtigkeit und auf Grund der Tatsache, dass sie nicht einfach unter den Alltag von <strong>Schule</strong> zu<br />
subsumieren ist, ein Medium darstellen, die innere Entwicklung unsrer <strong>Schule</strong> deutlich zu unterstützen.<br />
Schülerinnen und Schüler erfahren in der Schülerfirma vor allem eigene Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten,<br />
die ihnen bisher oft nicht zugänglich waren. Das gilt vor allem für den Umgang mit fremden Personen, für den Bereich<br />
der organisatorischen Fähigkeiten und nicht zuletzt für den Umgang mit Technik. Dabei ist es weniger wichtig,<br />
verschiedene technische Abläufe perfekt zu beherrschen. Vielmehr geht es oft erst einmal um die Grunderfahrung,<br />
nicht zwei linke Hände zu haben und die Dinge zu Ende bringen zu können. Ihre unmittelbare Zufriedenheit mit dem,<br />
was sie in der <strong>Schule</strong> tun, wird größer, denn ihre Identifikation mit der Firma überträgt sich auf andere Bereiche der<br />
<strong>Schule</strong>. Eine wiederholte Erfahrung anderer <strong>Schule</strong>n ist, dass Schülerinnen und Schüler selbst Krankheit oder<br />
Schulmüdigkeit ganz unwichtig werden, wenn es um „ihre Firma" geht.<br />
Alle diese Veränderungen werden nicht unmittelbar und nicht in der Form großer Ereignisse erfolgen. Bedeutsam sind<br />
vielmehr die vielen kleinen Schritte, die mit einer Schülerfirma gegangen werden und die einzelnen kleinen<br />
Entwicklungen, die sie bei Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften auslösen. Ihre Wirkung ist oft nicht sofort als<br />
<strong>Schule</strong>ntwicklung erkennbar, sie schaffen aber reale Veränderungen. Diese wirken auf Dauer auch von dieser Seite in<br />
die Richtung eines innovativen Klimas in unserer <strong>Schule</strong> und erzeugen damit Stück für Stück eine offene Haltung der<br />
Beteiligten zur <strong>Schule</strong>.<br />
2. Rechtsstatus und Schulverein<br />
Die Schülerfirma verfolgt pädagogische Ziele sowie die Gewinnung von Geldmitteln zur Unterstützung der schulischen<br />
Arbeit. Da wir von einem letztendlichen Jahresumsatz von mehr als 30 678 € (auf Grund des Schulkiosks) ausgehen<br />
müssen, kommt aus steuerlichen Gründen nur eine Trägerschaft durch den Schulverein in Frage. Dieser bleibt<br />
steuerbefreit, wenn seine Einnahmen einschließlich der aus der Schülerfirma erwirtschafteten Gewinne unterhalb der<br />
Geringfügigkeitsgrenze liegen. Wird sie überschritten, ist für eine Steuerbefreiung Voraussetzung, dass der Gewinn<br />
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke eingesetzt wird. Auch der Bereich der Haftpflicht- und Unfallversicherung ist<br />
so problemlos abzudecken, da Rechtssicherheit durch die Anerkennung als Schulveranstaltung entsteht. Aus<br />
- 4 -
juristischer Sicht ist es großer Bedeutung, dass der Status der Schülerfirma bei jedem Geschäftskontakt offen<br />
dargestellt wird.<br />
3. Rahmenbedingungen zur Umsetzung<br />
Um das Konzept einer Schülerfirma erfolgreich umsetzen zu können, sind eine Reihe von Punkten zu klären.<br />
• Mitarbeit des Schulvereins. Die notwendigen Änderungen in der Satzung des Schulvereins und die<br />
Einzelheiten besonders zum Bereich der rechtlichen Anbindung und zu steuerlichen Aspekten müssen mit<br />
dem Schulverein gemeinsam erarbeitet werden und sollten zum Jahreswechsel 2011/12 erfolgen. Da der<br />
Schulverein dem Vereinsrecht unterliegt und sein Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember geht,<br />
wäre der ein sinnvoller Wechselzeitpunkt.<br />
• Einverständnis der Schulleitung/der Gesamtkonferenz/des Schulvorstandes. Klärung, wie viel Stunden für<br />
das Vorhaben zur Verfügung gestellt werden können. Es sollen Verlagerungsstunden in der Aufbauphase<br />
gewährt werden.<br />
• Mitarbeit von Lehrkräften. Frau Rieche, Frau Schmidt, Frau Schünemann und eventuell Herr Herm haben sich<br />
zur Mitarbeit bereit erklärt.<br />
• Technische und räumliche Ausstattung. Computer, Werkzeuge, Küche, Werkstatt, Büro, Lagermöglichkeiten<br />
o.ä.<br />
• Rechtliche Grundlagen. Steuerliche Fragen werden über den Schulverein und das gültige Vereinsrecht<br />
geregelt. Dazu sollte eine externe Fachkraft engagiert werden. Die Schüler/innen sind in der Zeit über die<br />
<strong>Schule</strong> unfallversichert.<br />
• Informationen der beteiligten Lehrkräfte über fachliche Abläufe, Bestimmungen und die rechtlichen<br />
Grundlagen in den einzelnen Bereichen müssen eingeholt worden sein.<br />
���� Produkthaftung<br />
���� Garantie<br />
���� Arbeitssicherheit<br />
���� Infektionsschutzgesetz/Gesundheitszeugnis<br />
���� Erstellen von Arbeitszeugnissen<br />
���� (Haftpflicht-)Versicherung der Geräte/Materialien<br />
• Betreuung der Schüler. Die Arbeit in einer Schülerfirma ist in der Anfangsphase für die Lehrkraft mit einem<br />
Mehraufwand verbunden. Die Betreuung der Schülerinnen und Schüler ist zu sichern, es müssen auch<br />
mögliche Vertretungen eingeplant werden.<br />
• Zustimmung durch die Eltern. Nach einer Informationsveranstaltung sollte den Schülerinnen und Schülern<br />
ein Elternbrief mitgegeben werden, der jegliche Infos über die geplante Schülerfirma enthält sowie eine<br />
Kenntnisnahmeerklärung der Eltern . Bei Rückfragen steht den Eltern die betreuende Lehrkraft zur<br />
Verfügung. Ein Einverständnis ist nicht erforderlich, da es sich um eine Schulveranstaltung handelt.<br />
• Zeitplanung. Zunächst stehen zwei, später dann ggf. auch mehr Wochenstunden zur Verfügung. Die jeweilige<br />
Laufzeit geht über ein ganzes Schuljahr. In den Einführungswochen der Schülerfirma sollte mit allen<br />
beteiligten Schülerinnen und Schülern ein Verlaufsplan ausgearbeitet werden, der dann ausgehängt wird. 3<br />
3 Anhang B<br />
- 5 -
4. Firmenstruktur<br />
Es gibt eine flache Hierarchie. Das heißt, dass in den Abteilungen grundsätzlich im Team gearbeitet wird, wobei jeder<br />
verantwortlich ist. 4<br />
4.1. Abteilungen mit Teamleitung<br />
In einer Abteilung arbeiten mindestens drei, besser fünf bis acht, höchstens aber zehn Schüler mit. Die Teamleitung<br />
besteht jeweils aus zwei Schülern und einer Lehrkraft. Es koordiniert abteilungsintern Sach- und Personalfragen, ist für<br />
Zeitplänen und Mitarbeitermotivation zuständig und hält Kontakt zum <strong>Führungsteam</strong>. Ein Schüler übernimmt die<br />
Abteilungsleitung und vertritt die Abteilung auch nach außen. Abteilungsleiter sollten bei hohem Arbeitsaufkommen in<br />
der Lage sein, in anderen Abteilungen auszuhelfen bzw. dort auch stellvertretende Funktionen zu übernehmen.!!!<br />
4.1.1. Verwaltung - Bei Bedarf Unterstützung in anderen Abteilungen!!!<br />
o Personalmanagement<br />
� Bearbeitung und Pflege der Angestelltenunterlagen<br />
� Personalverwaltung<br />
� Einsatzplanung und ggf. Umsetzungen in Zusammenarbeit mit den produktiven Abteilungen<br />
o Logistik (Beschaffung, Einkauf, Lager)<br />
o Buchhaltung<br />
� Angebote einholen sowie Konditionen aushandeln<br />
� Schriftliches Fixieren aller Ein- und Ausgänge von Ware oder Materialien<br />
� Guten Kontakt zu Lieferanten pflegen<br />
� Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge<br />
� Sammeln von Quittungen und Belegen<br />
� Verantwortlich für die Wirtschaftlichkeit der Firma, indem darauf geachtet wird, dass nicht<br />
mehr Geld ausgegeben wird als zur Verfügung steht<br />
o Marketing (In der Anfangsphase der Schülerfirma überwiegend damit beschäftigt, die Öffentlichkeit<br />
auf das Unternehmen aufmerksam zu machen!)<br />
� Katalogisierung von Aufträgen/Dienstleistungen<br />
� Werbung, Flyer, Plakate<br />
4.1.2. Produktion und Verkauf - Je nach Form der Abteilungen werden<br />
4 Anhang F und G<br />
Güter produziert und verkauft oder<br />
Dienstleistungen angeboten.<br />
� Planung<br />
� Qualitätskontrolle<br />
� Lagerhaltung<br />
� Überprüfung der Bestände (Ware, Materialien o.ä.) und Führung eines<br />
Warenwirtschaftsbuches, um Wareneingang, Herstellung, (Verlust) und Produktausgang zu<br />
dokumentieren<br />
� Kalkulation/Preise festsetzen<br />
� Zusammenarbeit mit der Logistik und dem Marketing<br />
- 6 -
4.1.3. Mögliche Geschäftsfelder<br />
o Spieleherstellung<br />
o Fahrradwerkstatt<br />
o Schmuck<br />
o Hardwarewerkstatt<br />
o Anfertigung von Bildpostkarten<br />
o Catering<br />
o ......<br />
4.2. <strong>Führungsteam</strong><br />
Das <strong>Führungsteam</strong> ist in die Abteilungen integriert und trifft regelmäßig zusammen. Es besteht aus zwei der<br />
mitarbeitenden Lehrkräfte und zwei Schülern aus den Teamleitungen, die von allen beteiligten SuS gewählt werden.<br />
• Es koordiniert die Abteilungen, strukturiert die Arbeitsabläufe und trifft Entscheidungen darüber, wie die<br />
einzelnen Abteilungen zu besetzen sind.<br />
• Darüberhinaus obliegt ihm auch die Personalentscheidungen; es stellt ein, mahnt ab und kündigt.<br />
• Es ist zuständig für Führungsmotivation, Erkundigungen über den Stand der Produktion, Einhalten<br />
terminlicher Vorgaben.<br />
• Es lädt regelmäßig zu den Firmentreffen ein: entweder zu Koordinierungstreffen mit den Leitungsteams oder<br />
zu Vollversammlungen.<br />
4.3. Erweitertes <strong>Führungsteam</strong><br />
Dem erweiterten <strong>Führungsteam</strong> gehören zusätzlich noch je ein Mitglied des Schulvereins und der Schulleitung an. Es<br />
tagt mindestens einmal im Schuljahr, legt die grundlegenden Ziele und Eckpfeiler des Jahresplanes fest und justiert sie<br />
ggf. nach. Das Mitglied des Schulvereins hat bei allen Entscheidungen ein Vetorecht.<br />
5. Organisation<br />
Die Schülerfirma der <strong>Schule</strong> <strong>Am</strong> <strong>Dobrock</strong> wird ab dem Schuljahr 2010/2011 zweistündig als Ergänzung im WPK-Band<br />
der Hauptschule im 9. Schuljahr verpflichtend angeboten.<br />
5.1. Grundlagenvetrag<br />
Sobald sich zu Beginn eines neuen Schuljahres das <strong>Führungsteam</strong> gegründet hat, schließt es einen auf ein Jahr<br />
befristeten Vertrag mit der Schulleitung ab, in dem die grundsätzlichen Arbeitsbedingungen geregelt und für jeden<br />
Angestellten einsehbar sind. 5<br />
5.2. Bewerbung<br />
Die zukünftigen Neuntklässler haben im Verlaufe des 2. Halbjahres an einer Betriebserkundung der Schülerfirma<br />
teilgenommen und sich ein Bild von den in den einzelnen Abteilungen gestellten Anforderungen und den dort zu<br />
erbringenden Arbeiten gemacht sowie sich nach etwaigen Vor- und Nachteilen erkundigt 6 . Jede Schülerin/jeder<br />
Schüler hat sich bis spätestens zwei Wochen vor Ende des Schuljahres in üblicher Form schriftlich in zumindest zwei<br />
Abteilungen zu bewerben, wobei ggf. darauf geachtet wird, dass eine Schülerin/ein Schüler bei zweijähriger Teilnahme<br />
in der Schülerfirma in zwei der Abteilungen gearbeitet hat. Es besteht auch die Möglichkeit, zum Halbjahreswechsel<br />
den Arbeitsplatz mit den üblichen Verfahren zu wechseln.<br />
Es können zum Beginn eines Schuljahres auch neue Abteilungen gegründet werden.<br />
5 Anhang C<br />
6 In diesem Jahr werden sie ausführlich über die ihre Möglichkeiten informiert und haben die Möglichkeit, von<br />
vorneherein eigene Vorstellungen mit einzubringen.<br />
- 7 -
Die Bewerbungen werden vom <strong>Führungsteam</strong> gesichtet. 7 Im Anschluss hieran werden die Schülerinnen und Schüler<br />
zu Bewerbungsgesprächen eingeladen. Das <strong>Führungsteam</strong> entscheidet über die Besetzung der einzelnen Stellen und<br />
fertigt die Arbeitsverträge aus, die den Schülern zur Unterschrift vorgelegt werden. Schülerinnen und Schüler, die<br />
aufgrund mangelhafter Ergebnisse im Bewerbungsverfahren keine Stelle gefunden haben, müssen sich diesem<br />
Verfahren erneut unterziehen, wobei ihnen die Schulsozialpädagogin für ein Gespräch wie auch für andere Hilfen<br />
(Schreiben einer Bewerbung, Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch u. a. m.) zur Seite steht. Schülerinnen und<br />
Schülern ohne eine erfolgreiche Bewerbung droht eine Bewertung ihrer Leistung in der Schülerfirma mit<br />
„ungenügend".<br />
5.3. Arbeitsvertrag<br />
Die arbeitsvertraglich festgelegte Arbeitszeit der Beschäftigten beträgt drei Stunden pro Woche, so dass bei Bedarf<br />
auch Arbeiten am Nachmittag bzw. am Wochenende möglich sind. Die Probezeit beträgt vier Wochen. 8<br />
5.4. Abmahnung und Kündigung<br />
Bei gravierenden Pflichtverletzungen erfolgt nach einem Gespräch mit einem Mitglied des <strong>Führungsteam</strong>s eine<br />
schriftliche Abmahnung. Im Wiederholungsfall wird dem betreffenden Beschäftigten — ggf. auch fristlos — gekündigt.<br />
Hiervon betroffene Schülerinnen und Schüler haben sich dann nach einem verpflichtenden Gespräch mit der<br />
Schulsozialpädagogin in einer anderen Abteilung der Schülerfirma erneut zu bewerben.<br />
5.5. Arbeitszeugnis<br />
Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende jedes Schulhalbjahres ein Arbeitszeugnis als Fähigkeitsnachweis, in<br />
dem die folgenden Kriterien beschrieben werden. 9<br />
• Einstellung zur Arbeit (Interesse, Eigeninitiative, Einsatzbereitschaft)<br />
• Ordnung am Arbeitsplatz (Ordnung während und nach Beendigung der Arbeit)<br />
• Verlässlichkeit (Pünktlichkeit, Einhalten von Terminen und Absprachen)<br />
• Selbstständigkeit (Erledigung von Arbeitsaufträgen, Beschaffen von Arbeitsmitteln und Informationen)<br />
• Arbeitsweise (Sorgfalt, Arbeitsqualität, Arbeitstempo)<br />
• Teamfähigkeit (Umgangsformen, Einordnungsfähigkeit, Umgang mit Kritik)<br />
• Äußeres Erscheinungsbild (angemessene Arbeitskleidung, Hygiene)<br />
5.6. Aufgaben in der Arbeitszeit<br />
In den Abteilungen wird nach vorgegebenen Aufgabenkatalogen und Einsatzplänen gearbeitet. Dieses soll<br />
sicherstellen, dass zum einen innerhalb einer Abteilung wirklich alle anfallenden Arbeiten erledigt werden und zum<br />
anderen jeder Beschäftigte innerhalb seiner Abteilung mit wechselnden Tätigkeiten betraut wird. Für die Einhaltung<br />
der Aufgabenkataloge und Einsatzpläne ist jeder Beschäftige selbst verantwortlich, die diesbezügliche Kontrolle<br />
obliegt den Abteilungsleitern, wobei sie in Konfliktfällen durch die Geschäftsleitung unterstützt werden.<br />
Nach Beendigung des Arbeitstages und aller anfallenden Arbeiten erfolgt im Rahmen einer kurzen<br />
Abteilungsversammlung eine Reflexion. Dabei werden sowohl positive wie auch negative Erkenntnisse des Tages<br />
besprochen. Dies betrifft sowohl Arbeitsabläufe innerhalb der Abteilungen und das Arbeitsverhalten von Beschäftigen<br />
wie auch Gesichtspunkte, die den Betrieb als Ganzen betreffen wie z. B. Veränderung des Warenangebotes, Erstellung<br />
bzw. Veränderung von Preiskalkulationen, Reaktion auf Veränderungen im Kundenbereich, Einkauf, Finanzsituation<br />
der Abteilung u. a. m.<br />
7 Zum Schuljahr 2011/12 wird ein vorläufiges <strong>Führungsteam</strong> eingerichtet, zu dem auch zwei Schüler/innen benannt<br />
werden.<br />
8 Anhang D<br />
9 Weitere Kriterien können hinzugefügt werden.<br />
- 8 -
5.7. Finanzen<br />
Zum Jahresende und zum Schuljahresende 10 wird seitens der Abteilung „Verwaltung" eine schriftliche Bilanz bezüglich<br />
der Finanzsituation der Schülerfirma erstellt. Einmal pro Schuljahr wird diese Bilanz auf einer Gesamtkonferenz<br />
vorgestellt und erörtert. Darüberhinaus arbeitet die Verwaltung dem Schulverein bzw. dem externen<br />
Finanzdienstleister zu.<br />
Dier erzielten Gewinne werden in etwa wie folgt aufgeteilt: 10% gehen in das Ghanaprojekt und je 30 % gehen an den<br />
Schulverein, in Investitionen und an die beteiligten Klassen im Rahmen gemeinnütziger oder Schulprojekte wie z.B.<br />
Klassenfahrten. Im Falle einer Firmenauflösung fällt das Firmenguthaben zu gleichen Teilen an den Schulverein und an<br />
die <strong>Schule</strong>.<br />
5.8. Zusammenarbeit mit externen Firmen/Stellen<br />
Es ist anzustreben, mit örtlichen Betrieben eine Kooperation zu vereinbaren. Ebenso bietet sich eine enge<br />
Zusammenarbeit mit der BBS z.B. bei der Produktentwicklung oder Produktionsplanung bereits im 8. Schuljahr an.<br />
6. Zur Praxis<br />
• Um eine ordentliche Buchführung sicherzustellen, müssen die Schülerinnen und Schüler einen Ordner zur<br />
Dokumentation anlegen. Alle Einkäufe, die sie tätigen, müssen mit einer Quittung nachgewiesen, alle<br />
Verkäufe mit einer Rechnung ausgestellt werden. Diese Belege müssen von den Lernenden mit einer<br />
fortlaufenden Belegnummer beschriftet und abgeheftet werden. In einer separaten Tabelle müssen sie<br />
zudem die Belegnummer, das Datum, den Betrag, den Posten und die Information, ob es sich um eine<br />
Einnahme oder Ausgabe handelt, eintragen. <strong>Am</strong> Ende eines jeden Abrechnungszeitraumes müssen die<br />
Schülerinnen und Schüler die Summe der Einnahmen und Ausgaben getrennt ermitteln und anschließend die<br />
Differenz bilden. So können sie feststellen, welchen Gewinn oder Verlust ihr Schülerbetrieb erwirtschaftet<br />
hat.<br />
• Jede Abteilung legt einen Ordner an, in dem alles Wichtige abgeheftet werden muss und nachgelesen werden<br />
kann. Darin muss auch eine Organisationsstruktur mit namentlich benannten Zuständigkeiten und ein<br />
Organisationsplan 11 enthalten sein.<br />
• Aus rechtlichen Gründen ist es notwendig, dass auf allen Dokumenten (Rechnungen, Quittungen, Prospekten,<br />
...) und an allen Verkaufsstellen deutlich darauf hingewiesen wird, dass es sich um einen Schulbetrieb<br />
handelt. Ebenso ist es notwendig, eine Internetpräsenz über die Schulhomepage zu gestalten.<br />
• Alle offiziellen Papiere müssen Namen, Adresse und Logo enthalten.<br />
• Alle schriftlichen Dokumente müssen als Original oder als Kopie abgeheftet werden (Postmappe).<br />
Empfehlenswert sind ein Unternehmensprospekt, Mitarbeiterausweise, Stempel und Geschäftspapier.<br />
• Das Unternehmensprospekt hilft dabei, Kontakte außerhalb der <strong>Schule</strong> herzustellen.<br />
• Die Schülerfirma ist gehalten, nachhaltig zu wirtschaften. Das bedeutet u.a. Ressourcen zu schonen, Müll zu<br />
vermeiden, gesunde Produkte anzubieten, ... .<br />
• Zu empfehlen ist eine Inventarliste. Vorher sollten alle Geräte und größeren Anschaffungen als Eigentum des<br />
Unternehmens, z.B. mit einem Aufkleber mit dem Firmenstempel darauf gekennzeichnet werden. Die Liste<br />
bietet stets einen Überblick über die Ausstattung des Unternehmens, zum anderen wird Diebstahl erschwert.<br />
10 Ggf. auch quartalsweise<br />
11 Anhang E<br />
- 9 -
Anhang<br />
A - Zeitlicher Ablauf der Einführung der Schülerfirma<br />
2. Halbjahr 2010/11<br />
� Klärung und Satzungsänderung mit dem Schulverein (s.o.)<br />
� Klärung der Organisationsstruktur (Wer macht wann was?)<br />
� Klärung von Zeitstruktur/Ablaufplan für das 1. Hj. 11/12<br />
� Information und Werbung bei den SuS der 8. H-Klassen<br />
� Festlegung der Arbeitsschwerpunkte<br />
� Benennung der beteiligten Lehrkräfte<br />
1. Halbjahr 2011/12<br />
� Erarbeitung der notwendigen Voraussetzungen und Strukturen innerhalb der Abteilungen<br />
� Beginn der eigentlichen Firmenarbeit<br />
2. Halbjahr 2011/12<br />
� Arbeit in der Schülerfirma<br />
� Vorbereitung der kompletten Integration des Schülerkiosk<br />
Schuljahr 2012/13<br />
� Ausweitung auf das 10. H-Schuljahr, Einstieg der neuen 9. Klassen, u.U. Ausweitung auf andere Schulzweige<br />
Schuljahr 2013/14<br />
� Ausweitung auf andere Schulzweige<br />
- 10 -
B - Modellhafter Ablauf eines Schuljahres<br />
Zeitraum Inhalt<br />
Verlaufsplan 1. Halbjahr<br />
Inhaltlicher Kommentar<br />
1.- 3. Woche � Einführung der SuS In die Schülerfirma. � Die Schüler entscheiden sich nach Vorstellung für eine Abteilung in der<br />
� Genaue Vorstellung der<br />
sie sich einbringen wollen.<br />
Arbeitsabteilungen.<br />
� Mit dem Wissen um vorhandene Kenntnisse und Fähigkeiten kann sich<br />
� Entscheidung der Schüler betreffend der die betreuende Lehrkraft vorbehalten, vereinzelten Schülern eine<br />
Abteilung, in der sie arbeiten wollen. Abteilung zu empfehlen.<br />
4. – 6. Woche � Die Schüler recherchieren in<br />
Die Recherche soll den Schülern bei der Umsetzung ihrer Entwürfe<br />
Katalogen und im Internet.<br />
sowie bei der darauffolgenden Produktion behilflich sein. Sofern es ein<br />
� Recherche bezüglich Farben und Lacke. Anliegen ist, die Spielsachen farblich zu gestalten, müssen sie sich über<br />
� Arbeitsbeginn der Designabteilung. den Einsatz von Farben und Lacken erkundigen, die nicht<br />
� Auseinandersetzung mit den<br />
gesundheitsschädlich sind.<br />
Anforderungen ihrer Arbeitsbereiche. � Die Designer der Firma stellen bereits erste Entwürfe vor.<br />
� Die Schüler werden mit ihrem Arbeitsbereich vertraut gemacht, dies<br />
dient dazu, ihnen eventuelle Unsicherheiten zu nehmen.<br />
6. Woche � Vortragen der gesammelten Ideen. � Nachdem alle Schüler Recherche betrieben haben erfolgt nun eine<br />
Auswahl darüber, welche Produkte umgesetzt werden sollen.<br />
7.- 14. Woche � Arbeitsbeginn in allen Abteilungen � Alle Abteilungen nehmen jetzt den normalen Betrieb auf.<br />
14. Woche<br />
� Erste Firmensitzung mit allen<br />
� Die Sitzung dient dazu, eventuelle Schwierigkeiten zu besprechen und<br />
Abteilungen/Vollversammlung<br />
Lösungsansätze zu finden. Weiterhin wird festgehalten, wie der<br />
Produktionsstand ist.<br />
15.-19. Woche � Fortsetzung der Arbeit in allen<br />
� In dieser Zeit ist insbesondere die Arbeit der Marketingabteilung<br />
Abteilungen<br />
gefragt. Ihre Aufgabe ist es, einen Termin zu finden, an dem die<br />
Holzspielzeuge der Öffentlichkeit präsentiert werden können. Dazu<br />
muss Werbung betrieben werden (Flyer, Plakate, Elternbriefe usw.).<br />
20. Woche<br />
� Präsentation der Produkte<br />
� Die Produkte werden einem breiten Plenum vorgestellt oder eventuell<br />
verkauft.<br />
Zeitraum Inhalt<br />
Verlaufsplan 2. Halbjahr<br />
Inhaltlicher Kommentar<br />
21. Woche � Firmensitzung mit allen<br />
� Die Schüler reflektieren die Arbeit aus dem letzten Halbjahr. Ideen zu<br />
Abteilungen/Vollversammlung<br />
neuen Entwürfen werden besprochen.<br />
22. – 29. Woche � Fortsetzung der Arbeit in allen<br />
Abteilungen<br />
29. Woche � Firmensitzung mit allen<br />
Abteilungen/Vollversammlung<br />
30. – 35.Woche � Fortsetzung der Arbeit in allen<br />
Abteilungen<br />
35. Woche � Firmensitzung mit allen<br />
Abteilungen/Vollversammlung<br />
36.-39. Woche<br />
40. Woche<br />
� Fortsetzung der Arbeit in allen<br />
Abteilungen<br />
� Präsentation und Verkauf<br />
� Die Arbeitsvorgänge laufen mittlerweile routinierter ab. Ebenfalls<br />
erfolgt eine verbesserte Kommunikation zwischen den einzelnen<br />
Abteilungen.<br />
� Die einzelnen Abteilungen insbesondere die Produktionsabteilung<br />
tragen ihre Ergebnisse vor.<br />
� Nach Feststellung, dass bereits schon einige Spielzeuge zum Verkauf<br />
bereitstehen (sofern im ersten Halbjahr nicht erfolgt), beginnt die<br />
Marketingabteilung mit der Werbung.<br />
� Die Schüler arbeiten in ihren Abteilungen. Die Lehrkraft kann sich<br />
immer mehr aus dem Geschehen zurückziehen.<br />
� Organisatorisch befasst sich diese Sitzung ausschließlich mit der<br />
Präsentation und dem Verkauf der neu entworfenen sowie der<br />
restaurierten Produkte. Die einzelnen Abteilungen geben Auskunft<br />
darüber, wie weit die Organisation fortgeschritten ist und was noch zu<br />
erledigen ist. Bevor der Verkauf startet, ist es das Ziel einen Film zu<br />
zeigen, der Aufschluss über die einzelnen Abteilungen und ihre<br />
Arbeitsprozesse gibt.<br />
� Die letzten Produkte werden fertiggestellt. Alle Abteilungen arbeiten<br />
auf die Präsentation und dem anschließenden Verkauf hin.<br />
� Die neu entstandenen und restaurierten Holzspielzeuge werden nach<br />
Ankündigung verkauft.<br />
� Die Schüler haben ihre Arbeit in der Schülerfirma erfolgreich beendet<br />
und bekommen dafür ein Zertifikat ausgestellt.<br />
- 11 -
C - Vereinbarung mit der Schulleitung zur Gründung einer Schülerfirma<br />
zwischen der <strong>Schule</strong> <strong>Am</strong> <strong>Dobrock</strong> vertreten durch Herrn/Frau ....................................................(Schulleiter/in)<br />
und der Schülerfirma ......................................vertreten durch Herrn/Frau............................................ und durch<br />
Herrn/Frau...........................................<br />
Inhalt und Grundsätze<br />
Die Vereinbarung regelt das Innenverhältnis zwischen der <strong>Schule</strong> und der Schülerfirma im Rahmen der Durchführung<br />
des Projektes. Die Gründung und Betreibung der Schülerfirma ist ein von dem Schulvorstand und der<br />
Gesamtkonferenz befürwortetes Projekt, das jeweils über einen Zeitraum von einem Schuljahr durchgeführt wird. Das<br />
Projekt zielt neben einer Orientierung der beteiligten Schülerinnen und Schüler auf Ausbildung und Beruf<br />
insbesondere auf die Entwicklung von Eigeninitiative, Eigenverantwortung und unternehmerischem Handeln.<br />
Vereinbarung<br />
1.Die Schülerfirma wird in weitestgehender Verantwortung der beteiligten Schüler betrieben. Als Ansprechpartner<br />
stehen den Schülern in beratender und unterstützender Funktion Herr/Frau..................................... und<br />
Herr/Frau............................... zur Verfügung.<br />
2. Die beteiligten Schüler informieren ihre Eltern über ihre Mitarbeit in der Schülerfirma.<br />
3. Der Schülerfirma erhält folgende Räumlichkeiten zur mietfreien, zweckgebundenen und weitgehend<br />
eigenverantwortlichen Nutzung: .......................................................................................................................................<br />
Der Schülerfirma wird zu folgenden Bedingungen ein Schlüssel übergeben: .....................................................................<br />
Die Reinigung der genannten Räumlichkeiten erfolgt durch: ..............................................................................................<br />
4. Die Versicherung des Eigentums der Schülerfirma (Inventar) erfolgt durch ....................................................................<br />
5. Für die Schülerfirma wird ein eigenes Girokonto eingerichtet, zu dem grundsätzlich Herr/Frau ...................................<br />
(Schüler/in), sowie Herr/Frau ................................ (Lehrkraft) gemeinsam zugangsberechtigt sind. Der Zahlungsverkehr<br />
wird von ihnen gemeinsam abgewickelt. Die Zeichnungsberechtigung liegt bei der Lehrkraft. Für das Konto wird kein<br />
Dispo-Kredit beantragt. Die Geschäfte in den Abteilungen werden von der Teamleitung gemeinsam getätigt.<br />
6. Über die o.g. Unterstützung hinaus stellt die <strong>Schule</strong> der Schülerfirma keine finanziellen Mittel zur Verfügung.<br />
7. Den Abteilungen wird vom Schulverein jährlich ein Startkapital von maximal 250 € zur Verfügung gestellt, das sie<br />
beim <strong>Führungsteam</strong> beantragen müssen. Das <strong>Führungsteam</strong> der Schülerfirma ist berechtigt, darüber hinaus Geschäfte<br />
und Verträge bis zu insgesamt 1000 € pro Schuljahr abzuschließen. Höher Ausgaben müssen im erweiterten<br />
<strong>Führungsteam</strong> beschlossen werden. Der Umsatz muss durch ein gewissenhaft zu führendes Kassenbuch nachweisbar<br />
sein.<br />
8. Die Schülerfirma macht bei allen Geschäften und Verträgen ihren Partnern gegenüber deutlich, dass es sich um eine<br />
Schüler-Firma und damit um ein Projekt der <strong>Schule</strong> handelt.<br />
9. Die <strong>Schule</strong> stellt allen Schülern, die in der Schülerfirma tätig waren, eine Bescheinigung bzw. Arbeitszeugnis über<br />
ihre Teilnahme aus.<br />
10. Die Vereinbarung wird für ein Jahr geschlossen.<br />
(Datum, Unterschriften)<br />
..............................(Schulleiter/in) .................................(Geschäftsführer/in) ................................. (Geschäftsführer/in)<br />
- 12 -
D – Arbeitsvertrag<br />
zwischen Schülerfirma: …………….............… und Mitarbeiter ………...............………...................…. Klasse ......…<br />
§ 1 Beginn des Arbeitsverhältnisses<br />
Das Arbeitsverhältnis beginnt am …………………… .<br />
Die Probezeit beträgt 4 Wochen.<br />
§ 2 Arbeitsleistung<br />
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, Aufgaben der Schülerfirma pünktlich und ordentlich zu erledigen. Wenn die<br />
Erledigung von Aufgaben nicht rechtzeitig und ordentlich erfolgt, der Schülerfirma Schaden entsteht und/oder das<br />
Arbeitsklima beeinträchtigt wird, erhält der Verursacher Verwarnungen bzw. Abmahnungen.<br />
§ 3 Arbeitszeit<br />
Die Arbeitszeit des Arbeitnehmers beträgt drei Stunden pro Woche, so dass bei Bedarf auch Arbeiten am Nachmittag<br />
bzw. am Wochenende möglich sind.<br />
§ 4 Vergütung<br />
Alle Mitarbeiter der Schülerfirma werden, wenn Gewinn entsteht am Ende eines Geschäftsjahres an einem Gewinn<br />
beteiligt (z.B. durch Ausflüge, Essen o.ä.).<br />
§ 5 Verwarnungen / Abmahnungen<br />
Wird eine vereinbarter Auftragstermin nicht eingehalten oder der Mitarbeiter fehlt unentschuldigt bei<br />
Firmensitzungen oder anderen Veranstaltungen gibt es eine Verwarnung, die schriftlich vermerkt wird. Nach zwei<br />
Verwarnungen erfolgt die Abmahnung. Nach zwei Abmahnungen erfolgt die Kündigung.<br />
§ 6 Urlaub/Beurlaubungen<br />
Der Urlaub für alle Mitarbeiter ist während der gesetzlichen Ferien- und Feiertage. Beurlaubungen von zusätzlichen<br />
Arbeitseinsätzen, z.B. bei Leistungsabfall in den Fächern, sind möglich und müssen rechtzeitig vorher beantragt<br />
werden.<br />
§ 7 Nebenbeschäftigung<br />
Nebenbeschäftigungen sind erlaubt, sofern sie der Schülerfirma nicht schaden.<br />
§ 8 Kündigung<br />
Der Ausstieg aus der Firma erfolgt über eine schriftliche Kündigung bei der Geschäftsführung. Die Kündigungsfrist<br />
beträgt 4 Wochen.<br />
Datum<br />
Unterschrift Mitarbeiter Unterschrift Geschäftsführung<br />
- 13 -
E - Organisationsplan der Abteilungen und Inventarliste<br />
Um die Schülerinnen und Schüler auch möglichst intensiv an den rechtlichen und organisatorischen Grundlagen der<br />
Schülerfirma zu beteiligen, geben sich die einzelnen Abteilungen im Rahmen dieses Grundlagenkonzeptes einen<br />
eigenen Organisationsplan. Darin müssen alle Regelungen zum internen Geschäftsablauf sowie Rechte und Pflichten<br />
der Mitarbeiter aufgeschrieben werden. Folgende Punkte könnten geregelt werden:<br />
- Name, Adresse, CI des Unternehmens<br />
- Unternehmensform<br />
- Gegenstand/Struktur der Abteilung<br />
- Startkapital/Zusatzkapital<br />
- Vollversammlung<br />
- Jahresabschluss / Gewinnverteilung<br />
Durch die gemeinsame Erarbeitung in den ersten Sitzungen können die Schüler selbst entscheiden, was ihnen am<br />
wichtigsten erscheint.<br />
Die Organisationspläne müssen vom <strong>Führungsteam</strong> genehmigt werden.<br />
F - Organisationsstruktur<br />
- 14 -
G - Entwurf eines Organigramms<br />
Die Schülerfirma: Firmenstruktur und Arbeitsbereiche<br />
In allen Entscheidungsgremien werden die Entscheidungen werden möglichst im Konsens,<br />
zumindest aber mehrheitlich getroffen. Alle Gremienmitglieder sind stimmberechtigt. Alle<br />
Gremienmitglieder werden aus der Mitte der absendenden Gruppe gewählt.<br />
Erweitertes <strong>Führungsteam</strong>: Schulverein (1) mit Vetorecht<br />
+ Schulleitung (1)<br />
+ <strong>Führungsteam</strong> (2 Lehrkräfte<br />
+ 2 Schülervertreter)<br />
Aufgaben: Festlegung der Ziele und Eckpfeiler aus schulischer Sicht<br />
Jahresplanung<br />
Investitionen<br />
Treffen: jährlich und bei Bedarf<br />
<strong>Führungsteam</strong>: 2 mitarbeitende Lehrer<br />
+ 2 Schüler aus den Leitungsteams<br />
Aufgaben: siehe Konzept<br />
Treffen: bei Bedarf, mindestens aber sechswöchig<br />
Teamleitung: 2 Schüler<br />
+ 1 Lehrer je Abteilung<br />
Aufgaben: abteilungsinterne Sach- und Personalfragen<br />
Repräsentation<br />
Vertretung der Abteilung<br />
Abteilungen: jeweils (3)5-8(10) Schüler (WPK/AG)<br />
Verwaltung Produktion und Verkauf<br />
(beispielhaft)<br />
- Personalmanagement - Kiosk<br />
- Logistik - Schmuck und Textilien<br />
- Buchhaltung - Fahrradwerkstatt<br />
- Marketing - Dienstleistungen<br />
- 15 -
H – Einbindungsmöglichkeiten der verschiedenen Fächer<br />
I – Übersicht<br />
J – Quellen<br />
Albrecht, Thjomas et al., Die Schülerfirma - http://www.al-hh-online.de/HuEAB-Schuelerfirma.pdf<br />
Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung e.V., Traumberuf Chef, 2009<br />
Konzept zur Schülerfirma, GHS Wietzendorf<br />
- http://www.ghs-wietzendorf.de/index.php?option=com_content&view=article&id=64:schuelerfirmen<br />
Konzept einer Schülerfirma an der HHS Moordorf - http://www.slh-moordorf.de/schulprogramm/schuelerfirmakonzept.htm<br />
Ostrowski, Sabine – Ausarbeitungen zum Thema Schülerfirmen, 2010<br />
Teamwork - Schülerfirma der HS Dissen - http://www.hsdissen.de/firma.htm<br />
- 16 -



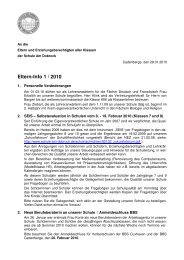

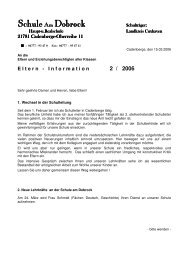
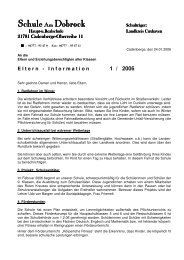
![Artikel der NEZ, 07.07.08 [263 KB] - Schule Am Dobrock](https://img.yumpu.com/26095670/1/184x260/artikel-der-nez-070708-263-kb-schule-am-dobrock.jpg?quality=85)

![Artikel der NEZ, 23.11.07 [180 KB] - Schule Am Dobrock](https://img.yumpu.com/26095667/1/184x260/artikel-der-nez-231107-180-kb-schule-am-dobrock.jpg?quality=85)
![Artikel der NEZ zur Ausstellung, 12.02.08 [16 KB] - Schule Am Dobrock](https://img.yumpu.com/26095665/1/184x260/artikel-der-nez-zur-ausstellung-120208-16-kb-schule-am-dobrock.jpg?quality=85)