Detaillierte Informationen zu den Beständen [ PDF , 2.162 kB
Detaillierte Informationen zu den Beständen [ PDF , 2.162 kB
Detaillierte Informationen zu den Beständen [ PDF , 2.162 kB
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
22<br />
ARCHIV<br />
Das Historische Archiv<br />
im Deutschen Technikmuseum<br />
s Zwischen 1997 und 2002 waren Archiv und Sammlung der AEG im Paketbahnhof<br />
untergebracht. Foto: Werner Mahler, Ostkreuz.<br />
Museen und Bibliotheken hat fast jeder<br />
schon einmal besucht. Spontan oder gut<br />
vorbereitet wer<strong>den</strong> Ausstellungshallen und<br />
Lesesäle ohne Zögern von <strong>den</strong> Besuchern<br />
betreten. Anders verhält es sich mit Archiven.<br />
Einerseits wer<strong>den</strong> sie in der Öffentlichkeit<br />
immer noch als verstaubte und antiquierte<br />
Einrichtungen hinter grauen Mauern<br />
wahrgenommen, in <strong>den</strong>en „spitzweghafte<br />
Sonderlinge“ ihrer eigenwilligen Beschäftigung<br />
nachgehen. Anderseits gelten sie als<br />
elitäre wissenschaftliche Institute, die nur<br />
einem kleinen Kreis von Insidern Zutritt gewähren.<br />
Auf diese noch weit verbreitete Unkenntnis<br />
über Aufgaben und Funktion von Archiven<br />
sowie darüber, was sich in ihnen an<br />
schriftlichen Quellen erhalten hat, ist wohl<br />
die Schwellenangst beim Besuch eines Archivs<br />
<strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>führen. In dem folgen<strong>den</strong><br />
Beitrag soll das Historische Archiv mit seinen<br />
vielfältigen Bestän<strong>den</strong> vorgestellt wer<strong>den</strong>.<br />
Bei einem hoffentlich unbefangenem<br />
Archivbesuch in der „Schatzkammer der<br />
Technik“ gibt es dann vieles von <strong>den</strong> Besuchern<br />
<strong>zu</strong> entdecken.<br />
Die Gründung<br />
Parallel <strong>zu</strong> <strong>den</strong> zahlreichen bundesrepublikanischen<br />
Museumsgründungen der späten<br />
1970er Jahre setzte unter <strong>den</strong> Archivaren<br />
eine breite Diskussion über <strong>den</strong> fachkundigen<br />
Erhalt und die professionelle<br />
Erschließung von Archivgut ein, welches<br />
sich außerhalb des Zugriffs der klassischen<br />
Staats-, Stadt-, Kirchen-, Wirtschafts- und<br />
Hochschularchive befand. In Kritik gerieten<br />
vor allem Bibliotheken und Museen, die<br />
unter Missachtung „des besonderen funktionalen<br />
Zusammenhangs des organisch<br />
gewachsenen Archivguts“ Archive und<br />
Nachlässe auflösten.<br />
Dies widersprach und widerspricht noch<br />
heute dem Provenienzgedanken, dem<br />
wichtigsten Ordnungsprinzip der modernen<br />
Archivwissenschaft. Es besagt, dass die<br />
übernommenen und <strong>zu</strong>meist nur als Unikate<br />
existieren<strong>den</strong> Dokumente entsprechend<br />
ihrer Herkunft möglichst in ihrem Entstehungs<strong>zu</strong>sammenhang<br />
<strong>zu</strong> belassen sind. Bei<br />
ihrer Erschließung gilt die Maxime, die<br />
„alte“ Ordnung <strong>zu</strong> bewahren bzw. wieder<br />
her<strong>zu</strong>stellen. Dahinter steht die Einsicht,<br />
DEUTSCHES TECHNIKMUSEUM BERLIN 5 | 2008<br />
dass diese Ordnung immer auch Informations-<br />
und damit Quellenwert besitzt und<br />
somit der wissenschaftlichen Forschung<br />
wichtige Erkenntnischancen bietet.<br />
Während der Archivar also versucht, <strong>den</strong><br />
vorgefun<strong>den</strong>en inhaltlichen Zusammenhang<br />
der Akten, Briefe, Aufzeichnungen<br />
etc. <strong>zu</strong> konservieren, stellen Bibliothekare<br />
oder Kusto<strong>den</strong> durch das Sammeln der<br />
prinzipiell mehrfach vorhan<strong>den</strong>en Bücher<br />
und Objekte <strong>den</strong> Zusammenhang erst her.<br />
Diese Ordnung einer Sammlung nach sachlichen<br />
Kriterien wird auch Pertinenzprinzip<br />
genannt.<br />
Vor dem Hintergrund dieser Diskussion<br />
und in Anbetracht der Tatsache, dass schon<br />
mit der Eröffnung des Museums umfangreiches<br />
Schriftgut <strong>zu</strong> übernehmen sein würde,<br />
sah die Vorlage des Senats von Berlin<br />
über die Errichtung eines Museums für Verkehr<br />
und Technik vom 23.4.1982 die Einrichtung<br />
eines Historischen Archivs (HA)<br />
vor. Unter der Verantwortung von Facharchivaren<br />
sollte das Archivgut erschlossen<br />
und Dritten <strong>zu</strong>gänglich gemacht wer<strong>den</strong>,<br />
damit das „Museum in die Funktion einer<br />
zentralen technikgeschichtlichen Informations-<br />
und Dokumentationsstelle hineinwachsen<br />
(könne).“<br />
Die Vorgängermuseen<br />
des DTMB<br />
Archive fallen weder vom Himmel noch<br />
schießen sie wie Pilze aus dem Bo<strong>den</strong>. Sie<br />
gehen vielmehr im Laufe vieler Jahre und<br />
Jahrhunderte aus <strong>den</strong> in Kellern oder auf<br />
Dachbö<strong>den</strong> abgelegten Papieren, <strong>den</strong> Altregistraturen,<br />
hervor. In ihnen fin<strong>den</strong> sich<br />
Briefe, Notizen, Protokolle und Verträge,<br />
gelegentlich auch Fotografien, technische<br />
Zeichnungen und Zeitungsausschnitte, auf<br />
die einst Behör<strong>den</strong>, Vereine sowie Privatpersonen<br />
<strong>zu</strong>r laufen<strong>den</strong> Erledigung des Alltagsgeschäftes<br />
<strong>zu</strong>rückgreifen mussten. Mit<br />
der Übernahme in ein Archiv wurde diesen<br />
Dokumenten ein besonderer, ein bleiben<strong>den</strong><br />
Wert <strong>zu</strong>erkannt.<br />
Bei der Eröffnung des ersten Museumsgebäudes<br />
auf der Industrie- und Verkehrsbrache<br />
in der Trebbiner Straße stand man<br />
in <strong>den</strong> neu geschaffenen Aktendepots<br />
<strong>zu</strong>nächst vor leeren Regalen. Wie die Objekte,<br />
so waren auch die Archivalien der<br />
großen technischen Vorläufermuseen in<br />
alle Winde zerstreut, galten als verschollen<br />
oder vernichtet. Als Traditions- bzw. Rechtsnachfolger<br />
nahm das DTMB die Spurensuche<br />
auch nach <strong>den</strong> schriftlichen Relikten<br />
seiner Vorgängereinrichtungen auf. Vieles<br />
konnte nach intensiven und langwierigen<br />
Recherchen in Museen, Privatsammlungen
DEUTSCHES TECHNIKMUSEUM BERLIN 5 | 2008<br />
und auf Trödelmärkten entdeckt und wieder<br />
nach Berlin <strong>zu</strong>rückgeführt wer<strong>den</strong>. So<br />
ist es heute möglich, sich einen wesentlichen<br />
Teil der Archivalien <strong>zu</strong>r Geschichte der<br />
Technischen Museen in Berlin im Lesesaal<br />
vorlegen <strong>zu</strong> lassen.<br />
Institut und Museum<br />
für Meereskunde (IMfM)<br />
Nach <strong>den</strong> ersten Bombenangriffen auf Berlin<br />
setzte 1943 die systematische Verlagerung<br />
der wertvollsten Bestände des Meereskundemuseums<br />
ein. Am Ende des Krieges<br />
waren wesentliche Teile des Museumsgebäudes<br />
zerstört und die Spuren <strong>zu</strong><br />
<strong>den</strong> verlagerten Exponaten und Archivalien<br />
verwischt. Erst die Gründung des DTMB<br />
wurde <strong>zu</strong>m Anlass genommen, <strong>den</strong> verschlungenen<br />
Weg der Sammlungen nach<strong>zu</strong>zeichnen.<br />
Am Ende der langwierigen<br />
Recherchen stand 1986 eine archivalische<br />
Bestandsbereinigung mit dem Altonaer<br />
Museum, wo wichtige Teile des Archivs<br />
nach Kriegsende Aufnahme gefun<strong>den</strong> hatten.<br />
Das knapp 8000 Aufnahmen (1870 –<br />
1940) umfassende Fotoarchiv sowie die aus<br />
über 400 Blatt bestehende Sammlung<br />
schiffsbautechnischer Zeichnungen (1740<br />
– 1945) des IMfM kehrten wieder nach Berlin<br />
<strong>zu</strong>rück. Nach 1989 ließ sich auch das<br />
Schicksal der Verwaltungsakten klären. Sie<br />
waren über verschie<strong>den</strong>e Stationen in das<br />
Archiv der Humboldt-Universität <strong>zu</strong> Berlin<br />
gelangt.<br />
Die Akten wur<strong>den</strong> mikroverfilmt und können<br />
seither mithilfe eines Lesegerätes im<br />
Lesesaal eingesehen wer<strong>den</strong>. Verschollen<br />
blieben bis heute die seinerzeit von <strong>den</strong><br />
Kusto<strong>den</strong> in <strong>den</strong> Sammlungen geführten<br />
Objektakten.<br />
Verkehrs- und Baumuseum<br />
(VBM)<br />
Ebenso wie ein großer Teil der Exponate<br />
hatten auch die Akten des Verkehrs- und<br />
Baumuseums <strong>den</strong> gut 40 Jahre währen<strong>den</strong><br />
Dornröschenschlaf in der Invali<strong>den</strong>straße<br />
ohne größere Verluste überstan<strong>den</strong>. In die<br />
Mühlen der Nachkriegsbürokratie von Ost<br />
und West geraten, blieb das Museum seit<br />
seiner kriegsbedingten Schließung 1943 für<br />
die Öffentlichkeit un<strong>zu</strong>gänglich. Erst mit<br />
dem Übergang des VBM an <strong>den</strong> Senat von<br />
Berlin im Zuge der S-Bahn-Verhandlungen<br />
öffneten sich 1984 wieder die Pforten des<br />
ehemaligen Hamburger Bahnhofs. In ihm<br />
hatten sich nahe<strong>zu</strong> vollständig die Bau- und<br />
Verwaltungsakten des Museums aus der<br />
Zeit von 1879 bis 1961 sowie ein über 1400<br />
Aufnahmen umfassendes Bildarchiv erhal-<br />
ten. Einen historischen Überblick über die<br />
Entwicklung der preußischen Eisenbahnund<br />
Bauverwaltung zwischen 1844 und<br />
1920 vermittelt die einzigartige Sammlung<br />
von ca. 1500 Lageplänen, Architektur- und<br />
technischen Zeichnungen. Mit einem Teil<br />
der großformatigen Pläne und Tafeln beteiligte<br />
sich das Ministerium für öffentliche<br />
Arbeiten an <strong>den</strong> Berliner Gewerbeausstellungen<br />
(1879 und 1896) wie an <strong>den</strong> Weltausstellungen<br />
in Chicago (1893), Brüssel<br />
(1897), Paris (1900), St. Louis (1904) und<br />
Mailand (1906).<br />
Deutsche Luftfahrtsammlung<br />
(DLS)<br />
Vollkommen ungeklärt blieb bisher das<br />
Schicksal der Akten der Deutschen Luftfahrtsammlung<br />
und ihrer bis in die frühen<br />
1920er Jahre <strong>zu</strong>rückreichen<strong>den</strong> Vorgängerinstitutionen.<br />
Das <strong>zu</strong>letzt im Glaspalast<br />
auf dem Gelände des Universum-Landes-<br />
Ausstellungsparks (ULAP) beheimatete<br />
Museum wurde im November 1943 durch<br />
Bombenangriffe vollständig zerstört. Der<br />
verschlungene und abenteuerliche Weg,<br />
<strong>den</strong> ein Teil der Luftfahrtzeuge nach ihrer<br />
kriegs-bedingten Verlagerung genommen<br />
hat, ließ sich inzwischen nachzeichnen.<br />
Welche wichtige Rolle bei dem Verlust der<br />
offiziellen Unterlagen eine Ersatzüberlieferung<br />
spielt, soll folgendes Beispiel deutlich<br />
machen.<br />
1992 wur<strong>den</strong> dem DTMB aus Italien Unterlagen<br />
<strong>zu</strong>r Geschichte der Deutschen Luftfahrtsammlung<br />
angeboten. Telefonische<br />
Nachfragen beim Anbieter, einem renommierten<br />
sizilianischen Künstler, ergaben,<br />
dass es sich bei <strong>den</strong> Dokumenten um <strong>den</strong><br />
Nachlass des Gründungsdirektors der Berliner<br />
Luftfahrtsammlung Georg Krupp handeln<br />
sollte. Der ehemalige Hauptmann der<br />
Fliegertruppe wurde 1936 entlassen, nachdem<br />
bei Dreharbeiten <strong>zu</strong> einem Fliegerfilm<br />
eine missbräuchlich genutzte Museumsmaschine<br />
<strong>zu</strong> Bruch gegangen war. Krupp<br />
schlug sich anschließend im schlesischen<br />
Bad Warmbrunn als Ingenieur durch, bis<br />
sich dort nach 1945 seine Spuren verloren.<br />
Der Sichtung der umfangreichen Sammlung<br />
in Palermo, bei der sich alle Angaben<br />
des Anbieters bestätigten, folgten langwierige<br />
Verkaufverhandlungen. Als diese<br />
schließlich erfolgreich abgeschlossen wer<strong>den</strong><br />
konnten und es galt, <strong>den</strong> Nachlass nach<br />
Berlin <strong>zu</strong> transportieren, stellte sich überraschend<br />
heraus, dass sich die Unterlagen<br />
nicht mehr in Palermo, sondern im polnischen<br />
Cieplice S’la¸ skie-Zdrój, dem vormaligen<br />
Bad Warmbrunn, befan<strong>den</strong>. Dort hat-<br />
Georg Krupp neben vielen persönlichen<br />
Unterlagen des Hauptmanns auch wesentliche<br />
Dokumente <strong>zu</strong>r Geschichte der DLS<br />
erhalten, die Eingang in das HA fan<strong>den</strong>.<br />
Nachlässe, Firmenarchive<br />
und Sammlungen<br />
Das Verwaltungsarchiv des DTMB mit <strong>den</strong><br />
Bestän<strong>den</strong> seiner Vorgängermuseen über-<br />
s Vorakte der Kgl. Eisenbahndirektion<br />
Berlin <strong>zu</strong>r Errichtung des Verkehrs-<br />
und Baumuseum, 1879.<br />
Foto: DTMB<br />
nimmt in erster Linie als Gedächtnisspeicher<br />
die wichtige Aufgabe der Rechtssicherung<br />
über längst abgeschlossene Vorgänge.<br />
Daneben besteht aber auch das Bedürfnis,<br />
in <strong>den</strong> Dauer- und Sonderausstellungen<br />
nicht nur die dreidimensionalen Objekte <strong>zu</strong><br />
präsentieren, sondern diese auch mit Fotos,<br />
Prospekten und Grafiken <strong>zu</strong> illustrieren<br />
bzw. sie in Beziehung <strong>zu</strong> Quellen wie Akten<br />
oder Briefe <strong>zu</strong> setzen. Um bei der Einrichtung<br />
der ersten Ausstellungsabteilungen<br />
auf einen entsprechen<strong>den</strong> Fundus an „Flachware“<br />
<strong>zu</strong>rückgreifen <strong>zu</strong> können, wurde eine<br />
Reihe herausragender Nachlässe und<br />
Sammlungen erworben, die die gewünschten<br />
Vorausset<strong>zu</strong>ngen erfüllten.<br />
Für <strong>den</strong> Bereich Schienenverkehr konnte<br />
die überaus facettenreiche Sammlung des<br />
Antiquars und Fachbuchautor Günther Metzeltin<br />
(1906–2004) erworben wer<strong>den</strong>. Er<br />
war Sohn des Ingenieurs Erich Metzeltin,<br />
dem langjährigen Direktor und Mitglied des<br />
Vorstandes der Hanomag in Hannover, dessen<br />
persönliche Aufzeichnungen die Grundlage<br />
der Sammlung bildeten.<br />
ten sich im ehemaligen Wohnhaus von ARCHIV<br />
23
24<br />
ARCHIV<br />
Die Entwicklungsgeschichte der deutschen<br />
Luftfahrt deckt umfassend bis in die späten<br />
1920er Jahre hinein der Nachlass des Fachbuchautors<br />
Willy Stiasny (1899–1954) ab.<br />
Er hatte schon als Kind begonnen, thematisch<br />
gegliederte und in Bän<strong>den</strong> <strong>zu</strong>sammengefügte<br />
Zeitungsausschnitte <strong>zu</strong>sammen<br />
<strong>zu</strong> stellen. Später war er als Archivar<br />
beim Deutschen Aero-Club, der Wissen-<br />
s Werbeplakat von 1936 für die<br />
Deutsche Luftfahrtsammlung<br />
auf dem ULAP-Gelände.<br />
Foto: DTMB<br />
schaftlichen Gesellschaft für Luftfahrt und<br />
<strong>zu</strong>letzt im Reichsluftfahrtministerium tätig.<br />
Mit der Geschichte der Schifffahrt beschäftigte<br />
sich Zeit seines Lebens der Neuköllner<br />
Kaufmann Thomas Wehde. Er hinterließ<br />
dem DTMB eine umfangreiche Sammlung<br />
von Stichen und Drucksachen, die vor allem<br />
seltene Darstellungen der Seefahrt seit dem<br />
späten 16. Jahrhundert enthält.<br />
Zu <strong>den</strong> Bestän<strong>den</strong> der ersten Stunde zählten<br />
auch einige Firmenarchive. Sie waren<br />
mit <strong>den</strong> musealen Sammlungen von Unternehmen<br />
verbun<strong>den</strong>, die die Aufbauarbeit<br />
des DTMB durch die Stiftung ihrer Akten<br />
und Objekte unterstützten. Eine zweite<br />
Quelle bildeten Insolvenzverwalter, die aus<br />
der Konkursmasse der ab<strong>zu</strong>wickeln<strong>den</strong> Firmen<br />
die wertvollsten Zeugnisse der Unternehmensgeschichte<br />
an <strong>den</strong> Meistbieten<strong>den</strong><br />
veräußerten. Zu <strong>den</strong> Firmenarchiven der<br />
ersten Gruppe zählt das als Schlüsselbestand<br />
<strong>zu</strong>r frühen Berliner Technik- und<br />
Industriegeschichte geltende Archiv der A.<br />
Borsig GmbH. Den zweiten Typus vertritt<br />
das Archiv der Zündapp-Apparate GmbH.<br />
Es dokumentiert die Wandlung eines am<br />
Ende des Ersten Weltkrieges gegründeten<br />
Rüstungsbetriebes hin <strong>zu</strong> einem der führen<strong>den</strong><br />
Zweiradherstellers Deutschlands. Nahe<strong>zu</strong><br />
lückenlos hat sich in Bild und Schrift die<br />
Dokumentation der vielfältige Produktpalette<br />
des Unternehmens von dessen Gründung<br />
im Jahre 1917 bis <strong>zu</strong>r Eröffnung des<br />
Konkursverfahrens 1984 erhalten.<br />
Ein wichtiges Bindeglied zwischen <strong>den</strong><br />
Archiven der Vorgängermuseum und <strong>den</strong><br />
während der Gründungsphase übernommenen<br />
Bestän<strong>den</strong> bildeten das Archiv und<br />
die archivischen Sammlungen des FDTM.<br />
Sie wur<strong>den</strong> <strong>zu</strong>sammen mit <strong>den</strong> Nachlässen<br />
wichtiger Vereinsmitglieder 1984 dem HA<br />
übergeben. Erst anhand der Akten des Fördervereines<br />
lässt sich nachvollziehen, welche<br />
Hindernisse es auf dem Weg hin <strong>zu</strong>r<br />
Wiedererrichtung eines technischen Museums<br />
in Berlin seit <strong>den</strong> frühen 1960er Jahren<br />
<strong>zu</strong> überwin<strong>den</strong> galt. Zu danken ist an<br />
dieser Stelle <strong>den</strong> Freun<strong>den</strong> und Förderern,<br />
die durch ihre zahlreichen Spen<strong>den</strong> <strong>den</strong><br />
weiteren Ausbau des HA unterstützt haben.<br />
Die intensive Erwerbungspolitik des DTMB<br />
während der stürmischen Auf- und Ausbaujahre<br />
ließen die Bestände in <strong>den</strong> Archivmagazinen<br />
rasch anwachsen. Profitieren<br />
konnte das HA dabei vor allem von <strong>den</strong> in<br />
ihren Fachbereichen national wie international<br />
hervorragend vernetzten Kollegen.<br />
So verfügt das HA über eine in dieser Fülle<br />
für <strong>den</strong> deutschsprachigen Raum einzigartige<br />
Sammlung von Nachlässen, Firmenarchiven,<br />
Fotografien und technischen Unterlagen<br />
<strong>zu</strong>r allgemeinen deutschen Luftfahrtgeschichte.<br />
Den Kern dieses Spezialbestandes<br />
bil<strong>den</strong> die herausragen<strong>den</strong> Nachlässe<br />
der bei<strong>den</strong> Luftfahrthistoriker, Sammler<br />
und Freunde Peter M. Grosz (1926–2006)<br />
und Neal O’ Connor (1925–2001).<br />
Von grundlegender Bedeutung für die<br />
Geschichte des Rundfunks wie der Nachrichtentechnik<br />
sind die Nachlässe des Physikers<br />
Robert v. Lieben (1878–1913) und<br />
des Fernsehpioniers Gerhart Goebel (1906–<br />
1995). Sie fan<strong>den</strong> <strong>zu</strong>sammen mit weiteren<br />
wichtigen Sammlungen über die Abteilung<br />
Nachrichtentechnik Eingang in das HA.<br />
Über die Abteilung Schienenverkehr erreichten<br />
eine Reihe kleinerer Nachlässe von<br />
Eisenbahnern, Fachbuchautoren und Ingenieuren<br />
sowie einige Fotosammlungen die<br />
Magazine. Einen besonderen Raum nimmt<br />
die wissenschaftliche Dokumentation <strong>zu</strong>r<br />
Entwicklung des deutschen und österreichischen<br />
Lokomotivbaus des Wiener Lokomotivkonstrukteurs<br />
und Hochschullehrers<br />
Adolph Giesl-Gieslingen (1903–1992)<br />
ein. Im Zusammenhang mit dem langjähri-<br />
DEUTSCHES TECHNIKMUSEUM BERLIN 5 | 2008<br />
gen Forschungsprojekt „Manufakturelle<br />
Schmuckproduktion“ der Abteilung Produktionstechniken<br />
konnten mehrere Nachlässe<br />
und Firmenarchive eingeworben wer<strong>den</strong>.<br />
Projekte<br />
Nach langwierigen Verhandlungen mit dem<br />
Vorstand der AEG fiel 1996 die endgültige<br />
Entscheidung, das Archiv und die museale<br />
Sammlung des Unternehmens dem DTMB<br />
<strong>zu</strong> übergeben. Damit sollte eines der<br />
bedeutendsten Archive der deutschen und<br />
speziell der Berliner Technik- und Wirtschaftsgeschichte<br />
an seinen Stammsitz <strong>zu</strong>rückkehren.<br />
Ausdrücklicher Wunsch des<br />
Vorstandes war es, die Bestände in Berlin<br />
einem breiten Publikum sowie Wissenschaft<br />
und Forschung <strong>zu</strong> öffnen.<br />
38 Fahrten waren nötig, um Akten und<br />
Exponate per Lkw-Gespann von Frankfurt/Main<br />
nach Berlin <strong>zu</strong> transportieren. Parallel<br />
hier<strong>zu</strong> wurde im HA eine vierköpfige<br />
Arbeitsgruppe <strong>zu</strong>r Erarbeitung eines Erschließungskonzeptes<br />
eingesetzt. Erfreulicher<br />
Weise konnte die Volkswagenstiftung-<br />
Stiftung für die finanzielle Förderung des<br />
Erschließungsprojektes gewonnen wer<strong>den</strong>.<br />
Dabei handelte es sich um ca. 6400 Aktenbände<br />
aus der Zeit zwischen der Gründung<br />
der Deutschen Edison-Gesellschaft für angewandte<br />
Elektricität 1884 (seit 1887 AEG)<br />
und der DM-Eröffnungsbilanz 1951. Ende<br />
2002 konnte das Projekt mit der Herausgabe<br />
des Findbuches erfolgreich abgeschlossen<br />
wer<strong>den</strong>.<br />
Der positive Verlauf des Erschließungsvorhabens<br />
bewog die EHG Elektroholding<br />
GmbH – sie verwaltet das Restgeschäft der<br />
AEG –, die Verzeichnung der noch nicht<br />
bearbeiteten Akten der Gesellschaft für<br />
drahtlose Telegraphie mbH (Telefunken)<br />
finanziell <strong>zu</strong> unterstützen. Mit der Erschließung<br />
wurde das Historische Forschungsinstitut<br />
Facts & Files aus Berlin beauftragt.<br />
2005 konnte das Findbuch vorgelegt wer<strong>den</strong>.<br />
Es dokumentiert in über 8000 Akten<br />
die Geschichte des Unternehmens von seiner<br />
Gründung 1903 bis <strong>zu</strong>m Stichjahr 1951.<br />
Weitere Unterstüt<strong>zu</strong>ng erfuhr das HA durch<br />
die Hans-Böckler-Stiftung, die die Sicherung<br />
und Erschließung der Unterlagen des<br />
Betriebsrates der AEG-Zentralverwaltung<br />
finanzierte.<br />
Als außergewöhnlicher Glücksfall für das<br />
HA erwies sich die Übernahme des Nachlasses<br />
des Industriephysikers Dr. Karl Mey<br />
(1879?). Nach dem Studium der Physik bei<br />
Erich Warburg trat er 1904 in die AEG ein<br />
und wurde dort im Alter von nur 30 Jahren<br />
Werksdirektor der Glühlampenfabrikation.
DEUTSCHES TECHNIKMUSEUM BERLIN 5 | 2008<br />
ARCHIV<br />
Nach dem Zusammenschluss der drei Glüh- verwaltet. In <strong>den</strong> <strong>zu</strong>rückliegen<strong>den</strong> Jahren Trust, London und „Modernism“ Corcoran<br />
lampenwerke AEG, Auergesellschaft und konnten 330 000 Datensätze eingearbeitet Gallery of Art Washington, gezeigt wer-<br />
Siemens & Halske <strong>zu</strong>r Firma Osram über- wer<strong>den</strong>, die, soweit dem keine daten<strong>den</strong>.nahm er auch dort sofort Führungsaufgarechtlichen Bestimmungen entgegenste- Eine derart intensive Nut<strong>zu</strong>ng der Archivben.<br />
1932 Jahre wurde ihm die Leitung des hen, für Recherchezwecke genutzt wer<strong>den</strong> bestände ist natürlich erst möglich, wenn<br />
gesamten Forschungsbereiches der Osram können. Daneben existieren weitere 35 000 <strong>zu</strong>vor die drei anderen archivischen Kern-<br />
KG übertragen. 1939 erfolgte seine Ernen- mit Bilddateien verbun<strong>den</strong>e Datensätze, die aufgaben Übernahme, Erhaltung und Ernung<br />
<strong>zu</strong>m Geschäftsführer von Telefunken die Suche nach Bildmotiven innerhalb der schließung erfüllt wur<strong>den</strong>. Wahrgenom-<br />
sowie 1940 die <strong>zu</strong>m stellvertreten<strong>den</strong> Vor- bisher erst <strong>zu</strong> kleinen Teilen erschlossenen men wer<strong>den</strong> diese Tätigkeiten in der breiten<br />
sitzen<strong>den</strong> der Geschäftsführung der Osram umfangreichen Bildarchive und grafischen<br />
KG. Gleichzeitig war er Mitglied in der Sammlungen ermöglicht.<br />
Deutschen Gesellschaft für technische Phy- Seit dem Be<strong>zu</strong>g des Neubaus 2002 ist die<br />
sik, die er 1919 mitbegründete, der Deut- Zahl der Archivbenutzer kontinuierlich geschen<br />
Physikalischen sowie der Deutschen wachsen. Trugen sich im Eröffnungsjahr<br />
Glastechnischen Gesellschaft. Der in dem bereits 459 Besucher in das Besucherbuch<br />
Nachlass enthaltene Schriftwechsel doku- ein, so waren es 2007 mit 872 Eintragunmentiert<br />
auf einzigartige Weise nicht nur gen fast doppelt so viele. Dabei ist die Zahl<br />
sein erfolgreiches Wirken innerhalb der Un- der ausgehobenen und anschließend wieternehmen<br />
AEG, Telefunken und Osram, der reponierten Archivalien in diesem Zeit-<br />
sondern auch seine gewichtige Einflussraum von 2000 auf 3544 angestiegen.<br />
nahme auf die Geschicke der wissenschaft- Die Anzahl der jährlich <strong>zu</strong> beantworteten<br />
lichen Gesellschaften.<br />
schriftlichen Anfragen ist inzwischen auf<br />
Anlässlich der Übergabe des Nachlasses mehr als 1100 angewachsen.<br />
gründete sein Sohn 2007 in Erinnerung an Das Spektrum der Themen, <strong>zu</strong> <strong>den</strong>en im<br />
das unternehmerische Werk seines Vaters HA gearbeitet wird, ist breit: es deckt neben<br />
die „Dr.-Karl-Mey-Stiftung“. Zweck der <strong>den</strong> klassischen Bereiche der Technik-, Wirt-<br />
Stiftung ist die Förderung von Publikationsschaft-, Sozialgeschichte sowie der Geund<br />
Erschließungsprojekten <strong>zu</strong>r Geschichschichts- und Kunstwissenschaften auch<br />
te von AEG-Telefunken. Gleichzeitig über- vielfältige heimat- und familienkundliche<br />
trug Dipl. rer. Pol. Karl Mey jun. dem HA Forschungen ab. Das Ergebnis dieser Arbei-<br />
auch seine persönlichen Papiere. In ihnen ten kann unter http://dtmberlin.interneto-<br />
spiegelt sich <strong>zu</strong>m einen die Reeducation-<br />
Politik der Alliierten in <strong>den</strong> frühen Nachkriegsjahren<br />
wider. Zum anderen dokumentiert<br />
sie bis in die 1980er Jahre die<br />
Geschichte des Berliner Traditionsunternehpac.de<br />
besichtigt wer<strong>den</strong>. Kombiniert man<br />
im Feld „Stichwort“ <strong>den</strong> Begriff „Archivbeleg“<br />
beispielsweise mit der Jahreszahl<br />
„2008“, dann erhält man eine Übersicht<br />
derjenigen Publikationen, die unter Ver-<br />
s Dr. Karl Mey war von 1939 bis 1945<br />
der Geschäftsführer des Unternehmens<br />
Telefunken.<br />
Foto: Frensdorf-Hoeland<br />
mens Gillette, in dem er in leitender Funkwendung von Archivalien des HA in die- Öffentlichkeit nicht. Anerkennung für ihr<br />
tion tätig war.<br />
sem Zeitraum entstan<strong>den</strong> sind. Bis heute Wirken hinter <strong>den</strong> Kulissen erhalten sie<br />
wur<strong>den</strong> 876 Monografien und Sonder- allenfalls von Fachkollegen. Daher sei an<br />
Nut<strong>zu</strong>ng<br />
drucke von <strong>den</strong> Archivbenutzern als Beleg dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen und Mit-<br />
Nach einer fünfzehnjährigen Planungs- und für genutzte Quellen der Bibliothek überarbeitern des HA gedankt, die mit tagtäg-<br />
Bauphase, die vor allem für das HA und lassen. Darüber hinaus ist das HA laufend lichem Engagement und Gleichmut da<strong>zu</strong><br />
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Leihgaben an zahlreichen Ausstellun- beitragen, Schicht für Schicht des immer<br />
immer wieder durch Provisorien und Begen im In- und Ausland beteiligt. Im <strong>zu</strong>rück- wieder nachwachsen<strong>den</strong> Altpapierbergs<br />
schränkungen bestimmt war, konnten 2001 liegen<strong>den</strong> Jahr konnte ein bunter Quer- ab<strong>zu</strong>tragen. Der gleiche Dank gilt auch <strong>den</strong><br />
schließlich die zweckmäßigen Büro- und schnitt aus <strong>den</strong> Bestän<strong>den</strong> in <strong>den</strong> Sonder- nahe<strong>zu</strong> einhundert Praktikanten, Volontä-<br />
Magazinräume im Servicetrakt des Neubaus ausstellungen „Karl May – Imaginäre Reiren, Stu<strong>den</strong>ten und Mitarbeitern öffentlich<br />
bezogen wer<strong>den</strong>. Sie bieten sowohl für die sen“ und „Gründerzeit. 1848–1871. Indu- geförderter Beschäftigungsprogramme.<br />
fachgerechte Magazinierung der Archivastrie & Lebensträume zwischen Vormärz<br />
JÖRG SCHMALFUß<br />
lien als auch <strong>zu</strong> deren Bearbeitung ideale und Kaiserreich“, beide Deutsches Histori-<br />
Bedingungen. Ausgezeichnete Arbeitsmögsches Museum, Berlin, „Peter Raacke: einlichkeiten<br />
existieren im neuen Leesaal auch fach modern“, Bauhausarchiv Berlin, „Ei-<br />
für die Besucher des Archivs. Neben Reaserne Zeiten“ und „Berlin im Licht“, beide<br />
derprintern, Kopierern und einer Medien- Stiftung Stadtmuseum Berlin, „Mark & Mestation,<br />
die das Abspielen nahe<strong>zu</strong> aller tropole in Potsdam 1908“, Haus für Bran-<br />
Audio- und Videoformate gestattet, eröff<strong>den</strong>burgische Geschichte, Potsdam, „1908<br />
nen die mit Rechnern ausgestatteten Re- – Von Abstraktion bis Zeppelinstiftung“,<br />
chercheplätze <strong>den</strong> Zugang <strong>zu</strong> <strong>den</strong> ver- Zeppelinmuseum Friedrichshafen, „Ganz<br />
zeichneten Bestän<strong>den</strong>. Sie wer<strong>den</strong> mithilfe Dame und doch Hausfrau“, Museum für<br />
der auch für <strong>den</strong> ungeübten Benutzer schnell Energiegeschichte(n), Hannover sowie<br />
<strong>zu</strong> bedienen<strong>den</strong> Archivsoftware „Augias“ „Sleeping & Dreaming“, The Wellcome<br />
25
26<br />
ARCHIV<br />
Institutionelles<br />
und privates<br />
Schriftgut<br />
Behördliches Schriftgut<br />
Schriftgut von Behör<strong>den</strong> wird im allgemeinen<br />
von <strong>den</strong> Landes- und Staatsarchiven<br />
übernommen. Deshalb findet sich im Archiv<br />
des Technikmuseums nur ein umfangreiches<br />
Aktenkonvolut aus dem im ehemaligen<br />
Hamburger Bahnhof untergebrachten<br />
Verkehrs- und Baumuseum. Es handelt sich<br />
um Erwerbungs- und Inventarisierungsakten<br />
sowie Akten <strong>zu</strong> Bauunterhaltung und<br />
Personal.<br />
Der Aktenbestand des ehemaligen Museums<br />
für Meereskunde wurde an die Humboldt<br />
-Universität <strong>zu</strong> Berlin abgegeben und<br />
kann im Archiv des Technikmuseums als<br />
Mikrofilm eingesehen wer<strong>den</strong>. Im Jahre<br />
1986 wur<strong>den</strong> im Zuge der Bestandsbereinigung<br />
vom Altonaer Museum in Hamburg<br />
ein umfangreicher Bildbestand und<br />
Technische Zeichnungen übergeben. 1991<br />
konnte ein Konvolut gerollte Zeichnungen<br />
vom Deutschen Historischen Museum in<br />
Berlin übernommen wer<strong>den</strong>.<br />
Zu <strong>den</strong> umfangreichen Bildbestän<strong>den</strong> des<br />
Verkehrs- und Baumuseums sowie des<br />
Museums für Meereskunde findet sich eine<br />
Beschreibung innerhalb der Fotosammlungen.<br />
s Modell des Dreimasters „Friedrich<br />
Wilhelm II.“<br />
Foto: DTMB<br />
Firmenarchive<br />
Da für Firmenarchive keine Abgabepflicht<br />
an ein staatliches Archiv besteht, sind viele<br />
in buchstäblich letzter Minute bei Verkauf<br />
oder Liquidation einer Firma in das Historische<br />
Archiv des Deutschen Technikmuseums<br />
gelangt oder wur<strong>den</strong> als Depositum<br />
hinterlegt. Es verwahrt 80 Firmenarchive,<br />
von <strong>den</strong>en 30 bereits erschlossen sind.<br />
Einer der bedeutendsten Bestände im<br />
Bereich der Firmenarchive ist das Archiv der<br />
Borsig AG mit Unterlagen <strong>zu</strong>r Firmen- und<br />
Familiengeschichte von der Gründung 1837<br />
bis ins Jahr 1967. Kernstück ist die 1930/31<br />
<strong>zu</strong>sammengestellte Sammlung von 282<br />
Dokumenten <strong>zu</strong>r Geschichte der Familie<br />
und der Firma Borsig. Durchweg im Original<br />
enthalten sind die Unterlagen <strong>zu</strong> <strong>den</strong><br />
Mitgliedern der Familie Borsig beginnend<br />
bei August Borsig bis <strong>zu</strong> <strong>den</strong> Brüdern Ernst<br />
und Conrad von Borsig. Ebenso gehören<br />
umfangreiche Bildbestände <strong>zu</strong>m Borsig-<br />
Bestand.<br />
Ebenfalls <strong>zu</strong> dem Bereich Lokomotiv- und<br />
Maschinenbau gehört das Firmenarchiv<br />
der Berliner Maschinenbau AG vormals<br />
L. Schwartzkopff mit <strong>den</strong> Lokomotivlieferlisten<br />
von 1867–1923 und dem Fotoalbum<br />
mit Ansichten der Fabrik in der Chausseestraße,<br />
aufgenommen durch <strong>den</strong> Hoffotografen<br />
E. A. Schwartz.<br />
Aus dem Bereich Luftfahrt ist das Archiv<br />
des Mittler-Verlages besonders erwähnenswert<br />
mit zahlreichen Fotografien und<br />
Handbüchern deutscher Flugzeugwerke.<br />
Interessant speziell <strong>zu</strong>r Berliner Geschichte<br />
ist das Archiv der Meierei Carl Bolle mit<br />
zahlreichen Unterlagen und Fotografien <strong>zu</strong>r<br />
s Der Stammbaum der Familie Borsig<br />
aus dem 19. Jahrhundert.<br />
Foto: DTMB.<br />
DEUTSCHES TECHNIKMUSEUM BERLIN 5 | 2008<br />
Milchverwertung und -versorgung Berlins<br />
sowie der späteren Filialkette Bolle.<br />
Einen guten Einblick in die Schifffahrtsgeschichte<br />
Berlins gibt das Firmenarchiv der<br />
Teltowkanal AG und Stern- und Kreisschifffahrt<br />
mit zahlreichen Unterlagen <strong>zu</strong><br />
Passagierschiffen, Fahrplänen und vielen<br />
Fotografien der bekannten Reederei.<br />
Aus dem Bereich Straßenverkehr sind bereits<br />
erschlossen das Zündapp-Archiv mit<br />
technischen <strong>Informationen</strong>, Prospekten und<br />
Fotografien <strong>zu</strong> <strong>den</strong> Produktionsbereichen<br />
Motorrad, Klein-Pkw, Motor, Nähmaschine<br />
und Rasenmäher und das Archiv der Bielefelder<br />
Fahrrad- und Motorradfabrik Rixe &<br />
Co., einer Fahrrad- und Motorradfabrik.<br />
Wegen seiner herausragen<strong>den</strong> Bedeutung<br />
wird das Firmenarchiv von AEG-Telefunken<br />
in einem separaten Abschnitt beschrieben.<br />
Verbände und Vereine<br />
Verbände und Vereine können selbst entschei<strong>den</strong>,<br />
ob sie ihre Archivalien verwalten<br />
oder an ein Archiv abgeben. Deshalb ist die<br />
Anzahl von Bestän<strong>den</strong> im Deutschen Technikmuseum<br />
Berlin auch eher gering. Hervor<strong>zu</strong>heben<br />
ist das Archiv der Buchbinderinnung<br />
Berlin. Das älteste Stück ist eine Liste<br />
der Berliner Buchbindermeister, beginnend<br />
im Jahr 1605. Darin ist auch ein Erlass vom<br />
Jahr 1812 <strong>zu</strong>r Einstellung jüdischer Lehrlinge<br />
und Gesellen enthalten. Zahlreiche Fotografien<br />
und einige Objekte wie die originale<br />
Obermeisterkette run<strong>den</strong> <strong>den</strong> Bestand<br />
ab.<br />
Nicht sehr umfangreich, aber sehr interessant<br />
ist das Archiv der Gesellschaft für Welt-<br />
s Mitgliederverzeichnis der Buchbinderinnung<br />
Berlin.<br />
Foto: DTMB
DEUTSCHES TECHNIKMUSEUM BERLIN 5 | 2008<br />
s Werbung für Fahrten mit der Berliner S-Bahn aus dem Jahr<br />
1958. Foto: DTMB<br />
raumforschung e.V. Die Gesellschaft wurde<br />
1948 in Stuttgart gegründet. Ihre Ziele reichen<br />
von breiter Öffentlichkeitsarbeit für<br />
die Raumfahrt über populärwissenschaftliche<br />
Veröffentlichungen bis <strong>zu</strong> internationaler<br />
Zusammenarbeit aller an der Raumfahrt<br />
Interessierter. Der dem Archiv vom<br />
Mitbegründer Prof. Heinz-Hermann Koelle<br />
geschenkte Bestand setzt sich aus Druckschriften<br />
der Gesellschaft und <strong>den</strong> Sammelbüchern<br />
<strong>zu</strong>sammen, die <strong>den</strong> gesamten<br />
Schriftverkehr enthalten.<br />
2005 wurde dem Archiv als Dauerleihgabe<br />
das Archiv des Verbandes der Bahnindustrie<br />
in Deutschland übergeben. Der<br />
Bestand enthält überwiegend Unterlagen<br />
nach 1945 wie Korrespon<strong>den</strong>z, Niederschriften<br />
der Mitgliederversammlungen und<br />
Geschäftsberichte. Von besonderer Bedeutung<br />
sind die Kriegstagebücher aus dem<br />
Zweiten Weltkrieg. Sowohl der Hauptausschuss<br />
Lokomotiven als auch die verschie<strong>den</strong>en<br />
Arbeitsausschüsse und die Verbandsmitglieder<br />
waren angehalten, über<br />
ihre Produktion während des Krieges Tagebuch<br />
<strong>zu</strong> führen. Kriegstagebücher der Berliner<br />
Maschinenbau AG, der Borsig Lokomotivwerke<br />
GmbH, der Henschel & Sohn<br />
GmbH, der Arnold Jung GmbH, der F. Schichau<br />
AG und anderer Lokomotivfabriken<br />
sind im Bestand enthalten.<br />
Nachlässe<br />
Der Bereich besteht <strong>zu</strong>r Zeit aus 250 Nachlässen<br />
und Sammlungen aus <strong>den</strong> unterschiedlichsten<br />
Bereichen. Der größte Teil<br />
der bereits verzeichneten Nachlässe kommt<br />
aus dem Bereich Luftfahrt, da im Vorfeld<br />
der Eröffnung der neuen Luftfahrtabteilung<br />
im Neubau gezielt gesammelt wurde und<br />
die Bestände per Werkvertrag gleich ver-<br />
zeichnet wer<strong>den</strong> konnten. Erwähnt seien<br />
hier die Sammlung Stiasny mit zahlreichen<br />
Unterlagen <strong>zu</strong>r frühen Luftschifffahrt und<br />
Luftfahrt und die Sammlungen Neil O´Connor<br />
und Peter Grosz mit Fotografien und<br />
Dokumenten speziell <strong>zu</strong>r Geschichte des<br />
Ersten Weltkrieges. Viele Dokumente wie<br />
Flugbücher, Soldbücher und Tagebücher<br />
aus <strong>den</strong> inzwischen über 60 Nachlässen von<br />
Fliegern beider Weltkriege sind in der Ausstellung<br />
<strong>zu</strong>r Luftfahrt im Neubau <strong>zu</strong> sehen.<br />
Aus dem Bereich Schienenverkehr sind<br />
die großen Sammlungen von Günther Metzeltin<br />
und dem Lokomotivkonstrukteur<br />
Giesl-Gieslingen sowie Personennachlässe<br />
vom Bahnbeamten bis <strong>zu</strong>m Reichsbahnpräsi<strong>den</strong>ten<br />
Werner Usbeck <strong>zu</strong> nennen. In<br />
Berlin sehr bekannt war Friedrich Kittlaus,<br />
der von 1949–1973 Direktor der S-Bahn<br />
war. Er organisierte mit großem Geschick<br />
<strong>den</strong> S-Bahnverkehr in bei<strong>den</strong> Teilen Berlins,<br />
was sich eindrucksvoll in <strong>den</strong> Dokumenten<br />
seines Nachlasses widerspiegelt.<br />
Zum Bereich Nachrichtentechnik gehören<br />
u. a. die Sammlungen des Fernsehpioniers<br />
Goebel und der Nachlass des Erfinders<br />
Robert von Lieben. Die Frühzeit des Nachkriegsfernsehens<br />
spiegelt sich im Nachlass<br />
von Karl Hermann Joksch, der als Bühnenbildner<br />
zahlreiche Kulissen für die Produktionen<br />
des NWDR und später beim NDR<br />
gestaltete. Sein Nachlass umfasst ca. 1500<br />
Fotografien und zehn Bände mit Skizzen<br />
und Entwürfen <strong>zu</strong> Bühnenbildern der verschie<strong>den</strong>sten<br />
Fernsehproduktionen, teilweise<br />
mit bekannten Schauspielern der<br />
damaligen Zeit.<br />
Große Bedeutung hat auch die Quellensammlung<br />
<strong>zu</strong>r Geschichte der Technik des<br />
Technikhistorikers, Schriftstellers und Archivars<br />
Franz Maria Feldhaus. Recht skurril ist<br />
s Flugzeugführerschein für Eindecker von Georg Braumüller.<br />
Foto: DTMB<br />
der Nachlass des Ingenieurs und Erfinders<br />
Otto Schmerenbeck, der, allerdings recht<br />
erfolglos, versuchte, seine Erfindungen wie<br />
eine Bade-Tret-Brause oder eine Maschinengewehr-Verschwindekabine<br />
<strong>zu</strong> vermarkten.<br />
Urkun<strong>den</strong><br />
Zu <strong>den</strong> Urkun<strong>den</strong> gehören Lehrbriefe, Meisterbriefe<br />
und Zeugnisse der verschie<strong>den</strong>en<br />
Gewerke wie Schlosser, Maler, Tischler,<br />
Schneider etc. Der älteste Meisterbrief ist<br />
auf <strong>den</strong> Samt- und Sei<strong>den</strong>wirker Natusius<br />
in Berlin ausgestellt und stammt von 1796.<br />
Eine weitere große Gruppe bil<strong>den</strong> die Reisepässe.<br />
Bei dem frühesten hier vorhan<strong>den</strong>en<br />
Reisepass handelt es sich um einen<br />
1810 vom Preußischen Polizeipräsidium in<br />
Berlin für <strong>den</strong> Schneidergesellen Carl Ulrich<br />
ausgestellten Pass. Der erste hier archivierte<br />
Pkw-Führerschein von 1907 ist auf eine<br />
Frau Anna Weber aus Berlin ausgestellt.<br />
Grafisch besonders aufwändig gestaltet<br />
sind die <strong>zu</strong> Dienstjubiläen und Geburtstagen<br />
ausgefertigten Ehrenurkun<strong>den</strong>. Die<br />
Spanne reicht von vorgedruckten Urkun<strong>den</strong><br />
bis <strong>zu</strong> künstlerisch gestalteten und mit<br />
Be<strong>zu</strong>g auf <strong>den</strong> Jubilar handgefertigten Exemplaren<br />
wie z. B. die Urkunde <strong>zu</strong>m 50. Geburtstag<br />
von Arthur Müller (Inhaber u.a.<br />
der Ambi-Werke und Mitbegründer des<br />
Flughafens Johannisthal) oder die Urkunde<br />
<strong>zu</strong>m 25jährigen Dienstjubiläum des Oberwerkmeisters<br />
bei der Reichsdruckerei in Berlin<br />
Otto Bastian.<br />
Die Sammlung enthält <strong>zu</strong>r Zeit 850 verzeichnete<br />
Einheiten des Zeitraums von<br />
1800–2000 aus sämtlichen Technikbereichen<br />
und wird ständig durch Ankäufe oder<br />
Schenkungen ergänzt.<br />
27<br />
ARCHIV<br />
URSULA SCHÄFER-SIMBOLON
28<br />
ARCHIV<br />
Sondersammlungen<br />
Firmenschriften<br />
Unter dem Begriff Firmenschriften wird das<br />
von <strong>den</strong> Unternehmen herausgegebene<br />
Schriftgut <strong>zu</strong>sammengefasst. Es handelt<br />
sich hierbei um Druckschriften und Musterbücher,<br />
die entweder <strong>den</strong> Geschäfts- und<br />
Werdegang der entsprechen<strong>den</strong> Firma darstellen,<br />
Werbezwecken dienen oder die<br />
jeweiligen Produkte und deren Gebrauch<br />
beschreiben. Da Archive und Bibliotheken<br />
Firmenschriften immer noch <strong>zu</strong>r „grauen Literatur“<br />
zählen und sich über Verzeichnungsfragen<br />
bisher nicht einigen konnten,<br />
hat das Deutsche Technikmuseum Berlin<br />
eine willkürliche Trennung innerhalb von<br />
Bibliothek und Archiv vorgenommen. Selbstdarstellungen<br />
und Monografien wer<strong>den</strong> in<br />
der Bibliothek aufbewahrt. Produktwerbung<br />
von Firmen der verschie<strong>den</strong>sten Produktionsbereiche<br />
gehört ins Archiv, wobei<br />
immer Überschneidungen möglich sind. Die<br />
Sondersammlung Firmenschriften im Historischen<br />
Archiv beinhaltet ca. 60 000 Musterbücher,<br />
Produktbeschreibungen, Preislisten,<br />
Ersatzteillisten, Handbücher sowie<br />
Betriebs-, Reparatur- und Wartungsanleitungen,<br />
enthält aber auch einige Betriebsordnungen,<br />
Kun<strong>den</strong>dienstbelege und Jubiläumsschriften.<br />
Die Sammlung wurde ins-<br />
Werbeblatt der Firma Osram für Nitra-<br />
Glühlampen. Foto: DTMB<br />
gesamt systhematisch und <strong>zu</strong> einem großen<br />
Teil in Einzelverzeichnung erschlossen, so<br />
dass gezielt <strong>zu</strong> diversen Themen recherchiert<br />
wer<strong>den</strong> kann. Die vielfältigen Sammelgebiete<br />
erstrecken sich über die meisten<br />
<strong>den</strong>kbaren Alltags- und Technikbereiche<br />
in der Zeit zwischen 1828 bis 2006.<br />
Allgemeiner Schwerpunkt ist die Zeitspanne<br />
von 1900 bis 1965. Es gibt Druckschriften<br />
von Firmen aus ganz Deutschland, Europa<br />
und sogar weltweit. Ein bevor<strong>zu</strong>gter<br />
Sammelauftrag gilt für die Standorte Berlin<br />
und angrenzende Gebiete mit etwa 8000<br />
bisher verzeichneten Schriften sowie die<br />
preußischen Provinzen. Eines der ältesten<br />
Stücke unserer Sammlung ist ein bemerkenswertes<br />
Kunstguß-Musterbuch der Königlichen<br />
Eisengießerei <strong>zu</strong> Berlin aus dem<br />
Jahre 1828. Es zeigt 12 Kolossalstatuen, die<br />
für das National<strong>den</strong>kmal auf dem Kreuzberg<br />
gefertigt wur<strong>den</strong>. Die Skulpturen sind<br />
als Genien gestaltet und stehen für die<br />
<strong>den</strong>kwürdigsten Schlachten dieser Zeit.<br />
Anhand von Firmenschriften lässt sich die<br />
historische und technologische Entwicklung<br />
bestimmter Produkte und einzelner Industriezweige<br />
nachvollziehen. Sie sind oft die<br />
einzigen noch vorhan<strong>den</strong>en authentischen<br />
Nachweise und wer<strong>den</strong> häufig für komplexe<br />
Recherchen, sowohl national als auch<br />
international genutzt. Sie sind u. a. Quellen<br />
für Ausstellungen, Forschungsprojekte,<br />
Restaurierungen, Diplomarbeiten und<br />
Dissertationen. Ein für die Firmenschriftensammlung<br />
untypisches aber repräsentatives<br />
Nut<strong>zu</strong>ngsbeispiel war die im Jahr 2005<br />
stattfin<strong>den</strong>de Kunstausstellung „Modernism.<br />
Designing a New World. 1914–1939“<br />
des Victoria & Albert Museums in London.<br />
s Werbeprospekt <strong>zu</strong> Helios<br />
Autobeleuchtungen. Foto: DTMB<br />
DEUTSCHES TECHNIKMUSEUM BERLIN 5 | 2008<br />
Dort wur<strong>den</strong> Bilder aus einem der Werbeprospekte<br />
<strong>zu</strong>m Volkswagen ausgestellt und<br />
auch auf der 2006 nachfolgen<strong>den</strong> europäischen<br />
Wanderausstellung gezeigt.<br />
Einen Sammlungsschwerpunkt bil<strong>den</strong> die<br />
Schriften der Firma Carl Zeiss Jena mit 1307<br />
Stück <strong>zu</strong> optischen Geräten im Zeitraum<br />
1864 bis 1980 und die der Nachfolgefirma<br />
Carl Zeiss Oberkochen mit 814 Stück zwischen<br />
1953 und 1980. Mit vielen Preislisten<br />
und Musterbüchern <strong>zu</strong> Beleuchtungsmitteln,<br />
u. a. <strong>zu</strong> Osram-Lampen oder <strong>den</strong><br />
Taschenlampen der Firma Oskar Böttcher<br />
GmbH, ist die Lichttechnik ein weiterer thematischer<br />
Schwerpunkt. Hervor<strong>zu</strong>heben<br />
sind etwa 200 Kataloge <strong>zu</strong> Kraftfahrzeugbeleuchtungen<br />
mit Jugendstil-Darstellungen<br />
um 1905 bis 1915. Komplexe innerhalb<br />
der Sammlung bil<strong>den</strong> die Berliner Maschinenbaufirma<br />
Ludw. Loewe mit 224 Schriften,<br />
aber auch die Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Aktiengesellschaft,<br />
Bamag, mit<br />
40 Prospekten. Ein Großteil des umfangreichen<br />
Sammlungsteils <strong>zu</strong> Straßenfahrzeugen<br />
aus <strong>den</strong> 1930er bis 1980er Jahren<br />
wurde vom Fachjournalisten Winkler<br />
<strong>zu</strong>sammengetragen. Weiterhin wird die<br />
Sammlung durch eine große Anzahl von<br />
Katalogen der Lokomotiv- und Waggonhersteller<br />
bereichert, so auch von 235 aus<br />
dem Firmenarchiv A. Borsig, Berlin-Tegel,<br />
darunter auch von Kältemaschinen. Die<br />
deutschen Flugzeug- bzw. Flugmotorenhersteller<br />
um 1910 bis <strong>zu</strong>m Zweiten Weltkrieg<br />
sind mit einer Fülle von Material vertreten,<br />
stellvertretend für viele andere wer<strong>den</strong><br />
hier Argus, Junkers und Rumpler genannt.<br />
Einige thematische Sammlungen<br />
sind über Interimsverzeichnisse grob erschlossen.<br />
Einen umfangreichen Komplex<br />
bildet die Privatsammlung Janert mit überwiegend<br />
europäischer und japanischer Kraftfahrzeugwerbung<br />
der 1950er–1980er Jahre.<br />
Erwähnenswert ist auch die Sammlung<br />
Stroekens <strong>zu</strong> verschie<strong>den</strong>en Bereichen der<br />
Schwachstrom- und Nachrichtentechnik.<br />
Die 1996 über Lottomittel erworbene große<br />
Sammlung „Ariel Cinematographica“, vom<br />
gleichnamigen Sammler Pete Ariel, dokumentiert<br />
entsprechende Geräte und Zubehör.<br />
Überwiegend Werbung <strong>zu</strong>r Unterhaltungselektronik<br />
der 1970er und 1980er<br />
Jahre enthält die von der Landesbildstelle<br />
Berlin übernommene Schriftensanmmlung<br />
<strong>zu</strong>r Kommunikationstechnik. Maschinen<br />
<strong>zu</strong>m Produktionsbereich Ziegel/Ziegeleien<br />
der ehemaligen DDR sind in der Sammlung<br />
Leonhardt <strong>zu</strong> fin<strong>den</strong>.<br />
WALTRAUD FRICKE
DEUTSCHES TECHNIKMUSEUM BERLIN 5 | 2008<br />
Reiseprospekte<br />
Das Sondersammelgebiet der Reiseprospekte<br />
umfasst ca. 10 000 Stück. Es teilt<br />
sich in verschie<strong>den</strong>e Untergruppen vom<br />
Ende des 19. Jahrhunderts bis 1945 (VBM)<br />
bzw. beim Rest bis in die heutige Zeit. So<br />
gehören Angebote von Reiseveranstaltern<br />
ebenso <strong>zu</strong> der Sammlung wie Speisekarten,<br />
Orts- und Hotelprospekte, Zugbegleiter<br />
und Fahrpläne von Bahn-, Bus- und Flugverbindungen.<br />
Den Grundstock der Sammlung<br />
bil<strong>den</strong> die 1472 Reiseprospekte des<br />
ehemaligen Verkehrs- und Baumuseums<br />
(VBM). Weitere größere Konvolute sind Teile<br />
der Sammlung Metzeltin und der Sammlung<br />
Böhm.<br />
Bei dem ältesten Dokument handelt es<br />
sich um einen Schiffsprospekt aus dem<br />
Jahre 1892 (VBM), bei dem jüngsten um<br />
einen Prospekt aus dem Jahre 2001. Geografisch<br />
gesehen bildet der deutsche bzw.<br />
deutschsprachige Raum die größte Gruppe<br />
neben Prospekten aus <strong>den</strong> klassischen Reiseländern<br />
Europas und einigen aus Übersee.<br />
Anhand des Bestandes lässt sich die<br />
Entwicklung des Tourismus von <strong>den</strong> Anfängen<br />
am Ende des 19. Jahrhunderts bis in die<br />
zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts einigermaßen<br />
verfolgen. Parallel <strong>zu</strong> der technischen<br />
Entwicklung im Bereich Verkehr und<br />
Transport gab es auch die Fortentwicklung<br />
der allgemeinen sozialen und wirtschaftlichen<br />
Verhältnisse: Bessere Urlaubs- und<br />
Freizeitregelungen ermöglichten immer<br />
mehr Menschen <strong>den</strong> Aufenthalt in Ferienorten,<br />
um sich dort <strong>zu</strong> erholen und Land<br />
und Leute kennen <strong>zu</strong> lernen; an die Stelle<br />
des bloßen „Irgendwohinfahrens“ trat das<br />
Erlebnis des Reisens. Am Beginn des modernen<br />
Tourismus stan<strong>den</strong> noch die althergebrachten<br />
Beförderungsmittel wie die Küstenschifffahrt<br />
und die Eisenbahnen. Zunächst<br />
noch auf <strong>den</strong> regionalen Rahmen<br />
beschränkt, verlagerte sich dies auch immer<br />
mehr in die klassischen Reiseregionen in<br />
Europa, wie Italien und <strong>den</strong> Mittelmeerraum<br />
generell. Die Reiseprospekte in der<br />
Sammlung spiegeln diese Aspekte deutlich<br />
wider. Anfänglich mehr Hotellisten oder<br />
Fahrpläne, wer<strong>den</strong> sie <strong>zu</strong>nehmend durch<br />
grafische Mittel ansprechend gestaltet und<br />
so <strong>zu</strong> einem Werbemittel, das nicht nur<br />
nüchtern informieren, sondern auch die<br />
Phantasie oder Abenteuerlust des Reisewilligen<br />
anregen will. Trotz aller Liberalisierung<br />
und Verbesserung der allgemeinen<br />
Lebensumstände war das Reisen in der<br />
ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts (und<br />
dieser Zeitraum ist innerhalb der Sammlung<br />
am besten erschlossen) immer noch ein Privileg<br />
der begüterten Schichten der Bevöl-<br />
s Deckblatt für einen Reiseprospekt<br />
der Lufthansa, 1937. Foto: DTMB<br />
kerung. Heute ist der Drang in die Ferne<br />
selbstverständlich und man muss eine Abenteuerreise<br />
gezielt buchen; vor 100 Jahren<br />
war jede Reise immer auch ein wenig Abenteuerreise.<br />
Die Reiseprospektsammlung des VBM ist<br />
vollständig mit Hilfe der EDV erschlossen<br />
wor<strong>den</strong>, wobei auch hier fortlaufend digitale<br />
Abbildungen in die Datensätze eingebun<strong>den</strong><br />
wer<strong>den</strong>. Die restlichen Bestände<br />
sind <strong>zu</strong>mindest systematisch abgelegt und<br />
wer<strong>den</strong> in einem zweiten Schritt digital<br />
erfasst und verwaltet.<br />
CLAUS BRÜNDEL<br />
Kalender, Fahrkarten<br />
und Briefmarken<br />
Zur Sammlung gehören 1100 meist moderne<br />
Werbekalender, die wegen ihrer bildlichen<br />
Darstellungen gesammelt wer<strong>den</strong>. Die<br />
ältesten Kalender stammen aus dem Ende<br />
des 19. Jahrhunderts. Einige Serien <strong>zu</strong>m<br />
Thema Eisenbahn, wie die Wandkalender<br />
der Deutschen Bundesbahn und der<br />
„Freunde der Eisenbahn“, sind über einen<br />
Zeitraum von mehr als vierzig Jahren nahe<strong>zu</strong><br />
komplett vorhan<strong>den</strong>. 200 Kalender <strong>zu</strong>m<br />
Bereich Eisenbahn und 150 Kalender <strong>zu</strong>m<br />
Bereich Automobil bil<strong>den</strong> <strong>den</strong> thematischen<br />
Schwerpunkt dieses Sammlungsbereiches.<br />
Besonders ältere Kalender der Bewag aus<br />
<strong>den</strong> Jahren 1938–1940, die <strong>zu</strong> Werbezwecken<br />
an private Haushalte abgegeben<br />
wur<strong>den</strong>, geben einen guten Einblick in die<br />
technische Entwicklung des Haushalts.<br />
Aus <strong>den</strong> Bestän<strong>den</strong> des Verkehrs- und<br />
Baumuseums bewahrt das Historische Archiv<br />
die in ihrer Art wohl einmalige Sammlung<br />
von über 100 000 Eisenbahnfahrkar-<br />
s Fahrschein für die Berlin-Potsdam-<br />
Magdeburger Eisenbahn-Gesellschaft,<br />
1852. Foto: DTMB<br />
s Thüringerwaldbahn, etwa 1960.<br />
Foto: DTMB<br />
ten aus aller Welt, überwiegend aus der<br />
Zeit zwischen 1890 und 1930. Die eigene,<br />
in <strong>den</strong> letzten 25 Jahren aufgebaute Fahrkartensammlung<br />
des DTMB umfasst etwa<br />
20 000 Eisenbahnfahrkarten und Fahrscheine<br />
des Öffentlichen Nahverkehrs aus der<br />
Zeit der Postkutschen mit einem Fahrschein<br />
von 1835 bis <strong>zu</strong>m BVG-Fahrschein der Neuzeit.<br />
Zwei Schwerpunkte sind Fahrscheine<br />
der BVG und ihrer Vorgänger sowie Eisenbahnfahrkarten<br />
der letzten 100 Jahre.<br />
Die Sammlung wächst hauptsächlich durch<br />
Spen<strong>den</strong> aus der Bevölkerung.<br />
Etwa 500 Briefmarken und postalische<br />
Belege aus der Zeit ab 1890 <strong>zu</strong> <strong>den</strong> Sammelgebieten<br />
des DTMB bil<strong>den</strong> <strong>den</strong> Grundstock<br />
für diese Sondersammlung. Zugänge<br />
s Deutscher Reichsbahn-Kalender<br />
von 1941. Foto: DTMB<br />
29<br />
ARCHIV
30<br />
ARCHIV<br />
s Siegelmarke der Berlin-Görlitzer-<br />
Eisenbahn-Gesellschaft. Foto: DTMB<br />
<strong>zu</strong> diesem Bereich erfolgen überwiegend<br />
aus Spen<strong>den</strong>. Von Bedeutung ist eine kleine<br />
Sammlung von etwa 90 Absenderfreistempeln<br />
deutscher Flugzeugfirmen der<br />
1930er und 1940er Jahre.<br />
„Moderner“ ist eine nahe<strong>zu</strong> komplette<br />
Sammlung der Kinderdorf-Ballonflugbelege,<br />
die das Historische Archiv durch eine<br />
großzügige Spende von Herrn Gerhard<br />
Hurck aus Marl erhielt.<br />
PETER MIKA<br />
Siegel<br />
Schellacksiegel dienten bis <strong>zu</strong>r Einführung<br />
des Briefmarken-Portos im Postverkehr, etwa<br />
um 1845, <strong>zu</strong>r Wahrung des Briefgeheimnisses.<br />
Als sie sich beim Bestempeln als<br />
hinderlich erwiesen, fan<strong>den</strong> bald Papiersiegel<br />
Verwendung. Basis der Sammlung ist<br />
die Eisenbahn- und Verkehrshistorische<br />
Sammlung von Günter Hermann Metzeltin.<br />
Sie enthält unter dem Titel „Die Bahnen<br />
im Spiegel der Siegel“ etwa 860 meist<br />
alte Siegel aus dem Zeitraum 1850 bis 1935<br />
<strong>zu</strong>m Bereich Schienenverkehr und wurde<br />
als Ausstellung konzipiert. Das Thema wird<br />
durch insgesamt ca. 1200 Siegelmarken von<br />
Privat- und Staatsbahnen ergänzt. Daneben<br />
befin<strong>den</strong> sich eine Fülle von Siegelmarken<br />
und eine geringere Zahl von Lackabdrücken<br />
und Stempeln deutscher Firmen<br />
sowie von Behör<strong>den</strong>, Ämtern und Gemein<strong>den</strong>,<br />
Organisationen und Verbän<strong>den</strong> im<br />
Bestand. Größere thematische Bereiche<br />
betreffen Post, Telegrafie, Telefonie, Marine,<br />
Luftfahrt und Produktionstechnik. Die<br />
Sammlung enthält auch ca. 280 Stadtwappen.<br />
WALTRAUD FRICKE<br />
Eintrittskarten<br />
Die kleine Sammlung von etwa 500 Eintrittskarten<br />
setzt sich <strong>zu</strong>meist aus Tickets für<br />
touristische Einrichtungen sowie für Museen<br />
und Ausstellungen <strong>zu</strong>sammen. Viele<br />
Spen<strong>den</strong> <strong>zu</strong>r Fahrkartensammlung enthalten<br />
auch Eintrittskarten.<br />
Der geographische Schwerpunkt liegt<br />
auch in dieser Gruppe bei Deutschland und<br />
besonders bei Berlin. Zu <strong>den</strong> bedeutenderen<br />
Berliner Stücken gehören Eintrittskarten<br />
für die Berliner Gewerbeausstellungen von<br />
1879 und 1896 sowie die Automobil- und<br />
Rundfunkausstellungen der 1920er und<br />
1930er Jahre, Besichtigungskarten für <strong>den</strong><br />
„Flughafen Tempelhof“ und <strong>den</strong> „Luftschiffbau<br />
Zeppelin“ in Staaken. Auch Eintrittskarten<br />
für Vorläufermuseen des Deutschen<br />
Technikmuseums sind vorhan<strong>den</strong>, so<br />
für das Verkehrs- und Baumuseum, die<br />
Deutsche Luftfahrtsammlung und die Berliner<br />
Verkehrsausstellung in der Urania, die<br />
vom Förderverein des Technikmuseums eingerichtet<br />
wor<strong>den</strong> war.<br />
DEUTSCHES TECHNIKMUSEUM BERLIN 5 | 2008<br />
PETER MIKA<br />
Werbemarken<br />
Die Sammlung rekrutiert sich aus ca. 7000<br />
plakativen Werbeträgern von Firmen,<br />
Behör<strong>den</strong>, Organisationen, Verbän<strong>den</strong> und<br />
Vereinen. Die größte Gruppe bil<strong>den</strong> Reklamemarken,<br />
eine Kleinform der Plakatkunst,<br />
die Ende des 19. Jahrhunderts entstand, als<br />
aus anfänglichen Siegelmarken Werbebriefmarken<br />
wur<strong>den</strong>. Werbemarken stellen<br />
einen repräsentativen Querschnitt der Werbegrafik<br />
dar. Sie hatten bis etwa 1914 als<br />
Werbeträger riesigen Erfolg, <strong>den</strong>n die Entwürfe<br />
der Miniplakate stammen oft von<br />
namhaften Künstlern. So wurde Anfang<br />
des 20. Jahrhunderts ein neuer sachlicher<br />
Plakatstil maßgeblich von Lucian Bernhard<br />
geprägt, dessen Arbeiten <strong>zu</strong>r Manoli-Zigarettenwerbung<br />
im Historischen Archiv <strong>zu</strong><br />
fin<strong>den</strong> sind. Die einzelnen Sammlungsbereiche<br />
orientieren sich am allgemeinen<br />
Sammlungsauftrag des Deutschen Technikmuseums<br />
Berlin, einschließlich der<br />
Alltagskultur. Neben <strong>den</strong> Werbemarken<br />
wer<strong>den</strong> Spen<strong>den</strong>- und Quittungsmarken<br />
gesammelt, hier im Besonderen vertreten<br />
durch Stücke der Deutschen Gesellschaft<br />
<strong>zu</strong>r Rettung Schiffbrüchiger oder eine Serie<br />
sogenannter Wohlfahrtsmarken mit<br />
s Werbemarke des Sarotti-Werks,<br />
Berlin-Tempelhof. Foto: DTMB<br />
s Eintrittskarte <strong>zu</strong> <strong>den</strong> Olympischen<br />
Spielen in Berlin 1936. Foto: DTMB<br />
s Eintrittskarte für die Deutsche Luftfahrtsammlung<br />
am Lehrter Bahnhof,<br />
etwa 1935. Foto: DTMB<br />
der Bezeichnung „Luftfahrerdank“. Weitere<br />
Kategorien sind Werbeaufkleber sowie<br />
Etiketten verschie<strong>den</strong>ster Verwendungszwecke,<br />
speziell eine recht große Sammlung<br />
von Kofferetiketten, die <strong>zu</strong>m größten<br />
Teil aus der Sammlung Kruppa <strong>zu</strong> Teilbereichen<br />
der Luftfahrttechnik stammen. Sie<br />
dokumentieren überwiegend nationale und<br />
internationale Fluggesellschaften wie die<br />
Deutsche Lufthansa oder die holländische<br />
KLM.<br />
Die Nahrungs- und Genussmittelwerbung<br />
bildet mit ca. 1000 Reklamemarken einen<br />
Hauptkomplex. Auf einem Großteil der<br />
Marken wird für Brauereiprodukte wie die<br />
Biere der Löwenbrauerei in Berlin geworben,<br />
auf einigen davon für die Milchprodukte<br />
der Berliner Firma Bolle, aber auch für<br />
Schokolade der Marke Sarotti. Als einer der<br />
Sammlungshöhepunkte sind die meisterhaften<br />
Darstellungen der verschie<strong>den</strong>en<br />
Produktionszweige der AEG auf Werbemarken<br />
<strong>zu</strong> nennen. Textile Techniken sind<br />
mit Reklame für Gütermann-Nähseide und<br />
andere Waren präsent. Das Thema Haushalt<br />
ist mit Werbemarken für die Einkochapparate<br />
Rex und Weck oder <strong>zu</strong> Reini-<br />
s Kofferetikett der Lufthansa,<br />
Passagiergepäck. Foto: DTMB
DEUTSCHES TECHNIKMUSEUM BERLIN 5 | 2008<br />
Funkausstellung, Berlin 1925.<br />
Foto: DTMB<br />
gungsmitteln wie Lux vertreten. Ganze<br />
Bilderserien, teilweise mit Sprüchen, haben<br />
Gummiprodukte <strong>zu</strong>m Inhalt und die thematisch<br />
unterschiedlichsten Bildfolgen<br />
werben für Excelsior- oder Continental-<br />
Absätze. Sammlungschwerpunkte bil<strong>den</strong><br />
nationale und internationale Ausstellungen<br />
und Messen, Gewerbe-, Industrie- und<br />
Landwirtschaftsausstellungen von 1896 bis<br />
1990 mit ungefähr 1000 Werbemarken <strong>zu</strong><br />
deutschen Ausstellungen, 120 <strong>zu</strong> Berliner<br />
Ausstellungen und etwa 400 <strong>zu</strong> internationalen<br />
Ausstellungen.<br />
WALTRAUD FRICKE<br />
Postkarten<br />
Postkarten dienen <strong>zu</strong>m Versen<strong>den</strong> relativ<br />
kurzer Mitteilungen per Post. Das Sammelgebiet<br />
wird als die Philokartie bezeichnet.<br />
Die ersten Postkarten waren Correspon<strong>den</strong>zkarten<br />
mit eingedruckten Briefmarken.<br />
Diese wur<strong>den</strong> in Europa und Kanada um<br />
1870 von der Post herausgegeben und<br />
erfreuten sich sofort großer Beliebtheit.<br />
Besondere Bedeutung erhielten sie im<br />
Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 als<br />
Feldpostkarten. Da diese häufig Landschaftsmotive<br />
zeigen, können sie als Vorläufer<br />
der Ansichtskarte gelten. 1872<br />
erfolgte im Deutschen Reich die Einführung<br />
von Correspon<strong>den</strong>zkarten mit bezahlter<br />
Antwort und im gleichen Jahr wur<strong>den</strong> von<br />
Privatpersonen auf eigene Rechnung hergestellte<br />
Postkarten <strong>zu</strong>r Beförderung <strong>zu</strong>gelassen.<br />
Erstmals verwendeten auch Firmen<br />
auf Karten aufgezogene Fotos <strong>zu</strong> Werbezwecken.<br />
Um 1900 setzten sich Ansichtskarten<br />
im großen Stil durch, da sie anschaulich<br />
und preiswert waren.<br />
s Glashüttenwerke von Poncet, Berlin.<br />
Foto: DTMB<br />
Die Sammlung enthält ca. 20 000 Postkarten<br />
<strong>zu</strong>m Thema Technik und Verkehr. Den<br />
Grundstock bil<strong>den</strong> drei große Sammlungen<br />
überwiegend <strong>zu</strong>m Schienenverkehr. Es handelt<br />
sich hierbei um ca. 3500 Postkarten<br />
aus <strong>den</strong> umfangreichen Eisenbahn- und verkehrshistorischen<br />
Sammlungen von Günter<br />
Hermann Metzeltin, ca. 650 Lokomotivdarstellungen<br />
des Sammlers Brandtstetter<br />
und eine von <strong>den</strong> Freun<strong>den</strong> und Förderern<br />
des DTMB e.V. großzügig <strong>zu</strong>r Verfügung<br />
gestellte Sammlung von etwa 900 Postkarten.<br />
Darauf aufbauend entstand ein umfangreicher,<br />
mit einer speziellen Systematik<br />
erschlossener Komplex, unterteilt in die<br />
Bereiche Eisenbahnwesen und Personennahverkehr.<br />
Zu <strong>den</strong> weiteren Hauptgruppen zählen<br />
Luft- und Raumfahrt, Wasserbau und Schiff-<br />
s Die Historische Mühle im Park von Potsdam-Sanssouci.<br />
Foto: DTMB<br />
fahrt sowie Energietechnik und Straßenverkehr.<br />
Besonders <strong>zu</strong> erwähnen sind hier<br />
159 wertvolle Karten des Berliner Postkartenvertriebs<br />
W. Sanke, welche die Anfänge<br />
der deutschen Luftfahrt dokumentieren.<br />
Mehrere tausend Postkarten des Sammlers<br />
Wehde zeigen Schiffsmotive. Eine Spezialsammlung<br />
des Sammlers Walter Heesch ist<br />
mit über 1200 malerischen Ansichten von<br />
Wasser- und Windmühlen, hauptsächlich<br />
aus dem mitteldeutschen Raum, aber auch<br />
dem Ausland, im Zeitraum 1900 bis 1945<br />
einmalig. So ist auf 29 darin enthaltenen<br />
Grußkarten die 1788 erbaute historische<br />
Windmühle von Sanssouci <strong>zu</strong> sehen. Einige<br />
unserer ältesten Grußkarten zwischen<br />
1897 und 1904 sind unter dem Motto „All<br />
Heil“ in einer größeren Sammlung <strong>zu</strong>m<br />
Thema Fahrrad enthalten. Dort gibt es auch<br />
vielfältige Motive von Radrennen und Rennfahreren,<br />
u. a. der berühmten Berliner Sechstagerennen.<br />
Aus <strong>den</strong> Vorgängermuseen<br />
des Technikmuseums, dem ehemaligen Verkehrs-<br />
und Baumuseum bzw. dem Museum<br />
für Meereskunde, stammen etwa 50<br />
Postkarten. Eine Sammlung von Berliner<br />
Ansichten zeigt u. a. auch frühe Gebäudeansichten<br />
des Museumsstandortes in der<br />
Trebbiner Straße. Sammlungshöhepunkte<br />
stellen Postkarten deutscher und internationaler<br />
Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsausstellungen<br />
im Zeitraum 1896–<br />
1967 dar, die im Hinblick auf das hundertjährige<br />
Jubiläum der Berliner Gewerbeausstellung<br />
im Jahre 1996 gesammelt wur<strong>den</strong>.<br />
Hervor<strong>zu</strong>heben sind die vielen farbigen<br />
Ansichten der Berliner Gewerbeausstellung<br />
von 1896, u. a. die Darstellungen von<br />
„Kairo“ oder <strong>den</strong> Kolonialabteilungen.<br />
WALTRAUD FRICKE<br />
31<br />
ARCHIV
32<br />
ARCHIV<br />
AEG- und<br />
Telefunken-<br />
Sammlung<br />
Firmenschriften der AEG<br />
Die Sammlung der Firmenschriften von<br />
AEG-Telefunken umfasst ca. 50 000 Drucke.<br />
Z. Zt. sind ca. 4900 Einheiten in einer Datenbank<br />
erschlossen. Eine große Anzahl, vornehmlich<br />
aus dem Telefunken-Bereich, ist<br />
systematisch in Ordnern abgelegt. Enthalten<br />
sind Bedienungsanleitungen, Handbücher,<br />
Preis- und Ersatzteillisten, Werbematerial,<br />
Selbstdarstellungen und Produktbeschreibungen,<br />
mithin die Art von Drucker-<br />
Druckerzeugnissen, die üblicherweise unter<br />
dem Begriff der „Gebrauchsliteratur“ <strong>zu</strong>sammengefasst<br />
wer<strong>den</strong> und bei <strong>den</strong>en Firmen<br />
als Urheber fungieren. Beginnend mit<br />
<strong>den</strong> frühen Preislisten, der AEG-Zeitung als<br />
Beleg beigefügten Prospekten um 1900 bis<br />
<strong>zu</strong> <strong>den</strong> Produktbeschreibungen der Unterhaltungselektronik<br />
bei Telefunken (ca.<br />
1990) sind praktisch alle Bereiche samt Untersparten<br />
des Konzerns vertreten.<br />
Die ältesten Firmenschriften im AEG-Bestand<br />
beschreiben in erster Linie elektrische<br />
Ausstattungen für <strong>den</strong> gewerblichen und<br />
industriellen Bereich (Bergwerke etc.), da<strong>zu</strong><br />
zählen Maschinen <strong>zu</strong>r Stromerzeugung<br />
und -verteilung sowie Beleuchtungstechnik<br />
(Lampen und Installationsmaterial etc.). Mit<br />
Beginn des 20. Jahrhunderts setzte in immer<br />
stärkerem Maße eine Elektrifizierung<br />
auch der privaten Bereiche ein, was sich bei<br />
der AEG durch Entwicklung und Bau von<br />
elektrischen Geräten für <strong>den</strong> Haushalt bemerkbar<br />
macht. Dieser Prozess dauerte<br />
nicht <strong>zu</strong>letzt wegen des Ersten Weltkrieges<br />
bis in die 1920er Jahre. Die meisten auch<br />
heute noch vertrauten Hausgeräte, wie<br />
Kühlschrank, Staubsauger und elektrische<br />
Kochherde waren bis <strong>zu</strong>r Marktreife entwickelt.<br />
Eine Verbreitung nach heutigen<br />
Maßstäben war aufgrund der Vermögensund<br />
Einkommensverhältnisse der damaligen<br />
Zeit noch unmöglich. Die Gestaltung<br />
der Werbeschriften war damals wie heute<br />
ein Spiegel der jeweiligen Vorstellungen<br />
von Familie und gesellschaftlichem Status,<br />
wie die Abbildungen exemplarisch verdeutlichen<br />
sollen. Die ausgewählten Werbeschriften<br />
für <strong>den</strong> gewerblichen (Gastronomie)<br />
und <strong>den</strong> industriellen Bereich (Gaszentrale<br />
im Bergbau) sind ihrem Gegen-<br />
s AEG-Produktwerbung für Waschgeräte,<br />
1956. Foto: DTMB<br />
stand gemäß zwar etwas moderater gehalten,<br />
aber von durchaus ansprechender Gestaltung<br />
und nicht auf eine rein sachliche,<br />
nüchterne Darstellung begrenzt.<br />
Wie bei allen anderen Sammlungen des<br />
Historischen Archivs wird auch in diesem<br />
Sammlungsbereich die Textinformation<br />
schrittweise durch digitale Bilder unterstützt.<br />
Eine entsprechende Datenbank für<br />
<strong>den</strong> Firmenschriftenbestand von Telefunken<br />
ist im Einstehen und wird bei geeigneter<br />
Gelegenheit vorgestellt wer<strong>den</strong>.<br />
Bildarchiv der AEG<br />
Der in <strong>den</strong> Jahren 1996/1997 in das Deutsche<br />
Technikmuseum Berlin eingebrachte<br />
Gesamtbestand von AEG-Telefunken ist so<br />
s AEG-Werbekarte für Nernst-Lampen,<br />
1903. Foto: DTMB<br />
DEUTSCHES TECHNIKMUSEUM BERLIN 5 | 2008<br />
s AEG-Werbeblatt für elektrische<br />
Kochherde, 1953. Foto: DTMB<br />
umfangreich, dass es notwendig war, ihn<br />
in einzelne Teilbereiche <strong>zu</strong> gliedern. Neben<br />
<strong>den</strong> Akten der AEG und von Telefunken ist<br />
auch eine sehr große Menge (ca. 1000 000<br />
Abzüge und Negative insgesamt) an fotografischem<br />
Material vorhan<strong>den</strong>. Der wichtigste<br />
Teil des Bildarchivs ist die alte Glasnegativ-Sammlung<br />
(ca. 15 000 Stck., gescannt<br />
ca. 5000), die <strong>den</strong> Grundstock bildet,<br />
weil in ihr die ältesten Aufnahmen der<br />
AEG enthalten sind. Die Aufnahmen zeigen<br />
Menschen am Arbeitsplatz, Produkte, Fertigung,<br />
dokumentieren Bauvorhaben und<br />
nicht <strong>zu</strong>letzt die sozialen Institutionen der<br />
AEG wie Sanitärdienst, Ausbildung, Arbeitsschutz<br />
und Erholungsheime bzw. Freizeitgestaltung.<br />
Daneben gibt es eine Reihe<br />
s Werbeschrift für militärische<br />
Beleuchtungstechnik, 1913. Foto: DTMB
DEUTSCHES TECHNIKMUSEUM BERLIN 5 | 2008<br />
s AEG-Firmenplakat von 1888.<br />
Foto: DTMB<br />
von Negativsammlungen neueren Datums,<br />
die nicht erschlossen sind. Im Rahmen der<br />
Ausstellung „AEG im Bild“ wurde der Negativbestand<br />
vorgestellt und im da<strong>zu</strong>gehörigen<br />
Katalog in Auszügen veröffentlicht.<br />
Die zweite wichtige und <strong>zu</strong>gleich mit Abstand<br />
größte Fotosammlung bil<strong>den</strong> die 128<br />
AEG-Fotoschränke. In diesen Schränken mit<br />
je 4 Ebenen befin<strong>den</strong> sich Hängemappen<br />
mit alten und neuen Abzügen aus allen<br />
Bereichen (Fertigung, Produktionsstätten,<br />
Personen, Produkte etc.) des AEG-Telefunken-Konzerns<br />
sowie Dias, Folien und einige<br />
Negative.<br />
Inhaltlich spiegelt dieser Bildbestand von<br />
der Glühbirne bis <strong>zu</strong>m Atomkraftwerk, von<br />
<strong>den</strong> Verwaltungsgebäu<strong>den</strong> bis <strong>zu</strong> <strong>den</strong> Fertigungs-<br />
und Forschungsstätten des AEG-<br />
Telefunken-Konzerns je<strong>den</strong> Produktionsbereich.<br />
Art und Umfang der Sammlung<br />
lassen darauf schließen, dass die Abbildungen<br />
in erster Linie für eigene Publikationen<br />
und Presseinformationen gedacht waren.<br />
Der Zugriff erfolgt ebenfalls über eine Datenbank,<br />
wobei die Mappen thematisch erfasst<br />
sind, die einzelnen Fotos jedoch noch<br />
nicht.<br />
385 Fotoalben bil<strong>den</strong> einen weiteren Teil<br />
des Bildarchivs, in dem sich weitgehend die<br />
gleichen Themen widerspiegeln wie bei <strong>den</strong><br />
Fotoschränken. Sie sind jedoch in Form<br />
einer Fotoreihe jeweils einem Projekt oder<br />
einer Produktgruppe gewidmet. Darüber<br />
hinaus wur<strong>den</strong> auch <strong>zu</strong> Dienstjubiläen oder<br />
anderen Ereignissen einige Alben angefertigt.<br />
Alle Alben wur<strong>den</strong> durchfotografiert<br />
und die digitalen Abbildungen <strong>den</strong> entsprechen<strong>den</strong><br />
Datensätzen <strong>zu</strong>geordnet, um<br />
s Innenaufnahme der Flugzeugfabrik Hennigsdorf, 1915.<br />
Foto: DTMB<br />
die Textinformation durch einen visuellen<br />
Eindruck <strong>zu</strong> verstärken.<br />
Filmsammlung der AEG<br />
Die Filmsammlung des AEG-Telefunken-<br />
Archivs besteht z. Zt. aus 736 Datensätzen,<br />
hinter <strong>den</strong>en sich 540 unterschiedliche Filmtitel<br />
verbergen, da einige Filme mit gleichem<br />
Inhalt, aber z. B. anderer Sprachfassung<br />
gesondert eingearbeitet wur<strong>den</strong>.<br />
Enthalten sind Filme <strong>zu</strong>r Produktion, technische<br />
Erläuterungen, Belege für verwendetes<br />
Material und Filme <strong>zu</strong>r Produktwerbung.<br />
Im Bereich der Werbefilme <strong>zu</strong>m Thema<br />
Hausgeräte sei insbesondere auf die Puppentrickfilme<br />
der Firma Diehl in Farbe aus<br />
<strong>den</strong> 1950er Jahren hingewiesen, die in zeittypischer<br />
Art hinsichtlich des Rollenverhaltens<br />
der Geschlechter die entsprechen<strong>den</strong><br />
Geräte bewerben (z. B.: AEG-Film Nr. 110<br />
„Der Ehezwist“). Es gibt aber auch Filme,<br />
die sich mit der Rolle der Frau in der Arbeitswelt<br />
auf wissenschaftlicher bzw. dokumentarischer<br />
Ebene auseinandersetzen, z. B. der<br />
AEG-Film Nr. 42 „Frauen für leichte Arbeit<br />
gesucht“.<br />
Bei der Anführung einiger Beispiele darf<br />
Telefunken selbstverständlich nicht unerwähnt<br />
bleiben. Hier geht es, beginnend in<br />
<strong>den</strong> späten 1920er Jahren, vornehmlich um<br />
Werbefilme für Radiogeräte und Schallplattenspieler<br />
(AEG-Film Nr. 16 „Die 5 von<br />
Telefunken“), später auch für Fernsehgeräte<br />
und Stereoanlagen. Im Bereich der<br />
Industrieprojekte der bei<strong>den</strong> Firmen gibt es<br />
einige Dokumentarfilme, exemplarisch hierfür<br />
sind der AEG-Film Nr. 200 „Atomkraftwerk<br />
Kahl“ für die AEG und Nr. 003 „Der<br />
Großsender“ (Sender Mühlacker bei Stuttgart)<br />
für Telefunken.<br />
Das Material liegt in unterschiedlichen<br />
Formaten (Filmrolle 16 mm oder 35 mm als<br />
Ton- oder Stummfilm) sowie als Farb- oder<br />
Schwarzweißfilm vor. Der überwiegende<br />
Teil stammt aus <strong>den</strong> 1950er und 1960er<br />
Jahren. Eine größere Anzahl der Rollen ist<br />
auf andere Datenträger (VHS, Betacam SP,<br />
Digi-Betacam oder DVD) umkopiert wor<strong>den</strong>,<br />
um eine bessere Sichtung vor Ort im<br />
Archiv bzw. eine professionelle Bearbeitung<br />
innerhalb von Film- und Fernsehprojekten<br />
<strong>zu</strong> ermöglichen.<br />
s Telefunken-Logo, ca. 1935.<br />
Foto: DTMB<br />
CLAUS BRÜNDEL<br />
33<br />
ARCHIV
34<br />
ARCHIV<br />
Plansammlung<br />
Karten und Pläne<br />
Dieser Bereich umfasst <strong>zu</strong>r Zeit etwa 7500<br />
Landkarten und Lagepläne sowie etwa<br />
12 500 Seekarten. Den Schwerpunkt bil<strong>den</strong><br />
entsprechend dem Interesse des DTM<br />
die Verkehrskarten.<br />
Zu <strong>den</strong> ältesten Karten im Bestand zählt<br />
eine Sammlung von sehr dekorativen Seekarten,<br />
<strong>zu</strong>meist aus dem europäischen<br />
Raum, aus dem 17. und 18. Jahrhundert.<br />
Auf die Sammlung des Museums für Meereskunde<br />
geht eine Reihe von Seekarten<br />
aus der Zeit von 1860 bis etwa 1920 <strong>zu</strong>rück.<br />
Schließlich gibt es eine Reihe modernerer<br />
Seekarten, vorwiegend von <strong>den</strong> Deutschen<br />
Küsten, die vom Förderverein übergeben<br />
wur<strong>den</strong>. So ist die Entwicklung der<br />
Seekarte gut dokumentiert.<br />
Dem Verkehr <strong>zu</strong> Lande dienten die frühen<br />
Post- und Reisekarten. Diese Gattung ist<br />
mit einigen Karten aus der Zeit um 1800<br />
vertreten. Mit der Entwicklung der Eisenbahn<br />
nahmen private Reisen <strong>zu</strong> und wuchs<br />
auch der Bedarf an Karten für <strong>den</strong> deutschen<br />
und europäischen Raum. Dies lässt<br />
sich deutlich an der Ausgabe der verschie<strong>den</strong>en<br />
Eisenbahn- und Reisekarten Mitteleuropas<br />
erkennen, die ab <strong>den</strong> 1840er Jahren<br />
bei zahlreichen Verlagen erschienen.<br />
Das rasche Wachsen des Eisenbahnnetzes<br />
s Stadtplan von Bad Nauheim aus dem<br />
Jahr 1930. Foto: DTMB<br />
lässt sich anhand der Karten gut verfolgen.<br />
Deutlich sind auf diesen Karten bis nach<br />
1900 auch Postkutschenverbindungen neben<br />
<strong>den</strong> Eisenbahnlinien verzeichnet.<br />
Der geographische Schwerpunkt in der<br />
Kartensammlung liegt bei Berlin, Bran<strong>den</strong>burg,<br />
Deutschland und Mitteleuropa. So ist<br />
der deutsche Raum bei <strong>den</strong> Eisenbahnkarten<br />
gut abgedeckt. Aus der Sammlung des<br />
Eisenbahnhistorikers Metzeltin sind aber<br />
auch viele Landkarten <strong>zu</strong>m Thema Eisenbahn<br />
aus dem überseeischen Raum in <strong>den</strong><br />
Bestand des DTMB gelangt.<br />
In der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts<br />
taucht ein weiterer populärer Typ der<br />
Verkehrskarte auf: die Straßenkarte, anfangs<br />
noch unter der Bezeichnung „Radfahrerkarte“.<br />
Später wird diese „Radfahrerund<br />
Automobilistenkarte“ und schließlich<br />
nur noch „Autokarte“ genannt. Bis <strong>zu</strong> <strong>den</strong><br />
1930er Jahren hatten viele führende Benzinvertriebsfirmen,<br />
Reifenhersteller und<br />
s Berliner U-Bahn-Netzplan vom Januar 1970.<br />
Foto: DTMB<br />
DEUTSCHES TECHNIKMUSEUM BERLIN 5 | 2008<br />
einige namhafte Verlage in Deutschland<br />
Kartenserien für <strong>den</strong> deutschsprachigen<br />
Raum in ihrem Programm. Beispiele für Herausgeber<br />
der Kartenserien sind Aral/BV,<br />
Olex/BP, Standard/Esso, Stellin/Shell, Continental,<br />
Ravenstein und Ullstein/BZ. Dieser<br />
Bereich ist im Bestand des DTMB gut vertreten.<br />
Von fast allen Serien sind Beispiele<br />
vorhan<strong>den</strong>, einige Serien sind fast vollständig<br />
in Einzelblättern, aber selten in allen<br />
Auflagen vorhan<strong>den</strong>.<br />
Mit der erweiterten Freizeit und höheren<br />
Mobilität ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts<br />
erschienen auch immer mehr Wanderkarten.<br />
Es gibt sie in der Kartensammlung<br />
des DTMB vermehrt für Urlaubsgebiete<br />
wie die Schneekoppe und <strong>den</strong> Harz, aber<br />
auch für Ausflüge in die Mark Bran<strong>den</strong>burg.<br />
Besonders zahlreich sind Silva- und<br />
Pharus-Wanderkarten erhalten geblieben.<br />
Für die nähere Umgebung Berlins waren<br />
die sehr genauen Karten des Reichsamtes<br />
für Landesaufnahme in Berlin sehr beliebt.<br />
Die Serie „Karte von Berlin und Umgebung<br />
in 12 Blättern“ im Maßstab 1:50 000 kam<br />
von 1901 bis etwa 1943 in mehreren Neuauflagen.<br />
In <strong>den</strong> 1930er Jahren heraus. Eine<br />
Reihe von Karten für Wasserwanderer, die<br />
das Gebiet der bran<strong>den</strong>burgischen und<br />
mecklenburgischen Seen und Gewässer<br />
abdeckten. Heute wird dieser Kartentyp<br />
wieder aktuell und die älteren Karten wer
DEUTSCHES TECHNIKMUSEUM BERLIN 5 | 2008<br />
s Stark beschädigte Schautafel aus dem Verkehrs- und Baumuseum. Foto: DTMB<br />
<strong>den</strong> <strong>zu</strong>r Information genutzt. Die Stadtentwicklungen<br />
im Berliner Nahbereich lassen<br />
sich gut an Stadtplänen ablesen. Für die<br />
Zeit ab 1870 sind Pläne von Berlin in kurzen<br />
Zeitabstän<strong>den</strong> vorhan<strong>den</strong>. An Stadtplänen<br />
ist auch immer die Entwicklung des<br />
Öffentlichen Personennahverkehrs ab<strong>zu</strong>lesen.<br />
Direkter ist sie jedoch an <strong>den</strong> Karten<br />
der Systematikgruppe ÖPNV nach<strong>zu</strong>vollziehen,<br />
die eine große Anzahl Karten aus<br />
Berlin enthält. Zu <strong>den</strong> frühen Karten zählen<br />
Droschkenwegemesser aus der Zeit von<br />
1880 bis 1920. Einige Karten der Berliner<br />
Straßenbahn Betriebs GmbH und der Hochbahngesellschaft<br />
sind ebenfalls vorhan<strong>den</strong>.<br />
Den Schwerpunkt bil<strong>den</strong> jedoch die BVG-<br />
Liniennetze, die ab 1930 zahlreich vertreten<br />
sind. Der Bestand von über 12 500 Seekarten<br />
für die Küstenforschung des Instituts<br />
für Geographie der Technischen Universität<br />
Berlin wurde bei dessen Auflösung übernommen<br />
und ist mittels Übersichtskarten<br />
erschlossen. Die Verzeichnung der Seekarten<br />
erfolgt aktuell mit Unterstüt<strong>zu</strong>ng des<br />
Fördervereins.<br />
Technische Zeichnungen<br />
Der überwiegende Teil der Sammlung umfasst<br />
etwa 3000 Blätter technische Zeichnungen<br />
aus <strong>den</strong> Bereichen des Schienenverkehrs,<br />
z. B. Eisenbahnwagen aus dem<br />
Nachlass des Eisenbahnhistorikers Metzeltin<br />
und dem Nachlass des österreichischen<br />
Eisenbahningenieurs A. Giesl-Gieslingen.<br />
Im Bestand befin<strong>den</strong> sich ferner etwa 250<br />
Bau- und Detailzeichnungen aus dem VEB<br />
Waggonbau Gotha <strong>zu</strong> Schwerlast-Straßenrollern<br />
für Eisenbahnfahrzeuge. Der Bereich<br />
der Schifffahrt wird repräsentiert durch<br />
Zeichnungen <strong>zu</strong> Linien-, Fracht- und Segel-<br />
s Brückenkopf der Alten Oderbrücke bei Glogau, rechtes Ufer, 1857.<br />
Foto: DTMB<br />
schiffen aus dem Bestand des Instituts und<br />
Museums für Meereskunde (MfM). 30 Kupferstiche<br />
diverser Schiffstypen aus dem<br />
18. Jahrhundert des Schiffbauers Frederik<br />
Hendrik Chapman sind in einer plantechnischen<br />
Sammlung <strong>zu</strong>sammengefasst.<br />
Plansammlung des<br />
Verkehrs- und Baumuseums<br />
Das frühere Verkehrs- und Baumuseum im<br />
Hamburger Bahnhof wurde im Zuge der S-<br />
Bahn-Verhandlungen mit der Deutschen<br />
Reichsbahn 1984 an <strong>den</strong> Berliner Senat übergeben,<br />
der dem damaligen Museum für<br />
Verkehr und Technik <strong>den</strong> Bestand <strong>zu</strong>wies.<br />
Er setzt sich aus technischen Zeichnungen,<br />
Architekturzeichnungen, Schautafeln, Fahrplänen<br />
und Karten aus dem Eisenbahn-,<br />
Wasserbau- und Hochbaubereich in der Zeit<br />
von ca. 1835–1943 <strong>zu</strong>sammen. Im Einzelnen<br />
besteht die Sammlung aus etwa 750<br />
Plänen, etwa 250 Fahrplänen, Übersichtslandkarten<br />
und Tariftabellen; etwa 190<br />
Schautafeln; etwa 70 Gemäl<strong>den</strong>, Druckgrafik<br />
und Zeichnungen. Vom ehemaligen<br />
Kaufhaus Wertheim in der Leipzigerstraße<br />
sind Entwürfe von A. Messel und H. Braun<br />
vorhan<strong>den</strong>.<br />
Architektur-Zeichnungen<br />
Der Bestand setzt sich aus etwa 200 Grundund<br />
Aufrissen von Bauwerken <strong>zu</strong>sammen.<br />
Darin sind u. a. Architekturzeichnungen<br />
vom Kraftwerk Unterspree, Zeichnungen<br />
vom Flughafen Tempelhof aus dem Nachlass<br />
Krupp und Entwürfe der Berlin-Anhaltischen<br />
Maschinenbau-A.G. <strong>zu</strong> fin<strong>den</strong>.<br />
s Fahrkartenausgabe des Bahnhofs<br />
Frankfurt/Oder, 1873. Foto: DTMB<br />
PETER MIKA<br />
35<br />
ARCHIV
36<br />
ARCHIV<br />
Bildersammlung<br />
Bildersammlung<br />
Zu der Bildersammlung gehören die Gemälde<br />
und Zeichnungen, die Druckgrafik, Plakate<br />
vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in<br />
die Gegenwart sowie die Sammlung von<br />
Werbeaufstellern und Verpackungen. Die<br />
Bildersammlung bietet mit ihren Bestän<strong>den</strong><br />
aus dem 16. bis 21. Jahrhundert einen<br />
Überblick <strong>zu</strong>r Technik-, Industrie- und Sozialgeschichte.<br />
Sie bezeugt sowohl die technischen<br />
Errungenschaften als auch die<br />
Lebensumstände der Menschen, die technische<br />
Objekte erfan<strong>den</strong>, mit ihnen arbeiteten<br />
und lebten.<br />
Einzelne Nachlässe des Architektenpaares<br />
Schüler-Witte, des Luftfahrthistorikers<br />
Schreurs, des Eisenbahnhistorikers Metzeltin<br />
sowie die Bestände der Borsigschen Vermögensverwaltung,<br />
des Instituts und<br />
Museums für Meereskunde und des Verkehrs-<br />
und Baumuseums bestehen als<br />
eigenständige Sammlungen innerhalb der<br />
Bildersammlung. Im 1986 übernommenen<br />
Nachlass von Schüler-Witte befin<strong>den</strong> sich<br />
Plakate, Lokomotiv-Baupläne, Fahrpläne,<br />
Postkarten, Grafiken, Handzeichnungen<br />
und Gemälde von W. Kohlhoff von 1940–<br />
1970. Im Bestand Schreurs sind Druckgrafiken<br />
und Handzeichnungen <strong>zu</strong>r Luftfahrt-<br />
geschichte zwischen dem 18. und dem 20.<br />
Jahrhundert vertreten. Der Nachlass Metzeltin<br />
besteht überwiegend aus Druckgrafiken<br />
und Handzeichnungen <strong>zu</strong>r Eisenbahngeschichte<br />
um 1900. Die Bildersammlung<br />
des Bestandes der Borsigschen Vermögensverwaltung<br />
ist mit Gemäl<strong>den</strong>, Grafiken<br />
und Handzeichnungen <strong>zu</strong>r Industriegeschichte<br />
von der Mitte des 19. Jahrhunderts<br />
bis <strong>zu</strong>m Beginn des 20. Jahrhunderts<br />
repräsentiert.<br />
Die archivische Sammlung des Instituts<br />
und Museums für Meereskunde umfasst<br />
Druckgrafik und Handzeichnungen <strong>zu</strong>r<br />
Schifffahrtsgeschichte zwischen dem 17.<br />
und 19. Jahrhundert. Der Sammlung des<br />
Verkehrs- und Baumuseums setzt sich aus<br />
Gemäl<strong>den</strong>, Druckgrafik und Handzeichnungen<br />
<strong>zu</strong>m Eisenbahn-, Wasserbau- und<br />
Hochbaubereich von 1830–1945 <strong>zu</strong>sammen.<br />
Gemälde<br />
Dieser Sammlungsteil enthält ca. 100 Bilder<br />
des 19. bis 21. Jahrhunderts in Form von<br />
Ölgemäl<strong>den</strong>, Aquarellen, Tempera und anderen<br />
Maltechniken. Kunstwerke aus dem<br />
Bestand des Verkehrs- und Baumuseums,<br />
der Borsigschen Vermögensverwaltung, der<br />
Sammlung Schreurs und der Sammlung<br />
Schüler-Witte existieren als eigenständige<br />
Sammlungen.<br />
Im Bestand des Verkehrs- und Baumuseums<br />
sind der Künstler W. Obronski und der<br />
Industriemaler Otto Bollhagen <strong>zu</strong> fin<strong>den</strong>.<br />
Der Maler P. F. Meyerheim ist mit zwei<br />
Gemäl<strong>den</strong> aus dem 7-teiligen Zyklus „Lebensgeschichte<br />
der Lokomotive“ vertreten,<br />
die als Auftragsarbeiten für die Loggia der<br />
DEUTSCHES TECHNIKMUSEUM BERLIN 5 | 2008<br />
Villa Borsig in Moabit zwischen 1873–1876<br />
gefertigt wur<strong>den</strong> und heute im 1. Lokschuppen<br />
des DTMB hängen. Aus dem Borsig-Archiv<br />
treten die Künstler A. Mödinger<br />
und Carl E. Biermann mit Darstellungen<br />
industrieller Fabrikanlagen hervor. Weitere<br />
namhafte Künstler der Bildersammlung sind<br />
O. Antoine, L. Sandrock und H. Uhl. G. Fenkohl<br />
und F. Suplie sind mit Darstellungen<br />
des Schiffshebewerks Niederfinow vertreten.<br />
Zeichnungen<br />
Zu diesem Bestand gehören u.a. 20 Zeichnungen<br />
aus dem Bestand des Verkehrsund<br />
Baumuseums und ca. 30 Zeichnungen<br />
des Instituts und Museums für Meereskunde.<br />
Aus der Sammlung des Verkehrs- und<br />
Baumuseums sind insbesondere die farbige<br />
Zeichnung vom Salonwagen für König<br />
Georg V. von Hannover und Karikaturen<br />
<strong>zu</strong> einem Schlafwagen von L. Storch hervor<strong>zu</strong>heben.<br />
Aus dem Bestand des Museums<br />
für Meereskunde ist der Landschaftsund<br />
Marinemaler H. Penner <strong>zu</strong> nennen.<br />
Neben Entwürfen von A. Messel <strong>zu</strong>m Kaufhaus<br />
Wertheim in der Leipziger Straße sind<br />
auch Zeichnungen von W. Knapp mit Darstellungen<br />
der Berliner U-Bahn <strong>zu</strong> fin<strong>den</strong>.<br />
Grafik<br />
Der Grafikbestand umfasst ca. 1200 Original-<br />
und Reproduktionsgrafiken aus dem<br />
16. bis 21. Jahrhundert. In der Sammlung<br />
aus dem Nachlass Wehde befin<strong>den</strong> sich<br />
überwiegend Kupfer- und Holzstiche aus<br />
der Geschichte der Schifffahrt vom 17.–19.<br />
Jahrhundert, so z. B. Ansichten von Seeschlachten,<br />
und Stadtansichten von L. Bakk-<br />
s P. F. Meyerheim: Eisenbahnbrücke über s P. Braumüller: Ballonflug im Berliner Verein für Luftschiffahrt, um 1905.<br />
<strong>den</strong> Rhein, 1875. Foto: C. Kirchner/DTMB Foto: DTMB
DEUTSCHES TECHNIKMUSEUM BERLIN 5 | 2008<br />
s J. G. Wolffgang: Lustschiff König<br />
Friedrichs I. von Preußen. Foto: DTMB<br />
s Hans Rudolf Manuel Deutsch: Meeresungeheuer,<br />
um 1550. Foto: DTMB<br />
huisen, J. G. Wolffgang, R. Dodd, M. de<br />
Ruyter, M. Merian, S. della Bella, J. van<br />
Someren, N. Simonsen, A. Kittendorfer, A.<br />
Gio und R. Purcell, überwiegend aus der<br />
Zeit zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert.<br />
Der Nachlass Metzeltin enthält Grafiken<br />
<strong>zu</strong>r Geschichte des Eisenbahnwesens. Ein<br />
weiteres Grafik-Konvolut <strong>zu</strong>r Eisenbahngeschichte<br />
aus dem Nachlass eines Frankfurter<br />
Antiquars enthält u.a. Eisenbahnspiel-<br />
Tableaus <strong>zu</strong>r Pariser Weltausstellung 1855.<br />
In der Sammlung befin<strong>den</strong> sich auch Notenblätter<br />
<strong>zu</strong> Eisenbahn-Tänzen und der Eisenbahn-Lust-Walzer<br />
von J. Strauß. Der grafische<br />
Bereich der Sammlung Schreurs<br />
enthält u. a. Kupferstiche <strong>zu</strong>r Geschichte<br />
der Ballone in Frankreich aus dem 18. Jahrhundert.<br />
Im Nachlass Gütschow sind Abbildungen<br />
<strong>zu</strong>r Geschichte der Luftfahrt <strong>zu</strong>sammengefasst.<br />
Der Maler und Grafiker J.<br />
Turner ist mit Radierungen <strong>zu</strong> Industriebauten<br />
und Eisenbahndarstellungen vertreten.<br />
Weitere Künstler wie S. Sigrist, W.<br />
D<strong>zu</strong>baj und A. Kampf sind durch einzelne<br />
s Plakat aus <strong>den</strong> 1930er Jahren<br />
Foto: C. Kirchner/DTMB<br />
Werke <strong>zu</strong>m Schienenverkehr und <strong>zu</strong>m Arbeitsleben<br />
repräsentiert. Aus dem Bestand<br />
des Verkehrs- und Baumuseums ist eine von<br />
M. Klinger gestaltete Ehrenurkunde für die<br />
Hygiene-Ausstellung 1911 in Dres<strong>den</strong> hervor<strong>zu</strong>heben.<br />
Plakate<br />
Die Sammlung enthält ca. 2000 Werbeplakate<br />
und Plakatentwürfe namhafter<br />
Wirtschaftsunternehmen, überwiegend <strong>zu</strong>r<br />
Geschichte der Luftfahrt, und des Automobilwesens.<br />
Im einzelnen liegen Plakate<br />
der Werbegrafiker J. Gipkens und J. Klinger<br />
mit Motiven <strong>zu</strong> Flugveranstaltungen von<br />
1910–1917 vor. Im Bestand ist auchdas Plakat<br />
„Valier – Vorstoß in <strong>den</strong> Weltraum“<br />
(um 1930) von V. Römer <strong>zu</strong> fin<strong>den</strong>.<br />
Einen großen Teil nehmen die Arbeitsschutz-Plakate<br />
der Industria GmbH Berlin<br />
und der Ponti-Gesellschaft aus <strong>den</strong> 1930er<br />
bis 1950er Jahren ein. Neben Unfall- und<br />
Arbeitsschutz sind hier die Arbeitsmoral,<br />
Arbeitsqualität, Rentabilität, das Verhalten<br />
am Arbeitsplatz sowie der Umgang mit <strong>den</strong><br />
Kollegen zentrale Plakatthemen. Aus dem<br />
Bereich des Schienenverkehrs befin<strong>den</strong> sich<br />
Plakate aus dem Nachlass Metzeltin und ca.<br />
20 Plakate der Deutschen Bundesbahn aus<br />
<strong>den</strong> 1960er Jahren im Inventar. Im Plakatbestand<br />
gibt es auch politische DDR-Plakate<br />
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands<br />
(SED), der Gesellschaft für Sport und<br />
Technik (GST) und der Gesellschaft für<br />
Deutsch-Sowjetische Freundschaft (DSF).<br />
Zum AEG-Bestand gehören Plakate <strong>zu</strong><br />
AEG-Lampen des Architekten und Grafikers<br />
P. Behrens. Ferner sind Plakate <strong>zu</strong> AEG-<br />
Haushaltsgeräten wie z. B. dem „Vampyr“-<br />
s Werbeaufsteller „Schmerz laß nach“,<br />
1958. Foto: DTMB<br />
Staubsauger, „Olympia“– Schreibmaschinen<br />
und Werbung der Firma Telefunken<br />
vorhan<strong>den</strong>. Eine gesonderte Sammlung<br />
setzt sich aus großformatigen französischen<br />
Fahrradplakaten seit 1895 <strong>zu</strong>sammen. Diese<br />
Sammlung ist dem Düsseldorfer Fahrradhändler<br />
G. Volke <strong>zu</strong> verdanken, der<br />
1980 dem Museum sein „Velociped-Archiv“<br />
übergab. Die künstlerische Grafik der<br />
lithografischen Plakate wird durch bekannte<br />
Künstler wie PAL (J. de Paléologue), Misti<br />
(F. Mist-Mifliez) oder H. Gray repräsentiert.<br />
Werbeaufsteller<br />
Die Sammlung besteht vorwiegend aus<br />
Aufstellern für die Schaufensterwerbung<br />
zwischen 1930 und 1970. Vertreten sind<br />
Firmen mit Produkten des täglichen Bedarfs.<br />
Hervor<strong>zu</strong>heben ist der Bestand von<br />
Werbeaufstellern und Verpackungen <strong>zu</strong>m<br />
Drogeriebedarf. Ein Großteil dieses Bestandes<br />
besteht aus dem Geschäftsnachlass<br />
einer Drogerie aus der DDR. Dieses Konvolut<br />
umfasst Produktwerbung verschie<strong>den</strong>er<br />
Cremes und Pflegemittel, z.B. von PRAX<br />
über Putz-, Scheuer- und Spülmittel wie<br />
ATA oder IMI bis hin <strong>zu</strong> Mitteln gegen<br />
Ameisen, Fliegen und Motten von Delicia.<br />
Ein weiterer thematischer Schwerpunkt<br />
sind Werbeaufsteller und Tüten mit Werbung<br />
für Rollfilme der Firmen Gevaert,<br />
Kodak und Agfa. Im Bereich der Textilbekleidung<br />
fin<strong>den</strong> sich die Marken Triumph,<br />
Schiesser und Jockey im Bestand. Kathreiners<br />
Malzkaffee ist ebenso mit Werbeaufstellern<br />
vertreten wie Knorr-Produkte oder<br />
Zinsser Allsat Knoblauchperlen und -pillen.<br />
37<br />
ARCHIV<br />
MARTIN BRENNIGK
38<br />
BIBLIOTHEK<br />
Fotoalben<br />
und Videos<br />
Fotoalben<br />
Die Sammlung umfasst bisher ca. 380 Alben.<br />
Hier<strong>zu</strong> zählen Erinnerungsalben, insbesondere<br />
von Militärangehörigen aus dem<br />
Bereich Luftfahrt des Ersten und Zweiten<br />
Weltkrieges, aber auch von Privatpersonen,<br />
die ihren Urlaub in Alben festgehalten haben.<br />
Ein anderer Teil der Fotoalben ist im<br />
Auftrag von Firmen hergestellt wor<strong>den</strong>, die<br />
ihre Produkte bzw. Arbeitsbereiche vorstellen.<br />
Die technischen Schwerpunkte bil<strong>den</strong><br />
Luftfahrt- und Bahntechnik, Architektur,<br />
Industrie, Handwerk und der Bereich<br />
Personenbeförderung. Die Aufnahmen reichen<br />
vom privaten Schnappschuss bis <strong>zu</strong>r<br />
professionellen Industriefotografie. Die<br />
gezeigte Auswahl soll einen Eindruck davon<br />
vermitteln, dass neben Prachtalben, die<br />
schon durch die Art der Anfertigung, Gestaltung<br />
und Größe ihre Bedeutung vermitteln,<br />
auch Alben von beschei<strong>den</strong>er<br />
Ausstattung durchaus durch ihre Inhalte<br />
beeindrucken. Das gilt z. B. für die Fotoreihe<br />
<strong>zu</strong> dem Unglück beim Bau der Nord-<br />
Süd-Bahn am 20.08.1935 in Berlin oder die<br />
Röntgenfotografien von Prof. König in<br />
Frankfurt am Main. Eine größere Zahl der<br />
Alben stammt aus der Sammlung Metzel-<br />
s Fotoalbum Victoria-Versicherung<br />
in Berlin, ca. 1909. Foto: DTMB<br />
tin. Das älteste Album ist aus der zweiten<br />
Hälfte des 19. Jahrhunderts, das neueste<br />
stammt von 1991. Die Sammlung ist nicht<br />
abgeschlossen. Die überwiegende Zahl ist<br />
mit Hilfe der EDV voll erschlossen. Die Textinformationen<br />
<strong>zu</strong> <strong>den</strong> Alben wer<strong>den</strong> durch<br />
Digitalfotos, die in die Datensätze eingebun<strong>den</strong><br />
sind, ergänzt.<br />
DEUTSCHES TECHNIKMUSEUM BERLIN 5 | 2008<br />
CLAUS BRÜNDEL<br />
Videos<br />
Der Bestand umfasst etwa 500 Videos von<br />
Filmmaterial aus <strong>den</strong> Jahren ab 1900, wobei<br />
auch hier der Grundstock vom Förderverein<br />
gesammelt wurde. Zumeist handelt es<br />
s Damenhand im Handschuh mit Armband<br />
und Blumenstrauß. Foto: DTMB<br />
s Prachtalbum <strong>zu</strong>r Silbernen Hochzeit<br />
von Dir. Bachmann, 1887. Foto: DTMB<br />
sich dabei um Videomitschnitte von technikbezogenen<br />
Fernsehsendungen oder<br />
Videoumspielungen von Filmmaterial. Der<br />
Bestand wächst durch Belegexemplare, die<br />
das Museum von Fernsehanstalten und<br />
Produktionsfirmen erhält. Drei bedeutende<br />
Bestände sind in diesem Sammlungsbereich<br />
<strong>zu</strong> fin<strong>den</strong>: <strong>zu</strong>m einen die Dokumentation<br />
<strong>zu</strong>m Windmühlenaufbau des DTMB, <strong>zu</strong>m<br />
anderen die Luftfahrthistorische Dokumentationssammlung<br />
<strong>zu</strong>m Thema „Lilienthal“<br />
und eine Materialsammlung <strong>zu</strong>r Geschichte<br />
des Rundfunks, beide vom Rundfunkjournalisten<br />
Werner Schwipps.<br />
PETER MIKA<br />
s Videokassette mit der Dokumentation<br />
„Otto Lilienthal“. Foto: DTMB<br />
s Prachtalbum <strong>zu</strong>m Ausbau der Bahnstrecke<br />
Eisenerz-Vordernberg, 1890. Foto: DTMB
Kleine Erwerbungen<br />
DEUTSCHES TECHNIKMUSEUM BERLIN 5 | 2008<br />
Die Kleinen Erwerbungen bestehen <strong>zu</strong>meist<br />
aus Einzelstücken, die in anderen<br />
archivalischen Sammlungen nicht untergebracht<br />
wer<strong>den</strong> konnten. Sie sind jedoch von<br />
Wert für sozial- und kulturgeschichtliche<br />
s Mitgliedskarte der Betriebssportgruppe<br />
der Junkers, Dessau. Foto: DTMB<br />
s Album <strong>zu</strong>m Bau des Flughafens Tempelhof 1937.<br />
Foto: DTMB<br />
Forschungen. Enthalten sind z. B. Notgeld,<br />
Lebensmittelkarten, Arbeits-, Haushaltsbücher,<br />
Mitgliedskarten für verschie<strong>den</strong>e Vereine<br />
wie z. B. Automobilklubs, Radfahrvereine<br />
oder Betriebssportgruppen.<br />
s Arbeitszeitbuch für <strong>den</strong> Kraftdroschkenführer<br />
B. Witte, Berlin. Foto: DTMB<br />
Für die Geschichte des öffentlichen Nahverkehrs<br />
in Berlin sehr interessant ist die<br />
Akte <strong>zu</strong>m Hochbahnunglück am Gleisdreieck<br />
1908. Sie enthält nicht nur die Unterlagen<br />
über <strong>den</strong> Prozess gegen <strong>den</strong> „Unglücksfahrer“,<br />
sondern es wur<strong>den</strong> nach<br />
diesem Unglück auch umfangreiche Untersuchungen<br />
<strong>zu</strong>r Unfallverhütung und <strong>zu</strong>r<br />
Auslastung der Hochbahn angestellt, die<br />
dieser Akte beigefügt sind<br />
Für Freunde der Fliegerei von besonderem<br />
Interesse ist das grafisch schön gestaltete<br />
Album <strong>zu</strong>m Ausbau des Flughafens Tempelhof<br />
von 1937, dem Ingenieur Ernst Sagebiel<br />
gewidmet, und zahlreiche Flugbücher<br />
s Schnittmuster im Postkartenformat.<br />
Foto: DTMB<br />
vom Ballonfahrer über <strong>den</strong> Segelflieger bis<br />
<strong>zu</strong>m Motorflugpiloten. Kleine Kuriosa sind<br />
die Schnittmuster für Kleidung, Pantoffeln<br />
oder Schuhe aus dem Zweiten Weltkrieg,<br />
die oft aus Zeitungspapier selbst entworfen<br />
oder noch 1945 als Notschnittmuster im<br />
Postkartenformat vertrieben wur<strong>den</strong>.<br />
Die Sammlung enthält <strong>zu</strong>r Zeit 1900 verzeichnete<br />
Einheiten aus dem Zeitraum von<br />
1750–2006 und wird ständig ergänzt.<br />
URSULA SCHÄFER-SIMBOLON<br />
s Detail einer Lebensmittelkarte von<br />
Groß-Berlin, 1950. Foto: DTMB<br />
39<br />
BIBLIOTHEK
40<br />
DEUTSCHES TECHNIKMUSEUM BERLIN 5 | 2008<br />
Werbeschrift der Hortaxin-Werke, Berlin-Neukölln, Januar 1916. Foto: DTMB<br />
Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin<br />
(DTMB)<br />
Trebbiner Straße 9, 10963 Berlin<br />
U-Bahn Gleisdreieck und Möckernbrücke<br />
S-Bahn Anhalter Bahnhof (Südausgang)<br />
Tel.: (030) 90254-0, Fax: (030) 90254-175<br />
www.dtmb.de, E-Mail: info@dtmb.de<br />
Öffentlichkeitsarbeit: Ulrike Andres<br />
Tel.: (030) 90254-224, E-Mail: andres@dtmb.de<br />
Di.–Fr. 9.00–17.30 Uhr<br />
Sa, So,. Feiertage 10.00–18.00 Uhr<br />
Montag geschlossen<br />
Science Center Spectrum<br />
Möckernstraße 26, 10963 Berlin<br />
Tel.: (030) 90254-284, Fax: (030) 90254-283<br />
E-Mail: spectrum@dtmb.de<br />
Di.–Fr. 9.00–17.30 Uhr<br />
Sa, So,. Feiertage 10.00–18.00 Uhr<br />
Montag geschlossen<br />
Oldtimer-Depot<br />
Wegen Umbauarbeiten bis auf Weiteres<br />
geschlossen.<br />
Bibliothek, Historisches Archiv<br />
Di.–Do. 10.00–17.15 Uhr, Fr. 10.00–14.00 Uhr<br />
Bibliothek: Tel.: (030) 90254-113<br />
Historisches Archiv: Tel.: (030) 90254-133<br />
Freunde und Förderer des<br />
Deutschen Technikmuseums Berlin e.V. (FDTM)<br />
Trebbiner Straße 9, 10963 Berlin<br />
Tel: (030) 262 20 31, Fax (030) 26 55 81 85<br />
Homepage: über www.dtmb.de<br />
E-Mail: fdtm-Berlin@t-online.de<br />
Die Geschäftsstelle im Stellwerk ist<br />
donnerstags von 10.00–13.00 Uhr geöffnet.<br />
Archenhold-Sternwarte<br />
Alt-Treptow 1, 12435 Berlin<br />
Tel.: (030) 534 80 80, Fax: (030) 534 80 83<br />
www.astw.de, E-Mail: zgp@astw.de<br />
Besichtigung: Mi.–So. 14.00–16.30 Uhr<br />
Zeiss-Großplanetarium<br />
Prenzlauer Allee 80, 10405 Berlin<br />
Tel.: (030) 42 18 45 12, Fax: (030) 42 51 252<br />
www.astw.de, E-Mail: zgp@astw.de<br />
Förderverein der Archenhold-Sternwarte<br />
und des Zeiss-Großplanetarium Berlin e.V.<br />
Archenhold-Sternwarte<br />
z. Hd. Herrn D. Fürst (Sekretär)<br />
Alt-Treptow 1, 12435 Berlin<br />
Tel.: (030) 534 80 80, Fax (030) 534 80 83<br />
E-Mail: dfuerst@astw.de<br />
Zucker-Museum<br />
Amrumer Straße 32, 13353 Berlin<br />
Tel.: (030) 31 42 75 74, Fax: (030) 31 42 75 86<br />
E-Mail: <strong>zu</strong>ckermuseum@berlin.de<br />
Mo.–Do. 9.00–16.30 Uhr, So. 11.00–18.00 Uhr<br />
Fördererkreis Zucker-Museum e.V.<br />
c/o Verlag Dr. Albert Bartens KG<br />
z. H. Herrn Dr. Jürgen Bruhns<br />
Lückhoffstraße 16, 14129 Berlin<br />
Tel.: (030) 803 56 78, Fax: (030) 803 20 49<br />
www.foerdererkreis-<strong>zu</strong>cker-museum.de<br />
E-Mail: JBruhns@bartens.com<br />
Zu unseren Titelfotos:<br />
Oben: Der Technikhistoriker Franz<br />
Maria Feldhaus vor seiner<br />
Arbeitskartei. Foto: DTMB<br />
Unten links: Lesezimmer der Bibliothek des<br />
Vereins Deutscher Ingenieure<br />
in der Berliner Dorotheenstrasse<br />
um 1930. Foto: DTMB<br />
Unten Mitte: Kartenlesesaal des ehemaligen<br />
Museums für Meereskunde.<br />
Foto: DTMB<br />
Unten rechts: Blick in <strong>den</strong> Lesesaal des DTMB.<br />
Foto: DTMB<br />
01<br />
02<br />
03<br />
04<br />
05<br />
06<br />
07<br />
08<br />
09<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
30<br />
31<br />
32<br />
33<br />
34<br />
35<br />
36<br />
37<br />
38<br />
39<br />
40<br />
41<br />
42<br />
43<br />
44<br />
45<br />
46<br />
47<br />
48<br />
49<br />
50<br />
61<br />
62<br />
63<br />
64<br />
65<br />
66<br />
67<br />
68<br />
69<br />
70<br />
71





![Faltblatt mit Stellplan [ PDF , 5189 kB ] - Deutsches Technikmuseum](https://img.yumpu.com/21363070/1/131x260/faltblatt-mit-stellplan-pdf-5189-kb-deutsches-technikmuseum.jpg?quality=85)



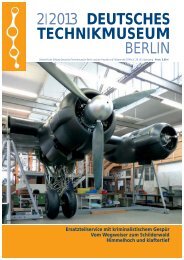


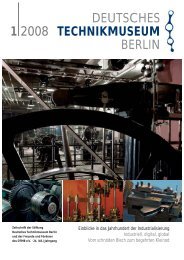
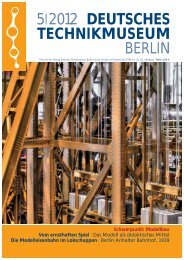
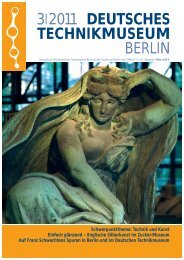

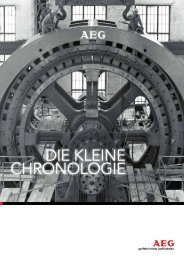
![Arbeitsblatt Klasse 7-13 [ PDF , 287 kB ]](https://img.yumpu.com/7070538/1/184x260/arbeitsblatt-klasse-7-13-pdf-287-kb-.jpg?quality=85)