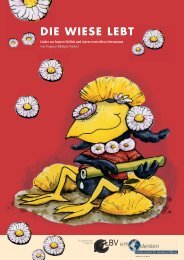Lokale Agenda 21 und Wirtschaft - Umdenken - Landeszentrale für ...
Lokale Agenda 21 und Wirtschaft - Umdenken - Landeszentrale für ...
Lokale Agenda 21 und Wirtschaft - Umdenken - Landeszentrale für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Landeszentrale</strong> <strong>für</strong> Umweltaufklärung (Hrsg.)<br />
<strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong><br />
Schlussbericht zum Modellprojekt in Rheinland-Pfalz<br />
B.A.U.M. Consult GmbH München <strong>und</strong> Hamm
Auftraggeber / Herausgeber:<br />
<strong>Landeszentrale</strong> <strong>für</strong> Umweltaufklärung<br />
Roland Horne<br />
<strong>Landeszentrale</strong> <strong>für</strong> Umweltaufklärung (LZU),<br />
Rheinland-Pfalz<br />
Kaiser-Friedrich-Str. 1, 55116 Mainz<br />
E-Mail: roland.horne@umdenken.de<br />
www.umdenken.de<br />
Projektbearbeitung:<br />
B.A.U.M. Consult GmbH<br />
Ludwig Karg (Geschäftsführer), Jobst Münderlein<br />
Gotzinger Str. 48/50<br />
81371 München<br />
L.Karg@baumgroup.de; J.Muenderlein@baumgroup.de<br />
Johannes Auge (Geschäftsführer )<br />
Sachsenweg 9<br />
59073 Hamm<br />
J.Auge@baumgroup.de<br />
www.baumgroup.de<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
2
Kontakte zu den Verbandsgemeinden<br />
Verbandsgemeinden Kirchen <strong>und</strong> Betzdorf<br />
Ansprechpartnerin <strong>für</strong> die Verbandsgemeinde Kirchen:<br />
Frau Monika Lieth (<strong>Agenda</strong>beauftragte)<br />
Lindenstr. 1, 57548 Kirchen<br />
E-Mail: m.lieth@kirchen-sieg.de<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Ansprechpartner <strong>für</strong> die Verbandsgemeinde Betzdorf (im Auftrag):<br />
Ingenieurbüro Gottfried Frings<br />
Finkenweg 2, 57518 Steineroth<br />
Frings-Ing@t-online.de<br />
Verbandsgemeinde Kandel<br />
Ansprechpartnerin:<br />
Silke Wiedrig (<strong>Agenda</strong>beauftragte)<br />
Gartenstraße 8, 76870 Kandel<br />
E-Mail: wiedrigs@vg-kandel.de<br />
3
Inhalt<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
1 Aufgabenstellung im Modellprojekt....................................................................................6<br />
2 Ausgangssituation................................................................................................................7<br />
2.1 Stand der <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> in Rheinland-Pfalz ........................................................7<br />
2.2 Auswahl der Modellkommunen.....................................................................................7<br />
2.2.1 Auswahlkriterien...............................................................................................8<br />
2.2.2 Verbandsgemeinden Kirchen <strong>und</strong> Betzdorf .....................................................8<br />
2.2.3 VG Kandel......................................................................................................10<br />
3 Kirchen <strong>und</strong> Betzdorf .........................................................................................................12<br />
3.1 Ergebnis der Potenzialanalyse....................................................................................13<br />
3.2 Vorgehen im Modellprojekt .........................................................................................15<br />
3.3 Projekte .......................................................................................................................17<br />
3.3.1 Energieforum..................................................................................................17<br />
3.3.2 Energieberatung.............................................................................................18<br />
3.3.3 Bürger-Photovoltaik-Anlage ...........................................................................18<br />
3.3.4 Internetplattform .............................................................................................19<br />
3.3.5 Nachhaltige Mobilität in der Region ...............................................................20<br />
3.4 Strukturen....................................................................................................................<strong>21</strong><br />
3.4.1 Arbeitskreise...................................................................................................<strong>21</strong><br />
3.4.2 Internetplattform .............................................................................................<strong>21</strong><br />
3.4.3 <strong>Agenda</strong>beauftragte.........................................................................................<strong>21</strong><br />
3.5 Weiteres Vorgehen......................................................................................................<strong>21</strong><br />
4 Kandel ..................................................................................................................................22<br />
4.1 Ergebnis der Potenzialanalyse....................................................................................23<br />
4.2 Vorgehen im Modellprojekt .........................................................................................24<br />
4.3 Projekte .......................................................................................................................26<br />
4.3.1 <strong>Lokale</strong>s Ressourcennetzwerk ........................................................................26<br />
4.3.2 Holzhackschnitzelanlage................................................................................30<br />
4.3.3 Pflanzenöl als Treibstoff.................................................................................30<br />
4.3.4 Tag der offenen Unternehmen <strong>für</strong> Auszubildende.........................................31<br />
4.3.5 Direktvermarktungsinitiative „Bauerntheke"...................................................31<br />
4.3.6 Weitere Aktivitäten .........................................................................................32<br />
4.4 Strukturen....................................................................................................................32<br />
4.4.1 Arbeitskreise...................................................................................................32<br />
4.4.2 FREK – „Verein zur Förderung regenerativer Energien Kandel e.V." ...........33<br />
4.4.3 MBR-Südpfalz e.V .........................................................................................33<br />
4.4.4 Verein <strong>für</strong> Gewerbe <strong>und</strong> Handel e.V. .............................................................34<br />
4.4.5 Stadtmarketingprozess ..................................................................................34<br />
4.4.6 E-Newsletter „Nachhaltiges <strong>Wirtschaft</strong>en“ .....................................................34<br />
4.5 Weiteres Vorgehen......................................................................................................35<br />
4
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
5 Erfahrungen aus dem Modellprojekt.................................................................................36<br />
5.1 Externe Rahmenbedingungen ....................................................................................36<br />
5.1.1 „Die Mühen der Ebene“..................................................................................36<br />
5.1.2 Globale Trends...............................................................................................36<br />
5.2 <strong>Lokale</strong> Herausforderungen im Modellvorhaben ..........................................................37<br />
5.2.1 Stakeholdermanagement ...............................................................................37<br />
5.2.1.1 Rolle der Verwaltung.........................................................................38<br />
5.2.1.2 <strong>Wirtschaft</strong>sakteure ............................................................................38<br />
5.2.1.3 Bürgerschaft......................................................................................39<br />
5.2.1.4 Externe Berater .................................................................................39<br />
5.2.2 Konfliktmanagement / Politische Unwägbarkeiten.........................................40<br />
5.2.3 Kooperation mit der <strong>Wirtschaft</strong>.......................................................................40<br />
5.2.3.1 Einbindung der lokalen <strong>Wirtschaft</strong>sakteure.......................................40<br />
5.2.3.2 Gute Beispiele / Erfolge motivieren...................................................41<br />
5.2.3.3 Projektmanagement..........................................................................43<br />
5.2.4 Regionalisierung der Nachhaltigkeit ..............................................................43<br />
6 Fazit <strong>und</strong> Ausblicke ............................................................................................................45<br />
6.1 Die richtigen Themenfelder .........................................................................................45<br />
6.1.1 Kostensenkungspotenziale durch betrieblichen Umweltschutz.....................45<br />
6.1.2 Erneuerbare Energien....................................................................................46<br />
6.1.3 Regionale Kooperationen...............................................................................46<br />
6.2 Partnerschaften stiften ................................................................................................47<br />
6.2.1 Betriebliche Kooperationen ............................................................................47<br />
6.2.2 Erfahrungsaustausch zwischen kommunalen Akteuren ................................48<br />
6.2.3 Multilaterale Partnerschaftsansätze...............................................................48<br />
6.3 Ausblicke .....................................................................................................................49<br />
6.3.1 Stabilisierungsempfehlungen.........................................................................49<br />
6.3.2 Neue Themenfelder erschließen....................................................................51<br />
7 Literatur................................................................................................................................54<br />
8 Ausgewählte Internetadressen..........................................................................................57<br />
9 Anhänge...............................................................................................................................59<br />
9.1 Details zu Arbeitsprozess <strong>und</strong> Ergebnissen ...............................................................59<br />
9.1.1 VG Kirchen <strong>und</strong> VG Betzdorf .........................................................................59<br />
9.1.2 VG Kandel......................................................................................................62<br />
9.2 Stabilisierungsbedingungen ........................................................................................67<br />
5
1 Aufgabenstellung im Modellprojekt<br />
„<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> – da geht nichts!“<br />
So oder so ähnlich hört man die Verantwortlichen<br />
<strong>für</strong> <strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> Prozesse häufig<br />
klagen. Die <strong>Landeszentrale</strong> <strong>für</strong> Umweltaufklärung<br />
in Rheinland-Pfalz wollte das nicht glauben<br />
<strong>und</strong> hat just zu Beginn des <strong>21</strong>. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
ein Modellprojekt dazu ins Leben gerufen.<br />
Es gibt eine Fülle guter Beispiele, aber wohl<br />
kein „Patentrezept“, um Unternehmen in den<br />
Prozess der nachhaltigen Kommunalentwicklung<br />
dauerhaft einzubinden. In zwei Verbandsgemeinden<br />
sollten übertragbare Vorgehensweisen<br />
erprobt <strong>und</strong> dokumentiert<br />
werden.<br />
Am Ende des Projekts sollte eine Dokumentation<br />
stehen, die allen Verbandsgemeinden<br />
in Rheinland Pfalz <strong>und</strong> darüber hinaus, u.a.<br />
auf folgende Fragen erste Antworten geben<br />
kann: 1<br />
• Wie kann in einer Kommune die Kooperation<br />
<strong>und</strong> Einbindung der <strong>Wirtschaft</strong> in<br />
1 Diese Dokumentation der Kommunikations- <strong>und</strong><br />
Entwicklungsprozesse sollte damit auch als Gr<strong>und</strong>lage<br />
<strong>für</strong> die Erarbeitung eines entsprechenden Leitfadens<br />
dienen.<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Innovationsprozesse gestaltet werden?<br />
Wie können Win-Win-Situationen initiiert<br />
<strong>und</strong> befördert werden?<br />
• Welche nachahmenswerten Projekte <strong>und</strong><br />
Aktivitäten („best practices“ = Gute<br />
Beispiele) gibt es? Was sind<br />
wegweisende „Aufhänger“ <strong>für</strong> den<br />
Entwicklungsprozess vor Ort?<br />
• Wie schafft man Strukturen, die nachhaltige<br />
Entwicklung auf Verbandsgemeindeebene<br />
auch in den nächsten<br />
Jahrzehnten sicherstellen?<br />
• Wie können betriebliche Prozesse <strong>und</strong><br />
eine nachhaltige Kommunalentwicklung<br />
zusammengebracht werden?<br />
Dass das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile<br />
ein Wettbewerbsfaktor <strong>für</strong> viele Unternehmen<br />
geworden ist, belegen aktuelle Studien (s.<br />
Kasten).<br />
Ökoradar: Wettbewerbsfaktor Nachhaltigkeit<br />
Nachhaltigkeit, darüber sind sich Wissenschaft, Politik <strong>und</strong><br />
auch zahlreiche Unternehmen einig, ist heute ein zentraler<br />
Wettbewerbsfaktor.<br />
Dennoch ist Nachhaltigkeit <strong>für</strong> die Praxis bislang kaum handlungsleitend.<br />
Erhebliche Informationsdefizite <strong>und</strong> mangelndes<br />
Know-how können als wesentliche Gründe da<strong>für</strong> benannt<br />
werden. Das zeigte eine im Auftrag des BMBF-geförderten<br />
Verb<strong>und</strong>projektes „Ökoradar“ durchgeführte Unternehmensbefragung<br />
durch das IFO-Institut.<br />
Und zuversichtlich stimmt, was die Studie ebenfalls bestätigt,<br />
dass die Mehrheit der Betriebe <strong>und</strong> Unternehmen, die in den<br />
vergangenen Jahren ihre Unternehmensentwicklung an der<br />
Nachhaltigkeit orientiert hatten, nicht nur ihre Umsatzentwicklung<br />
als zufriedenstellend bis positiv (71%) empfinden, sondern<br />
immerhin 41% auch generell eine Verbesserung ihrer<br />
Wettbewerbsfähigkeit sehen. Insbesondere <strong>für</strong> kleinere <strong>und</strong><br />
mittlere Unternehmen (KMU) ist dies ein wesentliches Motiv<br />
um auf Nachhaltigkeit zu setzen.<br />
Quelle: Nachhaltiges <strong>Wirtschaft</strong>en in Deutschland. Erfahrungen,<br />
Trends <strong>und</strong> Potenziale, Ifo-Institut, August 2002,<br />
www.oekoradar.de<br />
6
2 Ausgangssituation<br />
2.1 Stand der <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> in<br />
Rheinland-Pfalz<br />
In Rheinland-Pfalz verlief die Entwicklung<br />
zur <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> in den letzten Jahren<br />
recht dynamisch. Viele Kommunen haben<br />
die Bedeutung der partizipativen Elemente<br />
<strong>für</strong> eine Nachhaltige Entwicklung<br />
erkannt <strong>und</strong> versuchen die ökonomischen,<br />
sozialen <strong>und</strong> ökologischen Aspekte in ihrer<br />
Entwicklungsplanung gleichwertig zu berücksichtigen.<br />
Da es keinen Königsweg zu einer <strong>Lokale</strong>n<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> gibt, ist sehr viel Kreativität <strong>und</strong><br />
Experimentierfreude gefragt. Um so schwieriger<br />
ist es, den Stand aller <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong><br />
<strong>21</strong>-Prozesse in einer Umfrage quantitativ zu<br />
erfassen. Die <strong>Landeszentrale</strong> <strong>für</strong> Umweltaufklärung<br />
Rheinland-Pfalz hat deshalb nur<br />
statistisch erfasst, ob es in einer Kommune<br />
Aktivitäten zur <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> gibt <strong>und</strong><br />
ob hierzu ein parlamentarischer Beschluss<br />
vorliegt. Welche konkreten Aktionen vor Ort<br />
umgesetzt werden <strong>und</strong> wie der <strong>Agenda</strong>-<br />
Prozess im Detail strukturiert ist, kann in den<br />
Angaben der einzelnen Kommunen nachgelesen<br />
werden ( www.umdenken.de ).<br />
Detailliertere Auskunft zum Stand <strong>und</strong> der<br />
geografischen Lage der im Rahmen der<br />
<strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> aktiven Kommunen in<br />
Rheinland-Pfalz finden sich in der folgenden<br />
Übersicht.<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
2.2 Auswahl der Modellkommunen<br />
Anfang 2001 wurden von der B.A.U.M. Consult<br />
München in Abstimmung mit der <strong>Landeszentrale</strong><br />
<strong>für</strong> Umweltaufklärung (LZU) in einem zweistufigen<br />
Auswahlverfahren aus allen 163 Verbandsgemeinden<br />
2 des Landes Rheinland-Pfalz<br />
drei Partnergemeinden ausgewählt. Die Einladung<br />
zur Teilnahme am Modellprojekt wurde im<br />
Frühjahr 2000 über die <strong>Landeszentrale</strong> <strong>für</strong><br />
Umweltaufklärung sowie die kommunalen Gebietskörperschaften<br />
versandt.<br />
Der engagierte Rücklauf von Bewerbungen aus<br />
acht rheinland-pfälzischen Kommunen war ein<br />
deutliches Zeichen <strong>für</strong> das Interesse von Kommunen<br />
an der Einbeziehung der <strong>Wirtschaft</strong> in<br />
die <strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong>. Die Auswahl der Partnergemeinden<br />
erfolgte durch eine umfangreiche<br />
Befragung, die folgende Auswahlkriterien<br />
berücksichtigte:<br />
• Organisation <strong>und</strong> „Qualität“ des <strong>Agenda</strong><br />
<strong>21</strong>- Prozesses<br />
• Organisation der örtlichen <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
• Siedlungs- <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur der<br />
Verbandsgemeinde<br />
• Annähernd repräsentative Gemeindestruktur<br />
um die Übertragbarkeit der Ergebnisse<br />
zu gewährleisten<br />
2 Verbandsgemeinde kurz: VG<br />
7
Mit Hilfe einer Entscheidungstabelle wurden<br />
die Partnergemeinden, die Verbandsgemeinde<br />
Kandel sowie die Verbandsgemeinden<br />
Kirchen <strong>und</strong> Betzdorf gemeinsam<br />
ausgewählt. Die ausgewählten Modellkommunen<br />
hatten sowohl im Hinblick auf<br />
die bereits existierenden <strong>Agenda</strong><strong>21</strong>-<br />
Aktivitäten als auch bei der Einbindung<br />
bzw. Aktivierung der örtlichen <strong>Wirtschaft</strong><br />
erste Erfolge vorzuweisen <strong>und</strong> bereits<br />
typische Herausforderungen bewältigt.<br />
2.2.1 Auswahlkriterien<br />
Entscheidend <strong>für</strong> die Auswahl von Kirchen<br />
<strong>und</strong> Betzdorf war der Wunsch der beiden<br />
Verbandsgemeinden, über gemeinsame<br />
Aktivitäten im Rahmen der <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> das<br />
Zusammenwachsen der Region zu unterstützen.<br />
In jüngster Zeit verstärkte sich das<br />
Bewusstsein, dass der zunehmende Wettbewerb<br />
der Regionen ein gemeinsames<br />
Vorgehen erforderlich macht. Einzelne Kooperationen<br />
zeigten, dass beide Verbandsgemeinden<br />
voneinander profitieren können.<br />
Im Modellprojekt sahen die Bürgermeister<br />
der Verbandsgemeinden eine Chance, diesen<br />
Prozess des Zusammenwirkens im<br />
Bereich der <strong>Wirtschaft</strong>sförderung zu unterstützen.<br />
Zudem erhofften sich beide Verbandsgemeinden<br />
mit der Kooperation eine<br />
Belebung <strong>und</strong> gegenseitige Befruchtung der<br />
<strong>Agenda</strong>-<strong>21</strong>-Aktivitäten.<br />
Ein weiteres wichtiges Auswahlkriterium <strong>für</strong><br />
das Modellprojekt war der Erfahrungshintergr<strong>und</strong><br />
der beiden Verbandsgemeinden in<br />
Sachen <strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong>. In Kirchen liegt<br />
seit April 2000 ein Ratsbeschluss zur Umsetzung<br />
der <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> vor, der<br />
seitdem durch eine Koordinationsstelle bei<br />
der Verbandsgemeindeverwaltung intensiv<br />
begleitet <strong>und</strong> vorangetrieben wird. Mehrere<br />
Arbeitsgruppen <strong>und</strong> Projekte sind aus diesen<br />
Aktivitäten hervorgegangen. In Betzdorf<br />
ist ebenfalls eine Koordinierungsstelle ein-<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
gerichtet worden, die seit Dezember 1998 diverse<br />
Projekte <strong>und</strong> Einzelmaßnahmen auf den<br />
Weg gebracht hat.<br />
Die Auswahl der VG Kandel beruhte auf den<br />
bereits recht erfolgreich angelaufenen <strong>Agenda</strong><br />
<strong>21</strong>-Aktivitäten sowie dem Wunsch des Bürgermeisters<br />
durch das Modellvorhaben Impulse<br />
zur weiteren Aktivierung der Bürgerschaft <strong>und</strong><br />
zur Verknüpfung der <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> mit<br />
dem Stadtmarketingprozess der Stadt Kandel<br />
zu setzen.<br />
2.2.2 Verbandsgemeinden Kirchen <strong>und</strong><br />
Betzdorf<br />
Die Verbandsgemeinden Kirchen <strong>und</strong> Betzdorf<br />
gehören zum Landkreis Altenkirchen am nordöstlichen<br />
Rand von Rheinland-Pfalz. Sie befinden<br />
sich im Grenzbereich zwischen Westerwald<br />
<strong>und</strong> Siegerland in einer reizvollen <strong>und</strong><br />
waldreichen Mittelgebirgslandschaft.<br />
Wie in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland insgesamt<br />
bilden die kleinen <strong>und</strong> mittelständischen<br />
Betriebe auch im Kreis Altenkirchen das Rückgrat<br />
der <strong>Wirtschaft</strong>. Die überwiegende Anzahl<br />
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten<br />
wie auch die zur Verfügung stehenden Ausbil-<br />
dungsplätze gibt es in kleinen <strong>und</strong> mittleren<br />
Unternehmen (KMU).<br />
Insbesondere die im nördlichen Kreisgebiet <strong>und</strong><br />
dem angrenzenden nordrhein-westfälischen<br />
Siegerland historisch gewachsene Eisenerz-<br />
gewinnung sowie –verhüttung wurde in den<br />
letzten Jahrzehnten eingestellt. Dies hat zu<br />
erheblichen strukturellen Veränderungen in der<br />
Arbeitswelt geführt <strong>und</strong> stellt an die wirtschaft-<br />
liche Entwicklung ernorme Herausforderungen.<br />
VG Betzdorf<br />
Die Verbandsgemeinde Betzdorf mit ihren<br />
Ortsgemeinden Alsdorf, Grünebach, Scheuer-<br />
feld, Wallmenroth <strong>und</strong> der Stadt Betzdorf (heu-<br />
te größte Stadt im Kreis Altenkirchen) liegt<br />
8
eingebettet zwischen Sieg <strong>und</strong> Heller, um-<br />
geben von waldreichen Höhen am Fuße des<br />
Westerwaldes. Auf einer Fläche von 2.451<br />
ha leben ca. 18.000 Einwohner. Verwal-<br />
tungssitz der Verbandgemeinde ist die Stadt<br />
Betzdorf.<br />
Die Verbandsgemeinde Betzdorf ist ein<br />
bedeutender <strong>Wirtschaft</strong>sstandort im Drei-<br />
Länder-Eck Rheinland-Pfalz, Nordrhein-<br />
Westfalen, Hessen. Aufgr<strong>und</strong> der strate-<br />
gisch günstigen Lage zwischen den Bal-<br />
lungszentren Rhein-Main <strong>und</strong> Rhein-Ruhr<br />
<strong>und</strong> den guten Anbindungen an das Stra-<br />
ßen-, Schienen- <strong>und</strong> Luftverkehrsnetz haben<br />
hier international bekannte Unternehmen,<br />
wie z.B. die Firma "Wolf-Garten" <strong>und</strong> der<br />
Büro- <strong>und</strong> Werkstattversand "Schäfer-Shop"<br />
ihren Firmensitz.<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Als Mittelzentrum verfügt der Standort Betzdorf<br />
über Einrichtungen der allgemeinen <strong>und</strong> beruf-<br />
lichen Aus- <strong>und</strong> Weiterbildung, wie Gymnasi-<br />
um, Realschulen, Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Hauptschulen,<br />
Berufsbildende Schulen <strong>und</strong> Erwachsenenbil-<br />
dungseinrichtungen, Einrichtungen im Sozial-<br />
<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsbereich, Fachärzte, Altenzent-<br />
rum sowie größere Anlagen im Bereich von<br />
Freizeit <strong>und</strong> Sport. Darüber hinaus sind weitere<br />
Dienstleistungseinrichtungen wie zahlreiche<br />
Behörden, Gericht oder Banken, spezialisierte<br />
Handwerksbetriebe <strong>und</strong> städtebaulich integrier-<br />
te Einkaufszentren vorhanden.<br />
9
VG Kirchen<br />
Zur Verbandsgemeinde Kirchen gehören die<br />
Ortsgemeinden Brachbach, Friesenhagen,<br />
Harbach, Kirchen, Mudersbach <strong>und</strong> Nieder-<br />
fischbach. Auf einer Fläche von 12.678 ha<br />
leben ca. 26.000 Einwohner. Verwaltungs-<br />
sitz der Verbandgemeinde ist die Ortsge-<br />
meinde Kirchen/Sieg.<br />
Die Verbandsgemeinde Kirchen verfügt über<br />
ein breites Angebot kommunaler Einrichtun-<br />
gen: Kindergärten <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>schulen, die<br />
Duale Oberschule Kirchen zusammen mit<br />
der Berufsbildenden Schule, Altenzentren,<br />
zahlreiche Spiel- <strong>und</strong> Sportplätze, Tennis-<br />
plätze, Freibäder <strong>und</strong> ein Freizeitbad, Turn-<br />
<strong>und</strong> Mehrzweckhallen, ein Sportzentrum,<br />
sowie das St. Elisabeth Kreiskrankenhaus.<br />
Die Verbandsgemeinde stellt sich seit eini-<br />
gen Jahren in besonderem Maße die Aufga-<br />
be, den veränderten wirtschaftlichen Rah-<br />
menbedingungen <strong>und</strong> strukturellen Verände-<br />
rungen durch gezielte <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
gerecht zu werden. Vor allem durch die<br />
Gründung der Strukturförderungsgesell-<br />
schaft betreibt sie ein Standortmarketing <strong>für</strong><br />
Industrie <strong>und</strong> Gewerbe, das von der Landes-<br />
regierung mit dem Prädikat "Mittelstands-<br />
fre<strong>und</strong>liche Kommune" ausgezeichnet wur-<br />
de. Herausragend beurteilt wurden u.a. die<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
gelungene Umstrukturierung ehemaliger In-<br />
dustriebrachen in kleine Einheiten <strong>für</strong> den Mit-<br />
telstand, die rasche Abwicklung von Genehmi-<br />
gungsverfahren sowie die gute Beratung <strong>für</strong><br />
Unternehmer <strong>und</strong> Existenzgründer.<br />
Ein zunehmender <strong>Wirtschaft</strong>sfaktor der Region<br />
ist der Fremdenverkehr, dessen Förderung von<br />
beiden Verbandsgemeinden als zukünftige<br />
Herausforderung angesehen wird. Der hohe<br />
Erholungswert der Landschaft <strong>und</strong> die bereits<br />
vorhandenen Einrichtungen <strong>und</strong> Sehenswür-<br />
digkeiten bieten gute Voraussetzungen. Der im<br />
Ausbau befindliche Radweg auf der alten<br />
Bahnlinie Kirchen-Olpe wird das Freizeitange-<br />
bot erheblich verbessern <strong>und</strong> einen neuen<br />
Schwerpunkt setzen.<br />
2.2.3 VG Kandel<br />
Die VG Kandel liegt im Landkreis Germersheim<br />
im Südosten von Rheinland-Pfalz. Dieser<br />
grenzt an Frankreich <strong>und</strong> liegt in unmittelbarer<br />
Nachbarschaft zu den Ballungs- <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong>sräumen<br />
Ludwigshafen/Mannheim <strong>und</strong><br />
der TechnologieRegion Karlsruhe in Baden-<br />
Württemberg.<br />
Im Kreisgebiet befinden sich die B<strong>und</strong>esautobahn<br />
A65 <strong>und</strong> die B<strong>und</strong>esstraße B9 <strong>und</strong> am<br />
nahegelegenen Rhein befinden sich zwei große<br />
Hafenanlagen (Containerumschlagplätze). Per<br />
Bahn ist die VG Kandel an Karlsruhe bzw. Landau<br />
<strong>und</strong> Mannheim/Ludwigshafen angeschlossen.<br />
Von Bedeutung sind ferner die Universität<br />
Karlsruhe <strong>und</strong> die Universität Koblenz-Landau<br />
in unmittelbarer Nachbarschaft des Kreises<br />
sowie die Johannes-Gutenberg-Universität<br />
Mainz.<br />
Zur Verbandsgemeinde Kandel gehören die<br />
Ortsgemeinden Erlenbach, Freckenfeld, Minfeld,<br />
Steinweiler, Winden, Vollmersheim <strong>und</strong><br />
Kandel, wo auch der Verwaltungssitz der Verbandgemeinde<br />
ist. Auf einer Fläche von<br />
691.561 ha leben in der VG Kandel ca. 16300<br />
Einwohner.<br />
10
In den Nachbargemeinden im Landkreis<br />
betreibt die DaimlerChrysler AG das größte<br />
Nutzfahrzeugwerk in Europa. Auch das<br />
globale Versorgungslager der DaimlerChrys-<br />
ler AG befindet sich im Kreisgebiet. Eine<br />
zusätzliche Konzentration von großen Zulie-<br />
ferbetrieben der DaimlerChrysler AG steht<br />
kurz vor der Umsetzung. Bedeutende Fir-<br />
men sind ferner die Nolte AG, die Firma<br />
Heye-Glas, Europa-Karton, die Firma Ei-<br />
chenauer <strong>und</strong> die Firma Kardex. Das Kreis-<br />
gebiet ist neben den Industrieansiedlungen<br />
geprägt durch großflächige Anbauflächen <strong>für</strong><br />
Tabak, Gemüse <strong>und</strong> andere Nutzpflanzen,<br />
darunter auch Wein. Es befindet sich eines<br />
der bedeutendsten Naturschutzprojekte, der<br />
Bienwald, in der Gemarkung des Kreises. Im<br />
Bereich der schulischen Bildung, sowie der<br />
Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, kann im Kreisgebiet<br />
auf viele gute Einrichtungen verwiesen wer-<br />
den.Neben den großen Industrieunterneh-<br />
men im Umkreis der Verbandsgemeinde ist<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
diese jedoch im wesentlichen von mittelständi-<br />
schen Betrieben geprägt. Handwerk, Einzel-<br />
handel/Dienstleistungen, Land- <strong>und</strong> Forstwirt-<br />
schaft <strong>und</strong> der Fremdenverkehr sind wichtige<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sfaktoren. Mit dem Modellvorhaben<br />
<strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> sowie dem<br />
nahezu parallel begonnenen Stadtmarketing-<br />
prozess in der Stadt Kandel verdeutlicht die<br />
Verwaltung in der Verbandsgemeinde ihren<br />
Willen den strukturellen Herausforderungen <strong>für</strong><br />
die heimische <strong>Wirtschaft</strong> frühzeitig zu begeg-<br />
nen.<br />
11
3 Kirchen <strong>und</strong> Betzdorf<br />
<strong>Agenda</strong>-Highlights<br />
(in Kirchen <strong>und</strong> Betzdorf)<br />
März 2000: Erste Informationsveranstaltung<br />
zur <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> in der Verbandsgemeinde<br />
Kirchen im Rathaus mit Herrn Dirk<br />
Kron<br />
April 2000: Ratsbeschluss zur Erarbeitung<br />
einer <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> in der Verbandsgemeinde<br />
Kirchen<br />
September/Oktober 2000: Info-Serie zur<br />
<strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde<br />
Kirchen<br />
Oktober/November 2000: Weitere Info-<br />
Veranstaltungen in jeder der 6 Kirchener<br />
Ortsgemeinden mit Herrn Dirk Kron<br />
November 2000: Gründung des Arbeitskreises<br />
„Kinder <strong>und</strong> Jugend“ in der Ortsgemeinde<br />
Mudersbach; Gründung von insgesamt<br />
5 Arbeitskreisen in der Verbandsgemeinde<br />
Kirchen<br />
Februar 2001: Gründung des Arbeitskreises<br />
„Spielplätze“ in der Ortsgemeinde Kirchen<br />
April 2001: Start des Modellprojektes „<strong>Agenda</strong><br />
<strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong>“; Ratsbeschluss<br />
zur Dialogvereinbarung in der Verbandsgemeinde<br />
Kirchen; Großes <strong>Agenda</strong>-Fest<br />
im/am Rathaus in Kirchen mit den Arbeitsgruppen<br />
<strong>für</strong> die Bürger/innen der Verbandsgemeinde<br />
August 2001: Modellprojekt „<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong>“ – 1. Treffen mit den <strong>Wirtschaft</strong>sunternehmen<br />
in der Betzdorfer<br />
Stadthalle<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
VG Kirchen<br />
September 2001: Modellprojekt „<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong><br />
<strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong>“ – 2. Treffen mit den <strong>Wirtschaft</strong>sunternehmen<br />
in der Dualen Oberschule<br />
in Kirchen;<br />
Info-Stand der <strong>Agenda</strong>-Arbeitsgruppen beim<br />
Kirchener Umweltmarkt<br />
November 2001: Gründung des Arbeitskreises<br />
„Natur <strong>und</strong> Umwelt“ in der Ortsgemeinde<br />
Mudersbach; Kunstausstellung in der Villa<br />
Kraemer organisiert vom Arbeitskreis Jugend –<br />
Familie – Kultur der Verbandsgemeinde Kirchen;<br />
Modellprojekt „<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong>“<br />
– Treffen der Arbeitsgruppe „Personalplanung<br />
<strong>und</strong> Qualifizierung“ bei der IHK Betzdorf/Kirchen;<br />
Einrichtung einer Lenkungsgruppe<br />
im <strong>Agenda</strong>-Prozess in Kirchen<br />
Dezember 2001 <strong>und</strong> Januar 2002: Modellprojekt<br />
„<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong>“ – Treffen der<br />
Arbeitsgruppe „Energie- <strong>und</strong> Ressourceneffizienz“<br />
– Vorbereitung einer Info-Veranstaltung<br />
zum Thema Energie<br />
Februar 2002: Lesung von Autorinnen aus<br />
Betzdorf <strong>und</strong> Kirchen in der Villa Kraemer organisiert<br />
vom Arbeitskreis „Jugend – Familie –<br />
Kultur“ der Verbandsgemeinde Kirchen<br />
März 2002: Energieforum – Info-Veranstaltung<br />
zum Thema Energie organisiert von der Arbeitsgruppe<br />
„Energie- <strong>und</strong> Ressourceneffizienz“<br />
des Modellprojektes „<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Wirtschaft</strong>“<br />
Juli 2002: <strong>Agenda</strong>forum in der Verbandsgemeinde<br />
Kirchen – Entwicklung von Leitsätzen<br />
<strong>und</strong> Leitprojekten<br />
12
Oktober 2002: Ratsbeschluss über die<br />
Ergebnisse des <strong>Agenda</strong>forums in der Verbandsgemeinde<br />
Kirchen<br />
November 2002: Bürger-Photovoltaik-<br />
Anlage – ein Projekt aus dem Arbeitskreis<br />
Energie der Verbandsgemeinde Kirchen -<br />
geht in Betrieb<br />
Dezember 2002: Präsentation der Ergebnisse<br />
des Modellprojektes in der Dualen<br />
Oberschule in Kirchen<br />
Februar 2003: Eröffnung der Begegnungsstätte<br />
Villa Kraemer mit einer Theateraufführung<br />
– ein Projekt des Arbeitskreises Jugend-Familie-Kultur<br />
der Verbandsgemeinde<br />
Kirchen<br />
April 2003: Hobbykünstlermarkt in der Villa<br />
Kraemer organisiert von dem Arbeitskreis<br />
Jugend-Familie-Kultur der Verbandsgemeinde<br />
Kirchen<br />
Oktober 2003: Teilnahme der <strong>Agenda</strong>-<br />
Aktiven am Festumzug der 175. Mudersbacher<br />
Kirmes<br />
November 2003: 2. Lesung von Autorinnen<br />
aus Betzdorf, Kirchen <strong>und</strong> Siegen in der<br />
Villa Kraemer organisiert vom Arbeitskreis<br />
„Jugend – Familie – Kultur“ der Verbandsgemeinde<br />
Kirchen<br />
3.1 Ergebnis der Potenzialanalyse<br />
In der Region Kirchen/Betzdorf sind verschiedene<br />
Institutionen <strong>und</strong> Verbände als<br />
Ansprechpartner <strong>für</strong> die örtliche <strong>Wirtschaft</strong><br />
von Bedeutung:<br />
� Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde<br />
Kirchen (Sieg) mbH<br />
� <strong>Wirtschaft</strong>sförderungsgesellschaft Kreis<br />
Altenkirchen mbH mit Sitz in Kirchen<br />
� Industrie- <strong>und</strong> Handelskammer zu<br />
Koblenz, Bezirksstelle Betzdorf Kirchen<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Als weitere Informationsquelle stand zu Projektbeginn<br />
eine Imageanalyse zur Verfügung,<br />
die von Frau Professor Funke (FH Mainz) auf<br />
der Basis von mündlichen Befragungen<br />
(n=1.470, davon 178 in Betzdorf <strong>und</strong> 142 in<br />
Kirchen) im Januar 2001 vorgelegt worden ist.<br />
Die Imageanalyse ist Teil eines Regionalkonzepts<br />
“Zukunftsfähiger Kreis Altenkirchen”, das<br />
Frau Professor Funke im Auftrag des Kreises<br />
Altenkirchen parallel zum Modellprojekt in Kirchen<br />
<strong>und</strong> Betzdorf erstellte. Die Ergebnisse der<br />
Imageanalyse wurden im weiteren Verlauf des<br />
Jahres 2001 in den einzelnen Verbandsgemeinden<br />
diskutiert <strong>und</strong> zu einem Leitbild <strong>für</strong><br />
den Kreis Altenkirchen zusammengeführt.<br />
Sowohl in Kirchen als auch in Betzdorf gab es<br />
im Vorfeld des Modellprojektes zahlreiche Aktivitäten<br />
im Hinblick auf die <strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong>.<br />
� In Kirchen wurde im April 2000 ein<br />
Ratsbeschluss gefasst, zur Erarbeitung<br />
einer <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong>. In der Verbandsgemeinde<br />
wurde eine Verwaltungsstelle<br />
eingerichtet, um die <strong>Lokale</strong><br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> in Kirchen zu koordinieren<br />
<strong>und</strong> voranzubringen. Die zuständige<br />
Mitarbeiterin, Frau Monika Lieth, war<br />
auch zuständig <strong>für</strong> die Begleitung des<br />
Modellprojektes.<br />
� Auch in Betzdorf wurde – hier allerdings<br />
ohne formalen Ratsbeschluss -<br />
ein Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung<br />
beauftragt, die <strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong><br />
zu koordinieren. Zu Beginn des Modellprojektes<br />
zeichnete sich hier jedoch<br />
eine Veränderung ab. Der zuständige<br />
Mitarbeiter verließ die Stadtverwaltung<br />
Betzdorf <strong>und</strong> eröffnete ein Ingenieurbüro;<br />
die Aufgaben der <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong><br />
<strong>21</strong> Betzdorf fielen formal an die Umweltverwaltung.<br />
Der ehemalige Mitarbeiter,<br />
Gottfried Frings, wurde von der<br />
Stadtverwaltung beauftragt, als externer<br />
Berater das Modellprojekt zu begleiten.<br />
13
In beiden Verbandsgemeinden war die<br />
<strong>Agenda</strong>-Arbeit von zahlreichen – auch gemeinsamen<br />
– Aktionen geprägt. In Kirchen<br />
hatte sich z.B. ein Energie-Arbeitskreis etabliert,<br />
der sich regelmäßig zu verschiedenen<br />
Energiethemen austauschte <strong>und</strong> Aktivitäten<br />
vorbereitete.<br />
Die Interessen der beiden Projektkoordinatoren<br />
im Modellprojekt waren im Hinblick auf<br />
die örtliche <strong>Wirtschaft</strong> unterschiedlich gelagert:<br />
� In Kirchen bestand das Interesse der<br />
<strong>Agenda</strong>-Koordinatorin darin, gemeinsam<br />
mit der Strukturförderungsgesellschaft<br />
neue Kontakte zur örtlichen<br />
<strong>Wirtschaft</strong> aufzubauen, die bis dato in<br />
den <strong>Agenda</strong>-Aktivitäten – von Ausnahmen<br />
abgesehen - noch keine größere<br />
Rolle gespielt hat.<br />
� In Betzdorf bestanden zu Projektbeginn<br />
bereits gute Kontakte insbesondere<br />
zu den größeren Betrieben am<br />
Ort, die im Zuge des Modellprojektes<br />
vertieft werden sollten. Zudem sollten<br />
weitere auch kleinere Betriebe <strong>für</strong> eine<br />
aktive Beteiligung an der <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong><br />
gewonnen werden.<br />
Befragung der örtlichen Betriebe<br />
Die beteiligten Entscheidungsträger haben<br />
sich in den Verbandsgemeinden Kirchen/Sieg<br />
<strong>und</strong> Betzdorf dazu entschlossen,<br />
zur Information <strong>und</strong> Aktivierung der örtlichen<br />
<strong>Wirtschaft</strong> <strong>für</strong> das Modellvorhaben eine<br />
Fragebogenaktion in beiden Verbandsgemeinden<br />
durchzuführen. Die Fragebögen<br />
(siehe Anhang) wurden über die Verbandsgemeinden<br />
verschickt. Die Umfrage diente<br />
dazu, die Unternehmen <strong>für</strong> das Thema <strong>Agenda</strong><br />
<strong>21</strong> zu sensibilisieren <strong>und</strong> die Bereitschaft<br />
zur Teilnahme an dem Modellprojekt<br />
zu evaluieren. Weiteres Ziel der Fragebogenaktion<br />
war die Verbesserung der Infor-<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
mationslage der Verbandsgemeinden über die<br />
örtliche <strong>Wirtschaft</strong>.<br />
Insgesamt wurden 171 (131 <strong>und</strong> 40) Fragebögen<br />
verschickt. Der Rücklauf der Fragebögen<br />
war mit 16 (12 %) in Kirchen <strong>und</strong> 14 ( 35 %) in<br />
Betzdorf zufriedenstellend. Der Rücklauf repräsentierte<br />
auch die <strong>Wirtschaft</strong>sstruktur der Region.<br />
Die meisten Betriebe beschäftigen weniger<br />
als 50 Mitarbeiter (61% der Rückläufe), der<br />
Mittelstand ist nicht sehr stark vertreten, <strong>und</strong><br />
einige Großunternehmen am Ort dominieren<br />
das <strong>Wirtschaft</strong>sgeschehen (z.B. Wolf Garten,<br />
Schäfer Shop usw.).<br />
Die Auswertung der Fragebögen erbrachte<br />
folgende Erkenntnisse:<br />
• Ein Zusammenhang zwischen örtlicher<br />
<strong>Wirtschaft</strong> <strong>und</strong> der <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> wird<br />
von den Betrieben nur in Ausnahmefällen<br />
gesehen. 92% der Betriebe gaben an, noch<br />
keine Aktivitäten im Bereich der <strong>Lokale</strong>n<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> unternommen zu haben.<br />
• Ein wichtiger Indikator <strong>für</strong> eine nachhaltige<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sweise im Betrieb ist der Umgang<br />
mit den natürlichen Ressourcen, da hier<br />
ökonomische Interessen mit ökologischen<br />
Verbesserungen gut kombinierbar sind. In<br />
der Auswertung der Fragebögen zeigt sich,<br />
dass eine konsequente Wertstofftrennung<br />
in zahlreichen Betrieben Standard ist. Energiesparmaßnahmen<br />
wurden zumindest<br />
noch von jedem zweiten Unternehmen<br />
durchgeführt. Im Umgang mit der Ressource<br />
Wasser <strong>und</strong> beim Einsatz regenerativer<br />
Energieträger scheint in der örtlichen <strong>Wirtschaft</strong><br />
noch ein relativ hohes Entwicklungspotenzial<br />
zu stecken.<br />
• Ein weiteres Nachhaltigkeitsthema ist der<br />
Umgang mit den Beschäftigten. Hier<br />
herrscht bei den Betrieben eine relativ hohe<br />
Sensibilität vor. Qualifizierte Arbeitskräfte<br />
sind in der Region begehrt. 56 % der Befragten<br />
haben besondere Maßnahmen zur<br />
Qualifizierung der Beschäftigten ergriffen.<br />
14
• Weitere Nachhaltigkeitskriterien sind die<br />
Kommunikation <strong>und</strong> die Kooperation in<br />
der Region. Auch hier scheint das Bewusstsein<br />
<strong>für</strong> ein Engagement relativ<br />
groß. Ein Drittel der Betriebe engagiert<br />
sich öfters in gemeinnützigen Aktionen<br />
in der Region, ein weiteres Drittel zumindest<br />
teilweise. Die meisten Betriebe<br />
beziehen ihre Rohstoffe <strong>und</strong> Materialien<br />
beim lokalen Handel.<br />
• Das Interesse an einer langfristigen<br />
Stärkung der Zusammenarbeit mit anderen<br />
Unternehmen <strong>und</strong> den Verbandsgemeinden<br />
ist groß. 88% der Rückläufer<br />
bek<strong>und</strong>en hieran ein großes oder gar<br />
ein sehr großes Interesse.<br />
Die Umfrage zeigte, dass in der Region ein<br />
erhebliches Potenzial an kooperationsbereiten<br />
Betrieben verschiedener Größenordnung<br />
vorhanden ist. Diese Betriebe hatten<br />
durch die Fragebogenaktion eine erste Information<br />
über das Projekt erhalten. Ein<br />
Zusammenhang mit der <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong><br />
wird dabei in der Regel nicht gesehen.<br />
In Gesprächen mit den <strong>Agenda</strong>-<br />
Beauftragten <strong>und</strong> den Verwaltungsspitzen<br />
wurde darauf verwiesen, dass ein zielgerichtetes<br />
<strong>und</strong> praxisorientiertes Vorgehen erforderlich<br />
sei, um die örtliche <strong>Wirtschaft</strong> in das<br />
Projekt einzubeziehen.<br />
3.2 Vorgehen im Modellprojekt<br />
In Abstimmung mit der Verwaltungsspitze<br />
<strong>und</strong> den <strong>Agenda</strong>beauftragten wurden die<br />
lokalen <strong>Wirtschaft</strong>svertreter von der Verbandsgemeinde<br />
zu einer Auftaktveranstaltung<br />
eingeladen, um das Modellprojekt vorstellen.<br />
Es wurde festgelegt, dass die ersten<br />
Aktivitäten im Modellprojekt zunächst nicht<br />
mit den Aktivitäten <strong>und</strong> Arbeitskreisen der<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
<strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> verknüpft werden sollten.<br />
Vielmehr sollten die Bedürfnisse der örtlichen<br />
Betriebe erfragt werden, um daraus Hinweise<br />
<strong>für</strong> eine nachhaltige <strong>Wirtschaft</strong>sweise zu erhalten.<br />
In einem ersten Gespräch mit den Bürgermeistern<br />
der beiden Verbandsgemeinden wurde<br />
Einigung darüber erzielt, dass die mit den Betrieben<br />
zu besprechenden Themen nicht vorgegeben<br />
werden sollten. Gleichwohl sollten in<br />
den zentralen Handlungsfeldern, die die Betriebe<br />
interessieren, konkrete Vorschläge <strong>für</strong> Maßnahmen<br />
erfolgen. Dieser Termin wurde zudem<br />
genutzt, um über die Presse die Öffentlichkeit<br />
über das Modellprojekt zu informieren. Die<br />
Resonanz durch die lokale Presse war erfreulich<br />
hoch. (s. Zeitungsartikel im Anhang).<br />
Aufgr<strong>und</strong> der anstehenden Bürgermeisterwahl<br />
in Kirchen im Sommer 2001 ruhten die Arbeiten<br />
am Modellprojekt jedoch zunächst. Nach der<br />
Wahl des neuen Kirchener Bürgermeisters<br />
Wolfgang Müller stiegen die <strong>Agenda</strong>-<br />
Verantwortlichen nach der Sommerpause rasch<br />
in die Planung der ersten Schritte ein.<br />
In einer Auftaktveranstaltung sollten die Betriebe<br />
über das Modellvorhaben informiert werden<br />
<strong>und</strong> mit Good-Practice-Beispielen Anregungen<br />
<strong>für</strong> eine nachhaltige <strong>Wirtschaft</strong>sweise <strong>und</strong> Kooperationsmöglichkeiten<br />
erhalten. Diese Veranstaltung<br />
fand am 27.08.2001 in der Stadthalle<br />
Betzdorf statt.<br />
Im Ergebnis dieser Veranstaltung, die mit ca.<br />
30 Vertretern örtlicher Betriebe gut besucht<br />
war, zeigte sich, dass die vorgestellten Good-<br />
Practice-Beispiele aus anderen Kommunen <strong>für</strong><br />
die Betriebe nicht konkret genug waren. Auch<br />
die vorgestellten Ansätze zur Kooperation wurden<br />
von den Beteiligten nicht aufgegriffen.<br />
Um das Thema „<strong>Agenda</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong>“ in der<br />
Region plastischer zu vermitteln sollten in einer<br />
zweiten Veranstaltung Beispiele <strong>und</strong> Ideen aus<br />
15
der Region präsentiert werden. In einer<br />
Vorbesprechung am 19.09.2001 einigten<br />
sich die <strong>Agenda</strong>-Beauftragten sowie einzelne<br />
Vertreter der örtlichen <strong>Wirtschaft</strong> auf fünf<br />
Kurzbeiträge, die Impulse <strong>für</strong> die weiteren<br />
Arbeiten setzen sollten.<br />
Folgende fünf Beiträge wurden in einer<br />
Veranstaltung am 28.09.2001 in der Dualen<br />
Oberschule in Kirchen vorgestellt:<br />
1. Mobilität / Verkehrsentwicklung<br />
2. Energie- <strong>und</strong> Ressourceneffizienz<br />
3. Personalplanung <strong>und</strong> Qualifizierung<br />
4. Telearbeitsplätze<br />
5. Firmenkooperationen<br />
Die Diskussionen über diese fünf Impulsreferate<br />
führten zur Bildung von drei thematischen<br />
Arbeitsgruppen. Diese bildeten das<br />
Gerüst <strong>für</strong> die weiteren Arbeiten im Modellprojekt.<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Folgende Arbeitsgruppen wurden gebildet:<br />
1. Personalplanung/Qualifizierung<br />
Diese Arbeitsgruppe traf sich im Zeitraum<br />
von Oktober 2001 bis Mai 2002 insgesamt<br />
dreimal. Zentrales Projekt dieser<br />
Arbeitsgruppe war die Erstellung einer Internet-Plattform,<br />
in der die Region mit ihren<br />
Vorzügen präsentiert werden soll.<br />
Zudem soll die Integration einer Jobbörse<br />
helfen, qualifiziertes Personal in die Region<br />
zu holen.<br />
2. Energie <strong>und</strong> Ressourceneffizienz<br />
Diese Arbeitsgruppe traf sich in kleinerem<br />
Rahmen mehrfach im o.g. Zeitraum.<br />
Sie bereitete das Energieforum am<br />
13.03.2002 vor <strong>und</strong> initiierte eine Energieberatung<br />
<strong>für</strong> Betriebe aus Kirchen <strong>und</strong><br />
Betzdorf.<br />
16
3. Mobilität/Verkehrsentwicklung<br />
Diese Arbeitsgruppe führte eine Befragung<br />
der örtlichen Betriebe durch mit<br />
dem Ziel, Verbesserungen der Verkehrssituation<br />
in Kirchen/Betzdorf zu erreichen.<br />
Aufgr<strong>und</strong> mangelnder konkreter<br />
Ansatzpunkte <strong>für</strong> Aktionen wurde diese<br />
Arbeitsgruppe im weiteren Projektverlauf<br />
mit der Arbeitsgruppe 1 (Personalplanung,<br />
Qualifizierung) zusammengelegt.<br />
Am 10.12.2002 wurden die (Zwischen-)<br />
Ergebnisse des Modellprojektes in der Region<br />
präsentiert. Die Veranstaltung, die<br />
wiederum in der Dualen Oberschule in Kirchen<br />
stattfand, war mit knapp 40 teilnehmenden<br />
Personen gut besucht. Die vorgestellten<br />
Ergebnisse wurden von den Teilnehmenden<br />
positiv aufgenommen <strong>und</strong> mit<br />
dem Wunsch verknüpft, den begonnenen<br />
Prozess auch nach Beendigung des Modellprojektes<br />
der LZU weiter zu führen.<br />
Im Zuge einer Abschlussbesprechung mit<br />
den beiden Bürgermeistern am 22.01.2003<br />
im Rathaus Betzdorf wurden die Zwischenbilanz<br />
<strong>und</strong> deren Präsentation noch einmal<br />
reflektiert. Schritte zur Weiterführung des<br />
Prozesses wurden festgelegt.<br />
Eine chronologische Darstellungen der<br />
Schlüsselveranstaltungen <strong>und</strong> deren Ergebnisse<br />
findet sich im Anhang.<br />
3.3 Projekte<br />
3.3.1 Energieforum<br />
In den beiden Energie-Arbeitskreisen im<br />
<strong>Agenda</strong>-Prozess zeigte sich, dass es einen<br />
Informationsbedarf im Hinblick auf den Einsatz<br />
regenerativer Energien gibt <strong>und</strong> dass<br />
gleichzeitig regionale Anbieter (Solarenenergie,<br />
Heizen mit Holz) Erfahrung in der<br />
Anwendung innovativer Versorgungstechniken<br />
haben.<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
So entstand die Idee eines Energieforums, in<br />
dem interessante Vorträge über regenerative<br />
Energieträger mit einer Ausstellung regionaler<br />
Anbieter kombiniert werden sollten. Konzeption<br />
<strong>und</strong> Planung des Energieforums erfolgte durch<br />
den Arbeitskreis Energie <strong>und</strong> Ressourceneffizienz<br />
des Modellprojektes in Kooperation mit<br />
dem Arbeitskreis Energie der <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong><br />
<strong>21</strong> in Kirchen.<br />
Das „Energieforum – Intelligente Energienutzung<br />
– jetzt vor Ort“ fand am 13.03.2003 in der<br />
Betzdorfer Stadthalle mit folgenden Fachbeiträgen<br />
statt:<br />
� Energie aus nachwachsenden Rohstoffen<br />
(Markus Mann – Mann Naturenergie<br />
GmbH, Langenbach)<br />
� Die Sonne macht‘s möglich! (Matthias<br />
Schwanhäußer, Transferstelle der Fachhochschule<br />
Bingen)<br />
� Kosten sparen durch Energiemanagement<br />
(Markus Rothe, Energieagentur NRW)<br />
In der begleitenden Ausstellung präsentierten<br />
sich ca. 20 überwiegend regionale Anbieter,<br />
z.B. <strong>für</strong> Solartechnik, <strong>für</strong> Holzhackschnitzelheizungen,<br />
Architekturdienstleistungen usw..<br />
17
Die Veranstaltung war mit ca. 100 Personen<br />
sehr gut besucht. Mit der Veranstaltung<br />
wurde ein wichtiger Beitrag zur Vernetzung<br />
regionaler Akteure geleistet. Es zeigt sich,<br />
dass das Themenfeld Energie hierzu sehr<br />
gut geeignet ist.<br />
Während der Veranstaltung wurde die Idee<br />
zur Entwicklung eines Angebotes (Energieberatung)<br />
an die örtlichen Betriebe vorgestellt.<br />
3.3.2 Energieberatung<br />
Aufgr<strong>und</strong> der hohen Einspar-Potenziale, die<br />
insbesondere im Energiebereich durch Optimierung<br />
von Produktionsprozessen <strong>und</strong><br />
technischen Innovationen in vielen Betrieben<br />
umgesetzt werden können, wurde im<br />
Arbeitskreis Energie <strong>und</strong> Ressourceneffizienz<br />
beschlossen, eine Energieberatung in<br />
Betrieben zu organisieren. Dabei wurde auf<br />
ein Angebot der Transferstelle Bingen zurückgegriffen,<br />
die eine professionelle Beratung<br />
in Form eines Potenzialchecks durchführt.<br />
Die Verbandsgemeinden erklärten sich<br />
zur Übernahme der entstehenden Reisekosten<br />
bereit, so dass die beiden Projektkoordinatoren<br />
die Planungen in Angriff nehmen<br />
konnten.<br />
Mit dieser Maßnahme bot sich den VGen ein<br />
konkreter Ansatz zur Schaffung eines Angebotes<br />
an die heimischen Betriebe, das <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
<strong>und</strong> Umweltschutz im Sinne<br />
der <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> kombiniert.<br />
Im Zeitraum von Juli bis Dezember 2002<br />
wurden insgesamt 18 Betriebe von den<br />
Energieberatern besucht. Die Ergebnisse<br />
zeigten, dass in jedem Betrieb Potenziale<br />
zur Senkung von Betriebskosten durch Energiesparmaßnahmen<br />
vorhanden sind.<br />
Jeder Betrieb erhielt im Nachgang ein Protokoll,<br />
in dem die spezifischen Einsparmöglichkeiten<br />
aufgezeigt wurden.<br />
Die Äußerungen einzelner Betriebe (Fa.<br />
Bubenzer, Fa. Schäfer Shop) während der<br />
Abschlussveranstaltung zeigten, dass das<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Angebot sehr positiv aufgenommen worden ist<br />
<strong>und</strong> in den Betrieben zu guten Ergebnissen<br />
geführt hat.<br />
Die Bürgermeister haben im Rahmen der Abschlussbesprechung<br />
am 22.01.2003 beschlossen,<br />
die Ergebnisse der Energieberatung durch<br />
Telefonate mit den beteiligten Betrieben zu<br />
evaluieren <strong>und</strong> bei entsprechend positiver Resonanz<br />
weitere Energieberatungen anzubieten.<br />
Das Projekt Energieberatung ist in dieser Form<br />
auch in anderen Regionen in Rheinland-Pfalz<br />
durchführbar. Mit dem Beratungsangebot der<br />
Transferstelle Bingen steht ein ausgereiftes<br />
Instrument mit erfahrenen Beratern zu einem<br />
günstigen Preis zur Verfügung. Der Koordinationsaufwand,<br />
um die Einsätze der Transferstelle<br />
– insbesondere in entfernteren Regionen –<br />
effizient zu gestalten, ist jedoch nicht zu unterschätzen.<br />
3.3.3 Bürger-Photovoltaik-Anlage<br />
Der Arbeitskreis Energie der <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong><br />
<strong>21</strong> entwickelte in Kirchen das Projekt „Bürger-<br />
18
Photovoltaik-Anlage“. Die Finanzierung der<br />
Anlage erfolgte über Anteilsscheine, die von<br />
Akteuren aus der ganzen Region gezeichnet<br />
wurden (Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger, Firmen,<br />
Verbände <strong>und</strong> eine Arztpraxis). Die nach<br />
Süden ausgerichteten <strong>und</strong> in optimaler Lage<br />
vorhandenen Dachflächen der Oberschule<br />
boten ideale Voraussetzungen <strong>für</strong> einen<br />
wirtschaftlichen Betrieb der Anlage.<br />
In einem ersten Schritt wurde eine 10-kW-<br />
Anlage auf dem Dach der Dualen Oberschule<br />
eingeweiht. Die Anlage kann zu einem<br />
späteren Zeitpunkt bis auf 50 kW erweitert<br />
werden.<br />
Das Projekt Bürger-Photovoltaik-Anlage ist<br />
ein sichtbares Symbol <strong>für</strong> die <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong>.<br />
<strong>Agenda</strong>beauftragte Monika Lieth: „Für die<br />
Bürger ist es eine sinnvolle Geldanlage,<br />
lokale Handwerker profitieren von den Bauleistungen,<br />
Ressourcen werden geschont<br />
<strong>und</strong> der Kohlendioxyd-Ausstoß wird verringert.“<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
3.3.4 Internetplattform<br />
Ausgangspunkt der Überlegungen zur Einrichtung<br />
einer gemeinsamen Internetplattform <strong>für</strong><br />
die Region waren drei zunächst unterschiedliche<br />
Ansatzpunkte:<br />
� Die Strukturförderungsgesellschaft Kirchen<br />
besitzt auf ihrer eigenen Homepage<br />
eine Jobbörse, die Arbeitsplatz-<br />
Angebote <strong>und</strong> Nachfrage über das<br />
Internet zueinander bringt.<br />
Gleichzeitig gab es Überlegungen,<br />
die Homepage der VG zu erweitern<br />
<strong>und</strong> ein neues Internet-Angebot<br />
einzurichten, mit dem die Vorzüge<br />
der Region dargestellt werden.<br />
� Im Zuge des Leitbild-Projektes, das<br />
Frau Prof. Funke von der FH Mainz<br />
zum selben Zeitpunkt im Auftrag des<br />
Kreises Altenkirchen durchführte,<br />
wurden in beiden Verbandsgemeinden<br />
im Zuge einer Stärken-Schwächen-<br />
Analyse konkrete Ansatzpunkte <strong>für</strong> ein<br />
Regionalmarketing erarbeitet, die im<br />
Zuge des geplanten Internet-Auftritts<br />
Verwendung finden konnten.<br />
� Die Betriebe, die sich am Arbeitskreis<br />
„Personalplanung / Qualifizierung“ des<br />
Modellprojektes beteiligten, beklagten<br />
die Schwierigkeiten bei der Anwerbung<br />
von Fachkräften. Die Fa. Wolff Garten<br />
berichtete, dass sie einen Internet-<br />
Auftritt plante, mit dem sie die Vorzüge<br />
der Region herausstellen <strong>und</strong> Online-<br />
Bewerbungen ermöglichen wollte.<br />
Im Zuge der weiteren Treffen der Arbeitsgruppe<br />
„Personalplanung / Qualifizierung“ wurden die<br />
drei Ansätze miteinander verknüpft. Zudem<br />
wurde der geplante Internet-Auftritt zu einer<br />
gemeinsamen Aktion der Strukturförderungsgesellschaft<br />
Kirchen mit dem informellen Arbeitskreis<br />
der Personalleiter der größeren Betriebe<br />
der Region. Auf diesem Weg wurde das<br />
Projekt Internetplattform vorbereitet <strong>und</strong> ein<br />
19
erster Entwurf konnte bereits im Rahmen<br />
der Abschlussveranstaltung des Modellprojektes<br />
am 10.12.2002 der Öffentlichkeit<br />
präsentiert werden.<br />
In der Abschlussbesprechung mit den beiden<br />
Bürgermeistern wurde deutlich, dass<br />
das Projekt „Internetplattform“ in beiden<br />
Verbandsgemeinden höchste Priorität genießt.<br />
Die weiteren Schritte zur Realisierung<br />
<strong>und</strong> Freischaltung wurden festgelegt.<br />
3.3.5 Nachhaltige Mobilität in der Region<br />
Der Arbeitskreis Mobilität <strong>und</strong> Verkehrsentwicklung<br />
traf sich in der Anfangsphase des<br />
Modellprojektes unter der Leitung von Gottfried<br />
Frings mehrere Male. Anschließend<br />
wurde der AK mit der Arbeitsgruppe „Personalplanung/Qualifizierung“<br />
verschmolzen, da<br />
es einen hohen Grad an personeller Überschneidung<br />
in diesen beiden Arbeitsgruppen<br />
gab <strong>und</strong> das Thema „Mobilität“ kaum konkrete<br />
Ansatzpunkte <strong>für</strong> lokales Handeln<br />
zuließ.<br />
Im Rahmen der Arbeitsgruppe wurden vier<br />
Themenbereiche besprochen:<br />
Verkehrsentzerrung durch Verschiebung<br />
der Arbeitszeit in den Großunternehmen<br />
bzw. in den Schulen<br />
Die Möglichkeiten der Arbeitszeitverschiebung<br />
waren bereits in zurückliegenden Jahren<br />
mehrfach erörtert worden. Ziel war <strong>und</strong><br />
ist es, durch diese Verschiebung die gravierendsten<br />
Verkehrsspitzen <strong>und</strong> Ströme zu<br />
entzerren <strong>und</strong> somit die Staugefahr insbesondere<br />
in Betzdorf zu vermindern. In einigen<br />
Firmen wurden diesbezüglich Versuche<br />
unternommen <strong>und</strong> auch gewisse Arbeitszeitverschiebungen<br />
eingeleitet (insbesondere<br />
gleitende Arbeitszeiten). Weiterführende<br />
Veränderungen waren aus sehr unterschiedlichen<br />
<strong>und</strong> zum Teil betrieblichen Rahmenbedingungen<br />
wie z. B. Schichtdienst, nicht<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
möglich. Die Verschiebung der Schulbeginnzeiten<br />
stieß ebenfalls auf Probleme, nicht zuletzt<br />
was die Beförderung <strong>und</strong> die Vernetzung der<br />
entsprechenden ÖPNV-Angebote (Bus- <strong>und</strong><br />
Bahntakte) betraf.<br />
Einrichtung einer Biodiesel Tankstelle<br />
Bereits Ende der 90er Jahre wurden hierzu von<br />
der VG Betzdorf die heimischen Tankstellen in<br />
Betzdorf befragt. Daraufhin konnte <strong>für</strong> ca. 2<br />
Jahre ein Betreiber einer freien Tankstelle hier<strong>für</strong><br />
gewonnen werden.<br />
Nach der Aufgabe der Tankstation fand sich<br />
kein Interessent mehr <strong>für</strong> dieses Thema. Im<br />
Rahmen des Modellprojektes wurden die Pächter<br />
bzw. Besitzer der Tankstellen nochmals<br />
darauf angesprochen, bei gleichem Ergebnis.<br />
Weiterhin wurde die gewerbliche Tankstation<br />
der Fa. ARAL im Gewerbegebiet Struthhof vom<br />
Schäfer Shop darauf befragt. Auch hierbei<br />
wurde kein Interesse signalisiert. Somit verbleiben<br />
<strong>für</strong> Interessenten an Bio Diesel die Tankstellen<br />
in Gebhardshain ca. 6Km von Betzdorf,<br />
Hachenburg ca. 16 km <strong>und</strong> in Herdorf ca.8 km<br />
entfernt.<br />
Befragung der transportrelevanten Unternehmen<br />
in den beiden VG’s um evtl. Verbindungen<br />
<strong>und</strong> Kooperationen zu suchen.<br />
Von einem Ingenieurbüro wurde in Absprache<br />
mit der Verwaltung ein Fragebogen entworfen,<br />
der detailliert die unterschiedlichen Transportwege<br />
untersuchte. Dieser Fragebogen hatte die<br />
genutzten Transportwege <strong>und</strong> die Uhrzeit der<br />
benötigten Transportvorgänge zum Inhalt. Hieraus<br />
sollten evtl. mögliche gemeinsame<br />
Nutzungen <strong>für</strong> Transporte sowie evtl. gemeinsame<br />
Einkäufe untersucht werden.<br />
Die Teilnahme an der Befragung war sehr gering,<br />
obwohl gezielt Unternehmen angeschrieben<br />
wurden (ca. 45), bei denen relevante<br />
Transportaktivitäten zu erwarten waren. Ebenfalls<br />
waren die ausgefüllten Fragebogen, was<br />
die Beantwortung der Fragen betrifft, in Ihrer<br />
Aussagekraft sehr unterschiedlich. Nach zahlreichen<br />
Telefonaten <strong>und</strong> Rückfragen konnte<br />
20
festgestellt werden, dass eine relevante<br />
Möglichkeit, verkehrsmindernde Maßnahmen<br />
durchzuführen <strong>und</strong> mit anderen, vielleicht<br />
benachbarten Unternehmen zu kooperieren,<br />
von den teilnehmenden Firmen derzeit<br />
nicht gesehen wird.<br />
Optimierung von Ampelschaltungen<br />
Nach Auskunft der Verwaltungen zum Thema<br />
der Optimierung von Ampelschaltungen<br />
wurden in den vergangen Jahren gemeinsam<br />
mit den zuständigen Behörden, verschiedene<br />
Anstrengungen unternommen.<br />
Weitere Verbesserungen werden nach deren<br />
Aussagen nur durch eine Veränderung<br />
<strong>und</strong> Verbesserung in der Führung von Verkehrsströmen<br />
gesehen.<br />
3.4 Strukturen<br />
Mit dem Modellprojekt sollten Organisationsstrukturen<br />
aufgebaut werden, die über<br />
die Laufzeit des Projekts hinausreichen.<br />
3.4.1 Arbeitskreise<br />
Mit der Zusammenlegung des<br />
Energiearbeitskreises der LA <strong>21</strong> in Kirchen<br />
<strong>und</strong> dem AK Energie aus dem Modellprojekt<br />
ist ein wichtiger Schritt zur Bündelung von<br />
Aktivitäten in der Region gemacht worden.<br />
Dieses Forum hat sich zum Ziel gesetzt, das<br />
Angebot einer Energieberatung<br />
weiterzuführen sowie weitergehende<br />
Aktivitäten zu planen.<br />
Der informelle Arbeitskreis der Personalleiter<br />
hat sich <strong>für</strong> das Projekt „Internetplattform“<br />
geöffnet <strong>und</strong> wird dieses Vorhaben<br />
weiter konstruktiv begleiten.<br />
3.4.2 Internetplattform<br />
Es ist geplant, eine Internetplattform zum<br />
Regionalmarketing <strong>und</strong> zur Anwerbung von<br />
Fachkräften (Jobbörse) zur Verfügung zu<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
stellen. Diese Plattform soll dann auch zur<br />
Information der Bevölkerung über die <strong>Agenda</strong>-<br />
Aktivitäten sowie zur Vernetzung der <strong>Agenda</strong>-<br />
Aktiven in beiden Verbandsgemeinden genutzt<br />
werden können. Der gemeinsame Internetauftritt<br />
soll das Zusammenwachsen der beiden<br />
Verbandsgemeinden stärken.<br />
3.4.3 <strong>Agenda</strong>beauftragte<br />
Die <strong>Agenda</strong>beauftragten sind wichtige Motoren<br />
<strong>für</strong> den begonnenen Prozess der Zusammenarbeit<br />
der Kommunen mit der <strong>Wirtschaft</strong> <strong>für</strong><br />
eine nachhaltige Entwicklung in Kirchen <strong>und</strong><br />
Betzdorf. Dieses wurde bereits im Verlauf des<br />
Modellprojektes deutlich (s. Kap. 3.5). Mit jeweils<br />
einer Stelle in jeder Verbandsgemeinde<br />
sind da<strong>für</strong> die formalen Voraussetzungen geschaffen<br />
worden.<br />
3.5 Weiteres Vorgehen<br />
Die Veranstaltung „Ergebnis <strong>und</strong> Ausblick“ am<br />
10.12.2002 hat deutlich gemacht, dass es eine<br />
große Anzahl von Betrieben in der Region gibt,<br />
die großes Interesse an einer verstärkten Zusammenarbeit<br />
<strong>für</strong> eine gemeinsame Entwicklung<br />
haben. Dabei wurde auch deutlich, dass<br />
der Weg, über eine Abfrage der Interessen der<br />
<strong>Wirtschaft</strong> zu konkreten Aktivitäten zu kommen,<br />
erfolgreich war. Nun gilt es, den begonnenen<br />
Prozess zu stabilisieren <strong>und</strong> mit neuen Aktivitäten<br />
weiterzutragen. Dabei spielen die in Kap.<br />
3.4 genannten Strukturen eine gewichtige Rolle.<br />
Stabilisierung <strong>und</strong> Weiterentwicklung des Prozesses<br />
waren auch die zentralen Themen bei<br />
der Abschlussbesprechung des Modellprojektes<br />
mit den beiden Bürgermeistern am<br />
22.1.2003 in Betzdorf. Im Verlaufe der Besprechung<br />
wurden folgende Maßnahmen beschlossen,<br />
um den Dialogprozess mit der <strong>Wirtschaft</strong><br />
weiterzutragen:<br />
<strong>21</strong>
� Die Ergebnisse des Projektes sollen an<br />
geeigneter Stelle publiziert werden.<br />
� Der Prozess der Kooperation mit der<br />
<strong>Wirtschaft</strong> soll weitergeführt werden.<br />
� Der gemeinsame Internetauftritt wird<br />
weiter vorangetrieben. Die Betriebe sind<br />
nach Fertigstellung <strong>und</strong> Freischaltung<br />
intensiv zu informieren <strong>und</strong> einzubinden.<br />
� Von den VGen werden nach einer Befragung<br />
der Betriebe, die bereits an dem<br />
Programm teilgenommen haben, Mittel<br />
<strong>für</strong> weitere 10 Energieberatungen in Betrieben<br />
zur Verfügung gestellt.<br />
� Der Kirchener Energie-Arbeitskreis wird<br />
mit dem Energie-Arbeitskreis des Modellprojektes<br />
verzahnt.<br />
4 Kandel<br />
<strong>Agenda</strong>-Highlights<br />
in der VG Kandel<br />
November 1998: Verbandsgemeinderatsbeschluss<br />
zur Aufstellung einer <strong>Lokale</strong>n<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong><br />
Dezember 1998: Auftaktveranstaltung <strong>und</strong><br />
Gründung der Arbeitskreise Verkehr, Energie<br />
& Klimaschutz, Siedlungsentwicklung<br />
<strong>und</strong> Kultur<br />
1999: Erarbeitung eines Leitbildes <strong>für</strong> die<br />
VG Kandel, Durchführung einer <strong>Agenda</strong>woche<br />
Oktober 2000: <strong>Agenda</strong>beauftragte der VG<br />
Kandel wird Frau Silke Wiedrig<br />
Januar 2001: Gründung der Direktvermarktungsinitiative<br />
„Bauerntheke“<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
� Seitens der VG Kirchen wird Frau Lieth die<br />
Koordinationsfunktion im Rahmen der <strong>Agenda</strong><br />
<strong>21</strong> beibehalten.<br />
� Seitens der VG Betzdorf wird Herr Becher<br />
die Koordinationsfunktion im Rahmen der<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> von Herrn Frings übernehmen.<br />
� In regelmäßigen Abständen (z.B. halbjährlich)<br />
werden gemeinsame Arbeitskreistreffen<br />
vorgesehen, um die bisherigen Aktivitäten<br />
zu bilanzieren <strong>und</strong> neue Aktivitäten zu<br />
planen.<br />
� Der gemeinsame Auftritt der beiden VGen<br />
soll verbessert werden (u.a. durch einen<br />
gemeinsamen Briefkopf).<br />
März 2001: Start des Modellprojektes „<strong>Agenda</strong><br />
<strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong>“<br />
Mai 2001: AK Verkehr veranstaltet die „Tour<br />
de Kandel“; Modellprojekt „<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>Wirtschaft</strong>“ – 1. Treffen mit dem Umweltausschuss<br />
<strong>und</strong> Vertretern der LA <strong>21</strong><br />
Juli 2001: Modellprojekt „<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong>“<br />
– Vorbesprechung mit den <strong>Wirtschaft</strong>sunternehmen;<br />
AK Energie <strong>und</strong> Klimaschutz<br />
veranstaltet den „Tag der offenen Solaranlage“<br />
<strong>und</strong> vergibt Preise <strong>für</strong> die leistungsfähigsten<br />
Solaranlagen in der VG<br />
August-November 2001: Vorstellung der<br />
Direktvermarktungsbroschüre „Gudes vun do“,<br />
Durchführung von Bauernmärkten <strong>und</strong> Präsen-<br />
22
tation der Bauerntheke auf regionalen Ausstellungen<br />
November 2001: Vorstellung Radwegekonzept<br />
<strong>für</strong> die VG Kandel<br />
Dezember 2001: Inbetriebnahme der auf<br />
Pflanzenölnutzung umgerüsteten Dienstfahrzeuge<br />
der VG Kandel<br />
März / April 2002: Mehrere Vorbereitungstreffen<br />
<strong>für</strong> die „1. Kandeler Energietage“<br />
April 2002: Bildung von Arbeitsgruppen in<br />
drei Ortsgemeinden <strong>und</strong> Beginn Dorfmoderation<br />
sowie Fortschreibung der Dorferneuerungskonzepte<br />
September 2002: 1. Tag der offenen Höfe<br />
der Bauernthekebetriebe der VG Kandel;<br />
Gründung des Bürgervereins zur „Förderung<br />
regenerativer Energien Kandel e.V. (FREK)“<br />
Oktober 2002: 1. Kandeler Energietage mit<br />
Vorträgen <strong>und</strong> Ausstellung in Zusammenarbeit<br />
mit dem ortsansässigen K<strong>und</strong>enzentrum<br />
der Pfalzwerke AG<br />
Januar – Dezember 2003: Projekt Naturstrombündelung<br />
zur Förderung des Naturstrombezuges<br />
Januar – Juni 2003: Planung <strong>und</strong> Ausschilderung<br />
Kraut- <strong>und</strong> Rübenradweg nach<br />
den aktuell gültigen Richtlinien des Landes<br />
Rheinland-Pfalz<br />
April - September 2003: Bau einer Kräuterspirale<br />
mit einer Mädchengruppe in Vollmersweiler<br />
September 2003: Auftaktveranstaltung der<br />
europäischen Biomassetage <strong>für</strong> Rheinland-<br />
Pfalz: Vorträge <strong>und</strong> „Energietour Südpfalz“<br />
in Kooperation mit der Energieagentur Speyer/Neustadt-Südpfalz;<br />
Inbetriebnahme der<br />
nachführenden Photovoltaikanlage des<br />
FREK e.V. in Kandel (Demonstrationsanlage);<br />
2. Tag der offenen Höfe der Bauernthekebetriebe<br />
November 2003: Planung Radweg „Vom<br />
Riesling zum Zander“ in Kooperation mit den<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Landkreisen Südliche Weinstrasse <strong>und</strong> Germersheim<br />
sowie der Gemeinde Neupotz<br />
4.1 Ergebnis der Potenzialanalyse<br />
Zu Beginn des Modellprojekts wurde in ersten<br />
Gesprächen mit den lokalen Verwaltungsspitzen<br />
aus Verbandsgemeinde, Stadt Kandel, den<br />
Ortsgemeinden <strong>und</strong> der <strong>Agenda</strong>beauftragten<br />
<strong>und</strong> basierend auf den vorliegenden Studien<br />
zur lokalen <strong>und</strong> regionalen <strong>Wirtschaft</strong>sentwicklung<br />
eine Analyse der Perspektiven <strong>für</strong> Nachhaltiges<br />
<strong>Wirtschaft</strong>en in der Verbandsgemeinde<br />
vorgenommen.<br />
In der Verbandsgemeinde Kandel sind demnach<br />
folgende Institutionen <strong>und</strong> Verbände als<br />
wichtige Ansprechpartner <strong>für</strong> die <strong>Wirtschaft</strong>sentwicklung<br />
identifiziert worden:<br />
• <strong>Wirtschaft</strong>sförderung des Kreises Germersheim<br />
• Verein <strong>für</strong> Gewerbe <strong>und</strong> Handel e.V., Kandel<br />
• Stadtmarketingbeauftragter der Stadt Kandel.<br />
Neben diesen <strong>Wirtschaft</strong>sinstitutionen spielt der<br />
Umweltausschuss in der VG Kandel eine wichtige<br />
Rolle zur Integration der Aktivitäten aus<br />
den verschiedenen Arbeitskreisen des <strong>Lokale</strong>n<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> Prozesses. Besonders in den Bereichen<br />
Regionalvermarktung <strong>und</strong> nachhaltige<br />
Energieversorgung kommen aus diesen Strukturen<br />
wertvolle Anregungen zur nachhaltigen<br />
wirtschaftlichen Entwicklung der Verbandsgemeinde.<br />
Gr<strong>und</strong>lage <strong>für</strong> die weitere Potenzialanalyse war<br />
neben den Bewerbungsunterlagen der Verbandsgemeinde<br />
Kandel auch eine aktuelle<br />
Diplomarbeit zur nachhaltigen <strong>Wirtschaft</strong>sentwicklung<br />
der Verbandsgemeinde. Darüber<br />
hinaus wurden erste Kontakte zur Kreiswirtschaftsförderung,<br />
dem Verein <strong>für</strong> Gewerbe <strong>und</strong><br />
Handel <strong>und</strong> dem Stadtmarketingprozess in<br />
Kandel hergestellt. Aus Gesprächen mit einigen<br />
lokalen Entscheidungsträgern <strong>und</strong> aus den<br />
23
vorhandenen Unterlagen ergaben sich wichtige<br />
Erkenntnisse <strong>für</strong> die Ausrichtung <strong>und</strong><br />
Konzeption des Modellvorhabens.<br />
Als gr<strong>und</strong>legend positiv <strong>und</strong> ausbaufähig<br />
bewertet wurden die aktiven Arbeitskreise<br />
des noch recht jungen <strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong>-<br />
Prozesses in der Verbandsgemeinde <strong>und</strong><br />
die Aktivitäten des Stadtmarketingprozesses<br />
der Stadt Kandel.<br />
Die <strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> begann in der Verbandsgemeinde<br />
Kandel im Januar 1999 mit<br />
einer Auftaktveranstaltung mit Beteiligung<br />
der Universität Kaiserslautern, basierend auf<br />
einem Beschluß des Verbandsgemeinderats<br />
zur Erarbeitung einer <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> vom<br />
4. November 1998. Mit diesem Gr<strong>und</strong>satzbeschluss<br />
haben die Verbandsgemeinde<br />
<strong>und</strong> die zugehören Ortsgemeinden sich<br />
verpflichtet im Sinne der Rio-<strong>Agenda</strong> nachhaltig<br />
zu handeln <strong>und</strong> zu wirtschaften. Es<br />
bildeten sich gleich zu Beginn des <strong>Agenda</strong>prozesses<br />
mehrere Arbeitskreise, die sich<br />
an den Handlungsfeldern des neuen Leitbildes<br />
einer umfassenden Steigerung der Lebensqualität<br />
in der Verbandsgemeinde orientierten.<br />
Neben dem Themenkomplex Energie<br />
<strong>und</strong> Klimaschutz befassten sich diese<br />
Arbeitskreise zu Beginn mit den Themen<br />
Verkehr, Siedlungsentwicklung <strong>und</strong> Ökologie<br />
sowie Konsum. Diese Arbeitskreise werden<br />
in Kandel von engagierten Bürgerinnen<br />
<strong>und</strong> Bürgern getragen <strong>und</strong> von der damals<br />
neu geschaffenen Stelle der <strong>Agenda</strong>beauftragten<br />
der Verbandsgemeinde tatkräftig<br />
unterstützt. Frau Silke Wiedrig wurde als<br />
<strong>Agenda</strong>beauftragte mit der Koordination der<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> Aktivitäten betraut. Zu Beginn<br />
des Prozess arbeitete sie studienbegleitend<br />
als Honorarkraft, seit Oktober 2000 ist sie<br />
hauptamtlich beschäftigt.<br />
In Absprache mit dem Stadtmarketingbeauftragten<br />
konnte über eine von diesem durchgeführte<br />
Betriebsbefragung die lokale <strong>Wirtschaft</strong><br />
bereits frühzeitig über das Anlaufen<br />
des Modellvorhabens unterrichtet werden.<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Im Fragebogen wurden Fragen zur Bekanntheit<br />
der <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> zu etwaigen Umwelt-/<br />
Nachhaltigkeitsaktivitäten der Betriebe<br />
integriert (Fragebogen s. Anhang). 3 Die folgenden<br />
Themenbereiche wurden ihrer Bedeutung<br />
<strong>für</strong> die lokale <strong>Wirtschaft</strong> entsprechend bewertet:<br />
Innovative Partnerschaften (20%), Ausbildung/Qualifizierung<br />
(20%), effiziente Ressourcennutzung<br />
17%, umweltverträgliche Produktion<br />
(13%), Aufbau von Regionalmarketing<br />
(10%), ÖPNV/Nachhaltige Mobilität (genannt),<br />
Leistungsschau (genannt).<br />
Viele lokale Betriebe waren zu Beginn des<br />
Modellvorhabens bereits aktiv in den im Sommer<br />
2000 begonnenen Stadtmarketingprozess<br />
der Stadt Kandel eingeb<strong>und</strong>en. Aktiv unterstützt<br />
wurde der Stadtmarketingprozess von<br />
der Stadt Kandel <strong>und</strong> dem lokalen Verein <strong>für</strong><br />
Gewerbe <strong>und</strong> Handel. Der Stadtmarketingprozess<br />
hatte bereits vor Beginn des Modellvorhabens<br />
sehr erfolgreich einige Aktivitäten zur<br />
Belebung der Innenstadt <strong>und</strong> Einzelhandelsförderung<br />
angestoßen. Für die umfassenden Fragestellungen<br />
einer nachhaltigen <strong>Wirtschaft</strong>sentwicklung<br />
wurde der Stadtmarketingprozess<br />
erst durch das Modellprojekt geöffnet.<br />
Als wegweisend <strong>für</strong> das gesamte Modellvorhaben<br />
<strong>und</strong> die <strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> in der Verbandsgemeinde<br />
Kandel stellten sich die ambitionierten<br />
Aktivitäten des Verbandsgemeindebürgermeisters<br />
<strong>und</strong> der <strong>Agenda</strong>beauftragten<br />
heraus, die gemeinsam neue Aktivitäten im<br />
Bereich der Förderung regenerative Energien<br />
<strong>und</strong> des Direkt-/Regionalmarketings angestoßen,<br />
aufgegriffen <strong>und</strong> vorangetrieben hatten.<br />
4.2 Vorgehen im Modellprojekt<br />
Basierend auf einem ersten Gespräch mit der<br />
Verwaltungsspitze <strong>und</strong> einigen Unternehmern<br />
wurde vereinbart, im Rahmen von getrennt<br />
3 Das im September 2001 verfasste Gutachten des<br />
Stadtmarketingbeauftragten wertet zwar die Umfrage<br />
aus, erwähnt aber das Modellvorhaben nicht.<br />
24
geführten Vorgesprächen mit einigen lokalen<br />
Betrieben sowie Beteiligten der <strong>Lokale</strong>n<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> der Politik über eine geeignete<br />
Vorgehensweise <strong>für</strong> das Modellvorhaben<br />
zu beraten. Einvernehmlich wurde auch<br />
beschlossen, das Modellvorhaben zunächst<br />
parallel zu dem bereits laufenden <strong>Agenda</strong>bzw.<br />
Stadtmarketingprozess zu beginnen.<br />
Damit sollten der politische Stellenwert des<br />
Vorhabens herausgehoben <strong>und</strong> die Effizienz<br />
<strong>und</strong> Effektivität des Vorhabens <strong>für</strong> die <strong>Wirtschaft</strong><br />
gesichert werden.<br />
Der Stadtmarketingprozess <strong>und</strong> die <strong>Lokale</strong><br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> waren zu Beginn des Modellvorhabens<br />
nicht nur institutionell voneinander<br />
getrennt. Zwischen den Betrieben in der<br />
Verbandsgemeinde <strong>und</strong> den ehrenamtlichen<br />
<strong>Agenda</strong>-Akteuren existierten auch keine<br />
bzw. lediglich punktuelle Verbindungen, die<br />
es im Modellvorhaben nach Möglichkeit<br />
auszubauen galt. Eine stärkere Verflechtung<br />
dieser beiden Prozesse stieß jedoch im<br />
Weiteren auf diverse eher persönlich motivierte<br />
Hindernisse. Obwohl diese zwischen<br />
wesentlichen lokalen Akteuren auch im<br />
Laufe des Modellvorhabens nicht gänzlich<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
ausgeräumt werden konnten, findet inzwischen<br />
zumindest ein recht regelmäßiger Informationsaustausch<br />
statt <strong>und</strong> im Bereich der Förderung<br />
der Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte<br />
hat es auch punktuelle Zusammenarbeit<br />
gegeben. Darüber hinaus haben einige der im<br />
Modellvorhaben beteiligten <strong>Wirtschaft</strong>svertreter<br />
aus Kandel zumindest zeitweilig versucht Anknüpfungspunkte<br />
zum Stadtmarketingprozess<br />
zu identifizieren.<br />
Nachdem diese Strategie vereinbart war, galt<br />
es die bürgerschaftlichen Akteure der <strong>Lokale</strong>n<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> sowie die politischen Vertreter im<br />
Gemeinderat über das geplante weitere Vorgehen<br />
zu informieren. In einer Sondersitzung des<br />
Umweltausschusses wurden die Zielsetzungen<br />
des Modellvorhabens vorgestellt <strong>und</strong> die geplante<br />
Vorgehensweise erläutert. Der Vorschlag,<br />
das Modellvorhaben zunächst getrennt<br />
vom <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong>-Prozess zu beginnen<br />
<strong>und</strong> erst zu einem späteren Zeitpunkt die beiden<br />
Prozesse zusammen zu führen, stieß sowohl<br />
bei den anwesenden Politikern als auch<br />
bei den in der <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> engagierten<br />
Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürgern auf Zustimmung.<br />
25
Nach diesem ersten Treffen mit VertreterInnen<br />
der LA <strong>21</strong> wurden die lokalen <strong>Wirtschaft</strong>svertreter<br />
von der VG zu einer Vorbesprechung<br />
eingeladen. Es wurde eine Einigung<br />
darüber erzielt, dass die Verwaltungsspitze<br />
<strong>und</strong> die Vertreter der örtlichen <strong>Wirtschaft</strong><br />
gemeinsam zur Auftaktveranstaltung<br />
einladen würden. Ergänzend zur anregenden<br />
Darstellung guter Beispiele <strong>und</strong> gelungener<br />
Unternehmenskooperationen sollten<br />
auch lokale (Vorreiter-)Betriebe von ihren<br />
Erfahrungen im Bereich Nachhaltiges <strong>Wirtschaft</strong>en<br />
berichten. Durch Pressegespräche<br />
wurde anschießend die lokale Öffentlichkeit<br />
über die Zielsetzung <strong>und</strong> die beginnenden<br />
Aktivitäten des Modellvorhabens informiert.<br />
Bei der Auftaktveranstaltung im Juni 2001,<br />
zu der ca. 35 lokale Betriebe in das Kandeler<br />
Feuerwehrgerätehaus kamen, wurden<br />
Informationen zum Modellvorhaben verbreitet<br />
<strong>und</strong> in einem Impulsvortrag nachahmenswerte<br />
Praxisbeispiele u.a. zur „Kooperation<br />
zwischen Kommune <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> im<br />
Bereich betriebliches Umweltmanagement“<br />
am Beispiel ÖKOPROFIT <strong>und</strong> zum Thema<br />
„Regionalvermarktung“ am Beispiel der<br />
Initiative „BRUCKER LAND/Unser Land“;<br />
vgl. Kaiptel 5.2.3.2 <strong>und</strong> 6.1.3 ) vorgestellt. In<br />
Anschluss daran berichteten Vertreter der<br />
Fa. Nolte von der Einführung eines Umweltmanagementsystems<br />
<strong>und</strong> den damit<br />
verb<strong>und</strong>enen Erfolgen beim Recycling.<br />
Als Ergebnisse dieser Auftaktveranstaltung<br />
wurden zwei Arbeitsgruppen gebildet:<br />
• Die AG <strong>Lokale</strong>s Ressourcen-Netzwerk<br />
setzte sich zum Ziel regenerative Energien<br />
zu fördern <strong>und</strong> durch kooperatives<br />
Handeln von Unternehmen Ressourcen<strong>und</strong><br />
Kosteneinsparungen zu erzielen.<br />
• Die AG Nachhaltig Leben <strong>und</strong> Arbeiten<br />
strebte u.a. an, Aktivitäten zur Verbesserung<br />
der Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungssituation<br />
in der VG durchzuführen <strong>und</strong> einen<br />
E-Newsletter zum nachhaltigem<br />
<strong>Wirtschaft</strong>en zu produzieren.<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Als wesentliche Aktivitäten der beiden Arbeitskreise<br />
kristallisierten sich zum einen der Tag<br />
der offenen Tür „Arbeitgeber der Verbandsgemeinde<br />
Kandel stellen sich vor“ (13./14. Sept.<br />
2002) zur Förderung der Ausbildungschancen<br />
von Jugendlichen in der VG sowie die Organisation<br />
der „1. Kandeler Energietage“ im Herbst<br />
2002 heraus.<br />
Ende 2002 fand eine Sitzung zur Nachbereitung<br />
der Kandeler Energietage statt. Dabei<br />
wurde auch ein Resümee der Zwischenergebnisse<br />
des Modellvorhabens <strong>und</strong> der bisherigen<br />
Arbeit in den Arbeitsgruppen gezogen <strong>und</strong> u.a.<br />
wurde vereinbart die Kandeler Energietage im<br />
folgenden Jahr zu wiederholen.<br />
Eine chronologische Darstellung der Schlüsselveranstaltungen<br />
<strong>und</strong> deren Ergebnisse findet<br />
sich im Anhang.<br />
4.3 Projekte<br />
4.3.1 <strong>Lokale</strong>s Ressourcennetzwerk<br />
Basierend auf der Projektkonzeption im Rahmen<br />
des Arbeitstreffens zum Auftakt des Modellvorhabens<br />
hat sich der Arbeitskreis „<strong>Lokale</strong>s<br />
Ressourcennetzwerk“ folgende Ziele gesetzt:<br />
• Kosteneinsparungen durch eine vernetzte<br />
Nutzung lokaler Ressourcen (Energie, Güter,<br />
Dienstleistungen)<br />
26
• Verbesserung der Versorgung mit<br />
erneuerbaren Energien<br />
• Dauerhafte Kooperationen zwischen<br />
den Unternehmen <strong>und</strong> weiteren relevanten<br />
Partner in der Verbandsgemeinde<br />
Nach einigen Treffen der Arbeitsgruppe, bei<br />
dem sich eine Gruppe aus 10-15 Vertretern<br />
der örtlichen Unternehmen aus recht unterschiedlichen<br />
<strong>Wirtschaft</strong>ssektoren über die<br />
konkrete Ausrichtung des Projektes verständigten,<br />
begann im Frühjahr 2002 die<br />
Vorbereitung einer größeren öffentlichkeitswirksamen<br />
Veranstaltung. Aus Gründen der<br />
personellen Verstärkung sowie der ähnlichen<br />
Zielsetzung wurden auch die Mitglieder<br />
des LA <strong>21</strong>-Arbeitskreises „Energie <strong>und</strong><br />
Klimaschutz“ zu diesen Treffen mit eingeladen.<br />
Als Aufhänger <strong>für</strong> die geplanten Maßnahmen<br />
dienten die Europäischen Biomassetage<br />
der Regionen, bei denen sich europaweit<br />
Einrichtungen <strong>und</strong> Projekte vorstellten, die<br />
sich mit der Nutzung erneuerbarer Energieträger<br />
befassten. Der Arbeitskreis <strong>Lokale</strong>s<br />
Ressourcennetzwerk gab hierbei den Anstoß<br />
zur Veranstaltung der „1. Kandeler<br />
Energietage“ <strong>und</strong> knüpfte damit erfolgreich<br />
an die vom <strong>Agenda</strong>-Arbeitskreis Energie<br />
<strong>und</strong> Klimaschutz zuvor organisierten Aktivitäten<br />
an (z.B. „Tag der offenen Solaranlage“).<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Die Verbandsgemeinde Kandel hat die 1. Kandeler<br />
Energietage zusammen mit dem größten<br />
regionalen Energieversorger, der Pfalzwerke<br />
AG, <strong>und</strong> der Forstverwaltung organisiert. Am<br />
18. Oktober 2002 fand in den Gebäuden der<br />
Pfalzwerke AG ein Symposium zum „Einsatz<br />
erneuerbarer Energieträger“ statt. Zwei Tage<br />
später, am 20.10.2002 wurde zudem eine gut<br />
besuchte Ausstellung organisiert, die einer<br />
zweistelligen Anzahl von lokalen Unternehmern<br />
aus dem Bereich der regenerativen, energiesparenden<br />
Umwelttechnik eine Gelegenheit<br />
bot, ihr Dienstleistungsspektrum dem breiten<br />
Publikum vorzustellen.<br />
Von den eingeladenen Experten herausgehoben<br />
<strong>und</strong> von lokalen Unternehmen praktisch<br />
veranschaulicht wurden die immensen regionalen<br />
Potenziale bei den regenerativen Energieträgern<br />
Holz, Erdwärme, Solarenergie, Pflanzenöl,<br />
Biogas. So können z.B. die regionalen<br />
Bestände an verwertbarem, bisher ungenutztem<br />
Holz sowohl <strong>für</strong> die dezentrale Beheizung<br />
von Privathäusern als auch <strong>für</strong> die Wärmeversorgung<br />
größerer Gebäudekomplexe genutzt<br />
werden. Der Referent der Pfalzwerke AG erläuterte<br />
neue klimaschonende Alternativen bei der<br />
zentralen Energieversorgung von Neubaugebieten.<br />
Die Kandeler Ernergietage dienten als öffentlichkeitswirksame<br />
Plattform <strong>für</strong> die vom Verbandsgemeindebürgermeister<br />
<strong>und</strong> einigen<br />
Mitgliedern der Arbeitskreise „<strong>Lokale</strong>s Ressourcennetzwerk“<br />
<strong>und</strong> „Energie <strong>und</strong> Klima-<br />
27
schutz“ angeregte Gründung des Vereins<br />
„Förderung regenerativer Energien Kandel<br />
e.V." (FREK). Während den Veranstaltungen<br />
<strong>und</strong> in diversen Presseberichten über<br />
die Energietage konnten erfolgreich neue<br />
Mitglieder <strong>für</strong> den Verein geworben werden.<br />
Die Kandeler Energietage haben gezeigt,<br />
dass sich durch gezielte, öffentlichkeitswirksame<br />
Veranstaltungen die ortsansässigen<br />
Unternehmen <strong>für</strong> die Ziele Nachhaltigen<br />
<strong>Wirtschaft</strong>ens aktivieren <strong>und</strong> allmählich <strong>für</strong><br />
die Ziele <strong>und</strong> den Prozess der <strong>Lokale</strong>n<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> gewinnen lassen. Deutlich wurde,<br />
dass bei lokalen Entscheidungsträgern<br />
aus Verwaltung, Politik <strong>und</strong> Unternehmen<br />
sowie bei Privatleuten bei Informationsbedarf<br />
hinsichtlich der Gestaltungsspielräume<br />
im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung<br />
weiterhin sehr groß ist.<br />
Besonders hervorzuheben ist die gelungene<br />
Zusammenarbeit bei der Vorbereitung dieser<br />
1. Kandeler Energietage zwischen ehrenamtlich<br />
tätigen Bürgern, der Verwaltung<br />
<strong>und</strong> den lokalen Betrieben. Insbesondere<br />
die Zusammenarbeit mit dem Forstamt in<br />
Kandel <strong>und</strong> mit der Pfalzwerke AG hat sich<br />
als sehr fruchtbar erwiesen <strong>und</strong> seitdem<br />
weiter entwickelt.<br />
Zwar gelang es nur zum Teil die lokalen<br />
<strong>Wirtschaft</strong>svertreter zu erreichen, um so<br />
mehr kann dieser erste Schritt als gelungener<br />
Anstoß <strong>für</strong> weitere Aktivitäten zur ökologisch<br />
<strong>und</strong> ökonomisch integrierten Wirt-<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
schaftsentwicklung der Verbandsgemeinde<br />
gelten.<br />
Die beteiligten Vertreter <strong>und</strong> Vertreterinnen aus<br />
der <strong>Wirtschaft</strong>, der Verwaltung <strong>und</strong> der Bürgerschaft<br />
haben sich bei einem Nachbereitungstreffen<br />
darauf verständigt die Kandeler Energietage<br />
2003 wiederum im Rahmen der Europäischen<br />
Biomassetage zu organisieren, deren<br />
Auftaktveranstaltung in Kandel stattfinden soll.<br />
„Mit Schwung <strong>und</strong> Energie in die Zukunft!“, so<br />
lautete dann auch das Motto der 2. Kandeler<br />
Energietage 2003. Gemeinsam mit der<br />
Energie-Agentur Speyer-Neustadt / Südpfalz<br />
organisierten die Verbandsgemeinden Kandel,<br />
Herxheim <strong>und</strong> die Handwerkskammer der Pfalz<br />
eine Energietour Südpfalz.<br />
Die Veranstaltung stand einerseits Handwerksbetrieben<br />
<strong>für</strong> die K<strong>und</strong>enberatung zur Verfügung,<br />
andererseits wurde Bauherren <strong>und</strong> Bürgern<br />
die Möglichkeit geboten, sich umfassend<br />
über Energieeinsparungen <strong>und</strong> erneuerbare<br />
Energien zu informieren. Handwerker <strong>und</strong> Bauherren<br />
luden gemeinsam dazu ein, die Vorbildprojekte<br />
im Bereich Erneuerbare Energien - -<br />
vor Ort hautnah <strong>und</strong> im persönlichen Gespräch<br />
kennen zu lernen.<br />
Im Rahmen dieser Energietour Südpfalz wurde<br />
die Landesweite Auftaktveranstaltung der Europäischen<br />
Biomasse-Tage am Samstag, den<br />
27.09.2003, in der Realschule Kandel abgehalten.<br />
28
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Aus dem Programm:<br />
10.00 Uhr Eröffnung in der Realschule Kandel<br />
Begrüßung durch Hans-Joachim Ritter, Vorsitzender der Stiftung Ökologie <strong>und</strong><br />
Demokratie e.V. <strong>und</strong> der EnergieAgentur Speyer/Neustadt Südpfalz als Veranstalter,<br />
Grußwort des Landrats des Landkreises Germersheim, Dr. Fritz Brechtel,<br />
Grußwort des Verbandsbürgermeisters der Verbandsgemeinde Kandel, Günther<br />
Tielebörger<br />
10.20 Uhr Bioenergie als Chance <strong>für</strong> Rheinland-Pfalz<br />
Staatssekretär Hendrik Hering, Ministerium <strong>für</strong> Umwelt <strong>und</strong> Forsten<br />
10.45 Uhr Vorstellung Bioenergiekonzept Realschule Kandel mit Anlagenbesichtigung, Kurt<br />
Hellwig, Firma WAT, als Contractor<br />
11.15 Uhr Fahrt nach Wörth<br />
11.30 Uhr Präsentation des im Bau befindlichen, landesweit größten Biomasseheizwerks<br />
durch die Projektbeteiligten<br />
Pfalzwerke AG, Kraft Wärme Wörth GmbH, Landesverein <strong>für</strong> Innere Mission in der<br />
Pfalz e.V., Wohnbau Wörth am Rhein GmbH, Stadtverwaltung Wörth<br />
12.15 Uhr Vorführung Hackschnitzelerzeugung im Rahmen der Landschaftspflege in Freckenfeld<br />
Dipl. Forstingenieur. Johannes Becker, Forstamt Bienwald<br />
An der Energietour beteiligten sich u.a. folgende Objekte:<br />
Orte Objekt Sonderprogramm<br />
Kandel Holzhackschnitzel -Heizanlage Auftaktveranstaltung, Vorführung<br />
Kandel Fotovoltaikanlage 10.00 -14.00 Uhr<br />
Kandel Fotovoltaikanlage 7,4 kwp Info-Stand<br />
Kandel Nachgeführte Fotovoltaikanlage Beratung <strong>und</strong> Information<br />
Kandel Wärmepumpentechnik, Erdsondenanlagen Beratung <strong>und</strong> Information<br />
Wörth Biomasse Heizwerk Auftaktveranstaltung<br />
Steinweiler Erdsonden-Heizanlage, Wärmepumpe<br />
Schaidt Holzheizung & Solar<br />
Herxheim Blockheizkraftwerk Waldfreibad Beratung <strong>und</strong> Information<br />
Landau Fotovoltaikanlage Besichtigung von oben, Bewirtung<br />
Kapsweyer<br />
Landau-<br />
Nussdorf<br />
Gommers-<br />
heim<br />
Heizungsunterstütze Solaranlage, Pelletheizofen<br />
Fotovoltaik- <strong>und</strong> Solarthermie- Module, Regenwassernutzung<br />
Heizungsunterstützte Solaranlage,<br />
Pelletheizofen<br />
Oberhausen Pelletheizkessel mit Solaranlage<br />
Besichtigung von 14 -17 Uhr<br />
29
Weitere Veranstaltungen zu den Themen<br />
„Solaranlagen – ein Erfahrungsaustausch“,<br />
„energetische Gebäudesanierung“, „Strom<br />
aus Sonne (Photovoltaik)“ boten viel Gelegenheit<br />
zum Erfahrungsaustausch <strong>für</strong> die<br />
lokal Aktiven.<br />
4.3.2 Holzhackschnitzelanlage<br />
Basierend auf guten Erfahrungen mit der<br />
Versorgung der Integrierten Realschule<br />
Kandel mit einer Holzhackschnitzel-<br />
Heizanlage, wurde angeregt weitere ähnlich<br />
gelagerte Projekte in der VG voranzutreiben.<br />
Ein Projekt, das im Rahmen der Arbeitskreis<br />
„<strong>Lokale</strong>s Ressourcennetzwerk“ thematisiert<br />
<strong>und</strong> zu Beginn ausgiebig behandelt wurde,<br />
war die Idee der Modernisierung der Energieversorgung<br />
der Asklepios-Klinik in Kandel<br />
auf der Basis der lokal verfügbaren, erneuerbaren<br />
Ressource Holz.<br />
Der Arbeitskreis beschäftigte sich zweimal<br />
intensiv mit der Möglichkeit der Installation<br />
einer Holzhackschnitzelanlage <strong>und</strong> möglichen<br />
Verknüpfungen mit anderen Vorhaben.<br />
Mit der Unterstützung fachk<strong>und</strong>iger Teilnehmer<br />
erörterte er die Verfügbarkeit <strong>und</strong><br />
Eignung lokaler Holzressourcen <strong>und</strong> diskutierte<br />
technische <strong>und</strong> finanzielle Aspekte.<br />
Schließlich befand der Vertreter der Klinik,<br />
dass er ausreichend Informationen erhalten<br />
habe, um zu entscheiden welche Option <strong>für</strong><br />
das Krankenhaus in Frage käme. Wie sich<br />
dann leider herausstellte, wurde dieses<br />
Vorhaben nicht weiter verfolgt, da der betreffende<br />
Klinikleiter nur wenig später seine<br />
Stelle gewechselt hat.<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
4.3.3 Pflanzenöl als Treibstoff<br />
Ein weiteres Vorhaben, das im Rahmen der AG<br />
<strong>Lokale</strong>s Ressourcennetzwerk aufgegriffen <strong>und</strong><br />
weiter verfolgt wurde, war die Idee des Maschinenring<br />
Südpfalz e.V. <strong>und</strong> dessen Umweltberatung<br />
„agrar-umwelt-technik“ (a.u.t. GmbH),<br />
Pflanzenöl als Treibstoffalternative <strong>für</strong> umgerüstete<br />
Dieselmotoren in der Region Südpfalz<br />
zu nutzen.<br />
Realisiert wurde die Umrüstung von zwei Verbandsgemeindefahrzeugen<br />
auf Pflanzenölbetrieb<br />
sowie die Installation eines Pflanzenöltankpunktes<br />
bei einer örtlichen Tankstelle. Am<br />
06. Dezember 2001 übergaben die agrarumwelt-technik<br />
gmbh <strong>und</strong> das Autohaus Tretter<br />
zwei speziell auf Pflanzenöl umgerüstete<br />
Dienstfahrzeuge an die Verbandsgemeinde<br />
Kandel.<br />
Fahrzeuge, die durch einen Fachmann auf den<br />
Betrieb mit Pflanzenöl umgestellt werden, können<br />
ohne Probleme mit Öl betrieben werden.<br />
Sollte es dennoch einmal Probleme geben, so<br />
ist das Fahrzeug durch eine zusätzliche Produktversicherung<br />
<strong>für</strong> das a.u.t. – Öl versichert.<br />
Auf den Fahrzeugumbau hat sich das Autohaus<br />
Müller in Hatzenbühl spezialisiert. Sind die<br />
Umrüstkosten <strong>für</strong> das Fahrzeug einmal aufgewendet<br />
worden, kann bei jedem Tanken durch<br />
die beträchtliche Preisdifferenz zum Mineralöldiesel<br />
<strong>und</strong> auch zum Biodiesel (= verestertes<br />
Pflanzenöl) gespart werden.<br />
Bei der Pflanzenölproduktion bleibt der gesamte<br />
Kohlendioxid-Kreislauf geschlossen: Es werden<br />
Rapspflanzen angebaut, die Samen geerntet<br />
<strong>und</strong> das Öl in einer Ölmühle ausgepresst.<br />
Bei der Verbrennung des Öls wird genau soviel<br />
CO2 emittiert, wie die Pflanzen während ihres<br />
Wachstums vorher der Atmosphäre entzogen<br />
haben. Überdies bleibt die gesamte Wertschöpfung<br />
auf diesem Weg in der Region. Dadurch<br />
wird das „Pflanzenölprojekt“ zu einem hervorragenden<br />
„<strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong>-Projekt“.<br />
Getankt werden kann das Pflanzenöl an einer<br />
zentral gelegenen Tankstelle in Kandel. Da das<br />
30
Öl in die Wassergefährdungsklasse 0 eingestuft<br />
wird, kann es auch in Hoftankstellen<br />
(z.B. in 1000 l Gitterboxen) zur Verfügung<br />
gestellt werden.<br />
4.3.4 Tag der offenen Unternehmen <strong>für</strong><br />
Auszubildende<br />
Idee <strong>und</strong> Umsetzung <strong>für</strong> dieses Vorhaben<br />
stammen vom <strong>Lokale</strong>-<strong>Agenda</strong>-Arbeitskreis<br />
"Nachhaltig Leben <strong>und</strong> Arbeiten in der VG<br />
Kandel", der das Profil der Verbandsgemeinde<br />
Kandel als Arbeits- <strong>und</strong> Ausbildungsmarkt<br />
sowie als Einkaufs- <strong>und</strong> Dienstleistungsstandort<br />
schärfen <strong>und</strong> die sog.<br />
"weichen" Standortfaktoren in der Verbandsgemeinde<br />
entwickeln <strong>und</strong> fördern will.<br />
Beim Tag der offenen Tür "Arbeitgeber der<br />
VG Kandel stellen sich vor" am 13. September<br />
2002 von 14 bis 18 Uhr <strong>und</strong> am 14.<br />
September von 10 bis 13 Uhr boten Betriebe,<br />
Geschäfte <strong>und</strong> Institutionen in der Verbandsgemeinde<br />
eine neue <strong>und</strong> unverbindliche<br />
Art des Kennenlernens an. Zielgruppe<br />
waren einmal nicht die K<strong>und</strong>en sondern alle,<br />
die sich <strong>für</strong> Arbeits- <strong>und</strong> Ausbildungsmöglichkeiten<br />
interessieren. Welche Berufe sind<br />
in den teilnehmenden Kandeler Betrieben<br />
gefragt <strong>und</strong> wie wird dort gearbeitet? Wer<br />
bildet aus? Wo können zukünftige, junge<br />
Arbeitssuchende ein Praktikum absolvieren<br />
oder als Aushilfskraft jobben?<br />
Mit einem Faltblatt <strong>und</strong> einem Pressegespräch<br />
im Büro des Verbandsgemeindebürgermeisters<br />
wurde im Vorfeld darüber informiert,<br />
wer an welchem der beiden Tage mit<br />
macht bzw. nach telefonischer Anmeldung<br />
seine Pforte öffnet <strong>und</strong> wer die jeweilige<br />
Ansprechperson ist. Informationen gab es<br />
außerdem an beiden Tagen an einem Infostand.<br />
Und damit die Wege <strong>für</strong> die Interessierten<br />
nicht zu weit wurden, kreiste der<br />
<strong>Agenda</strong>-Minibus zwischen Innenstadt <strong>und</strong><br />
den Gewerbegebieten Horst <strong>und</strong> Lauterburger<br />
Strasse.<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Kooperationspartner waren die Verbandsgemeinde<br />
<strong>und</strong> die Stadt Kandel, der Verein <strong>für</strong><br />
Handel <strong>und</strong> Gewerbe, ansässige Betriebe <strong>und</strong><br />
die Kandeler Dienststelle des Arbeitsamtes.<br />
4.3.5 Direktvermarktungsinitiative „Bauerntheke"<br />
In Zusammenarbeit mit den heimischen Landwirten<br />
entstand die Direktvermarktungsinitiative<br />
„Bauerntheke“. Die Idee war entstanden durch<br />
die Verbandsgemeinde Kandel <strong>und</strong> den LA <strong>21</strong>-<br />
Arbeitskreis Siedlungsentwicklung, Landwirtschaft<br />
<strong>und</strong> Ökologie zur Förderung der Vermarktung<br />
lokaler Erzeugnisse.<br />
Als erster Schritt gaben die Landwirte gemein-<br />
sam mit der Verbandsgemeindeverwaltung<br />
eine Direktvermarkterbroschüre „Gudes vun<br />
do“ mit Unterstützung der Staatlichen Lehr- <strong>und</strong><br />
Forschungsanstalt Neustadt <strong>und</strong> dem Maschinenring<br />
Südpfalz heraus. Des weiteren wurden<br />
die Verbraucherinnen <strong>und</strong> Verbraucher durch<br />
die Organisation von Bauernmärkten, Tage der<br />
offenen Höfe etc. auf das heimische Angebot<br />
<strong>und</strong> die Produktion in den heimischen Betrieben<br />
aufmerksam gemacht. Die Bauerntheke<br />
31
präsentiert die Verbandsgemeinde Kandel<br />
regelmäßig auf regionalen Verbrauchermessen.<br />
B.A.U.M. hat diese Initiative im Sinne eines<br />
Coaching der lokalen Aktivitäten vor dem<br />
Erfahrungshintergr<strong>und</strong> aus anderen vergleichbaren<br />
Prozessen (vgl. Kap. 6.1.3.<br />
UNSER LAND) kritisch begleitet <strong>und</strong> Anregungen<br />
<strong>für</strong> Verbesserungsmöglichkeiten<br />
geliefert.<br />
4.3.6 Weitere Aktivitäten<br />
Neben diesen bereits realisierten Projekten,<br />
hat sich der Arbeitskreis „Nachhaltiges <strong>Wirtschaft</strong>en“<br />
(in Zusammenarbeit mit dem<br />
FREK e.V. <strong>und</strong> den anderen Arbeitskreisen<br />
der LA <strong>21</strong>) <strong>für</strong> die Zukunft folgende weitere<br />
Aktivitäten vorgenommen:<br />
• Strombündelung zur Förderung der<br />
Abnahme von Naturstrom durch private<br />
Haushalte, eine Kooperation des FREK<br />
e.V., der Verbandsgemeinde <strong>und</strong> der<br />
Pfalzwerke AG (Beginn Januar 2003,<br />
bislang 60 teilnehmende Haushalte gewonnen)<br />
• Bau einer Geothermieanlage zur Erzeugung<br />
von Strom <strong>und</strong> gleichzeitiger Nutzung<br />
der Wärme zur Trocknung von<br />
Holz aus dem Bienwald bzw. Klärschlamm<br />
• Kooperationen der örtlichen Handwerksbetriebe<br />
zur Versorgung der entstehenden<br />
Neubaugebiete mit regenerativen<br />
Energien<br />
• Gegenseitige Unterstützung der<br />
umweltzertifzierten Unternehmen in der<br />
Verbandsgemeinde („Cross-<br />
Zertifizierung“)<br />
• Informationsplattform „Nachhaltig <strong>Wirtschaft</strong>en“<br />
im Internet<br />
• Versorgung des Industriegebiets „Horst“<br />
mit erneuerbaren Energien<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Diverse weitere Projekte <strong>und</strong> Aktivitäten zur<br />
Förderung Nachhaltigen <strong>Wirtschaft</strong>ens, die<br />
nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem<br />
Modellvorhaben stehen, sind in der VG Kandel<br />
angelaufen bzw. in der Planung:<br />
• Erstellung eines Radwegenutzungskonzepts<br />
<strong>für</strong> die heimische Bevölkerung <strong>und</strong><br />
den Radtourismus<br />
• Dorferneuerung: Fortschreibung der Dorfentwicklungspläne,<br />
Initiierung einer Arbeitsgruppe<br />
„Nachhaltige Dorferneuerung“<br />
• Regionalmarketing zur Stärkung des <strong>Wirtschaft</strong>s-<br />
<strong>und</strong> Wohnstandortes VG Kandel,<br />
Entwicklung eines Regionalen Entwicklungskonzeptes<br />
• Großprojekt Bienwald Tourismus in Zusammenarbeit<br />
mit dem LA <strong>21</strong>-Arbeitskreis<br />
„Leben am Strom“ des Landkreis Germersheim<br />
• Raumordnung: Lobbyarbeit <strong>für</strong> eine nachhaltige<br />
Fortschreibung des regionalen<br />
Raumordnungsplanes<br />
• Energiebewusste Verbandsgemeinde:<br />
Neubau/Renovierung des VG-Verwaltungsgebäudes<br />
unter Berücksichtigung energieeffizienter<br />
Technologien (Niedertemperaturheizung,<br />
Photovoltaikanlage, Wiederverwendung<br />
von Regenwasser bei der Toilettenspülung)<br />
<strong>und</strong> zwei auf Pflanzenölbasis<br />
betriebenen Dienstfahrzeuge.<br />
4.4 Strukturen<br />
4.4.1 Arbeitskreise<br />
In der Verbandsgemeinde Kandel wurde im<br />
Rahmen des Modellvorhabens ein neuer Arbeitskreis<br />
gegründet, der Arbeitskreis „Nachhaltig<br />
<strong>Wirtschaft</strong>en“. Von diesem Arbeitskreis aus<br />
wurden mittels zweier Arbeitsgruppen („AG<br />
<strong>Lokale</strong>s Ressourcennetzwerk“ <strong>und</strong> „AG Leben<br />
<strong>und</strong> Arbeiten“) erste Projekte zur Förderung<br />
einer nachhaltigen <strong>Wirtschaft</strong>sentwicklung in<br />
der VG voran getrieben.<br />
32
Das Modellvorhaben lief nicht gänzlich unabhängig<br />
von den zuvor bereits existierenden<br />
AK-Strukturen. Schon nach einigen<br />
Monaten zeigte sich, dass sich die Arbeit<br />
der Arbeitsgruppe „<strong>Lokale</strong>s Ressourcennetzwerk“<br />
gut mit dem Engagement des LA<br />
<strong>21</strong>-Arbeitskreises „Energie <strong>und</strong> Klimaschutz“<br />
verbinden ließ, was auch zu einer personellen<br />
Verstärkung der Arbeitsgruppe beitrug.<br />
4.4.2 FREK – „Verein zur Förderung regenerativer<br />
Energien Kandel e.V."<br />
Der im Vorfeld der Kandeler Ernergietage<br />
gegründete Verein zur „Förderung regenerativer<br />
Energien Kandel e.V." (FREK) hat sich<br />
zum Ziel gesetzt, den Umwelt- <strong>und</strong> Klimaschutz<br />
in der Region voran zu bringen <strong>und</strong><br />
zu diesem Zweck den Einsatz erneuerbarer<br />
Energieressourcen zu fördern. Über die<br />
Förderung von Modellprojekten sieht die<br />
Satzung des Vereins auch klassische Öffentlichkeitsarbeit<br />
in Form von Veranstaltungen<br />
<strong>und</strong> Ausstellungen zum umweltschonenden<br />
Umgang mit Energie vor. Zudem<br />
sollen auch konkrete Energieberatungen <strong>für</strong><br />
Unternehmen <strong>und</strong> Privathaushalte ermöglicht<br />
werden.<br />
Der niedrige Jahresbeitrag von 60 €, der<br />
steuerlich absetzbar ist, soll <strong>für</strong> die Vereinsmitglieder<br />
ökologisch sinnvoll kompensiert<br />
werden. Geplant ist es, durch einen<br />
Zusammenschluss von mindestens 50<br />
Kleinverbrauchern die neuerdings von den<br />
Pfalzwerken gewährte Option der „Strombündelung“,<br />
das heißt der kollektiven Abnahme<br />
von Öko-Strom zu einem ansonsten<br />
nur <strong>für</strong> Großverbraucher gewährten günstigeren<br />
Tarif, zu nutzen.<br />
Als erstes Projekt wurde vom Verein beim<br />
Kandeler Wasserturm eine Bürger-<br />
Fotovoltaikanlage errichtet, die unter anderem<br />
auch den Schulen in der Verbandsgemeinde<br />
als Demonstrationsobjekt dient.<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Als Mitglieder können sich neben den lokalen<br />
Unternehmen auch engagierte Einzelpersonen<br />
aus der Region eigen-initiativ <strong>und</strong> mitgestaltend<br />
in die Aktivitäten des Vereins einbringen. Durch<br />
die Erschließung neuer Energie- <strong>und</strong> Humanressourcen<br />
besitzt das FREK ein großes Potenzial<br />
<strong>für</strong> die nachhaltige Entwicklung der<br />
Verbandsgemeinde.<br />
Der Verein zur Förderung regenerativer Energien<br />
Kandel e.V. zeigt sehr deutlich wie wichtig<br />
es ist, dass die <strong>Agenda</strong> Chefsache ist. Er ist<br />
damit ein gelungenes Beispiel <strong>für</strong> die herausragende<br />
Bedeutung sog. „local heroes“ (Verbandsgemeindebürgermeister,innovationsbegeisterter<br />
Unternehmer).<br />
Folgende Aktivitäten hat der FREK in Kooperation<br />
mit den thematisch ähnlich ausgerichteten<br />
AKs der <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> des Modellvorhabens<br />
geplant:<br />
� Erstellung eines Dachflächen- <strong>und</strong> Solarflächenkatasters<br />
in Zusammenarbeit mit<br />
der <strong>Agenda</strong> AG der ortsansässigen Integrierten<br />
Gesamtschule<br />
� Bau eines Wasserkraftwerkes<br />
4.4.3 MBR-Südpfalz e.V .<br />
Der Maschinen- <strong>und</strong> Betriebshilfsring Südpfalz<br />
e.V. (www.agrar-umwelt-technik.de/mbr_home.htm<br />
) ist eine landwirtschaftliche Vereinigung<br />
mit ca. 1800 Mitgliedsbetrieben. Hierzu<br />
zählen land- <strong>und</strong> forstwirtschaftliche Lohnunternehmen<br />
sowie im Bereich des Landschaftsbaus<br />
<strong>und</strong> der Gewässerpflege tätige Unternehmen.<br />
Seit zehn Jahren ist der Verein im<br />
Bereich der kommunalen <strong>und</strong> umwelttechnischen<br />
Dienstleistungen <strong>für</strong> Verbands- <strong>und</strong><br />
Ortsgemeinden, Kreisverwaltungen <strong>und</strong> private<br />
Unternehmen engagiert. Wie sich im Modellvorhaben<br />
gezeigt hat, sind die Maschinenringe<br />
wichtige Akteure, wenn es darum geht, Aktivitäten<br />
zu Nachhaltigem <strong>Wirtschaft</strong>en, insbesondere<br />
auch der regenerativen Energieversorgung<br />
in ländlich strukturierten Räumen wie der Ver-<br />
33
andsgemeinde Kandel, zu forcieren (vgl.<br />
www.mrsolar.de ).<br />
4.4.4 Verein <strong>für</strong> Gewerbe <strong>und</strong> Handel e.V.<br />
Der frühere Verkehrsverein, heute Verein <strong>für</strong><br />
Gewerbe <strong>und</strong> Handel Kandel e.V., vertritt<br />
die Interessen der lokalen „städtischen“<br />
<strong>Wirtschaft</strong>. Der Kooperation seiner Mitglieder<br />
ist es im wesentlichen zu verdanken,<br />
dass das Modellvorhaben zeitweise erfolgreich<br />
mit dem Stadtmarketingprozess (s.u.)<br />
kooperiert hat.<br />
4.4.5 Stadtmarketingprozess<br />
Stadtmarketing dient dazu die lokale Standortqualität<br />
zu erhöhen <strong>und</strong> damit ein attraktives<br />
Kommunal-Profil zu gewinnen, um sich<br />
im überregionalen <strong>und</strong> internationalen Wettbewerb<br />
langfristig besser behaupten zu<br />
können. Der Stadtmarketingprozess der<br />
Stadt Kandel ist eine wichtige Parallelstruktur<br />
zum Modellvorhaben der Verbandsgemeinde<br />
im Hinblick auf die Standortsicherung,<br />
Belebung der örtlichen <strong>Wirtschaft</strong> <strong>und</strong><br />
der Steigerung der Lebensqualität („Wertschöpfung“)<br />
<strong>für</strong> die Bevölkerung.<br />
Wie der Stadtmarketingbeauftragte in einem<br />
Schreiben vom 4. Juli 2001 (s. Anhang)<br />
selbst ausführte, „ist der dauerhafte Erfolg<br />
des Stadtmarketings nur gesichert, wenn<br />
langfristige Wirkungen getroffener Entscheidungen<br />
beachtet <strong>und</strong> das Prinzip Nachhaltigkeit<br />
berücksichtigt wird“. Die gemeinsame<br />
Befragung von Stadtmarketing <strong>und</strong> Modellvorhaben<br />
ergab, das die lokalen Betriebe<br />
sowohl vom Stadtmarketingprozess als auch<br />
der LA <strong>21</strong> Unterstützung bei der Schaffung<br />
innovativer Partnerschaftsansätze <strong>und</strong> der<br />
Umsetzung von Ressourceneffizienz- <strong>und</strong><br />
Ressourceneinsparungsmaßnahmen erwarten.<br />
Die gemeinsame Betriebsbefragung war<br />
damit ein wichtiger Schritt zur Verzahnung<br />
dieser beiden Prozesse, die beide von der<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Sensibilisierung <strong>und</strong> Aktivierung lokaler Betriebe<br />
<strong>für</strong> zukunftsgerichtete Kooperationen leben.<br />
4.4.6 E-Newsletter „Nachhaltiges <strong>Wirtschaft</strong>en“<br />
Als eine Idee des Arbeitskreises „Nachhaltig<br />
Leben <strong>und</strong> Arbeiten“ geboren <strong>und</strong> von der Beraterfirma<br />
B.A.U.M. umgesetzt wurde ein elektronischer<br />
„E-Newsletter“ entworfen <strong>und</strong> während<br />
einer Arbeitskreissitzung vorgestellt. Aufgr<strong>und</strong><br />
personeller Kapazitätsengpässe vor Ort<br />
sowohl bei den Beteiligten als auch Seitens der<br />
<strong>Agenda</strong>beauftragten wurde das Projekt jedoch<br />
nicht weiter verfolgt.<br />
Zwei Ideen könnten jedoch in Zukunft wieder<br />
aufgegriffen werden: a) einen E-Newsletter<br />
zum Thema Nachhaltiges <strong>Wirtschaft</strong>en als VGübergreifendes<br />
Informationsmedium zu etablieren<br />
<strong>und</strong> b) diese Vorlage aufgreifend evtl. ein<br />
(elektronisches) Informationsblatt des neuen<br />
Fördervereins <strong>für</strong> regenerative Energien in<br />
Kandel („FREK-News“) zu etablieren.<br />
34
4.5 Weiteres Vorgehen<br />
Ende 2002 wurde in der Verbandsgemeinde<br />
Kandel ein Arbeitstreffen zur Reflexion der<br />
Erfahrungen mit dem Modellvorhaben<br />
durchgeführt.<br />
Es wurde deutlich, dass es eine Anzahl an<br />
Betrieben in der Region gibt, die großes<br />
Interesse an einer verstärkten Zusammenarbeit<br />
im Rahmen von nachhaltigkeitsorientierten<br />
Projekten gezeigt haben. Im<br />
weiteren wird es darauf ankommen, den<br />
begonnenen Prozess zu stabilisieren <strong>und</strong><br />
gemeinsam neue Aktivitäten durchzuführen.<br />
Dabei können die in Kap. 3.4 genannten<br />
Strukturen eine wichtige Rolle spielen.<br />
In eine Abschlussbesprechung mit dem<br />
Bürgermeister <strong>und</strong> der <strong>Agenda</strong>beauftragten<br />
wurde festgehalten:<br />
� Die Ergebnisse des Projektes sollen an<br />
geeigneter Stelle publiziert werden<br />
� Der Prozess der Kooperation mit der<br />
<strong>Wirtschaft</strong> soll weitergeführt werden<br />
� Der Internetauftritt der LA <strong>21</strong> in Kandel<br />
soll professionalisiert werden, d.h. die<br />
Ergebnisse der eigenen Aktivitäten sollten<br />
ansprechender aufbereitet werden<br />
<strong>und</strong> insbesondere durch Verknüpfungen<br />
zu anderen Kommunen mit vergleichbaren<br />
Prozessen <strong>und</strong> Aktivitäten angereichert<br />
werden<br />
� Die Verbandsgemeinde Kandel will<br />
erwägen, ob (wie in den anderen Verbandsgemeinden<br />
Kirchen <strong>und</strong> Betzdorf<br />
des Modellvorhabens geschehen), Mittel<br />
<strong>für</strong> Energieberatungen in Betrieben zur<br />
Verfügung gestellt werden können<br />
� Seitens der VG Kandel wird Frau<br />
Wiedrig die Koordinationsfunktion im<br />
Rahmen der <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> beibehalten<br />
� Auch weiterhin sollten in möglichst regelmäßigen<br />
Abständen (z.B. halbjähr-<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
lich) Arbeitskreistreffen des AK Nachhaltiges<br />
<strong>Wirtschaft</strong>en stattfinden, um die bisherigen<br />
Aktivitäten zu bilanzieren, neue Aktivitäten<br />
zu planen<br />
� Es soll überlegt werden, ob die VG bei<br />
bestimmten Anlässen noch stärker gemeinsam<br />
mit der Stadt Kandel <strong>und</strong> dem<br />
dort laufenden Stadtmarketingprozess auftreten<br />
kann (u.a. durch einen gemeinsamen<br />
Briefkopf)<br />
� Um den neuen Verein zur Förderung regenerativer<br />
Energien in Kandel (FREK e.V.)<br />
zu stabilisieren, sollte dieser sich um eine<br />
Vernetzung mit anderen ähnlich ausgerichteten<br />
Vereinen bemühen. Denkbar wäre eine<br />
z.B. grenzüberschreitende Kooperation<br />
mit weiteren Initiativen in der PAMINA-<br />
Region oder mittelfristig eine Teilnahme an<br />
entsprechenden europäischen Netzwerken.<br />
35
5 Erfahrungen aus dem Modellprojekt<br />
In diesem Kapitel werden schlaglichtartig die<br />
wesentlichen Erfolge <strong>und</strong> Herausforderungen,<br />
die sich im Laufe des Modellvorhabens<br />
zeigten, thematisiert. Es werden erste Empfehlungen<br />
formuliert, worauf Kommunen <strong>und</strong><br />
beteiligte Akteure vor Ort besonders achten<br />
müssen, wenn <strong>Wirtschaft</strong>sakteure verstärkt<br />
in den <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong>-Prozess eingeb<strong>und</strong>en<br />
werden sollen.<br />
5.1 Externe Rahmenbedingungen<br />
5.1.1 „Die Mühen der Ebene“<br />
Generell lassen sich b<strong>und</strong>esweit - trotz vieler<br />
sehr engagierter <strong>und</strong> phantasievoller<br />
Beteiligungsprozesse in deutschen Städten<br />
<strong>und</strong> Gemeinden <strong>und</strong> den damit verb<strong>und</strong>enen<br />
innovativen <strong>und</strong> oft wegweisenden Modellprojekten<br />
- deutliche Ermüdungserscheinungen<br />
bei vielen der noch laufenden oder<br />
auch gerade erst begonnenen <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong><br />
<strong>21</strong>-Prozessen feststellen. Eine gewisse<br />
Ratlosigkeit hat sich verbreitet, obwohl<br />
zunehmend die Verwaltungen bei der<br />
Institutionalisierung der Nachhaltigkeit an<br />
Terrain gewinnen. Immer mehr fehlt der<br />
<strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> der allgemeine politische<br />
Rückenwind. Die <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> wird nur<br />
selten vom Reform-Mainstream (Arbeitsmarkt,<br />
Ges<strong>und</strong>heit, Renten, Steuern) zur<br />
Kenntnis genommen. Deren Nichtbeachtung<br />
bei der <strong>Agenda</strong> 2000 ebenso wie bei der<br />
<strong>Agenda</strong> 2010 sorgt deshalb nicht nur<br />
sprachlich <strong>für</strong> größere Irritationen, sowohl<br />
bei <strong>Agenda</strong>-Aktiven als auch bei noch<br />
unbeteiligten Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürgern.<br />
Auch die im Vorfeld der Weltkonferenz <strong>für</strong><br />
Nachhaltige Entwicklung in Johannesburg<br />
2002 erarbeitete nationale<br />
Nachhaltigkeitsstrategie lässt Kommunen<br />
<strong>und</strong> kommunal Engagierte im „luftleeren<br />
Raum“.<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Hier gilt es <strong>für</strong> die Zukunft auch von Seiten der<br />
Kommunen stärker darauf hinzuwirken, dass<br />
nationale Politiken <strong>und</strong> Strategien einerseits<br />
immer auch am Paradigma der Nachhaltigen<br />
Entwicklung gemessen werden, andererseits<br />
dass nationale <strong>und</strong> europäische Nachhaltigkeitsstrategien<br />
(ähnlich wie dies bei der Europäischen<br />
Beschäftigungsstrategie der Fall ist)<br />
in ihrer Bedeutung <strong>für</strong> die lokale Ebene gestärkt<br />
werden.<br />
Oft sind <strong>Agenda</strong>prozesse nicht oder nur sehr<br />
schwach an die Verwaltung <strong>und</strong> Politik angeb<strong>und</strong>en<br />
oder stehen gar im Widerspruch zu<br />
diesen. Ungeklärt sind das Rollenverständnis<br />
<strong>und</strong> die Zielsetzung bei den Beteiligten, insbesondere<br />
das Verhältnis von Ehrenamtlichen zu<br />
Verwaltung <strong>und</strong> Politik. In den meisten <strong>Agenda</strong>prozessen<br />
sind nur wenige Personengruppen<br />
tatsächlich mit eingeb<strong>und</strong>en, weshalb diese<br />
sich oft etwas allein gelassen fühlen. Viele<br />
dieser <strong>Agenda</strong>aktivisten brauchen Unterstützung,<br />
um den zunehmenden Anforderungen an<br />
eine professionalisierte Mitarbeit gerecht werden<br />
zu können, gerade wenn es um rechtliche,<br />
wirtschaftliche oder finanzielle Themen geht.<br />
Wie im zweiten Kapitel erläutert, standen auch<br />
die ausgewählten Modellkommunen vor ähnlichen<br />
Herausforderungen. Entscheidend ist hier<br />
eine Klärung der Rollenverständnisse bei allen<br />
Beteiligten (inkl. externen Beratern).<br />
5.1.2 Globale Trends<br />
Weltweit gibt es derzeit ca. 6500 laufende <strong>Lokale</strong><br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong>-Prozesse, die meisten davon<br />
in Europa, mit den skandinavischen Ländern<br />
als Vorreitern. Dort führen aufgr<strong>und</strong> der nationalen<br />
LA <strong>21</strong>-Kampagnen so gut wie alle Kommunen<br />
einen solchen Prozess durch. 4 In<br />
Deutschland gibt es insgesamt ca. 2.400 <strong>Agenda</strong>-Kommunen.<br />
Das ist eine beachtliche<br />
Zahl <strong>und</strong> fast ein Drittel aller weltweiten LA <strong>21</strong>-<br />
4 Stand 2002, vgl. www.iclei.org<br />
36
Prozesse. Allerdings sind es nur knapp 17%<br />
aller deutschen Kommunen. Darunter fallen<br />
auch jene Kommunen, die ihre LA <strong>21</strong> Bemühungen<br />
bereits wieder eingestellt haben.<br />
Neue Impulse <strong>für</strong> die <strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong> kommen<br />
aus Südafrika. Der dortige Weltgipfel<br />
<strong>für</strong> nachhaltige Entwicklung im Jahre 2002<br />
war die bislang weltweit größte Zusammenkunft<br />
von Politikern <strong>und</strong> NGOs, um über<br />
gangbare Wege in eine nachhaltige Zukunft<br />
zu debattieren. Trotz der wenig präzisen<br />
offiziellen Ergebnisse im Johannesburger<br />
„Programme of Action“ konnte das dort parallel<br />
dazu stattfindende, von ICLEI einberufene<br />
globale Treffen von Vertretern der<br />
kommunalen Ebene neuen Mut machen.<br />
Unter dem Slogan „ <strong>Lokale</strong>s Handeln bewegt<br />
die Welt / Local Action moves the<br />
World“ wurde dazu aufgerufen sich weltweit<br />
<strong>für</strong> eine verstärkte Umsetzung der <strong>Agenda</strong><br />
<strong>21</strong> zu engagieren.<br />
Parallel zum steigenden Engagement <strong>für</strong> die<br />
Umsetzung der <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> in anderen<br />
Weltregionen hat sich seit Mitte der 90er<br />
Jahre aus dem Umfeld des Weltsozialforums<br />
in Porto Allegre eine neue globale<br />
Gegenbewegung herausgebildet, die <strong>für</strong> das<br />
Gemeinwesen (lokal) engagierte Personen<br />
vor allem unter den Jüngeren begeistert <strong>und</strong><br />
von den „etablierteren“ Strukturen der <strong>Lokale</strong>n<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> fernhält. Wichtige Themen<br />
<strong>und</strong> Herausforderungen <strong>für</strong> eine nachhaltige<br />
Entwicklung werden unter diesem Vorzeichen<br />
stärker mit den Stichworten Sicherheit<br />
<strong>und</strong> Frieden, Armutsbekämpfung <strong>und</strong> verantwortlichem<br />
Unternehmertum thematisiert<br />
(vgl. auch Kap. 6.3.2).<br />
5.2 <strong>Lokale</strong> Herausforderungen im Modellvorhaben<br />
An dieser Stelle sollen die Herausforderungen<br />
vor Ort - in gewisser Weise sind dies die<br />
lokalen Rahmenbedingungen - näher betrachtet<br />
werden, die den Lauf des Modell-<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
vorhabens wesentlich beeinflusst haben <strong>und</strong><br />
die auch <strong>für</strong> andere Kommunen in Rheinland-<br />
Pfalz übertragbar sind. Der Fokus liegt bei all<br />
diesen Betrachtungen auf der Frage nach der<br />
„gelungenen“ Einbindungen der lokalen <strong>Wirtschaft</strong>.<br />
Im wesentlichen handelt es sich dabei um drei<br />
Kernbereiche des Prozessmanagements:<br />
� Stakeholdermanagement<br />
� Konfliktmanagement<br />
� Kooperation mit der <strong>Wirtschaft</strong>.<br />
5.2.1 Stakeholdermanagement<br />
Im Rahmen des Modellvorhabens hat sich in<br />
beiden Verbandsgemeinden deutlich gezeigt,<br />
dass es von herausragender Bedeutung ist<br />
frühzeitig mit allen Beteiligten die jeweiligen<br />
Aufgaben <strong>und</strong> Verantwortlichkeiten abzustimmen<br />
<strong>und</strong> darüber eine Vereinbarung zu treffen,<br />
die allen Beteiligten als Orientierung dient. Auf<br />
diese Weise können vorhandene Ressourcen<br />
optimal eingesetzt werden <strong>und</strong> es werden unnötige<br />
Frustrationserlebnisse vermieden.<br />
Das gleiche gilt im Übrigen auch bei einer Gesamtschau<br />
der in den beiden Verbandsgemeinden<br />
laufenden <strong>Agenda</strong>prozesse. Auch dort<br />
gilt es <strong>für</strong> die Zukunft zu klaren Vereinbarungen<br />
über die Zielsetzungen des Prozesses (Leitbildentwicklung,<br />
Indikatoren, Evaluation, Berichterstattung)<br />
allgemein sowie über die damit<br />
verb<strong>und</strong>enen Rollen der Verwaltung, der Politik,<br />
der <strong>Wirtschaft</strong>, der bürgerschaftlich<br />
Engagierten <strong>und</strong> der Berater zu kommen.<br />
Hier<strong>für</strong> würde sich ggf. eine gesonderte<br />
Organisationsuntersuchung der gesamten<br />
<strong>Agenda</strong>prozesse in den beteiligten Verbandsgemeinden<br />
eignen, ähnlich der in Bayern von<br />
der dortigen <strong>Agenda</strong>zentrale „KommA<strong>21</strong>“<br />
geförderten Organisationsuntersuchung<br />
(weitere Informationen dazu sind erhältlich<br />
unter http://www.bayern.de/lfu/komma<strong>21</strong>/ ).<br />
37
Im folgenden werden, ohne Anspruch auf<br />
Vollständigkeit, einige wesentliche Merkposten<br />
<strong>und</strong> Vorschläge <strong>für</strong> die (zukünftige) Rollenverteilung<br />
zwischen Verwaltung, Politik,<br />
<strong>Wirtschaft</strong>, Ehrenamtlichen <strong>und</strong> externen<br />
Beratern ausgeführt.<br />
5.2.1.1 Rolle der Verwaltung<br />
Den Kommunen kommt eine Schlüsselposition<br />
zu, um Unternehmen <strong>und</strong> andere Interessengruppen<br />
zusammenzuführen <strong>und</strong><br />
einen konstruktiven Dialog zwischen den<br />
Akteuren mit dem Ziel einer wirtschaftlich<br />
nachhaltigen Entwicklung auf lokaler <strong>und</strong><br />
regionaler Ebene zu ermöglichen. Die Kultur<br />
der Partnerschaft <strong>und</strong> des Dialogs mit der<br />
<strong>Wirtschaft</strong>, wie sie durch einen LA <strong>21</strong>- Prozess<br />
gefördert wird, kann wesentlich effektiver<br />
<strong>für</strong> die Umgestaltung der <strong>Wirtschaft</strong> vor<br />
Ort sein als der Einsatz ordnungspolitischer<br />
Maßnahmen (Gesetze <strong>und</strong> Verordnungen).<br />
<strong>Agenda</strong> muss Chefsache sein <strong>und</strong> bleiben!<br />
Dies bedeutet, dass der oder die BürgermeisterIn<br />
eine aktive Rolle bei Schlüsselveranstaltungen<br />
<strong>und</strong> bei der<br />
Kontaktaufnahme mit wirtschaftlichen Entscheidungsträgern<br />
spielen muss.<br />
Für die Stabilisierung des <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong><br />
<strong>21</strong> Prozesses ist es auch von entscheidender<br />
Bedeutung diesem innerhalb der Verwaltung<br />
eine prominente Rolle zuzuweisen.<br />
Innerhalb der Verwaltung sollte die LA <strong>21</strong>-<br />
Koordinationsstelle (z.B. als Stabsstelle)<br />
deshalb so institutionell verankert werden,<br />
dass sie dieser Aufgabe <strong>und</strong> Bedeutung<br />
gerecht werden kann.<br />
Zu den Hauptaufgaben der <strong>Agenda</strong>koordinationsstelle<br />
(oder des <strong>Agenda</strong>büros),ob<br />
innerhalb der Verwaltung angesiedelt oder<br />
extern beauftragt, gehört die Information <strong>und</strong><br />
Mobilisierung der lokalen Akteure/Stakeholder,<br />
Koordination <strong>und</strong> Steuerung<br />
des Stakeholderinputs, Prozessbegleitung<br />
(d.h. Vermittlung von Umsetzungs-Know-<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
How) sowie das Monitoring <strong>und</strong> die Evaluation<br />
der Umsetzungsergebnisse.<br />
Empfehlungen:<br />
Die Aufgaben der Koordination, Steuerung <strong>und</strong><br />
Umsetzung von <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong>-Prozessen bedarf,<br />
je strategischer sie von kommunaler Seite angegangen<br />
wird, immer mehr der Professionalisierung<br />
der beteiligten Akteure. Die Verwaltung<br />
sollte deshalb auch intern <strong>für</strong> entsprechende<br />
Qualifizierungen der davon betroffenen Mitarbeiterinnen<br />
<strong>und</strong> Mitarbeiter (z.B. <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong>,<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sförderung, Stadt-<br />
/Regionalentwicklung) sorgen.<br />
Es zeigt sich immer wieder, dass sich von der<br />
Erfahrungen anderer Vieles lernen lässt. <strong>Agenda</strong><br />
<strong>21</strong>-KoordinatorInnen sollten deshalb eng mit<br />
regionalen LA <strong>21</strong>-Koordinationsstellen <strong>und</strong><br />
fachlichen Beratungseinrichtungen zusammenarbeiten<br />
<strong>und</strong> den Erfahrungsaustausch mit<br />
anderen Kommunen suchen <strong>und</strong> nutzen.<br />
5.2.1.2 <strong>Wirtschaft</strong>sakteure<br />
Es ist selbstverständlich, dass die <strong>Wirtschaft</strong><br />
entscheidend ist <strong>für</strong> die ökonomische Entwicklung<br />
<strong>und</strong> Beschäftigung. Sie transformiert natürliche<br />
Ressourcen in Güter <strong>und</strong> Dienstleistungen,<br />
die im besten Falle immer auch die<br />
Lebensqualität erhöhen <strong>und</strong> Nutzen schaffen.<br />
Die <strong>Wirtschaft</strong> beschäftigt Menschen, die diese<br />
Produkte herstellen <strong>und</strong> damit Einkommen<br />
verdienen. Um eine nachhaltige Entwicklung zu<br />
erreichen, müssen die Art <strong>und</strong> Weise der Nutzung<br />
<strong>und</strong> Sicherung von natürlichen Ressourcen<br />
<strong>und</strong> des Humankapitals verändert werden.<br />
Ohne die <strong>Wirtschaft</strong> an Bord geht das nicht.<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sakteure vor Ort können Projekte im<br />
Rahmen der <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> auf eine stabile<br />
wirtschaftliche Basis stellen, indem sie sie<br />
durch eine Anschubsfinanzierung oder mit<br />
ihren Managementkompetenzen unterstützen.<br />
Vertreter aus der <strong>Wirtschaft</strong> können mit ihrer<br />
wertvollen Erfahrung helfen, Projekte so zu<br />
38
managen, dass diese langfristig selbsttragend<br />
werden.<br />
Klein- <strong>und</strong> mittelständischen Unternehmen<br />
(KMU) fehlen oft die materiellen Ressourcen,<br />
Informationen <strong>und</strong> Personalkapazitäten,<br />
die <strong>für</strong> eine nachhaltige <strong>Wirtschaft</strong>sweise<br />
erforderlich sind. Die <strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong><br />
bietet <strong>für</strong> sie den Rahmen, um an einer<br />
abgestimmten lokalen Initiative teilzunehmen,<br />
in der die Kommunalverwaltung als<br />
Koordinator eine professionelle Prozessleitung<br />
organisiert <strong>und</strong> ggf. auch Zugang zu<br />
technischer Unterstützung vermittelt.<br />
Empfehlung:<br />
Generell gilt es zu beachten, lokale Kammern<br />
<strong>und</strong> Verbände frühzeitig <strong>für</strong> entsprechende<br />
Vorhaben zu gewinnen, in die Entwicklung<br />
der endgültigen Projektkonzeption<br />
mit einzubeziehen <strong>und</strong> zur Übernahme einer<br />
verantwortlichen Rolle zu motivieren.<br />
<strong>Lokale</strong> Betriebe brauchen eine konkrete<br />
Ansprache sowie befristete <strong>und</strong> klar definierte<br />
Angebote zur Beteiligung. Dabei ist es<br />
sehr wichtig den Nutzen <strong>für</strong> die einzelnen<br />
Beteiligten deutlich herauszustellen <strong>und</strong><br />
auch den gemeinsamen Nutzen (d.h. die<br />
Synergieeffekte einer Kooperation) in Form<br />
von neuen strategischen Partnerschaften /<br />
Netzwerken / Clustern (gerade im ländlichen<br />
Raum) zu thematisieren.<br />
Schließlich sollte, wenn möglich, die Abstimmung<br />
mit weiteren laufenden lokalen<br />
Prozessen zur Förderung der lokalen/regionalen<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sentwicklung (z.B.<br />
Stadtmarketing / Regionalmarketing) gesucht<br />
<strong>und</strong> ausgebaut werden.<br />
5.2.1.3 Bürgerschaft<br />
Die ehrenamtlich Engagierten sind eine<br />
tragende Säule in allen <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong>-<br />
Prozessen. Auch bei Projekten in Zusam-<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
menarbeit mit der <strong>Wirtschaft</strong> spielen diese eine<br />
wesentliche Rolle. Sie bringen ihre Ideen <strong>und</strong><br />
Tatkraft ein, um Maßnahmen zur Sicherung der<br />
Zukunft voranzubringen. Auch Vertreter von<br />
Betrieben wissen dies zu schätzen <strong>und</strong> wollen,<br />
wenn sie nach Feierabend im Sinne des Gemeinwohls<br />
aktiv werden, von den vielen unterschiedlichen<br />
Erfahrungen <strong>und</strong> Lebenswelten<br />
der LA <strong>21</strong>-Akteure profitieren. Gerade im zukunftsorientierten<br />
Austausch der Ideen <strong>und</strong><br />
Vorstellungen von Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürgern mit<br />
der <strong>Wirtschaft</strong> liegt ein großes Innovationspotenzial,<br />
das alle Beteiligten zu schätzen wissen.<br />
Empfehlungen:<br />
Wichtig ist darauf zu achten, dass ehrenamtliche<br />
<strong>Agenda</strong>-Aktive sich auf gewisse Spielregeln<br />
mit der <strong>Wirtschaft</strong> einlassen. Dazu gehören<br />
Ansprüche an die Dauer <strong>und</strong> Effizienz von<br />
Arbeitstreffen sowie Aspekte der Vertraulichkeit<br />
von Geschäftsinformationen<br />
5.2.1.4 Externe Berater<br />
Externe Berater motivieren, liefern Anregungen,<br />
unterstützen <strong>und</strong> begleiten (“coachen“)<br />
zentrale Akteure, damit diese Ihre Aufgaben<br />
professionell bewältigen können. D.h. sie unterstützen<br />
lokale Akteure in der Verwaltung bei<br />
der Koordination <strong>und</strong> Steuerung des Prozesses<br />
<strong>und</strong> sie machen den lokalen Akteuren Mut <strong>für</strong><br />
die Umsetzung ihrer oft innovativen wenn nicht<br />
sogar visionären Ideen. Ggf. springen sie auch<br />
als unbeteiligte Dritte ein, wenn Konflikte moderiert<br />
werden müssen. Im Sinne einer Stabilisierung<br />
der lokalen Prozesse ist es jedoch nicht<br />
sinnvoll oder gar ihre Aufgabe, die Rolle der<br />
zentralen Akteure vor Ort auszufüllen, wenn es<br />
z.B. darum geht den Kontakt zu bestimmten<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sakteuren herzustellen oder zu pflegen.<br />
39
Empfehlungen:<br />
Um aus extern unterstützten Modellvorhaben<br />
den größtmöglichen Nutzen ziehen zu<br />
können, ist es wichtig, dass sich die Akteure<br />
vor Ort (in der Verwaltung, Betriebe, Vereine<br />
<strong>und</strong> BürgerInnen) auf die eigenen Kompetenzen<br />
<strong>und</strong> Kräfte (Wachsen aus der Region)<br />
besinnen.<br />
Die Einbeziehung von externem Sachverstand<br />
(z.B. zur Klärung von Fachfragen, oder<br />
auch zur Moderation schwieriger Prozesse)<br />
sollte möglichst zielgerichtet erfolgen.<br />
Ziele, Erwartungen <strong>und</strong> Aufgaben sollten<br />
möglichst frühzeitig gemeinsam mit den<br />
Beratern definiert <strong>und</strong> in eine klare Rollen<strong>und</strong><br />
Aufgabenverteilung überführt werden.<br />
Damit sich die Distanz nicht hinderlich auf<br />
die Kommunikation zwischen den vor Ort<br />
Beteiligten <strong>und</strong> den Beratern auswirkt, gilt es<br />
von beiden Seiten in regelmäßigen Abständen<br />
den Kontakt zu suchen, um so „Durchhänger“<br />
auf beiden Seiten zu vermeiden.<br />
5.2.2 Konfliktmanagement / Politische<br />
Unwägbarkeiten<br />
In allen beteiligten Modellkommunen hat es<br />
wie fast überall zeitweilig politische Hemmnisse<br />
gegeben. Diese basierten zum Teil auf<br />
veränderten politischen Mehrheiten nach<br />
einer Wahl, zum Teil waren sie in den parteipolitisch<br />
divergierenden Mehrheiten in der<br />
Verbandsgemeinde <strong>und</strong> Ortgemeindestrukturen<br />
zu suchen. Für eine Aktivierung <strong>und</strong><br />
Beteiligung der lokalen/regionalen Unternehmerschaft<br />
erweisen sich derartige Konstellationen<br />
als problematisch.<br />
Empfehlungen:<br />
Unterschiedliche Ziel- <strong>und</strong> Prioritätensetzungen<br />
stellen eine stete Herausforderung<br />
<strong>und</strong> Bereicherung bei der Lösungssuche in<br />
<strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong>-Prozessen dar. Für den<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Erfolg eines solchen Projektes ist es deshalb<br />
unerlässlich, dass alle beteiligten Akteure konstruktiv<br />
zusammenarbeiten. Auftretende verwaltungsinterne<br />
sowie politische Differenzen<br />
(etwa zwischen verschiedenen Verwaltungsebenen<br />
oder bei der Einbeziehung der <strong>Wirtschaft</strong>sförderung<br />
in die Projektleitung) sollten<br />
frühzeitig angesprochen <strong>und</strong> geklärt werden..<br />
In möglichst regelmäßigen Abständen sollten<br />
deshalb von externen Beratern moderierte gemeinsame<br />
strategische Besprechungen zwischen<br />
Koordinatoren <strong>und</strong> Entscheidungsträgern<br />
vor Ort stattfinden.<br />
Möglichst frühzeitig sollten den Entscheidungsträgern<br />
in Politik, Verwaltung <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong><br />
auch gemeinsame Perspektiven (z.B. Nachhaltiges<br />
Stadtmarketing, nachhaltige Regionalvermarktung)<br />
aufgezeigt werden bzw. evtl. vom<br />
Land eine Finanzierung <strong>für</strong> unterstützte integrierende<br />
Beteiligungsprozesse (Zukunftskonferenzen,<br />
<strong>Lokale</strong> Aktionsplanung <strong>für</strong> Beschäftigung)<br />
in Aussicht gestellt werden .<br />
5.2.3 Kooperation mit der <strong>Wirtschaft</strong><br />
Während einerseits Unternehmen weltweit<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong>-Aktivitäten <strong>für</strong> sich entwickelt haben<br />
<strong>und</strong> andererseits Gemeinden <strong>und</strong> Städte Arbeitsbeziehungen<br />
zu ortsansässigen Betrieben<br />
aufgebaut haben, gibt es bisher nur sehr wenige<br />
Beispiele <strong>für</strong> eine erfolgreiche Integration<br />
von <strong>Wirtschaft</strong>sunternehmen in beteiligungsorientierte<br />
Planungs- <strong>und</strong> Entwicklungsprozesse<br />
wie etwa die LA <strong>21</strong>.<br />
5.2.3.1 Einbindung der lokalen <strong>Wirtschaft</strong>sakteure<br />
Das übergeordnete Projektziel des Modellvorhabens<br />
lautete Kooperation <strong>und</strong> Einbindung<br />
der <strong>Wirtschaft</strong> in Innovationsprozesse <strong>und</strong><br />
Schaffung von Win-Win Situationen. In den<br />
Erwartungen der Verbandsgemeinden sollten<br />
dabei nicht nur dauerhafte Kooperationen zwi-<br />
40
schen den Beteiligten geschaffen werden,<br />
sondern vielmehr auch konkrete Projekte<br />
angegangen <strong>und</strong> umgesetzt werden, die <strong>für</strong><br />
alle Beteiligten einen Nutzen erzielen.<br />
Dieser Erwartung konnte in den beteiligten<br />
Verbandsgemeinden entsprochen werden.<br />
So konnten in Kandel einige neue Unternehmen<br />
<strong>für</strong> konkrete Maßnahmen gewonnen<br />
werden (z.B. Pfalzwerke AG). Kontakte<br />
zum lokalen Stadtmarketingprozess wurden<br />
zeitweilig intensiviert <strong>und</strong> die Zusammenarbeit<br />
mit der Forstverwaltung konnte intensiviert<br />
werden. In Kirchen/Betzdorf hat sich<br />
die IHK Koblenz – Niederlassung Betzdorf<br />
regelmäßig in die Veranstaltungen eingebracht.<br />
In keiner der Verbandsgemeinden ist<br />
es allerdings gelungen die lokale oder regionale<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sförderung in das Vorhaben<br />
stärker einzubinden.<br />
Das Instrument der Betriebsbefragung ist<br />
auch im Rahmen der <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong><br />
geeignet um eine Situationsanalyse durchzuführen<br />
<strong>und</strong> Betriebe <strong>für</strong> neue Themen zu<br />
sensibilisieren <strong>und</strong> zu mobilisieren. Die<br />
Befragungen in den beiden<br />
Modellkommunen haben sich gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
bewährt, hätten jedoch vermutlich bei einer<br />
klareren Zieldefinition <strong>und</strong> intensiveren<br />
Nachverfolgung eine noch größere Wirkung<br />
erzielen können.<br />
Empfehlung:<br />
Bereits im Vorfeld eines Prozesses zur<br />
Einbindung der <strong>Lokale</strong>n <strong>Wirtschaft</strong> sollten<br />
die entscheidenden lokalen <strong>und</strong> regionalen<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sakteure angesprochen werden<br />
<strong>und</strong> wenn möglich an der endgültigen Projektkonzeption<br />
beteiligt werden. Vorhandene<br />
Interessenkonflikte sollten bereits hier angesprochen<br />
<strong>und</strong> entsprechende Arrangements<br />
getroffen werden.<br />
Bei der Ansprache der lokalen <strong>Wirtschaft</strong><br />
sollte deutlich werden, dass wesentliche<br />
kommunale <strong>und</strong> evtl. überregionale Akteure<br />
„<strong>für</strong> die <strong>Wirtschaft</strong>“ an einem Strang ziehen<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
(z.B. durch Einladungen mit einem gemeinsamen<br />
Briefkopf).<br />
Betriebsbefragungen sind in der Regel recht<br />
arbeitsintensiv. Deshalb sollte darauf geachtet<br />
werden, diese inhaltlich nicht zu überfrachten<br />
<strong>und</strong> möglichst stringent bei den Betrieben<br />
nachzuverfolgen. In jedem Fall sollten diese<br />
auch durch eine gezielte, frühzeitige persönliche<br />
Kontaktaufnahme mit wichtigen lokalen<br />
<strong>Wirtschaft</strong>svertretern ergänzt werden.<br />
Vertreter der <strong>Wirtschaft</strong> profitieren von heterogenen<br />
Arbeitsgruppen, in denen meist ein innovativeres<br />
Arbeitsklima herrscht. Sie können<br />
dadurch oft Potenziale erschließen, die Ihnen<br />
ansonsten nicht leicht zugänglich sind (z.B.<br />
Know-how, Legitimation, Partner). Zu starke<br />
Wettbewerbssituationen (innerhalb einer Branche)<br />
können innovative Potenziale auch hemmen.<br />
Es sollte deshalb jeweils nach Bedarf <strong>und</strong><br />
Interesse entschieden werden, ob der Kreis der<br />
Beteiligten einen eher vertraulichen Charakter<br />
behalten <strong>und</strong> auf <strong>Wirtschaft</strong>sakteure beschränkt<br />
bleiben soll, oder ob er <strong>für</strong> eine Zusammenarbeit<br />
mit den bürgerschaftlichen Akteuren<br />
der <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> geöffnet werden<br />
soll (wie es sich bei Projekten zur Förderung<br />
von Zukunftstechnologien der Energieerzeugung<br />
anbietet).<br />
5.2.3.2 Gute Beispiele / Erfolge motivieren<br />
Auch in diesem Modellvorhaben wurde im Hinblick<br />
auf die Kooperation mit <strong>Wirtschaft</strong>sakteuren<br />
betont, dass schnelle Erfolge wichtig sind,<br />
um möglichst viele Betriebe zum Mitmachen<br />
anzuregen <strong>und</strong> die Interessierten nicht gleich<br />
wieder zu verlieren. Dazu werden inspirierende<br />
Gute Beispiele benötigt. Diese helfen die<br />
Machbarkeit innovativer Ideen sowie unterschiedlicher<br />
Umsetzungsvarianten darzustellen<br />
<strong>und</strong> regen an, eigene Ideen zu entwickeln. Sie<br />
dienen als Orientierungshilfe oder „Visionsinstrument“<br />
<strong>und</strong> regen eigene Lernprozesse vor<br />
Ort an.<br />
41
Nachhaltigkeitsorientierte gute Beispiele<br />
sollten klare Ziele verfolgen, sich um einen<br />
Ausgleich wirtschaftlicher, sozialer <strong>und</strong> ökologischer<br />
Interessen bemühen, die Partizipation<br />
von verschiedenen interessierten Akteuren<br />
vor Ort ermöglichen, sich <strong>für</strong> die Situation<br />
vor Ort eignen <strong>und</strong> mittels Partnerschaften<br />
umgesetzt werden, um auch bisher ungenutzte<br />
Ressourcen zu erschließen.<br />
In den Verbandsgemeinden Kirchen <strong>und</strong><br />
Betzdorf ist es gelungen, die Vertreter der<br />
<strong>Wirtschaft</strong> <strong>für</strong> bewährte Maßnahmen zur<br />
Förderung von betrieblichen Umweltmaßnahmen<br />
zu gewinnen. Die in Kirchen <strong>und</strong><br />
Betzdorf durchgeführte kostenlose Energieberatung<br />
basierte auf einem<br />
Beratungsangebot der Transferstelle Bingen<br />
<strong>und</strong> ähnelt in der Idee dem Guten Beispiel<br />
ÖKOPROFIT. Damit war ein schneller Projekterfolg<br />
vorprogrammiert, der weitere Unternehmen<br />
<strong>für</strong> das Projekt interessiert <strong>und</strong><br />
neue gemeinsame Aktivitäten ermöglicht<br />
hat.<br />
ÖKOPROFIT - b<strong>und</strong>esweit r<strong>und</strong><br />
50 Projekte mit mehr als 750 Unternehmen<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
ÖKOPROFIT - Mit Umweltschutz Gewinne<br />
erzielen<br />
ÖKOPROFIT ist ein einjähriges Programm zur<br />
Beratung von Betrieben über Maßnahmen zur<br />
Umweltverbesserung. Die Kommunalverwaltung<br />
koordiniert den Prozess; die ausgewählten Betriebe<br />
werden von Experten sowohl einzeln <strong>und</strong><br />
direkt beraten, als auch gemeinsam mit anderen<br />
teilnehmenden Betrieben geschult. Ergebnisse<br />
sind signifikante Verbesserungen der betrieblichen<br />
Umweltleistung, die zu geringerer Umweltverschmutzung<br />
bei gleichzeitiger Kosteneinsparung<br />
<strong>und</strong> häufig verbesserten Arbeitsbedingungen<br />
führen. ÖKOPROFIT wurde in Österreich entwickelt<br />
<strong>und</strong> wird ebenfalls erfolgreich in Deutschland,<br />
Italien, Slowakei, Slowenien <strong>und</strong> China<br />
umgesetzt. In Mainz ergab beispielsweise die<br />
erste Ökoprofit-R<strong>und</strong>e 2001 eine Umweltentlastung<br />
von umgerechnet knapp 500.000 € bezogen<br />
auf 18 teilnehmende Betriebe. Dadurch konnte die<br />
Umweltqualität der gesamten Stadt erheblich<br />
verbessert werden. Das entspricht einem verminderten<br />
CO2-Ausstoß von 1,7 Mill. kg.<br />
Weitere Informationen finden Sie dazu unter:<br />
www.arqum.de oder www.baumgroup.de<br />
In der <strong>Agenda</strong> von Kandel wurden die anfangs<br />
präsentierten Guten Beispiele zur Entwicklung<br />
eigener Projektideen <strong>und</strong> Vorhaben genutzt.<br />
Nicht zu erfüllen waren damit allerdings die<br />
hohen Erwartungen der lokalen <strong>Wirtschaft</strong>sakteure,<br />
weitere genau <strong>für</strong> ihre Ideen <strong>und</strong> auf die<br />
lokale Situation zugeschnittene Vorbildprojekte<br />
zu identifizieren <strong>und</strong> aufzubereiten.<br />
Empfehlungen:<br />
Gute Beispiele <strong>für</strong> Nachhaltiges <strong>Wirtschaft</strong>en<br />
sollten an Themenfeldern ansetzen, die <strong>für</strong><br />
Unternehmen <strong>und</strong> Betriebe unmittelbare Relevanz<br />
besitzen (z.B. Kosten, Ressourcen, Qualifizierung)<br />
<strong>und</strong> deren Nutzen <strong>für</strong> die beteiligten<br />
Betriebe klar herausstellen.<br />
42
Zur Darstellung von Guten Beispielen sollten<br />
nach Möglichkeit öffentlichkeitswirksame<br />
größere Events organisiert werden. Zur<br />
Erhöhung der Akzeptanz sollte bei den vorzustellenden<br />
Beispielen wenn möglich auf<br />
Aktivitäten von <strong>Wirtschaft</strong>svertretern vor Ort<br />
zurückgegriffen oder auf diesen aufgesetzt<br />
werden. Ergänzend können überregionale<br />
Know-How-Träger eingeladen werden, um<br />
bei der (Weiter-)Entwicklung eigener Ansätze<br />
<strong>und</strong> Ideen mitzuwirken oder auch andere<br />
Beispiele mit einfließen zu lassen.<br />
Wichtig ist, dass sich motivierende Beispiele<br />
an lokalen Problemstellungen orientieren.<br />
Nur wenn tatsächlich auch lokaler<br />
Handlungsdruck besteht, werden sich<br />
Betriebe <strong>und</strong> Unternehmen auch <strong>für</strong> eine<br />
rasche Umsetzung von konkreten Vorhaben<br />
einsetzen.<br />
Um dennoch auch mittel- oder langfristig<br />
orientierte Projekte auf den Weg zu bringen,<br />
ist es wichtig die aufgezeigten Nutzenpotenziale<br />
möglichst durch zusätzliche Motivationsanreize<br />
zu verstärken (evtl. durch Wettbewerbe,<br />
Auszeichnungen etc.).<br />
5.2.3.3 Projektmanagement<br />
Folgende wesentliche Faktoren gilt es beim<br />
Management von Projekten, die die Zusammenarbeit<br />
mit lokalen <strong>Wirtschaft</strong>sakteuren<br />
forcieren wollen, zu berücksichtigen:<br />
Zielorientierung <strong>und</strong> Zeitökonomie, Ambiente<br />
<strong>und</strong> informelle Gelegenheiten.<br />
Empfehlungen:<br />
Zielorientierung <strong>und</strong> Zeitökonomie: Die<br />
Kooperation mit der <strong>Wirtschaft</strong> funktioniert in<br />
der Regel nur dann, wenn auch nach den<br />
Spielregeln der <strong>Wirtschaft</strong> gearbeitet wird.<br />
Dies bedeutet dass klare Übereinkünfte über<br />
die angestrebten Ziele <strong>und</strong> den Weg dorthin<br />
getroffen werden.<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Erforderlich ist deshalb ein professionelles<br />
Projektmanagement, d.h. darauf zu achten, die<br />
„wertvolle“ Zeit der Akteure nicht unnötig zu<br />
beanspruchen. Obwohl dies natürlich auch<br />
generell bei der Arbeit in bürgerschaftlichen<br />
Planungsprozessen zu beachten ist, kommt<br />
dem Aspekt der Zeitökonomie eine besondere<br />
Bedeutung zu, wenn es darum geht Entscheidungsträger<br />
aus der Privatwirtschaft einzubinden.<br />
KoordinatorInnen von <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong>-<br />
Prozessen sollten daher die Anzahl <strong>und</strong> Dauer<br />
von Arbeitstreffen möglichst reduzieren <strong>und</strong><br />
falls erforderlich deren Vorbereitung <strong>und</strong> Leitung<br />
engagierten <strong>Wirtschaft</strong>sakteuren oder<br />
externen Moderations-Profis übertragen.<br />
Angenehmes Ambiente <strong>und</strong> informelle Gelegenheiten:<br />
Ein weiterer, oft unterschätzter Aspekt<br />
<strong>für</strong> die Zusammenarbeit mit <strong>Wirtschaft</strong>sakteuren<br />
ist es, ein entsprechendes Umfeld <strong>für</strong><br />
Arbeitstreffen zu schaffen. Dazu gehört nicht<br />
nur entsprechende „wirtschaftsnahe“ Räumlichkeiten<br />
zu nutzen, sondern auch atmosphärisch<br />
<strong>für</strong> den „gemütlicheren“ Teil bewusst Sorge<br />
zu tragen. Veranstaltungen dieser Art sind<br />
ein Zusatzengagement, das durch eine kleine<br />
Erfrischung <strong>und</strong> ein Stärkungshäppchen belohnt<br />
werden sollte. Außerdem lässt ein kleiner<br />
Imbiss immer auch den nötigen Raum <strong>für</strong> den<br />
informelleren, kreativen Austausch.<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sakteure, die sich <strong>für</strong> die Mitarbeit im<br />
Rahmen der <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> begeistern lassen,<br />
sind der Zusammenarbeit mit ehrenamtlich-engagierten<br />
Bürgern gegenüber durchaus<br />
aufgeschlossen. Meistens betrachten sie eine<br />
heterogene Arbeitsgruppe als willkommene, ja<br />
oft sogar als wirtschaftlich inspirierende Abwechslung<br />
zum Tagesgeschäft.<br />
5.2.4 Regionalisierung der Nachhaltigkeit<br />
In Rheinland-Pfalz liegen im Unterschied zu<br />
den Verwaltungsstrukturen anderer B<strong>und</strong>esländer<br />
viele Kompetenzen der kommunalen<br />
Selbstverwaltung bei den Ortsgemeinden. Die-<br />
43
se sind jedoch oft viel zu klein, als dass dort<br />
formalisierte <strong>Agenda</strong>prozesse stattfinden<br />
könnten. Mehrere Ortsgemeinden (zwischen<br />
zwei <strong>und</strong> 50) bilden eine Verbandsgemeinde.<br />
Auf dieser Verwaltungsebene sind die<br />
Zuständigkeiten <strong>für</strong> Bauleitplanung, Schulen,<br />
Wasser- <strong>und</strong> Abwasserversorgung u.a.<br />
angesiedelt. Auf dieser Ebene finden sinnvoller<br />
Weise formalisierte <strong>Agenda</strong>prozesse<br />
statt, die ohnehin aufgr<strong>und</strong> des engen direkten<br />
Kontaktes mit den Ortsgemeinden in<br />
diese hinein wirken.<br />
Die Verbandsgemeinden können in ihrer<br />
Vorbildsfunktion gerade auch <strong>für</strong> die lokalen<br />
Betriebe deutliche Impulse <strong>für</strong> nachhaltiges<br />
<strong>Wirtschaft</strong>en setzen. Dazu gehören Maßnahmen<br />
zur rationellen <strong>und</strong> umweltschonenden<br />
Energie- <strong>und</strong> Ressourcennutzung<br />
(z.B. Solardächer auf eigenen Gebäuden,<br />
auf Pflanzentreibstoff umgestellte Fahrzeuge<br />
etc.), sozial- <strong>und</strong> ökologisch verantwortliche<br />
Beschaffungspraktiken (z.B. keine Produkte<br />
aus Kinderarbeit) sowie innovative<br />
Maßnahmen zur Gestaltung der Arbeitsbeziehungen<br />
in der Verwaltung (Flexibilisierung<br />
der Arbeitzeiten zur Vereinbarkeit von<br />
Familie <strong>und</strong> Beruf etc.).<br />
Allerdings können nicht alle Bereiche der LA<br />
<strong>21</strong>-Arbeit sinnvoll auf der Ebene der Verbandsgemeinden<br />
angegangen werden.<br />
Gerade bei der Förderung einer nachhaltigen<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sentwicklung stoßen die lokale<br />
Akteure immer wieder an entsprechende<br />
Grenzen. Bei Maßnahmen zur Schließung<br />
von Stoffkreisläufen stellt sich beispielsweise<br />
immer wieder heraus, dass die ideale<br />
geografisch bestimmbare Interventionseinheit<br />
nicht mit lokalen Verwaltungsgrenzen<br />
übereinstimmt. Dazu kommt, dass bestimmtes<br />
Know-How, das <strong>für</strong> derartige Innovationen<br />
mobilisiert werden muss (z.B. wissenschaftliche<br />
Expertise) lokal oft nicht verfügbar<br />
ist.<br />
Verbandsgemeinden haben oft nur begrenzt<br />
Einfluss <strong>und</strong> Zugang zur lokalen <strong>Wirtschaft</strong>,<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
weil in wichtigen Ortsgemeinden konkurrierende<br />
oder parallel laufende Prozesse stattfinden.<br />
Der Ansatz der Regionalisierung der Nachhaltigkeit<br />
bietet hier auch <strong>für</strong> die Aktivierung <strong>und</strong><br />
Einbeziehung der <strong>Wirtschaft</strong> einige Potentiale:<br />
� Regionale Ansätze stärken <strong>und</strong> erschließen<br />
die endogenen Potenziale (Humanressourcen,<br />
Wissen etc.) <strong>für</strong> Entwicklungs- <strong>und</strong><br />
Anpassungsprozesse, die mit der zunehmenden<br />
globalen Verflechtung der <strong>Wirtschaft</strong><br />
erforderlich werden.<br />
� Bestimmte Themen können regional besser<br />
angegangen werden, z.B. Verkehr oder<br />
Ressourcenvernetzung, da administrative<br />
Zuständigkeiten hier meist nur behindern<br />
<strong>und</strong> lokale Akteure oft überfordert sind.<br />
� Oft sind mittlere <strong>und</strong> größere Unternehmen<br />
nicht lokal sondern eher überregional oder<br />
gar international aufgestellt, was einen erheblichen<br />
Einfluss auf die Wahrnehmung<br />
ihres Engagements <strong>für</strong> den jeweiligen<br />
Standort („territoriale Verantwortlichkeit“)<br />
<strong>und</strong> damit <strong>für</strong> die <strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> hat.<br />
� Regionale Ansätze ermöglichen es über<br />
internationale Kooperationen auch zusätzliche<br />
Finanzierungsquellen seitens des B<strong>und</strong>es,<br />
der Länder oder der EU zu erschließen.<br />
Um die Potenziale einer regionalen Vernetzung<br />
im Hinblick auf eine nachhaltige wirtschaftliche<br />
Entwicklung zu erschließen, müssen allerdings<br />
zunächst einmal wesentliche lokale Akteure<br />
zusammengeführt werden. Dabei kommt es<br />
auch darauf an, bei den richtigen Themen anzusetzen.<br />
44
6 Fazit <strong>und</strong> Ausblicke<br />
6.1 Die richtigen Themenfelder<br />
Aktivitäten zur Einbindung der lokalen <strong>Wirtschaft</strong><br />
in den Prozess der <strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong><br />
sind auf die vor Ort Handelnden angewiesen.<br />
Nur diese können auf Dauer sicherstellen,<br />
dass konkrete Nachhaltigkeits-<br />
Vorhaben realisiert werden. Damit das lokale<br />
Engagement verwirklicht werden kann,<br />
bedarf es allerdings auch geeigneter Strukturen<br />
(Arbeitskreise, R<strong>und</strong>e Tische, Foren<br />
etc.). Beim Aufbau solcher Strukturen können<br />
Pilotprojekte wie das Projekt „<strong>Lokale</strong><br />
<strong>Agenda</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz“<br />
einen wesentlichen Beitrag leisten, indem<br />
sie durch erste realisierte konkrete Projekte<br />
die lokalen <strong>Wirtschaft</strong>sakteure zur Beteiligung<br />
motivieren <strong>und</strong> Erfahrungen aus anderen<br />
Regionen zum Aufbau entsprechender<br />
Strukturen übertragen. Externe Berater können<br />
dabei die Tatkraft der vor Ort Engagierten<br />
nicht ersetzen. Sie können sie aber<br />
durch die prozessbegleitende Beratung<br />
dabei unterstützen die ersten Gr<strong>und</strong>pfeiler<br />
<strong>für</strong> Nachhaltiges <strong>Wirtschaft</strong>en einzuschlagen.<br />
Wichtig ist es dabei frühzeitig die wesentlichen<br />
<strong>für</strong> die <strong>Wirtschaft</strong> interessanten Themenfelder<br />
zu besetzen. Dazu gehören neben<br />
Kostensenken durch Umweltschutz <strong>und</strong><br />
Ressourceneffizienz-Maßnahmen auch die<br />
Themenfelder „Erneuerbare Energien“ <strong>und</strong><br />
„Regionale Kooperationen“.<br />
6.1.1 Kostensenkungspotenziale durch<br />
betrieblichen Umweltschutz<br />
Ein erfolgreiches Beispiel der letzten Zeit ist<br />
ECO+. Hierbei erhielten 80 Unternehmen im<br />
Rahmen einer regionalen Pilotkampagne<br />
des Ministeriums <strong>für</strong> Umwelt <strong>und</strong> Verkehr in<br />
Baden-Württemberg eine kostenlose Beratung.<br />
Dabei wurden Maßnahmen mit einem<br />
Entlastungspotential von r<strong>und</strong> 668.027 €,<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
4.873.828 kWh Energie, 15.138 m³ Frischwasser<br />
<strong>und</strong> 2.310 t CO2 von B.A.U.M. identifiziert.<br />
Ergebnis der Vor-Ort-Analyse <strong>und</strong> Beratung ist<br />
ein Paket mit schnell <strong>und</strong> einfach umsetzbaren,<br />
auf das Unternehmen zugeschnittenen Maßnahmen<br />
zur Kostensenkung. Der besondere<br />
Fokus liegt dabei auf Maßnahmen des betrieblichen<br />
Umweltschutzes - beispielsweise in den<br />
Bereichen Energie, Wasser, Abfall, Roh-, Hilfs<strong>und</strong><br />
Betriebsstoffe. Das Programm verfolgt<br />
zwei Ziele, zum einen die Erschließung von<br />
Kostensenkungspotenzialen in Unternehmen<br />
als wichtiger Beitrag zur Zukunftssicherung <strong>und</strong><br />
zum anderen damit verb<strong>und</strong>en eine Reduzierung<br />
von Umweltbelastungen. Kooperationspartner<br />
des Ministeriums sind die Industrie- <strong>und</strong><br />
Handelskammer Südlicher Oberrhein, die<br />
Handwerkskammer Freiburg <strong>und</strong> der B<strong>und</strong>esdeutsche<br />
Arbeitskreis <strong>für</strong> umweltbewusstes<br />
Management (B.A.U.M. e. V.) - Europas größte<br />
Umweltinitiative der <strong>Wirtschaft</strong>.<br />
45
6.1.2 Erneuerbare Energien<br />
Die begrenzten Vorkommen fossiler Energien<br />
<strong>und</strong> emissionsbedingte Klimaveränderungen<br />
schüren das weltweite Interesse an<br />
einer Energiewende. Erneuerbare Energien<br />
(EE) gewinnen darum zunehmend an Bedeutung<br />
<strong>für</strong> die Energieversorgung.<br />
Die politischen Rahmenbedingungen in<br />
Deutschland bieten auch <strong>für</strong> die nächsten<br />
Jahre günstige Perspektiven <strong>für</strong> ein weiteres<br />
Wachstum. Von den Fördermaßnahmen<br />
profitieren dabei sowohl die Nutzer<br />
erneuerbarer Energien als auch<br />
Unternehmen, die sich attraktive Märkte<br />
erschließen können.<br />
Das Erneuerbare Energien Gesetz hatte in<br />
den vergangenen Jahren einen deutlichen<br />
Anstieg der Nutzung erneuerbarer Energien<br />
zur Stromerzeugung bewirkt. Der Anteil der<br />
erneuerbaren Energien am Stromverbrauch<br />
konnte von 4,6 Prozent im Jahr 1998 auf<br />
r<strong>und</strong> 8 Prozent in diesem Jahr gesteigert<br />
werden. Damit werden heute durch die erneuerbaren<br />
Energien r<strong>und</strong> 50 Millionen<br />
Tonnen Kohlendioxidemissionen vermieden.<br />
Windenergie, aber auch Biomasse, Solarstrahlung,<br />
Wasserkraft <strong>und</strong> Geothermie<br />
wurden <strong>und</strong> werden weiterhin gezielt unterstützt,<br />
wodurch neue Industriezweige entstanden,<br />
deutsche Exportchancen verbessert<br />
sowie bestehende Arbeitsplätze gesichert<br />
<strong>und</strong> neue Stellen geschaffen werden<br />
konnten. Nach Branchenangaben gibt es im<br />
gesamten Bereich der erneuerbaren Energien<br />
r<strong>und</strong> 135.000 Arbeitsplätze.<br />
Das neue Marktanreizprogramm <strong>für</strong> Erneuerbare<br />
Energie wird diesen Trend noch<br />
bestärken (s. Kasten rechts). Die B<strong>und</strong>esregierung<br />
hat es sich zum Ziel gesetzt, den<br />
Anteil der EE bis 2010 auf mindestens 12,5<br />
Prozent zu erhöhen. Die Novelle des EEG<br />
soll dazu beitragen, dass der Anteil bis 2020<br />
mindestens 20 Prozent erreicht.<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Marktanreizprogramm (MAP)<br />
<strong>für</strong> Erneuerbare Energien ab 2004<br />
Das B<strong>und</strong>esumweltministerium verbessert<br />
die Förderung des Marktzugangs <strong>für</strong><br />
erneuerbare Energien. Ab 2004 gelten<br />
neue Förderrichtlinien, die der gestiegenen<br />
Nachfrage nach Fördergeldern<br />
Rechnung tragen. Zudem wird der Kreis<br />
der Antragsberechtigten erweitert. Künftig<br />
können neben privaten Nutzern auch<br />
Kommunen, kommunale Einrichtungen<br />
<strong>und</strong> Kirchen Anträge im Rahmen des<br />
MAP stellen. Freiberuflich Tätige sowie<br />
kleine <strong>und</strong> mittlere Unternehmen können<br />
die Richtlinie aber erst nach der Genehmigung<br />
durch die EU-Kommission nutzen.<br />
Die neuen Richtlinien gelten bis<br />
Ende 2006. Das zentrale Ziel des Marktanreizprogramms<br />
ist es, durch Investitionsanreize<br />
den Absatz von Technologien<br />
der erneuerbaren Energien im<br />
Markt zu stärken <strong>und</strong> dazu beizutragen,<br />
dass deren Kosten gesenkt <strong>und</strong> deren<br />
<strong>Wirtschaft</strong>lichkeit verbessert wird.<br />
http://www.erneuerbare-energien.de<br />
6.1.3 Regionale Kooperationen<br />
Begriffe wie Netzwerk, Akteursnetz, Cluster<br />
<strong>und</strong> Kooperation sind in den letzten Jahren zur<br />
Zauberformel <strong>für</strong> zukunftsweisendes regionales<br />
<strong>Wirtschaft</strong>en geworden. Die Region bildet jedoch<br />
keine scharf umrissene Einheit. Regionalität<br />
<strong>und</strong> Regionalisierung von Stoff- <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong>skreisläufen<br />
lassen sich unterschiedlich<br />
erreichen. Hier ist immer auch nach geografischen<br />
<strong>und</strong> biologischen Gr<strong>und</strong>parametern (Bodenqualität,<br />
Fruchtbarkeit etc.) sowie Stoff,<br />
Produkt bzw. Energiearten zu unterscheiden,<br />
wie in einem bmbf-Abschlussbericht zum Forschungsprogramm<br />
„Regional Nachhaltiges<br />
<strong>Wirtschaft</strong>en“ festgestellt wird (vgl. BMBF/ISOE<br />
2003).<br />
46
Das Netzwerk UNSER LAND<br />
Ziel dieser Regional(vermarktungs)initiative ist<br />
der Erhalt <strong>und</strong> die Verbesserung der Lebensgr<strong>und</strong>lagen<br />
<strong>für</strong> Menschen, Tiere <strong>und</strong> Pflanzen in<br />
der Region. „Wir machen das Ziel - die Erhaltung<br />
der Lebensgr<strong>und</strong>lagen - im wahrsten Sinne des<br />
Wortes "schmackhaft". 1994 wurde zunächst die<br />
Solidargemeinschaft BRUCKER LAND e.V. gegründet.<br />
Bis 2000 folgten sieben weitere aus den<br />
Landkreisen r<strong>und</strong> um München, die sich im gleichen<br />
Jahr unter dem Dachverein UNSER LAND<br />
e.V. zusammenschlossen. Circa 1000 Mitglieder<br />
zählt UNSER LAND heute. Sie alle stammen aus<br />
den fünf Säulen, die das Netzwerk tragen:<br />
Handwerk <strong>und</strong> Handel, Verbraucherschutz,<br />
Landwirtschaft, Umwelt- <strong>und</strong> Naturschutz sowie<br />
den Kirchen. 40 Produkte bietet UNSER LAND<br />
inzwischen in r<strong>und</strong> 400 Geschäften unter dem<br />
jeweiligen Landkreislogo an <strong>und</strong> setzt sich auch<br />
<strong>für</strong> die Zusammenarbeit von Stadt <strong>und</strong> Land im<br />
Bereich der regionalen Lebensmittel <strong>und</strong> dem<br />
Einsatz erneuerbarer Energien ein. Seit Oktober<br />
2003 bieten 60 Münchner Märkte UNSER LAND<br />
Lebensmittel an. Bereits jetzt zeichnet sich eine<br />
ausgesprochen große Akzeptanz bei den<br />
Münchnerinnen <strong>und</strong> Münchnern ab. Derzeit<br />
gründet sich die Solidargemeinschaft MÜNCHEN<br />
LAND.<br />
Weitere Informationen:<br />
http://www.unserland.info/<br />
Von besonderer Bedeutung sind aber die in<br />
jedem Fall sehr hohen Anforderungen an die<br />
Kooperationsfähigkeit der Menschen vor<br />
Ort. Nur einige wenige regionale Kooperationsinitiativen<br />
sind von einzelnen Unternehmen<br />
selbst initiiert worden. Die Auswertung<br />
existierender Kooperationen zeigt, dass die<br />
Gründung <strong>und</strong> das Management solcher<br />
Initiativen meist von speziellen Träger- <strong>und</strong><br />
Initiatorenorganisationen geleistet wird (sog.<br />
Kooperationsbroker) .<br />
Kooperationsbroker sind in der Regel jene<br />
lokalen Akteure, die Unternehmenskooperationen<br />
initiieren, zwischen den Unternehmen<br />
vermitteln, moderieren ggf. den Prozess der<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Schaffung von Partnerschaften mit diversen<br />
anderen lokalen oder regionalen Akteuren<br />
steuern, begleiten <strong>und</strong> notwendige Hintergr<strong>und</strong>arbeit<br />
leisten.<br />
Die beiden miteinander zum Teil verwobenen<br />
Regionalinitiativen UNSER LAND <strong>und</strong> ZIEL <strong>21</strong><br />
sind gute Beispiele da<strong>für</strong>, dass regionale Ansätze<br />
<strong>für</strong> Nachhaltiges <strong>Wirtschaft</strong>en großes<br />
Potenzial erschließen können. Damit dieses<br />
gelingt, müssen sog. Kooperationsbroker mit<br />
ausreichenden finanziellen <strong>und</strong> personellen<br />
Mitteln unterstützt werden.<br />
6.2 Partnerschaften stiften<br />
Um alle möglichen Ressourcen auf lokaler<br />
Ebene <strong>für</strong> eine nachhaltige Entwicklung am Ort<br />
auszuschöpfen, gilt es Partnerschaften zu<br />
schmieden. Dabei können im Hinblick auf die<br />
Aktivierung <strong>und</strong> Einbindung der lokalen <strong>Wirtschaft</strong><br />
folgende drei Aspekte getrennt betracht<br />
werden: betriebliche Kooperationen, Erfahrungsaustausch<br />
zwischen Kommunen <strong>und</strong><br />
multilaterale Partnerschaftsansätze.<br />
6.2.1 Betriebliche Kooperationen<br />
Wie in Kapitel 6.1.3. angesprochen, ist es ein<br />
wesentliches Ziel der <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> die<br />
Betriebe vor Ort als Partner <strong>für</strong> strukturelle<br />
Veränderungsprozesse zu gewinnen. Denn<br />
diese können der Dynamik der globalisierten<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sverflechtungen einen alternativen,<br />
dem Standort <strong>und</strong> den lokalen Lebensbedingungen<br />
(Umweltbedingungen, sozialer Zusammenhalt)<br />
<strong>und</strong> Zukunftschancen bevorzugenden<br />
Ansatz entgegen setzen. Eine Voraussetzung<br />
da<strong>für</strong> ist es, möglichst viele kleinere<br />
<strong>und</strong> mittlere Betriebe <strong>für</strong> diese Zielsetzung zu<br />
mobilisieren <strong>und</strong> durch kooperative Zusammenschlüsse<br />
(Netzwerke, Cluster etc.) miteinander<br />
zu vernetzen um sie im Wettbewerb um<br />
die besten Lösungen <strong>für</strong> die Zukunft zu stärken.<br />
47
Ziel <strong>21</strong><br />
Der bayerische Landkreis Fürstenfeldbruck<br />
hat sich in seiner Vereinbarung „Ziel <strong>21</strong>“<br />
das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis zum Jahr<br />
2030 seine Energieversorgung ausschließlich<br />
über regenerative Energieträger zu<br />
gewährleisten. Dazu wurde am 18. Januar<br />
2001 der Verein ZIEL <strong>21</strong> (Zentrum Innovative<br />
Energien im Landkreis Fürstenfeldbruck<br />
e. V.) ins Leben gerufen. Mit breiter<br />
Unterstützung der BürgerInnen wurde ein<br />
Kompetenz- <strong>und</strong> Beratungszentrum gegründet,<br />
das die Koordination <strong>und</strong> Vernetzung<br />
der Akteure <strong>und</strong> Aktivitäten verbessern<br />
<strong>und</strong> r<strong>und</strong> um das Thema Energiewende<br />
beraten soll. Mit ZIEL <strong>21</strong> ist ein<br />
breites Netzwerk entstanden. Neben dem<br />
Landkreis kooperieren u.a. die Sparkasse<br />
Fürstenfeldbruck, der Bayerische Gemeindetag,<br />
Energieversorgungsunternehmen,<br />
der B<strong>und</strong> der Selbstständigen <strong>und</strong> der<br />
Deutsche Gewerbeverband.<br />
Weitere Informationen: www.ziel<strong>21</strong>.de<br />
6.2.2 Erfahrungsaustausch zwischen<br />
kommunalen Akteuren<br />
Der Wissenstransfer <strong>und</strong> -austausch zwischen<br />
kommunalen Akteuren ist eine entscheidende<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> den Erfolg<br />
<strong>und</strong> die Stabilisierung von LA <strong>21</strong>-Prozessen<br />
generell <strong>und</strong> auch <strong>für</strong> die Frage der Einbindung<br />
der lokalen <strong>Wirtschaft</strong>.<br />
Die Erfahrungen mit dem Modellvorhaben<br />
weisen darauf hin, dass sich dies auf unterschiedlichen<br />
Akteursebenen zu vollziehen<br />
hat.<br />
In beiden Modellkommunen hat es im Laufe<br />
des Projektes zwar einen gewissen Erfahrungsaustausch<br />
gegeben, dieser blieb jedoch<br />
im wesentlichen auf Telefonate <strong>und</strong><br />
kurze Treffen zwischen den <strong>Agenda</strong>beauftragten<br />
beschränkt. Und auch auf der<br />
Ebene der politischen Entscheidungsträger<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
war die Situation nicht anders. Oft blieben deshalb<br />
gute Ansätze oder erfolgreiche Aktivitäten<br />
in den Modellkommunen von der jeweils anderen<br />
unbemerkt oder zumindest nicht berücksichtigt<br />
(z.B. Energieberatung <strong>für</strong> Betriebe in<br />
den VG Kirchen <strong>und</strong> Betzdorf, Gründung des<br />
FREK e.V. in der VG Kandel).<br />
Zu begrüßen wäre deshalb eine stärkere Vernetzung<br />
<strong>und</strong> ein forcierter Erfahrungsaustausch<br />
auch der lokalen Akteure aus der <strong>Wirtschaft</strong><br />
<strong>und</strong> der LA <strong>21</strong> (Betriebe, ehrenamtlich Engagierte<br />
in den LA <strong>21</strong>-Arbeitskreisen) .<br />
Der rheinland-pfälzischen <strong>Landeszentrale</strong> <strong>für</strong><br />
Umweltaufklärung (LZU) käme zukünftig eine<br />
wichtige Rolle zu, um dem Wissenstransfer auf<br />
der Ebene der in den LA <strong>21</strong>-Arbeitskreisen<br />
engagierten Betrieben <strong>und</strong> Bürgern entsprechende<br />
Unterstützung zu gewähren. Eine Internetplattform<br />
ist da<strong>für</strong> nur ein, wenn auch<br />
zeitgemäßes, Medium. Themenspezifische<br />
Angebote <strong>für</strong> die Vernetzung <strong>und</strong> den Erfahrungsaustausch<br />
dieser Zielgruppe (Seminare,<br />
Fortbildungsangebote, Studienfahrten, Betriebsbesichtigungen)<br />
könnten hier evtl. neue<br />
Impulse setzen <strong>und</strong> Innovationspotenziale erschließen.<br />
6.2.3 Multilaterale Partnerschaftsansätze<br />
Nachhaltiges <strong>Wirtschaft</strong>en ist das Bemühen<br />
wirtschaftliche Tätigkeiten mit sozialen <strong>und</strong><br />
ökologischen Belangen in Einklang zu bringen.<br />
Dabei spielen “Neue Strategische Partnerschaften”<br />
(NSP) auf lokaler <strong>und</strong> regionaler<br />
Ebene eine zentrale Rolle. 5<br />
Derartige Partnerschaften bezeichnen neue<br />
Formen einer drei Sektoren übergreifenden<br />
Kooperation zwischen öffentlichem Sektor,<br />
Geschäftswelt <strong>und</strong> Bürgergesellschaft. Gemeinsames<br />
Kennzeichen ist - bei einer Vielfalt<br />
von Ansätzen, Strukturen, Ressourcen <strong>und</strong><br />
5 Im Zusammenhang mit spezifischen sozioökonomischen<br />
Themen wie der Massenarbeitslosigkeit<br />
wird auch von neuen „sozialen“ Partnerschaften<br />
gesprochen.<br />
48
Themen – die Bereitschaft der Partner, die<br />
Synergien zu nutzen, die sich aus der Interaktion<br />
<strong>und</strong> Kooperation zwischen ihren vielfältigen<br />
Arbeitskulturen <strong>und</strong> Wissensquellen<br />
ergeben.<br />
Der <strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong>-Prozess bietet eine<br />
hervorragende Plattform zur Schaffung solcher<br />
innovativer Partnerschaften, gerade<br />
auch im Hinblick auf die Vernetzung <strong>und</strong><br />
Kooperation lokaler Betriebe mit der Verwal<br />
tung, Sozialeinrichtungen, Vereinen, Umweltinitiativen<br />
<strong>und</strong> engagierten Bürgerinnen<br />
<strong>und</strong> Bürgern.<br />
Das Kopenhagen Zentrum –<br />
Neue Soziale Partnerschaften<br />
Das Kopenhagen Zentrum erforscht die Erfolgsbedingungen<br />
<strong>und</strong> Leistungen von Neuen<br />
Sozial-Partnerschaften <strong>und</strong> definiert sie folgendermaßen:<br />
“Menschen <strong>und</strong> Organisationen zusammengesetzt<br />
aus Staat, <strong>Wirtschaft</strong> <strong>und</strong> Bürgerschaft,<br />
die sich in freiwilligen, gegenseitig befruchtenden,<br />
innovativen Beziehungen <strong>für</strong> allgemeine<br />
soziale Ziele einsetzen, indem sie ihre Ressourcen<br />
<strong>und</strong> Fähigkeiten kombinieren.”<br />
Weitere Informationen:<br />
www.copenhagencentre.org<br />
6.3 Ausblicke<br />
6.3.1 Stabilisierungsempfehlungen<br />
Die <strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> ist immer auch eine<br />
Suchbewegung oder ein Lernprozess. Das<br />
gilt auch dann, wenn mit der Einbeziehung<br />
lokaler <strong>Wirtschaft</strong> zielorientierte, effizienzgewohnte<br />
Akteure mit am Werke sind. Erfolge<br />
sind damit auch auf Überzeugung <strong>und</strong><br />
Kooperationsbereitschaft angewiesen. Als<br />
Plattform <strong>für</strong> Innovationsprozesse kann die<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
<strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong> dabei helfen neue strategische<br />
Partnerschaften zu schmieden. Dies braucht<br />
jedoch seine Zeit <strong>und</strong> erfordert in gewisser<br />
Weise auch eine Veränderung herkömmlicher<br />
Verhaltensmuster <strong>und</strong> Gewohnheiten, bei allen<br />
Akteuren.<br />
Die hier wiedergegebenen Empfehlungen basieren<br />
u.a. auf den Ergebnissen des Forschungsprojektes<br />
„Bedingungen institutioneller<br />
Stabilisierung lokaler <strong>Agenda</strong><strong>21</strong> Prozesse –<br />
Modellhafte Stabilisierungspfade“, das von<br />
B.A.U.M. zusammen mit der Münchner Projektgruppe<br />
<strong>für</strong> Sozialforschung (MPS), der Universität<br />
Bremen <strong>und</strong> der ZWE Arbeit <strong>und</strong> Region<br />
durchgeführt wurde.<br />
Der angestrebte Wandel vollzieht sich nicht<br />
immer geradlinig sondern eher in Form langwieriger,<br />
widersprüchlicher <strong>und</strong> unübersichtlicher<br />
Prozesse. „Stabilität“ setzt unter diesen<br />
Bedingungen Flexibilität voraus – nämlich die<br />
Fähigkeit bei allen Beteiligten, in flexibler Weise<br />
auf stetig sich verändernde Rahmenbedingungen,<br />
Problemlagen <strong>und</strong> Akteurskonstellationen<br />
reagieren zu können.<br />
Um <strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong>-Prozesse zu stabilisieren<br />
sind gr<strong>und</strong>sätzlich zwei idealtypische Phasen<br />
zu unterscheiden.Die Etablierung als eigenständiger<br />
kommunalpolitischer Akteur spielt<br />
bei LA <strong>21</strong>-Prozessen eine bedeutende Rolle.<br />
Während dieser Phase rücken verschiedene<br />
Aspekte in den Vordergr<strong>und</strong>, wie etwa organisatorische<br />
Stabilisierung, Entwicklung eines<br />
gemeinsamen Selbstverständnisses, Rollenerklärung,<br />
Mobilisierung <strong>und</strong> Vernetzung lokaler<br />
Akteure, Erprobung neuer Beteiligungsformen<br />
<strong>und</strong> die Entwicklung innovativer Modellprojekte.<br />
In einer darauffolgenden Phase geht es stärker<br />
um die Verstetigung des Prozesses, um Informations-<br />
<strong>und</strong> Vernetzungsmanagement, um<br />
Diffusion <strong>und</strong> Transfer von Erfahrungen <strong>und</strong> um<br />
die Entwicklung geeigneter Controlling-<br />
Instrumente. Hinweise zu den allgemeinen<br />
Stabilisierungsbedingungen <strong>für</strong> <strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong>-<br />
Prozesse finden sich im Anhang (vgl. Kap.<br />
10.4). :<br />
49
Die beiden Modellkommunen, die am Projekt<br />
„<strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong>“ teilgenommen<br />
haben, stehen zwischen diesen<br />
beiden Phasen. Daher bieten sich folgende<br />
Ansatzpunkte <strong>für</strong> die weitere Entwicklung<br />
auch im Hinblick auf die Einbindung der<br />
lokalen <strong>Wirtschaft</strong>:<br />
Einerseits geht es dabei um Maßnahmen<br />
zur Professionalisierung der Beteiligungsprozesse<br />
mit dem Ziel, die lokalen Potenziale<br />
<strong>für</strong> eine nachhaltige Entwicklung zu stärken<br />
<strong>und</strong> besser in kommunale Planungs<strong>und</strong><br />
Umsetzungsprozesse einzubinden. Auf<br />
folgende bewährte Methoden kann zurückgegriffen<br />
werden:<br />
• Perspektiven-Werkstätten: diese ermöglichen<br />
die gezielte Einbindung lokaler<br />
Akteure bei konkreten Vorhaben<br />
• Bürgerkonferenzen: dienen der Verzahnung<br />
von LA <strong>21</strong>-Prozess <strong>und</strong> Verwaltungshandeln<br />
• Zukunftskonferenzen/“Promenade der<br />
Visionen“: eine Methode zur Aktivierung<br />
neuer Akteure, die nicht nur <strong>für</strong> neuen<br />
Schwung in der <strong>Agenda</strong> sorgen, sondern<br />
auch die nötigen Ressourcen mitbringen,<br />
um bereits avisierte Vorhaben<br />
endlich realisieren zu können.<br />
• Andererseits geht es um die Verstetigung<br />
des Prinzips der Nachhaltigkeit<br />
(„Mainstreaming“) in kommunalen Entwicklungsprozessen:<br />
• Leitbildentwicklung <strong>und</strong> Leitlinien: nur<br />
wo gemeinsam entwickelte Visionen den<br />
Handelnden eine Orientierung bieten,<br />
kann sicher gestellt werden, dass divergierende<br />
Interessen ausbalanciert <strong>und</strong><br />
in gemeinsames zukunftsorientiertes<br />
Handeln überführt werden. Insbesondere<br />
die <strong>Wirtschaft</strong> lebt von klaren Rahmenbedingungen<br />
<strong>und</strong> Zielkorridoren. Ist<br />
sie aber nicht an deren Formulierung mit<br />
beteiligt, werden wirtschaftliche Interes-<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
sen nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt<br />
<strong>und</strong> es wird nur in Ausnahmefällen<br />
gelingen die lokalen <strong>Wirtschaft</strong>sbetriebe als<br />
engagierte Partner zu gewinnen.<br />
• <strong>Lokale</strong> Aktionspläne/-programme: Ideen<br />
<strong>und</strong> Maßnahmen zu entwickeln <strong>und</strong> diese<br />
umzusetzen scheitert oft an der zu großen<br />
Unverbindlichkeit der Abmachungen. Die<br />
Dokumentation der Entstehungsgeschichte,<br />
die Zuordnung beteiligter Akteure <strong>und</strong> die<br />
Niederschrift von vereinbarten Zielen, Indikatoren<br />
6 , Umsetzungsschritten <strong>und</strong> Finanzierungswegen<br />
verleiht der LA <strong>21</strong> nicht nur<br />
Transparenz, sondern auch Bestand.<br />
• Nachhaltigkeits-Check: Dieses Instrument<br />
stellt eine Möglichkeit dar, bereits im Frühstadium<br />
von Planungsprozessen <strong>und</strong> Innovationsprozessen<br />
sowohl im Verwaltungshandeln<br />
als auch bei Betrieben eine balancierte<br />
Berücksichtigung von ökologischen,<br />
sozialen <strong>und</strong> ökonomischen Wirkungen zu<br />
erreichen. Die <strong>Wirtschaft</strong> kann davon profitieren<br />
indem sie Risiken bei Produktion <strong>und</strong><br />
Vermarktung neuer Produkte <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
antizipiert.<br />
Je gr<strong>und</strong>legender die beteiligten Personen <strong>und</strong><br />
Organisationen aus der Verwaltung, Unternehmen,<br />
Wissenschaft, Vereinen etc. sich über<br />
gemeinsame Ziele, Regeln <strong>und</strong> Entscheidungsmechanismen<br />
verständigen, desto größer<br />
sind die Chancen <strong>für</strong> langfristige Kooperationserfolge.<br />
Für die Frage der Einbindung der <strong>Wirtschaft</strong> ist<br />
es darüber hinaus ganz entscheidend, diejenigen<br />
Themenfelder zu erschließen, die es lokalen<br />
<strong>Wirtschaft</strong>sakteuren ermöglichen, das eigene<br />
Geschäftsinteresse mit zukunfts-orientierten<br />
Innovationsprozessen zu verbinden.<br />
6 vgl. auch die gemeinsam empfohlenen Indikatoren<br />
zur kommunalen Nachhaltigkeit, Bonn, 2003 zum<br />
download unter<br />
http://www.agendatransfer.net/agendaservice/admin/download/indikatoren_neu.pdf<br />
50
Die <strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> muss sich deshalb so<br />
schnell wie möglich <strong>für</strong> die „neuen“ Themen<br />
öffnen. Im nächsten abschließenden Kapitel<br />
werden einige dieser neuen Themen angerissen.<br />
6.3.2 Neue Themenfelder erschließen<br />
Wie bereits in Kapitel 6.1 erläutert, werden<br />
folgende wirtschaftsnahe <strong>und</strong> -relevante<br />
Themenfelder im Rahmen der <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong><br />
sicher nicht an Bedeutung verlieren:<br />
• Förderung kostensenkender Umweltschutzmaßnahmen<br />
in Betrieben<br />
• Förderung der Erschließung regenerativer<br />
Energiequellen<br />
• Schließung regionaler Ressourcenkreisläufe<br />
/ Stoffstrommanagement<br />
• Versorgung mit Produkten <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
aus der Region<br />
• Bedarfsorientierte, zukunftsgerichtete<br />
Entwicklung bei Ausbildung <strong>und</strong> Qualifizierung.<br />
Auch in den beiden Modellkommunen waren<br />
dies die Themen, die sich als unmittelbar<br />
handlungsrelevant herauskristallisierten.<br />
Das Themenfeld Umweltschutz / Erneuerbare<br />
Energien / Ressourcenmanagement /<br />
Regionalvermarktung bleibt dabei nicht nur<br />
zentral in der Diskussion über den besseren<br />
Weg hin zu einer nachhaltigen Entwicklung<br />
in Kommunen, sondern bietet auch zahlreiche<br />
Aktivierungspotenziale zur Einbindung<br />
der lokalen <strong>Wirtschaft</strong>. Das konnte in diesem<br />
wie auch in anderen ähnlich gelagerten<br />
Pilot-/Modellvorhaben immer wieder gezeigt<br />
werden.<br />
Dennoch sollte die <strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> nicht<br />
bei den sogenannten „Umweltthemen“ stehen<br />
bleiben. Eine Verknüpfung der <strong>Agenda</strong><br />
mit den „harten“ Themen der <strong>Wirtschaft</strong>,<br />
Beschäftigung, Finanzen etc. gewinnt zunehmend<br />
an Bedeutung. Denn auch dort<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
werden entscheidende Weichen <strong>für</strong> eine nachhaltige<br />
lokale bzw. regionale Entwicklung gestellt.<br />
Angesichts der extrem angespannten Haushaltslage<br />
in den Kommunen, der aktuellen<br />
bisher ungelösten Herausforderungen am Arbeitsmarkt<br />
<strong>und</strong> beim Umbau des Sozialstaats<br />
sowie entsprechender Reformvorhaben der<br />
B<strong>und</strong>esregierung <strong>und</strong> dem europäischen, ja<br />
sogar globalen Trend die Rolle der Unternehmen<br />
auch im Lichte der Nachhaltigkeit zu diskutieren,<br />
sollten die Kommunen in Rheinland-<br />
Pfalz sich deshalb in Zukunft auch stärker mit<br />
folgenden Themen <strong>und</strong> Ansätzen befassen:<br />
• Nachhaltige <strong>Wirtschaft</strong>s- <strong>und</strong> Beschäftigungsförderung<br />
vor Ort:<br />
Hier sind Ansätze zur Stärkung kommunaler<br />
Kompetenzen <strong>und</strong> Kapazitäten besonders<br />
zu berücksichtigen, um im Sog globaler<br />
Veränderungsprozesse <strong>und</strong> nationaler<br />
Reformbestrebungen ein komplementäres<br />
lokales Engagement <strong>für</strong> eine nachhaltige<br />
<strong>Wirtschaft</strong>s- <strong>und</strong> Beschäftigungsentwicklung<br />
vor Ort zu ermöglichen.<br />
• Nachhaltige Kommunalhaushalte: Bürgerbeteiligung<br />
bei der Haushaltsplanaufstellung<br />
wird angesichts der knappen<br />
Kommunalkassen auch in Deutschland zunehmend<br />
zu einem Thema. Bürger übernehmen<br />
dabei eine Teilverantwortung <strong>für</strong><br />
die Gestaltung des kommunalen Haushaltsplanes.<br />
Sie informieren sich, machen<br />
Vorschläge, unterstützen bei der Prioritätensetzung<br />
<strong>und</strong> helfen mit bei der Umsetzung.<br />
Ermutigende Erfahrungen liegen aus<br />
ersten Modellversuchen u.a. in der rheinland-pfälzischen<br />
Gemeinde Neustadt an<br />
der Weinstraße ( http://www.neustadt-<br />
weinstrasse.de/ ) sowie den Kommunen<br />
Rheinstetten <strong>und</strong> Groß-Umstadt bereits<br />
vor.<br />
51
Nachhaltiges Unternehmertum („CSR –<br />
Corporate Social Responsibility“): 7<br />
Dabei geht es um die „triple-bottom-line“<br />
unternehmerischen Handelns sowohl bei<br />
größeren global agierenden Unternehmen<br />
als auch bei kleinen <strong>und</strong> mittelständischen<br />
Betrieben. Praktisch bedeutet das, dass sich<br />
Betriebe <strong>und</strong> Unternehmen im eigenen Interesse<br />
über die notwendige, aber im Lichte<br />
globaler Herausforderungen nicht hinreichende<br />
Auseinandersetzung mit der ökologischen<br />
Dimension ihres Tuns hinaus auch<br />
in ihrem eigenen Interesse <strong>für</strong> ganzheitlichere,<br />
umfassende Ansätze der Unternehmensführung<br />
öffnen. CSR betrifft sowohl innerbetriebliche<br />
Fragen (Qualifizierung <strong>und</strong> Weiterbildung,<br />
Arbeitszeitmodelle, Ges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>und</strong> Sicherheit am Arbeitsplatz, integrierte<br />
Produktpolitik, Umweltmanagementsysteme,<br />
Sozialauditierung, Verhaltenskodices)<br />
7 CSR wird auch übersetzt mit „gesellschaftliche<br />
Verantwortung der Unternehmen“. Synonym<br />
wird oft auf der Begriff „Corporate Citizenship<br />
verwendet (vgl. Dyllick 2004).<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
als auch das externe Stakeholder- <strong>und</strong> Innovationsmanagement<br />
(Sponsoring, Mitarbeiterfreistellung,<br />
K<strong>und</strong>en- <strong>und</strong> Zuliefererbeziehungen,<br />
Unternehmenskooperationen, Public-Private-<br />
Partnerships, Berichterstattung sowie die territoriale<br />
Verantwortung von Betrieben <strong>für</strong> die<br />
dauerhafte Sicherung der Infrastruktur <strong>und</strong><br />
allgemeinen Lebensbedingungen am Standort).<br />
Das so verstandene gesellschaftliche Engagement<br />
vieler Firmen bleibt jedoch noch sehr oft<br />
karitativ (Stufe 1), d. h. ist weder nutzenorientiert<br />
auf die <strong>für</strong> das Unternehmen günstigen<br />
Nebenwirkungen ausgerichtet (Stufe 2) noch im<br />
Sinne der Nachhaltigkeit strategisch in das<br />
Geschäftsmodell integriert (Stufe 3).<br />
Quelle: Die <strong>Lokale</strong> Dimension der unternehmerischen Verantwortung, B.A.U.M. e.V.<br />
Jahrbuch 2004<br />
52
Die Kommunen in Rheinland-Pfalz <strong>und</strong> in<br />
anderen Regionen der B<strong>und</strong>esrepublik sollten<br />
sich möglichst umfassend <strong>und</strong> schnell<br />
um geeignete Rahmenbedingungen <strong>und</strong><br />
Unterstützungsangebote <strong>für</strong> die lokale Wirt-<br />
Wir sind nicht nur<br />
<strong>für</strong> das verantwortlich,<br />
was wir tun,<br />
sondern auch <strong>für</strong> das,<br />
was wir nicht tun.<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
schaft bemühen, um im internationalen Wettbewerb<br />
rechtzeitig die richtigen Weichen einer<br />
nachhaltigen Zukunftssicherung zu stellen.<br />
53
7 Literatur<br />
<strong>Agenda</strong>Transfer (Hrsg.) (Juli 2003): Gemeinsam<br />
empfohlene Indikatoren zur<br />
kommunalen Nachhaltigkeit, Bonn,<br />
zum download unter<br />
www.agendatransfer.net/agendaservice/admin/download/indikatoren_neu.p<br />
df<br />
B.A.U.M. Consult München GmbH (2003):<br />
Approaches and success factors of<br />
regional RE initiatives. Summary and<br />
comparative Evaluation of Assessment<br />
reports. Draft September 2003,<br />
Zwischenbericht zur sozialökonomischen<br />
Begleitforschung im<br />
EU-Vorhaben „Network of Rural Areas<br />
aiming at a very high RE rate 100%<br />
RE-NET“ Project No. NNE5-2001-357,<br />
http://www.100re.net<br />
BMBF / ISOE (Hg.) (2003): „Was <strong>für</strong> eine<br />
<strong>Wirtschaft</strong>. Nachhaltig, regional, beispielhaft“<br />
zum download unter<br />
http://www.nachhaltig.org/<br />
B<strong>und</strong>esumweltministerium <strong>für</strong> Umwelt, Naturschutz<br />
<strong>und</strong> Reaktorsicherheit (Juli<br />
1999): Nachhaltige Entwicklung in<br />
den Kommunen <strong>und</strong> Beteiligung der<br />
<strong>Wirtschaft</strong> – <strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> – Dokumentation<br />
zum Kongreß am 2./3.<br />
März 1999 in Leipzig, B<strong>und</strong>esministerium<br />
<strong>für</strong> Umwelt & B<strong>und</strong>esverband der<br />
Deutschen Industrie (BDI) (Hrsg.):<br />
Schaltegger, S.; Herzig, C.; Kleiber,<br />
O. & Müller, J. (Autoren) (2002):<br />
Nachhaltigkeitsmanagement in Unternehmen.<br />
Konzepte <strong>und</strong> Instrumente<br />
<strong>für</strong> eine nachhaltige Unternehmensentwicklung.<br />
Berlin.<br />
B<strong>und</strong>esministerium <strong>für</strong> Umwelt, Naturschutz<br />
<strong>und</strong> Reaktorsicherheit / Umweltb<strong>und</strong>esamt<br />
(Hrsg.) (1998): Handbuch Lo-<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
kale AGENDA <strong>21</strong>. Wege zur nachhaltigen<br />
Entwicklung in den Kommunen,<br />
Bonn.<br />
B<strong>und</strong>esministerium <strong>für</strong> Umwelt / Umweltb<strong>und</strong>esamt<br />
(2003): Leitfaden „Die <strong>Lokale</strong><br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> zeigt Profil - Projektbausteine<br />
an der Schnittstelle <strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong><br />
<strong>21</strong>/Betriebliche Umweltmanagementsysteme,<br />
kostenlos erhältlich unter<br />
www.umweltb<strong>und</strong>esamt.de<br />
B<strong>und</strong>esministerium <strong>für</strong> Umwelt/ Umweltb<strong>und</strong>esamt<br />
(2003): Leitfaden „Die <strong>Lokale</strong><br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> zeigt Profil - Projektbausteine<br />
an der Schnittstelle <strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong><br />
<strong>21</strong>/Betriebliche Umweltmanagementsysteme,<br />
kostenlos erhältlich unter<br />
www.umweltb<strong>und</strong>esamt.de<br />
B<strong>und</strong>esweite Servicestelle <strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong><br />
(Juni 2003): Anknüpfungspunkte <strong>für</strong> die<br />
lokale <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> in Deutschland.<br />
BUND / Unternehmensgründung ? (2002):<br />
Zukunftsfähiges Unternehmen. Wege zur<br />
nachhaltien <strong>Wirtschaft</strong>sweise von Unternehmen,<br />
ökom verlag, München.<br />
Butterbrodt, D. (1997): Von traditionellen Unternehmenskonzepten<br />
zu modernen Managementkonzepten.<br />
In: Winter, G.<br />
(Hrsg.): Ökologische Unternehmensentwicklung.<br />
Berlin, Heidelberg, New York.<br />
S. 97-130.<br />
Christian Ganzert/Bernhard Burdick (2003): Die<br />
"regionale Idee" als Zusatznutzen <strong>für</strong><br />
Anbieter <strong>und</strong> Nachfrager von regionalen<br />
Lebensmitteln. Erfahrungen von Aktivierungsprozessen<br />
in Much (Rhein-Sieg-<br />
Kreis).<br />
Damm, D./ Lang, R. (2001): Handbuch Unternehmenskooperation.<br />
Erfahrungen mit<br />
Corporate Citizenship in Deutschland;<br />
Stiftung Mitarbeit/UPJ (Hrsg.): Brennpunkt-Dokumentation<br />
zu Selbsthilfe <strong>und</strong><br />
Bürgerengagement; Nr. 39,<br />
Bonn/Hamburg.<br />
54
Deutsches Kompetenzzentrum <strong>für</strong> Nachhaltiges<br />
<strong>Wirtschaft</strong>en 2002: Nachhaltiges<br />
<strong>Wirtschaft</strong>en in Deutschland. Erfahrungen,<br />
Trends <strong>und</strong> Potenziale. Witten.<br />
Dyllick, Prof. Dr. Thomas (2004): Was ist<br />
CSR? Erklärung <strong>und</strong> Definition,<br />
B.A.U.M. Jahrbuch 2004, , Hamburg.<br />
ecom.ag (2000): Landkarte nachhaltiges<br />
<strong>Wirtschaft</strong>en in Nordrhein-Westfalen.<br />
Eine qualitative Untersuchung von<br />
Geschäftsfeldern <strong>für</strong> nachhaltiges<br />
<strong>Wirtschaft</strong>en in Nordrhein-Westfalen.<br />
Im Auftrag des Ministeriums <strong>für</strong> Umwelt<br />
<strong>und</strong> Naturschutz, Landwirtschaft<br />
<strong>und</strong> Verbraucherschutz des Landes<br />
NRW.<br />
Future e.V. (2000): Nachhaltigkeit. Jetzt!.<br />
Anregungen, Kriterien <strong>und</strong> Projekte<br />
<strong>für</strong> Unternehmen, München.<br />
Gaitsch, R., C. Ganzert (2003): Der Zuschnitt<br />
von Regionen <strong>und</strong> seine Bedeutung<br />
<strong>für</strong> das Regionalisierungspotenzial<br />
nachhaltigen <strong>Wirtschaft</strong>ens am<br />
Beispiel der Vermarktung von regionalen<br />
Nahrungsmitteln.<br />
Gege, M. (Hrsg.) (1997): Kosten senken<br />
durch Umweltmanagement. 1000 Erfolgsbeispiele<br />
aus 100 Unternehmen.<br />
München.<br />
Habisch, A. (2003): Corporate Citizenship.<br />
Gesellschaftliches Engagement von<br />
Unternehmen in Deutschland; Berlin/Heidelberg.<br />
Heiland, Dr. Stefan, Tischer, Dr. Martin,<br />
Döring, Dr. Thomas, Pahl, Dr. Thilo,<br />
Jessel, Prof. Dr. Beate (September<br />
2003): Indikatoren zur Zielkonkretisierung<br />
<strong>und</strong> Erfolgskontrolle im Rahmen<br />
der <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong>, Forschungsbericht<br />
200 16 107, UBA-FB 000513,<br />
Berlin.<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Herzig, C.; Rheingans-Heintze, A. & Schaltegger,<br />
S., Tischer, M. 2003: Auf dem Weg<br />
zu einem Nachhaltigen Unternehmertum<br />
im Handwerk. Entwicklung eines integrierten<br />
Konzepts. Lüneburg: CSM.<br />
Hollbach-Grömig, B., Jens Libbe (1998) Nachhaltig<br />
<strong>Wirtschaft</strong>en in Kommunen. 25<br />
Jahre DIFU Zukunftswerkstatt, ICLEI /<br />
B.A.U.M. Consult (2003), CapaCity –<br />
Qualifizierungsprogramm <strong>für</strong> eine nachhaltige<br />
<strong>Lokale</strong> Aktionsplanung <strong>für</strong> Beschäftigung,<br />
Kursmaterialien des<br />
Fernlerngangs.<br />
http://www.iclei.org/itc/capacity/germany.<br />
html<br />
InWent (Hrsg.) (April 2003): Porto Alegres Beteiligungshaushalt<br />
- Lernerfahrung <strong>für</strong><br />
deutsche Kommunen. Dokumentation<br />
eines Fachgesprächs vom 19.12.2002,<br />
Dialog Global Nr. 5 – Schriftenreihe der<br />
Servicestelle, Bonn.<br />
Kluge, Thomas , Engelbert Schramm (Hg.):<br />
Aktivierung durch Nähe - Regionalisierung<br />
nachhaltigen <strong>Wirtschaft</strong>ens. ökom<br />
Verlag, München<br />
Landesanstalt <strong>für</strong> Umweltschutz Baden-<br />
Württemberg (2001). Einbindung der<br />
<strong>Wirtschaft</strong> in die <strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong>. Ein<br />
Leitfaden mit 17 Beispielen aus der Praxis.<br />
Arbeitsmaterialien 15, Karlsruhe.<br />
Maaß, F./ Clemens, R. (2002): Corporate Citizenship.<br />
Das Unternehmen als guter<br />
Bürger; Schriften zur Mittelstandsforschung<br />
Nr. 94 NF, Wiesbaden.<br />
Marketingberatung Dr, Eggers/ MBE (September<br />
2001), <strong>Wirtschaft</strong>sstandort Kandel,<br />
Gutachen im Auftrag der Stadt Kandel.<br />
Mohn, R. (2003): Die gesellschaftliche Verantwortung<br />
des Unternehmers; München.<br />
Münchener Projektgruppe <strong>für</strong> Sozialforschung,<br />
Universität Bremen, ZWE Arbeit <strong>und</strong> Region<br />
<strong>und</strong> B.A.U.M. Consult München<br />
2001, „Bedingungen institutioneller Stabi-<br />
55
lisierung lokaler <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong>-Prozesse<br />
– Modellhafte Stabilisierungspfade“,<br />
Abschlussbericht zum BMU-<br />
Forschungsprojekt.<br />
Münderlein, J. (2003): Feedback <strong>für</strong> nachhaltiges<br />
Unternehmensmanagement,<br />
B.A.U.M. Jahrbuch 2003, Hamburg.<br />
Münderlein, J. (2004): Die lokale Dimension<br />
der unternehmerischen Verantwortung,<br />
B.A.U.M. Jahrbuch 2004 (im Erscheinen),<br />
Hamburg.<br />
Niedersächsisches Institut <strong>für</strong> <strong>Wirtschaft</strong>sforschung<br />
e.V. (2003): NIW Workshop<br />
2002, Umwelt <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Niedersachsen.<br />
Märkte, Innovationen,<br />
Chancen, Anreize <strong>und</strong> Instrumente,<br />
Hannover.<br />
Niedersächsisches Institut <strong>für</strong> <strong>Wirtschaft</strong>sforschung<br />
e.V. (2003): NIW Workshop<br />
2002, Umwelt <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Niedersachsen.<br />
Märkte, Innovationen,<br />
Chancen, Anreize <strong>und</strong> Instrumente,<br />
Hannover.<br />
Peters, U., Sauerborn, K., Spehl, H., Tischer,<br />
M., Witzel, A. (1996): Nachhaltige<br />
Regionalentwicklung - ein neues<br />
Leitbild <strong>für</strong> eine veränderte Struktur<strong>und</strong><br />
Regionalpolitik. Trier<br />
The Copenhagen Centre (TCC), CSR<br />
Europe and International Business<br />
Leaders Forum (IBLF) (Mai 2003):<br />
Partnership Matters - Current issues<br />
in cross-sector collaboration<br />
The Copenhagen Centre (TCC), CSR<br />
Europe and International Business<br />
Leaders Forum (IBLF) (Dezember<br />
2003): It Simply Works Better! Campaign<br />
Report on European CSR Excellence<br />
2003-2004, with the support<br />
of the European Commission, DG<br />
Employment.<br />
Tischer, M. & Münderlein, J. (2003): Sustainable<br />
regional economic develop-<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
ment - a case for cooperation, in:<br />
Nischwitz, G., Molitor, R. 2003 (eds):<br />
Regional Governance – Engine for Sustainable<br />
Development. München: ökom.<br />
Tischer, M. (2001): Nachhaltige Entwicklung<br />
<strong>und</strong> Unternehmenskooperation in der<br />
Region. Marburg<br />
Weber, B. (Heidelberger Oberbürgermeisterin)<br />
(2003), Challenger Report „Nachhaltigkeit<br />
<strong>und</strong> <strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong>: Statt einer Epoche<br />
bürgerschaftlichen Engagements nur<br />
eine Episode einzelner Gruppen?“ an<br />
den Rat <strong>für</strong> Nachhaltige Entwicklung,<br />
Berlin, 1. Oktober 2003, abgerufen unter<br />
www.nachhaltigkeitsrat.de am<br />
26.11.2003<br />
56
8 Ausgewählte Internetadressen<br />
<strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong><br />
� B<strong>und</strong>esweite Servicestelle <strong>Lokale</strong> <strong>Agenda</strong><br />
<strong>21</strong> http://www.agendaservice.de/<br />
� Der Internationale Rat <strong>für</strong> kommunale<br />
Umweltinitiativen (ICLEI)<br />
http://www.iclei.org<br />
� <strong>Landeszentrale</strong> <strong>für</strong> Umweltaufklärung<br />
Rheinland-Pfalz<br />
http://www.umdenken.de<br />
Datenbanken / Nachschlagewerke<br />
� Aachener Stiftung Kathy Beys "Lexikon<br />
der Nachhaltigkeit"<br />
http://www.nachhaltigkeit.aachenerstiftung.de/1000/Veranlassung.htm<br />
� Bmbf-Förderschwerpunkt „Nachhaltig<br />
<strong>Wirtschaft</strong>en - Regionale Ansätze“<br />
http://www.nachhaltig.org/<br />
� EU Kommission, Responsible Entrepreneurship<br />
for SMEs, Datenbank<br />
http://europa.eu.int/comm/enterprise/ent<br />
repreneurship/support_measures/responsible_entr<br />
epreneurship/index.htm<br />
� Gute Beispiele Datenbank<br />
http://www.gute-beispiele.net<br />
� Lexikon der Nachhaltigkeit<br />
http://www.nachhaltigkeit.info/<br />
� Nachhaltigkeitsportal <strong>und</strong> Akteursnetzwerk<br />
"Nachhaltiges Österreich"<br />
http://www.nachhaltigkeit.at<br />
� Nachhaltigkeits-Tatenbank, <strong>Wirtschaft</strong><br />
http://taten.municipia.at/wirtschaft/index.<br />
html<br />
� Oekomedia Online, Basel<br />
http://www.oekomedia.org<br />
� Ökoradar - Internetportal zum Thema<br />
Nachhaltiges <strong>Wirtschaft</strong>en<br />
http://www.oekoradar.de<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
� Umweltdatenbank<br />
http://www.umweltdatenbank.de/<br />
Nachhaltiges <strong>Wirtschaft</strong>en<br />
� B.A.U.M. e.V. http://www.baumev.de<br />
� B.A.U.M. Group www.baumgroup.de<br />
� B<strong>und</strong>esinitiative „Unternehmen: Partner der<br />
Jugend“ www.upj-online.de<br />
� Econsense - Forum Nachhaltige Entwicklung<br />
http://www.econsense.de/<br />
� ifeu - Institut <strong>für</strong> Energie <strong>und</strong> Umweltforschung<br />
Heidelberg http://www.ifeu.de/<br />
� IFOK GmbH – Institut <strong>für</strong> Organisationskommunikation<br />
http://www.ifok.de/<br />
� IISD - International Institute for Sustainable<br />
Development – Business and Development:<br />
A Global Guide<br />
http://www.bsdglobal.com/<br />
� imug Institut <strong>für</strong> Markt - Umwelt - Gesellschaft<br />
http://www.imug.de/<br />
� IÖW – Institut <strong>für</strong> ökologische <strong>Wirtschaft</strong>sforschung<br />
http://www.ioew.de<br />
� IUWA "Institut <strong>für</strong> Umwelt<strong>Wirtschaft</strong>sAnalysen"<br />
Heidelberg e.V.: http://www.iuwa.de<br />
� Öko-Institut e.V.<br />
http://www.oekoinstitut.de/nachhaltig.htm<br />
� Unternehmensgrün<br />
http://www.unternehmensgruen.de/ Weltzukunftsrat<br />
http://www.weltzukunftsrat.de<br />
� World Business Council for Sustainable<br />
Development (WBCSD)<br />
http://www.wbcsd.org/<br />
57
Verantwortliches Unternehmertum (CSR,<br />
Corporate Citizenship)<br />
� COSORE - Soziale Verantwortung in<br />
kleinen <strong>und</strong> mittleren Unternehmen<br />
http://www.cosore.com/de/konzept.html<br />
� CSRwire - CSR Directory<br />
http://www.csrwire.com/directory/<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
� Ministerium <strong>für</strong> <strong>Wirtschaft</strong> <strong>und</strong> Arbeit des<br />
Landes Nordrhein-Westfalen - Aktion Corporate<br />
Citizenship NRW<br />
http://www.corporate-citizenship.nrw.de/<br />
� CSR Austria Informationsbüro<br />
http://csr.webisodes.at<br />
� CSR Europe http://www.csreurope.org/<br />
58
9 Anhänge<br />
9.1 Details zu Arbeitsprozess <strong>und</strong> Ergebnissen<br />
9.1.1 VG Kirchen <strong>und</strong> VG Betzdorf<br />
Die Veranstaltungen <strong>und</strong> deren Ergebnisse im Einzelnen:<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
1. Vorbesprechung mit der LZU<br />
Zeit(raum) 9.10.2000<br />
Beteiligte LZU, B.A.U.M.<br />
Ergebnisse - Klärung des Auftrags / Vertrags<br />
- Durchführung eines zweistufigen Verfahrens zur Auswahl der Modellkommunen<br />
2. Vorbesprechung mit der LZU<br />
Zeit(raum) 22.1.2001<br />
Beteiligte LZU, B.A.U.M.<br />
Ergebnisse - Abstimmung über generelle Zielsetzung(en)<br />
- Festlegung des Arbeitsprozesses<br />
- Erstellung einer Projektkonzeption<br />
Auftaktbesprechung <strong>und</strong> Präsentation des Modellprojektes in der Region<br />
Zeit(raum) 18.4.2001 (Auftaktbesprechung)<br />
Bürgermeister, Beigeordneter, <strong>Agenda</strong>-Beauftragte, B.A.U.M.<br />
Beteiligte<br />
Ergebnisse<br />
Man hat sich auf folgende Schritte geeinigt:<br />
- Zwei vorbereitende Veranstaltungen werden im Juni 2001 durchgeführt.<br />
- Es wird im Sommer eine Betriebsbefragung durchgeführt.<br />
- Im September wird eine öffentliche Auftaktveranstaltung durchgeführt.<br />
Auftaktveranstaltung – 1. Sitzung AK Nachhaltig <strong>Wirtschaft</strong>en<br />
Zeit(raum) 27.8.2001<br />
Beteiligte Bürgermeister, <strong>Agenda</strong>-Beauftragte, ca. 30 Personen überwiegend aus Betrieben,<br />
Moderation: B.A.U.M.<br />
Ergebnisse Man hat sich darauf geeinigt, dass<br />
- die vorgestellten Guten-Beispiele noch keinen konkreten Ansatzpunkt geliefert<br />
hatten<br />
- einzelne Ideen <strong>und</strong> Vorschläge im Plenum vorhanden sind<br />
- ein weiteres Treffen notwendig ist, um konkrete Ansätze zu entwickeln<br />
Vorbereitungstreffen<br />
Zeit(raum) 19.09.2001 (Vorbesprechung)<br />
Beteiligte Bürgermeister, <strong>Wirtschaft</strong>sförderer Kirchen, <strong>Agenda</strong>-Beauftragte, B.A.U.M., Vertreter<br />
der <strong>Wirtschaft</strong><br />
59
Ergebnisse<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Man hat sich darauf geeinigt, dass zu folgenden Themen<br />
- Personalplanung<br />
- Firmenkooperationen<br />
- Energie- u. Ressourceneffizienz<br />
- Verbesserung der Verkehrsituation<br />
- Telearbeitsplätze<br />
Kurzvorträge von lokalen <strong>Wirtschaft</strong>sakteuren gehalten werden sollen. Und diese<br />
anschließend in Arbeitsgruppen diskutiert werden sollen.<br />
Arbeitstreffen - 2. Sitzung AK Nachhaltig <strong>Wirtschaft</strong>en<br />
Zeit(raum)<br />
Beteiligte<br />
Ergebnisse<br />
28.09.2001 (Arbeitstreffen)<br />
Bürgermeister, <strong>Agenda</strong>-Beauftragte, ca. 20 Personen überwiegend aus Betrieben,<br />
Moderation: B.A.U.M.<br />
Nach fünf Kurzvorträgen wurden drei Arbeitsgruppen gebildet zu folgenden Themenbereichen:<br />
- Energie- u. Ressourceneffizienz<br />
- Mobilität / Verkehr<br />
- Qualifizierung / Firmenkooperationen<br />
Die Arbeitsgruppen haben in vorbereiteten Arbeitsblättern jeweils Details zu den<br />
Zielsetzungen, Voraussetzungen <strong>und</strong> der Umsetzung konkreter Projektaktivitäten<br />
festgehalten <strong>und</strong> weitere Arbeitstreffen konkretisiert.<br />
Arbeitstreffen<br />
Zeit(raum) <strong>21</strong>.11.2001<br />
Beteiligte Bürgermeister, <strong>Agenda</strong>-Beauftragte, ca. 15 Personen überwiegend aus Betrieben,<br />
Moderation: B.A.U.M.<br />
Ergebnisse Die Fa. tmp.worldwide stellte ihre Ideen zum Aufbau eines Internet-Portals <strong>für</strong> die<br />
Fa. Wolf-Garten vor.<br />
Man hat sich darauf geeinigt, dass ....<br />
- ein Internet-Portal <strong>für</strong> die Region wünschenswert wäre, um die Stärken der<br />
Region herauszustellen <strong>und</strong> über eine Jobbörse Arbeitskräfte zu gewinnen.<br />
- Die Verknüpfung mit der derzeit stattfindenden Stärken-Schwächen-Analyse<br />
(Projekt des Landkreises Altenkirchen, Durchführung Frau Prof. Funke, FH<br />
Mainz) soll gesucht werden.<br />
Elefantenr<strong>und</strong>e“ – Zwischenabstimmung mit der LZU<br />
Zeit(raum) 17.1.2002<br />
Beteiligte LZU, Bürgermeister, <strong>Agenda</strong>beauftragte, <strong>Wirtschaft</strong>sförderer, Beigeordneter,<br />
B.A.U.M.<br />
Ergebnisse - Gute Beispiele aufbereiten<br />
- Vorschläge <strong>für</strong> Exkursionen unterbreiten<br />
- Moderation eines Arbeitskreises je Modellkommune<br />
60
Arbeitstreffen - 3. Sitzung AK Nachhaltig <strong>Wirtschaft</strong>en<br />
Zeit(raum)<br />
Beteiligte<br />
Ergebnisse<br />
23.01.2002<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Bürgermeister, <strong>Agenda</strong>-Beauftragte, ca. 20 Personen überwiegend aus Betrieben,<br />
Moderation: B.A.U.M.<br />
Man hat sich darauf geeinigt, dass ....<br />
- das Vorhaben „Internet-Plattform“ gemeinsam mit der Verbandsgemeinde<br />
Kirchen realisiert werden soll, da hier bereits eine Jobbörse besteht.<br />
- die bestehende Personalleiterr<strong>und</strong>e der großen Unternehmen am Ort in die<br />
Diskussion eingeb<strong>und</strong>en werden soll.<br />
Energieforum<br />
Zeit(raum) 13.03.2002<br />
Beteiligte Bürgermeister, 3 Referenten, ca. 10 Aussteller von Energiesystemen, ca. 100<br />
Besucher<br />
Ergebnisse Informationsveranstaltung mit Fachvorträgen<br />
Man hat sich darauf geeinigt, dass ....<br />
- den Betrieben eine kostenlose Energieberatung angeboten wird.<br />
Informationsgespräch der Modellkommunen<br />
Zeit(raum) 27.8.2002<br />
Beteiligte <strong>Agenda</strong>beauftragte, LZU<br />
Ergebnisse - Reflexion des bisher Erreichten<br />
- Empfehlungen <strong>für</strong> Projektabschlussphase<br />
Arbeitstreffen<br />
Zeit(raum) <strong>21</strong>.10.2002<br />
Beteiligte <strong>Agenda</strong>-Beauftragte, B.A.U.M.<br />
Ergebnisse Man hat sich darauf geeinigt, dass ....<br />
- der Abschluss des Modellprojektes am 10.12.2002 gleichzeitig als Zwischenbilanz<br />
der weiteren Arbeiten in der Region gestaltet wird.<br />
Veranstaltung „Ergebnisse <strong>und</strong> Ausblick“<br />
Zeit(raum) 10.12.2002<br />
Beteiligte Bürgermeister, <strong>Agenda</strong>-Beauftragte, knapp 40 Personen überwiegend aus Betrieben,<br />
Moderation: B.A.U.M.<br />
Ergebnisse Man hat sich darauf geeinigt, dass ....<br />
- die Ergebnisse Mut machen <strong>und</strong> interessante Anknüpfungspunkte bieten.<br />
- der Prozess einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Verbandsgemeinden<br />
<strong>und</strong> der örtlichen <strong>Wirtschaft</strong> auch nach Beendigung des Modellprojektes<br />
weitergeführt werden soll.<br />
61
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Abschlussbesprechung<br />
Zeit(raum) 22.01.2003<br />
Beteiligte Bürgermeister, <strong>Agenda</strong>-Beauftragte, weitere Mitarbeiter der Verwaltungen aus<br />
den VGen, B.A.U.M.<br />
Ergebnisse Man hat sich darauf geeinigt, dass ....<br />
- die Ergebnisse des Projektes an geeigneten Stellen publiziert werden sollen.<br />
- der Prozess der Kooperation mit der <strong>Wirtschaft</strong> weitergeführt werden soll.<br />
- der gemeinsame Internetauftritt weiter vorangetrieben wird. Die Betriebe sind<br />
nach Fertigstellung <strong>und</strong> Freischaltung intensiv zu informieren <strong>und</strong> einzubinden.<br />
- von den VGen Mittel <strong>für</strong> weitere 10 Energieberatungen in Betrieben zur Verfügung<br />
gestellt werden.<br />
- der Kirchener Energie-Arbeitskreis mit dem Energie-Arbeitskreis des Modellprojektes<br />
verzahnt wird.<br />
- seitens der VG Kirchen Frau Lieth die Koordinationsfunktion im Rahmen der<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> beibehalten wird.<br />
- seitens der VG Betzdorf Herr Becher die Koordinationsfunktion im Rahmen<br />
der <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> übernehmen wird.<br />
- In regelmäßigen Abständen (z.B. halbjährlich) gemeinsame Arbeitskreistreffen<br />
vorgesehen werden, um die bisherigen Aktivitäten zu bilanzieren <strong>und</strong><br />
neue Aktivitäten zu planen.<br />
- der gemeinsame Auftritt der beiden VGen verbessert wird (u.a. durch einen<br />
gemeinsamen Briefkopf).<br />
Zwischen <strong>und</strong> nach diesen Treffen fanden vor Ort noch mehrere kleinere Arbeitstreffen der<br />
einzelnen AGs statt, bei denen der Berater von B.A.U.M. nicht vor Ort vertreten war.<br />
9.1.2 VG Kandel<br />
Die Veranstaltungen <strong>und</strong> deren Ergebnisse im Einzelnen:<br />
1. Vorbesprechung mit der LZU<br />
Zeit(raum) 9.10.2000<br />
Beteiligte LZU, B.A.U.M.<br />
Ergebnisse - Klärung des Auftrags / Vertrags<br />
- Durchführung eines zweistufigen Verfahrens zur Auswahl der Modellkommunen<br />
2. Vorbesprechung mit der LZU<br />
Zeit(raum) 22.1.2001<br />
Beteiligte LZU, B.A.U.M.<br />
Ergebnisse - Abstimmung über generelle Zielsetzung(en)<br />
- Festlegung des Arbeitsprozesses<br />
Erstellung einer Projektkonzeption<br />
62
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Auftaktbesprechung <strong>und</strong> Präsentation des Modellvorhabens in der Region<br />
Zeit(raum) 27.3.2001<br />
Beteiligte Bürgermeister, VG Mitarbeiter, Stadtmarketingbeauftragter, Unternehmer, <strong>Agenda</strong>beauftragte,<br />
BGM Erlenbach, Rheinpfalz-Zeitung, Moderation: B.A.U.M.<br />
Ergebnisse - Projektfahrplan wurde angenommen<br />
- Zwei vorbereitende Veranstaltungen im Frühjahr/Sommer 2001<br />
- Betriebsbefragung wird in Stadtmarketingumfrage integriert<br />
- Projektergebnisse im Bereich Direkt-/Regionalvermarktung angestrebt<br />
- Auftaktveranstaltung <strong>für</strong> Sommer 2001 angestrebt<br />
Vorbesprechung mit VertreterInnen der LA <strong>21</strong> / Umweltausschuss<br />
Zeit(raum) 10.5.2001<br />
Beteiligte Bürgermeister, <strong>Agenda</strong>beauftrage. Mitglieder des Umweltausschusses, <strong>Agenda</strong><br />
<strong>21</strong>-Vertreter, B.A.U.M.<br />
Ergebnisse - Direkt-/Regionalvermarktung erörtert<br />
- Prozessverlauf Modellvorhaben <strong>und</strong> Stadtmarketing abstimmen<br />
- Modellvorhaben soll Beitrag zu Dorferneuerungskonzepten liefern<br />
- Neu-Definition des <strong>Agenda</strong>beirats angestrebt<br />
Vorbesprechung mit <strong>Wirtschaft</strong>svertretern<br />
Zeit(raum) 5.7.2001<br />
Beteiligte Bürgermeister, <strong>Agenda</strong>beauftragte, Stadtmarketingbeauftragter, <strong>Wirtschaft</strong>s- <strong>und</strong><br />
andere Interessensvertreter, Moderation: B.A.U.M.<br />
Ergebnisse - Auftakt als Abendveranstaltung, ca. 4 Std.<br />
- Präsentationen: Gute Beispiele (B.A.U.M.), lokale Firmen<br />
- Einladung via VG <strong>und</strong> Verein <strong>für</strong> Handel <strong>und</strong> Gewerbe <strong>und</strong> die Bauern <strong>und</strong><br />
Winzerschaft, sowie durch persönliche Ansprache<br />
Öffentliche Auftaktveranstaltung<br />
Zeit(raum) 19.10.2001<br />
Beteiligte Bürgermeister, LZU, <strong>Agenda</strong>beauftragte, VG Mitarbeiter, Unternehmensvertreter,<br />
Moderation: B.A.U.M.<br />
Ergebnisse - Zwei Arbeits- /Projektgruppen gebildet:<br />
- „<strong>Lokale</strong>s Ressourcen-Netzwerk“ <strong>und</strong><br />
- „Nachhaltig Leben <strong>und</strong> Arbeiten in der VG Kandel“<br />
- Beide Arbeitsgruppen zusammen bilden den Arbeitskreis „Nachhaltig <strong>Wirtschaft</strong>en“<br />
dessen nächstes Treffen <strong>für</strong> den: 26.11.2001 angesetzt wurde<br />
63
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
1. Treffen der AK Nachhaltiges <strong>Wirtschaft</strong>en<br />
Zeit(raum) 26.11.2001<br />
Bürgermeister, <strong>Agenda</strong>beauftragte, Unternehmer, Moderation: B.A.U.M.<br />
Beteiligte<br />
Ergebnisse - Präsentation guter Beispiele <strong>für</strong> Ressourcenvernetzung vorbereiten<br />
- Entwurf eines E-Newsletters „Nachhaltig <strong>Wirtschaft</strong>en in Kandel“<br />
- Teilnehmer organisieren einen Pressetermin <strong>und</strong> werben bei weiteren Unternehmen<br />
um Unterstützung<br />
- Termin <strong>für</strong> nächste gemeinsame Sitzung der beiden Arbeitsgruppen,<br />
28.1.2002<br />
„Elefantenr<strong>und</strong>e“ – Zwischenabstimmung mit der LZU<br />
Zeit(raum) 17.1.2002<br />
Beteiligte LZU, Bürgermeister, <strong>Agenda</strong>bauftragte, <strong>Wirtschaft</strong>sförderer, Beigeordneter,<br />
B.A.U.M.<br />
Ergebnisse - Gute Beispiele aufbereiten<br />
- Vorschläge <strong>für</strong> Exkursionen unterbreiten<br />
- Moderation eines Arbeitskreises je Modellkommune<br />
2. Treffen des AK Nachhaltiges <strong>Wirtschaft</strong>en<br />
Zeit(raum) 28.1.2002<br />
Beteiligte Bürgermeister, <strong>Agenda</strong>beauftragte, Unternehmensvertreter, Moderation:<br />
B.A.U.M.<br />
Ergebnisse AG <strong>Lokale</strong>s Ressourcennetzwerk:<br />
- Einladung weiterer interessierter Personen zur Vorbereitung der geplanten<br />
öffentlichen Fachtagung “Zukunftsressourcen Holz-/Biomasse”<br />
- Besuch des Landauer Forums <strong>für</strong> Erneuerbare Energien” (11.3.2002) durch<br />
die <strong>Agenda</strong>bauftragte<br />
- Prüfung der Realisierungschancen zur Nutzung der Abwärme eines Blockheizkraftwerkes<br />
in Verbindung mit der geplanten Faulschlammkläranlage<br />
- Evtl. Exkursion Kandeler KfZ-Häuser zum “Ökoeffizienz-Netz KfZ” in Karlsruhe<br />
AG “Nachhaltig Arbeiten <strong>und</strong> Leben”:<br />
- Statt einer Ausbildungsmesse wird ein “Tag der offenen Tür”: Arbeitgeber der<br />
VG Kandel stellen sich vor” veranstaltet. Partner sind das Arbeitsamt, Bildungsträger,<br />
der Verein <strong>für</strong> Gewerbe <strong>und</strong> Handel, die VG <strong>und</strong> die Stadt Kandel<br />
- Durchführung einer Fragebogenaktion um das Interesse bei lokalen Betrieben<br />
zu eruieren<br />
- Prüfung, ob E-Newsletter Nachhaltiges <strong>Wirtschaft</strong>en evtl. Verbandsgemeindeübergreifend<br />
realisiert werden kann<br />
- nä. Termin 20.3.2002<br />
64
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
3. Treffen der AG „Nachhaltig Arbeiten <strong>und</strong> Leben“<br />
Zeit(raum) 19.3.2001<br />
Beteiligte Bürgermeister, <strong>Agenda</strong>beauftragte, Unternehmensvertreter, Arbeitsamt etc.<br />
Ergebnisse - Rücklauf der Fragebogenaktion war ermutigend<br />
- Termin <strong>für</strong> Tag der offenen Tür ”Arbeitgeber der VG Kandel stellen sich vor”<br />
13./14. September 2002<br />
- Nachfassen durch persönliche Ansprache wegen Beteiligung der Betriebe<br />
- Aufruf zur Beteiligung im Amtsblatt, Plakatentwurf mit <strong>Agenda</strong>logo, Pressengespräch<br />
3. Treffen der AG „<strong>Lokale</strong>s Ressourcennetzwerk“<br />
Zeit(raum) 20.3.2001<br />
Beteiligte Bürgermeister,<br />
B.A.U.M.<br />
<strong>Agenda</strong>beauftragte, Unternehmensvertreter, Moderation:<br />
Ergebnisse - Vorstellung guter Beispiele aus dem Bereich Holz-Ressourcen-Netzwerke<br />
- Bericht vom Forum “Erneuerbare Energien” in Landau<br />
- evtl. Exkursion nach VG Weilerbach<br />
- Zusammenführung der AG mit dem AK Energie <strong>und</strong> Klimaschutz der LA <strong>21</strong><br />
4. Treffen der AG „<strong>Lokale</strong>s Ressourcennetzwerk“<br />
Zeit(raum) 10.4.2002<br />
Beteiligte Bürgermeister, <strong>Agenda</strong>beauftragte, Unternehmensvertreter<br />
Ergebnisse - Zielkonkretisierung <strong>für</strong> die geplante(n) Veranstaltung zum Thema „Nachhaltige<br />
Holznutzung“<br />
- Sensibilisierung von politischen Entscheidungsträgern, betroffenen Verwaltungsmitarbeitern,<br />
Großabnehmern, Architekten etc.<br />
- Durchführung eines Workshops „Holz als Energieträger“<br />
- 2. Öffentliche Informationsveranstaltung zum Thema „Heizen mit Holz, Holz<br />
als Baustoff“<br />
5. Treffen der AG „<strong>Lokale</strong>s Ressourcennetzwerk“<br />
Zeit(raum) 23.4.2002<br />
Beteiligte Bürgermeister, <strong>Agenda</strong>beauftragte, Unternehmensvertreter<br />
Ergebnisse - Festlegung über Ziele, Zielgruppen, Art <strong>und</strong> Ablauf der Veranstaltung, Referenten,<br />
Moderation, Ort, Dauer des geplanten Workshops „Nachhaltige Holznutzung“<br />
- Klärung von Aufgaben<br />
65
Informationsgespräch der Modellkommunen<br />
Zeit(raum) 27.8.2002<br />
Beteiligte <strong>Agenda</strong>beauftragte, LZU<br />
Ergebnisse - Reflexion des bisher Erreichten<br />
- Empfehlungen <strong>für</strong> Projektabschlussphase<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
3. Treffen des AK „Nachhaltiges <strong>Wirtschaft</strong>en“<br />
Zeit(raum) 10.12.2002<br />
Beteiligte Bürgermeister, <strong>Agenda</strong>beauftragte, Unternehmensvertreter<br />
Ergebnisse - Rückblickende Bewertung der Erfahrungen mit dem Modellvorhaben<br />
- Einigung über weitere Aktivitäten<br />
- Zusammenführung der Arbeitsgruppe „<strong>Lokale</strong>s Ressourcennetzwerk“ mit<br />
dem LA <strong>21</strong>-Arbeitskreis „Energie <strong>und</strong> Klimaschutz“ als AK „Nachhaltiges<br />
<strong>Wirtschaft</strong>en“ geplant<br />
Zwischen <strong>und</strong> nach diesen Treffen fanden vor Ort noch mehrere kleinere Arbeitstreffen der<br />
einzelnen AGs statt, bei denen der Berater von B.A.U.M. nicht vor Ort vertreten war.<br />
66
9.2 Stabilisierungsbedingungen<br />
1. Politische Einbindung & Relevanz<br />
• Legitimation des Verfahrens<br />
• Legitimation der Beteiligten<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
• Politisches „Gewicht“: Anerkennung der LA <strong>21</strong> als zentrales kommunales Projekt<br />
2. Thematische Integration<br />
• Verknüpfung von ökonomischen, ökologischen, <strong>und</strong> sozialen Anliegen<br />
• Verknüpfung mit anderen strukturbestimmenden Politikprozessen<br />
• Verknüpfung mit zentralen lokalen Problemlagen<br />
• Etablierung neuer Instrumente der „Querschnittspolitik“ in der Verwaltung<br />
3. Vernetzung gesellschaftlicher Akteursgruppen<br />
• Beteiligung aller gesellschaftlich relevanten organisierten Akteure<br />
• Vernetzung mit bestehenden Strängen/Netzwerken gesellschaftlichen Engagements<br />
4. Effizientes Prozessmanagement<br />
• Hinreichende finanzielle <strong>und</strong> personelle Ressourcen<br />
• Vernetzende Organisationsstruktur<br />
• Effizientes Wissens- <strong>und</strong> Vernetzungsmanagement<br />
• Professionelle Prozessmoderation<br />
• Transparenz & verlässliche Informationen<br />
• Reflexive Verfahren der Selbstbeobachtung <strong>und</strong> Selbstkorrektur<br />
5. Aufklärung & Popularisierung<br />
• Öffentliche Sichtbarkeit<br />
• Attraktive Verbreitung<br />
• Bewusstseinsbildung<br />
6. Partizipation & bürgerschaftliches Engagement<br />
• Breite Bürgerbeteiligung im Rahmen neuer Partizipationsformen<br />
• Ausgleich von Machtgefälle<br />
• Förderung bürgerschaftlichen Engagements<br />
7. Regionale & überregionale Vernetzung<br />
• Regionale Vernetzung<br />
• Nationaler <strong>und</strong> internationaler Erfahrungsaustausch<br />
• <strong>Agenda</strong>-Städtepartnerschaften<br />
8. Nachhaltigkeits-Controlling<br />
• Nachhaltigkeitsindikatoren<br />
• Monitoringsysteme<br />
• Nachhaltigkeitsberichte<br />
• Regelmäßige Evaluation der Zielerreichung<br />
• Regelmäßige Anpassung von Zielen, Indikatoren <strong>und</strong> Maßnahmen<br />
9. Unterstützende politische Rahmenbedingungen<br />
• Sichtbarkeit eines nationalen Nachhaltigkeitsdiskurses (Nachhaltigkeitsplan etc.)<br />
• Unterstützung lokaler <strong>Agenda</strong>-Prozesse durch die Landesregierungen<br />
Tab. 1: Allgemeine Stabilisierungsbedingungen .<br />
Quelle: MPS, B.A.U.M., Universität Bremen, ZWE Arbeit <strong>und</strong> Region (2001): „Bedingungen institutioneller Stabilisierung<br />
lokaler <strong>Agenda</strong><strong>21</strong> Prozesse – Modellhafte Stabilisierungspfade“, Bericht einer von der Deutschen B<strong>und</strong>esstiftung Umwelt<br />
finanzierten Studie, München/Berlin, S. 47<br />
67
Politische<br />
Einbindung<br />
& Relevanz<br />
Vernetzung<br />
von Akteuren<br />
Partizipation &<br />
bürgerschaftl.<br />
Engagement<br />
Thematische<br />
Integration<br />
<strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> <strong>und</strong> <strong>Wirtschaft</strong> in Rheinland-Pfalz<br />
Aufklärung &<br />
Popularisierung<br />
Regionale &<br />
überregionale<br />
Vernetzung<br />
Unterstützende politische Rahmenbedingungen<br />
Effizientes<br />
Prozessmanagement<br />
Nachhaltigkeitscontrolling<br />
Abb. 3: Stabilisierungsbedingungen der <strong>Lokale</strong>n <strong>Agenda</strong> <strong>21</strong> im Zusammenhang.<br />
Quelle: MPS, B.A.U.M., Universität Bremen, ZWE Arbeit <strong>und</strong> Region (2001):<br />
„Bedingungen institutioneller Stabilisierung lokaler <strong>Agenda</strong><strong>21</strong> Prozesse –<br />
Modellhafte Stabilisierungspfade“, Bericht einer von der Deutschen B<strong>und</strong>esstiftung<br />
Umwelt finanzierten Studie, München/Berlin, S. 51<br />
68