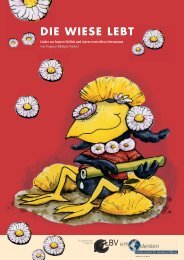90 Dreifaltigkeitssonntag / Trinitatis 07.06.09 nachhaltig predigen 11 ...
90 Dreifaltigkeitssonntag / Trinitatis 07.06.09 nachhaltig predigen 11 ...
90 Dreifaltigkeitssonntag / Trinitatis 07.06.09 nachhaltig predigen 11 ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>90</strong><br />
Joh 3, 1-8 (9-15)<br />
Röm 8, 14-17<br />
<strong>07.06.09</strong><br />
Wer an den Gott des<br />
Lebens, der Gerechtigkeit, des<br />
Friedens, den Schöpfergott<br />
glaubt, bei dem muss eine<br />
radikale Veränderung im<br />
Leben sichtbar werden.<br />
<strong>Dreifaltigkeitssonntag</strong> / <strong>Trinitatis</strong><br />
ev. Reihe I: Joh 3, 1-8 (9-15) kath. 1. L.: Dtn 4, 32-34.39-40 kath. 2. L.: Röm 8, 14-17 kath. Evang.: Mt 28, 16-20<br />
14.06.09<br />
Der Autor betrachtet die ev. Predigtperikope und den Text zur 2. kath. Lesung.<br />
Stichworte zur Nachhaltigkeit: radikale Veränderung, keine nächtlichheimlichen<br />
Lippenbekenntnisse, Engagement für Nachhaltigkeit beweist keinen<br />
Glauben, Leben im Geist Jesu bzw. Nachfolge ist ohne Engagement aber nicht möglich<br />
<strong>Trinitatis</strong> / Gottesbeziehung<br />
Der Sonntag <strong>Trinitatis</strong> /<strong>Dreifaltigkeitssonntag</strong><br />
bietet sicherlich Gelegenheit, Überlegungen<br />
über die inner-trinitarischen Beziehungen<br />
anzustellen. Der Evangelist Johannes und mit<br />
ihm Paulus in seinem Römerbrief schlagen<br />
ein anderes Thema für den Sonntag vor. Sie<br />
zeigen die Bedeutung der Dreifaltigkeit für<br />
unsere Gottesbeziehung auf.<br />
Der Pharisäer Nikodemus kommt nachts zu<br />
Jesus, um ihm gegenüber zu bekennen, dass<br />
„du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen<br />
ist“ (Joh 3, 2). Die ausdrückliche Erwähnung,<br />
dass er nachts zu Jesus kommt, ist dabei entscheidend<br />
für die Qualität seines Bekenntnisses<br />
zu Jesus. Es bleibt ein theoretisches Bekenntnis,<br />
das keinerlei Auswirkungen für sein Leben<br />
haben soll. Diese Situation kennen wir zur Genüge.<br />
Zu den Zielen Frieden, Gerechtigkeit und<br />
Bewahrung der Schöpfung bekennt sich<br />
inzwischen fast jeder in unserer Gesellschaft.<br />
Aber diese „Sonntagsreden“ haben manchmal<br />
(?)/häufig (?) keine konkreten Konsequenzen<br />
– sowohl auf privater als auch auf politischer<br />
Ebene. „Warum soll ich der Umwelt zuliebe<br />
langsamer fahren, wenn mich alle anderen<br />
dabei überholen? Wenn es alle machen würden,<br />
z. B. weil es ein Gesetz so vorschreibt,<br />
würde ich mich natürlich daran halten.“ „Natürlich<br />
treten wir für den Schutz der Erde ein,<br />
aber bitte nicht mit strengen CO 2-Grenzwer-<br />
<strong>11</strong>. Sonntag im Jahreskreis / 1. Sonntag nach <strong>Trinitatis</strong><br />
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong><br />
ten, die unsere Automobilindustrie schädigen.“<br />
„Wenn wir die Waffen nicht liefern, dann<br />
liefert sie ein anderes Land – zum Schaden für<br />
unsere Wirtschaft.“<br />
Solche „frommen“ Bekenntnisse ohne Konsequenzen<br />
sind nach Ansicht von Jesus nichts<br />
wert. Wer an den Gott des Lebens, der Gerechtigkeit,<br />
des Friedens, den Schöpfergott glaubt,<br />
bei dem muss eine radikale Veränderung im<br />
Leben sichtbar werden: „Wenn jemand nicht<br />
von Neuem geboren wird, kann er das Reich<br />
Gottes nicht sehen“(Joh 3, 3). Paulus stellt<br />
fest: „Alle, die sich vom Geist Gottes leiten<br />
lassen, sind Söhne Gottes. ... Ihr habt nicht<br />
einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven<br />
macht ..., sondern ... der euch zu Söhnen<br />
macht“ (Röm 8, 14-15).<br />
Werke der Nächstenliebe, Engagement für<br />
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der<br />
Schöpfung werden so nicht zum Beweis des<br />
Gottesglaubens – denn sie könnten ja auch<br />
aus ganz anderer Motivation geschehen, sondern<br />
sie sind unverzichtbarer Bestandteil des<br />
Lebens aus Gottes Geist, ohne sie bleiben wir<br />
ein Nikodemus. Nachfolge in dem Geist<br />
Gottes heißt, sich auf Jesu Vertrauen, das<br />
„Vom-Vater-her-Sein und zum-Vater-hin-<br />
Sein“, auf „den Geist, in dem wir rufen:<br />
Abba, Vater“ (Röm 8, 15), einzulassen.<br />
ev. Reihe I: Lk 16, 19-31 kath. 1. L.: Ez 17, 22-24 kath. 2. L.: 2 Kor 5, 6-10 kath. Evang.: Mk 4, 26-34<br />
Der Verfasser betrachtet alle Predigtperikopen des Sonntags. Stichworte zur<br />
Nachhaltigkeit: die Bereitschaft zum vorausschauenden Denken, Werte- statt<br />
Güterorientierung, andere Kulturen wahrnehmen, nicht nur im Hin-blick auf<br />
ihre finanziellen Ressourcen (Lk 16); in der Schöpfung steckt Gottes herrschaftlicher<br />
Wille zum Heil (für alle), das hat für uns Maßstab zu sein (Ez 17);<br />
Christen sind frei, zu gestalten, sie sind glaubensgemäß nicht materiellen<br />
Zwängen unterworfen, Altenheime / Gesundheitsreform (2 Kor 5); wir haben<br />
kein Recht auf Erfolg unserer Bemühung, Allmachtsgedanken schaden (Mk 4)<br />
Thomas Kupczik, Trier<br />
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong>
Predigttext (evang.): Lk 16, 19 - 31<br />
Exegetische Beobachtungen<br />
Es handelt sich um eine der großen<br />
Beispielerzählungen im Lukasevangelium, in<br />
der gleichen Weise gestaltet wie die Gleichnisse<br />
vom barmherzigen Samariter oder vom<br />
verlorenen Sohn. Der Evangelist behandelt hier<br />
das Thema Arm und Reich und die verderbliche<br />
Rolle des Besitzes fürs Seelenheil. Er<br />
greift auf einen Erzählstoff zurück, der den<br />
Zeitgenossen wohl vertraut war und in zahlreichen<br />
Varianten kursierte: ein ägyptisches<br />
Märchen berichtet z. B. von der Fahrt des<br />
Setme Chamois ins Totenreich, wo der Reiche<br />
sich plötzlich in der finsteren Unterwelt wieder<br />
findet, während der Arme, ausgestattet<br />
mit Ehrengewändern und Luxus, seinen Platz<br />
beim Gott Osiris einnehmen darf, der überdies<br />
befohlen hatte, ihm die Grabausstattung<br />
des Reichen zu schenken. „Gib, so rettest du<br />
dich; behalte und genieße, so verdirbst du“,<br />
lautet die einfache Moral dieser Erzählungen.<br />
Bei Lukas hat die Geschichte eine zweite<br />
Pointe: Der Reiche bittet Abraham, er möge<br />
doch seine fünf Brüder vor dem Verhängnis<br />
warnen, das ihn betroffen hat. Abraham lehnt<br />
ab unter Hinweis auf Mose und die Propheten.<br />
Theologische Wertung<br />
Die Beispielerzählung beginnt mit dem<br />
altbekannten Problem der Theodizee: Die verschiedenen<br />
Lebenswege geben unserem Gerechtigkeitsempfinden<br />
Rätsel auf. Damit Gott<br />
nicht ungerecht oder machtlos erscheint,<br />
wird ein Ausgleich des erlittenen Unrechts<br />
notwendig. Dies geschieht direkt nach dem<br />
Tod durch Umkehrung der Verhältnisse: Der<br />
arme Lazarus wird erhöht, der Reiche erniedrigt.<br />
So kann Gott gerecht, gütig und zugleich<br />
allmächtig bleiben, und unser moralisches<br />
Ver-halten behält Bedeutung für das<br />
Ergehen: Wer zu Lebzeiten nur bequem war<br />
und die Nächstenliebe versäumt hat, wird<br />
dafür zur Rechenschaft gezogen. Dabei muss<br />
die himmlische Vergeltung ebenso unerbittlich<br />
verfahren wie Gott es auf Erden macht.<br />
Die verspätete Einsicht des Reichen kann so<br />
weder ihm, noch seinen lebenden Brüdern<br />
helfen. Die Wahrheit über das rechte Leben<br />
war ihnen ja durch Gesetz und Propheten<br />
bekannt. Ihre Blindheit zu Lebzeiten erklärt<br />
sich aus der verderblichen Wirkung von Geld<br />
und Reichtum auf die Menschen. Der Satz<br />
„Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr…“<br />
beschreibt ein Grundanliegen des Evangelisten.<br />
Nachhaltige Aspekte<br />
Die Lazaruserzählung kann als Appell an<br />
unsere Fähigkeit zu vorausschauendem Denken<br />
interpretiert werden, weil sie die Fernwirkungen<br />
aktuellen Fehlverhaltens drastisch<br />
beschreibt. Das Problem der „Reichen“ ist<br />
nicht ihr Mangel an Wissen, sondern ihr<br />
Mangel am Willen, ihr Leben in einen Horizont<br />
tätiger Nächstenliebe zu stellen. Ihr Verhalten<br />
zeugt nicht nur von Egoismus, sondern<br />
offenbart Kleinglauben: Dass mit einer<br />
Verantwortung auch die Kraft wächst, übersteigt<br />
ihren Horizont. Lieber hält man sich<br />
ans Gegebene. Was man dabei übersieht, kann<br />
auch nicht verunsichern, stört nicht das<br />
gemütliche Beisammensein. Lazarus, der krank<br />
vor der Tür lag, war der abgewiesene Anruf<br />
Gottes zur Umkehr. Gegen solche Lieblosigkeit<br />
richtet selbst das Evangelium vom<br />
auferstandenen Christus nichts aus. Das<br />
Übersehen von Not wird heute allerdings<br />
dem leicht gemacht, der sein Interesse auf<br />
Kommerzfernsehen, Boulevard und den engsten<br />
Familienkreis beschränkt. Doch kann<br />
sich der besinnungslose Konsumhedonist vor<br />
den Folgen seines Tuns oder Nichthandelns<br />
ebenso wenig drücken wie der Reiche in<br />
unserer biblischen Erzählung: Wenn Raubüberfälle<br />
in der Stadt zunehmen, wenn<br />
immer mehr Flüchtlinge und Armutsmigranten<br />
ankommen, die in seiner Nachbarschaft<br />
untergebracht und mit seinen Steuergeldern<br />
versorgt werden müssen, werden ihm<br />
die Versäumnisse seiner Zeit und ihrer politischen<br />
Vertreter vielleicht bewusst.<br />
Dem erzählenden Jesus geht es um die<br />
Sinnausrichtung unseres Daseins: Sollen Werte<br />
das Leben bestimmen oder Interessen? Nach<br />
Edmund Husserl sind Werte die letzten<br />
Zufluchtsorte von Transzendenz in unserer<br />
modernen Welt. Sie schützen vor Verdinglichung<br />
und Entfremdung in einer anonym<br />
gewordenen, an Effizienz und Kapitalverwertungskriterien<br />
ausgerichteten Warenwelt.<br />
Werte motivieren zu einem Lebensstil, der<br />
unsere enge Lebenswelt „überschreitet“. Erich<br />
Fromm hat dem Existenzmodus des „Habens“<br />
ein Konzept der „Seinsorientierung“ gegenüber<br />
gestellt. Statt besitzen, herrschen, kontrollieren<br />
zu wollen, was in der Konsequenz<br />
14.06.09<br />
Lk 16, 19-31<br />
Der besinnungslose<br />
Konsumhedonist kann sich<br />
vor den Folgen seines Tuns<br />
oder Nichthandelns ebenso<br />
wenig drücken wie der<br />
Reiche in unserer biblischen<br />
Erzählung.<br />
91
92<br />
14.06.09<br />
Gerodete Wälder können<br />
neu gepflanzt werden,<br />
ausgeräumte Landschaften<br />
neu erblühen,<br />
wenn wir es nur wollen.<br />
Ez 17, 22-24<br />
2 Kor 5, 6-10<br />
zu unlösbaren Konflikten führt, soll der<br />
Mensch im „Seinsmodus“ seine kreativen Fähigkeiten<br />
entfalten, Interesse am Gestalten entwickeln,<br />
seine Freude am gemeinsamen Erreichen<br />
von Zielen haben. Im Mittelpunkt steht<br />
die Gemeinschaft durch Lieben und Geben.<br />
Werte benötigen keinen Platz und verbrauchen<br />
keine Ressourcen. Sie vermehren sich<br />
durch Weitergabe, während Güter sich durch<br />
Weggabe verknappen. Demokratie wäre so<br />
ein segensreiches Werte-Geschenk für viele<br />
Länder Afrikas. Die dort herrschenden<br />
Diktaturen behindern die Entwicklung <strong>nachhaltig</strong>.<br />
Da durch Korruption viel Geld verloren<br />
geht, wären Regeln und Methoden des<br />
„good government“ dringlicher und wertvoller<br />
als mancher Millionenbetrag an Entwicklungshilfe.<br />
Die Weitergabe von Werten<br />
macht allerdings mehr Mühe als die Überweisung<br />
von Geld und ist langwieriger als<br />
ein Gütertransport in Krisengebiete. Wenn<br />
wir Bildungsstätten gründen, Experten<br />
schicken und auf Lernprozesse setzen, hilft<br />
das gegen Fehlhaltungen und Unwissen <strong>nachhaltig</strong>.<br />
Wenn wir uns auch selbst öffnen können<br />
für Wissen und Erfahrungen anderer; wenn<br />
wir die Errungenschaften von Kulturen, die<br />
uns fremd sind, respektieren können, lernen<br />
und gewinnen wir ebenso. Anzustreben ist<br />
nicht die Anpassung aller Menschheitskulturen<br />
an den westlichen Lebensstil, sondern<br />
eine Konvergenz, die allen historisch<br />
gewordenen Eigenheiten das jeweils Beste<br />
abgewinnt und aufhebt in einer gemeinsamen<br />
Zukunft. An vielem lässt sich sparen,<br />
nur nicht am Denken. Lukas würde sich freuen,<br />
wenn seine Warnung vor den Suchtgefahren<br />
des Reichtums gehört würde.<br />
1. Lesung (kath.): Ez 17, 22 - 24<br />
Theologische Wertung<br />
Der Text gehört zu den Unheilsankündigungen<br />
Ezechiels. Seine Drohworte münden<br />
in das Bekenntnis zu dem einen Gott, der<br />
alles geschaffen hat und heute noch die Völkerwelt<br />
regiert. Er hat den Untergang Israels<br />
herbeigeführt, doch dies ist nicht sein letztes<br />
Wort. Ezechiel, der seine umfassende Geschichtsschau<br />
aus exilischer Perspektive entwirft,<br />
löst Israel vom Tempelkult, indem er<br />
verkündet, Gott könne an jedem Ort verehrt<br />
werden. Statt durch den Tempelkult am Zion<br />
wird Israels Identität künftig nur noch durch<br />
Wort und Geist Jahwes gestiftet. Veranschaulicht<br />
wird dies durch eine Zeichenhandlung:<br />
Gott pflückt ein Reis von einer Zeder und<br />
pflanzt es an einem anderen Ort wieder ein.<br />
Nachhaltige Aspekte<br />
Hier denke ich an die bildhaften Parallelen<br />
im Handeln Gottes. Einmal führt er Völker<br />
heran, um Israel zu strafen oder zu befreien,<br />
so dass diese zu Paradigmen seiner Weltregierung<br />
werden. Im Lesetext vollzieht er<br />
das Gleiche an der Natur: Er erniedrigt und<br />
erhöht Bäume, lässt Pflanzen ergrünen und<br />
verdorren, pflanzt Schösslinge um. Gott demonstriert,<br />
dass er überall „im Regimente<br />
sitzt“, damit alle „erkennen, dass ich Jahwe<br />
bin“. Natur und Geschichte werden zu<br />
Aspekten einer umfassenden Handlungskonzeption:<br />
Sie besteht in Gottes Willen<br />
zum Heil, der sich an Menschen, Völkern<br />
und allem Lebendigen vollzieht. Die ganze<br />
Schöpfung wird Adressat göttlichen Gerichts<br />
und Heilshandelns. Der einzelne Mensch,<br />
den Ezechiel als erster unter den Propheten in<br />
persönlicher Verantwortung vor Gott sieht,<br />
muss sich diesem Prozess stellen: Will er<br />
Gottes Werk mittun, indem er sich unter<br />
sein Gesetz stellt, oder will er der „Sünde“<br />
verfallen und „sterben?“ Jeder wird nach seinem<br />
persönlichen Verhalten beurteilt, Kollektivurteile<br />
sind abgetan. Dieses Recht auf<br />
freie Entscheidung ermöglicht allen Künftigen<br />
Chancen, neu anzufangen. Für uns mag<br />
es sich darin zeigen, dass gerodete Wälder<br />
neu gepflanzt, ausgeräumte Landschaften<br />
wieder neu erblühen können, wenn wir es nur<br />
wollen. Damit auch unsere Zeit erkennt, dass<br />
allem Geschehen ein transzendentaler Sinn<br />
innewohnt, der auf Heil und Leben zielt.<br />
2. Lesung (kath.): 2 Kor 5, 6 – 10<br />
Theologische Wertung<br />
Zentralthema des 2. Korintherbriefes ist<br />
das apostolische Amt. Im Kontext von Kap.<br />
4, 7 bis 6, 10 geht es um den Inhalt der apostolischen<br />
Verkündigung. Christlich existieren<br />
bedeutet, ein geistlich bestimmtes Leben<br />
im „neuen Bund“ zu führen, welches sich im<br />
Glauben konstituiert und in den Gnadengaben<br />
von Glaube, Liebe und Hoffnung ausweist.<br />
Die Christen leben „zwischen den<br />
Zeiten“: noch in der Welt, aber so, dass sie
der Welt gekreuzigt sind und sich darin als<br />
„Fremde“ fühlen. Das „Schauen“ der Wahrheit<br />
liegt in der Zukunft. Gegenwärtig bleibt nur<br />
die Hoffnung, welche immer wieder durch Trost<br />
und Zuversicht gestärkt werden muss. Dabei<br />
hilft das Bestreben, Gott zu gefallen. Denn zum<br />
einen hält es die Verbindung zu ihm, zum anderen<br />
mehrt es den „Lohn“, den jeder einmal vor<br />
dem „Richterstuhl Christi“ empfangen wird.<br />
Nachhaltige Aspekte<br />
Die begnadeten Sünder sind frei, durch gute<br />
Tat Gott zu erfreuen, ohne in gesetzliche Verdienstethik<br />
zurück zu fallen. Helle Zuversicht<br />
befreit zu mutigem Bekennen und Tun. Das<br />
Fremdheitsgefühl im eigenen Körper muss<br />
dabei nicht hindern, sondern kann beflügeln,<br />
weil damit auch manche Angst verblasst.<br />
Christliche Menschen sind frei, „zwischen den<br />
Zeiten“, im Seinsmodus als „Neue Kreatur“<br />
neue Modelle des Miteinander zu versuchen:<br />
Müssen alte, verwitwete Menschen vor der<br />
Alternative stehen, entweder allein oder kaserniert<br />
in Heimen zu leben? Betreute Wohngemeinschaften<br />
dürften für viele besser sein. Auch<br />
Wohnprojekte, bei denen sich mehrere Generationen<br />
aus freiem Entschluss zusammen finden,<br />
um einen Teil ihres Lebens miteinander zu verbringen,<br />
finden zu Recht immer mehr Interesse.<br />
Wer schreibt vor, dass es im Wirtschaftlichen<br />
allein auf den Gewinn ankommt? Kirchliche<br />
Einrichtungen erleben durch die Gesundheitsreform<br />
zwar Kostendruck und Wettbewerb<br />
wie andere und müssen sparen. Sie<br />
sind aber aus Prinzip nicht gewinnorientiert.<br />
Sie können sich dadurch auch künftig von<br />
kommerziellen Einrichtungen abheben. Wenn<br />
sie ihre Verwaltungen nicht allzu üppig ausstatten<br />
(Verwaltung und Juristerei sind die<br />
größten Feinde des Evangeliums), haben sie<br />
Geld und geistliche Ressourcen frei, um die<br />
Atmosphäre menschlicher, christlicher zu gestalten.<br />
Manche Theolog/inn/en, die im Gemeindedienst<br />
nicht unterkommen können, wären hier<br />
in verschiedenen Funktionen einsetzbar. Nach<br />
entsprechender Fortbildung könnten gerade sie<br />
dazu beitragen, den Geist dieser Einrichtungen zu<br />
heben. Auch das ehrenamtliche Engagement der<br />
Gemeinden, die sie mittragen, kann mithelfen.<br />
Evangelium (kath.): Mk 4, 26 - 34<br />
Theologische Wertung<br />
Das Evangelium ist von der Passionsge-<br />
schichte her konzipiert: als Werbebotschaft<br />
für den Glauben an Jesus Christus. Er war der<br />
Messias und Menschensohn, der in Galiläa<br />
wirkte und am Kreuz für uns alle starb. Die<br />
beiden Gleichnisse von der selbstwachsenden<br />
Saat und vom Senfkorn illustrieren die Wirkung<br />
dieses Evangeliums: geheimnisvoll wie<br />
das selbsttätige Wachsen der Saat; gewaltig<br />
wie die Entwicklung einer großen Staude aus<br />
einem winzigen Korn – erneut ein Gleichnis,<br />
das die natürlichen Lebensprozesse in den Blick<br />
nimmt. Es passt gut zur Jahreszeit, in der alles<br />
wächst und reift, manches Feld ist vielleicht<br />
schon abgeerntet und liegt bereit für eine<br />
zweite Aussaat. Ist es nicht vermessen, die Wirkung<br />
unserer Predigt damit zu vergleichen?<br />
Nachhaltige Aspekte<br />
Eine Karikatur von Marie Marcks zeigt einen<br />
Mann, der die Erdkugel auf seinem Rücken<br />
trägt. Eine Frau steht daneben und sagt: „roll<br />
das Ding doch.“ Es heißt, Gutmenschen wären<br />
schon von fern zu erkennen am sauertöpfischen<br />
Gesichtsausdruck. Unbefangene fragen:<br />
Warum tun die das? Wenn sie überhaupt nichts<br />
davon haben? Bei Manchem hat man den Eindruck,<br />
er suche geradezu nach einer Möglichkeit,<br />
Verantwortung, Last und Probleme zu übernehmen,<br />
um sich so fühlen zu können, wie es<br />
das Gesicht zeigt. Fehlt diesen Leuten die Fähigkeit<br />
zum Glück? Ein anderer Cartoon zeigt,<br />
wie ein leptosomer, bebrillter Mensch mit<br />
einem Schild in der Fußgängerzone steht:<br />
„Pfarrer auf der Suche nach einer lieben, kleinen<br />
Randgruppe“. Böse, gewiss, denn wer<br />
sich angesprochen fühlt, wird zwingende Argumente<br />
für sein Tun beibringen, die jede<br />
Kritik beschämen. Wird „so jemand“ seine<br />
Schützlinge auch mal wieder loslassen können?<br />
Jesus kann uns beruhigen: Vieles wächst<br />
von allein, wenn ihr nur die richtige Saat ausbringt.<br />
Nicht alles können wir vollbringen.<br />
Zu oft gießen kann auch schaden. Oft ist es<br />
Kleinglaube, der zu gouvernantenhafter, kontrollierender<br />
Ängstlichkeit verführt. Was aus<br />
der Saat werden kann, zeigt die Senfstaude.<br />
Ob sie heranwächst, haben wir meist nicht in<br />
der Hand. Wenn sie nicht wächst, dürfen wir<br />
es erneut versuchen. Unser Glück darf nicht<br />
davon abhängen. Vertrauen kann sehr gut tun.<br />
Winfried Anslinger, Homburg<br />
14.06.09<br />
Mk 4, 26-34<br />
93
94<br />
21.06.09<br />
Bei all den Krisen und<br />
Gefahren unserer heutigen<br />
Zeit hoffen wir doch selbst<br />
immer wieder auf Rettung.<br />
12. Sonntag im Jahreskreis / 2. Sonntag nach <strong>Trinitatis</strong><br />
ev. Reihe I: Lk 14, (15) 16-24 kath. 1. L.: Ijob 38, 1.8-<strong>11</strong> kath. 2. L.: 2 Kor 5, 14-17 kath. Evang.: Mk 4, 35-41<br />
Mk 4, 35-41<br />
Mk 4, 35-41 Das Wunder der Sturmstillung:<br />
Unser täglich Leben<br />
Wir hören Nachrichten; täglich aktuelles<br />
Geschehen verbunden mit Informationen, Erläuterungen<br />
und Kommentaren. Trauriges,<br />
Fürchterliches, Interessantes, Belangloses nehmen<br />
unsere Wahrnehmungsorgane auf. Doch<br />
meist gehen wir trotzdem getrost unserer<br />
täglichen Arbeit und Verpflichtungen nach.<br />
Als gläubige Menschen geht es uns oft<br />
genauso. Doch wir ziehen uns einmal in der<br />
Woche zurück – zur Begegnung mit Jesus in<br />
seinem Brot. Nicht, dass wir ihn schlafend<br />
vorfinden, wohl aber sind seine Worte der<br />
Frohen Botschaft letztlich für uns nicht mehr<br />
aufrüttelnd. Wir haben ihm – Gott, seinem<br />
Sohn und dem Heiligen Geist – viele schöne<br />
Plätze bereitet, die wir gerne besuchen. Nur<br />
noch an anderen Stellen in unserem Leben<br />
regen wir uns auf und diskutieren. Gottes Anwesenheit,<br />
unser Glaube gibt uns diese Sicherheit,<br />
unser Leben hier als überwiegend angenehm<br />
zu beschreiben. Die Alltagsaufgaben<br />
anzugehen und je nach Gutdünken mal die<br />
eine oder andere Blickrichtung aufzunehmen,<br />
mal zu unterstützen oder um in Betroffenheit<br />
zu erstarren. So sorglos müssen sich die<br />
Fischer am Anfang ihrer Fahrt gefühlt haben.<br />
Dann passiert es – auf einmal bekamen sie –<br />
auf einmal bekommen wir Angst. Warum?<br />
Vielleicht weil wir krank werden, unsere<br />
Zukunft sich als unsicher erweist, wir mit<br />
dem Tod konfrontiert sind, wir Ungerechtigkeiten<br />
erkennen, uns bedroht fühlen. Was<br />
vorher sicher schien und reibungslos ablief,<br />
hat ein abruptes Ende erfahren. „Dieser Jesus<br />
ist doch jetzt gefordert“, so denken wir,<br />
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong><br />
Der Autor betrachtet die Bibelstellen der kath. Leseordnung. Stichworte<br />
zur Nachhaltigkeit: Gott setzt Grenzen, diese verlangen nach Anerkennung,<br />
dem Fortschritt Maßstäbe geben (Ijob 38); sich von der Liebe<br />
drängen zu lassen führt zu einer <strong>nachhaltig</strong>en Mitgestaltung der Schöpfung<br />
(2 Kor 5), wir müssen Jesus nicht erst aufwecken – seine Anweisungen<br />
sind schon gegeben (Mk 4)<br />
„wieso kann er das nur zulassen?“ Ja, wo ist<br />
er, dass ich ihn wecken kann, wie die Jünger<br />
im Boot?<br />
Was wäre, wenn ich mir vorstelle, dass<br />
Jesus mir im wirklichen Leben begegnet?<br />
Seine Anwesenheit sichtbar und fühlbar ist?<br />
Was wir sonntags feiern, eben keine müde und<br />
routinemäßige Zusammenkunft ist? Diejenigen,<br />
die gekommen sind, haben Fragen,<br />
wollen Hilfe. Aber er kennt ja mein Problem,<br />
unsere Probleme. Die Fragen brauchen wir<br />
folglich nicht mehr alle zu stellen. Da horche<br />
ich genauer hin, was er sagt und lass mich<br />
davon betreffen und bewegen. Und andere<br />
tun es mit mir. Wir tauschen uns aus, was wir<br />
gehört haben, wie wir es für uns verstehen<br />
und umsetzen können und bändigen so unsere<br />
(Lebens-)Angst und schenken uns gegenseitig<br />
Hoffnung. Und das verstärkt sich<br />
immer mehr. Unser Leben wird anders. Die<br />
plötzliche Angst kann mir und uns keine<br />
Angst mehr machen.<br />
Vom Rettungswunder zur Nachhaltigkeit<br />
Unsere Perikope von der Sturmstillung wird<br />
häufig als Rettungswunder bezeichnet. Bei all<br />
den Krisen und Gefahren unserer heutigen<br />
Zeit hoffen wir doch selbst immer wieder auf<br />
Rettung oder zumindest auf das Ausbleiben<br />
von Situationen, wo wir auf Rettung angewiesen<br />
wären. Die Sturmstillung zeigt uns,<br />
wie unversehens wir in eine Notlage kommen<br />
können (vgl. Vers 38: „wir zugrunde gehen“).<br />
Die Frage, wer dafür verantwortlich ist oder<br />
Schuld hat, stellt sich hier nicht.<br />
Schon im Alten Testament in den Psalmen<br />
(vgl. Ps 69, 2) ist von Notlagen die Rede, die<br />
mittlerweile auch in unseren Sprachschatz<br />
übergegangen sind: „wenn einem das Wasser<br />
bis zum Halse steht“. Ob unverschuldet oder<br />
selbst verschuldet, sind diese Situationen
nicht außergewöhnlich.<br />
Der Umgang mit Notlagen, eigener und<br />
fremder Not, erweckt laut unserer Perikope<br />
den Eindruck, dass wir das Gefühl haben,<br />
Jesus „aufwecken“ zu müssen und ihn um<br />
Hilfe zu bitten. Das Gefühl ihn „aufzuwecken“,<br />
das ist ein Schritt, der zwar von einer<br />
Notsituation ausgelöst werden kann, aber immer<br />
wieder neu gegangen werden muss – bis<br />
dahin, dass wir davon ausgehen können, dass<br />
ER immer da ist. Das heißt, ihn als Lebendigen<br />
zu sehen, seine Anweisungen zu befolgen,<br />
seinen Gedanken und Worten Leben<br />
einzuhauchen. Unser Leben, das Denken und<br />
Handeln muss sich von ihm durchgehend<br />
infizieren lassen.<br />
Jesus als den immer Anwesenden zu erleben,<br />
ist ein grundlegender, langer Prozess<br />
und sehr umfassend. Er ist nicht nur auf<br />
mich, auch auf alle anderen Geschöpfe und<br />
die gesamte Schöpfung ausgerichtet. Und in<br />
dieser Perspektive zu handeln, Not zu sehen<br />
und die geschwisterliche Hilfe anzubieten,<br />
ist eine Nachhaltigkeit, die das Leben für den<br />
Einzelnen und im Miteinander auf Dauer verbessert.<br />
Letztlich ist diese Denk- und Handlungsweise<br />
sogar notwendig, um unsere Gesellschaft<br />
zusammenzuführen und den Fortbestand<br />
der Schöpfung nicht vorzeitig zu beenden.<br />
2 Kor 5, 14-17 … für die Nachhaltigkeit<br />
gestorben…<br />
So würde vielleicht Paulus heute im<br />
Korintherbrief schreiben. Seine Liebe zu<br />
Christus hat in ihm förmlich gebrannt, so dass<br />
sein Zeugnis wahrhaft <strong>nachhaltig</strong> gewirkt<br />
hat. Da er kein großer Redner war (2 Kor 10,<br />
10), wie seine Gegner bemerken, muss wohl<br />
seine innere Überzeugung und seine Hingabe<br />
ausschlaggebend gewesen sein.<br />
Aber dieses Engagement, die Durchdrungenheit<br />
seiner Person von Jesus hat ihn für unseren<br />
Glauben so entscheidend und prägend<br />
gemacht. Seine Liebe zu Jesus drängt ihn und<br />
meint damit auch uns, sich in diese Liebe zu<br />
stellen. Nicht mehr menschliche Maßstäbe<br />
(Wissen, Zeit, Leid) und Besitztümer zählen<br />
(„mein Haus, mein Boot …“) sondern nur die<br />
Ausrichtung hin auf Jesus (die Erfahrung<br />
eines absoluten Lebens). Wenn sich darum<br />
unser Leben dreht, dann hat sich grundlegend<br />
etwas gewandelt. Paulus spricht daher<br />
von der neuen Schöpfung. Und diese Schöp-<br />
fung kann nicht mehr untergehen. Sie bietet<br />
Leben für alle, die in Christus leben. Oder im<br />
Bild des Evangeliums ausgedrückt: die Jesus<br />
als mitlebende Person bei sich wissen.<br />
Ijob 38, 1.8-<strong>11</strong> Menschliche Grenzen<br />
anerkennen<br />
Mit der Drohung an die Adresse Ijobs „bis<br />
hierher darfst du und nicht weiter …“ könnte<br />
man sich an den Baum der Erkenntnis im<br />
Paradies erinnert fühlen. Eine Autorität setzt<br />
Grenzen. Gott will dem Menschen Grenzen<br />
aufzeigen, die er vermeintlich nicht mehr<br />
kennt oder kennen lernen will. In der Fortsetzung<br />
des Satzes heißt es: „Hier muss sich<br />
legen deiner Wogen Stolz“. Also die Selbstherrlichkeit<br />
des Menschen hindert ihn, selbst<br />
zu erkennen, was noch seine Leistung ist und<br />
was er Gott als dem Schöpfer zuzuerkennen<br />
hat.<br />
Während früher Menschen verstärkt aus<br />
ihrer Erfahrung lernten und ihre Hilfen<br />
davon ableiteten, versucht der Mensch heute,<br />
in das Leben selbst einzugreifen; natürlich<br />
immer unter dem Mantel der Verbesserung<br />
und der notwendigen Hilfeleistung. Aber ist<br />
abzusehen, wie sich z. B. gentechnische<br />
Veränderungen langfristig auswirken? Wenn<br />
wir dem Leben höchste Priorität einräumen,<br />
damit dem Schöpfer alle Macht zuerkennen<br />
und trotzdem in Versuchen alles Leben nachzuahmen<br />
oder zu verändern trachten, dann<br />
stimmen unsere Welt- bzw. Glaubensausrichtung<br />
nicht mehr überein.<br />
Es geht nicht darum, den Fortschritt zu<br />
behindern, sondern um die Frage, was ist<br />
noch Fortschritt? Was ist noch verantwortlich?<br />
Wollen wir Gottes Planung übernehmen?<br />
Die Anerkennung einer Grenze des<br />
Menschen zur Veränderung der Schöpfung<br />
Gottes ist eine unumgängliche Voraussetzung<br />
für dauerhaftes, <strong>nachhaltig</strong>es Leben<br />
auf diesem Planeten. Indem der Mensch seine<br />
Grenze annimmt, wird er ein neuer Mensch.<br />
Er wird zu dem, was sein Menschsein ausmacht.<br />
Rüdiger Torner, Köngernheim/Rhh.<br />
21.06.09<br />
Ijob 38, 1.8-<strong>11</strong><br />
Die Selbstherrlichkeit des<br />
Menschen hindert ihn, selbst<br />
zu erkennen, was noch seine<br />
Leistung ist und was er<br />
Gott als dem Schöpfer<br />
zuzuerkennen hat.<br />
2 Kor 5, 14-17<br />
95
96<br />
Lk 15, 1-3.<strong>11</strong>b-32<br />
28.06.09<br />
Diejenigen, die andere<br />
schon längst aufgegeben<br />
haben, sind die Menschen,<br />
die Jesus zuallererst zu<br />
finden sucht.<br />
13. Sonntag im Jahreskreis / 3. Sonntag nach <strong>Trinitatis</strong><br />
ev. Reihe I: Lk 15, 1-3.<strong>11</strong>b-32 kath. 1. L.: Weish 1, 13-15; 2, 23-24 kath. 2. L.: 2 Kor 8, 7.9.13-15<br />
kath. Evang.: Mk 5, 21-43 oder kurz: Mk 5, 21-24.35b-43<br />
Lk 15, 1-7 (8-10)<br />
Lost and found: der Sonntag und „sein“ Text<br />
Der Wochenspruch für den 3. Sonntag<br />
nach <strong>Trinitatis</strong> lässt deutlich den thematischen<br />
Fokus dieses Sonntags erkennen: Der<br />
Menschensohn ist gekommen, zu suchen und<br />
selig zu machen, was verloren ist (Lk 19, 10).<br />
Dieser Vers, das Fazit der Zachäus-Perikope<br />
im Lukasevangelium, bringt es auf den<br />
Punkt: Jesus geht zu den Verlorenen, nicht<br />
zu denen, die sich schon gefunden haben. An<br />
den Motiven des Suchens und Findens wird<br />
nachvollziehbar, was Jesus unter Barmherzigkeit<br />
versteht. Das Gleichnis vom verlorenen<br />
Sohn (Lk 15, <strong>11</strong>-32), das auch zu den<br />
Texten dieses Sonntags gehört (Predigtreihe<br />
III), macht es beispielhaft deutlich, dass es<br />
für Jesus keine Verlorenen gibt. Im Gegenteil:<br />
Diejenigen, die andere schon längst aufgegeben<br />
haben, sind die Menschen, die Jesus<br />
zuallererst zu finden sucht.<br />
Dem Gleichnis vom verlorenen Sohn gehen<br />
im Lukasevangelium zwei weitere Gleichnisse<br />
voraus, die in den thematischen<br />
Zusammenhang des Suchens und Findens<br />
gehören: das Gleichnis vom verlorenen Schaf<br />
(15, 1-7) und das Gleichnis vom verlorenen<br />
Groschen (15, 8-10). Der Hirte lässt um des<br />
einen Schafes willen, das sich verirrt hat, die<br />
99 anderen allein. Weil ihm gerade dieses<br />
eine Schaf am Herzen liegt, geht der Hirte<br />
ihm nach, bis er es gefunden hat. Die Frau,<br />
die einen ihrer zehn Silbergroschen verloren<br />
hat, setzt alles daran, diesen wieder zu finden.<br />
Die beiden Gleichnisse zeigen: Jesus hat eine<br />
hohe Wertschätzung für das Einzelne (vgl.<br />
dazu auch die Parallele Mt 18, 14). Beide<br />
Gleichnisse verbindet die Freude, die am<br />
Ende steht. Sie ist Folge und somit Frucht<br />
des Wiederfindens. Die Freude am Finden<br />
des Verlorenen ist das entscheidende Argument<br />
gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten,<br />
die an Jesu Mahlgemeinschaft und<br />
Umgang mit Zöllnern und Sündern Anstoß<br />
nehmen.<br />
Jesus ist somit selbst die Auslegung seiner<br />
Gleichnisse (Eduard Schweizer zur Stelle). An<br />
seinem Verhalten zu den Outcasts seiner Zeit<br />
wird deutlich, was einen guten Hirten ausmacht:<br />
Die Liebe gibt keinen auf. Und deshalb<br />
handelt gerade derjenige verantwortungsethisch,<br />
der sich von ihr leiten lässt und<br />
nicht von einem Kalkül, das die 99 anderen<br />
zu dem einen ins Verhältnis setzt und in der<br />
Abwägung den 99 mehr Gewicht gibt. Die<br />
Pointe des Textes besteht also darin, dass das<br />
Verhalten des Hirten gerade nicht unvernünftig<br />
ist. Denn die Freude stellt sich erst<br />
dann ein, wenn das eine Schaf gefunden und<br />
damit die Herde wieder komplett ist. Damit<br />
klingt auch bei Lukas an, was Paulus als<br />
Charakteristikum derjenigen bestimmt, die<br />
in der Nachfolge des guten Hirten die gute<br />
Botschaft verkünden: GehilfInnen der Freude,<br />
und nicht Herren über den Glauben zu sein<br />
(2 Kor 1, 24).<br />
Drinnen oder draußen?<br />
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong><br />
Der Verfasser betrachtet alle genannten Bibeltexte. Stichworte zur<br />
Nachhaltigkeit: Wertschätzung für das Einzelne, Freude am Wiederfinden,<br />
entscheidend für Jesus ist nicht statistische Ökonomik, sondern<br />
Liebe / welche Schafe sind bei uns außerhalb der Herde geraten? Armut<br />
bedeutet „draußen sein“ – die Verantwortung für die Situation wird nicht<br />
dem Schaf überlassen, Sozialstaat und Rahmenbedingungen (Lk 15);<br />
krankmachende / todbringende gesellschaftliche Strukturen ausgleichen<br />
(kath. Perikopen)<br />
Die Auslegung des Gleichnisses vom verlorenen<br />
Schaf (oder in anderer Pespektive: vom<br />
suchenden Hirten) unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten<br />
wirft die Frage auf, wer denn<br />
bei uns heute in sozialer Hinsicht außerhalb<br />
der Herde geraten ist. Zuallererst fallen mir<br />
dazu Langzeitarbeitslose und Kinder aus bildungsfernen<br />
Schichten ein. Der Entwurf des<br />
dritten Armuts- und Reichtumsberichts der
Bundesregierung, der im Mai 2008 erschienen<br />
ist, spricht davon, dass die Schere zwischen<br />
Arm und Reich weiter auseinandergegangen<br />
ist. 13% der bundesdeutschen Bevölkerung<br />
sind nach der gängigen Armutsdefinition<br />
der EU als arm zu bezeichnen. Weitere<br />
13% wären es auch, wenn sie keine staatlichen<br />
Sozialtransfers erhielten. Besonders<br />
betroffen sind die Familien von Alleinerziehenden<br />
und MigrantInnen. Selbst diejenigen,<br />
die Arbeit haben, sind nicht mehr vor<br />
dem Abrutschen in Armut sicher. Dafür spricht<br />
das Anwachsen der sog. „working poor“, d. h.<br />
derer, die im Niedriglohnsegment beschäftigt<br />
sind und trotz ihrer Arbeit auf aufstockende<br />
Transferzahlungen angewiesen sind.<br />
Armut ist dabei keinesfalls mehr eine Frage<br />
der unteren Gesellschaftsschichten. Weil<br />
diese auch die Mittelschicht erfasst hat und<br />
quer zu der sozialen Segmentierung liegt,<br />
haben die Soziologen Heinz Bude und<br />
Andreas Willisch den Vorschlag gemacht,<br />
nicht mehr von oben und unten, sondern von<br />
drinnen und draußen zu sprechen. Gerade in<br />
dieser Perspektive wird deutlich: Armut<br />
bedeutet mehr als geringes Einkommen.<br />
Armut kulminiert in mangelnder Teilhabe an<br />
den Chancen und Möglichkeiten unserer<br />
Gesellschaft. Darauf hat auch die Denkschrift<br />
des Rates der EKD zur Armut in Deutschland<br />
mit dem Titel „Gerechte Teilhabe“ aufmerksam<br />
gemacht. Die Debatte um gesellschaftliche<br />
Teilhabe weist auf die vielen<br />
unterschiedlichen Facetten der Armut in<br />
einem reichen Land hin, nämlich in Hinsicht<br />
auf Ernährung, Bildungschancen, Gesundheit<br />
und Altersvorsorge. Die PISA-Studien<br />
belegen im Übrigen, dass sich die Bildungseliten<br />
aus sich selbst heraus reproduzieren<br />
und schlechte Bildungschancen sich genauso<br />
„vererben“ wie die guten.<br />
Vor diesem Hintergrund gewinnt das<br />
Gleichnis vom verlorenen Schaf an besonderer<br />
Aktualität. Das gestiegene Risiko der<br />
gesellschaftlichen Exklusion zeigt, dass auch<br />
in Deutschland die Chancen und Risiken der<br />
Globalisierung ungleich verteilt sind. Die<br />
einen genießen – mehr oder weniger zufällig –<br />
den Vorteil, der richtigen Generation anzugehören,<br />
die richtigen Eltern und deshalb die<br />
richtige Qualifikation sowie den richtigen<br />
Job in der richtigen Firma am richtigen Ort<br />
zu haben. Wer dieses Glück nicht hat, läuft<br />
Gefahr, abgehängt zu werden, und d.h.<br />
28.06.09<br />
immer mehr im Niedriglohnsegement bzw.<br />
in Arbeitslosigkeit zu landen.<br />
Der Umbau zum aktivierenden Sozialstaat<br />
hat in den letzten Jahren dazu geführt, die<br />
Verantwortung für die negativen Auswirkungen<br />
des Globalisierungsprozesses einseitig<br />
denen aufzubürden, die von seinen<br />
Segnungen am wenigsten profitieren. Die<br />
Armutsfrage verschärft sich somit durch das<br />
gesellschaftliche Auseinanderdriften von<br />
GlobalisierungsgewinnerInnen und -verlierer-<br />
Innen. Sowohl das Gleichnis vom verlorenen<br />
Schaf als auch die Exklusionsdebatte lenken<br />
unseren Blick auf die, die draußen sind, auf<br />
die „Überflüssigen“ und Abgehängten. In der<br />
Sichtweise des guten Hirten geht es darum,<br />
wie diejenigen, die draußen sind, wieder in<br />
die Gesellschaft hereingeholt werden können.<br />
Das Gleichnis vom verlorenen Schaf setzt<br />
diesbezüglich Maßstäbe: es entkoppelt die<br />
Sorge für die Exkludierten von jedem<br />
Kosten-Nutzen-Kalkül: Schon ein einziges<br />
Schaf, das draußen ist, ist Grund genug, sich<br />
auf die Suche zu machen. Die Liebe ist für<br />
den Hirten Antrieb und Motiv, die Freude ist<br />
die Belohnung für beide.<br />
Für Jesus gibt es also keine verlorenen<br />
Fälle. Was bedeutet dies für die Herausforderung<br />
von Teilhabegerechtigkeit und<br />
Inklusion? Zuerst gilt es die, die draußen stehen,<br />
wirklich wahrzunehmen und nicht zu<br />
übersehen. Dazu braucht es den ersten Schritt<br />
aus der Vertrautheit der 99 heraus. Dort ist<br />
der Glaube als sorgender und deshalb aufsuchender<br />
Glaube gefragt. Das Diakonische<br />
Werk der EKHN hat in seiner Stellungnahme<br />
zum Entwurf des dritten Armuts- und<br />
Reichtumsberichts der Bundesregierung Vorschläge<br />
gemacht. Es braucht Lösungen, die<br />
den betroffenen Familien und ihren Kindern<br />
helfen. Die Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze<br />
um 20% könnte ein erster Schritt sein,<br />
ist aber noch nicht des Rätsels endgültige<br />
Lösung. Vielmehr ist gerade im Sinne der<br />
Nachhaltigkeit eine Verbesserung der Kinderbetreuung<br />
und der schulischen Bildung (z. B.<br />
durch Ganztagsschulen) gefordert. Zur Begrenzung<br />
des Niedriglohnsektors und zur<br />
Lösung des Problems der Langzeitarbeitslosigkeit<br />
müssen mehr öffentlich geförderte<br />
Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden.<br />
Im Übrigen betrifft die Aufgabe der<br />
Inklusion nicht nur den Hirten. Vielmehr 97
98<br />
28.06.09<br />
Zur Gewährleistung des<br />
sozialen Friedens, an dem<br />
auch die Reichen ein<br />
Interesse haben dürften,<br />
gehört deshalb<br />
Teilhabegerechtigkeit für alle.<br />
Weish 1, 13-15; 2, 23-24<br />
2 Kor 8, 7.9.13-15<br />
Mk 5, 21-43<br />
sind auch die gut situierten unter den 99<br />
Schafen gefragt, die sich (noch) in Sicherheit<br />
befinden. Das Diakonische Werk der EKHN<br />
weist darauf hin, dass es um der Handlungsfähigkeit<br />
des Sozialstaats willen auch um<br />
steuerpolitische Fragen (z. B. Erbschafts- und<br />
Vermögenssteuer) und d. h. um die Solidarität<br />
der Wohlhabenden und Reichen mit den<br />
Armen geht. Zur Gewährleistung des sozialen<br />
Friedens, an dem auch die Reichen ein<br />
Interesse haben dürften, gehört deshalb<br />
Teilhabegerechtigkeit für alle.<br />
So sei noch einmal auf das paulinische Leitbild<br />
von Kirche als Leib mit vielen Gliedern<br />
verwiesen (1 Kor 12), das sich auch auf die<br />
Gesellschaft anwenden lässt. Damit der Gesamtorganismus<br />
funktioniert, braucht es<br />
konstitutiv jedes einzelne Glied. Und gerade<br />
die, die die Schwächsten zu sein scheinen,<br />
sind die Nötigsten (1 Kor 12, 22). Weil alle<br />
anderen Glieder mitleiden, wenn ein Glied<br />
leidet (1 Kor 12, 26), deshalb sieht der gute<br />
Hirte (im Sinne von good governance) auf<br />
jedes einzelne: damit sich alle freuen können.<br />
Weish 1, 13-15; 2, 23-24 /<br />
2 Kor 8, 7.9.13-15 / Mk 5, 21-43<br />
Die beiden neutestamentlichen Texte für<br />
den 13. Sonntag im Jahreskreis verstehe ich<br />
als Fortführung und Verdeutlichung des Verses<br />
aus dem Buch der Weisheit: Denn Gott<br />
hat den Tod nicht gemacht und hat keine<br />
Freude am Untergang der Lebenden (1, 13).<br />
Mk 5, 21-43 zeigt Jesus als den Herrn über<br />
Leben und Tod. Er heilt den Blutfluss der<br />
Frau, die ihn bedrängt, als er schon unterwegs<br />
zur todkranken Tochter des Synagogenvorstehers<br />
Jairus ist. Diese weckt er vom Tod<br />
wieder auf. Vor dem Hintergrund des<br />
Gegensatzes zwischen Leben und Tod lesen<br />
sich diese beiden Episoden wie Inklusionsgeschichten<br />
der besonderen Art. Auch hier<br />
tritt Jesus als der gute Hirte in Erscheinung,<br />
der die Menschen, die draußen sind, wieder<br />
in die Gemeinschaft zurückholt. Das gilt<br />
sowohl für die kranke Frau als auch für das<br />
vom Tod auferweckte Mädchen. Die namenlose<br />
Frau, die 12 Jahre unter dem Blutfluss<br />
litt, war zur permanenten Unreinheit und damit<br />
zu einer Außenseiterposition verdammt.<br />
Alle ihre Bemühungen, dies zu ändern, scheiterten.<br />
Die Ärztehonorare haben sie finanziell<br />
ruiniert. Erst als es ihr gelingt, Jesus im<br />
Vorübergehen zu berühren, erfährt sie durch<br />
ihn am eigenen Körper Heilung. Ihr Glaube<br />
an den Heiland hat die Reintegration in die<br />
Gesellschaft möglich gemacht.<br />
Als Inklusionsgeschichten gelesen, lenken<br />
die beiden Perikopen unseren Blick auf<br />
krankmachende und todbringende Strukturen<br />
unserer Gesellschaft. Solche sind z. B. die von<br />
den Armuts- und Reichtumsberichten der<br />
Bundesregierung monierten „deutschen Realitäten“,<br />
zumal eine Facette von Armut auch<br />
eine schlechtere Gesundheitsversorgung darstellt.<br />
Wo es gelingt, verfestigte Strukturen<br />
von Armut und Ausgrenzung zu durchbrechen,<br />
dort wird Heilung im umfassenden<br />
Sinn erfahrbar: sowohl auf individueller als<br />
auch auf gesellschaftlicher Ebene.<br />
Die Verse aus dem 2. Korintherbrief beziehen<br />
sich auf die von Paulus auf dem Apostelkonzil<br />
mit seinen Kollegen ausgehandelte<br />
Kollekte für die Jerusalemer Armen (vgl.<br />
Gal 2, 10). Die Kollekte, die er jetzt der<br />
Gemeinde in Korinth ans Herz legt, ist für<br />
ihn ein Akt der Geschwisterlichkeit, denn sie<br />
zielt auf den Ausgleich zwischen Arm und<br />
Reich innerhalb der einen grenzüberschreitenden<br />
christlichen Gemeinschaft.<br />
Dahinter steht auch hier die paulinische<br />
Konzeption von der christlichen Gemeinde<br />
als Körper. Seine unterschiedlichen Glieder<br />
sind alle aufeinander verwiesen. Wo ungleiche<br />
Verhältnisse herrschen, dort ist die paulinische<br />
Argumentation darauf ausgerichtet,<br />
dass der Überfluss der einen zum Beheben<br />
des Mangels der anderen beitragen möge.<br />
Das Modell von Paulus basiert auf dem<br />
Prinzip der Gerechtigkeit, auch wenn dieser<br />
Begriff hier nicht fällt. Der Prozess des gerechten<br />
Ausgleichs ist jedoch nicht einseitig,<br />
sondern auf Gegenseitigkeit hin angelegt: Im<br />
Augenblick soll euer Überfluss ihrem Mangel<br />
abhelfen, damit auch ihr Überfluss einmal<br />
eurem Mangel abhilft. So soll ein Ausgleich<br />
entstehen (2 Kor 8, 14). D. h. die, die mehr<br />
haben, profitieren letztendlich auch von den<br />
Armen. Paulus denkt also <strong>nachhaltig</strong>! Wie<br />
könnte daraus eine Handlungsmaxime für<br />
arme Hungernde und reiche Übersättigte, für<br />
die wohlhabenden Länder des Nordens und<br />
die überschuldeten Länder des Südens, für<br />
multinationale Pharmakonzerne und die ver-
armten Aidskranken in den Ländern der<br />
Dritten Welt werden?<br />
Literatur:<br />
Heinz Bude, Die Ausgeschlossenen, Das Ende<br />
vom Traum einer gerechten Gesellschaft,<br />
München 2008.<br />
Heinz Bude / Andreas Willisch (Hg.), Exklusion.<br />
Die Debatte über die „Überflüssigen“, Frankfurt<br />
am Main 2008.<br />
Kirchenamt der EKD (Hg.), Gerechte Teilhabe.<br />
Befähigung zu Eigenverantwortlichkeit und<br />
Solidarität. Eine Denkschrift des Rates der EKD<br />
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong><br />
zur Armut in Deutschland, Gütersloh 2006.<br />
Eduard Schweizer, Das Evangelium nach Lukas<br />
(NTD, Bd.3), Göttingen 18. Aufl. 1982.<br />
Jean Ziegler, Das Imperium der Schande. Der<br />
Kampf gegen Armut und Unterdrückung,<br />
München 2005.<br />
Dr. Gunter Volz, Frankfurt am Main<br />
Der Verfasser betrachtet die ev. Predigtperikope ausführlich sowie die<br />
Bibelstelle zur kath. 1. Lesung. Stichworte zur Nachhaltigkeit: im Hinblick<br />
auf den Klimawandel mit Blindheit geschlagen sein und auf die<br />
Blindheit der anderen weisen, den eigenen Lebensstil auf den Prüfstand<br />
stellen – meine Aktivitäten, mein Bedarf, meine Unterstützung der<br />
Ausbeutung durch Auswahl meiner Konsumartikel, Strategien zur Ko-<br />
Existenz entwickeln (Lk 6); aufrecht / aufrichtig sein – als Voraussetzung<br />
für alles Weitere (Ez 1)<br />
28.06.09<br />
05.07.09<br />
ev. Reihe I: Lk 6, 36-42 kath. 1. L.: Ez 1, 28b-2, 5 kath. 2. L.: 2 Kor 12, 7-10 kath. Evang.: Mk 6, 1b-6<br />
Lukas 6, 36-42 „Seid barmherzig, wie<br />
auch euer Vater barmherzig ist“<br />
Unser Predigttext ist Teil der lukanischen<br />
Bergpredigt: Lk 6, 20-49, die im Allgemeinen<br />
als Feldrede bezeichnet wird, da sie Jesus<br />
hält, nachdem er vom Berg hinabgestiegen<br />
ist (V. 17). Ihre Hauptteile, das Gebot der<br />
Feindesliebe (Vv 27-35) und Einzelermahnungen<br />
(Vv 36-45), werden gerahmt von<br />
vier Seligpreisungen (Vv 20-23) und vier<br />
Weherufen (Vv 24-26) sowie der Aufforderung<br />
zum Handeln (Vv 46-49). „Im Kontext<br />
des Lukasevangeliums bildet diese Rede<br />
die Grundunterweisung Jesu, die den Aposteln<br />
und Jüngern zur Weitergabe in der Kirche und<br />
über sie hinaus anvertraut ist“ (Kremer, S. 71).<br />
Jesus spricht wie ein Prophet die Jünger<br />
direkt in der zweiten Person an: „Selig seid<br />
ihr Armen …“ (V. 20), „Weh euch Reichen …“<br />
(V. 24), „Seid barmherzig …“ (V. 36). Aber<br />
14. Sonntag im Jahreskreis / 4. Sonntag nach <strong>Trinitatis</strong><br />
nicht nur die Jünger, die mit Jesus umhergezogen<br />
sind, nicht nur die Hörer der urchristlichen<br />
Gemeinde, für die Lukas sein Evangelium<br />
schrieb, sondern wir Christen heute,<br />
ich selbst bin mit der direkten Anrede Jesu<br />
gemeint. Mich spricht Jesus an, mir redet er<br />
leidenschaftlich wie ein Freund ins Herz!<br />
Die Seligpreisungen (Vv 20-23) in ihrer<br />
geschärften Klarheit, die kein Wenn und<br />
Aber kennen, sind die prophetische Ankündigung<br />
der Umkehrung der Lebenssituation,<br />
einer grundsätzlichen Änderung der Wirklichkeit,<br />
die gekennzeichnet ist von Armut<br />
und Hunger, Elend und Hass. Aber was hat<br />
sich seitdem in 2.000 Jahren geändert?<br />
Nichts? Die Antwort darauf sind die Warnungen<br />
der Weherufe (Vv 24-26), die uns,<br />
die mich meinen; sie sind Aufrufe zur<br />
Umkehr: Wenn ihr umkehrt, dann werden<br />
sich die Verheißungen erfüllen! Es kann sich<br />
nur was ändern, wenn wir es tun, wenn ich es<br />
Lk 6, 36-42<br />
Die Seligpreisungen sind<br />
die prophetische Ankün-<br />
digung der Umkehrung der<br />
Lebenssituation.<br />
99
100<br />
05.07.09<br />
Nur das Brot, das ich mit<br />
anderen Menschen teile,<br />
kann sich vermehren. Nur<br />
geteiltes Leben kann zum<br />
Leben im Überfluss werden.<br />
tue: „Was nennt ihr mich aber Herr, Herr,<br />
und tut nicht, was ich euch sage?“ (V. 46).<br />
Unserem Abschnitt voraus geht das Gebot<br />
der Feindesliebe: „Aber ich sage euch, die ihr<br />
zuhört: Liebt eure Feinde; tut wohl denen,<br />
die euch hassen; segnet, die euch verfluchen;<br />
bittet für die, die euch beleidigen“ (Vv 27 f.).<br />
Ausführlich wird dargelegt, was das konkret<br />
bedeutet, u. a. die Goldene Regel in positiver<br />
Fassung zitiert (V. 31). Am Ende des Abschnitts<br />
ruft Jesus nochmals auf: „… liebt<br />
eure Feinde; tut Gutes und leiht, wo ihr<br />
nichts dafür zu bekommen hofft. So wird<br />
euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder<br />
des Allerhöchsten sein; denn er ist gütig<br />
gegen die Undankbaren und Bösen“ (V. 35).<br />
Unser Predigttext ist eine Konkretisierung<br />
des Gebotes der Nächsten- und Feindesliebe;<br />
dabei hat Lukas die urchristliche Gemeinde<br />
und ihr Zusammenleben im Blick (Kremer,<br />
S. 77). Er will mit Jesu Worten Wege weisen,<br />
wie mit Spannungen, Streitigkeiten, wie mit<br />
Feindschaft in der Gemeinde, aber auch über<br />
sie hinaus umzugehen ist:<br />
Im Zentrum steht dabei die Barmherzigkeit:<br />
„Seid barmherzig, wie auch euer<br />
Vater barmherzig ist“ (V. 36). Eine Barmherzigkeit,<br />
die Maß nimmt an der Barmherzigkeit<br />
Gottes. So wie Gott mir gegenüber<br />
barmherzig ist, soll auch ich barmherzig sein<br />
mit dem Nächsten, mit meinem Feind.<br />
Barmherzigkeit befähigt mich, in meinem<br />
Feind den Menschen zu sehen, in ihm das<br />
einzigartige Geschöpf Gottes, das Kind<br />
Gottes, das Gott so liebt, wie er mich selbst<br />
liebt. Barmherzigkeit mit dem Nächsten,<br />
mit meinem Feind setzt aber voraus, dass ich<br />
auch – und zuerst – mit mir selbst barmherzig,<br />
mir selbst kein Feind bin und mich<br />
annehmen kann, wie ich bin, mich selbst lieben<br />
kann. Ich kann das, weil, „wenn uns unser<br />
Herz verdammt, Gott größer ist als unser<br />
Herz und erkennt alle Dinge“ (1 Joh 3, 20).<br />
Er verhilft mir dazu, eins mit mir selbst zu<br />
sein. Man könnte V. 36 deshalb ergänzen: Seid<br />
eins mit euch selbst, wie euer Vater im<br />
Himmel es ist!<br />
Der Barmherzige ist der, der nicht richtet,<br />
d. h. nicht verurteilt. Das steht uns nicht zu!<br />
Das ist Gottes Sache! Bei Johannes heißt es<br />
aber auch von Jesus: „… ich bin nicht<br />
gekommen, dass ich die Welt richte, sondern<br />
dass ich die Welt rette“ (Joh 12, 47). Von<br />
Sufimeister Rumi (1207-1273) wird folgen-<br />
des Wort überliefert: „Draußen hinter den<br />
Ideen von rechtem und falschem Tun liegt<br />
ein Acker. Wir treffen uns dort“ (zitiert nach<br />
Pierre Stutz). In diesen Worten ist eine<br />
Grundhaltung ausgedrückt, die wahrnehmen<br />
will, ohne zu bewerten, zu beurteilen – zu<br />
verurteilen. Ähnlich ist das im Gleichnis Jesu<br />
vom Unkraut und vom Weizen ausgedrückt:<br />
„Lasst beides miteinander wachsen bis zur<br />
Ernte“ (Mt 13, 30). Wahrnehmen, ohne zu<br />
bewerten und zu verurteilen. Schauen, was<br />
ist. Annehmen, was ist. Da muss ich zunächst<br />
auf mich selbst schauen, auch wahrnehmen<br />
und annehmen, was mir gar nicht gefällt,<br />
meine Schwächen und Fehler, meine Neigungen,<br />
die mich dahin führen, wohin ich<br />
nicht will. Das alles ist Teil meines Selbst, zu<br />
dem Gott schon immer Ja gesagt hat. Und<br />
was ich angenommen habe, das kann sich<br />
auch verwandeln – in pures Leben. Nicht richten,<br />
nicht verurteilen – ein guter Weg, sich<br />
mit sich selbst zu versöhnen. Nicht richten,<br />
nicht verurteilen – ein guter Weg, auch Versöhnung<br />
mit anderen Menschen zu schaffen.<br />
„Vergebt, so wird euch vergeben“ (V. 37).<br />
Keiner ist ohne Schuld. Auch ich habe andere<br />
Menschen verletzt. Barmherzigkeit befähigt<br />
mich, meinen Feind nicht nur als Täter,<br />
sondern auch als Opfer, als Verletzten zu<br />
sehen. Das mag mir helfen, ihm zu vergeben.<br />
Vergebung stiftet neue Beziehungen zwischen<br />
Menschen, stiftet neue Lebensmöglichkeiten<br />
unter Menschen, verlebendigt das<br />
Leben in einer Gemeinde. Versöhnung unter<br />
den Versöhnten ist ein Stück Erlösung unter<br />
den Erlösten. Und dort, wo Erlösung konkret<br />
wird, strahlt sie auch aus auf die nichtchristliche<br />
Umwelt.<br />
Und weiter: „Gebt, so wird euch gegeben.<br />
Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes<br />
Maß wird man in euren Schoß<br />
geben“ (V. 38). Dahinter verbirgt sich nicht<br />
mehr und nicht weniger als das Geheimnis<br />
des Lebens selbst: Nur das Brot, das ich mit<br />
anderen Menschen teile, kann sich vermehren.<br />
Nur geteiltes Leben kann zum Leben im<br />
Überfluss werden. Überall, wo ich mich<br />
selbst öffne und einem Menschen Anteil an<br />
mir selbst gebe, und überall, wo ich selbst<br />
Anteil nehme an einem anderen Menschen,<br />
der sich mir mit-teilt, überall dort wächst das<br />
Leben – wachsen Glaube, Hoffnung, Liebe<br />
(1 Kor 13, 13).<br />
Das Bild vom Blinden, der den Blinden
führt, führt mich auf mich selbst zurück, auf<br />
meine eigene Blindheit, auf meine mangelnde<br />
Einsicht, meine Erkenntnisunfähigkeit. Es<br />
meint vor allem den Mangel an Selbsterkenntnis,<br />
der im Mangel an Gotteserkenntnis<br />
gründet. Nur in der Begegnung mit Gott<br />
kann ich erkennen, wer ich selbst bin. Jesus<br />
ist der Weg der Gottes- und Selbsterkenntnis.<br />
Ihn zu suchen, sein Wort zu verstehen,<br />
ihm zu folgen – das ist der Weg aus der<br />
eigenen Blindheit. Erst dann kann ich auch<br />
anderen ein Führer aus ihrer Blindheit sein.<br />
Das Gleichnis vom Splitter im Auge des<br />
anderen und vom Balken im eigenen Auge<br />
macht mich auf die Gefahr der Selbstgerechtigkeit<br />
aufmerksam, der Heuchelei. Es<br />
ist die Blindheit, die Erkenntnis sein will,<br />
aber nur der Hochmut ist, der vor dem Fall<br />
kommt. Die Haltung, die sich selbst erhebt,<br />
überhebt über andere und den Morast im<br />
eigenen Innern nicht wahrhaben will. Es verbirgt<br />
sich dahinter auch die Spaltung von<br />
Wort und Tat, von Überzeugung und Leben:<br />
„Sie <strong>predigen</strong> Wasser und trinken Wein.“<br />
Hier geht es um das Leben in Übereinstimmung<br />
mit sich selbst, um die Einheit von<br />
Glaube und Tat in Erkenntnis der eigenen<br />
Grenzen, Mängel und Bedürftigkeit, um das<br />
„Ich bin, was ich tue“ (C.S. Lewis). Und Maß<br />
nehme ich dabei immer wieder neu, Tag für<br />
Tag an Jesus Christus, an seiner Liebe, seinem<br />
Wort, seinem Lebensbeispiel, seinem Handeln,<br />
um „vollkommen“ zu werden wie er (V. 40).<br />
Aspekte der Nachhaltigkeit<br />
Die Bilder von dem Blinden, der den<br />
Blinden führt, und vom Splitter und dem<br />
Balken lassen mich an den politischen und<br />
persönlichen Umgang mit Realität und<br />
Ursachen des Klimawandels denken. Sind<br />
wir nicht von Blindheit geschlagen? Stecken<br />
wir nicht den Kopf in den Sand vor den<br />
Konsequenzen der durch uns Menschen verursachten<br />
globalen Erderwärmung? Die klimatischen<br />
Veränderungen bleiben uns hier in<br />
den grünen und wasserreichen Breiten<br />
Mitteleuropas vielfach noch abstrakt – trotz<br />
vieler Bilder und Zeugnisse in den Medien.<br />
Und mit dem Finger auf die Blindheit der<br />
anderen zu zeigen – Die Politiker, die<br />
Wirtschaftsbosse, die Lobbyisten, der<br />
Kapitalismus sind schuld! –, ist leicht und<br />
entlarvende Selbstentlastungsstrategie.<br />
Aber wir leben alle in den wirtschaftlichen<br />
Verhältnissen der Wohlstandsgesellschaften<br />
des Westens mit ihrem enormen Energieund<br />
Ressourcenverbrauch. Wir selbst sind so<br />
verstrickt in die Lebensverhältnisse und den<br />
Lebensstil unserer Gesellschaft, dass wir<br />
selbst Ursache der Bedrohung des Lebens auf<br />
diesem Planeten sind.<br />
„Weh euch Ihr Reichen! Denn ihr habt<br />
euren Trost schon gehabt!“ (V. 24). Ich bin<br />
angesprochen. Ich muss was tun. Nur ich<br />
kann das tun, was nur ich tun kann! Und das<br />
heißt für mich, den eigenen Lebensstil, die<br />
eigene Lebensphilosophie, die eigenen Bedürfnisse<br />
und Interessen auf den Prüfstand zu<br />
stellen: mein persönlicher Energie- und<br />
Naturverbrauch, die Nutzung des Autos<br />
(Ideologie vom freien Bürger auf freien<br />
Straßen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung),<br />
meine Essgewohnheiten (Fleisch), meine<br />
Bedürfnisse an Kleidung (Quantität und Qualität),<br />
an Freizeitaktivitäten, mein Technikbedarf.<br />
Wo kaufe ich ein? Bin ich mir bewusst,<br />
dass mein Einkauf beim Discounter<br />
von anderen Menschen bezahlt wird (Formen<br />
von Ausbeutung durch geringe Löhne, unmenschliche<br />
Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit…)?<br />
Wie kann ich selbst so leben, dass ich<br />
weniger Energie und Lebensressourcen verbrauche,<br />
weniger das ökologische System dieser<br />
Welt belaste als bisher? Wie kann ich<br />
durch persönliches, soziales und politisches<br />
Engagement dazu beitragen, dass sich politische<br />
und wirtschaftliche Strukturen Leben<br />
zerstörender Ressourcenausbeutung ändern?<br />
Durch gemeinsames sozialethisches Handeln<br />
vieler, z. B. durch Kaufboykott, können auch<br />
Marktmechanismen verändert, humanisiert<br />
werden. Es geht hier um nicht weniger als<br />
eine neue Weise, das Leben mit anderen<br />
Menschen, das Leben mit allem, was auf dieser<br />
Erde lebt, zu teilen. Dazu bedarf es des<br />
Bewusstseins von der Einheit allen Lebens,<br />
„dass alles, was existiert, ko-existiert“ und<br />
„nur in der Koexistenz der Beziehung leben<br />
und überleben kann“ (Dorothee Sölle).<br />
Ez 1, 28b-2, 5: „Stell dich auf deine Füße,<br />
Menschensohn, ich will mit dir reden.“<br />
05.07.09<br />
Ez 1, 28b-2, 5<br />
Der Prophet Ezechiel erzählt von seiner<br />
Berufung im Rahmen einer Epiphanie: „Als<br />
ich diese Erscheinung sah, fiel ich nieder auf 101
102<br />
05.07.09<br />
Nicht von oben herab,<br />
sondern auf gleicher Höhe,<br />
auf Augenhöhe<br />
gewissermaßen will Gott<br />
mit seinem Menschen reden.<br />
12.07.09<br />
mein Gesicht“ (V. 28). Und der Herr sagt zu<br />
ihm: „Stell dich auf deine Füße, Menschensohn,<br />
ich will mit dir reden.“<br />
Ein ungemein beeindruckendes Bild: Der<br />
Mensch wirft sich „in Furcht und Zittern“<br />
vor seinem Gott nieder, und Gott will, dass<br />
er sich auf seine Füße stellt, sich auf-richtet,<br />
denn er will mit ihm reden. Er stellt den<br />
Menschen aufrecht vor sich hin, nicht<br />
gekrümmt, gebeugt, sondern mit geradem<br />
Rückgrat aufrecht zwischen Himmel und<br />
Erde, fest auf dem Boden stehend, ausgerichtet<br />
nach oben hin zum Himmel. Nicht von<br />
oben herab, sondern auf gleicher Höhe, auf<br />
Augenhöhe gewissermaßen will Gott mit seinem<br />
Menschen reden. So wie es seiner Würde<br />
als Geschöpf Gottes entspricht, in dem der<br />
Atem des Heiligen Geistes ein- und ausweht,<br />
mit jedem Atemzug, mit jedem Atemzug<br />
neu verlebendigend.<br />
Die Voraussetzung, dass Gott mit Ezechiel<br />
redet, ist sein Aufrecht-Sein vor Gott, sein<br />
Gerad-Sein vor Gott! Gott sieht in ihm sein<br />
Ebenbild, sein Abbild, der Mensch ist von<br />
seiner Art, von seiner Würde! Gott achtet die<br />
Würde seines Menschen, den er liebt. Er ist<br />
der Gott der Menschenwürde und der<br />
Menschenrechte!<br />
Und dieses Gerad-Sein meint auch ein<br />
15. Sonntag im Jahreskreis / 5. Sonntag nach <strong>Trinitatis</strong><br />
Ganz-Sein vor Gott (Gen 17, 1: „Geh vor mir<br />
her und sei ganz!“), ein inneres Eins-Sein, das<br />
befähigt, ganz in Übereinstimmung mit sich<br />
selbst die Einheit von Glaube und Tat zu<br />
leben. Gott schenkt dieses Ganz-Sein. Und es<br />
ist die Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit<br />
der Verkündigung: „Ob sie dann<br />
hören oder nicht – denn sie sind ein widerspenstiges<br />
Volk –, sie werden erkennen müssen,<br />
dass mitten unter ihnen ein Prophet<br />
war“ (Ex 2, 5).<br />
Thomas Bettinger, Landstuhl<br />
Quellen:<br />
Jakob Kremer: Lukasevangelium, Reihe: Die<br />
Neue Echter Bibel, Kommentar zum Neuen Testament<br />
mit der Einheitsübersetzung, Bd. 3, Echter-<br />
Verlag, Würzburg 1988<br />
Pierre Stutz: Vom Umgang mit Ungerechtigkeiten<br />
in meinem Leben, Vortrag am 25. Mai 2006<br />
beim 96. Deutschen Katholikentag in Saarbrücken<br />
Dorothee Sölle: Mystik und Widerstand – „Du<br />
stilles Geschrei“, Piper-Verlag, 2006<br />
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong><br />
ev. Reihe I: Lk 5, 1-<strong>11</strong> kath. 1. L.: Am 7, 12-15 kath. 2. L.: Eph 1, 3-14 oder kurz Eph 1, 3-10 kath. Evang.: Mk 6, 7-13<br />
Am 7, 12-15<br />
Die Autorin betrachtet die Bibelstellen der kath. Leseordnung. Stichworte<br />
zur Nachhaltigkeit: den Mund aufmachen, auch auf die Gefahr hin, nicht<br />
gehört zu werden / Nord-Süd-Konflikt, soziale Ungerechtigkeiten (Am 7);<br />
der Mensch hat schon in sich, was er zur Bewahrung der Schöpfung benötigt<br />
... er soll seine Kreativität und seinen Verstand nutzen, Lebensstile<br />
auf Kosten anderer (Eph 1) sowie zahlreiche Impulse / Anstöße zu den Versen<br />
aus Mk 6, die hier nicht nochmals aufgeführt werden<br />
Amos 7, 12-15<br />
Exegetische Anmerkungen<br />
Amos wird angegriffen für das, was er prophezeit,<br />
und des Landes verwiesen. Seine Pro-<br />
phetie ist nicht erwünscht, weil sie in dieser<br />
radikalen Form nicht wahrgenommen und<br />
angenommen werden will. Die Regierenden<br />
befürchten, dass hinter den Worten des Amos<br />
judäische, dem Nordreich feindlich gesinnte<br />
Kreise stecken, die Amos mit Geld bestochen
haben. Amos ist aber kein Berufsprophet,<br />
sondern ein Berufungsprophet. Er lebt nicht<br />
von seinem Prophetentum, denn sein Broterwerb<br />
ist die Viehzucht und Landwirtschaft.<br />
Jahwe selbst sei es, der ihn, – so wörtlich –<br />
„von hinter der Herde wegpackte“.<br />
Predigtgedanken<br />
Wer sagt, was unbequem, radikal ist, die<br />
bestehende Ordnung und Sicherheit in Frage<br />
stellt, hat es oft schwer, mit seinen Worten<br />
anzukommen und gehört zu werden. Die Ungerechtigkeit,<br />
dass viele Reichen immer reicher<br />
werden und viele Armen immer ärmer,<br />
bringt Unheil, z. B. Nord-Süd-Konflikt,<br />
gesellschaftliche Ungerechtigkeit in unserem<br />
Land. Wenn alle Menschen auf der Welt so<br />
viel Rohstoffe und Ressourcen verbrauchen<br />
würden wie wir in westlichen Ländern,<br />
würde dieser Standard nicht mehr möglich<br />
sein. Ist er überhaupt notwendig, gerecht<br />
und verantwortbar? Menschen, die immer<br />
wieder den Finger in die Wunde legen, die<br />
auf drastische Auswirkungen der Raubbaus<br />
mit den Gütern der Welt und der Schöpfung<br />
aufmerksam machen, werden oft nicht gehört,<br />
für Spinner und Schwarzmaler gehalten.<br />
Wer spürt, dass ihm eine Botschaft von Gott<br />
gegeben ist, die nicht aus seinen eigenen<br />
Interessen kommt, der kann die Erfahrung<br />
machen, dass er nicht gehört werden will.<br />
Wie viele werden dafür bezahlt, dass sie nach<br />
dem Mund der Einflussreichen reden;<br />
Lobbyisten in unserer Zeit?<br />
Quelle:<br />
A. Deissler, Hosea, Joel, Amos, St. Benno Leipzig<br />
1985<br />
Eph 1, 3-14<br />
Exegetische Bemerkungen<br />
Ein Großteil der Bibelwissenschaftler geht<br />
davon aus, dass Paulus den Epheserbrief nicht<br />
selbst verfasst hat. Er soll einige Zeit nach<br />
seinem Tod entstanden sein und in paulinischer<br />
Tradition weitergeführt worden sein.<br />
Die Verse 3-14 im 1. Kapitel sind als ausführlicher<br />
Lobpreis Gottes gestaltet, nach<br />
Vorlage eines antiken Briefes. Die Kompaktheit<br />
der zentralen Heilsbotschaft und hymnisch<br />
überladene Sprache lassen den Text beim<br />
einmaligen Lesen kompliziert erscheinen.<br />
Zentrale Kernaussagen des Textes:<br />
1. Gott hat uns schon immer geliebt und<br />
will unser Heil.<br />
2. Durch Christus sind wir erlöst und<br />
gerettet.<br />
3. Durch den Heiligen Geist gehören wir<br />
jetzt schon zu Gott.<br />
Anmerkungen aus der Sicht der Nachhaltigkeit<br />
12.07.09<br />
Aus der festen Zusage und Überzeugung<br />
des Verfassers, dass jeder Mensch zuerst von<br />
Gott geliebt ist, ergibt sich, dass jeder<br />
Mensch die Aufgabe im Leben hat, darauf Der Mensch trägt in sich,<br />
Antwort zu geben. Das kann nur in Solidarität<br />
mit allen Menschen der Welt gesche- was er zur Bewahrung der<br />
hen und nicht auf Kosten der sog. „Dritten<br />
Welt“. Das, was der Mensch tut, soll zum Schöpfung und zur<br />
„Lob seiner (Gottes) herrlichen Gnade“ (V. 6a)<br />
geschehen. Somit ist es nicht mit einem Gerechtigkeit unter den<br />
Lebensstil vereinbar, der auf Kosten anderer<br />
geht, ein Lebensstil, der in Kauf nimmt, dass Menschen einbringen kann.<br />
durch ungerechte Verteilung der Güter,<br />
Menschen ihrer Existenzgrundlage entzogen<br />
werden. In und an uns Menschen muss ablesbar<br />
sein, dass wir als Gottes Söhne und<br />
Töchter leben. Gott will das Heil der<br />
Menschen und damit das Heil aller Menschen<br />
und Geschöpfe, und nicht nur derer, die gerade<br />
diesen Text lesen.<br />
„Mit aller Weisheit und Einsicht reich<br />
beschenkt“ – das könnte in der Predigt als<br />
Aufhänger genommen werden, dass der<br />
Mensch in sich trägt, was er zur Bewahrung<br />
der Schöpfung und zur Gerechtigkeit unter<br />
den Menschen einbringen kann. Jeder Mensch<br />
darf und soll kreativ sein und soll seinen<br />
Verstand benutzen.<br />
Es ist klar, dass nicht jeder Mensch die Eph 1, 3-14<br />
Möglichkeit hat, Großprojekte anzutreiben,<br />
zur gerechteren Verteilung der Güter und<br />
zum fairen Umgang mit den Ressourcen auf<br />
der Welt. Allerdings kann sich jeder Mensch<br />
überlegen, wo er in seinem begrenzten<br />
Bereich Möglichkeit hat, Schöpfung zu<br />
bewahren, z. B. durch Art und Weise des<br />
Aufbaus und der Pflege des eigenen Gartens,<br />
neue Lebensräume für Tiere zu schaffen, Verzicht<br />
auf Einsatz von chemischen Mitteln, ...<br />
Wichtig bei allem ist, nicht die moralische<br />
Keule zu schwingen, sondern aus der Liebe<br />
Gottes zu seinen Geschöpfen die eigene Ver- 103
104<br />
Mk 6, 7-13<br />
12.07.09<br />
Einsatz für Gerechtigkeit<br />
und Frieden, für<br />
Nachhaltigkeit erfordert,<br />
dies nicht nur in Worten zu<br />
tun, sondern auch Taten<br />
folgen zu lassen.<br />
antwortlichkeit herauszuspüren und wahrzunehmen.<br />
Ermutigung soll im Vordergrund<br />
stehen, und positive Handlungsoptionen sollen<br />
aufgezeigt werden.<br />
Mk 6, 7-13<br />
Biblischer Hintergrund<br />
Jesus ist in Galiläa unterwegs gewesen und<br />
hat das Reich Gottes verkündet. Dann kommt<br />
er wieder in seine Heimatstadt Nazareth<br />
zurück. Sein Auftreten und Wirken bleibt<br />
aber nicht ohne Widerspruch und Ablehnung.<br />
Nun beansprucht er seine Jünger und<br />
erteilt ihnen den ersten Missionsauftrag und<br />
startet damit einen neuen Anlauf seiner<br />
Verkündigung.<br />
Exegetische Anmerkungen und Impulse<br />
„V. 7 Er rief die Zwölf zu sich und sandte sie<br />
aus, jeweils zwei zusammen. Er gab ihnen die<br />
Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben.“<br />
Wenn die Jünger zu zweit ausgesandt werden,<br />
soll dies sowohl ein Zeichen für<br />
Gemeinschaft sein als auch die Glaubwürdigkeit<br />
erhöhen. Die Zwölf können<br />
gegenseitig Zeugen sein. Wer etwas erreichen<br />
will, schafft dies nicht im Alleingang.<br />
Jesus braucht seine Jünger, die im Namen<br />
Gottes unterwegs sein sollen.<br />
Unreine Geister – was können das sein?<br />
– Psychosomatische Krankheiten<br />
– Allmachtsvorstellungen von Menschen: Alles<br />
ist machbar<br />
– Vorstellungen von Menschen: nehmen und<br />
verbrauchen, solange die Rohstoffe, Ressourcen<br />
und Kapazitäten da sind, ohne Rücksicht<br />
auf Nachhaltigkeit und spätere Generationen<br />
– Gewissenlosigkeit: kein Gespür haben für<br />
die ganz persönliche Verantwortung, mit<br />
den Schätzen der Welt so umzugehen, dass<br />
es allen Menschen zum Leben dient.<br />
Impulse zum Nachdenken:<br />
– Wo suche ich nach Mitstreiterinnen und Mitstreitern<br />
in der Gemeinde oder in meinem<br />
Umfeld, um Projekte der Nachhaltigkeit<br />
durchzusetzen, z. B. im Pfarrgemeinderat<br />
beschließen, fair gehandelten Kaffee bei<br />
Gemeindefesten auszuschenken?<br />
– Jeder Christ hat eine Sendung und Berufung:<br />
Spüre ich den Auftrag an mich ganz<br />
persönlich, mich in der Gemeinschaft mit<br />
anderen für Nachhaltigkeit einzusetzen?<br />
„V. 8 Und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab<br />
nichts auf den Weg mitzunehmen, kein Brot,<br />
keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, V. 9 kein<br />
zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen.“<br />
Jesus gebietet den Jüngern, nichts mitzunehmen,<br />
was über den Augenblick hinaus<br />
Sicherheit geben könnte. Die Jünger werden<br />
so die Erfahrung machen, abhängig zu sein<br />
und müssen auf Bequemlichkeiten verzichten.<br />
Durch diese Erscheinung soll deutlich<br />
werden, dass sie tatkräftiges Zeugnis für die<br />
Einfachkeit, Armseligkeit und Sorglosigkeit<br />
der christlichen Botschaft ablegen. Wort und<br />
Tat stimmen überein.<br />
Impulse zum Nachdenken<br />
– Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden, für<br />
Nachhaltigkeit erfordert, dies nicht nur in<br />
Worten zu tun, sondern auch Taten folgen<br />
zu lassen.<br />
– Frieden heißt nicht nur keinen Krieg führen,<br />
sondern z. B. auch in der eigenen Ausdrucksweise<br />
gewaltfrei zu sprechen.<br />
– Bin ich beim Autokauf darauf bedacht, ein<br />
Auto nach dem Spritverbrauch zu beurteilen<br />
oder nur nach dem Gefallen? Unabhängig<br />
davon, ob der Sprit teuer oder billig<br />
ist?<br />
– Suche ich nach Alternativen in meiner<br />
Fortbewegung? Bus, Bahn, Fahrgemeinschaft...<br />
– Kaufe ich ein größeres Auto, weil ich einmal<br />
im Jahr im Urlaub fahre und da möglichst<br />
viel mitnehmen möchte? Schwereres<br />
Auto, höherer Spritverbrauch<br />
– Es gibt so viele Dinge zu kaufen, die man<br />
einfach nicht braucht, auch wenn sie<br />
bequem sein könnten. Lasse ich mich verführen?<br />
Nur mal ausprobieren?<br />
– Wenn ich eine Wanderung unternehme,<br />
muss ich alles Mögliche einpacken oder begnüge<br />
ich mich auch mit dem Notwendigen?<br />
Wer alles klein einpackt, produziert<br />
unnötigen Verpackungsmüll. Mehrwegbehältnisse<br />
– Wenn ich nur das Notwendige dabei habe,<br />
kann ich den Augenblick viel eher wahr-
nehmen, bin ich viel aufmerksamer für das<br />
Spontane und Ungeplante, was mir geschenkt<br />
wird. Ich kann mich viel eher auf<br />
das Einlassen, was mir vor Ort begegnet.<br />
„V.10 und er sagte zu ihnen: Bleibt in dem<br />
Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder<br />
verlasst. V. <strong>11</strong> Wenn man euch aber in einem Ort<br />
nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann<br />
geht weiter und schüttelt den Staub von euren<br />
Füßen, zum Zeugnis gegen sie.“<br />
Füße abschütteln gilt als symbolisches<br />
Gericht, vgl. Mk 6, 4 ff. Die Jünger sollen<br />
sich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es<br />
ihnen gegenüber keine Ablehnung geben<br />
würde. Jesus macht bei seinem Missionsauftrag<br />
gleich auf dieses Thema aufmerksam<br />
und gibt ihnen Anweisung zum Handeln.<br />
Impulse zum Nachdenken<br />
– Wer sich für Nachhaltigkeit einsetzt, wird<br />
nicht überall mit offenen Armen empfangen.<br />
Bin ich so realistisch?<br />
– Wer Menschen gewinnen möchte, sich<br />
gemeinsam für ökologisch-soziales Handeln<br />
einzusetzen, wird auch immer wieder die<br />
Erfahrung machen, dass Menschen nicht<br />
bereit sind, sich mit diesen Gedanken konfrontieren<br />
zu lassen. Führe ich gleich Gericht<br />
gegen sie, oder habe ich im Hinterkopf,<br />
dass für sie vielleicht noch nicht der<br />
„Kairos“ da ist, in dem sie dafür empfänglich<br />
sind?<br />
V. 12 Die Zwölf machten sich auf den Weg und<br />
riefen die Menschen zur Umkehr auf. V. 13 Sie trieben<br />
viele Dämonen aus und salbten viele Kranke<br />
mit Öl und heilten sie.“<br />
Auffällig ist, dass Jesus seine Jünger nicht<br />
damit beauftragt, das Reich Gottes zu verkünden,<br />
sondern „nur“ die Menschen zur<br />
Umkehr aufzurufen, Dämonen auszutreiben<br />
und Kranke zu heilen. Die Jünger sollen<br />
praktische Spuren hinterlassen.<br />
Impulse zum Nachdenken<br />
– Wer andere zur Umkehr aufruft, muss auch<br />
selbst bereit sein umzukehren.<br />
– Gilt Umkehr im ökologischen Bereich nur<br />
in meiner Einstellung, oder gehe ich tatsächlich<br />
in den Bioladen?<br />
– Lerne ich umzudenken, Geldanlagen auch<br />
nach ethischen Gesichtspunkten zu beurteilen<br />
oder nur nach einem günstigen Ertrag<br />
für meinen Geldbeutel?<br />
– Wer sich für Nachhaltigkeit einsetzt, setzt<br />
sich für Heilung ein. Ziel meines Anspruches,<br />
Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen<br />
zu verwirklichen, sollte das<br />
„magis“, ein Mehr an Leben sein.<br />
– Umkehr im Sinne der Nachhaltigkeit<br />
heißt: Effizienz, Suffizienz, Konsistenz optimieren.<br />
Gedanken zur Jahreszeit<br />
Sommerzeit, Urlaubszeit: mal etwas ausprobieren,<br />
sich auf Neues einlassen<br />
– sich Zeit nehmen herauszufinden, wo ich<br />
Menschen in meiner Umgebung finde, die<br />
sich auch mit dem Thema der Nachhaltigkeit<br />
beschäftigen, Institutionen aufsuchen<br />
– sich Zeit nehmen, nach Alternativen von<br />
ökologischer Verwertbarkeit zu suchen<br />
– sich Zeit nehmen, sich auf Notwendiges zu<br />
beschränken, nicht alles vorzuplanen.<br />
Elisabeth Geisler, Waldems-Esch<br />
12.07.09<br />
105
106<br />
Mt 28, 16-20<br />
... weil eine Erbschaft per se<br />
<strong>nachhaltig</strong> ist: Etwas<br />
Erlebtes, Erkanntes,<br />
Erfahrenes soll weiterwirken,<br />
lebendig bleiben.<br />
Jer 23, 1-6<br />
19.07.09 16. Sonntag im Jahreskreis / 6. Sonntag nach <strong>Trinitatis</strong><br />
ev. Reihe I: Mt 28, 16-20 kath. 1. L.: Jer 23, 1-6 kath. 2. L.: Eph 2, 13-18 kath. Evang.: Mk 6, 30-34<br />
Der Autor betrachtet alle Bibelstellen des Sonntags. Stichworte zur Nachhaltigkeit:<br />
Erbschaft, Vermächtnisse sind per se <strong>nachhaltig</strong> – es geht um die<br />
Fortführung des Gegebenen (Ökologie – Oikos – Haus Gottes), das Erbe<br />
aufrichtig und angstfrei annehmen (Mt 28); es gibt Anlass zur Klage – wie<br />
bei Jeremias (Klimapolitik, Globalisierungsopfer, ...) – wir sollen klagen<br />
und uns dabei ruhig auf Gott berufen (Jer 23); Zusammenhänge erkennen,<br />
im Frieden zusammenleben – nur so gedeiht das Oikos als Gesamtes<br />
(Eph 2); bei der Speisung der Hungernden (nach Essen, Gerechtigkeit,<br />
Bildung, ...) nicht skeptisch sein, sondern einfach einmal anfangen (Mk 6)<br />
Matth. 28, 16-20<br />
Zum Text<br />
Als Verfasser des ersten Evangeliums wird<br />
ein Matthäus genannt und auf jenen bekehrten<br />
Zolleinnehmer verwiesen, der bei Markus<br />
und Lukas Levi heißt. Da das Evangelium<br />
jedoch den Untergang Jerusalems voraussetzt<br />
und eher um das Jahr 80 herum verfasst sein<br />
dürfte, ist ein nicht näher bekannter, judenchristlicher<br />
Lehrer, der selbst ein Apostelschüler<br />
war, als Verfasser anzusehen. Quelle<br />
seines Werkes ist zum einen das Markusevangelium,<br />
dann eine Spruch- und Redesammlung,<br />
die auch von Lukas benutzt<br />
wurde, sowie Sondergut. Der Abschnitt 28,<br />
16-20 erneuert die in Kapitel 10 berichtete<br />
Sendung der Jünger durch den „noch irdischen“<br />
Jesus, nun aber erweitert zum weltweiten<br />
Auftrag. Parallelen finden sich in<br />
Lukas 24, 47 und auch Johannes 20, 21.<br />
Predigtgedanken<br />
Der Text hat testamentarische Züge und<br />
lässt sich zugleich auf das Erleben eines<br />
Gottesdienstes beziehen. Die Jünger Jesu<br />
haben die Gemeinschaft mit ihm wie einen<br />
Gottesdienst erlebt, und nun verfügt der<br />
Testament-Geber: „Geht in den Alltag und<br />
haltet all das lebendig, lasst all das lebendige<br />
und alltägliche Wirklichkeit werden, was Ihr<br />
hier erkannt und erlebt habt.“ Um Nachhaltigkeit<br />
geht es hier, weil eine Erbschaft<br />
per se <strong>nachhaltig</strong> ist: Etwas Erlebtes, Erkanntes,<br />
Erfahrenes soll weiterwirken, lebendig<br />
bleiben. Und es geht auch im weiteren<br />
Sinne um Ökologie. Denn der Inhalt des<br />
Erbes ist das Ganze, das Umfassende. Der<br />
Mensch Jesus verkörpert das „Haus Gottes“.<br />
Wer da auf sein Erbe schaut, wird auch auf<br />
erlebte Heilungen zurückblicken und auf<br />
verantwortliches Miteinander mit dem Ziel<br />
„Dass alle leben!“ Der Auftrag „Gebt IHR<br />
ihnen zu essen!“ gehört dazu genau so wie die<br />
Ermöglichung von Neuanfängen und die Ermutigung<br />
dazu.<br />
Hier können je nach örtlicher Gegebenheit<br />
und Interesse der Hörenden einzelne Stücke<br />
der „Erbmasse“ benannt, vertieft und in ökologische<br />
Bezüge gebracht werden. Als Kernaussage<br />
des Textes ist dabei das „Ich bin bei<br />
Euch alle Tage“ nicht zu vergessen. Trost und<br />
Stärkung durch nahestehende Menschen wie<br />
Eltern und Großeltern gegenüber einem Kind,<br />
später dann Freunde oder Ehepartner sind das<br />
Eine, darüber hinaus sind diese Worte die<br />
unbegrenzt gültige Zusage Gottes, die im<br />
gottesdienstlichen Geschehen sowohl mit der<br />
Feier der Taufe als auch mit der des Abendmahls<br />
vergegenwärtigt wird. In Umkehrung<br />
der bekannten „Barmer These“ ist hier dann<br />
daran zu erinnern, dass Gottes „Anspruch auf<br />
unser ganzes Leben“, wovon gern und mit Recht<br />
gerade im Zusammenhang mit ökologischer<br />
Verantwortung der Christen gesprochen wird,<br />
zugleich „Gottes gnädiger Zuspruch“ ist. Manche<br />
Erben haben ihre Schwierigkeiten damit,<br />
das Erbe anzunehmen, weil es ihnen als all zu<br />
große Last vorkommt. Wie gut, wenn dann der<br />
Erblasser ihnen die Ermutigung zusagte: „Habt<br />
keine Angst, ich bin bei Euch alle Tage!“<br />
Jeremia 23, 1-6<br />
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong><br />
Zum Text<br />
Der Text gehört zu dem Teil des Jeremiabuches,<br />
in dem Prophetenworte gegen<br />
Juda und Jerusalem zur Zeit der Könige<br />
Joschija bis Zidikia gesammelt sind. Unter<br />
König Joschija zum Propheten berufen, wen-
det Jeremia sich zunächst gegen die noch<br />
nachwirkenden religiösen und ethischen Missstände.<br />
Joschija, der eine umfassende Reform<br />
des Jahweglaubens veranlasst, findet die Zustimmung<br />
Jeremias auch zu seiner Lossagung<br />
vom zerfallenden Assyrerreich. Unter König<br />
Jojakim (609-597) werden die Reformen rückgängig<br />
gemacht, und heidnische Sitten greifen<br />
erneut um sich. Der Prophet protestiert<br />
leidenschaftlich – auch gegen die Regierung<br />
– und wird verfolgt. Tief enttäuschen ihn der<br />
Misserfolg seiner Verkündigung und seiner Warnungen,<br />
der Unglaube seiner Zuhörer und die<br />
Nachstellung sogar durch seine Verwandtschaft.<br />
Von der Verschleppung nach Babylon<br />
bleibt er verschont. König Zidikija lässt ihn<br />
als Verräter verhaften, weil er die anti-babylonische<br />
Politik kritisiert hat. Jeremia setzt seine<br />
harsche Kritik aber selbst aus dem Gefängnis<br />
heraus fort. Nach weiteren Unruhen flieht<br />
Jeremia ins ägyptische Exil. Seine leidenschaftliche<br />
Kritik und Klage wie sein ebenfalls leidenschaftlicher<br />
Trost, gipfelnd in der „Verheißung<br />
des neuen Bundes“, sind sein Vermächtnis.<br />
Predigtgedanken<br />
Der Text beginnt mit einem „Weheruf“ im<br />
Namen Gottes. Gottes Urteil gegen die falschen<br />
Hirten wird proklamiert, – gegen den<br />
König, seine Berater, seine Hofpropheten, die<br />
ganze „PR-Abteilung“, gegen alle maßgeblichen<br />
Kräfte, die am Zustand des Volkes Juda<br />
wie auch Israels schuldig sind. Alle sie sind<br />
die schlechten Hirten. Jeremia präsentiert<br />
sich hier als durch und durch politischer<br />
Prophet, der ohne jede Scheu die Autorität<br />
Gottes für seine Klage in Anspruch nimmt.<br />
Eine derartige „Einmischung in die Politik“<br />
durch kirchliche Instanzen oder Personen<br />
wäre heutzutage kaum vorstellbar, aber<br />
durchaus geboten!? Es wird nicht schwer<br />
sein, Gegebenheiten und Geschehnisse der<br />
Gegenwart zu benennen, die dem Unglauben<br />
und ethischen Verfall im Königreich Juda zur<br />
Zeit Jeremias entsprechen. „Es gilt ... ein<br />
offenes Bekenntnis ...“ (eg 136, 4), auch wenn<br />
wir genau wie Jeremia die Erfahrung machen<br />
werden, nur wenig Gehör zu finden. Gerade<br />
in den gesellschaftlichen Bereichen, die mit<br />
den Schlagworten einer ökumenischen<br />
Dekade benannt werden – Frieden, Gerechtigkeit<br />
und Bewahrung der Schöpfung „brüsten<br />
Unglaub’ und Torheit sich frecher jetzt<br />
als je“ (eg 136, 3). Globalisierung hat durch-<br />
aus etwas mit der „Zerstreuung der Schafe“<br />
zu tun, wenn sie eben nicht als globale Verantwortung<br />
zum Wohl aller verstanden wird. Dazu<br />
gehörte, „dass alle satt werden“ (Brot-für-die-<br />
Welt), und das setzt Bewahrung der Schöpfung<br />
voraus. Die bisher verfolgte Klimapolitik mit<br />
ihren Scheinlösungen und Ausflüchten gäbe<br />
einem Jeremia genug Anlass zur Klage.<br />
Er würde es andererseits an leidenschaftlichem<br />
Trost nicht fehlen lassen: Augen auf für<br />
die bestellten neuen Hirten! Es gibt sie immer<br />
wieder, die Verantwortungsbewussten in Politik,<br />
Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft.<br />
Ist es überheblich oder vermessen, in solchen<br />
Hoffnungsträgern Bevollmächtigte Gottes zu<br />
sehen? Und ist es naiv oder unzeitgemäß,<br />
eine trotzige Hoffnung auf DEN Hirten zu<br />
setzen, den Schöpfer und Bewahrer allen<br />
Lebens? Jeremia hatte zu seiner Zeit gewiss<br />
nicht den konkreten Menschen Jesus aus<br />
Nazareth vor Augen, wohl aber die Vision,<br />
dass Gott sehr konkret in unsere Geschichte<br />
eintreten wird. Er ist DER gute Hirte, der<br />
sich im Glauben der Christen im Menschen<br />
Jesus verkörpert. Weil er Gott ist, ist sein<br />
Eintreten in unsere Geschichte Grund zur Hoffnung<br />
und gegen alle Verzweiflung und<br />
Selbstaufgabe. Weil er zugleich der Mensch<br />
Jesus ist, wissen wir, was wir von seinem<br />
Eintreten zu erwarten haben.<br />
Epheser 2, 13-18<br />
Zum Text<br />
Der Epheserbrief zählt zu den paulinischen<br />
Schriften, wobei der Verfasser durchaus auch<br />
ein Schüler des Apostels gewesen sein kann.<br />
Der Gestaltung nach ist das Schreiben ein<br />
Brief, nach Stil und Inhalt jedoch eher eine<br />
Predigt: Im Eingangsteil finden sich Gotteslob<br />
und Fürbitte, am Ende ein liturgischer<br />
Lobpreis. Predigtthema ist die Kirche, und<br />
zwar die weltweite mit Christus als Herrn<br />
und Haupt. Das wird inhaltlich in den Kapiteln<br />
1 bis 3 entfaltet, wozu der Predigttext<br />
zählt.<br />
19.07.09<br />
Augen auf für die bestellten<br />
neuen Hirten! Es gibt sie<br />
immer wieder, die<br />
Verantwortungsbewussten in<br />
Politik, Kultur, Wirtschaft<br />
und Wissenschaft.<br />
Eph 2, 13-18<br />
Predigtgedanken<br />
Um Frieden geht es in dieser Predigt, und<br />
zwar um DEN Frieden, der durch Jesus verkörpert<br />
wird, um den Frieden zwischen Gott<br />
und den Menschen und den der Menschen<br />
untereinander, hier insbesondere der Juden<br />
und der Heiden. Wobei aus christlicher Sicht 107
108<br />
Wahre Wunder gibt es<br />
immer wieder; wir müssen<br />
sie nur tun. Geben wir den<br />
Hungernden zu essen.<br />
Mk 6, 30-34<br />
19.07.09<br />
wohl zu beachten ist, dass Paulus die angestammten<br />
Hausgenossen Gottes im Judentum<br />
verwurzelt sieht, und hinzu kommen<br />
dürfen die neuen, die ehemaligen Heiden.<br />
Doch sagen uns diese Verse etwas zu Nachhaltigkeit<br />
und Ökologie? Vielleicht, wenn<br />
wir Ökologie nicht gleich verkürzt mit Umweltfragen<br />
erklären, sondern weiter als Lehre<br />
vom ganzen Haus des Lebens verstehen.<br />
Damit es ein Haus des Lebens sein kann bzw.<br />
werden kann, muss Frieden sein bzw. werden.<br />
Weitere Stich- und Anreizworte im Text lohnen<br />
ein vertiefendes Nachdenken: fremd und<br />
ausgeschlossen sein (Vers 12), einander fern<br />
oder nahe sein (Vers 13), Jesus als verkörperter<br />
Friede (Vers 14), zu neuen Menschen<br />
gemacht werden (Vers 15), Friede den Fernen<br />
und den Nahen (Vers 17), Alle in einem<br />
Geist Zugang zu Gott (18). ...<br />
Sind das nicht alles zu vertiefende Verheißungen<br />
für jene Menschen, die sich<br />
Gedanken oder auch Sorgen machen über die<br />
weitere Entwicklung der menschlichen Beziehungen<br />
zu- bzw. gegeneinander? Und<br />
natürlich gehört in solches An- und Weiterdenken<br />
dann auch das Verständnis von und<br />
das Verhältnis zur außermenschlichen Mitwelt.<br />
Dass die GANZE Kreatur nach Erlösung und<br />
Frieden seufzt, gehört auch zum theologischen<br />
Vermächtnis des Paulus. Gewiss verbietet<br />
es sich, in diesem Text aus dem<br />
Epheserbrief eine Art „Paulinischer Ökologie“<br />
erkennen zu wollen. Gewiss geht es im<br />
Kern um das Verhältnis von Judentum und<br />
Christentum und damit um die Verwurzelung<br />
des Christlichen im jüdischen Glauben,<br />
um Frieden und Versöhnung. Es verbietet<br />
sich jedoch nicht, auf der Basis solchen<br />
An-Denkens (Andacht) weiterzudenken und<br />
die gesamte „Hausgenossenschaft Gottes“ und<br />
ihren Frieden mit in den Blick zu nehmen.<br />
Markus 6, 30-44<br />
Zum Text<br />
Markus gilt als Verfasser des ältesten, griechisch<br />
geschriebenen Evangeliums (um 70 n.<br />
Chr. vermutlich in Rom), als Mitarbeiter des<br />
Paulus und später des Petrus. Er sammelte<br />
Überlieferungen über das Leben, Wirken und<br />
Lehren Jesu (Wundererzählungen, Gleichnisse,<br />
Einzelworte und Passionsberichte), ordnete<br />
diese zeitlich und sachlich und verarbeitete<br />
sie so zu seinem Evangelium. Der vorlie-<br />
gende Text gehört von der Gattung her zu<br />
den Wundererzählungen.<br />
Predigtgedanken<br />
Die Sättigung der Vielen ist Thema in allen<br />
vier Evangelien und damit ein Kernthema<br />
der frühen christlichen Überlieferung. Dabei<br />
gehören Eingangsgebet und Brotbrechen<br />
schon zu jedem traditionellen jüdischen<br />
Mahl. Zugleich wird voraus gewiesen auf die<br />
Stiftung des Abendmahls und die künftige<br />
Mahlfeier der Gemeinde – damit aber auch<br />
darauf, dass diese Mahlfeier zugleich ein<br />
Sättigungsmahl war, bei dem besonders die<br />
Armen der Gemeinde versorgt wurden. Dass<br />
noch zwölf Körbe mit Brot übrig blieben, ist<br />
nicht Zeichen für orientalische Übertreibung<br />
seitens der Erzähler, sondern veranschaulicht<br />
die Fülle des Segens, den Gott in der Person<br />
und im Wirken Jesu zu Teil werden lässt,<br />
und steht für seine unermessliche Güte.<br />
Kernsatz der Erzählung ist für mich jedoch<br />
Vers 37: „Gebt doch ihr ihnen zu essen!“ Und<br />
das eigentliche Wunder ist, dass sie es tun –<br />
trotz aller klugen Vorbehalte und Ausreden.<br />
Was sie – was wir – dann im Namen Jesu und<br />
in der Gemeinschaft mit ihm tun, ist eben,<br />
etwas von der unermesslichen Güte Gottes,<br />
von seinem Segen weiter zu geben. Und das<br />
konkret, handfest, nicht nur in wohl klingenden<br />
Worten und Programmen. Womit wir<br />
wieder beim Abendmahl sind und seinem<br />
Kern: „Dies ist mein Leib.“ Das Wort ward<br />
Fleisch. Worte und Programme mit Hand<br />
und Fuß sind gefragt – und sind möglich.<br />
Und von wegen Wunder: Wahre Wunder<br />
gibt es immer wieder; wir müssen sie nur<br />
tun. Geben wir den Hungernden zu essen.<br />
Damit ist dann die globale Verantwortlichkeit<br />
angesprochen, die sich natürlich nicht<br />
Lebensmitteltransporten erschöpft. Beim<br />
Abendmahl feiert auch nicht in fröhlicher,<br />
sättigender Runde eine Teil-Gemeinschaft,<br />
die dann gnädig etwas von ihrem Kuchen für<br />
die Armen der Welt übrig hat – sondern die,<br />
die Armen der Welt, sind Teil der Gemeinde<br />
und von uns genau so zu sehen und nicht als<br />
Empfänger unserer Mildtätigkeit. „Gebt ihr<br />
ihnen zu essen“ ist damit die Aufforderung<br />
zum gerechten Teilen. Und da sind wir in der<br />
Tat gefordert.<br />
Wilfried Stender, Essen
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong><br />
Stellung im Kirchenjahr<br />
Der heutige Evangelientext ist in der evangelischen,<br />
wie in der katholischen Leseordnung,<br />
der Bericht der Brotvermehrung bei<br />
Johannes. In der katholischen Leseordnung<br />
folgen auf die Berichte aus dem für das Lesejahr<br />
B sonst üblichen Evangelium des Markus<br />
fünf Lesungen aus dem 6. Kapitel des Johannesevangeliums.<br />
Der Text des 17. Sonntags<br />
schließt sich aber trotzdem organisch an<br />
den an sich fälligen Markustext an, denn auch<br />
bei Markus wäre die Brotvermehrungserzählung<br />
an der Reihe. Als Lesungstext wird<br />
das alttestamentliche Pendant zur Brotvermehrung<br />
aus dem zweiten Buch der Könige<br />
gelesen. Der neutestamentliche Text aus dem<br />
Epheserbrief schlägt die Brücke zum Begriff<br />
der Einheit und Gemeinschaft.<br />
Überlegungen zu Joh 6, 1-15<br />
Exegetische Überlegungen<br />
17. Sonntag im Jahreskreis / 7. Sonntag nach <strong>Trinitatis</strong><br />
Die Autorin betrachtet alle genannten Bibelstellen, wobei sie die alttestamentliche<br />
Lesung in ihre Überlegungen zu Joh 6 einbezieht. Stichworte<br />
zur Nachhaltigkeit: Bei globaler sozialer Gerechtigkeit geht es<br />
nicht nur um die Verteilung, sondern um die Schaffung von Strukturen /<br />
Fairer Handel, Würde – Schaffung einer Win-win-Situation (Joh 6 / 2 Kön 4);<br />
Konziliarer Prozess Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung<br />
– Helfen durch Partnerschaft statt anonyme Spenden (Eph 4)<br />
Mit Kapitel 6 des Johannesevangeliums<br />
wechselt der Ort der Handlung von Jerusalem<br />
nach Galiläa. Der heutige Evangelientext ist<br />
der Beginn der großen Brotrede. Diese<br />
erstreckt sich von dem vorliegenden Text, der<br />
Speisung der 5.000, über das Wunder des<br />
Seewandels (6, 16 ff.) bis hin zum Bekenntnis<br />
des Petrus: „Du bist der Heilige Gottes“ (6,<br />
69). In Vers 6, 41 findet sich das erste „Ichbin-Wort“,<br />
in dem Jesus sich als das „Brot<br />
des Lebens“ bezeichnet. Die Volksmenge, die<br />
Augenzeuge der Zeichen Jesu an den Kranken<br />
wurde, folgt Jesus, wohl in Erwartung<br />
weiterer Wunder, nach. Die Frage Jesu, wo es<br />
Brot zu kaufen gibt, scheint eher ein Test zu<br />
sein als eine wirkliche Frage, „denn er wusste<br />
selbst, was er tun wollte“ (6, 6). Es ist ja auch<br />
ganz offensichtlich, dass die Jünger keine<br />
200 Denare (das Jahreseinkommen eines<br />
Arbeiters) haben, um die riesige Menge satt<br />
zu bekommen. In Vers 10-13 folgt das<br />
eigentliche Wunder. Mit fünf Gerstenbroten<br />
und zwei Fischen (die ein Kind dabei hat)<br />
macht Jesus, nachdem er das Dankgebet gesprochen<br />
hat, fünftausend Männer (die Frauen<br />
und Kinder werden nicht gezählt) satt. Am<br />
Ende bleiben sogar noch zwölf Körbe übrig,<br />
mehr als zu Beginn da war. Die Menschen, die<br />
anwesend sind, ziehen den Schluss: „Dieser<br />
ist wirklich der Prophet, der in die Welt<br />
kommt“ (6, 14).<br />
Verbindung zur alttestamentlichen Lesung<br />
(2 Kön 4)<br />
Eine ähnliche Form wie die Erzählung der<br />
Brotvermehrung des Jesus findet sich auch<br />
schon im alten Testament, im zweiten Buch<br />
der Könige, welches die alttestamentliche<br />
Lesung des Sonntag ist. Hier ist es der<br />
Prophjet Elischa, der mit zwanzig Gerstenbroten<br />
und einigen frischen Körnern einhundert<br />
Männer satt macht. Die große Ähnlichkeit<br />
hat Bibelwissenschaftler vermuten lassen,<br />
dass die Geschichte von Elischa einfach<br />
nur auf Jesus übertragen wurde. Selbst wenn<br />
das so wäre, muss man sich trotzdem fragen,<br />
„was denn bei Jesus so Eindrückliches geschah,<br />
dass eine solche Geschichte auf ihn<br />
übertragen und dabei typisch neu gestaltet<br />
wurde.“ 1<br />
Bedeutung für Ökologie und Nachhaltigkeit<br />
26.07.09<br />
ev. Reihe I: Joh 6, 1-15 kath. 1. L.: 2 Kön 4, 42-44 kath. 2. L.: Eph 4, 1-6 kath. Evang.: Joh 6, 1-15<br />
2 Kön 4, 42-44<br />
Joh 6, 1-15<br />
Nicht die Jünger teilen, wie in den Berichten<br />
der Brotvermehrung bei den Synoptikern,<br />
das Brot aus, sondern Jesus selbst gibt, und<br />
plötzlich ist aus dem scheinbar Wenigen ein 109
<strong>11</strong>0<br />
26.07.09<br />
Nachhaltigkeit muss nicht<br />
immer sparen bedeuten.<br />
Es kann sein, dass alle<br />
mehr davon gewinnen,<br />
wenn sie geben.<br />
Überfluss geworden. Woher kommt der<br />
Überfluss? Darüber haben sich schon jahrhundertelang<br />
TheologInnen die Köpfe zerbrochen.<br />
Eine Theorie besagt, dass Jesus es<br />
schafft, dass die Menschen ihre Angst überwinden.<br />
Ihre Angst, zu kurz zu kommen, ihre<br />
egoistische Angst, die sie in die Vereinzelung,<br />
in die innere Einsamkeit treibt. Im<br />
Evangelium ist die Rede davon, dass Jesus<br />
die Leute auffordert, sich zusammenzusetzen.<br />
Sie tun, wie ihnen geheißen, und vielleicht<br />
legen sie das Wenige zusammen, was sie mitgebracht<br />
haben. Und im Zusammenlegen<br />
erfahren sie Ergänzung und Bereicherung.<br />
Zwei Dinge werden dabei klar:<br />
1. Wer zusammensitzt, der schaut sich an,<br />
für den ist die Lage überschaubar. Das nimmt<br />
Angst, das nimmt Bedrohlichkeit. Wenn<br />
Menschen zusammensitzen und zusammen<br />
essen, Mahl halten, entsteht Beziehung. Und<br />
in dem heutigen Evangelium wird diese<br />
Beziehung mit Gott in Verbindung gebracht.<br />
Er ist der Urheber dieser Beziehung.<br />
2. Nachhaltigkeit muss nicht immer sparen<br />
bedeuten. Es kann sein, dass alle mehr<br />
davon gewinnen, wenn sie geben.<br />
Auf die Weltsituation übertragen kann das<br />
heißen:<br />
Wenn Hungernde, also die Entwicklungsländer,<br />
mit an unseren Tischen sitzen dürfen,<br />
also auf gleicher Augenhöhe, verlieren wir<br />
nicht, wir gewinnen auch. Es entsteht Beziehung,<br />
und auch wir werden beschenkt.<br />
Und: Dann geht es nicht mehr „nur“ um<br />
Lebensmittel, sondern dann geht es um die<br />
Würde und den Wert jedes einzelnen Menschen.<br />
Es geht um gerechte Strukturen, die<br />
nicht von Abhängigkeit geprägt sind. Solche<br />
Strukturen schaffen nicht nur Beziehung, sondern<br />
auch Gerechtigkeit und Frieden. Ein<br />
kleiner Schritt dahin sind die fair gehandelten<br />
Produkte. Sie orientieren sich nicht am<br />
Preiskampf der Unternehmer, sondern an der<br />
Leistung der Erzeuger. Die Konsumenten<br />
bekommen für den höheren Preis, den sie<br />
bezahlen, aber auch etwas: hochwertige Produkte,<br />
die sozial gerecht und umweltverträglich<br />
produziert wurden.<br />
Praktische Vorschläge zur Umsetzung<br />
Das Hungertuch aus dem Jahr 2004 macht<br />
deutlich, dass es nicht um das Brot alleine<br />
geht, sondern auch um die Beziehung, die<br />
beim gemeinsamen Essen bzw. Teilen entsteht.<br />
Als Ergänzung kann auch die folgende<br />
Geschichte gelesen werden:<br />
Das halbe Brot<br />
Als der Arzt Professor Dr. Breitenbach gestorben<br />
war, gingen seine drei Söhne daran, das Erbe<br />
ihres Vaters getreu seinem letzten Willen unter sich<br />
zu verteilen. Da waren alte, noch handgeschnitzte<br />
Eichenmöbel, schwere Teppiche, kostbare Gemälde.<br />
Und dann war da noch eine Vitrine, ein schmaler,<br />
hoher Glasschrank mit vergoldeten Füßen und<br />
geschliffenen Scheiben. In diesem Schrank waren<br />
Erinnerungsstücke aufbewahrt. Behutsam wurde<br />
Stück um Stück herausgenommen. Als die Brüder<br />
das unterste Fach öffneten, stutzten sie. In grauem<br />
Seidenpapier eingewickelt lag da ein ziemlich großes,<br />
hartes Stück. Was kam zum Vorschein? – Ein<br />
steinhart gewordenes halbes Brot! Die alte Haushälterin<br />
erzählte den erstaunten Söhnen die<br />
Geschichte dieses Brotes: In der schweren Notzeit<br />
nach dem Ersten Weltkrieg (1914-1918) war der<br />
alte Herr einmal schwer krank gewesen. Zu der<br />
Erkrankung war ein allgemeiner Erschöpfungszustand<br />
getreten, so dass die behandelnden Ärzte<br />
etwas von kräftiger Nahrung murmelten und dann<br />
entmutigt die Achseln zuckten. Gerade in jener<br />
kritischen Zeit hatte ein Bekannter ein halbes Brot<br />
geschickt. Sosehr sich der Professor auch über diese<br />
Gabe freute, aß er sie doch nicht. Er wusste, dass<br />
im Nachbarhaus die Tochter des Lehrers krank<br />
war und Hunger litt. Er sagte damals: „Was liegt<br />
schon an mir altem Mann, das junge Leben<br />
braucht es nötiger“, und so musste die Haushälterin<br />
das halbe Brot den Lehrersleuten bringen.<br />
Wie sich später herausstellte, hatte auch die<br />
Lehrerfrau das Brot nicht behalten wollen, sondern<br />
an eine alte Witwe weitergegeben, die in einer<br />
Dachkammer ein Notquartier gefunden hatte. Aber<br />
auch damit war die seltsame Reise des Brotes noch<br />
nicht zu Ende. Die Alte trug es zu ihrer Tochter,<br />
die nicht weit von ihr mit ihren beiden Kindern in<br />
einer Kellerwohnung Zuflucht gefunden hatte. Diese<br />
Tochter wieder erinnerte sich daran, dass ein paar<br />
Häuser weiter ein Arzt krank war, der einen ihrer<br />
Buben kürzlich bei schwerer Krankheit behandelt<br />
hatte, ohne etwas dafür zu verlangen. Sie nahm<br />
das halbe Brot unter den Arm und ging damit zur<br />
Wohnung des Doktors. „Wir haben es sogleich wieder<br />
erkannt!“, schloss die Haushälterin. „Als der<br />
Herr Professor das Stück Brot wieder in den<br />
Händen hielt und von dessen Wanderung hörte,
war er tief bewegt und sagte. „Solange noch die<br />
Liebe unter uns ist, habe ich keine Furcht um uns.“ 2<br />
Überlegungen zu Eph 4, 1-6<br />
Exegetische Überlegungen<br />
Der Brief an die Epheser ist wahrscheinlich<br />
nicht von Paulus selbst, sondern von einem<br />
„Schüler“ des Paulus nach dessen Tod geschrieben<br />
worden. Auch handelt es sich nicht<br />
im eigentlichen Sinn um einen Brief, sondern<br />
eher um eine Epistel, genauer noch ein theologisches<br />
Lehrschreiben. 3 Während die ersten<br />
drei Kapitel sich eher auf der theoretischen<br />
Ebene mit Gemeinde befassen und<br />
einen hohen Abstraktionsgrad aufweisen,<br />
wird der Verfasser ab Kapitel vier konkreter,<br />
und es folgt der eher praktische Teil des<br />
Briefes. Gut erkennbar ist die Zäsur auch<br />
durch das Gebet am Ende des 3. Kapitels, das<br />
mit dem Wort „Amen“ abschließt. In den<br />
vorangegangenen Kapiteln wurde auf der<br />
theoretischen Ebene erklärt, was Gott in seiner<br />
Gnade geplant hat, damit die Menschen<br />
das Heil bekommen können. Jetzt schließen<br />
sich praktische Folgerungen aus dem zuvor<br />
Gesagten an. Dazu zählen „Haltungen, auf<br />
die es im Gemeinschaftsleben der Getauften<br />
besonders ankommt“ 4 (4, 2-4): Demut,<br />
Friedfertigkeit, Geduld. Die Aufforderung,<br />
sich um die Einheit zu bemühen (das griechische<br />
Wort enotes kommt in dieser Form im<br />
NT nur hier und in 4, 13 vor), wird in den<br />
Versen vier bis sechs ausgeführt und erklärt.<br />
Sieben Faktoren sind es, die die Einheit begründen:<br />
Ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr,<br />
ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater.<br />
Überlegungen zur Ökologie und Nachhaltigkeit<br />
Der Epheserbrief, besonders die zur heutigen<br />
Lesung gehörenden Verse drei bis sechs<br />
des vierten Kapitels, ist einer der biblischen<br />
Texte, auf den sich die ökumenischen Bemühungen<br />
stützen. Dabei geht es neben allen<br />
Einheitsbemühungen auch um einen gemeinsamen<br />
Lernweg der christlichen Kirchen, der<br />
unter dem Begriff „Konziliarer Prozess“<br />
zusammengefasst ist.<br />
Auf der VI. Vollversammlung des Ökumenischen<br />
Rates der Kirchen (ÖRK) in<br />
Vancouver (Kanada) 1983 schlug die DDR-<br />
Delegation ein gesamtchristliches Friedens-<br />
konzil vor, wie es Dietrich Bonhoeffer angesichts<br />
des drohenden Zweiten Weltkrieges<br />
fünfzig Jahre zuvor für geboten hielt. Ein<br />
Konzil war nicht möglich, und so kam es zur<br />
Einigung auf einen konziliaren Prozess<br />
gegenseitiger Verpflichtung auf Gerechtigkeit,<br />
Frieden und Bewahrung der Schöpfung.<br />
Der Konziliare Prozess ist seitdem ein fortlaufendes<br />
Geschehen des Nachdenkens und<br />
Beratens in größeren und kleineren Gruppen<br />
und Arbeitskreisen. Er ist wesentlicher Bestandteil<br />
der Ökumene, ja, der konziliare<br />
Prozess hat mit dafür gesorgt, dass der<br />
Gedanke der Ökumene in breiten Teilen der<br />
Gemeinden erst angekommen ist. Dabei ist<br />
wichtig zu beachten, dass das Ziel nicht nur<br />
sein soll, Einheit auf der Ebene des Glaubens<br />
zu erreichen. Die ökumenische Bewegung<br />
(Ökumene = griech. oikouménï „ganze bewohnte<br />
Erde“, „Erdkreis“) hat auch dafür<br />
gesorgt, dass ein größeres Bewusstsein für<br />
Zusammenhänge weltweit entstanden ist,<br />
dass Menschen eine stärkere Verbindung und<br />
Solidarität zu Gemeinden in der Zweiten<br />
bzw. Dritten Welt empfinden. Das führt weg<br />
vom anonymen Spenden, hin zu Partnerschaften<br />
und Lernen in Beziehung.<br />
Pascale Jung, Losheim-Wadern<br />
Quellen:<br />
1<br />
Schweizer, Eduard: Das Evangelium nach Markus,<br />
Göttingen, 1989, S. 73.<br />
2<br />
Aus: Zisler, K., Reischl, W., Perstling, H., Neuhold, H.,<br />
Gruber, A.: Glaubensbuch 6. Im Glauben wachsen.<br />
Graz 1987, Seite 96.<br />
3<br />
Vgl. Mussner, F.: Der Brief an die Epheser (ÖTK<br />
10 / GTB 509) Gütersloh 1982, S. 17.<br />
4<br />
Josef Pfammatter: Epheserbrief, Kolosserbrief.<br />
Die neue Echter-Bibel 10 u. 12, Würzburg 19<strong>90</strong>,<br />
S. 30.<br />
26.07.09<br />
Eph 4, 1-6<br />
Die ökumenische Bewegung<br />
hat auch dafür gesorgt, dass<br />
ein größeres Bewusstsein für<br />
Zusammenhänge weltweit<br />
entstanden ist.<br />
<strong>11</strong>1
<strong>11</strong>2<br />
02.08.09<br />
Vers 15 stellt fest,<br />
dass das Licht gesehen<br />
werden muss.<br />
Mt 5, 13-16<br />
18. Sonntag im Jahreskreis / 8. Sonntag nach <strong>Trinitatis</strong><br />
Stellung im Kirchenjahr<br />
Die <strong>Trinitatis</strong>zeit ist die Zeit der werdenden<br />
und wachsenden Kirche. Daher bietet<br />
sich eine Predigt zu und über Kirche und<br />
Kirchen an. Die <strong>Trinitatis</strong>sonntage überspannen<br />
die Sommermonate bis hin zum Herbst.<br />
Diese Zeit war früher stark von der Landarbeit<br />
bestimmt. Die ersten Früchte in Feld<br />
und Garten sind geerntet, andere sind noch<br />
im Wachstum begriffen. Zum Wachsen brauchen<br />
Pflanzen Luft, Wasser, Wärme und<br />
Licht. Diese elementaren Naturkräfte haben<br />
aber auch ihre Schattenseiten, die zerstören<br />
können. Inzwischen sind ganze Landstriche<br />
und Regionen immer wieder bedroht durch<br />
Überschwemmungen, Sturm, Hagel, Dürreund<br />
Hitzewellen. Heute wissen wir nur zu<br />
gut, dass an der Entstehung dieser Naturkatastrophen<br />
der Mensch durch sein Verhalten<br />
seinen Anteil hat. Es wäre denkbar,<br />
dass eine Predigt die Verantwortung des Menschen<br />
gegenüber der Schöpfung aufnimmt.<br />
Diese kann sich aber nicht nur darauf beschränken,<br />
Naturkatastrophen zu verhindern.<br />
Matthäus 5, 13-16: Salz der Erde und<br />
Licht der Welt<br />
Anmerkungen zum Text<br />
Die Bergpredigt bildet den Rahmen und<br />
die zwei Bildworte/Gleichnisse über Salz der<br />
Erde und Licht der Welt prägen unseren<br />
Text. Für Julius Schniewind beschreiben<br />
diese beiden Bilder „Art und Beruf der<br />
Jüngergemeinde“. Salz und Licht zählen zu<br />
den „Grund-Nahrungsmitteln und den Grund-<br />
Bedürfnissen“. Während sich das Matthäusevangelium<br />
an Juden und Judenchristen<br />
richtet, ist der Hörerkreis der Bergpredigt<br />
vorrangig auf die Jünger Jesu (Mt 5, 1) einzugrenzen.<br />
Schniewind spricht im Zusam-<br />
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong><br />
ev. Reihe I: Mt 5, 13-16 kath. 1. L.: Ex 16, 2-4.12-15 kath. 2. L.: Eph 4, 17.20-24 kath. Evang.: Joh 6, 24-35<br />
Der Verfasser betrachtet den ev. Predigttext und seine Bezüge zur<br />
Nachhaltigkeit. Stichworte: Authentizität der christlichen Kirchen, die<br />
Wahrheit aussprechen (Lager für Atomwaffen / Verstoß gegen das Völkerrecht),<br />
Rüstungsexporte nicht stillschweigend tolerieren, Glaubhaftigkeit<br />
der Kirche als Ausgangsbasis für christliches Engagement in<br />
Sachen Nachhaltigkeit<br />
menhang mit den Versen von der „Würde der<br />
Jüngerschaft“. Worin liegt die Würde? Folgen<br />
wir Gottfried Voigt, liegt die Würde<br />
darin, dass die Welt durch die Jünger Jesu<br />
erhalten (Salz) und erhellt (Licht) würde.<br />
Sicherlich eine gewagte Aussage.<br />
Vers 13 „Ihr seid Salz der Erde“ – Gehen<br />
wir davon aus, dass die Hörerfrage („Ihr“ –<br />
die Jünger) geklärt ist. Salz besteht aus einer<br />
chemischen Verbindung aus Natrium und<br />
Chlor (NaCl). Natrium ist ein edles Mineral<br />
und Chlor ein gefährliches Gift. Erst die<br />
Verbindung beider Substanzen macht daraus<br />
ein wertvolles Nahrungsmittel. Salz ist als<br />
Würze für Speisen unersetzlich und hat konservierende<br />
Eigenschaften. Salz wirkt daher<br />
extrem <strong>nachhaltig</strong>. Dass Salz „salzlos/kraftlos“<br />
werden kann, ist physikalisch unmöglich.<br />
Salz kann allerdings verunreinigt werden<br />
und dadurch nutzlos und wertlos werden.<br />
Vers 14 „Ihr seid Licht der Welt“ – Im „Ihr“<br />
findet sich wieder die direkte Anrede der<br />
Jünger. Bei der Formulierung „Licht der<br />
Welt“ ist auf ein anderes Jesuswort hinzuweisen,<br />
in dem Jesus diese Formulierung für sich<br />
in Anspruch nimmt – Joh 8, 12: „Ich bin das<br />
Licht der Welt!“ Licht hat nicht nur im<br />
Neuen und Alten Testament, sondern in allen<br />
Religionen eine zentrale Bedeutung. Dass<br />
hier das Wort von der „Bergstadt“ genannt<br />
wird, führt nicht wirklich zu neuen Erkenntnissen,<br />
sondern ist eher als Dublette zum<br />
„Lichtwort“ zu verstehen.<br />
Vers 15 führt den Gedanken über das Licht<br />
fort und stellt fest, dass das Licht gesehen<br />
werden muss. Wenn es nicht gesehen wird,<br />
hat es seine Daseinsberechtigung verloren.<br />
War schon das „kraftlose Salz“ unsinnig, so
ist es kompletter Unsinn, ein Licht anzuzünden<br />
und unter einen „Scheffel“ (andere Übersetzung:<br />
„unters Bett“) zu stellen.<br />
Vers 16 präzisiert den vorhergehenden Gedankengang<br />
und führt ihn fort und spricht<br />
im Zusammenhang mit dem Licht von<br />
„guten Werken“. Die entscheidende Frage:<br />
Was sind gute Werke?<br />
Zwei Predigtvorschläge<br />
„Die Welt wird durch die Jünger Jesu erhalten<br />
und erhellt.“<br />
Der Anknüpfungspunkt dieser Predigt könnte<br />
der „Hiroshima-Gedenktag“ am 6. August<br />
sein. Wenn die Predigt vier Tage vor dem 64. Jahrestag<br />
des Hiroshima-Gedenkens gehalten<br />
wird, könnte nach dem Hinweis auf diesen<br />
Gedenktag berichtet werden, wie das damals,<br />
am 6. August 1945, war: Die Explosion der<br />
Bombe über der japanischen Großstadt<br />
Hiroshima zerstörte in wenigen Augenblicken<br />
jegliches Leben in einem weiten<br />
Umkreis. Das grell glühende Licht war nicht<br />
nur hunderte Kilometer weit zu sehen, sondern<br />
auch für Hunderttausende Menschen<br />
tödlich. 20 solcher todbringender Atomsprengköpfe,<br />
jeder mit einer Vernichtungskraft von<br />
13 Hiroshioma-Bomben, lagern heute noch<br />
in Deutschland. Sie lagern auf dem Rheinland-Pfälzischen<br />
Fliegerhorst Büchel in der<br />
Eifel. Diese Tatsache dürfte vielen Zuhörern<br />
völlig unbekannt sein. Die Frage, warum bis<br />
heute in Deutschland noch Atomwaffen lagern,<br />
könnte auch vor dem Hintergrund der<br />
Menschenrechts-Charta gestellt werden. Nach<br />
dieser ist die Herstellung, Lagerung und der<br />
Einsatz von Atomwaffen völkerrechtswidrig.<br />
Die Kirche darf zu diesen Themen nicht<br />
schweigen. Die „guten Werke“, von denen in<br />
Vers 16 gesprochen wird, könnten auf diesen<br />
völkerrechtswidrigen Verstoß hinwirken. Weiterhin<br />
könnte auf die Zusammenhänge zwischen<br />
Krieg, Rüstungsproduktion und Rüstungsexport<br />
hingewiesen werden. Ohne Rüstungsexporte<br />
könnte mancher Krieg nicht geführt<br />
werden. Deutschland zählt inzwischen zur weltweiten<br />
Elite der Rüstungsexporteure (3. Stelle).<br />
Darauf hat die GKKE (Gemeinsame Konferenz<br />
Kirche und Entwicklung, www.gkke.org) der<br />
Deutschen Bischofskonferenz und der EKD<br />
schon mehrfach hingewiesen.<br />
Im Gegenzug könnte der aktive Einsatz für<br />
Frieden durch Abrüstung, durch die Vernichtung<br />
der vorhandenen Atomwaffen eine<br />
Nachhaltigkeit schaffen, die ein weltweiter<br />
Beitrag für mehr Gerechtigkeit, Frieden und<br />
Bewahrung der Schöpfung wäre.<br />
Zur atomaren Bedrohung schreibt Papst<br />
Benedikt XVI: „Der Weg, um eine Zukunft<br />
des Friedens für alle zu sichern, besteht nicht<br />
nur in internationalen Übereinkünften über<br />
die Nicht-Verbreitung von Atomwaffen, sondern<br />
auch in dem Bemühen, mit Entschiedenheit<br />
ihre Verminderung und ihren endgültigen<br />
Abbau zu verfolgen.“ Zur gleichen<br />
Thematik äußert sich der Ratsvorsitzende der<br />
EKD, Bischof Wolfgang Huber: „Im Teufelskreis<br />
der Absicht, Böses mit Bösem zu vergelten,<br />
gewinnen die Atomwaffen wieder an<br />
Bedeutung. Die Ausbreitung der Atomwaffen<br />
lässt sich nur verhindern, wenn die bisherigen<br />
Atommächte die Verfügung über atomare<br />
Waffen beenden. Das schließt die 20 amerikanischen<br />
Atomwaffen ein, die immer noch<br />
in Deutschland lagern.“<br />
„Was drauf steht sollte auch drin sein!“<br />
02.08.09<br />
Eine zweite Predigt könnte eine ganz andere<br />
inhaltliche Gewichtung bekommen. Sie<br />
könnte unter dem Motto stehen: „Was drauf<br />
steht sollte auch drin sein!“ Dabei wäre der<br />
Fokus auf Kirche als Institution gesetzt und<br />
das Thema könnte lauten: „Wenn Kirche<br />
drauf steht, sollte auch Kirche drin sein!“<br />
Ausgangspunkt wären die Verse 14-16<br />
(„Licht der Welt“).<br />
„Licht“ spielt in allen Religionen eine<br />
wichtige Rolle, so auch damals im Judentum.<br />
Und wenn Jesus sagt: „Ihr seid das Licht der<br />
Welt!“, mag das noch einigermaßen moderat<br />
klingen. Doch wenn heute ein evangelischer<br />
oder katholischer Prediger diese Aussage auf<br />
seine jeweilige Kirche bezieht, klingt das<br />
schon sehr anmaßend. Hat doch Kirche in<br />
den zurückliegenden Jahren einen starken<br />
Bedeutungsverlust erleben müssen. Das spiegelt<br />
sich u. a. in Kirchenaustritten. Sicherlich<br />
macht es Sinn, nach den Gründen zu suchen.<br />
Und an manchen dieser Gründe kann und<br />
muss auch ernsthaft gearbeitet werde. Aber<br />
vielleicht sind es auch ganz andere Gründe,<br />
etwa die, dass wir einen Grundsatz der<br />
Werbung nicht ernst genug nehmen: Tue<br />
Gutes und rede darüber! Festzustellen ist, <strong>11</strong>3
<strong>11</strong>4<br />
02.08.09<br />
Klaffen Anspruch und<br />
Wirklichkeit nicht zu oft<br />
auseinander? Ist in (der)<br />
Kirche drin, was<br />
drauf steht?<br />
dass zumindest die beiden großen Volkskirchen<br />
offensichtlich Probleme damit haben,<br />
ihr „Licht leuchten zu lassen“.<br />
Die Kirche kann von der Wirtschaft lernen.<br />
Für die Wirtschaft ist klar, dass auf<br />
Werbung nicht verzichtet werden kann. Es<br />
kommt allerdings darauf an, richtig zu werben,<br />
Produkte ins rechte „Licht“ zu setzen.<br />
Werbeagenturen leben davon, dass sie dieses<br />
professionell tun. In den Kirchen wurde Werbung<br />
und Öffentlichkeitsarbeit bisher eher<br />
stiefmütterlich behandelt. Mit einer guten<br />
Öffentlichkeitsarbeit könnte auch den Kirchenaustritten<br />
entgegengewirkt werden. Hinsichtlich<br />
der Kirchenaustritte muss allerdings<br />
auch eine ehrliche Auseinandersetzung<br />
bezüglich der Gründe stattfinden. Bei genauer<br />
Draufsicht sind es jedenfalls nicht nur finanzielle<br />
Gründe. Was also sind die anderen<br />
Gründe? Klaffen Anspruch und Wirklichkeit<br />
nicht zu oft auseinander? Ist in (der) Kirche<br />
drin, was drauf steht?<br />
Dennoch, bei aller berechtigter Kritik, die<br />
an den Kirchen aufkommen kann, könnte<br />
auch fröhlich und selbstbewusst von den<br />
„guten Werken“ geredet werden, die in und<br />
durch die Kirchen getan werden. Hierzu<br />
könnten die „zwölf guten Gründe, in der<br />
Kirche zu sein“ hilfreich sein:<br />
Zwölf gute Gründe, in der Kirche zu sein<br />
Im christlichen Glauben bewahrt die Kirche eine<br />
Wahrheit, die Menschen sich nicht selber sagen<br />
können. Daraus ergeben sich Maßstäbe für ein verantwortungsbewusstes<br />
Leben.<br />
In der Kirche wird die menschliche Sehnsucht<br />
nach Segen gehört und beantwortet.<br />
Die Kirche begleitet Menschen von der Geburt<br />
bis zum Tod. Das stärkt auf geheimnisvolle Weise.<br />
In der Kirche können Menschen an einer<br />
Hoffnung auf Gott teilhaben, die über den Tod<br />
hinausreicht.<br />
Die Kirche ist ein Ort der Ruhe und Besinnung.<br />
Unsere Gesellschaft ist gut beraten, wenn sie solche<br />
Orte pflegt.<br />
In der Kirche treten Menschen mit Gebeten und<br />
Gottesdiensten für andere ein. Sie tun das auch<br />
stellvertretend für die Gesellschaft.<br />
Die kirchlichen Sonn- und Feiertage mit ihren<br />
Themen, ihrer Musik und ihrer Atmosphäre prägen<br />
das Jahr. Die Kirche setzt sich dafür ein, diese<br />
Tage zu erhalten.<br />
In Seelsorge und Beratung der Kirche wird der<br />
ganze Mensch ernst genommen und angenommen.<br />
In Krankenhäusern und anderen sozialen Einrichtungen<br />
der Kirche schaffen viele haupt- und<br />
ehrenamtlich Engagierte ein besonderes, menschliches<br />
Klima.<br />
Wer die Kirche unterstützt, übt Solidarität mit<br />
den Schwachen und Benachteiligten.<br />
Kirchliche Musik und Kunst sind bis heute prägende<br />
Kräfte unserer Kultur.<br />
Wo immer Menschen hinkommen oder hinziehen,<br />
treffen sie auch die weltweite christliche Gemeinschaft.<br />
Dazu kann jede und jeder beitragen.<br />
(Quelle: Amt für Öffentlichkeitsarbeit der<br />
Nord-elbisch-Evangelisch-Lutherischen Kirche,<br />
Broschüre „12 Gründe, in der Kirche zu<br />
sein“)<br />
Dank:<br />
Mein Dank gilt den Mitgliedern des<br />
Seniorenkreises „Gespräch um Vier“ im<br />
Haadter Wohnstift, namentlich Charlotte<br />
Becker, Helga Erhard, Gisela Rose und<br />
Conrad Pohle und den Mitgliedern des Ökumenischen<br />
Gesprächskreises Venningen, namentlich:<br />
Heidi und Otto Christmann, Hans Hesse,<br />
Hildegard Hein, Brigitte Stauch, Hanna und<br />
Günter Vogeler.<br />
Literatur:<br />
Julius Schniewind, NTD, Bd. 1, Matthäusevangelium,<br />
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen,<br />
1968<br />
Eduard Schweizer, NTD, Bd. 1, Matthäusevangelium,<br />
Evangelische Verlagsanstalt Berlin, 1977<br />
Gottfried Voigt, Der schmale Weg, Predigtexte<br />
zur Reihe I, Ev. Verlagsanstalt Berlin, 1978<br />
Eberhard Dittus, Neustadt an der Weinstraße
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong><br />
Exegetische Überlegungen<br />
1 Kön 19, 4-8<br />
Ein wichtiger Inhalt des ersten Buches der<br />
Könige ist die Geschichte des Propheten Elija.<br />
Dabei handelt es sich nicht um eine einheitliche<br />
Erzählung. Wahrscheinlich standen am<br />
Anfang kleine Einzelerzählungen, die später –<br />
nicht ohne Bruchstellen – zusammengefügt<br />
wurden. Die vorliegende Perikope besteht aus<br />
drei Abschnitten: Verzweiflung des Propheten<br />
und Flucht in die Wüste. Erste Stärkung durch<br />
den Engel. Zweite Stärkung durch den Engel<br />
und Neuaufbruch. Elija flieht vor dem Zorn<br />
der Königin in die Wüste, um sein Leben zu<br />
retten. Trotz seiner vorausgehenden Erfolge<br />
ist er verzweifelt, entkräftet und wehrlos. Er<br />
will sterben. Der erste Besuch des Engels mit<br />
Brot und Wasser wird von Elija erstaunlich<br />
nüchtern hingenommen. Er isst und trinkt<br />
und legt sich wieder hin. Aber es verändert<br />
nichts in ihm. Noch gehen ihm nicht die<br />
Augen auf. Beim zweiten Mal wird die<br />
Zuwendung Gottes direkter. Der Hinweis<br />
auf den Weg, den Elija noch zu gehen hat,<br />
weckt in ihm Zukunftsperspektiven. „Vierzig<br />
Tage und vierzig Nächte“ ist wohl eine ab –<br />
sichtlich symbolische Zeitangabe, die an den<br />
gleich langen Aufenthalt des Mose auf dem<br />
Horeb erinnern soll. Sowohl Mose als auch<br />
Elija machen auf diesem Berg eine neue und<br />
entscheidende Gotteserfahrung.<br />
Eph 4, 30 - 5, 2<br />
Im zweiten Lesungstext kann man insofern<br />
eine inhaltliche Verbindung zum atl. Lesungstext<br />
sehen, als es auch da um Zukunftsperspektiven<br />
geht. Der Verfasser stellt im<br />
zweiten Teil des 4. Kapitels den „alten“ und<br />
den „neuen“ Menschen gegenüber. Der alte<br />
Mensch, der von Ausschweifung, Gier und<br />
19. Sonntag im Jahreskreis / 9. Sonntag nach <strong>Trinitatis</strong><br />
Der Autor beschränkt sich auf die Texte der katholischen Leseordnung.<br />
Er bedenkt die Frage: „Wovon leben wir?“ auf dem Hintergrund<br />
der Zeitsituation sowie anhand der ersten Lesung (1 Kön 19, 4-8) und des<br />
Evangeliums (Joh 6, 41-51). Die ökologische und ökonomische<br />
Entwicklung stellt nicht nur die Frage nach materiellen Lebensmitteln,<br />
sondern auch nach dem, was die Seele nährt, damit Menschen in Zukunft<br />
leben können. Stichworte: Zukunftsperspektive; Sinnfrage; Gottes<br />
Gegenwart als „Lebens-Mittel“.<br />
Gemeinheit gekennzeichnet ist, geht zugrunde<br />
(vgl. 4, 19-22). Der neue Mensch trägt das<br />
Siegel (Zeichen der Zugehörigkeit) Gottes.<br />
Güte, Barmherzigkeit, Vergebung sind seine<br />
Eigenschaften, weil auch Gott durch Christus<br />
vergeben hat. Ein Leben in den christlichen<br />
Tugenden, vor allem in der Liebe, hat seinen<br />
letzten Grund in der Nachahmung Gottes,<br />
dessen Liebe in Jesus Christus offenbar wurde.<br />
Während der alte Mensch dem Untergang<br />
geweiht ist, steht der neue Mensch für eine<br />
Zukunft, die sowohl ihre Wurzeln als auch<br />
ihre Auswirkungen in der Liebe Gottes hat.<br />
09.08.09<br />
ev. Reihe I: Mt 25, 14-30 kath. 1. L.: 1 Kön 19, 4-8 kath. 2. L.: Eph 4, 30 - 5, 2 kath. Evang.: Joh 6, 41-51<br />
1 Kön 19, 4-8<br />
Joh 6, 41-51<br />
Joh 6, 41-51<br />
Die Evangeliumsperikope ist der sog. Brotrede<br />
Jesu in der Synagoge von Kafarnaum<br />
entnommen. Sie ist in Beziehung gesetzt zur<br />
ersten Lesung 1 Kön 19, 4-8, da es in beiden<br />
Texten um „Brot vom Himmel“ geht, wenn<br />
auch in je unterschiedlicher Weise. Anlass für Der alte Mensch, der von<br />
das ungläubige Murren der Juden ist die vorausgehende<br />
Aussage Jesu, er sei das Brot vom Ausschweifung, Gier und<br />
Himmel. Das Murren war schon zur Zeit der<br />
Wüstenwanderung Israels Ausdruck der un- Gemeinheit gekennzeichnet<br />
gläubigen Auflehnung. Hier steht es als Auflehnung<br />
gegen Jesus als Boten des Himmels, ist, geht zugrunde.<br />
da man ja glaubte, seine irdische Herkunft zu<br />
kennen. Die folgenden Verse verweisen darauf,<br />
dass der Glaube an diesen Jesus Geschenk,<br />
„Gnade“ Gottes ist (V. 44). Wer auf<br />
den Vater hört und Schüler Gottes ist (V 45),<br />
der erkennt im Glauben das wahre Wesen<br />
Jesu. Die Verse 48-51 greifen noch einmal Eph 4, 30 - 5, 2<br />
das Brotmotiv auf. Jesus als das Brot des<br />
Lebens ist mehr als das Manna in der Wüste.<br />
Dieses sicherte das irdische Leben, jenes das<br />
Ewige. Vers 51b hat sakramentale, eucharistische<br />
Anklänge: das Brot, das Jesus gibt, ist<br />
er selbst, „sein Fleisch für das Leben der<br />
Welt“. <strong>11</strong>5
<strong>11</strong>6<br />
09.08.09<br />
Kein Geschehen kann so<br />
sinnlos sein, dass Gott nicht<br />
daraus etwas Sinnvolles,<br />
etwas Neues, etwas<br />
Lebensträchtiges und<br />
Zukunftsweisendes machen<br />
könnte.<br />
Predigtskizze<br />
Aufgrund der täglichen Nachrichten will<br />
einem der Optimismus bezüglich der Zukunft<br />
unserer Welt schwer fallen. Tat man<br />
zuerst noch solche Nachrichten als vordergründige<br />
Panikmache ab, so bestätigt sich<br />
wohl ihr Wahrheitsgehalt in einem immer<br />
bedrängenderen Maße. Die Zukunftsaussichten<br />
scheinen nicht gut zu sein. Über die<br />
Gründe und Hintergründe lässt sich trefflich<br />
streiten. Nahrungsmittelknappheit, Hungerkatastrophen,<br />
Erschöpfung der natürlichen<br />
Ressourcen einerseits und steigender Energiebedarf<br />
andererseits, Klimawandel mit verheerenden<br />
Folgen, Spekulanten, die aus all dem<br />
noch skrupellos Gewinn ziehen, das alles sind<br />
Stichworte, die Zukunftsängste wecken.<br />
Geht unserer Erde – und auf ihr dem<br />
Menschen – die Puste aus?<br />
Wovon sollen wir, und erst recht künftige<br />
Generationen, leben?<br />
Politik und Wirtschaft versuchen, Zuversicht<br />
nach dem Motto zu verbreiten: „Wir<br />
sind auf das Schlimmste gefasst, aber wir<br />
bekommen schon alles in den Griff“. So jagt<br />
denn ein „Gipfel“ den anderen: Klimagipfel,<br />
Erdölgipfel, G-8-Gipfel, WHO-Gipfel und<br />
viele andere. Manchmal hat man den Eindruck,<br />
es ist wie das Pfeifen im dunklen Wald<br />
gegen die Angst. Viele Menschen mögen sich<br />
die bedrückende Frage stellen: „Hat das<br />
Leben dann überhaupt noch einen Sinn, wenn<br />
die Zukunftsaussichten so schlecht sind?“ In<br />
Klammern: Ob die sooft beklagte sinkende<br />
Kinderzahl nicht einen wichtigen Grund<br />
darin hat, dass man seinen Nachkommen eine<br />
solche Welt nicht zumuten will? Menschen<br />
reagieren auf diese Sinnfrage unterschiedlich.<br />
Die einen werden agressiv und wollen sich<br />
mit Gewalt nehmen, wovon sie glauben, dass<br />
es ihnen zusteht. Egoismus und Rücksichtslosigkeit<br />
machen sich nach der Devise breit:<br />
Ich nehme alles mit, was das Leben bietet.<br />
Wer weiß, was morgen ist? Andere verfallen<br />
in Resignation und Depression, weil sie glauben,<br />
es habe sowieso alles keinen Sinn. Man<br />
müsse das Schicksal eben hinnehmen …<br />
Die erste Lesung des heutigen Sonntages<br />
zeigt am Beispiel eines von Gott berufenen<br />
Menschen die Möglichkeit einer zukunftsorientierten<br />
Lösung: Wir dürfen die Rechnung<br />
nicht ohne den Wirt und die Zukunft unserer<br />
Welt nicht ohne Gott machen. Der Prophet<br />
Elija war machtvoll für das Reich Gottes<br />
eingetreten. Das war sein Lebensinhalt. In<br />
einer spektakulären Aktion hatte er den<br />
Baalskult und seine Priester ausgerottet. Er<br />
schien auf dem Höhepunkt seiner Karriere<br />
angekommen. Aber: Konnte er davon leben?<br />
Sehr rasch fiel sein Ruhm wie ein Kartenhaus<br />
zusammen. Die Königin, eine Anhängerin<br />
des Baalskultes, ließ ihn verfolgen. Ihm blieb<br />
nur der Weg in die Wüste, wo er sich unter<br />
einem Ginsterstrauch mit seinem spärlichen<br />
Schatten niederließ. Er fiel in eine tiefe Depression.<br />
Kein Ausweg, keine Zukunft! Alles<br />
ist sinnlos und ziellos. Wegschauen, vergessen,<br />
schlafen!<br />
Auch Elija hat die Rechnung ohne den<br />
Wirt gemacht. Denn Gott selbst bewirtet ihn<br />
– zwei Mal, geduldig, einfühlsam, durch<br />
einen Engel. Es geht dabei nicht nur um Brot<br />
und Wasser. Es geht auch um eine neue<br />
Perspektive. Es wird ein Weg aufgezeigt, ein<br />
Weg, den Elija noch nicht kennt. Er erfährt<br />
nur, dass er für diesen Weg Kraft braucht und<br />
dass er diese Kraft nicht aus sich selbst bekommt.<br />
Er erhält sie von Gott. Und im<br />
Gehen erschließt sich ihm das Ziel: die<br />
Begegnung mit Gott am Gottesberg Horeb<br />
und ein neuer Auftrag, der eine Wende in der<br />
Geschichte Israels bedeutet. Er soll einen<br />
neuen König salben.<br />
Die Botschaft dieser Lesung könnte heißen,<br />
dass kein Geschehen im Laufe der Geschichte<br />
so sinnlos sein kann, dass Gott nicht daraus<br />
etwas Sinnvolles, etwas Neues, etwas Lebensträchtiges<br />
und Zukunftsweisendes machen<br />
könnte. Vorausgesetzt, der Mensch lässt sich<br />
auf Gott ein, er lässt sich von ihm nähren und<br />
Kraft geben, er lässt sich von ihm Weg und<br />
Ziel weisen, er lässt sich von Gott in Dienst<br />
nehmen und beauftragen.<br />
Wovon leben wir? – Nicht von unseren<br />
selbst ausgedachten Zukunftsperspektiven.<br />
Erst recht nicht von unseren Zukunftsängsten.<br />
Wir können – wie Elija – leben von der<br />
Zuwendung Gottes, die uns fürsorglich<br />
durch die Wüsten des Lebens führt. Diese<br />
Zuwendung Gottes ist, gemäß unserem<br />
christlichen Glauben, in Jesus Christus sichtbar<br />
und greifbar geworden. Sein Leben und<br />
Wirken zeigen, dass nicht Egoismus und<br />
Ausbeutung Wege zum wahren Leben sind,<br />
sondern das Füreinander-da-sein. Jesus hat es
uns vorgelebt bis zum Tod am Kreuz.<br />
Deshalb spricht er auch von seinem Leben im<br />
Bild vom Weizenkorn oder vom Lebensbrot,<br />
Bilder der Hingabe und Bilder der Hoffnung.<br />
Wenn Jesus im Evangelium heute<br />
sagt: „Ich bin das Brot des Lebens“, dann verweist<br />
er auf sich selbst als Quelle der<br />
Lebenskraft und der Hoffnung. Angesichts<br />
unserer verwirrenden und oft unübersichtli-<br />
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong><br />
Predigtsituation – Kirchenjahreszeit<br />
Israelsonntag<br />
Der 10. Sonntag nach <strong>Trinitatis</strong> ist der<br />
sog. „Israelsonntag“ oder auch „Gedenktag<br />
an die Zerstörung Jerusalems“. In den Jahren<br />
70-71 n. Chr. wurde Jerusalem von den<br />
Römern zerstört. Josephus Flavius (* 37 n.<br />
Chr.) schreibt darüber: „6.000 Menschen<br />
wurden im Tempel verbrannt. 100.000 wurden<br />
gefangen nach Rom verschleppt und die<br />
Stadt Jerusalem mit ihren herrlichen Palästen<br />
dem Erdboden gleich gemacht“ (De bello<br />
judaico).<br />
Ev. Predigttext: Lk 19, 41-48<br />
Exegetische Hinweise<br />
Lukas schreibt vom Weinen Jesu und der<br />
Ankündigung der Zerstörung Jerusalems im<br />
Rückblick. Das Evangelium entsteht um ca.<br />
80 n. Chr., und die Zerstörung hat zu diesem<br />
Zeitpunkt bereits stattgefunden. In der<br />
Vision Jesu beschreibt Lukas daher den tatsächlichen<br />
späteren Verlauf.<br />
chen Wege in eine ungewisse Zukunft sind<br />
wir eingeladen, ihn in unser Leben als<br />
„Lebensmittel“ aufzunehmen, ihm zu glauben<br />
und zu vertrauen. Im Brot der Eucharistie<br />
bietet er sich uns an: „Steh auf und<br />
iss, sonst ist der Weg zu weit für dich.“<br />
20. Sonntag im Jahreskreis / 10. Sonntag nach <strong>Trinitatis</strong><br />
Die Autorin betrachtet den ev. Predigttext und die kath. 1. Lesung.<br />
Stichworte zur Nachhaltigkeit: Kraft durch Zusammenhalt und den<br />
begleitenden Blick auf Gott – für Naturschutz, Energiepolitik, Katastrophenhilfe<br />
(Lk 19); Weisheit denkt in langfristigen Perspektiven, erst<br />
bei mir den Weg bereiten, dann die anderen einladen (Spr 9)<br />
Assoziationen<br />
– Jesus weint über Jerusalem.<br />
Weint Gott über uns hier und heute?<br />
Wie weit sind wir von der nächsten Katastrophe<br />
entfernt?<br />
– „Gott sei Dank, es ist Sonntag“ EKD-<br />
Kampagne: www.ekd.de/sonntagsruhe<br />
– Jes 56,7: Dieses Haus soll ein Bethaus sein;<br />
ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht.<br />
Übertragung:<br />
Dieser Tag soll ein Sonntag sein; ihr aber<br />
habt ihn zum Regentag gemacht.<br />
Dieser Tag soll ein Feiertag sein; ihr aber<br />
habt ihn zum Werktag gemacht.<br />
Diese Welt soll eine Lebenswelt sein; ihr aber<br />
habt sie zur Wüste gemacht.<br />
Diese Erde soll Gottes Erde sein; ihr aber<br />
habt sie zu eurem Eigentum gemacht.<br />
Bezug zu Nachhaltigkeit<br />
Anton Sauer, Heusenstamm<br />
– Jesus sieht, wie die Menschen in ihr Unglück<br />
rennen, weil sie Gott nicht mehr als<br />
Mittelpunkt in ihrem Leben haben. Sie sind<br />
09.08.09<br />
16.08.09<br />
ev. Reihe I: Lk 19, 41-48 oder Mk 12, 28-34 kath. 1. L.: Spr 9, 1-6 kath. 2. L.: Eph 5, 15-20<br />
kath. Evang.: Joh 6, 51-58<br />
Lk 19, 41-48<br />
<strong>11</strong>7
<strong>11</strong>8<br />
16.08.09<br />
Die Probleme der<br />
Gegenwart sind groß, und<br />
die Schritte, die wir gehen<br />
können, klein.<br />
Spr 9, 1-6<br />
zerstritten, konkurrenzorientiert und von materiellen<br />
Gewinnen geleitet. Das macht sie zu<br />
„leichten Opfern“ für das Römische Reich.<br />
Schlussfolgerung für die Gegenwart: Es braucht<br />
den Zusammenhalt von Menschen, um<br />
diese Welt und das Leben zu erhalten und<br />
zu stärken. Es braucht Motivation und Verantwortungsbewusstsein.<br />
Diese Kraft lässt<br />
sich ohne den Blick auf Gott nicht finden.<br />
Stichworte: Naturschutz, Energiepolitik,<br />
Katastrophenhilfe, soziale Marktwirtschaft,<br />
Work-Life-Balance, Spiritualität, Ökumene<br />
– Jesus fängt an einer Stelle an zu handeln. Er<br />
vertreibt die Händler aus dem Tempel.<br />
Dies ist nur eine kleine Aktion angesichts<br />
der damaligen Bedrohung durch die Römer.<br />
Jesu Handeln beschäftigt uns Menschen aber<br />
noch bis heute, auch wenn die damalige Katastrophe<br />
nicht abgewendet werden konnte.<br />
Die Probleme der Gegenwart sind groß,<br />
und die Schritte, die wir gehen können,<br />
klein. Das Beispiel Jesu kann uns Mut<br />
machen, diese kleinen Schritte trotzdem<br />
immer wieder zu gehen. Die damalige<br />
Zerstörung hätte verhindert werden können.<br />
Das zeigt die Hoffnung, die Jesus bei<br />
der Tempelaktion trotz allem hatte.<br />
Unsere Zukunft ist die, die wir daraus<br />
machen – mit Gottes Hilfe.<br />
Kath. 1. Lesung: Spr 9, 1-6<br />
Exegetische Hinweise<br />
Spr 1-9 ist eine Sammlung der Worte von<br />
Weisen, die sich nicht sicher zeitlich datieren<br />
lässt. Salomo wird zugesprochen, dass er diese<br />
Sammlung erstellt hat, aber nicht der alleinige<br />
Urheber ist (Donald Guthrie). Die Verse<br />
9, 1-6 gehören eng mit 9, 13-18 zusammen<br />
als zwei Hälften eines Lehrgedichts über<br />
„Frau Weisheit“ und „Frau Torheit“ (Susanne<br />
Gorges-Braunwarth). Im Alten Testament ist<br />
die Gottesfurcht die Grundlage der Weisheit.<br />
Die Weisen galten daher zusammen mit den<br />
Priestern auch als die Verkündiger des<br />
Willens Gottes (z. B. Jer 18, 18).<br />
Assoziationen<br />
– Weisheit kommt von Gott.<br />
– Weisheit zeigt sich, lädt ein, aber zwingt nicht.<br />
– Weisheit bringt Veränderung.<br />
– Weisheit ist Lebensfülle.<br />
Bezug zu Nachhaltigkeit<br />
Die Weisheit denkt langfristig. Zuerst<br />
wird das Haus gebaut, jede der sieben Säulen<br />
behauen, das Vieh geschlachtet, der Wein<br />
gemischt und der Tisch bereitet. Und dann<br />
folgt eine schlichte Einladung.<br />
Schlussfolgerung für die Gegenwart: Es gibt<br />
viel zu tun für mich. (Appelle, Schuldzuweisungen<br />
oder Anklagen an andere Menschen<br />
gehören nicht dazu.) Weisheit beginnt<br />
mit der Frage nach Gott. Darauf folgt mein<br />
eigenes Denken und Handeln. Erst dann ist<br />
eine Einladung an andere möglich. Eine Einladung<br />
zum Leben.<br />
Quellen:<br />
Donald Guthrie, Kommentar zur Bibel. AT und<br />
NT in einem Band; Brockhaus 2003; S. 667<br />
Susanne Gorges-Braunwarth, Frauenbilder –<br />
Weisheitsbilder – Gottesbilder. Die personifizierte<br />
Weisheit im Gottesbild der nachexilischen Zeit;<br />
Lit-Verlag 2002, S. 218<br />
Ivonne Heinrich, Westerburg
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong><br />
21. Sonntag im Jahreskreis / <strong>11</strong>. Sonntag nach <strong>Trinitatis</strong><br />
Exegetische Hinweise zum Buch Josua<br />
Das Buch Josua ist Abschluss und Anfang<br />
zugleich. Abschluss, weil das den Vätern verheißene<br />
Land (Gen 12, 7) nun dem Volk<br />
Israel zum Erbe gegeben wird (Jos 1, 2 ff.).<br />
Die Zeit der Knechtschaft in Ägypten, der<br />
Exodus und die Wüstenwanderung sind<br />
Geschichte. Gleichzeit erzählt das Buch den<br />
Anfang von der Sesshaftigkeit des Volkes<br />
Gottes. Um die Treue zum Glauben geht es<br />
in der alttestamentlichen Lesung. Josua<br />
macht sich zum Sprecher für die Glaubenstreue.<br />
In Kanaan wirken die dort verehrten<br />
Gottheiten und Rituale faszinierend auf<br />
das Volk, das nur den schlichten Kult der<br />
Wüstenwanderer kannte. Josua vollendet das<br />
politische Wirken des Mose und wird wie er<br />
als „Knecht des Herrn“ (Jos 24, 29) bezeichnet.<br />
Am Beginn des Josuabuches (Jos 1, 5 f.)<br />
wird ihm in einer thematischen Jahwerede<br />
zugesprochen, dass er dem Volk das Land, das<br />
Jahwe den Vorfahren versprochen hatte, zum<br />
Erbe geben wird. So versammelt er dann auch<br />
am Ende seines Lebens das ganze Volk in<br />
Sichem und verpflichtet es an Jahwe festzuhalten<br />
(Jos 23 und 24). Entschieden sollen sie<br />
sich von den fremden Gottheiten und Ritualen<br />
abwenden. Durch die Verleihung des<br />
Landes an Israel tritt Jahwe seine Rechte<br />
nicht ab, das Land bleibt sein heiliges Land<br />
(Jos 22, 19). Das Land Kanaan ist der Ort, an<br />
dem Jahwe mit seinem Volk seine Geschichte<br />
schreibt. Der Besitz des Landes verpflichtet<br />
zur richtigen Antwort auf Gottes Treue.<br />
Israel soll in seiner Geschichte Gottes Handeln<br />
erkennen, seinen Willen tun und alles<br />
befolgen, was im Gesetzbuch des Mose steht<br />
(Jos 23, 6). Josua schließt in Sichem für sein<br />
Volk einen Bund und legt Gesetz und Recht<br />
fest. Den Besitz des gelobten Landes haben<br />
die Israeliten alleine Jahwe zu verdanken. Er<br />
hat sein Wort gehalten.<br />
Marcelo de Barros Souza und José Luis<br />
Caravias (S. 86 f.) gehen davon aus, dass das<br />
Buch Josua zum deuteronomistischen Geschichtswerk<br />
gehört und fünfhundert Jahre<br />
nach den entsprechenden Ereignissen entstand:<br />
„Wer fundamentalistisch an die entsprechenden<br />
Josua-Texte herangeht und sie<br />
wörtlich nimmt, deutet die Ereignisse etwa<br />
so: ... In der Hoffnung auf die Verheißung,<br />
die Gott Abraham gegeben hat, er werde<br />
dem Volk Israel das Land Kanaan übergeben,<br />
ziehen die Menschen durch die Wüste, dringen<br />
in das verheißene Land ein, erobern eine<br />
kanaanäische Stadt nach der anderen und zerstören<br />
sie alle miteinander, bis sie selbst die<br />
alleinigen Herren des Landes sind. Diese Art<br />
von Lektüre dient heute manchen Leuten als<br />
religiöser Vorwand dazu, die Expansionspolitik<br />
des gegenwärtigen Staates Israel den<br />
Palästinensern gegenüber zu rechtfertigen.<br />
Doch auch manche Christen verstehen die<br />
Texte so. Für sie ist nämlich das AT lediglich<br />
Symbol und Vorbild für das NT, so dass sie<br />
gar kein Problem darin sehen, dass sich Gott<br />
bzw. Gottes Volk im AT unterdrückerisch<br />
gebärdet.“<br />
Nachhaltigkeitsaspekte und mögliche Predigtinhalte<br />
23.08.09<br />
ev. Reihe I: Lk 18, 9-14 kath. 1. L.: Jos 24, 1-2a.15-17.18b kath. 2. L.: Eph 5, 21-32 kath. Evang.: Joh 6, 60-69<br />
Der Verfasser betrachtet die Bibeltexte der beiden kath. Lesungen.<br />
Stichworte zur Nachhaltigkeit: Erinnerung an das geschichtliche Handeln<br />
Gottes als Grundlage und Rechtfertigung für die Kritik an aktuellen Unrechtssituationen,<br />
Entscheidung entweder für Gott oder die Götter unserer<br />
Zeit (Jos 24); Soziale Gerechtigkeit als Aspekt von Nachhaltigkeit insbesondere<br />
bei der Benachteiligung von Frauen in allen Gesellschaften (Eph 5)<br />
Jos 24, 1-2a.15-17.18b<br />
Der Besitz des Landes<br />
verpflichtet zur richtigen<br />
Antwort auf Gottes Treue.<br />
Weltgestaltung aus geschichtlicher und heilsgeschichtlicher<br />
Erfahrung<br />
In einer langen Rede lässt Josua Jahwe selber<br />
zu Wort kommen (Jos 24, 2 ff.), in der er<br />
an seine Treue zum Volk von Anfang an erinnert.<br />
Das Vergessenwollen verlängert das Exil,<br />
und das Geheimnis der Erlösung liegt in der<br />
Erinnerung. Diese so oft zitierte jüdische<br />
Weisheit betont, dass der Glaube an Jahwe<br />
ein Glaube an sein Wirken in der Geschichte<br />
ist. So erklärt das Buch Josua theologisch die<br />
Gegenwart aus der Vergangenheit und vermittelt<br />
Erkenntnisse und Lehren für die<br />
Zukunft. Auch dem christlichen Glauben <strong>11</strong>9
120<br />
23.08.09<br />
Gott und sein Wirken in<br />
der Geschichte werden nur<br />
dann ernst genommen, wenn<br />
wir bereit sind, die momen-<br />
tane Situation <strong>nachhaltig</strong><br />
zu verbessern.<br />
geht es in Treue zu den jüdisch-christlichen<br />
Traditionen des AT und NT nicht um eine<br />
vergangene Wirklichkeit, auf die wir vielleicht<br />
wehmütig und nostalgisch zurückblicken.<br />
Wenn christliche Theologie versucht,<br />
über Gott, die Welt und die Menschen auf<br />
der Grundlage der biblischen Botschaft nachzudenken,<br />
muss sie immer auch eine prophetische<br />
Kritik an der heutigen politischen und<br />
ökonomischen Situation sein. Es geht ihr<br />
einerseits um die Erinnerung an das Handeln<br />
Gottes in der Geschichte und andererseits um<br />
eine zukünftige und noch ausstehende Wirklichkeit.<br />
Das Wort des Rates der Evangelischen Kirche<br />
in Deutschland und der Deutschen<br />
Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und<br />
sozialen Lage in Deutschland/Für eine Zukunft<br />
in Solidarität und Gerechtigkeit greift<br />
diese Gedanken auf: „Das Volk Gottes lebt<br />
aus der Erinnerung an die Geschichte des<br />
Erbarmens Gottes ... Daraus schöpft es Kraft<br />
und Zuversicht; es weiß sich dadurch zugleich<br />
motiviert zur barmherzigen und solidarischen<br />
Zuwendung zu den Armen, Schwachen<br />
und Benachteiligten. ... Die Bibel übt<br />
prophetische Kritik an gesellschaftlichen<br />
Unrechtssituationen ...; sie setzt sich vor<br />
allem für die Benachteiligten und die Fremden<br />
ein ... So wird in großen Teilen des AT die<br />
gesellschaftsgestaltende Kraft des biblischen<br />
Glaubens deutlich“ (S. 40 f.). Theologisches<br />
Reflektieren will glaubenden Menschen<br />
Zugänge eröffnen, die gegenwärtigen politischen<br />
und ökonomischen Bedingungen zu<br />
verändern, um der Herrschaft Gottes zum<br />
Durchbruch zu verhelfen. Gott und sein Wirken<br />
in der Geschichte werden nur dann ernst<br />
genommen, wenn wir bereit sind, die momentane<br />
Situation <strong>nachhaltig</strong> zu verbessern<br />
(vgl.: Für eine Zukunft ..., S. 49 f).<br />
Der Glaube an Jahwe und seine gesellschaftlich<br />
politischen Folgen<br />
Die Entwicklung des Glaubens an Jahwe<br />
ist ein langer Prozess. Die Glaubensinhalte<br />
unterscheiden sich fundamental von der<br />
kanaanäischen Religion und ihren Gottheiten.<br />
Der Glaube an Jahwe ist Symbol des<br />
sozialen Kampfes eines unterdrückten Volkes<br />
um Selbständigkeit und um gerechtere und<br />
geschwisterliche Lebensbedingungen. Jahwe<br />
will, dass die Güter der Erde (Herden, Grund<br />
und Boden) allen zugänglich sind. Das Land<br />
soll seinem Volk insgesamt gehören. Niemand<br />
darf bevorzugt oder gar ausgeschossen<br />
werden. Er ist parteiisch für die, die kein<br />
Land besitzen und kämpft an ihrer Seite,<br />
damit sie etwas bekommen. Die Religion<br />
Israels ist eine Religion von Unterdrückten,<br />
während die Religion der Kanaanäer oftmals<br />
die Interessen der Unterdrücker widerspiegelt.<br />
Der Glaube an Jahwe hat Auswirkungen<br />
auf sein Volk. Er stärkt das Bemühen um eine<br />
geschwisterliche Gesellschaftsordnung und<br />
verpflichtet das Volk Israel zur Solidarität. In<br />
Sichem wird Glaube aus der Privatheit in das<br />
Licht einer öffentlichen Diskussion hineingestellt.<br />
Die Philosophin Hanna Arendt hat<br />
Politik einmal so definiert: Treffen sich Menschen,<br />
um miteinander etwas in der Welt<br />
anzufangen, entsteht politische Macht. Genau<br />
darum geht es Josua in Sichem. Er sucht eine<br />
politische Entscheidung, die nach den Grundlagen<br />
für das zukünftige Zusammenleben im<br />
Volk Israel sucht.<br />
Was bewirkt heute der Glaube an Jahwe,<br />
den Gott der Bibel?<br />
Führt er zu Solidarität und zum gesellschaftlichen<br />
Engagment?<br />
Bestärkt er uns, <strong>nachhaltig</strong>e Entwicklungen<br />
anzustoßen?<br />
Führt er uns aus der Privatheit in die<br />
Öffentlichkeit?<br />
Jahwe oder die Götter?<br />
Josua stellt die Frage: Entscheidet euch,<br />
wem ihr dienen wollt, Gott oder den Göttern?<br />
Eine Entscheidung ist fällig, die unaufschiebbar<br />
ist. Wer sie jetzt nicht fällt, ist den neuen<br />
Göttern bereits verfallen. Josua erinnert<br />
daran, dass es im Kern nicht Kriege und<br />
Eroberungen waren, die Israel ins gelobte<br />
Land gebracht haben, sondern letztendlich<br />
das Hören Einzelner oder des ganzen Volkes<br />
auf Gottes Wort; denn die Geschichte Israels<br />
ist auch eine Geschichte des In-Vergessenheit-Geratens<br />
Jahwes. In Sichem findet<br />
eine Versammlung gegen das Vergessen statt,<br />
ein Versprechen es mit Gott zu halten, ein Ja<br />
zu einem Weg gegen den Strom, eine Absage<br />
an die Götzen. Die Diskussion um die Zukunft<br />
beginnt mit dem Hören auf die<br />
Geschichte Gottes mit seinem Volk. Nicht<br />
die eigenen Interessen, sondern das Interesse<br />
Gottes an Welt und Mensch und seine Treue
stehen im Vordergrund und führen zu einer<br />
Entscheidung. Auch heute stehen wir am<br />
Scheideweg von Sichem. Wir dürfen von der<br />
Option Gottes für die Armen, von seiner<br />
Vision einer Veränderung bestehender Verhältnisse<br />
und der Überwindung von Gewalt<br />
zwischen Menschen, Gruppen und Völkern<br />
nicht lassen.<br />
Wie halten wir es mit dem Traum Gottes<br />
von einer Welt, die sich dem Frieden, der<br />
Gerechtigkeit und der Bewahrung der<br />
Schöpfung verpflichtet weiß? Wie kommen<br />
wir zu politischen Entscheidungen, die auch<br />
die nachfolgenden Generationen mit in den<br />
Blick nehmen (Gentechnologie, Energie,<br />
Umwelt, Außenpolitik) und den Götzen<br />
unserer Zeit eine klare Absage erteilen?<br />
Literaturempfehlungen<br />
Eugen Sitarz (Hrsg.), Höre, Israel! Jahwe ist einzig,<br />
Stuttgart 1987.<br />
Marcelo de Barros Souza, Jose Luis Caravias,<br />
Theologie der Erde, Düsseldorf 19<strong>90</strong>.<br />
Norbert Greinacher, Der Schrei nach Gerechtigkeit.<br />
Elemente einer prophetischen politischen<br />
Theologie, München 1986.<br />
Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland/Sekretariat<br />
der Deutschen Bischofskonferenz<br />
(Hrsg), Für eine Zukunft in Solidarität und<br />
Gerechtigkeit. Wort des Rates der Evangelischen<br />
Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz<br />
zur wirtschaftlichen und sozialen Lage<br />
in Deutschland, Hannover/Bonn 1997.<br />
Exegetische Hinweise zum Eph 5, 21-33<br />
Der Abschnitt beginnt mit der Ermahnung<br />
zu gegenseitiger Unterordnung, was<br />
zunächst eine partnerschaftliche Ordnung<br />
andeuten könnte. Die anschließende Ehebelehrung<br />
jedoch fordert die Frauen, auf sich<br />
den Männern unterzuordnen wie dem Herrn<br />
(Christus). Das Verb sich unterordnen ist im<br />
Griechischen ein Ordnungsbegriff und beinhaltet<br />
die Anerkennung der bestehenden patriarchalischen<br />
Verhältnisse. Hubertus Halbfas<br />
schreibt in seiner kommentierten Bibel:<br />
„Hinter dieser die gesamte antike Gesellschaftsstruktur<br />
bestimmenden männlichen<br />
Dominanz (vgl. 1 Kor <strong>11</strong>, 3-12) steht zunächst<br />
im jüdisch-christlichen Raum die<br />
damalige Auslegung von Gen 2, 18-24. Da<br />
die Frau erst nach dem Mann, aus ihm und<br />
seinetwegen geschaffen sei, sei er auch in<br />
allem der Frau übergeordnet. Dieser Hintergrund<br />
wird nun christologisch überhöht. Die<br />
Überordnung des Mannes soll aus der<br />
Beziehung Christi zu seiner Kirche verstanden<br />
werden. ... Vers 33 bringt die Lektion<br />
noch einmal auf den Punkt: Der Mann soll<br />
seine Frau lieben, die Frau aber – sie fürchte<br />
(ehre) den Mann. Mit diesem überraschenden<br />
Verb wird eine sich unterordnende Haltung<br />
verlangt, wie Untergeordnete den ihnen<br />
Vorgeordneten begegnen“ (S. 574). Die<br />
Wirkungsgeschichte dieser Ehelektion transzendiert<br />
und rechtfertigt ein Machtgefälle<br />
zwischen Mann und Frau und fordert mit<br />
einer Grundsätzlichkeit, die dogmatisch legitimiert<br />
indiskutabel ist, die Unterordnung<br />
der Frau.<br />
Nachhaltigkeitsaspekte und mögliche Predigtinhalte<br />
23.08.09<br />
Der Abschnitt aus dem Epheserbrief muss<br />
uns Mut machen, „ganze Teile des NT von<br />
unserer eigenen Zeit und unserem Lebensgefühl<br />
her kritisch in Frage zu stellen und die<br />
Botschaft Jesu mit Fragen zu konfrontieren,<br />
die sich ihr in der Zeit ihrer ersten Interpretation<br />
so noch gar nicht stellen konnten“.<br />
Wir haben Grund „anhand dieses Textes in<br />
seiner Problematik einmal das Feld der<br />
Auseinandersetzung und des Nachdenkens<br />
viel weiter zu spannen und uns das Problem<br />
vorzulegen, wie schwer es ist, sich im<br />
Rahmen von Frömmigkeit und Religion freizuhalten<br />
von Ideolgie, Machtbegründung Eph 5, 21-32<br />
und autoritärem Denkstil. ... Nach zweitausend<br />
Jahren Patriarchalismus in der Kirche<br />
müssten wir, könnten wir durch die<br />
Vermittlung von Frauen vieles aus dem<br />
Munde Jesu lernen“ (Eugen Drewermann,<br />
Düsseldorf 1991, 147 ff). Doch nach wie vor<br />
blockiert die Kirche die Frauen, indem sie<br />
„von ihnen ein traditionelles Bild und einen<br />
altherkömmlichen Status weitervermittelt.<br />
Das von der Kirche geförderte, ja sakralisierte<br />
Bild der Frau ist das der hingebungsvollen<br />
Mutter, die sich gut aufopfern kann“ (Jacques<br />
Gaillot u. a., S. 219 f.).<br />
Man wird in der Religionsgeschichte kaum<br />
jemanden finden, der mit der Männerherrschaft<br />
deutlicher aufgeräumt hat als der<br />
Mann aus Nazareth. Er verurteilte alles, was<br />
nur den Geruch von Überlegenheit, Herrschaft<br />
und Macht an sich hatte. Da Frau und 121
122<br />
23.08.09<br />
Frauen zählen weltweit<br />
zu den Ärmsten der Armen,<br />
so dass bereits von einer<br />
Feminisierung der Armut<br />
und einer Apartheid der<br />
Geschlechter gesprochen wird.<br />
30.08.09<br />
Mann nach dem Bild Gottes geschaffen sind,<br />
müsste zumindest im jüdisch-christlichen<br />
Raum die Gleichberechtigung eine Selbstverständlichkeit<br />
sein. Frauen zählen weltweit<br />
zu den Ärmsten der Armen, so dass bereits<br />
von einer Feminisierung der Armut und einer<br />
Apartheid der Geschlechter gesprochen wird.<br />
Die Arbeitslast der Frauen erhöht sich nach<br />
wie vor, ihr Zugang zu den Wirtschaftsressourcen<br />
nimmt ab, und ihre Ernährungsund<br />
Bildungssituation, sowie ihr Gesundheitszustand<br />
verschlechtern sich rapide.<br />
Menschenverachtung und Frauenverachtung<br />
hängen fundamental zusammen. Die<br />
Geburt eines Mädchens gilt vielfach als<br />
Unglück. Franz Kamphaus differenziert die<br />
vielfältigen Formen von Gewalt, die Frauen<br />
treffen: „psychische Gewalt in Form des<br />
öffentlich anerkannten Gewaltrechtes von<br />
Männern gegenüber Frauen; sexuelle Gewalt<br />
und die damit verbundenen Einschüchterungen;<br />
materielle Gewalt, das heißt die<br />
männliche Kontrolle über das Wirtschaftsleben;<br />
ideologische Gewalt, das meint das<br />
angemaßte männliche Potenzgehabe, dem die<br />
weibliche Demut und Minderwertigkeit korrespondiert“<br />
(S. 124 f.). Auch in Deutschland<br />
ist Armut häufig weiblich. Besonders alleinerziehende<br />
und ältere Frauen sind auf<br />
Sozialhilfe angewiesen. Diejenigen sind in<br />
unserem Sozialsystem begünstigt, die ohne<br />
Unterbrechungen voll erwerbstätig waren –<br />
in der Regel Männer. Tätigkeiten im Haushalt,<br />
die Erziehung der Kinder, Pflege der<br />
Angehörigen und soziales ehrenamtliches<br />
Engagment werden zu wenig berücksichtigt.<br />
Klassische Frauenarbeit bleibt auch hierzu-<br />
lande eher unsichtbar und unbezahlt. Die<br />
Benachteilung der Frauen wurzelt immer in<br />
kulturellen Mustern und religiösen Wertvorstellungen,<br />
die männlich geprägte Strukturen<br />
fördern. Frauengerechte Entwicklung bedeutet<br />
darum die Mitgestaltung eines Prozesses,<br />
in dem Frauen und Männer partnerschaftlich<br />
die Verantwortung für ökonomische,<br />
politische, kulturelle und geistige Entwicklungen<br />
in ihrer Gesellschaft übernehmen.<br />
Wie kommen wir der Vision einer gemeinsamen<br />
Verantwortung von Frau und Mann in<br />
allen Bereichen der Gesellschaft (und der<br />
Kirche) näher?<br />
Welche Entwicklungsprojekte von Frauen<br />
und für Frauen sind zu fördern?<br />
Wie sprechen wir in der Verkündigung<br />
von einem Gott, der Mann und Frau als sein<br />
Abbild schuf und beiden die Erde anvertraute?<br />
Literaturempfehlungen<br />
Eugen Drewermann, Zwischen Staub und Sternen.<br />
Predigten im Jahreskreis, Düsseldorf 1991<br />
Franz Kamphaus, Eine Zukunft für alle. Umkehr<br />
zur Solidarität, Freiburg 1995<br />
Bischöfl. Hilfswerk Misereor (Hrsg.), Arbeitshefte<br />
zum Hungertuch. Das MISEREOR-Hungertuch<br />
„Barmherzigkeit und Gerechtigkeit“, Aachen<br />
1998<br />
Jacques Gaillot, Alice Gombault, Pierre de Locht,<br />
Ein Katechismus der Freiheit atmet, Küsnacht<br />
2004<br />
Hubertus Halbfas, Die Bibel, Düsseldorf 2001<br />
22. Sonntag im Jahreskreis / 12. Sonntag nach <strong>Trinitatis</strong><br />
Klaus Scheunig, Mandelbachtal<br />
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong><br />
ev. Reihe I: Mk 7, 31-37 kath. 1. L.: Dtn 4, 1-2.6-8 kath. 2. L.: Jak 1, 17-18.21b-22.27 kath. Evang.: Mk 7, 1-8.14-15.21-23<br />
Der Verfasser betrachtet die ev. Predigtperikope der Reihe I und die<br />
Bibelstelle zur kath. 2. Lesung. Stichworte zur Nachhaltigkeit: sich gegen<br />
die Erderwärmung einsetzen und damit heilen / die Ausbreitung von<br />
Krankheiten verhindern (Mk 7); im Menschen als der Erstlingsfrucht der<br />
Schöfung liegt die Pflicht und die Möglichkeit begründet, diese zu bewahren<br />
und zu gestalten, unter Beachtung der ihr mitgegebenen und für ihn<br />
durch das göttliche „und es war gut“ deutlich erkennbaren Grenzen (1 Jak 1)
Mk 7, 31-37<br />
Klimawandel und Ausbreiten von die Gehörlosigkeit<br />
verursachenden Krankheiten<br />
Der Bericht ähnelt den Berichten hellenistischer<br />
Heiler, die oft auch mit Speichel<br />
arbeiteten. Dabei wird bei Jesus die Heilung<br />
mehr an sein Wort gebunden als bei diesen<br />
Heilern.<br />
Heute wird das Wort „Taubstumm“ weniger<br />
gebraucht, da es auf die Betroffenen diskriminierend<br />
wirkt. Man spricht lieber von<br />
Gehörlosigkeit, das berücksichtigt, dass ein<br />
so genannter „Taubstummer“ durch entsprechende<br />
Schulung sprechen lernen kann. Das<br />
Wort gehörlos entstand erst nach der<br />
Einführung der allgemeinen Schulbildung<br />
tauber Kinder im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts<br />
als Begriff für einen Taubstummen,<br />
der durch eine unermüdliche Sprech erziehung<br />
entstummt worden ist. Daher hat<br />
das Wort die Bedeutung von „taub, aber<br />
sprechend“ erlangt, und taube Kinder,<br />
Schulentlassene und Erwachsene werden als<br />
„Gehörlose“ bezeichnet. Weltweit soll es etwa<br />
70 Millionen gehörlose Menschen geben. Es<br />
gibt erworbene Gehörlosigkeit als Folge von<br />
z. B. Meningitis, Enzephalitis, Scharlach,<br />
Masern, Tuberkulose, Mittelohr-Erkrankungen<br />
und anderen Krankheiten. Angeborene<br />
Gehörlosigkeit kann entweder vorgeburtlich<br />
erworben sein, durch Röteln und<br />
andere Erkrankungen, oder erblich.<br />
Krankheiten werden sich ausbreiten, so ist<br />
die Prognose von Wissenschaftlern. Vom weltweiten<br />
Klimawandel können vor allem<br />
Krankheitserreger und ihre Überträger profitieren.<br />
In Zukunft drohen Menschen, Tieren<br />
und Pflanzen häufige Epidemien, so liest<br />
man in einer US-Studie. Um sich besser<br />
gegen Krankheitsausbrüche wehren zu können,<br />
muss der Einfluss der Klimaänderung<br />
stärker beachtet und erforscht werden: „Wir<br />
müssen die globale Klimaveränderung sehr<br />
ernst nehmen“, so die Schlussfolgerung von<br />
Andrew Dobson. „In der Zukunft wird die<br />
Welt nicht nur wärmer, sondern auch kränker<br />
sein.“ Diese Erwärmung begünstigt Epidemien<br />
bei Tieren, Pflanzen und auch beim<br />
Menschen, berichtet ein US-Forscherteam<br />
um Drew Harvell, Cornell University, und<br />
Andrew Dobson, Princeton University. 1<br />
Die Heilung von Kranken war ein wichti-<br />
ger Teil der Reich-Gottes-Predigt Jesu.<br />
„Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige<br />
werden rein, Tote stehen auf, und Armen<br />
wird das Evangelium verkündet (Mt <strong>11</strong>, 5).<br />
Im Reich Gottes soll es dieses Elend nicht<br />
mehr geben. Wir glauben an das endgültige<br />
Kommen des Reiches Gottes, deshalb setzen<br />
wir uns für sein Kommen mit unseren oft so<br />
begrenzten menschlichen Kräften ein. Wer<br />
sich gegen die Erderwärmung durch sein<br />
Handeln einsetzt, verhindert Krankheiten<br />
und steht damit in der heilenden Tradition<br />
Jesu. Hinzu kommt, den betroffenen<br />
Menschen nach Möglichkeit zu helfen.<br />
Erstlingsfrucht der Schöpfung, Lesung 1<br />
Jak 1, 17-18.21b-22.27<br />
30.08.09<br />
Mk 7, 31-37<br />
Jak 1, 17-18.21b-22.27<br />
Im Jakobusbrief wird der Mensch die<br />
Erstlingsfrucht der Schöpfung genannt. Dieser<br />
Begriff kommt aus der biblischen Opfersprache<br />
Israels. Die erste Frucht war Gottes<br />
Eigentum, es war die erste Opfergabe. Nun<br />
fragt sich, welcher Schöpfung? Ist es die erste<br />
Schöpfung oder die Neuschöpfung in Christus?<br />
Die erste Schöpfung wurde durch den Menschen<br />
verdorben. Die Neuschöpfung in Christus,<br />
an der wir durch die Taufe Anteil haben, Wer sich gegen die<br />
ist die Neuschöpfung. Mit Christus und uns<br />
im Gefolge fängt die neue Schöpfung an. Erderwärmung durch sein<br />
Wir leben aber noch in der ersten Schöpfung.<br />
Benedikt XVI. führt dazu aus: „Indem Handeln einsetzt, verhindert<br />
der Schöpfergeist das neue und ewige Leben<br />
in den bestatteten Leib Jesu von Nazaret ein- Krankheiten und steht<br />
goss, brachte er das Werk der Schöpfung zur<br />
Erfüllung und schuf eine »Erstlingsfrucht«: damit in der heilenden<br />
die Erstlingsfrucht einer neuen Menschheit,<br />
die gleichzeitig Erstlingsfrucht einer neuen Tradition Jesu.<br />
Welt und eines neuen Zeitalters ist. Diese<br />
Erneuerung der Welt lässt sich in einem<br />
Wort zusammenfassen, in demselben, das der<br />
auferstandene Jesus als Gruß, aber mehr noch<br />
als Botschaft seines Sieges zu seinen Jüngern<br />
sprach: »Friede sei mit euch!« (Lk 24, 36;<br />
Joh 29, 19.21.26). Der Friede ist das Geschenk,<br />
das Christus seinen Freunden als<br />
Segen hinterlassen hat (vgl. Joh 14, 27), der<br />
für alle Menschen und alle Völker bestimmt<br />
ist.“<br />
Dieser uns hinterlassene Friede bestimmt<br />
auch unser Verhältnis zur Schöpfung. Wir<br />
dürfen sie durch unser Ausbeuten nicht<br />
bekämpfen. Nach dem 1. Schöpfungsbericht<br />
Genesis 1-2, 4, ist der Mensch der krönende 123
124<br />
30.08.09<br />
Der Mensch darf vom<br />
Paradies ernten, er darf es<br />
bebauen, er muss aber um<br />
seiner selbst willen die von<br />
Gott gesetzten Grenzen<br />
achten.<br />
06.09.09<br />
Abschluss des Schöpfungswerkes Gottes.<br />
Hier wird aus dem Erstling der Schöpfung,<br />
was ja schon eine herausgehobene Stellung<br />
bezeichnet, das Abbild Gottes, der über die<br />
Schöpfung herrschen soll, der sie gebrauchen,<br />
aber nicht verbrauchen darf. Er herrscht über<br />
sie im Auftrag Gottes. Dieser will die Schöpfung<br />
vom „Chaos zum Kosmos“ führen, vom<br />
„wüst und leer“ (toho wabohu) in Vers 1 zur<br />
Vollendung in Vers 31: „Gott sah alles an,<br />
was er gemacht hatte: Es war sehr gut. Es<br />
wurde Abend und es wurde Morgen: der<br />
sechste Tag.“ Dies ist auch die Zielrichtung<br />
der Arbeit in dieser Welt für den Erstling<br />
und gleichzeitig die Krone der Schöpfung.<br />
Alles andere wäre ein neuer Sündenfall der<br />
Menschheit. Damit bekennt der Mensch seinen<br />
Glauben an die Neuschöpfung, die das<br />
verkehrte Handeln der Menschen endgültig<br />
ausräumt.<br />
Im 2. Schöpfungsbericht Genesis 2, 5 - 3, 24,<br />
wird die Schöpfung als ein Paradiesesgarten<br />
dargestellt, und das Menschenpaar ist wahrlich<br />
der Erstling in dieser Schöpfung. Sie<br />
wird ihm übertragen, aber nicht, um willkürlich<br />
darin zu herrschen, sondern um sie im<br />
Sinne Gottes zu bebauen und zu behüten.<br />
Seine Grenzen werden ihm deutlich aufgezeigt,<br />
und da der Mensch diese überschreitet,<br />
verliert er das Paradies und muss sterben. Der<br />
Mensch darf vom Paradies ernten, er darf es<br />
bebauen, er muss aber um seiner selbst willen<br />
die von Gott gesetzten Grenzen achten, sonst<br />
entzieht er sich selbst die Lebensgrundlage.<br />
Das ist in der Welt der Auftrag des Erstlings<br />
der Schöpfung. Er ist die Erstlings-<br />
frucht dieser Schöpfung, das heißt, wenn er<br />
sie zerstört, zerstört er sich selbst mit. Er<br />
muss mehr und mehr sich bemühen, im<br />
Sinne Gottes mit ihr umzugehen. Gerade in<br />
diesen Sommertagen (2008) erleben wir wieder<br />
die Herrlichkeit der Schöpfung, wenn wir<br />
durch die Wälder gehen, wir können aber bei<br />
genauem Hinsehen auch z. B. in den Fichten<br />
die durch Menschen verursachten Schäden<br />
wahrnehmen. Wir setzten uns ein für die<br />
Schöpfung, weil wir glauben, dass auch sie<br />
auf dem Weg zur Vollendung ist. So steht es<br />
für uns und die Schöpfung im 2. Petrusbrief<br />
13: „Dann erwarten wir, seiner Verheißung<br />
gemäß, einen neuen Himmel und eine neue<br />
Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt“,<br />
damit wir auch weiter voller Überzeugung<br />
das Lied von Georg Thurmair (GL 852) singen<br />
können:<br />
Mein Gott, wie schön ist Deine Welt:<br />
Der Wald ist grün, die Wiesen blühn,<br />
die großen Ströme ziehn dahin,<br />
vom Sonnenglanz erhellt,<br />
die Wolken und die Winde fliehn,<br />
das Leben rauscht und braust dahin.<br />
Mein Gott, wie schön ist Deine Welt!<br />
Dr. Ernst Leuninger, Limburg<br />
1 C. Drew Harvell et al.: Climate Warming and<br />
Disease Risks for Terrestrial and Marine Biota, in<br />
Science 296 / 2002: S. 2158 ff.<br />
23. Sonntag im Jahreskreis / 13. Sonntag nach <strong>Trinitatis</strong><br />
ev. Reihe I: Lk 10, 25-37 kath. 1. L.: Jes 35, 4-7a kath. 2. L.: Jak 2, 1-5 kath. Evang.: Mk 7, 31-37<br />
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong><br />
Der Verfasser betrachtet den ev. Predigttext, den. 1. Lesungstext sowie<br />
den Evangeliumstext der kath. Leseordnung. Stichworte zur Nachhaltigkeit:<br />
Zerstörung der lokalen Wirtschaft in Afrika, der Wirtschaft unseres<br />
„fernen Nächsten“, steigende Nahrungspreise vs. Agrotreibstoffe bzw.<br />
deren Nachfrage (Lk 10); notwendige Veränderungen von Strukturen werden<br />
ängstlich institutionell verzögert, auch durch die Kirche, Aufruf zur aktiven<br />
Gestalung im Sinne des ersten Gebots (Jes 35); Heilen – Menschen und Natur,<br />
individuell und als Gemeinschaft – was sind heutige „Krankheiten“? (Mk 7)
Lukas 10, 25-37 (Ev. Reihe I)<br />
Die Geschichte von dem Menschen, der<br />
zwischen Jerusalem und Jericho unter die<br />
Räuber fiel, ist als klassischer Text der Diakonie<br />
angesehen worden. Darauf weist auch<br />
die Wirkungsgeschichte hin. Es geht um<br />
Barmherzigkeit, es geht um die Beantwortung<br />
der Frage: Wer ist denn mein<br />
Nächster (Vers 29). Lange Zeit wurde das<br />
karitative Element dieser Geschichte hervorgehoben:<br />
Der primär nicht zum jüdischen<br />
Volk gehört, hilft dem unter die Räuber<br />
Gefallenen, während der Priester und der<br />
Levit vorher achtlos an ihm vorüber gegangen<br />
sind. Daneben bleibt natürlich die Frage,<br />
was es bedeutet, dass der Samariter als nicht<br />
zum jüdischen Volk gehörend die Barmherzigkeit<br />
übt, während Priester und Levit<br />
eben nicht ihrem Auftrag der Sorge für die<br />
Juden – die Menschen – nachkommen. Der<br />
Samariter ist nicht nur barmherzig, sondern<br />
er sorgt auch aktiv dafür, dass der Kranke<br />
genesen kann. Spätestens nach der ÖRK-<br />
Vollversammlung in Uppsala 1967 und der<br />
dortigen Bibelarbeit von Helmut Gollwitzer<br />
wird dieser Text auch anders und erweitert<br />
gelesen: Die Frage nach dem Nächsten<br />
bezieht sich nicht nur auf den oder die<br />
Menschen, die „um die Ecke wohnen”, sondern<br />
sie bezieht sich auch auf den „fernen<br />
Nächsten”, also auf Menschen im Südteil der<br />
Erde, die weit weg sind von uns und unseren<br />
Problemen, und dort besonders auf die, die<br />
arm sind und arm gehalten werden. In einer<br />
Zeit, in der der Skandal der Armut in der sog.<br />
3. Welt in Europa wirklich bewusst wurde,<br />
begann man, die weitere Auslegung dieses<br />
Textes auch auf die gesamte Menschheit zu<br />
beziehen. Der Nächste ist eben nicht nur der<br />
Arme in unserer eigenen Gesellschaft, sondern<br />
auch der ferne Nächste, der in „Unterentwicklung<br />
und Armut lebt” und die<br />
Brotreste erhält, die von „der Reichen Tische<br />
fallen”. Im Text aber stecken weitere Dimensionen:<br />
„Liebe deinen Nächsten” bedeutet:<br />
Akzeptiere ihn, nimm ihn an, so wie er<br />
ist, der Andere, der Nächste. Dies ist uns<br />
geläufig und in den Kirchen tausendfach<br />
gepredigt.<br />
Der aber im Gebot bzw. Zitat auch enthaltene<br />
Aspekt der Eigenliebe ist in der<br />
Christenheit oft unter den Tisch gefallen; das<br />
Zitat Jesu aus Levitikus bzw. Deutero-<br />
nomium bezieht sich ausdrücklich auf „die<br />
Liebe zum Nächsten wie auf dich selbst”.<br />
Ohne Liebe zu mir selber, ohne mich selber<br />
zu akzeptieren wie ich bin, bin ich nicht frei,<br />
auch meinen Nächsten zu akzeptieren, wie er<br />
ist. Ohne, dass ich selber weiß, wer ich bin,<br />
ist es mir nicht möglich, auf den anderen vorurteilsfrei<br />
zuzugehen und mit ihm/ihr in eine<br />
dichtere und engere Kommunikation zu treten.<br />
Denn sonst bin ich letztlich immer doch<br />
wieder mit mir beschäftigt, nicht wirklich<br />
mit dem Anderen, der meine Zuwendung<br />
braucht. Eigenliebe darf nicht mit Gier nach<br />
materiellen Dingen verwechselt werden.<br />
Akzeptieren meiner selbst und an mir arbeiten<br />
zur Verbesserung und Veränderung meiner<br />
Kommunikation und Aktion mit der<br />
Schöpfung und mit anderen Menschen bedeutet<br />
Annehmen meiner eigenen Position in<br />
der Schöpfung; Gier nach Materiellem (z. B.<br />
Geld) ist Egoismus.<br />
06.09.09<br />
Lk 10, 25-37<br />
Die nächste Dimension – der ferne Nächste<br />
– ist schon erwähnt. Die Sicht auf die Welt<br />
erfordert die Beschreibung der Wirklichkeit:<br />
Der Zusammenhang zwischen unserem<br />
Reichtum und der Armut in der sog. 3. Welt<br />
ist vielfach beschrieben und inzwischen auch<br />
unumstritten. Wir essen die Hähnchenbrust,<br />
die Füße, Flügel und die anderen Reste, die<br />
wir als Abfall sehen, bekommen die Westafrikaner<br />
– dort wird die Aufzucht von<br />
Hühnern und der Verkauf auf den lokalen<br />
Märkten zu teuer, weil unsere Produkte subventioniert<br />
werden und – trotz Transport –<br />
billiger sind als dortigen; die lokale<br />
Wirtschaft in Afrika wird zerstört, die<br />
Menschen, die bisher davon gelebt haben, in<br />
Armut gebracht. Armut wird gemacht!<br />
Das Ansteigen der Lebensmittelpreise in<br />
bis dahin ungeahnte Höhen, die viele<br />
Menschen vor die Alternative stellen „essen<br />
oder Wohnung”, ist zu etwa dreiviertel auf<br />
den Hunger der Industrienationen nach<br />
Benzin für ihre Autos zurückzuführen: aus<br />
Nahrungsmitteln wird im wirklich großen<br />
Stil Agrotreibstoff gemacht, damit Lastwagen<br />
und PKW weiterhin uneingeschränkt<br />
fahren können. Was es bedeutet, wenn eine<br />
Familie sonst gerade mit Wohnung und<br />
Essen über die Runden kommt und nun weit<br />
mehr als den doppelten Preis für den Reis<br />
oder andere Grundnahrungsmittel bezahlen<br />
muss, kann man sich ohne Schwierigkeiten 125
126<br />
Jes 35, 4-7a<br />
06.09.09<br />
Es wird Zeit für uns, die<br />
Rolle zu wechseln: vom<br />
Räuber zum Samariter.<br />
ausmalen: statt am Tag dreimal Reis (in der<br />
aufkeimenden Mittelschicht in Indien z. B.)<br />
nur noch zweimal oder weniger. In vielen<br />
Familien war es bisher knapp einmal Reis am<br />
Tag; nun ist es weniger als die Hälfte davon<br />
oder nur jeden 2. Tag etwas. Mit sinkender<br />
Tendenz. Diese Zusammenhänge zeigen<br />
deutlich: Die bisherige Verteilung von<br />
Armut und Reichtum auf der Welt, das bisherige<br />
Wirtschaftssystem, kann so nicht weiter<br />
funktionieren – abgesehen von allen ökologischen<br />
Fragen. Es ist wahrhaftig nicht<br />
<strong>nachhaltig</strong>, dauerhaft oder zukuftsweisend.<br />
Ein letzter Aspekt:<br />
Der Mensch ist Teil der Schöpfung, Teil<br />
des Systems Erde. Besonders auch des Ökosystems<br />
– was wir sehr oft vergessen. Ist also die<br />
Schöpfung (Belebtes und Unbelebtes) nicht<br />
auch „der Nächste”, besser: „das Nächste”?<br />
Genauso wie bisher über „den Nächsten” als<br />
Menschen in der direkten Umgebung und<br />
„den fernen Nächsten” als Menschen irgendwo<br />
auf der Welt gesprochen wurde, kann<br />
man die ganze Schöpfung als „das Nächste”<br />
bezeichnen. Menschen leben nicht nur von<br />
der Natur, sondern sie sind Teil der Natur,<br />
Teil der Schöpfung auf unserer Erde. Daher<br />
müsste auch dem Teil der Schöpfung, der<br />
nicht Mensch ist, die gleiche Aufmerksamkeit<br />
und Hochachtung entgegengebracht<br />
werden, wie den Menschen. Tun wir das?<br />
Nutzen wir die Erde nicht rücksichtslos aus?<br />
Fischen die Meere leer, erwärmen das Klima,<br />
degradieren Flüsse zu Abwasserkanälen, holzen<br />
Wälder im wirklich großen Stil ab und<br />
verarbeiten die Bäume zu Essstäbchen oder<br />
einmal verwendetem Bauholz, um auf den<br />
freien Flächen nicht Nahrungsmittel anzubauen,<br />
sondern Treibstoff für die Transportindustrie?<br />
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst”<br />
bezieht sich auf<br />
– mich selber<br />
– meine Nächsten<br />
– die fernen Nächsten<br />
– die ganze Schöpfung (Ökologie).<br />
Es wird Zeit für uns, die Rolle zu wechseln:<br />
vom Räuber zum Samariter. Das Problem ist<br />
dabei nur, dass sich die grundsätzliche<br />
Situation nicht ändert, die Räuber sind nach<br />
wie vor unterwegs. Es reicht also nicht, die<br />
Rollen zu wechseln; wir brauchen die Änderung<br />
der Situation, die Änderung der politischen<br />
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.<br />
Und: die Änderung unserer eigenen<br />
Lebensführung. Ohne das werden sich die<br />
Räuber nicht verdrücken, werden sie nicht<br />
aufhören, der Befriedigung ihrer Gier nach<br />
Geld nachzugehen. Wer sind die Räuber?<br />
Sind wir nicht beides – Räuber und Samariter<br />
zugleich? Entscheiden wir uns also: Nicht<br />
ohne Grund also schickt Jesus die Fragenden<br />
weg mit dem Hinweis: „also macht es wie der<br />
Samariter ...”<br />
Jesaja 35, 4-7a<br />
Kommentatoren sprechen von einem „leuchtendem<br />
Zukunftsbild von der Verwandlung<br />
der Wüste in reich bewässertes, baumbestandenes<br />
Land” oder einem „lieblichen und ergreifenden<br />
Zeugnis der Hoffnung Israels”.<br />
Die genannten Pflanzen weisen darauf hin,<br />
dass sich der Verfasser die umgewandelte<br />
Wüste so vorgestellt hat, wie er das Nil-<br />
Delta vielleicht erlebt hat. Im wahrscheinlich<br />
letzten Kapitel des 1. Jesaja-Buches wird die<br />
Vision von der zukünftigen Lebenswirklichkeit<br />
nach Erlösung und Befreiung aus selbstverschuldeter<br />
Knechtsschaft und Unterdrückung<br />
entfaltet; in zweiter Linie findet<br />
der Rückweg des Diaspora-Judentums nach<br />
Jerusalem, also in das Zentrum der jüdischen<br />
Geschichte und des jüdischen Kultus, seine<br />
darstellende Beschreibung. Mit all diesem<br />
war die Hoffnung offensichtlich verbunden,<br />
in den Mittelpunkt der Geschichte zurückzukehren,<br />
aus der Bedeutungslosigkeit zu<br />
einem eigenständigen Königsreich zu kommen,<br />
das in der Weltgeschichte (der Region)<br />
wieder eine Rolle spielt.<br />
Man muss sich vor Augen führen, dass die<br />
prophetische Figur Jesaja eng an Amos und<br />
Hosea anknüpft, obwohl er im anderen Teil<br />
des jüdischen Landes, also im anderen Reich,<br />
wirkte. Immer wieder taucht der Zusammenhang<br />
zwischen nicht gottgefälligem<br />
Leben und Untergang bzw. Unheil auf. In der<br />
Vision von der veränderten Welt für die<br />
Juden und das Judentum wird Jahwes<br />
Antwort auf die Umkehr und Veränderung<br />
der Menschen in ihrem Leben beschrieben.<br />
Stichworte hierzu sind Recht und Gerechtigkeit<br />
für Arme, Schwache, Witwen und<br />
Waisen. Das Volk als Ganzes ist schuldig, als
Ganzes geht es dem Gericht entgegen. Einzelne<br />
mögen sich davon unterscheiden, aber<br />
wohl auch nicht wesentlich. Individualität ist<br />
zu dem Zeitpunkt nicht im Vordergrund<br />
oder wesentlich; spricht hier die noch lebendige<br />
Erfahrung der Wüstengruppen, die ja<br />
als Ganzes ziehen oder bleiben, wandern oder<br />
lagern? Kollektivschuld? Wir werden erinnert<br />
an die Debatte im Nachkriegsdeutschland,<br />
als es um die Aufarbeitung der Schuldfrage<br />
im Zusammenhang mit dem Holocaust,<br />
der Shoa, ging. Beurteilungskriterien sind<br />
die Einhaltung oder Durchsetzung der<br />
Inhalte der oben genannten Stichworte Recht<br />
und Gerechtigkeit. Grundlage dieser Argumentation<br />
seitens der Propheten – und damit<br />
auch der des Jesaja – ist die ausschließliche<br />
Gültigkeit des ersten Gebots, die durch „das<br />
Volk” ständig missachtet wird. Dazu kommt<br />
in der historischen Situation dann noch die<br />
tatsächliche militärische Bedrohung durch<br />
das größer werdende Assyrien und untaugliche<br />
Versuche der Politik beider Reiche, sich<br />
wirkungsvoll dem Zugriff der Assyrer zu entziehen.<br />
Den Untergang vor Augen warnen<br />
die Propheten, interpretieren das politisch –<br />
militärische Ende als Folge der Verhaltensweisen<br />
des Volkes – besser: der politischen,<br />
ökonomischen und religiösen Oberschicht.<br />
Wie so oft – so auch hier: Die Masse der<br />
Menschen wird zum Spielball, die Geschicke<br />
wirklich bestimmen wenige.<br />
Wie stark diese Vision und vor allem diese<br />
Hoffnung waren, zeigt der Entwurf des<br />
Bildes vom Wasser in der Wüste. Es rekrutiert<br />
auf das Aufbrechen der Urfluten beim<br />
Schöpfungsakt, so dass man bei dem vorliegenden<br />
Text davon ausgehen kann, dass ein<br />
neuer Schöpfungsakt, ein neuer Zeitabschnitt<br />
nach dem Gericht, dem das Volk unterworfen<br />
werden wird, gemeint ist. All das, was heute<br />
fehlt, soll zukünftig sein, soll der „Zukunftsherrscher”<br />
bringen: Einsicht, Gerechtigkeit,<br />
Fürsorge für die Armen und Beendigung des<br />
Krieges unter den Völkern sowie wichtig:<br />
Aufrichtung des Rechtes in der Begegnung<br />
mit dem erhabenen Gott. Dieser Neuanfang<br />
ist nicht auf die nationale Größe und<br />
Herrschaft Israels ausgerichtet, sondern in<br />
der politischen Gestalt unbestimmt. Die Einleitung<br />
der Heilszusage mit ihrer Aufforderung,<br />
mutig zu sein und sich nicht vor der<br />
Zukunft zu fürchten, könnte ein Satz für die<br />
Predigt sein. Veränderungen, die nötig sind,<br />
werden durch Angst vor den Unwägbarkeiten<br />
und Unberechenbarkeiten verzögert<br />
oder verhindert. Diesen Mechanismus finden<br />
wir in unserer Gesellschaft, in unserer Politik,<br />
in unserer Kirche nur allzu oft wieder.<br />
„Gott kommt und wird euch helfen“ (Vers 4)<br />
– und hinzuzufügen wäre: Wenn ihr denn<br />
endlich beginnen würdet, wirklich beginnen<br />
würdet. Die Zerstörung der Schöpfung, des<br />
Ökosystems Erde, von dem der Mensch ein<br />
Teil ist, schreitet unglaublich schnell voran.<br />
Alles Leben ist bedroht – wie seinerzeit Israel<br />
durch Assyrien. Was bedeutet in dieser<br />
Situation heute die Ausschließlichkeit der<br />
Geltung des ersten Gebotes für Christen?<br />
Wir gestalten die Welt egoistisch mit Geld,<br />
Technik, rücksichtslosem Fortschrittsglauben.<br />
Wir gestalten die Welt für uns Menschen<br />
und nicht für die ganze Schöpfung. Wir beuten<br />
die Erde rücksichtslos aus, wir gestalten<br />
sie rücksichtslos nach unseren Maßstäben<br />
und unseren Ideen, allein für unser egoistisches<br />
Wohlergehen. Die ökologische Vielfalt<br />
schrumpft, die Vielfalt der Nahrungsmittel<br />
auch für Menschen schrumpft, wir machen<br />
die Erde zur grauen Monotonie; zur Wüste,<br />
in der Leben nur noch schwer oder überhaupt<br />
nicht möglich ist.<br />
Wasser, blühen, neues Leben wird nur<br />
kommen, wenn wir umdenken, uns auf das<br />
erste Gebot besinnen, nicht uns selbst in den<br />
Mittelpunkt allen Lebens stellen, sondern<br />
diesen Platz Jahwe überlassen.<br />
Markus 7, 31-37<br />
06.09.09<br />
Veränderungen, die nötig<br />
sind, werden durch Angst<br />
vor den Unwägbarkeiten<br />
und Unberechenbarkeiten<br />
verzögert oder verhindert.<br />
Mk 7, 31-37<br />
Der Mensch, von allen guten Geistern verlassen.<br />
Jesus tritt ihm entgegen, Jesus öffnet<br />
Zukunft. Er handelt aus der Gemeinschaft<br />
mit Gott (mit dem Vater) heraus und ist so in<br />
der Lage, heilende, schöpferische Worte zu<br />
sprechen – und zu agieren. Er agiert nicht<br />
alleine, sondern in Gemeinschaft und vor<br />
einer Menge von Zeugen, die auf subtile<br />
Weise in Gang gesetzt werden, von dem<br />
Erfahrenen zu berichten. Heilung in Gemeinschaft<br />
– Heilung durch Gemeinschaft? Im<br />
Johannesevangelium wird berichtet, dass<br />
Jesus seinen Speichel (Speichel = Symbol für<br />
Segen) mit Erde mischt und damit den<br />
Kranken heilt. Jesus hat sich intensiv unter<br />
vier Augen um den Kranken gekümmert. 127
128<br />
Lk 17, <strong>11</strong>-19<br />
06.09.09<br />
13.09.09<br />
Leid teilen ist wichtig, mit-leiden notwendig.<br />
Das tut die Gemeinschaft. Dies ersetzt<br />
aber in vielen Fällen nicht die direkte, persönliche<br />
Zuwendung.<br />
Weitere Stichworte:<br />
Woran kranken wir? Einsamkeit? Kommunikationslosigkeit<br />
trotz – oder wegen? –<br />
Fernsehen, Telefon und Internet? Mit einfachen<br />
Mitteln heilen, bewusst Ökologie und<br />
Natur dazu einsetzen, ohne „Chemiekeule“,<br />
die Energie in uns aktivieren für Heilungsprozesse,<br />
Lebensstil verändern.<br />
24. Sonntag im Jahreskreis / 14. Sonntag nach <strong>Trinitatis</strong><br />
ev. Reihe I: Lk 17, <strong>11</strong>-19 kath. 1. L.: Jes 50, 5-9a kath. 2. L.: Jak 2, 14-18 kath. Evang.: Mk 8, 27-35<br />
Jesus berührt einen<br />
Aussätzigen und<br />
heilt ihn.<br />
Wolfram Walbrach, Düsseldorf<br />
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong><br />
Der Verfasser betrachtet den ev. Predigttext und den Text zur 1. kath.<br />
Lesung. Stichworte zur Nachhaltigkeit: sich wie Jesus an der Heilung der<br />
Kranken dieser Welt beteiligen, die Brücke zu den Ausgegrenzten<br />
(„Aussätzigen“) schlagen, aktiv am Reich des Lebens mitbauen (Lk 17);<br />
auf die Propheten hören, die Dinge an sich heranlassen, sorgfältig bedenken<br />
und nicht automatisch vorverurteilen (Jes 50)<br />
Thema: Nicht ausgrenzen, Hände reichen!<br />
Lk 17, <strong>11</strong>-19<br />
Wie viele Menschen leiden heute noch an<br />
Lepra? Etwa 2,5 Millionen Menschen sind<br />
heute davon betroffen. Weltweit werden<br />
stündlich 60 neue Leprakranke entdeckt. Im<br />
Schnitt leiden von diesen 60 Menschen schon<br />
fünf unter schweren Behinderungen, elf von<br />
ihnen sind Kinder unter 14 Jahren. Die Zahl<br />
der Neuinfektionen – ca. 660.000 pro Jahr –<br />
bleibt seit Jahren konstant. Jesus berührt<br />
einen Aussätzigen (so hießen sie lange<br />
Jahrhunderte, weil sie aus ihrer Umwelt ausgesetzt<br />
wurden) und heilt ihn. Ist er durch<br />
diese Berührung unrein? Wird er nun selbst<br />
ausgegrenzt?<br />
Heilung grenzt nicht aus. In den 2<strong>90</strong><br />
Projekten der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe<br />
z. B. werden in 45 Ländern der<br />
Erde über 126.000 Menschen mit der Medikamentenkombination<br />
gegen Lepra behan-<br />
delt. Auch die Kirchen engagieren sich hier<br />
durch die Hilfe ihrer Mitglieder. Über<br />
60.000 Kranke kamen im vergangenen Jahr<br />
neu in die Behandlung. Hier ist durch uns<br />
Jesus am Werk.<br />
– Jesu lebensspendende Hand<br />
– unsere lebensspendenden Hände<br />
Mit ihnen wollen wir helfen, ein Reich der<br />
Gerechtigkeit, des Friedens und des Lebens<br />
für alle zu errichten, indem wir helfen, die<br />
durch Krankheit Ausgesetzten zu reintegrieren.<br />
Aussätzige gab es bei uns bis ins die letzten<br />
Jahrhunderte, sie wurden ausgegrenzt,<br />
mussten mit einer Rassel vor Begegnung<br />
warnen, wie schon in biblischen Zeiten, wo<br />
sie „unrein“ rufen mussten.<br />
Als Auferstandener zeigt Jesus seine durchbohrten<br />
Hände, mit denen er das Reich der<br />
Auferstehung und des Lebens, der Gerechtig-
keit und des Friedens aufrichten wird, in dem<br />
es keine Krankheiten mehr gibt. Er hat die<br />
größte Macht, die Macht des Todes überwunden.<br />
Jährlich sterben drei Millionen durch<br />
Tuberkulose. Auch hier engagieren sich die<br />
Hilfswerke. Wenn wir mitsorgen, dass die<br />
Mittel für Heilung zur Verfügung gestellt<br />
werden, dann helfen wir mit an der Heilung<br />
der Welt, das ist auch unserer Hände Werk.<br />
Wir können und dürfen die Kranken nicht<br />
ausgrenzen, sondern wir müssen für sie zu<br />
heilenden Händen werden. So werden wir zu<br />
Zeugen für unseren Glauben an die alles heilenden<br />
Hände des Auferstandenen, der ein<br />
Reich ohne Not, ohne Ausgrenzung, ein<br />
Reich des Lebens, der Gerechtigkeit und des<br />
Friedens errichten will. Wir bauen mit an<br />
einer solch zukünftigen Menschheitsfamilie,<br />
da wir in Jesus alle Schwestern und Brüder<br />
sind.<br />
Thema: Nicht durch Spott ausgrenzen,<br />
sondern zuhören Jesaja 50, 5-9a<br />
Wir kennen die Situation. Da redet jemand<br />
anders als der Mainstream der Gesellschaft.<br />
Nicht, dass er gleich körperlich bedroht<br />
würde, aber in der Regel muss er mit Spott<br />
rechnen. Das geschieht auch hier dem<br />
Propheten Jesaja. Er, der immer die Heilsvision<br />
seines Volkes predigt, macht auch in<br />
der Situation des Unheils deutlich, dass dieses<br />
Unheil, in welchem sich das Volk befindet,<br />
eine Folge ihrer bösen Taten sei. Dies<br />
mögen die Menschen nicht hören, deshalb<br />
verfolgen und verprügeln sie ihn, reißen ihm<br />
den Bart aus und bespucken ihn. Aber er<br />
weiß sich in seinem Auftrag von Gott her<br />
gesandt und geht von dieser Sendung nicht<br />
ab.<br />
Mit welchem Spott wurden die ersten<br />
umweltorientiert Denkenden auch in unserem<br />
Land überhäuft. Sie wurden als Spinner<br />
und Gegner des Fortschritts hingestellt, als<br />
Unheilspropheten, ohne Anspruch auf Wahrheit<br />
ihrer Aussage. Heute ist es schon so, dass<br />
eine eher konservative Partei mit diesem<br />
Thema ihr Stimmentief bei den Wählern<br />
überwinden will. Was ist passiert? Die Vorhersage<br />
einer drohenden Umweltkatastrophe<br />
hat sich leider bewahrheitet. Der Klimawandel<br />
wird allerorten spürbar und hat gerade<br />
für die armen Länder verheerende Folgen.<br />
Mühsam errungene, keineswegs von allen<br />
Staaten geteilte, Grenzen der Umweltzerstörung,<br />
greifen nur wenig und oft auch<br />
zu spät. Hätte man früher den Unheilspropheten<br />
zugehört und sie nicht durch Spott<br />
ausgegrenzt, hätte manches rechtzeitig verhindert<br />
werden können. Umweltpropheten<br />
wurde vorgeworfen, dass sie die Industrie und<br />
damit den Standort Deutschland als Wirtschaftsnation<br />
bekämpften, heute wissen wir,<br />
dass Umwelttechnologie unsere größte Wachstumschance<br />
ist.<br />
Die kirchlichen Hilfswerke Diakonie<br />
Katastrophenhilfe und Caritas international<br />
verstärken ihre Zusammenarbeit bei der<br />
Vorsorge gegen die Folgen des Klimawandels.<br />
Dürren und Fluten, so sagen sie,<br />
nähmen weltweit zu, der Klimawandel liegt<br />
nicht in ferner Zukunft. Viele Menschen sind<br />
jetzt schon bedroht. Wer drohendes Unheil<br />
verhindern will, der sollte zuhören können,<br />
auch wenn das, was gesagt wird unbequem<br />
ist, auch wenn wir herausgefordert werden,<br />
wie die Menschen zur Zeit des Propheten<br />
Jesaja, unseren Lebensstil zu ändern. Der<br />
Mensch darf diese Botschaft nicht verdrängen,<br />
indem er die Boten durch Spott ausgrenzt.<br />
Er muss zuhören und in einem ernsthaften<br />
Denkprozess über das Für und Wider<br />
eintreten. Das gilt auch für andere Bereiche,<br />
so z. B. für die Gentechnik und Atomenergie.<br />
Dr. Ernst Leuninger, Limburg<br />
13.09.09<br />
129
130<br />
Weisheit ist Klugheit,<br />
die von Gott kommt,<br />
und die zum Beispiel<br />
Sanftmut und gute Werke<br />
kennt und gern tut.<br />
20.09.09 25. Sonntag im Jahreskreis / 15. Sonntag nach <strong>Trinitatis</strong><br />
ev. Reihe I: Mt 6, 25-34 kath. 1. L.: Weish 2, 1a.12.17-20 kath. 2. L.: Jak 3, 16 - 4, 3 kath. Evang.: Mk 9, 30-37<br />
Mt 6, 25-34<br />
Der Autor betrachtet im Wesentlichen den ev. Predigttext mit einigen<br />
Brücken zu anderen Texten dieses Sonntags. Stichworte zur Nachhaltigkeit:<br />
übertriebene materielle Absicherung ist unchristlich, verblendet,<br />
sofern es um den individuellen Komfortbereich und nicht um das<br />
existentiell Notwendige geht, soziale Gerechtigkeit; was für das Heute<br />
wirklich wichtig ist, lässt uns Gott erkennen, wir müssen nur die Augen<br />
und Ohren (bzw. Herzen) öffnen (Mt 6)<br />
Die Texte dieses Sonntages<br />
Mt 6, 25-34<br />
„... Sorget nicht …“ meint wohl, sorgt euch<br />
nicht um materielle Dinge, die ihr zwar auch<br />
notwendig braucht, die ihr aber in genügendem<br />
Maß von Gott geschenkt bekommt. Gott<br />
sorgt für seine ganze Schöpfung; also sorgt<br />
ihr euch nicht kleingläubig, griesgrämig um<br />
die Dinge, die ihr ja doch nicht machen<br />
könnt, weil sie eh in Gottes Hand liegen.<br />
„Trachtet …“, d.i. mit viel Cleverness, Mut,<br />
Zielstrebigkeit und Freude nach dem Reich<br />
Gottes streben, d.i. die eigentliche Erfüllung<br />
unseres Lebens durch Frieden, Freude,<br />
Zufriedenheit, Ehrfurcht, Achtung, Güte …<br />
und auf dem Weg dorthin übt Gerechtigkeit.<br />
Weish 2, 1a.12.17-20<br />
Hier wird das Vertrauen in Gott und seine<br />
Vorsorge und Sorge für die Gerechten hervorgehoben,<br />
gegen das Infragestellen, die Zweifel<br />
und Übeltaten der Gottlosen und Frevler.<br />
Jak 3, 16 - 4, 3<br />
Weisheit ist Klugheit, die von Gott kommt,<br />
und die zum Beispiel Sanftmut und gute<br />
Werke kennt und gern tut. Neid und Streit<br />
sind gegen Gott, teuflisch und böse. Bei der<br />
Weisheit, die von Gott kommt, geht es lauter,<br />
friedfertig und gütig zu, es werden Nachsicht<br />
und Barmherzigkeit geübt, und so zum<br />
Frieden beigetragen. Neid, Gelüste und<br />
Streit dagegen machen das alles kaputt.<br />
Mk 9, 30-37<br />
Jesus redet von Leid, Tod, Auferstehung<br />
und der Erfüllung seiner heilsbringenden Bot-<br />
schaft. Die Jünger hängen an typisch menschlichen<br />
Belangen: Macht, Karriere, Ehrgeiz.<br />
Sie wollen zwar nachfolgen, aber vom Dienen<br />
nichts wissen. Jesus sagt ihnen klar und deutlich:<br />
Wer unter euch der Erste sein will, der<br />
soll euer Diener sein.<br />
Zur Liturgie<br />
Folgende Lieder fallen mir ein: Die güldene<br />
Sonne (EG 449); Ich singe dir mit Herz und<br />
Mund (EG 324); Du meine Seele singe (EG<br />
302); Gottes Liebe ist wie die Sonne (EG 654);<br />
Vergiß nicht zu danken (EG 618); Herr, wir<br />
bitten, komm und segne uns (EG 610); Schenk<br />
uns Weisheit, schenk uns Mut (EG 653).<br />
Im Kalenderjahr gesehen:<br />
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong><br />
Es ist Nachsommer. Der größte Teil der<br />
Ernte ist schon eingefahren (Heu, Futtersilo,<br />
Getreide, Obst), ein weiterer Teil (Kartoffeln,<br />
Rüben, Äpfel und noch viele Garten- und<br />
Feldfrüchte) wartet darauf, noch geerntet zu<br />
werden – umsonst; denn viele Früchte werden<br />
nicht geerntet und vergammeln. In der<br />
Wirtschaft und im Handel ist der Aufschwung<br />
etwas schwächer geworden, aber<br />
insgesamt floriert die Wirtschaft noch gut.<br />
Die Öffentlichen Haushalte profitieren davon;<br />
für den Bürger sind die Energiekosten enorm<br />
gestiegen, die Preise für viele Alltagslebensmittel<br />
ebenfalls.<br />
Überlegungen und Gedanken zu Mt 6,<br />
25-34<br />
Im Wesentlichen beschränke ich mich auf<br />
den Predigttext nach der evangelischen Perikopenordnung<br />
für diesen Sonntag: („Sorget<br />
euch nicht!“) Er ist par exellence geeignet<br />
zum „<strong>nachhaltig</strong> Predigen“.
Die evangelische Perikopenordnung versucht,<br />
den Sonntagen der festlosen <strong>Trinitatis</strong>zeit ein<br />
Thema zuzuordnen und ihnen so auch ein<br />
besonderes Profil zu geben. Mt 6 (Vom<br />
Sorgen) ist eine Mahnung vor übertrieben<br />
ehrgeizigem und sich aufreibendem Sorgen<br />
um den Lebensunterhalt, Lebensstandard,<br />
materielle Zukunftssicherung. Dieser Text<br />
wirbt für mehr Gottvertrauen. Er enthält<br />
Worte gegen die Ängstlichkeit und gegen<br />
das bürgerliche Alles-versichern-und-absichern-wollen.<br />
Er wirbt für mehr zuversichtliches<br />
Gottvertrauen. Hier wird das „immer<br />
mehr haben wollen“ gegen einen einfacheren<br />
Lebensstil eingetauscht. Ohne von vornherein<br />
einen Zweifel aufkommen zu lassen: Das<br />
betrifft natürlich in erster Linie die, die schon<br />
in üppiger Weise gesorgt haben und immer<br />
noch emsig am „Aussorgen“ sind, und weniger<br />
die, die eh alle Mühe haben, ihren<br />
bescheidenen Lebensunterhalt zu bestreiten.<br />
An den anderen 15. Sonntagen (Reihen II-<br />
VI) stehen: (II) 1 Petr 5, 5c-<strong>11</strong>, „Alle eure<br />
Sorgen werft auf ihn!“; (III) Lk 18, 28-30<br />
„Lohn der Nachfolge“; (IV) Gal 5, 25.26 - 6,<br />
1-3.7-10 „Die Erfüllung des Gesetzes“; (V)<br />
Lk 17, 5.6 „Die Kraft des Glaubens“ und (VI)<br />
1 Mose 2, 4b-9.(10-14).15 „Bebauen und Bewahren“.<br />
Alle Texte weisen auf die Gaben<br />
Gottes für unser Leben hin, die Erfüllung<br />
unseres Lebens und die Erhaltung der göttlichen,<br />
natürlichen Ressourcen.<br />
Der Wochenspruch („Alle eure Sorgen<br />
werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“ 1 Petr<br />
5, 7) und das Biblische Eingangswort „Habe<br />
deine Lust am Herr; der wird dir geben, was<br />
dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine<br />
Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl<br />
machen.“ (Ps 37, 4.5) unterstreichen die<br />
Themata dieses Sonntages.<br />
Zu Mt 6, 25-34 „… Sorget nicht …“<br />
Die Mahnung vor übertriebenem Sorgen<br />
steht im Mt-Evangelium gleich nach einem<br />
Kapitel vom Fasten und dem Vaterunser.<br />
Während im Vaterunser die Bitten um das<br />
Notwendigste („Gib uns unser täglich Brot“)<br />
und um den sozialen Frieden („Vergib uns<br />
unsere Schuld, wie auch wir …“) formuliert<br />
sind, weisen die zwei unmittelbar voranstehenden<br />
Abschnitte auf Ehrlichkeit vor Gott<br />
(und uns selbst) hin und auf einen einfachen<br />
Lebensstil. Auch in der Lk-Parallele „Sorget<br />
nicht“ steht unser Abschnitt nach dem reichen<br />
Kornbauern (Erntedank; Mahnung) und<br />
mahnt, unser Leben als ein Geschenk Gottes<br />
zu sehen und als eine Antwort auf Gottes<br />
vielseitige Gaben.<br />
Zur Predigt:<br />
20.09.09<br />
Was bedeutet mir mein Leben? Und was<br />
möchte ich für mein Leben haben? Alle meinen:<br />
Etwas Glück und etwas Glücklichsein!<br />
(Hier lassen sich viele Beispiele finden. Schon<br />
die Konfirmanden sagen, gut bürgerlich,<br />
einen lieben Partner, Verständnis, Liebe, einen<br />
guten Beruf, ein schönes Zuhause.)<br />
Was tun wir aber? Wir sorgen vor, wir sorgen<br />
uns, wir sorgen für … und vor lauter „Wir wollen durch Sorge<br />
Sorgen sorgen wir am Leben vorbei. (Bestimmt<br />
die Hälfte meiner Versicherugen, die sorglos werden und<br />
der Vorsorge und der Vorsicht dienen sind<br />
doppelt oder unnötig und kosten mich viel vermehren durch unser<br />
Geld, das ich zum „Eigentlich leben“ ganz<br />
gut noch gebrauchen könnte. Ich werde Sorgen nur die Sorgen!“<br />
meine vielen Verträge mal durchforsten).<br />
„Wir wollen durch Sorge sorglos werden (Dietrich Bonhoeffer)<br />
und vermehren durch unser Sorgen nur die<br />
Sorgen!“ (Dietrich Bonhoeffer) Aber Jesus<br />
spricht in der Bergpredigt gegen das übertriebene<br />
Sorgen und Vorsorgen, das uns so<br />
sehr in Beschlag nimmt, dass uns keine Zeit<br />
und Muße oder keine Mittel mehr bleiben,<br />
um miteinander zu leben, zu feiern, zu freuen<br />
und auch, um füreinander dazusein.<br />
Martin Luther schreibt in der Auslegung zu<br />
seinem großen Kathechismus: „Woran du<br />
mit deinem Herz hängst, das ist eigentlich<br />
dein Gott!“ Daraus folgt: Wenn wir uns zu<br />
viele Gedanken und Sorgen machen um unsere<br />
Gesundheit, von einem Arzt zum andern<br />
rennen, massenhaft Arznei schlucken, dann<br />
trauen wir Gott zu wenig zu, dass er für uns<br />
sorgt – wie jener saudische Prinz, der seinen Mt 6, 25-34<br />
Privatjet mit einer Herzintensivstation ausstattete,<br />
um bei einem Herzinfarkt ja schnell<br />
genug versorgt werden zu können. Oder wir<br />
rennen von Bank zu Bank, um uns ja den<br />
höchsten Zinssatz für unser bißchen Erspartes<br />
zu sichern. Und wenn es auch nur ein Viertelprozent<br />
ausmacht. Oder wir eifern in Beruf<br />
und Karriere um die besten Aufstiegschancen<br />
und höchsten Renditen.<br />
Leider ist das Streben in unseren westli- 131
132<br />
20.09.09<br />
Jesus will uns den sturen<br />
Blick weglenken vom<br />
alleinigen Sorgen, vom<br />
übereifrigen Arbeiten, vom<br />
Ehrgeiz, immer mehr<br />
verdienen zu wollen.<br />
chen Gesellschaften nach immer mehr Gewinn,<br />
dem besseren Preis oder dem billigeren<br />
Angebot oberstes Prinzip und allgemein<br />
anerkannter Wert. Ich meine damit: Ein<br />
Kleinanleger (oder erst recht die größeren<br />
Anleger) verhandeln mit den Banken in ihrer<br />
Kleinstadt um ein paar zehntel Prozent und<br />
spielen die Sparkassen gegeneinander aus.<br />
Die versuchen über ihre Fondsmanager auch,<br />
die besten Renditen zu erzielen, die versuchen,<br />
das zu verwaltende Geld möglichst gut<br />
„am Markt anzubringen“; die großen Firmen<br />
wiederum wollen und müssen für ihre Geldgeber<br />
(Aktionäre und Fondsmanager) gute<br />
Renditen und möglichst hohe Gewinne zum<br />
Investieren erwirtschaften und intensivieren<br />
die Produktion und üben so schließlich und<br />
endlich auf den Arbeitnehmer einen enormen,<br />
manchmal unmenschlichen Druck aus.<br />
Dazu fällt mir eine Geschichte von Heinrich<br />
Böll ein, die gut zu unserem Thema passt<br />
und uns zum Nachdenken anregt (vgl.<br />
Platow):<br />
In einem kleinen Hafen irgendwo an einer<br />
Küste Europas liegt ein älterer Mann in<br />
Arbeitskleidung auf einem Haufen Netze<br />
neben seinem Fischerboot in der Sonne und<br />
döst vor sich hin. Ein schick angezogener<br />
Herr, vielleicht ein Manager im Urlaub, will<br />
ihn motivieren, ein zweites oder drittes Mal<br />
hinauszufahren zum Fischen. Aber der Fischer<br />
will nicht. Darauf der Fremde: „Aber stellen<br />
Sie sich doch vor, sie würden mehr fischen<br />
und sich vielleicht in einem Jahr schon ein<br />
zweites Boot kaufen können oder einen kleinen<br />
Kutter, und bald ein eigenes Kühlhaus<br />
und einen LKW mit Kühlung, und sie könnten<br />
ihren Fang selbst vermarkten und bessere<br />
Preise erzielen und noch mehr verdienen.“<br />
„Und dann?“, fragt der Fischer. „Dann könnten<br />
Sie sich Leute einstellen, die für Sie arbeiten!<br />
„Und dann?“, fragt der Fischer. „Dann<br />
könnten Sie beruhigt im Hafen sitzen, in der<br />
Sonne dösen und aufs Meer schauen …!“ Da<br />
setzt sich der Fischer auf, schiebt sich die<br />
Mütze in den Nacken und sagt: „Na und, das<br />
tue ich ja jetzt auch schon! – Ich sitze beruhigt<br />
im Hafen, döse in der Sonne und schaue<br />
aufs Meer. Nur Sie stören mich mit ihrem<br />
Geschwätz.“<br />
Die Geschichte zeigt, welchen Stellenwert<br />
die materiellen Dinge, der Erfolg, die Karriere<br />
im Leben von Menschen haben. Jesus<br />
will uns den sturen Blick weglenken vom<br />
alleinigen Sorgen, vom übereifrigen Arbeiten,<br />
vom Ehrgeiz, immer mehr verdienen<br />
zu wollen, hin zum Zeit haben für sich und<br />
andere, zum glücklich Sein – und zum<br />
Vertrauen auf Gott, der uns ja schenken will,<br />
was wir zum Leben brauchen.<br />
Literatur:<br />
Predigtstudien V, Kreuzverlag Stuttgart 1982<br />
Bieritz, Karl-Heinrich, Das Kirchenjahr. Feste,<br />
Gedenk- und Feiertage in Geschichte und Gegenwart,<br />
München 1998<br />
Platow, M.,Predigt: Das Glück des Glaubens,<br />
2007 (Mt 6, 25-34)<br />
Waldemar Müller, Niederkirchen
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong><br />
26. Sonntag im Jahreskreis / 16. Sonntag nach <strong>Trinitatis</strong><br />
Die Autorin betrachtet die Bibelstelle der kath. 1. Lesung. Mangelnde<br />
Ausdauer und Geduld, fehlendes Vertrauen in den richtigen Weg, einzelne<br />
Menschen entwickeln Visionen und Zukunftsstrategien, Gier und<br />
Egozentrik blockieren den schon sichtbaren Weg ins Gelobte Land,<br />
Verantwortung und Aufgaben adäquat verteilen, intelligente Selbstbeschränkung,<br />
Gier schaufelt Gräber – auch für andere.<br />
Nachhaltig <strong>predigen</strong> – Num <strong>11</strong>, 25-29<br />
Das Buch Numeri steht im Kontext der<br />
bedeutenden Erzählung der Befreiung und<br />
des Auszugs der Israeliten aus der Sklaverei<br />
in Ägypten. Am Berg Sinai erhält Mose die<br />
Gesetzestafeln mit den 10 Geboten, und es<br />
erfolgt der Bundesschluss zwischen Gott und<br />
dem Volk Israel. Schon hier, nach dem<br />
schnellen Erfolg des Aufbruchs aus Ägypten<br />
und der gelungenen Flucht durch das<br />
Schilfmeer, zeigt das Volk wenig Ausdauer<br />
und läuft Gefahr, wieder von fremden Göttern<br />
und alten Machthabern in den Bann gezogen<br />
zu werden. Moses energisches Handeln<br />
und ein hoher persönlicher Preis verhindern<br />
dies. Im Buch Numeri richtet sich nun der<br />
Blick vom Sinai hin zum Jordan in das<br />
„Gelobte Land“, in die Zukunft. Dies geschieht<br />
im Vertrauen darauf, dass Gott, der die<br />
Israeliten aus Ägypten befreit und durch die<br />
Wüste geführt hat, sein Volk auch weiter<br />
durch die Geschichte führen wird. Angesichts<br />
dieses Vertrauens auf Gott werden auch<br />
in schwierigen oder gar ausweglos erscheinenden<br />
Situationen Strategien entwickelt.<br />
Einzelne Menschen, die in besonderer Weise<br />
vom Geist Gottes berührt sind, ergreifen die<br />
Initiative und entwickeln Zukunftsstrategien.<br />
Sie überlassen sich nicht einfach dem<br />
Schicksal oder Zufall. Sie entwickeln Visionen,<br />
sind vorausschauend und fordern zu freiem<br />
und selbstbestimmten Handeln auf.<br />
Bevor das Volk vom Sinai aufbrechen kann,<br />
erfolgt eine Ordnung des Volkes sowohl im<br />
Lager als auf dem Marsch, wenig spektakulär<br />
und zeitraubend. Noch bevor es zum Aufbruch<br />
kommt, zeigt sich erneut die Ungeduld,<br />
Unzufriedenheit und Gier des Volkes.<br />
Vergessen sind die negativen Folgen der<br />
Sklaverei: „… und auch die Israeliten begannen<br />
wieder zu weinen und sagten: Wenn uns<br />
doch jemand Fleisch zu essen gäbe! Wir denken<br />
an die Fische, die wir in Ägypten<br />
umsonst zu essen bekamen, an die Gurken<br />
und Melonen, an den Lauch, an die Zwiebeln<br />
und an den Knoblauch. Doch jetzt vertrocknet<br />
uns die Kehle, nichts bekommen wir zu<br />
sehen als immer nur Manna“ (Num <strong>11</strong>, 4-6).<br />
Aufgrund dieses Geschreis „… entbrannte der<br />
Zorn des Herrn“ und „… Mose aber war verstimmt“.<br />
Er saß mal wieder zwischen allen<br />
Stühlen, der Herr zornig und das Volk unwillig.<br />
Man muss sich ernsthaft fragen, hatte<br />
Mose das, was wir heute unter einem Burnout-<br />
Syndrom verstehen, wenn er sagt: „Ich kann<br />
dieses ganze Volk nicht allein tragen, es ist<br />
mir zu schwer. Wenn du mich so behandelst,<br />
dann bring mich lieber gleich um, wenn ich<br />
überhaupt deine Gnade gefunden habe. Ich<br />
will mein Elend nicht mehr ansehen.“ Er war<br />
erschöpft, ausgebrannt. In dieser Situation<br />
wäre er am liebsten gestorben.<br />
Die Unzufriedenheit und Gier der Menschen<br />
bedroht das Leben jedes Einzelnen.<br />
27.09.09<br />
ev. Reihe I: Joh <strong>11</strong>, 1(2)3.17-27.41-45 kath. 1. L.: Num <strong>11</strong>, 25-29 kath. 2. L.: Jak 5, 1-6<br />
kath. Evang.: Mk 9, 38-43.45.47-48<br />
Num <strong>11</strong>, 25-29<br />
Mangelnde Ausdauer, der Wunsch nach<br />
schnellem Erfolg, die mangelnde Bereitschaft<br />
sich selbst etwas zu erarbeiten, auf Kosten<br />
anderer Dinge zu erhalten, das Anspruchsdenken<br />
„Mir stehen aber Fleisch und Melonen<br />
zu“, der Entfall der Frage nach dem<br />
Nächsten: „Wie geht es Dir?“ … Diese und<br />
andere Faktoren gefährden die Zukunft des<br />
Einzelnen wie der Gesellschaft als Ganzer.<br />
Nur solidarisches, <strong>nachhaltig</strong>es Handeln<br />
ermöglicht Leben auch in Zukunft. Gier,<br />
immer mehr, immer weiter, immer höher, nie<br />
genug, … vielleicht wäre ja doch nur für<br />
mich allein ein bisschen mehr drin? verhindert<br />
den Blick in die Zukunft, verhindert den<br />
Aufbruch ins Gelobte Land. Gier macht den<br />
Traum von einer besseren Welt zunichte. 133
134<br />
27.09.09<br />
Ohne Verzicht, ohne<br />
sinnvolle Selbstbegrenzung<br />
ist <strong>nachhaltig</strong>e Entwicklung<br />
nicht möglich.<br />
Welche Strategie bietet Gott in diesem<br />
Text an, um sowohl Mose als auch dem Volk<br />
wieder neue Kraft, neuen Mut und neuen<br />
Weitblick zu geben? Eigentlich ganz einfach:<br />
Die Last des Mose wird auf mehrere Schultern<br />
verteilt. 70 Älteste werden vor dem Offenbarungszelt<br />
zusammengerufen und Gott<br />
spricht: „Ich nehme etwas von dem Geist, der<br />
auf dir ruht, und lege ihn auf sie. So können<br />
sie mit dir zusammen die Last des Volkes tragen,<br />
und du musst sie nicht mehr allein tragen.“<br />
Geistsendung und Verantwortung werden<br />
geteilt. Mose wird entlastet, aber er muss<br />
auch von der Geistkraft Gottes abgeben. So<br />
ist eine Struktur der Leitung des Volkes<br />
geschaffen, die auch in Zukunft verantwortliches<br />
Handeln ermöglicht. Sie ist sozusagen<br />
nicht an eine bestimmte Person gebunden.<br />
Das ganze Unternehmen Aufbruch zum<br />
Jordan ist nun nicht mehr einzig und allein<br />
an die Person des Mose gebunden. Der<br />
Marsch ins gelobte Land kann erfolgen, auch<br />
wenn Mose etwas zustößt. Die Ältesten, die<br />
die verschiedenen Stämmen und Gruppen<br />
repräsentieren, können nun direkter und<br />
schneller handeln und sowohl Fürsprecher<br />
des Volkes als auch Orientierungspersönlichkeiten<br />
sein.<br />
Dies ist eine langfristige, auf Zukunft hin<br />
orientierte Entwicklung, die man durchaus<br />
als <strong>nachhaltig</strong> bezeichnen kann. Selbst Eldad<br />
und Medad werden von dieser Entwicklung<br />
nicht ausgeschlossen. Sie kommen zwar nicht<br />
zum Offenbarungszelt, doch Gott will, dass<br />
jeder Verantwortung übernimmt und Mose antwortet:<br />
„Wenn nur das ganze Volk des Herrn<br />
zu Propheten würde, wenn nur der Herr seinen<br />
Geist auf sie alle legte!“ (Num <strong>11</strong>, 29)<br />
Ab Vers 33 wird die Rahmenerzählung<br />
wieder aufgenommen. Es wird berichtet, wie<br />
Gott Wachteln in großer Zahl schickt, wie<br />
die Menschen sie gierig aufsammeln und<br />
essen, dass Gott aus Zorn das Volk danach<br />
sofort mit einer Plage schlägt. „Daher nannte<br />
man den Ort Kibrot-Taawa (Giergräber), da<br />
man dort die Leute begrub, die von der Gier<br />
gepackt worden waren.“ Einige waren wohl<br />
von der Gier nach Fleisch so gepackt worden,<br />
dass ihr Körper diese Gier nicht verkraftete.<br />
Ihre eigene Gier hat sie umgebracht. Hier<br />
wird uns in drastischer Weise das Gegenmodell<br />
zu <strong>nachhaltig</strong>em Handeln vor Augen<br />
gestellt. Unersättliche Gier, die ausschließlich<br />
auf schnelle exzessive Befriedigung unse-<br />
rer Triebe ausgerichtet ist, vernichtet Lebensmöglichkeiten.<br />
Ohne Verzicht, ohne sinnvolle<br />
Selbstbegrenzung ist <strong>nachhaltig</strong>e Entwicklung<br />
nicht möglich. Auch ist hier nicht langfristig<br />
dafür gesorgt, dass der Hunger in<br />
Zukunft sinnvoll gestillt werden kann. Die<br />
Gier gräbt sich ihr eigenes Grab in Kibrot –<br />
Taawa (Giergräber).<br />
Diese Tatsache trifft heute noch zu. Mit der<br />
Gier der Menschen werden viele Gräber<br />
geschaufelt. Aber heute schaufeln wir meist<br />
nicht gierig unsere eigenen Gräber, sondern<br />
Gräber für andere Menschen, Menschen die<br />
wir nicht einmal kennen. Vielleicht weil sie<br />
in anderen gesellschaftlichen Schichten,<br />
anderen Länder leben oder weil sie noch gar<br />
nicht geboren sind. Vielleicht sind wir selbst<br />
auch als Opfer diesem Mechanismus der Gier<br />
unterworfen. Andere nehmen sich ja nur was<br />
ihnen zusteht, und wir gehen leer aus. Unsere<br />
Umwelt und Mitgeschöpfe sind wehrlos der<br />
Gier des Menschen ausgeliefert. Hier ist<br />
Handeln auf der Basis der Prinzipien der<br />
Katholischen Soziallehre gefordert. Die<br />
Würde und Freiheit einer jeden Person, weitgehendes<br />
eigenverantwortliches Handeln,<br />
Solidarität mit allen Menschen und der ganzen<br />
Schöpfung, das Wohl der ganzen Gemeinschaft<br />
und die <strong>nachhaltig</strong>e Sorge für das<br />
Leben auf unserer Erde sollten Orientierungsmaßstäbe<br />
unseres Handelns werden.<br />
Wir sollten nicht auf den bequemen Weg der<br />
Wachteln, die uns im Halse stecken bleiben<br />
könnten, hoffen, sondern Strategien entwikkeln,<br />
die langfristig Lebensperspektiven eröffnen.<br />
Im Vertrauen auf Gott, der die Israeliten<br />
aus dem Sklavenhaus Ägypten herausführte<br />
und der uns als sein Abbild, als Mann und<br />
Frau geschaffen hat, der uns den Auftrag<br />
gegeben hat, Leben weiterzugeben, die Erde<br />
zu bevölkern und uns um sie zu sorgen und<br />
sie nutzbar zu machen. (vgl. Gen 1, 27-28)<br />
Brechen wir auf in das Gelobte Land und<br />
gehen wir etappenweise. Brechen wir auf wie<br />
das Volk Israel aus Kibrot-Taawa, aus dem<br />
Land der Giergräber nach Hazerot und schauen<br />
wir, was uns dort erwartet auf dem Weg<br />
ins Gelobte Land.<br />
Christine Schardt, Mainz
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong><br />
27. Sonntag im Jahreskreis / 17. Sonntag nach <strong>Trinitatis</strong> / Erntedank<br />
04.10.09<br />
ev. Reihe I: Mt 15, 21-28 / Lk 12, (13-14) 15-21 oder Mt 6, 25-34 kath. 1. L.: Gen 2, 18-24<br />
kath. 2. L.: Hebr 2, 9-<strong>11</strong> kath. Evang.: Mk 10, 2-16 oder kurz Mk 10, 2-12<br />
Die Autorin gibt Impulse zur Auslegung der Warnung vor Habgier und<br />
dem reichen Kornbauern (Lk 12) sowie zur Perikope vom Schätzesammeln<br />
(Mt 6). Sie weist auf den Familiencharakter des Erntedankgottesdienstes<br />
hin und darauf, das Anliegen der Gemeinde, danken zu<br />
wollen, nicht mit globalisierungskritischen Analysen zu verstopfen.<br />
Gleichwohl gilt es, keine Romantisierung moderner Lebensmittelproduktionen<br />
vorzunehmen oder unkritisch mit dem Dank als Ausdruck<br />
von Selbstbestätigung umzugehen.<br />
Erntedank: ein Balanceakt zwischen<br />
Seelsorge und Politik im Kontext eines<br />
Familiengottesdienstes<br />
Erntedankgottesdienst sind Festgottesdienste,<br />
für die bereits in vielen Gemeinden eigene<br />
wunderbar lebendige Traditionen bestehen.<br />
Mancherorts gehört das selbstgebackene Brot,<br />
das nachher gemeinsam verzehrt oder mitgegeben<br />
wird, dazu. Ganz überwiegend werden<br />
die Altäre mit vielen Früchten aus der<br />
Region dekoriert. „Wir pflügen und wir<br />
streuen“ von Matthias Claudius ist einer der<br />
kirchenmusikalischen Schlager des Erntedankgottesdienstes;<br />
ich möchte vorschlagen,<br />
dass er – wie etwa „O du fröhliche“ am Heiligen<br />
Abend – einfach zum festen Bestand<br />
des alljährlichen Erntedankgottesdienstes<br />
zählt. Oft sind viele Kinder bzw. Familien an<br />
diesem Tag im Gottesdienst; dies ist auch für<br />
das <strong>nachhaltig</strong>e Predigen von großer Bedeutung.<br />
Deshalb schlage ich vor, die Kinder ins<br />
Dekorieren des Altars einzubinden, indem sie<br />
etwa am Eingang Früchte erhalten, die sie auf<br />
dem Altar ablegen können oder die sie im<br />
Gottesdienst verzehren können. Ein kleines<br />
Äpfelchen oder ein Apfelstück reicht da<br />
schon aus. Mit dieser Geste werden die Sinne<br />
aufgeschlossen, ein herzliches Willkommen<br />
an die Kleinen und vielleicht auch an die<br />
Großen.<br />
An diesem Festsonntag wird ein Fest des<br />
Dankes gefeiert. Theologisch geht es darum,<br />
sich daran zu erinnern, dass wir uns unser<br />
Leben nicht selbst geben können. Es ist ein<br />
Geschenk, eine gute Gabe. Viele Menschen,<br />
die an diesem Tag in die Kirche kommen,<br />
wollen aber auch einen Blick auf das werfen,<br />
was ihnen gelungen ist, wofür sie dankbar<br />
sind, worauf sie stolz sein können. Erntedank<br />
ist so gesehen ein Fest, an dem Menschen sich<br />
in der Kirche mit ihren Leistungen anerkannt<br />
gefühlt wissen möchten. Die Feldfrüchte stehen<br />
stellvertretend für das Werk, das sie vorzuweisen<br />
haben, von dem sie aber wissen: Es<br />
geht durch unsere Hände, kommt aber her<br />
von Gott. Der Balanceakt liegt darin, Menschen<br />
diese Anerkennung zu geben, aber<br />
zugleich das Verständnis von „Haben“ und<br />
„Loslassen können“ zu vertiefen.<br />
Wo der Lebenszusammenhang es nahe legt,<br />
ist Erntedank auch eine Gelegenheit, einen<br />
Gottesdienst mit interkonfessioneller oder<br />
auch interreligiöser Beteiligung zu gestalten,<br />
z. B. wenn Grundschulklassen in die Gestaltung<br />
miteinbezogen werden. Allerdings:<br />
Es gibt auch Menschen, denen es nicht möglich<br />
ist, dankbar zu sein. Das kann vielfältige<br />
Gründe haben, die ernst zu nehmen sind:<br />
wenn man krank ist oder es einem in anderer<br />
Hinsicht zu schlecht geht; weil man sich<br />
sagt, wem sollte ich danken, ich habe mir<br />
doch alles selbst erarbeitet; schließlich weil<br />
man das Gefühl hat, in seinem Leben eigentlich<br />
immer zu kurz gekommen zu sein. Möglicherweise<br />
sind Empfindungen dieser Art<br />
auch denen vertraut, die den Erntedankgottesdienst<br />
besuchen. Aus mehreren Gründen<br />
halte ich den Erntedankgottesdienst nun für<br />
eine große Herausforderung:<br />
Erwachsene und Kinder sollen Gelegenheit<br />
erhalten, zusammen und doch je für sich in<br />
angemessener Weise diesen Gottesdienst zu<br />
feiern. Erntedank kann mit dem Altar voller<br />
Früchte des Feldes wie zu einer romantischen<br />
Verklärung einer früheren Agrargesellschaft<br />
Erntedank ist ein Fest, an<br />
dem Menschen sich<br />
in der Kirche mit ihren<br />
Leistungen anerkannt<br />
gefühlt wissen möchten.<br />
135
136<br />
04.10.09<br />
Nicht Gott hat den<br />
Kornbauern zum Tode<br />
verurteilt, sondern er<br />
stirbt an seiner Angst, ohne<br />
die vollen Scheunen<br />
nichts zu sein.<br />
Lk 12, (13-14) 15-21<br />
Mt 6, 25-34<br />
werden. Deshalb sind manche bereits schon<br />
so weit gegangen, einen Computer auf den<br />
Altar zu stellen oder Sushi oder ein in der<br />
Region hergestelltes Industrieprodukt etc.,<br />
was provokant wirkt oder wirken soll.<br />
Heutige Lebensmittelherstellungsmethoden<br />
wirken zerstörerisch auf die Schöpfung:<br />
Massentierhaltung, Gentechnologie und Export<br />
von Nahrungsmitteln sind nur Schlagworte,<br />
um die Problematik anzudeuten. Aus<br />
diesen Gründen kann es dazu kommen, dass<br />
der Erntedankgottesdienst aus gut gemeinten<br />
Gründen mit Globalisierungsthemen<br />
moralisch aufgeladen wird. Damit werden<br />
aber die dankbaren Herzen, die gekommen<br />
sind, genau dies auszudrücken, verstopft.<br />
Erntedank: ein Balanceakt zwischen Seelsorge<br />
und Politik im Kontext eines Familiengottesdienstes.<br />
Impulse zur Predigtvorbereitung<br />
Lk 12, 13-21 Warnung vor Habgier und der<br />
reiche Kornbauer<br />
Gerade in der Lebensphase, in der viele<br />
Menschen von den Eltern langsam Abschied<br />
nehmen müssen, also in den Jahren um fünfzig<br />
herum, wird das Thema Erbschaft in vielen<br />
Familien bedeutsam. In der von Luther<br />
überschriebenen Perikope „Warnung vor<br />
Habgier“ weist Jesus es ab, als Erbschlichter<br />
beansprucht zu werden. In der folgenden<br />
Perikope vom reichen Kornbauern erhält dieser<br />
von Gott ein überaus hartes Urteil. Obwohl<br />
er ja nicht weiter maßlos ernten wollte,<br />
sondern nur diese eine große Ernte gut einfahren<br />
wollte und sich um ihre sichere<br />
Verwahrung sorgte, wird er von Gott hierfür<br />
mit dem Tode bestraft. Der Umgang mit<br />
einer Erbschaft, der Umgang mit einer großen<br />
Ernte steht hier zur Diskussion. Es ist<br />
nicht genug, ein Erbe gut zu verwalten und<br />
für eine Ernte dankbar zu sein. Dankbar sein,<br />
das heißt der Perikope vom reichen Kornbauern<br />
zufolge offensichtlich zu haben als<br />
hätte man nicht.<br />
Eine Verbindung von Habgier und der – in<br />
der katholischen Theologie interpretierten –<br />
Todsünde Geiz führt in eine Aktualisierung<br />
des biblischen Textes, für den viele populäre<br />
Illustrationen zur Verfügung stehen (siehe<br />
Birgit Schönberger, Geiz und die hier genannten).<br />
„Geiz ist von der Todsünde zur<br />
Tugend avanciert“, so Schönberger und dies<br />
mit durchaus ökologisch <strong>nachhaltig</strong>en Gründen.<br />
Neben einer ganzen Kultur des Geizes<br />
und ihrer Internetseiten, Handbücher etc.<br />
stellt sich heraus, dass Geiz eine vorausschauende<br />
Lebensplanung beinhaltet, die wenig<br />
Raum für Spontanes oder Überraschungen<br />
lässt, die z. B. eine Einladung lieber ausschlägt,<br />
weil ihr von dieser Begegnung ja<br />
auch eine Gegeneinladung erwartet werden<br />
könnte. Bereits an diesem Beispiel wird deutlich,<br />
dass man mit Geld, Zeit, Vertrauen und<br />
Zuwendung oder – noch intimer – mit Liebe<br />
geizen kann. Etwas zu haben, bedeutet auch,<br />
etwas zu sein, oder noch prinzipieller: Haben<br />
= Sein. Nichts zu haben bedeutet nichts zu<br />
sein. So lautet in psychologischer Perspektive<br />
die Antwort auf die Frage, was Geiz auslöst,<br />
die Angst, sich selbst zu verlieren. Wenn ich<br />
dieses oder jenes oder diese Zeit für mich<br />
nicht habe, dann bin ich selbst überhaupt<br />
nicht mehr richtig vorhanden. „Geiz als verkleidete<br />
Angst vor dem Tod oder vor dem<br />
Nichts. Paradoxerweise beschleunigt Geiz<br />
den Tod […] Übertriebener Geiz dämpft die<br />
Lebenslust und tötet die Sinnlichkeit. Er vergiftet<br />
Liebesbeziehungen und gefährdet<br />
Freundschaften und die harmonische Zusammenarbeit<br />
mit Kollegen.“ (Schönberger) Geiz<br />
ist ein Ausdruck von Habgier und: Sie zeigt,<br />
wie sehr ich mich an das klammere, was ich<br />
habe, aus Angst mich selbst zu verlieren.<br />
Klar ist jetzt aber auch: Nicht Gott hat den<br />
Kornbauern zum Tode verurteilt, sondern er<br />
stirbt an seiner Angst, ohne die vollen Scheunen<br />
nichts zu sein. Nachhaltig <strong>predigen</strong><br />
heißt, sich zu vergegenwärtigen, wie sehr<br />
unser Leben gefördert wird, wenn wir uns<br />
von dem Leitbild der überfließenden Gnade<br />
Gottes bestimmen lassen.<br />
Mt 6, 25-34 Vom Schätze sammeln<br />
Es wäre falsch, aus diesen Zeilen allein ein<br />
Lob der Faulheit herauszulesen. Aber dennoch<br />
möchte Jesus mit diesen Worten<br />
Menschen befreien von der Sorge um ihr tägliches<br />
Brot, ihr Auskommen. Das Wort ist an<br />
arme Menschen gerichtet. Sie sollen den<br />
Reichen den Rücken zukehren, statt weiterhin<br />
nur auf deren Leben zu sehen und sich an<br />
ihnen zu messen. Sie sollen ihr Leben zentral<br />
auf Gott ausrichten. Allerdings dürfte seine<br />
Rede ziemlichen Widerspruch provoziert
haben. Gerade armen Menschen mitzuteilen,<br />
sie sollten sich nicht sorgen, kann leicht<br />
überheblich klingen. Jesus geht es darum,<br />
dass auch sie einen weiten Horizont zur<br />
Deutung ihres Lebens erhalten. Was hat ein<br />
Mensch vom Leben, wenn er sich nur noch<br />
abrackert und von Sorgen verzehren lässt? Es<br />
geht in diesem „Wort an die Armen“ um den<br />
Vorrang des Religiösen im Leben. Es hilft,<br />
das Leben als Ganzes zu stabilisieren.<br />
Gottvertrauen schafft einen Freiraum, dass<br />
Sorgen nicht wie Fluten über Köpfen zusammenschlagen.<br />
In einem Kinderfilm zur Bergpredigt wird<br />
zu diesem Stück folgende Geschichte erzählt:<br />
Ein Mädchen gehört in der Schule zu einer<br />
Clique von finanziell gut gestellten Jugendlichen<br />
bzw. sie möchte gern zu ihnen gehören,<br />
hat aber eben zu wenig Geld zur Verfügung.<br />
Sie versucht mit gespartem Geld<br />
mitzuhalten, wenn es abends ums Ausgehen<br />
geht, oder sie kauft sich ein Markenhandy,<br />
muss dafür aber ständig arbeiten. Manchmal<br />
wird sie total wütend auf ihre Mutter, die<br />
alleinerziehend ist und ihr nicht so viel Taschengeld<br />
geben kann. Sie erzählt ihren Schulkameraden<br />
Lügen über die Berufstätigkeit<br />
ihrer Mutter, erfindet einen erfolgreichen<br />
Vater ... Ihr Wunsch, auch gerne mehr Geld<br />
zu haben, wird sehr gut verständlich. Aber es<br />
ist auch eine Befreiung für sie, als das selbstgebaute<br />
Kartenhaus aus Lügen zusammenfällt.<br />
In diesem Zusammenbruch kann sie<br />
sehen, was an ihrem Leben unverwechselbar<br />
gut und schön ist, wer zu ihr hält und worauf<br />
sie vertrauen kann. Die Sorge um ein glückliches<br />
Leben wird durch den Blick auf das,<br />
was sie glücklich macht im eigenen Leben,<br />
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong><br />
durchbrochen. Diese Auslegung des „Sorget<br />
nicht“ ist tiefgründig, denn sie zeigt, wie verständlich<br />
es ist, dass Menschen sich mit Geld<br />
die Option auf viele Lebensmöglichkeiten<br />
erwirtschaften wollen, und wie diese Sorge<br />
doch auch Lebensmöglichkeiten nimmt. Es<br />
gilt, die Macht der Sorge im eigenen Leben<br />
zu durchbrechen, damit wir wieder zu Gott<br />
finden können.<br />
Nachhaltig <strong>predigen</strong> heißt, Durchblicke<br />
durch die menschlichen Systeme des Sorgens<br />
zu verschaffen. Falsches Sorgen baut auf der<br />
Annahme auf, man könnte – wenn man<br />
erfolgreich genug sorgt – eine andere Realität<br />
schaffen, sei es nun ein höheres persönliches<br />
Wohlbefinden oder sei es eine ökologischer<br />
gestaltete Umwelt. Richtiges Sorgen setzt<br />
sich voll für beides Genannte ein. Doch dies<br />
gelingt kaum ohne den Cantus firmus christlich<br />
verstandener Nachhaltigkeit: „Es geht<br />
durch unsere Hände, kommt aber her von<br />
Gott.“ Und mehr: geht aber zu auf Gott.<br />
Nachhaltiges Sorgen heißt loslassen lernen.<br />
Literatur:<br />
Manfred Köhnlein, Die Bergpredigt. Stuttgart 2005<br />
Birgit Schönberger, Der Geiz. In: Klaus Hofmeister /<br />
Lothar Bauerochse, Geil & Geizig. Die Todsünden<br />
als Gebote der Stunde. Würzburg 2004, S. 26-38<br />
Wilfried Engemann, Aneignung der Freiheit.<br />
Essays zur christlichen Lebenskunst. Stuttgart 2007<br />
Dr. Ilona Nord, Frankfurt am Main<br />
28. Sonntag im Jahreskreis / 18. Sonntag nach <strong>Trinitatis</strong><br />
Der Verfasser betrachtet alle Bibelstellen des Tages. Stichworte zur Nachhaltigkeit:<br />
Weinen, Warten, zu wissen Meinen – Gestalten mit Klugheit und<br />
Weisheit (Weish 7, Hebr 4); Verhältnis zu Armen und Armut, unspektakuläre,<br />
tragfähige Utopien entwickeln (Weish 7, Mk 12); Welt als Gütergemeinschaft<br />
sehen und in Gerechtigkeit leben und verwirklichen (Mk 10)<br />
04.10.09<br />
<strong>11</strong>.10.09<br />
ev. Reihe I: Mk 12, 28-34 kath. 1. L.: Weish 7, 7-<strong>11</strong> kath. 2. L.: Hebr 4, 12-13 kath. Evang.: Mk 10, 17-30<br />
oder Mk 10, 17-27<br />
137
138<br />
<strong>11</strong>.10.09<br />
Weish 7, 7-<strong>11</strong><br />
Hebr 4, 12-13<br />
Mk 10, 17-30<br />
Mk 12, 28-34<br />
Um seiner Verantwortung<br />
gerecht zu werden, benötigt<br />
der Mensch Klugheit und<br />
Weisheit, die er sich nicht<br />
selbst geben, sondern nur<br />
von Gott erbitten<br />
und erhalten kann.<br />
Exegetische Anmerkungen<br />
Weish 7, 7-<strong>11</strong>: In 6, 22-25 tritt Salomo<br />
gegenüber den Königen der Welt als<br />
Verkündiger auf und spricht sie in seiner<br />
Existenz als König vor Gott an. Mit derselben<br />
Haltung versucht er in 7, 1-14, die<br />
Adressaten zu einem Existenzwandel zu<br />
bewegen. Denn der König stammt nicht –<br />
wie in der Vorstellung anderer antiker Kulturen<br />
– von Gott ab, sondern ist wie alle anderen<br />
sterblichen Menschen aus der Erde erschaffen.<br />
Indem Weish so die Gleichheit aller<br />
Menschen vor Gott betont, dem sie Leben<br />
und Glück verdanken, unterstreicht sie das<br />
menschliche Angewiesensein auf die göttliche<br />
Hilfe. Dies konzentriert sich in Salomos<br />
Bitte um Weisheit und Klugheit, die an das<br />
Wortpaar „Weisheit und Wissen” (2 Chr 1, 10)<br />
erinnert.<br />
Hebr 4, 12-13: Die beiden Verse beschließen<br />
den Abschnitt Hebr 3, 7-4,<strong>11</strong>, der das<br />
„lebendige Wort Gottes” thematisiert.<br />
Diesem gegenüber hatte sich das Volk einst<br />
in der Wüste und hat es sich heute zu verantworten.<br />
Um die Ernsthaftigkeit der Verantwortung<br />
zu betonen, hebt Hebr die kritische<br />
Schärfe des Gottes Wortes hervor und unterstreicht<br />
die Notwendigkeit menschlicher<br />
Aufmerksamkeit.<br />
Mk 10, 17-30: In einer Lehrszene schildert<br />
Mk Jesu Haltung zu den Themen Berufung<br />
und Besitz und teilt seine Darstellung in drei<br />
Abschnitte: die fehlgeschlagene Berufung eines<br />
Reichen in die Nachfolge, Jesu daran<br />
anschließende Jüngerbelehrung über den<br />
Reichtum als Hindernis für den Zugang zum<br />
Reich Gottes und – nach einer Anfrage des<br />
Petrus – die Verheißung des Ausgleichs für<br />
das Verhalten der Jünger im Horizont der<br />
göttlichen Heilsplans.<br />
Mk 12, 28-34: Nach verschiedenen Gruppen<br />
(<strong>11</strong>, 27 - 12, 27) wendet sich hier ein einzelner<br />
Schriftgelehrter an Jesu. Er begegnet<br />
Jesus wegen seiner den Kontrahenten erteilten<br />
Antwort mit Wohlwollen, so dass es zum offenen<br />
Gedankenaustausch kommt. Mk schließt<br />
mit einer Notiz (V. 34), die darauf vorbereitet,<br />
dass Jesus nach der Befassung mit Fragen<br />
von Repräsentanten jüdischer Gruppen nun<br />
seinerseits lehrend aktiv wird (12, 35-40).<br />
Predigtskizze<br />
Hebr betont die entlarvende Wirkung von<br />
Gottes Wort. Es macht alle geschaffene Realität<br />
transparent, lässt ihr Wesen ans Tageslicht<br />
treten. Damit wird auch die gegenseitige<br />
Verwobenheit von Mensch und Schöpfung<br />
offenbar und erinnert den Menschen an seine<br />
Verantwortung im Kontext der geschaffenenen<br />
Wirklichkeit. Wir sind nicht nur eben<br />
ein Teil des Ganzen und Mitgeschöpf, sondern<br />
vor allem dazu beauftragt, Gottes<br />
Schöpfung, belebte und unbelebte Natur zu<br />
erhalten und zu gestalten. Somit stellt uns<br />
Gottes Wort mit aller Schärfe und allem<br />
Nachdruck in einen im wahrsten Sinn des<br />
Wortes globalen Horizont.<br />
Um seiner Verantwortung gerecht zu werden,<br />
benötigt der Mensch Klugheit und<br />
Weisheit – ratio und sapientia –, die er sich<br />
nicht selbst geben, sondern nur von Gott<br />
erbitten und erhalten kann. Dies zeigt Weish<br />
am Beispiel des Königs Salomo, der bei Gott<br />
um Hilfe für seine Aufgabe nachsucht. Denn<br />
er ist sich bewusst, dass nur diese von Gott<br />
geschenkten Fähigkeiten ihm die notwendige<br />
Einsicht in Strukturen und Zusammenhänge<br />
der vorhandenen Welt geben können.<br />
Sie eröffnen ihm zugleich den Blick für mögliche<br />
Entwicklungen, ob sie nun Verheißung<br />
oder Bedrohung bereithalten. Diese Sicht in<br />
mögliche Zukunft erweitert menschliches<br />
Wissen, ermöglicht Weisheit und befähigt<br />
zur guten Regierung, d. h. der Verwaltung,<br />
Erhaltung und Gestaltung der Welt, in die<br />
hinein er verwoben ist und die Gott ihm<br />
anvertraut hat.<br />
(Mk) Inmitten dieses globalen Horizontes<br />
der Interdependenz von Mensch und<br />
Schöpfung schenkt Gott der Menschheit eine<br />
ganz besondere Perspektive, die sich in der<br />
Antwort Jesu auf die Frage des Petrus zeigt:<br />
Gottes Heilsplan zielt ab auf eine Familie,<br />
die alle Menschen umfasst, die sich ganz von<br />
dem einen Vater her definiert und in der<br />
Gütergemeinschaft verwirklicht ist. Damit<br />
wendet sich Gott nachdrücklich gegen ein<br />
Denken und Handeln, das um das eigene Ego<br />
und den eigenen materiellen Besitz kreist<br />
und dem Menschen nur schadet. Gott stellt<br />
sich – und den, der ihm nachfolgt, – pointiert<br />
auf die Seite der Armen und Benachteiligten,<br />
fordert und fördert Engagement,<br />
das auf eine immer gerechtere
Verteilung der Güter drängt. Im Kern geht<br />
es um die Utopie – dies verdeutlicht die provozierende,<br />
ja schockierende Aufforderung<br />
Jesu an den reichen Mann –, eigenen Besitz<br />
vollkommen auf- und abzugeben.<br />
Mit Blick auf die gegenwärtige Situation<br />
mag Gottes Utopie, die Jesus präsentiert, als<br />
Illusion erscheinen. Aber der Schöpfer, der<br />
allem von ihm Geschaffenen auf den Grund<br />
sehen kann, für den alles transparent und<br />
möglich ist, hält an seinem Ziel fest. Gott<br />
will seine Vision realisieren und uns dazu in<br />
Anspruch nehmen, damit – allen Zweifeln<br />
und Zweiflern zum Trotz – sein Traum Wirklichkeit<br />
wird.<br />
Bezüge zur Nachhaltigkeit, Beispiele zur<br />
Umsetzung und weitere Kontexte<br />
1. Verwobenheit des Menschen in die Schöpfung,<br />
die er klug und weise gestalten muss und kann<br />
(Weish, Hebr)<br />
Hügel sind immer schöner als Häuser aus<br />
Stein. In der großen Stadt wird das Leben zu<br />
einem künstlichen Dasein. Viele Menschen<br />
spüren kaum noch richtige Erde unter den<br />
Füßen, sie sehen kaum noch Pflanzen wachsen,<br />
außer in Blumentöpfen, und lassen nur<br />
selten die Lichter der Straßen hinter sich, um<br />
den Zauber eines sternenübersäten Nachthimmels<br />
auf sich wirken zu lassen. Wenn<br />
Menschen so weit weg von all dem leben, was<br />
der Große Geist geschaffen hat, dann vergessen<br />
sie leicht seine Gesetze.<br />
Tatanga Mani/Walking Buffalo (1871-1967,<br />
Häuptling der Stoney-Indianer in Kanada; zit.<br />
nach www.walderlebnisraum.de)<br />
Kinder weinen<br />
Narren warten<br />
Dumme wissen<br />
Kleine meinen<br />
Weise gehen in den Garten<br />
Joachim Ringelnatz (Aus: Ders.: Sämtliche<br />
Gedichte, 1994)<br />
2. Hinwendung zu Gott drängt zur Solidarität<br />
mit dem Armen und Benachteiligten (Weish, Mk 12)<br />
Sola gratia<br />
einen Engel<br />
wünsche ich allen<br />
die ohne grund<br />
lächeln: aus<br />
gottes grazie<br />
allein<br />
Kurt Marti (Aus: Ders.: Namenszug mit Mond.<br />
Gedichte, 1996)<br />
3. Gerechte Verteilung der Güter (Mk 10)<br />
„Mit Zorn und Zärtlichkeit an der Seite der<br />
Armen“ – mit diesem Motto beging das<br />
Bischöfliche Hilfswerk Misereor 2008 sein<br />
50-jähriges Bestehen. Die beiden Gegensätze<br />
„Zorn“ und „Zärtlichkeit“ beschreiben das<br />
Spannungsfeld, in dem sich die Arbeit eines<br />
Entwicklungswerkes bewegt: Auf der einen<br />
Seite steht der „heilige“ Zorn über ungerechte<br />
Verhältnisse, der zum Handeln antreibt,<br />
auf der anderen Seite das Mitgefühl mit dem<br />
Nächsten: Denn Arme, Kranke und Ausgegrenzte<br />
sind keine anonymen Empfänger<br />
wohltätiger Hilfe, sondern verdienen Respekt.<br />
Das ist das Anliegen von Misereor wie<br />
seiner Partner in aller Welt. Einer dieser<br />
Partner ist Luís Cappio, Bischof von Barra in<br />
Brasilien, der in einem Grußwort sehr eindringlich<br />
begründete, warum es zu diesem<br />
Engagement keine Alternative gibt: „Für<br />
Christen ist es ein Gebot, sich an die Seite der<br />
Armen zu stellen. Es ist die Bedingung für<br />
die Authentizität und Wahrheit des Glaubens,<br />
eine Forderung der Treue zum Evangelium.<br />
Die Nachfolge Jesu findet an der<br />
Seite der Armen statt oder gar nicht“<br />
(www.misereor.de).<br />
4. Gottes Vision: Menschheit als eine Familie<br />
mit Gütergemeinschaft (Mk 10)<br />
<strong>11</strong>.10.09<br />
Mk 10<br />
Weish 7, 7-<strong>11</strong><br />
Hebr 4, 12-13<br />
Arme, Kranke und<br />
Ausgegrenzte sind keine<br />
anonymen Empfänger<br />
wohltätiger Hilfe, sondern<br />
verdienen Respekt.<br />
Mk 10<br />
„Weltweit wichteln” eine Mitmachaktion<br />
– nicht nur für Kinder. Es handelt sich um<br />
eine Adventsaktion, die dem Brauch des<br />
Wichtelns neben der Freude am Schenken<br />
einen tieferen Sinn gibt: Kinder in Deutschland<br />
beschenken sich untereinander mit fair<br />
gehandelten Produkten und machen Kindern<br />
in aller Welt mit einer selbst gestalteten<br />
Wichtelpuppe eine freudige Überraschung – Weish 7, 7-<strong>11</strong><br />
worldwide surprise. Der faire Handel sichert Mk 12, 28-34<br />
den Menschen in armen Ländern einen<br />
gerechten Lohn für ihre Arbeit, und mit der<br />
Wichtelpuppe können sich Kinder über<br />
Kontinente hinweg kennen lernen. So fördert<br />
die Aktion „Weltweit wichteln” interkultu- 139
140<br />
<strong>11</strong>.10.09<br />
18.10.09<br />
Heute gibt es viele<br />
Möglichkeiten, Gelähmten<br />
zu helfen, mit Roboterarmen,<br />
Implantaten und anderen<br />
Möglichkeiten.<br />
relles Lernen und entwicklungspolitisches<br />
Engagement – und das alles mit Spaß<br />
(www.weltweit-wichteln.de)<br />
Es gibt dich<br />
Dein Ort ist<br />
wo Augen dich ansehn.<br />
Wo sich die Augen treffen<br />
entstehst du.<br />
Von einem Ruf gehalten,<br />
immer die gleiche Stimme,<br />
es scheint nur eine zu geben<br />
mit der alle rufen.<br />
Du fielest,<br />
aber du fällst nicht.<br />
Augen fangen dich auf.<br />
Es gibt dich<br />
weil Augen dich wollen,<br />
dich ansehn und sagen<br />
dass es dich gibt.<br />
Hilde Domin (Aus: Dies.: Es gibt dich, 1987)<br />
29. Sonntag im Jahreskreis / 19. Sonntag nach <strong>Trinitatis</strong><br />
Literatur:<br />
Eckey, Wilfried: Das Markusevangelium: Orientierung<br />
am Weg Jesu. Ein Kommentar, 1998<br />
Engel, Helmut: Das Buch der Weisheit = Neuer<br />
Stuttgarter Kommentar Altes Testament 16 , 1998<br />
Gräßer, Erich: An die Hebräer (Hebr 1-6) = Evangelisch-Katholischer<br />
Kommentar XVII/1, 19<strong>90</strong><br />
Hecking, Detlef u. a.: Sehnsucht nach Gerechtigkeit.<br />
Denken und Handeln nach dem Buch der<br />
Weisheit = WerkstattBibel 3, 2002<br />
Joachim Feldes, Berlin<br />
ev. Reihe I: Mk 2, 1-12 kath. 1. L.: Jes 53, 10-<strong>11</strong> kath. 2. L.: Hebr 4, 14-16 kath. Evang.: Mk 10, 35-45 oder kurz Mk 10, 42-45<br />
Mk 2, 1-12<br />
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong><br />
Der Verfasser betrachtet die ev. Predigtperikope und den kath. Evangeliumstext.<br />
Stichworte zur Nachhaltigkeit: dem Lahmen die Träger sein<br />
– für eine heilere Welt für alle (Mk 2); Facetten des Gemeinwohls, christliche<br />
Forderungen und Grenzen des Individuums, Bedingungen eines<br />
globalen Gemeinwohls (Mk 10)<br />
Ausarbeitung: Lahme heilen (ev. Reihe<br />
I Mk 2, 1-12)<br />
Jesus heilt den Gelähmten auf sein Wort<br />
hin. Der Lahme im Evangelium nimmt auf<br />
das Wort Jesus sein Bett und geht weg, zuvor<br />
hatte Jesus Anstoß erregt, weil er dem Lahmen<br />
die Sünden vergeben hatte. Er hatte aber<br />
den Glauben der Träger gesehen, die den<br />
Kranken durch das Dach zu ihm herabgelassen<br />
hatten. Zur Verkündigung der Botschaft<br />
vom messianischen Reich gehört es auch wie<br />
bei Jesaja 35 steht: „6 Dann springt der<br />
Lahme wie ein Hirsch, / die Zunge des<br />
Stummen jauchzt auf. In der Wüste brechen<br />
Quellen hervor / und Bäche fließen in der<br />
Steppe.“<br />
Heute gibt es viele Möglichkeiten, Gelähmten<br />
zu helfen, mit Roboterarmen, Implantaten<br />
und anderen Möglichkeiten. Adulte<br />
Stammzellen werden nach dem Stand der<br />
Wissenschaften erst in 10-15 Jahren zu<br />
Einsatz kommen können. Gelähmte sind<br />
durchaus leistungsfähig. Mit dem gelähmten<br />
Hermann von Reichenau wurde vor 995<br />
Jahren ein Gelehrter geboren, dessen Lebenswerk<br />
großartig ist: Er verfasste eine Weltchronik<br />
des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung,<br />
er machte auch das Astrolabium<br />
bekannt, mit dem Seefahrer lange Zeit ihre
genaue Position auf dem Ozean bestimmten.<br />
Der englische Astrophysiker Stephen Hawkings<br />
ist seit mehr als vier Jahrzehnten gelähmt<br />
und kann nur mit einigen Gesichtsmuskeln<br />
über einen Computer kommunizieren. Mit<br />
32 Jahren wurde er als Mitglied in die „Royal<br />
Society“ der britischen Wissenschaften berufen.<br />
Mit 37 Jahren erhielt er in Cambridge<br />
den herausragenden Lucasischen Lehrstuhl<br />
für Mathematik, auf dem schon Sir Isaac<br />
Newton lehrte.<br />
Wenn wir an das Kommen des Reiches<br />
Gottes glauben, in dem es eine heile Welt<br />
gibt, und die Botschaft Jesu ernst nehmen,<br />
sind uns die Gelähmten in besonderer Weise<br />
anvertraut. Wir gehören in gewisser Weise zu<br />
den vier Trägern, die den Gelähmten Zugang<br />
zu Heilungswegen schaffen. Es geht dabei<br />
um einen Beitrag zur Schaffung einer heileren<br />
Welt für alle.<br />
Thema: Dem Gemeinwohl dienen<br />
(Evangelium Mk 10, 42-45)<br />
In der letzten Zeit ist viel von Machtmissbrauch<br />
zu hören. Da haben leitende<br />
Persönlichkeiten eines großen Konzerns in<br />
Deutschland ungeheure Bestechungsgelder<br />
eingesetzt, Korruption gehört neben der<br />
Armut zu den größten Problemen für die<br />
Entwicklung in ärmeren Ländern. Es ist aber<br />
auch an Machthaber vor allem in Afrika zu<br />
denken, die ihre Länder brutal terrorisieren<br />
und ausbeuten. Auch die Kirchen haben mit<br />
Machtmissbrauch in der Geschichte vor<br />
allem ihre Erfahrungen.<br />
Im Evangelium prangert Jesus die Mächtigen<br />
an, die ihre Macht über die Menschen<br />
missbrauchen. Große im Reich Gottes sollen<br />
nach Jesus Diener sein, ja sogar Sklaven aller,<br />
er geht für sich ja soweit, dass er sein Leben<br />
für viele als Lösegeld hingibt.<br />
Es geht im Staat nicht darum, dass die<br />
Mächtigen ihren Profit machen, sondern um<br />
das Gemeinwohl für alle. Dabei sind auch<br />
kommende Generationen und die Bewahrung<br />
der Schöpfung für diese mit einbezogen.<br />
Was ist Gemeinwohl?<br />
Das Konzilsdokument „Gaudium et spes“<br />
(1965) sagt dazu: „75. ... Unmenschlich ist<br />
es, wenn eine Regierung auf totalitäre oder<br />
diktatorische Formen verfällt, die die Rechte<br />
der Person und der gesellschaftlichen<br />
Gruppen verletzen.“ Christen sollen durch<br />
ihr pflichtbewusstes Handeln für das<br />
Gemeinwohl beispielgebend sein. Die politischen<br />
Parteien dürfen ihre Sonderinteressen<br />
nicht über das Gemeinwohl stellen. Die politische<br />
Gemeinschaft und die Kirche sind je<br />
auf ihrem Gebiet autonom, im Dienst am<br />
gleichen Menschen können sie Besseres leisten,<br />
wenn sie zusammenwirken.“<br />
Gemeinwohl bezieht sich auch auf die<br />
Wirtschaft. Die US-amerikanischen Bischöfe<br />
sagten dazu 1996: „Während die Enzyklika<br />
Demokratie und Marktwirtschaft (Centesimus<br />
annus 1996) anerkannte, bestand sie darauf,<br />
dass diese sich an dem Gemeinwohl und an<br />
dem Dienst für die Menschenwürde und<br />
Menschenrechte orientieren müssen. ... Der<br />
Katechismus der katholischen Kirche bestätigt<br />
die katholische Lehre, dass die Wirtschaft<br />
den Menschen dienen muss und den<br />
Grenzen der moralischen Ordnung und den<br />
Forderungen sozialer Gerechtigkeit unterworfen<br />
ist.“ Hier sind durchaus die Einkommensdifferenzen<br />
in der Wirtschaft zu hinterfragen,<br />
ob sie wirklich gegenüber dem<br />
Gemeinwohl zu verantworten sind. Machen<br />
sich die Diener der Wirtschaft nicht selbst zu<br />
ausbeutenden Herren?<br />
Auch der Bodenbesitz hat dem Gemeinwohl<br />
zu dienen und nicht nur dem Interesse<br />
von z. B. Großgrundbesitzern. „Das Gemeinwohl<br />
verlangt deshalb manchmal eine Enteignung<br />
von Grundbesitz, wenn dieser wegen<br />
seiner Größe, seiner geringen oder überhaupt<br />
nicht erfolgten Nutzung, wegen des Elends,<br />
das die Bevölkerung durch ihn erfährt, wegen<br />
eines beträchtlichen Schadens, den die Interessen<br />
des Landes erleiden, dem Gemeinwohl<br />
hemmend im Wege steht. Das Konzil hat das<br />
ganz klar gesagt“ (Paul VI Enzyklika Populorum<br />
Progressio (1967).<br />
Zur Realisierung des Gemeinwohls ist<br />
Solidarität notwendig. „Die Solidarität ist nicht<br />
ein Gefühl vagen Mitleids oder oberflächlicher<br />
Rührung wegen der Leiden so vieler<br />
Menschen nah oder fern. Im Gegenteil, sie ist<br />
die feste und beständige Entschlossenheit,<br />
sich für das „Gemeinwohl“ einzusetzen, das<br />
heißt, für das Wohl aller und eines jeden,<br />
weil wir alle für alle verantwortlich sind“<br />
(SCR Johannes Paul II. 1987).<br />
Im 1. Korintherbrief beschreibt Paulus in<br />
der Aussage über die Kirche als den einen<br />
Leib, in dem alle Glieder für das Ganze verantwortlich<br />
sind, sonst geht es ihnen selbst<br />
18.10.09<br />
Mk 10, 42-45<br />
141
142<br />
18.10.09<br />
In diesen<br />
Gemeinwohlgedanken sind<br />
alle Völker mit einzubezie-<br />
hen, desgleichen auch die<br />
kommenden Generationen<br />
und die Bewahrung der<br />
Schöpfung.<br />
25.10.09<br />
alles andere als gut. „20 So aber gibt es viele<br />
Glieder und doch nur einen Leib. 21 Das<br />
Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich bin<br />
nicht auf dich angewiesen. Der Kopf kann<br />
nicht zu den Füßen sagen: Ich brauche euch<br />
nicht. 22 Im Gegenteil, gerade die schwächer<br />
scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich.“<br />
Das eigentliche Gemeinwohl ist für Höffner<br />
das Gemeinwohl des Staates. Er definiert das<br />
wie folgt:“... Es ist das Gesamt der Einrichtungen<br />
und Zustände, die es dem einzelnen<br />
Menschen und den kleineren Lebenskreisen<br />
ermöglichen, im geordneten Zusammenwirken<br />
ihrer gottgewollten Sinnerfüllung<br />
(der Entfaltung der Persönlichkeit und dem<br />
Aufbau der Kulturbereiche) anzustreben“<br />
(Höffner, Christliche Gesellschaftslehre Seite 52).<br />
Insofern das Gemeinwohl allen dient, hat<br />
sich das Einzelwohl unterzuordnen. Auf der<br />
anderen Seite darf aber das Gemeinwohl die<br />
Person und ihre Freiheit und Würde nicht<br />
missbrauchen. Es ist dazu da, dass alle<br />
Personen zu ihrer bestmöglichen Entfaltung<br />
kommen. Auch das Gemeinwohl darf den<br />
Menschen nicht völlig beschlagnahmen, so<br />
darf ein Betrieb den Menschen nur als<br />
Belegschaftsmitglied sehen, aber es darf nicht<br />
den „totalen“ Betrieb geben. Im Staat ist der<br />
Mensch Staatsbürger und kann nicht vom<br />
Staat völlig vereinnahmt werden. Das wäre<br />
dann der „totale Staat“. Ziel von Sozialität ist<br />
die volle Entfaltung der Personalität.<br />
Das Gemeinwohl bedarf zu seiner Realisierung<br />
einer Autorität. Diese muss sich<br />
aber auf der verbindlichen Anerkennung der<br />
Menschenwürde aufbauen. Wenn dies nicht<br />
anerkannt wird, dann triumphiert die Macht.<br />
30. Sonntag im Jahreskreis / 20. Sonntag nach <strong>Trinitatis</strong><br />
Eine Demokratie, die die Menschenwürde<br />
nicht anerkennt, verwandelt sich sehr schnell,<br />
wie die Geschichte es lehrt, in einen hinterhältigen<br />
Totalitarismus. In einer echten<br />
Demokratie wird deutlich, dass die Mächtigen<br />
die Diener des Staates sind.<br />
Die Autorität in einem Staat ist durch das<br />
Gemeinwohl begründet und dient dem<br />
Gemeinwohl. Diese Autorität ist aber nicht<br />
von Irrtum frei. Deshalb bedarf sie der<br />
Kontrolle und der Kritik durch die Parlamente,<br />
die Gerichte und die öffentliche<br />
Meinung. Dazu gehört auch ganz wesentlich<br />
das Wahlrecht der Bürger. Am besten ist das<br />
Gemeinwohl in einer Demokratie aufgehoben.<br />
Die Autorität hat einzig und allein dem<br />
Gemeinwohl zu dienen, sonst wird sie zur<br />
Diktatur, die wir unserem Land ja nicht vor<br />
all zu langer Zeit erschreckend hatten. Die<br />
Autorität ist nicht der Souverän, das ist der<br />
Bürger, die Autorität ist Diener aller Bürger.<br />
In diesen Gemeinwohlgedanken sind alle<br />
Völker mit einzubeziehen, desgleichen auch<br />
die kommenden Generationen und die Bewahrung<br />
der Schöpfung, denn auch diese leistet<br />
ihren Beitrag für das Gemeinwohl und<br />
hat deshalb auch beim Gemeinwohl berücksichtigt<br />
zu werden.<br />
„Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr<br />
wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre<br />
Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre<br />
Macht über die Menschen missbrauchen. Bei<br />
euch aber soll es nicht so sein, sondern wer<br />
bei euch groß sein will, der soll euer Diener<br />
sein.“<br />
ev. Reihe I: Mk 10, 2-9 (10-16) kath. 1. L.: Jer 31, 7-9 kath. 2. L.: Hebr 5, 1-6 kath. Evang.: Mk 10, 46-52<br />
Dr. Ernst Leuninger, Limburg<br />
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong><br />
Der Verfasser betrachtet die Predigtperikope der ev. Reihe I. Stichworte<br />
zur Nachhaltigkeit: sozialer Aspekt der Nachhaltigkeit, die christlichen<br />
Grundlagen eines fördernden, für alle Beteiligten gedeihlichen<br />
Zusammenlebens, Scheinheiligkeit unter Bezug auf das, was Gott wirklich<br />
sagt, entlarven, Nachhaltigkeit in der Ehe – eine Schöpfungsgrundlage
Mk 10, 2-9<br />
Wenn die Exegese ihren Fokus auf die Nachhaltigkeit<br />
legt, dann kann es hier nicht um<br />
die ökologische Nachhaltigkeit gehen, sondern<br />
um die soziale Nachhaltigkeit. Mit<br />
sozialer Nachhaltigkeit ist die Verantwortung<br />
für ein intaktes und das (Zusammen)-Leben<br />
förderndes Verhalten gemeint.<br />
So wie in ökologischer Hinsicht unser Verhalten<br />
sich darauf ausrichten muss, dass die<br />
Schöpfung bewahrt wird und wir unsere<br />
Lebensgrundlage nicht zerstören, so legt die<br />
soziale Nachhaltigkeit ihr Augenmerk auf<br />
die Verhaltensweisen der Menschen untereinander,<br />
so dass Gerechtigkeit und Frieden<br />
unter den Menschen gefördert wird. Nur so<br />
kann sich Leben entfalten. Auf diesem<br />
Hintergrund versteht sich auch die folgende<br />
Auslegung.<br />
Nach einer ungenauen und von wenig<br />
Ortskenntnis zeugenden Einleitung in Vers 1<br />
beginnt die Perikope, die Markus so vorgefunden<br />
hat. Der hier auszulegende Teil ist der<br />
erste Abschnitt einer zusammengehörenden<br />
zweiteiligen Überlieferung, die sich in eine<br />
Belehrung an das „viele Volk“ (v 2-9) und<br />
eine Belehrung an die Jünger aufteilt (v 10-12).<br />
Die Frage der Pharisäer wird sofort als<br />
scheinheilig beschrieben, denn die Scheidungspraxis<br />
war durch Dtn 24, 1-4 geregelt.<br />
Umstritten war nur, was als Scheidungsgrund<br />
gelten durfte. So wie dieses Streitgespräch<br />
formuliert ist, darf man davon ausgehen,<br />
dass sich hier die Debatte einer judenchristlichen<br />
Gemeinde wiederspiegelt. Es fällt<br />
auf, dass die Pharisäer immer von einer Erlaubnis<br />
reden, während Jesus von einem<br />
Gebot redet. Die Pharisäer haben ganz offensichtlich<br />
nicht Belange der sozialen Nachhaltigkeit<br />
im Blick, sondern eher das, was sie<br />
für sich innerhalb des Erlaubten herausschlagen<br />
können. Jesus dagegen fragt nach Gottes<br />
Willen. Für ihn ist die Ehe schon zerstört,<br />
wenn jeder nur für sich das Maximum aus der<br />
Gemeinschaft herausholen will. Daher kommt<br />
Jesus seinem Gegner auch nicht entgegen,<br />
wenn er auf die Scheidungsurkunde eingeht,<br />
sondern unterstreicht sie als widergöttliche<br />
Menschensatzung. Sie ist Zeugnis für die<br />
Verstockung der jüdischen Gesetzesausleger<br />
und bleibt somit eine ständige Anklage.<br />
Jesus hebt hervor, dass Mann und Frau<br />
25.10.09<br />
gegenseitig Verantwortung füreinander über- Mk 10, 2-9 (10-16)<br />
nommen haben – und das nicht nur für eine<br />
bestimmte Zeit. Eine Ehe ist für ihn ein<br />
geschützter Raum, in dem sich Leben entfalten<br />
kann; in dem Leben gefördert wird.<br />
Dieser geschützte Raum darf nicht zerstört<br />
werden. Von Anfang an hat Gott sich das in<br />
keiner anderen Weise gedacht, als dass Mann<br />
und Frau in ihrer Zweigeschlechtlichkeit füreinander<br />
da sind. Sie sind nicht zeitlich<br />
begrenzt füreinander da – vielleicht nur so<br />
lange, wie beide einen Nutzen davon haben,<br />
sondern die Ehe soll <strong>nachhaltig</strong> sein. Nach- Nachhaltigkeit in einer Ehe<br />
haltigkeit in einer Ehe umfasst z. B. das gegenseitige<br />
Bereichern der Partner, Schwierig- umfasst z. B. das gegenseitige<br />
keiten gemeinsam zu meistern und das Leben<br />
zu fördern. Es geht darum, gemeinsam zu Bereichern der Partner,<br />
wachsen; das Füreinander-geschaffen-Sein zu<br />
gestalten – und das alles nicht mit der Schwierigkeiten gemeinsam<br />
Einstellung, dass man das tut, solange es gut<br />
geht oder man selbst einen Vorteil davon hat. zu meistern und das Leben<br />
Jesus geht es vielmehr darum, dass das<br />
Füreinander-geschaffen-Sein eine der Grund- zu fördern.<br />
lagen in der Schöpfung ist, das genauso wenig<br />
aufgegeben werden darf wie die Achtsamkeit<br />
für den Lebensraum, in den Gott uns<br />
Menschen gestellt hat. Nachhaltigkeit ist<br />
damit niemals nur ökologisch, sondern auch<br />
immer sozial zu verstehen, weil sonst ein Teil<br />
der Schöpfungsgrundlagen aufgegeben wird.<br />
Die enge schöpfungsgemäße Verbindung<br />
zweier Menschen wird sogar dadurch noch<br />
unterstrichen, dass der Mann Vater und Mutter<br />
verlassen wird, um mit seiner Frau zu leben.<br />
Das griechische Wort meint in diesem<br />
Zusammenhang mehr als nur „an seiner Frau<br />
hängen“, sondern „seiner Frau treu ergeben<br />
sein“. So, wie es eine weitreichende Entscheidung<br />
ist, die eigene Familie (Sippe) zu<br />
verlassen, so unterstreicht das griechische Wort<br />
für „zusammengefügt“ (v 9) die Nachhaltigkeit<br />
der angestrebten gemeinsamen Lebensbewältigung.<br />
Gott wird ausdrücklich als das<br />
Verbindende herausgestellt.<br />
Wie bei der ökologischen Nachhaltigkeit<br />
ist es auch bei der sozialen Nachhaltigkeit<br />
höchst problematisch, wenn Gott nicht in die<br />
eigenen Überlegungen und Handlungen eingebunden<br />
wird. Das Verbot der Ehescheidung<br />
wird von dem Willen des frei verfügenden<br />
Gottes abgeleitet und bezieht daher seine<br />
Relevanz. Da Gott kein Gott der Beliebigkeit<br />
ist, ist auch das Zusammenleben von<br />
Menschen auf Nachhaltigkeit ausgelegt. 143
144<br />
25.10.09<br />
31.10.09<br />
Freiheit – das ist für die<br />
meisten Menschen ihre<br />
eigene Freiheit.<br />
Literatur:<br />
Schweitzer, E., Das Evangelium nach Lukas. NTD<br />
1. Göttingen 1983 6<br />
Gnilka, J., Das Evangelium nach Markus. EKK<br />
Reformationstag<br />
II/2. Zürich, Düsseldorf 1994 4<br />
ev. Reihe I: Mt 5, 2-10 (<strong>11</strong>-12) kath. 1. L.: Röm <strong>11</strong>, 1-2a.<strong>11</strong>-12.25-29 kath. Evang.: Lk 14, 1.7-<strong>11</strong><br />
Mt 5, 2-10 (<strong>11</strong>-12)<br />
Die Autorin betrachtet den Predigttext der ev. Perikopenordnung u. a.<br />
unter Bezug auf die Olympischen Spiele, die zum Zeitpunkt der Texterstellung<br />
gerade in Peking stattfanden. Stichworte zur Nachhaltigkeit:<br />
Freiheit – wie sie mir und Anderen erscheint, und was sie für mich und<br />
andere wirklich ist oder sein könnte (Mt 5)<br />
Die Seligpreisungen als Wegweiser zur<br />
Freiheit der Kinder Gottes und der Stellenwert<br />
der Freiheit in der Welt<br />
Rechtzeitig zu den olympischen Spielen in<br />
Peking 2008 hatte man aufgeräumt – nicht<br />
nur den Müll, nicht nur schmutzige Abgase,<br />
auch die Zeitungen, das Internet, die Bevölkerung,<br />
die Menschen hat man aufgeräumt.<br />
Kein schlechtes Bild, kein schlechter Geruch,<br />
keine schlechte Nachricht, keine schlechte<br />
Kritik sollte das schöne Gesamtkunstwerk<br />
Olympia stören. Deshalb waren in Peking die<br />
Menschen noch ein bisschen unfreier als sonst.<br />
Und das IOC spielte mit. Auch die Athleten<br />
gaben auf Anweisung des IOC ihre Freiheit<br />
am Flughafen in Peking ab. Protest gegen<br />
Menschenrechtsverletzungen – auch stiller –<br />
verboten; Protest gegen Tierquälerei (z. B.<br />
Pelztiere) verboten; Protest gegen Umweltzerstörung<br />
– unerwünscht. Wer es trotzdem<br />
tat, riskierte, von den Spielen ausgeschlossen<br />
zu werden. Ein englischer Journalist wurde<br />
von Polizisten übel zugerichtet, als er versuchte,<br />
über eine unerwünschte Veranstaltung<br />
zu berichten – eine kleine Meldung in<br />
der Zeitung – von einem Protest irgendeiner<br />
Regierung oder des IOC ist mir nichts bekannt.<br />
– Die Freiheit hatte keinen hohen<br />
Stellenwert in den Tagen von Olympia –<br />
einen noch geringeren als sonst – und die<br />
meisten waren zufrieden damit. Sie wollten<br />
ungestört eintauchen in die Wettkämpfe,<br />
Hans-Jörg Ott, Birnbach<br />
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong><br />
wollten baden in den Emotionen der<br />
Athleten, sich mitreißen lassen von den<br />
Kommentaren der Sportjournalisten. – Freiheit<br />
– was ist das überhaupt? Freiheit – ein<br />
dehnbarer Begriff, unter dem vieles verstanden<br />
wird; und meistens ist der Blickwinkel<br />
auf die Freiheit nicht sehr weit und frei, sondern<br />
eng ausgerichtet auf die eigenen<br />
Interessen, die eigenen Bedürfnisse. Freiheit<br />
– das ist für die meisten Menschen ihre eigene<br />
Freiheit.<br />
Wir haben 2008 im Kirchenbezirk Germersheim<br />
ein historisches Spiel aus der Zeit der<br />
Reformation aufgeführt, in dem es eben<br />
darum geht. Da sind die aufständischen<br />
Bauern. Freiheit heißt für sie, ihr Land zu<br />
besitzen, nicht von Steuern und Abgaben<br />
erdrückt zu werden, genug zum Leben zu<br />
haben – die Freiheit der anderen haben sie<br />
nicht im Blick. Gerne folgen sie üblichen<br />
Feindbildern. Ohne mit der Wimper zu zucken,<br />
schreiben sie in Forderungskataloge hinein,<br />
man solle die Kriegskassen mit Geld füllen,<br />
das man den Juden abnehme. Da ist der<br />
Reichsritter Franz von Sickingen. Freiheit heißt<br />
für ihn, weiterhin frei seinen Geschäften –<br />
auch seinen kriegerischen Geschäften – nachgehen<br />
zu können. Freiheit ist für ihn relativ<br />
und sie ist für ihn käuflich. Er möchte im<br />
Machtpoker zwischen Kaiser, Papst und Territorialfürsten<br />
möglichst gut wegkommen;<br />
und so unterstützt er den, der am besten<br />
bezahlt, ihn am wenigsten einengt, ihm die
meisten Vorteile zu bringen scheint. Da ist<br />
der Universitätsgelehrte Paul Fagius aus dem<br />
pfälzischen Rheinzabern – begabter Hebraist,<br />
Schüler und Freund Bucers und Capitos –<br />
nicht reich, aber doch privilegiert. Freiheit<br />
ist für ihn die Freiheit des Denkens, die Freiheit<br />
des Forschens, die Freiheit der Bildung.<br />
Aber auch sein Blick auf die Freiheit war<br />
begrenzt. Dass nicht jeder Zugang zu Bildung<br />
hatte, dass Frauen von Schul-, geschweige<br />
denn Universitätsbildung völlig ausgeschlossen<br />
waren, das war für ihn überhaupt<br />
kein Problem, überhaupt keine Frage.<br />
Ich habe das Drehbuch für das Stück<br />
geschrieben und hierfür zunächst über die<br />
Zeit, über die Personen, über die Personengruppen<br />
recherchiert. Dabei ging mir auf,<br />
dass uns die Personen aus einer fernen Zeit so<br />
fern gar nicht sind: In jedem von uns ist ein<br />
Stück Bauernführer, der nur seine eigene<br />
Wut, seine eigene Misere, seine eigene Not<br />
sieht; in jedem von uns ist ein Stück Ritter<br />
Franz von Sickingen, der sich sein Stück von<br />
der Freiheit kauft, in jedem von uns ist ein<br />
Stück Paul Fagius, der sich keine Gedanken<br />
über ungleiche Bildungschancen macht.<br />
Welche Freiheit meinen WIR?<br />
– Die Freiheit, unbegrenzt mobil zu sein,<br />
jederzeit jeden fernen Winkel dieser Welt<br />
erreichen zu können und in jedem Winkel<br />
der Welt erreichbar zu sein; die Freiheit,<br />
beruflich und privat, global vernetzt zu sein,<br />
global zu leben.<br />
– Die Freiheit, kaufen zu können, was uns<br />
gefällt, ohne zu fragen, unter welchen<br />
Bedingungen und Begleitumständen es produziert<br />
wurde. Ein Beispiel: Immer noch<br />
kaufen wir von Möbeln bis zu Toilettenpapier<br />
Produkte, die die Wälder dieser Erde und<br />
somit Lebensräume unzähliger Lebewesen<br />
zerstören. Nicht überall, wo FSC draufsteht<br />
ist FSC drin! In Indonesien wird der Lebensraum<br />
der Orang-Utans weiterhin so gnadenlos<br />
zerstört, dass diese majestätischen<br />
Menschenaffen vom Aussterben bedroht sind.<br />
Und dabei kommt es am Rande der großen<br />
Verbrechen zu unglaublichen Vorfällen, bei<br />
denen Opfer zu Gewalttätern werden. In<br />
Urwaldcamps vergewaltigen Holzfäller für<br />
umgerechnet 50 Cent ganzkörperrasierte, angekettete<br />
Orang-Weibchen, weil sie sich<br />
menschliche Prostituierte nicht leisten kön-<br />
nen. Unsere Freiheit, billiges Toilettenpapier<br />
und schicke Gartenmöbel kaufen zu können,<br />
die Freiheit der Konzerne, Lebensräume zu<br />
zerstören, um Milliarden zu verdienen, die<br />
Freiheit der kleinen Arbeiter auf billigen Sex<br />
mit Menschen- oder Affenfrauen – für die<br />
ganz weit unten bleibt von der Freiheit<br />
nichts mehr übrig, weil die weiter oben sich<br />
alles genommen haben.<br />
– Wir meinen unsere Freiheit, Kindergärten<br />
und Schulen, Universitäten, Fachschulen,<br />
Ausbildungsbetriebe zu besuchen, eine Freiheit,<br />
die wir für selbstverständlich halten,<br />
eine Freiheit, die vielen Jugendlichen eine<br />
lästige Pflicht ist; eine Freiheit der Bildung,<br />
die manchem in der Wirtschaft zu weit geht.<br />
Die Jugendlichen sollen lernen, was die<br />
Wirtschaft braucht; Allgemeinbildung – einfach<br />
so – halten sie für unrentabel. Deshalb<br />
haben Geisteswissenschaften an den Universitäten<br />
im Moment einen schweren Stand;<br />
deshalb führt man das Abitur nach acht<br />
Jahren ein, deshalb hat man Diplom- durch<br />
Bachelor-Master-Studiengänge ersetzt, hat<br />
man den Handwerksmeister entwertet.<br />
Freiheit – so die vielerorts verfolgte Devise –<br />
Freiheit ist das, was MIR nützt, ist MEINE<br />
Freiheit und somit für jeden etwas anderes.<br />
Der Predigttext spricht von einer anderen<br />
Freiheit:<br />
31.10.09<br />
– Selig sind, die da geistig arm sind: Das ist<br />
die Freiheit, sich Gott völlig zu öffnen, seinen<br />
Willen zu meinem Willen werden zu lassen,<br />
seine Liebe zu meiner Liebe.<br />
– Selig sind, die da Leid tragen: Das ist die<br />
Freiheit, nicht wegzuschauen, wo andere leiden.<br />
– Selig sind, die Sanftmütigen: Das ist die<br />
Freiheit, nicht Ellenbogen und Fäuste, keine<br />
scharfen Waffen, keine bösen Blicke, keine<br />
verletzenden Worte zu benutzen.<br />
– Selig sind, die da hungert und dürstet nach<br />
der Gerechtigkeit: das ist die Freiheit, sich<br />
den Geschmack der Gerechtigkeit nicht<br />
abgewöhnen zu lassen, sich nicht abspeisen<br />
zu lassen mit ideologischem Fastfood und<br />
künstlichen Geschmacksverstärkern – Werbung<br />
z. B., die dem chinesischen Bauern und<br />
uns allen vorspiegelt, Gerechtigkeit sei, wenn<br />
wir auf einem noch größeren Flachbildschirm<br />
die Olympiade noch größer sehen können.<br />
– Selig sind die Barmherzigen: das ist die 145
146<br />
31.10.09<br />
Dies ist die Freiheit, von<br />
der Jesus spricht, eine<br />
gewaltige Freiheit, die den<br />
Mächtigen Angst macht.<br />
01.<strong>11</strong>.09<br />
Freiheit, andere mit den Augen der Liebe<br />
anstatt mit den Augen einer Castingkommission<br />
anzusehen, nicht nach kalten Erwartungen<br />
und Leistungen den ganzen Menschen<br />
zu beurteilen und zu verurteilen (zu<br />
alt, zu jung, zu unerfahren, zu hässlich, zu<br />
dick, zu dumm, zu unsportlich ...).<br />
– Selig sind, die reinen Herzens sind: Das ist<br />
die Freiheit, ein offener ehrlicher Mensch zu<br />
sein, die Freiheit, Masken und Verkleidungen<br />
abzulegen, die Freiheit ICH zu sein<br />
und nicht die, als die andere mich sehen<br />
möchten.<br />
– Selig sind, die Frieden stiften: Das ist<br />
Freiheit, anderen den Frieden zu erklären,<br />
ohne zu fragen, ob er ihn verdient hat, die<br />
Freiheit, sich zu versöhnen, ohne zu fragen,<br />
ob es nützlich ist.<br />
Dies ist die Freiheit, von der Jesus spricht,<br />
eine gewaltige Freiheit, die den Mächtigen<br />
Angst macht, eine Freiheit, die vielen unrealistisch,<br />
unerreichbar erscheint. Dennoch, es<br />
Allerheiligen / 21. Sonntag nach <strong>Trinitatis</strong><br />
ist die Freiheit, die er uns anbietet, die<br />
Freiheit, zu der er uns einlädt. Es wäre schön,<br />
wenn wir sie annehmen könnten, wenn wir<br />
sie spüren könnten, wenn wir sie leben könnten.<br />
Eine Lebensaufgabe.<br />
ev. Reihe I: Mt 5, 38-48 kath. 1. L.: Offb 7, 2-4.9-14 kath. 2. L.: 1 Joh 3, 1-3 kath. Evang.: Mt 5, 1-12a<br />
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong><br />
Der Autor betrachtet die Bibeltexte der kath. Leseordnung. Stichworte<br />
zur Nachhaltigkeit: biblische Gerechtigkeit hängt zunehmend mit Ökologie<br />
zusammen, Allerheiligen – Schrei nach Gerechtigkeit – was dient dem<br />
Leben, nicht: der Effizienz<br />
Begegnung und Konflikt zweier Welten<br />
In dem Fest Allerheiligen begegnen sich<br />
zwei „Welten“: die Welt des Himmels und<br />
die Welt der Erde. Sie sind nicht nur harmonisch<br />
durch die Hoffnung auf Vollendung,<br />
sondern auch konfliktreich durch den Gedanken<br />
des Gerichts, der einen Widerspruch<br />
zur Erde markiert, miteinander verbunden.<br />
Der Himmel steht für die Welt Gottes. Sie<br />
wird sichtbar in den Bildern eines „neuen<br />
Himmels und einer neuen Erde“ (Offb 21,1 ff.).<br />
Diese Bilder flüchten nicht in eine vermeintlich<br />
„rein geistige“ Welt, sondern bleiben der<br />
Erde treu. Sie erzählen nicht einfach vom<br />
Heike Krebs, Bellheim<br />
Hinweis:<br />
Wer Interesse an einer Aufführung unseres<br />
Historienspiels über die Freiheit „Tempora reformanda“<br />
hat, kann sich direkt an mich wenden<br />
(Hintere Str. 4, 76756 Bellheim oder Gemeindepädagogischer<br />
Dienst, z. Hd. Herrn Schaaf, Hauptstraße<br />
1, 76726 Germersheim).<br />
FSC: Forest Stewardship Council (Zertifikat für<br />
Holz aus <strong>nachhaltig</strong>er Forstbewirtschaftung)<br />
Himmel, sondern von einem neuen Himmel,<br />
der sich mit einer neuen Erde verbindet. So<br />
ist es kein Zufall, dass „das Wasser des<br />
Lebens“ (Offb 22, 1), heilende „Bäume des<br />
Lebens“ (Offb 22, 2) ebenso wie das „Licht“<br />
(Offb 22, 5) in den Bildern vom „neuen Himmel<br />
und der neuen Erde“ eine zentrale Bedeutung<br />
haben. Die Hoffnung auf den“neuen Himmel<br />
und die neue Erde“ ist die visionäre Antwort<br />
auf den Schrei derer, die unter der Ungerechtigkeit<br />
des römischen Imperiums und<br />
der Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen leiden.<br />
Sie werden Wirklichkeit, wenn Gott<br />
durch sein Gericht über Rom der zerstörenden<br />
Macht des Imperiums das Ende setzt.
Dies im Hintergrund mitzuhören, hilft, die<br />
Erste Lesung des Festes Offb 7, 2-4.9-14 besser<br />
zu verstehen. Die geschilderte Vision setzt<br />
den Gedanken des Gerichts als Untergang<br />
des Imperiums voraus. Vor diesem Hintergrund<br />
fragt der Text: Wer kann das überleben?<br />
Wer kann gerettet werden?<br />
Unser Text nennt diejenigen „Knechte<br />
unseres Gottes“, die das „Siegel auf der Stirn“<br />
(7, 3) tragen. Das Siegel bezeichnet die<br />
Zugehörigkeit zu Gott und dem Lamm. Die<br />
zu ihnen gehören, stehen um Gottes Thron<br />
und bekennen: „Die Rettung kommt von<br />
unserem Gott...“ (7, 10). Die Quelle von<br />
Rettung und Wohlergehen war nach der<br />
Ideologie des römischen Imperiums der<br />
Kaiser. Er war der Repräsentant einer Weltordnung,<br />
die vor allem die Armen und<br />
Kleinen als zerstörende Macht ihres Lebens<br />
und ihrer Lebensgrundlagen erlebten. Sie bekennen<br />
sich zu Gott und dem Lamm, dem<br />
von der römischen „Ordnung“ hingerichteten<br />
Messias. In Treue zu Gott und dem Lamm<br />
wird eine neue Welt möglich. Der Himmel<br />
steht in Konflikt mit der Erde. Dieser Konflikt<br />
stellt eine Bekenntnisfrage: Wo gehören<br />
wir hin? Zu wem bekennen wir uns?<br />
Auch der Text der zweiten Lesung, 1 Joh 3,<br />
1-3, markiert den Konflikt zwischen zwei<br />
Welten. Die Welt erkennt „die Kinder<br />
Gottes“ (3, 1) nicht, weil sie die Liebe Gottes,<br />
wie sie sich in Jesus gezeigt hat, nicht erkannt<br />
hat. Die Aussagen werden deutlicher,<br />
wenn wir „Welt“ (griechisch: kosmos) mit<br />
„Weltordnung“ übersetzen und „Liebe“ (griechisch:<br />
agaph) mit „Solidarität“. Eine „Weltordnung“,<br />
die auf Über- und Unterordnung<br />
setzt und ihre Macht durch die Zerstörung<br />
von Lebensgrundlagen sichert, steht in<br />
Konflikt mit der Welt Gottes, die in Gottes<br />
Solidarität mit allen Menschengeschwistern<br />
gründet und in der Solidarität unter Gleichen<br />
Gestalt gewinnt. Solidarität verbindet sich<br />
mit dem Tun der Gerechtigkeit. Ihre Grundlage<br />
ist das Recht aller Menschen auf Leben<br />
im Rahmen einer Schöpfung, die Leben und<br />
Lebensraum zugleich ist. Gerechtigkeit und<br />
Bewahrung der Schöpfung werden als zwei<br />
Seiten derselben Medaille sichtbar. Heiligkeit<br />
heißt dann: Jesus ähnlich werden, „sehen,<br />
wie er ist“ (1, 2). Wer Jesus ähnlich ist, dem<br />
ist das heilig, was ihm heilig war: das Leben<br />
der Menschen in Gottes Schöpfung. Als<br />
Gemeinde der „Heiligen“, die ihr ‚Heil’ auf<br />
den Weg der Solidarität setzt, wird die<br />
Christengemeinde „durchsichtig“ für Gottes<br />
neue Schöpfung.<br />
Die Seligpreisungen des Evangelium Mt 5,<br />
1-12a verbinden Verheißungen und Verhaltensweisen,<br />
die denen gelten, denen das<br />
Himmelreich gehört (5, 1). Sie sind eine<br />
Ermutigung für diejenigen, die in der gegenwärtigen<br />
Welt unter Armut und Unrecht leiden,<br />
die traurig und niedergedrückt sind, weil<br />
sie keine Perspektiven, sprich Alternativen<br />
mehr sehen. Zugleich eröffnen sie befreiende<br />
Horizonte, in denen Wege des Reiches<br />
Gottes und seiner Gerechtigkeit (Mt 6, 35)<br />
gegangen werden können. Aber auch dazu<br />
gehört wieder die Erfahrung des Konflikts in<br />
Gestalt von Beschimpfung, Verleumdung<br />
und Verfolgung.<br />
„Nachhaltige“ Zuspitzungen<br />
01.<strong>11</strong>.09<br />
Mt 5, 1-12a<br />
Die Seligpreisungen sind<br />
eine Ermutigung für<br />
diejenigen, die in der<br />
gegenwärtigen Welt unter<br />
Armut und Unrecht leiden.<br />
Es wird immer sichtbarer, wie sehr die<br />
Frage nach Gerechtigkeit, die in den biblischen<br />
Texten im Vordergrund steht, mit ökologischen<br />
Fragen zusammenhängt. Bis zum<br />
Jahr 2025 werden zwei Drittel der afrikanischen<br />
Agrarfläche verschwunden und weitere 1 Joh 3, 1-3<br />
135 Millionen Menschen auf der Flucht sein.<br />
Die knapper werdenden Ressourcen für<br />
Energie sollen dadurch erweitert werden,<br />
dass Energie aus Nahrungsmitteln gewonnen<br />
wird. Die erhöhte Nachfrage führt zu ihrer<br />
Verteuerung und damit zu Hunger und<br />
Verelendung. Die Armen sind die ersten<br />
Opfer ökologischer Zerstörungen, z. B. weil<br />
ihre Wohngebiete als erstes vernichtet werden,<br />
wenn die Meeresspiegel steigen. In den<br />
biblischen Texten zu Allerheiligen begegnet<br />
uns der Schrei nach Gerechtigkeit und in ihm<br />
die Hoffnung auf Gottes neue Welt. Zugleich<br />
ermutigen sie dazu, diese neue Welt jetzt<br />
schon lebendig werden zu lassen und der Auseinandersetzung<br />
mit Strukturen von Unrecht<br />
und Gewalt nicht aus dem Weg zu gehen.<br />
In der Begegnung der Welten von „Himmel“<br />
und „Erde“ wird eine unterschiedliche<br />
Logik, ein unterschiedlicher Geist deutlich.<br />
Unrecht und ökologische Zerstörungen sind<br />
Ausdruck eines Denkens, das auf Nützlichkeit<br />
und Effektivität ausgerichtet ist. Nützlichkeit<br />
ist wirtschaftliche Nützlichkeit. Als<br />
nützlich erscheint das Wachstum der Wirt- 147
148<br />
01.<strong>11</strong>.09<br />
„Ich darf sein, weil der<br />
andere und mit ihm die<br />
Schöpfung als Lebensraum<br />
sein darf.“<br />
Mk 12, 38-44<br />
08.<strong>11</strong>.09<br />
schaft. Sie erscheint heute vielen als Quelle<br />
der Rettung und des Wohlergehens. Effektiv<br />
ist das, was wirtschaftliche Interessen möglichst<br />
schnell verwirklichen hilft. In dieser<br />
Logik ist die Schöpfung den Gesetzen wirtschaftlichen<br />
Denkens unterworfen. Je schneller<br />
und effektiver, je zweckrationaler dies<br />
geschieht, umso deutlicher wird diese Logik<br />
als Logik des Todes und der Zerstörung sichtbar.<br />
Der Blick in Gottes neue Welt macht eine<br />
andere Logik, einen anderen Geist sichtbar.<br />
Vor aller Nützlichkeit und Effektivität steht<br />
die Frage, was dem Leben dient. In der<br />
Sprache des Festes Allerheiligen: Vor aller<br />
Nützlichkeit und Effektivität steht die Frage<br />
nach der Heiligkeit allen Lebens. Sie hat nur<br />
dann eine Chance, wenn unser Denken und<br />
Handeln statt auf private Aneignung und<br />
Unterwerfung auf die Anerkennung des<br />
anderen in seinem Recht auf Leben ausgerichtet<br />
ist. Dann tritt an die Stelle der<br />
Privatisierung des Lebens und der Lebensgrundlagen<br />
ein Bewusstsein der Zusammengehörigkeit<br />
aller Menschengeschwister.<br />
Menschwerden ist solidarisches Menschwerden.<br />
Statt „Ich denke (und unterwerfe),<br />
also bin ich“ gilt dann: „Ich darf sein, weil<br />
der andere und mit ihm die Schöpfung als<br />
Lebensraum sein darf.“<br />
Herbert Böttcher, Koblenz<br />
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong><br />
32. Sonntag im Jahreskreis / drittletzter Sonntag im Kirchenjahr<br />
ev. Reihe I: Lk 17, 20-24 (25-30) kath. 1. L.: 1 Kön 17, 10-16 kath. 2. L.: Hebr 9, 24-28 kath. Evang.: Mk 12, 38-44<br />
Der Verfasser betrachtet alle Predigtperikopen und legt seinen Schwerpunkt<br />
auf den Markustext. Stichworte zur Nachhaltigkeit: im Hier und<br />
Jetzt global Zustände schaffen, die dem Lebenswillen Gottes entsprechen<br />
(Lk 17); mehr teilen in dieser Welt, wer teilt, dem gibt Gott genug, darauf<br />
vertrauen (1 Kön 17); sich gegen die alltäglichen Zwangsopferungen stellen<br />
– wir sind bereits erlöst (Hebr 9); Spenden für Schwache in Nah und<br />
Fern, (Selbst-)Gerechtigkeit und Liebesgebot, Glaubhaftigkeit (Mk 12)<br />
Stellung im Kirchenjahr:<br />
Die Texte sind für den drittletzten Sonntag<br />
im Kirchenjahr vorgeschlagen. Leitbild dieses<br />
Sonntags im evangelischen Bereich ist<br />
„Der Tag des Heils“.<br />
Überlegungen zu Markus 12, 38-44<br />
Exegetische Überlegungen:<br />
Aufgrund des Themas dieser Reihe habe<br />
ich mich, statt für den im evangelischen Bereich<br />
eigentlich vorgesehenen Predigttext Lk 17,<br />
20 ff., für den Evangeliumstext Mk 12, 38-44<br />
entschieden. Nach Berger (Bibelkunde des<br />
NT, S. 274 f.) steht dieser Abschnitt im größeren<br />
Zusammenhang der beiden Kapitel <strong>11</strong><br />
und 12. Jesus zieht nach Jerusalem ein und<br />
eckt alsbald (Tempelreinigung) beim religiö-<br />
sen Establishment an. Dies führt zur Frage<br />
nach seiner Vollmacht, aus der heraus er handelt<br />
und spricht. Jesus rechnet mit seiner<br />
Ablehnung, sieht er sich doch in der Tradition<br />
derer, die vor ihm gekommen waren:<br />
die Propheten und Johannes der Täufer. Wenig<br />
schmeichelhaft für seine Gegner fällt das<br />
Gleichnis von den bösen Weingärtnern aus.<br />
Eben diese Gegner werden zu Beginn unseres<br />
Predigttextes heftig kritisiert. Jesus wirft<br />
ihnen das Auseinanderfallen von religiösem<br />
Anspruch und praktischem Handeln vor.<br />
Äußerlich betont Korrektem („sie verrichten<br />
zum Schein lange Gebete“) steht die Ausbeutung<br />
der Schwächsten der Gesellschaft<br />
(Witwen) gegenüber. Dies wird zu Konsequenzen<br />
führen (Mk 12, 40). Ihnen wird als<br />
Positivbeispiel die arme Witwe (also eben<br />
eine von diesen Randgestalten der damaligen
Gesellschaft) gegenübergestellt. Ihr Verhalten<br />
kann m. E. geradezu als die Erfüllung des<br />
Doppelgebots der Liebe (Mk 12, 29 ff.) angesehen<br />
werden. Liebe ist mehr als Opfer,<br />
zumal dann, wenn diese nur zum Schein dargebracht<br />
werden oder keine wirklichen Opfer<br />
sind (vgl. Vers 44). Wer Gott liebt, der muss<br />
auch seinen Nächsten lieben und das mit aller<br />
Konsequenz. So könnte man das Resümee<br />
unseres Predigttextes wohl formulieren.<br />
Das Handeln der armen Witwe ist in den<br />
Augen Jesu Beispiel für ein gelungenes<br />
Miteinander von Gottes- und Nächstenliebe.<br />
Nicht thematisiert wird die Frage, wie die<br />
Witwe nach ihrem Opfer weiter lebt, bzw.<br />
weiter leben kann. Nimmt man die Aussagen<br />
Jesu ernst, hat sie alles gegeben, was sie zum<br />
Leben hatte. Es ist wohl aber auch eher der<br />
krasse Gegensatz zum Handeln der Reichen<br />
und Frommen, der hier zum Ausdruck kommen<br />
soll und weniger die Frage, ob<br />
Nachfolge im Sinne Jesu tatsächlich völligen<br />
Verzicht auf persönliche Habe beinhaltet.<br />
Allerdings wird das Ausmaß der Opferbereitschaft<br />
der jeweils Handelnden sehr ernst<br />
in den Blick genommen und damit durchaus<br />
auch heutige Spendenpraxis hinterfragt.<br />
Zur Predigt:<br />
Spenden ist immer noch „in“ in Deutschland.<br />
Überall im Fernsehen, in den verschiedenen<br />
Hörfunkprogrammen, in der anstehenden<br />
Adventszeit auch wieder in den Kirchen,<br />
wird um Spenden gebeten. Wie gesagt, immer<br />
noch mit großem Erfolg. Wie in unserem<br />
Textabschnitt wird ganz sicher auch heute<br />
durchaus in unterschiedlichem Maß – gemessen<br />
am absoluten Reichtum der einzelnen<br />
Spender – gespendet. Die kleine Spende eines<br />
Einzelnen kann diesen auch heute weit mehr<br />
belasten als die Millionenspende einen Superreichen.<br />
Von hier aus könnte die Haltung, die<br />
Motivation, aus der heraus gespendet wird,<br />
kritisch herausgearbeitet werden. Dient eine<br />
Spende der Beruhigung des eigenen religiösen<br />
und sozialen Gewissens (siehe die Gegner<br />
Jesu), ist aber kein wirklicher Ausdruck wahrer<br />
Gottes- und Nächstenliebe? Oder kann am<br />
Maß der Spende und des sonstigen Verhaltens<br />
gegenüber dem Mitmenschen in Nah und<br />
Fern – auch in der Zukunft – ein wirkliches<br />
Verantwortungsbewusstsein erkannt werden?<br />
Es ist unmöglich, solche Entscheidungen<br />
08.<strong>11</strong>.09<br />
von der Kanzel herab zu treffen. Und das sollte<br />
auch nicht geschehen. Wer kann schon in<br />
das Herz, den Kopf oder den Geldbeutel<br />
eines Menschen hineinschauen. Dennoch<br />
würde ich das Verhältnis zwischen Anspruch<br />
und Wirklichkeit unseres Verhaltens gegenüber<br />
den Schwachen in Nah und Fern in den<br />
Zusammenhang des Doppelgebots der Liebe<br />
hineinstellen. Wer Gott liebt, der muss auch<br />
seinen Nächsten lieben – und zwar erkennbar.<br />
Dem Ernst dieses Anspruchs Jesu ist<br />
nichts zu nehmen. Ausgeführt werden könnte<br />
dies an Beispielen aus verschiedenen Bereichen<br />
der Probleme, die sich uns heute stellen:<br />
– Ist unsere Spende für „Brot für die Welt“<br />
oder „Misereor“ glaubhaft, wenn wir gleichzeitig<br />
die Verhältnisse, die zu Armut,<br />
Hunger und eigenem Wohlstand führen,<br />
einfach weiter bestehen lassen?<br />
– Ist unsere Spende für die Umweltorganisation,<br />
ist unser Bekenntnis zur Bewahrung<br />
der Schöpfung glaubhaft, wenn wir<br />
gleichzeitig unser persönliches Verhalten<br />
nicht ändern?<br />
– Ist die vielbeschworene Verantwortung für<br />
künftige Generationen glaubwürdig, wenn<br />
wir bei der ersten Schwierigkeit sofort wieder<br />
unseren eigenen kleinen Vorteil im Blick<br />
haben?<br />
– Ist es mit einer Spende für soziale Zwecke<br />
eines großen Unternehmens getan, wenn<br />
die Gewinne, aus denen die Spende finanziert<br />
wird, selbst aufgrund von ungerechten<br />
oder unsozialen Verhältnissen erzielt wurden?<br />
Dies sind nur einige Beispiele, an denen<br />
wir (auch der Verfasser) uns schmerzlich<br />
berührt, ertappt fühlen könnten, uns an der<br />
Seite derer sehen, die Jesus so heftig kritisiert.<br />
Allein: Diesen Schmerz müssen wir<br />
wohl aushalten, um die Ernsthaftigkeit unseres<br />
Textes nicht unerlaubt abzuschwächen.<br />
Verzicht könnte ein Stichwort sein, das im<br />
Verlauf der Predigt zu entfalten wäre. Auch,<br />
dass weniger manchmal durchaus mehr sein<br />
kann. Denn dass Reichtum alleine nicht<br />
glücklich macht, zeigen doch die Fälle so vieler<br />
ganz offensichtlich unglücklicher Menschen<br />
in den reichen Ländern unserer Erde. Worauf<br />
es wirklich ankommt ist, eine positive<br />
Haltung zum bekannten (und überwiegend<br />
doch auch gewollten) Glauben und zu den<br />
daraus sich ergebenden Konsequenzen zu gewinnen.<br />
Dazu sollte der Gemeinde aller Mut<br />
gemacht werden, auch unter dem Aspekt, 149
150<br />
Lk 17, 20-24 (25-30)<br />
08.<strong>11</strong>.09<br />
Wir Reiche sollen lernen,<br />
wie die Witwe zu vertrauen<br />
und erfahren, dass Gott<br />
genug gibt für alle.<br />
Genug – nicht zu viel.<br />
1 Kön 17, 10-16<br />
Hebr 9, 24-28<br />
dass sich nötige Veränderungen in einer<br />
Gemeinschaft, die das miteinander und sich<br />
gegenseitig trägt, leichter und einfacher erreichen<br />
lassen als alleine.<br />
Heil für die Welt und Heil für den einzelnen<br />
Menschen, das ist das Ziel dessen, was<br />
wir das Reich Gottes nennen. Dies wird wohl<br />
erst am Ende der Zeiten vollständig erreicht<br />
werden. Zugleich ist es aber überall dort schon<br />
mitten unter uns präsent, wo wir aufrichtig<br />
nach dem Doppelgebot der Liebe handeln.<br />
Die arme Witwe ist ein Beispiel dafür. Und<br />
zugleich ein Stachel in unserem Fleisch, die<br />
eigene Glaubens- und Lebenspraxis auf ihre<br />
Glaubwürdigkeit hin zu überprüfen.<br />
Zur Liturgie:<br />
Als Psalmlesung schlage ich Psalm 51 (EG<br />
Baden/Pfalz 733) vor, als Lieder zur Predigt<br />
„Ein wahrer Glaube …“, EG 413, und „Selig<br />
seid ihr …“, EG 667 (Regionalteil Baden/Pfalz).<br />
Zu den weiteren Texten:<br />
1. Könige 17, 10-16:<br />
„Teilen macht alle satt“, so möchte ich diese<br />
Perikope zusammenfassen. Gegen alle Vernunft,<br />
oder was wir heute darunter verstehen, geht<br />
die Witwe hin (trotz durchaus vorhandener<br />
Zweifel) und tut, was Elia sie heißt. Sie stellt<br />
ihre Zweifel hinter das Vertrauen zurück, das<br />
sie in Gott und seine Verheißungen – hier<br />
vermittelt durch den Propheten – hat. Und<br />
sie wird nicht enttäuscht.<br />
Vertrauen auf Gott, das ist ein wichtiges<br />
Thema unserer Tage. Lieber kontrollieren wir<br />
uns und unser Leben als auf Vertrauen zu<br />
bauen. Und in manchen Bereichen des<br />
Lebens ist das ja auch sinnvoll und lebenswichtig.<br />
Aber es ist eben nicht alles. Ja, die<br />
wichtigsten Dinge im Leben kann man nicht<br />
unter Kontrolle bringen: den Glauben, die<br />
Liebe, Gefühle. Hier ist Vertrauen die unerlässliche<br />
Grundlage, damit Leben gelingen<br />
kann, und zwar für alle. Gott schafft das<br />
Leben und er will Leben in Würde für alle.<br />
Für uns Reiche bedeutet dieser Text (s. oben),<br />
dass wir lernen sollen, wie diese Witwe zu<br />
vertrauen und erfahren, dass Gott genug gibt<br />
für alle. Genug – nicht viel zu viel.<br />
Wer auf Gott vertraut und gibt, wird erfahren,<br />
dass er auch weiter von ihm getragen<br />
und erhalten wird und das Leben einen neuen,<br />
tiefen Sinn erhält. Vor dem Hintergrund von<br />
wachsender Weltbevölkerung, wieder steigender<br />
Armut, Verknappung von Lebensraum<br />
und Ressourcen ein lohnender Text, bei dem<br />
es wichtig ist, die Schöpfung als Ganzes nicht<br />
aus dem Blick zu verlieren.<br />
Lukas 17, 20-24 (25-30):<br />
Ein endzeitlicher Text am Sonntag, der den<br />
„Tag des Heils“ zum Thema hat. Angesichts<br />
der Weltsituation auch heute wieder Zeiten<br />
für Unheilspropheten (vgl. Vers 30), die das<br />
Ende nahen sehen und Menschen nicht nur<br />
ängstigen, sondern – was noch schlimmer ist<br />
– teilweise zu einer Haltung ermutigen, die<br />
man mit den Worten „Nach uns die Sintflut“<br />
zusammenfassen könnte. Doch Ziel des<br />
Reiches Gottes ist ja nun nicht Zerstörung<br />
um der Zerstörung willen, sondern die Aufrichtung<br />
von Zuständen, die dem Lebenswillen<br />
Gottes entsprechen. Die wiederum ist<br />
nicht ausschließlich ein zukünftiger, sondern<br />
zutiefst gegenwärtiger Prozess! „Denn siehe,<br />
das Reich Gottes ist mitten unter euch.“ Menschen,<br />
die in der Nachfolge Jesu leben wollen,<br />
sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
Gottes am Bau dieses Reiches. Und das nicht<br />
aus Angst vor Strafe oder in Erwartung von<br />
künftigen Belohnungen, sondern aus dem<br />
Wunsch heraus, der Liebe Gottes, die sie<br />
selbst erfahren haben, eine liebende Antwort<br />
zu geben. Die letzten Dinge – dazu zählt<br />
auch das endgültige Kommen des Reiches<br />
Gottes – sollten wir auch Gott selbst überlassen,<br />
im Vertrauen darauf, dass wir bis dahin<br />
mit Freude und Liebe dem Leben auf dieser<br />
Erde dienen dürfen und sollen und dabei<br />
immer wieder einen handfesten Vorgeschmack<br />
von dem bekommen, auf das wir als Christen<br />
immer noch hoffen. Was es heißt, dass das<br />
Reich Gottes immer wieder unter uns ist, dort<br />
wo wir es schaffen, im Sinne Jesu eine Stimme<br />
zu verleihen, zu ihrem Recht zu verhelfen, die<br />
Würde des Lebens zu wahren, das lässt sich<br />
für jede/jeden sicher mit vielen Beispielen<br />
auch aus dem eigenen Umfeld belegen.<br />
Hebräer 9, 24-28:<br />
Mit diesem Text könnte die gegenwärtige<br />
„Opferpraxis“ unserer modernen Gesellschaft<br />
problematisiert werden. Opfer gibt es unzählige:<br />
Opfer von Naturkatastrophen, die unserem<br />
Umgang mit der Natur (Klima!) geschuldet<br />
sind. Verkehrsopfer, die wir auf dem<br />
Altar gedankenloser Mobilität opfern. Opfer
von Hunger und Armut, die unter ungerechten<br />
Verhältnissen bezüglich der Verteilung von<br />
Gütern auf dieser Welt sind. Die Schöpfung<br />
selbst, die nach wie vor kurzfristigen Profitund<br />
Wohlstandsinteressen geopfert wird.<br />
Opfer gibt es täglich und unzählige.<br />
Allerdings sind dies keine Opfer zu Gunsten<br />
Gottes. Solche sind mit und seit Jesus Christus<br />
auch gar nicht mehr notwendig. Opfer haben<br />
sich aus der Sicht Gottes ein für alle Mal erledigt.<br />
Vielmehr gilt es anzunehmen, was Jesus<br />
bewirkt hat: Erlösung. Wer sich aber erlöst<br />
weiß, kann Abstand nehmen von den angeblichen<br />
äußeren Zwängen und Notwendigkeiten,<br />
welche die oben genannten Opfer erst<br />
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong><br />
33. Sonntag im Jahreskreis / vorletzter Sonntag im Kirchenjahr<br />
15.<strong>11</strong>.09<br />
ev. Reihe I: Mt 25, 31-46 kath. 1. L.: Dan 12, 1-3 kath. 2. L.: Hebr 10, <strong>11</strong>-14.18 kath. Evang.: Mk 13, 24-32<br />
Der Autor betrachtet keine spezielle Bibelstelle aus den Lese- bzw.<br />
Perikopenordnungen dieses Sonntags, sondern gibt Anregungen aus dem<br />
Zusammenwirken der biblischen Impulse des Tages: Stichworte: das<br />
Reich Gottes bei der Entfaltung unterstützen, Geduld und Leidenschaft,<br />
ausreichende und soziale Energieversorgung, unhintergehbare Gesetze<br />
des Reichs Gottes: Einsetzen für Frieden und Gerechtigkeit<br />
1. Zugang – Situationsbeschreibung<br />
„Es gibt so viele Orte des Todes.<br />
Von Golgotha bis Auschwitz, von Tschernobyl<br />
Bis zum Platz des Himmlischen Friedens.<br />
Nicht nur im Geschichtsbuch,<br />
auch auf der Landkarte meines Herzens<br />
Zellen der Einsamkeit, Folterkammern<br />
Friedhöfe einer gestorbenen Hoffnung.<br />
Da suche ich nach Orten des Lebens,<br />
baue kleine Biotope der Hoffnung.<br />
Als Gegengewicht gegen all das Bedrohliche,<br />
Giftige, Tödliche in mir und um mich.“<br />
(Hermann Josef Coenenn)<br />
Die Verkündigungssprache in den<br />
Gottesdiensten unserer Kirche wird gegen<br />
Ende des Kirchenjahres düsterer und bedrohlicher.<br />
Die Schriftlesungen führen hinweg aus<br />
einem positiven Zukunftsdenken, das eigentlich<br />
nur von Erfolg wissen will, hin zu einer<br />
hervorbringen. Diese sind somit als Ausdruck<br />
einer Welt zu verstehen, die die Erlösung durch<br />
Gott noch nicht angenommen hat und immer<br />
noch versucht, selbst Heil zu schaffen. Dies<br />
aber kommt allein durch Jesus Christus bei<br />
dessen Wiederkunft für die, die auf ihn warten<br />
(Vers 28). Hinzufügen könnten man: Die<br />
wissen, dass sie das von ihm erwarten dürfen.<br />
Dieser Text will ermutigen, als Menschen<br />
zu leben, die wissen, dass sie erlöst sind. Und<br />
das führt dazu, die Umstände, die die Opfer<br />
unserer Tage provozieren, nicht mehr länger<br />
einfach hinzunehmen.<br />
Andreas Gutting, Albersweiler<br />
krassen und schroffen Betrachtung und<br />
Deutung der Weltzusammenhänge. Manchmal<br />
so, dass einem angst und bange wird. Zu<br />
allen Zeiten gibt es Menschen und Gruppen<br />
von Christenmenschen, die das, was wir aus<br />
der Gemeinde des Evangelisten Markus<br />
hören, sehr wörtlich nehmen und buchstabengetreu<br />
deuten, um für sich Verhaltensmaßregeln<br />
zu entwerfen. Sie machen sich und<br />
ihre Anhänger und Anhängerinnen zu<br />
Opfern ihrer Interpretation und setzen sich<br />
über Menschenrechte – um Gottes willen –<br />
brutal hinweg.<br />
Aber selbst bei nüchternern Betrachtung<br />
der Botschaft gerät man als kritischer Mensch<br />
doch leicht ins Grübeln, betrachtet man die<br />
Ereignisse und Entwicklungen unserer Umwelt.<br />
In vielen Bereichen des Zusammenlebens der<br />
Menschen mit ihrer Welt stoßen wir an<br />
Grenzen, nicht nur des Wachstums, sondern<br />
auch der Regelung der nächsten Dinge. Öko-<br />
08.<strong>11</strong>.09<br />
In vielen Bereichen des<br />
Zusammenlebens der<br />
Menschen mit ihrer Welt<br />
stoßen wir an Grenzen.<br />
151
152<br />
15.<strong>11</strong>.09<br />
Und welchen Preis sind wir<br />
bereit zu zahlen, um all das<br />
zu sichern, was wir zum<br />
Leben brauchen?<br />
nomie und Ökologie geraten immer mehr auf<br />
einen Kollisionskurs, betrachtet man z. B. lokale<br />
und globale Probleme der ausreichenden<br />
und sozial erschwinglichen Energieversorgung.<br />
Diese wird zu einem empfindlichen Katalysator<br />
oder Bremshebel für die Konjunktur,<br />
vorausgesetzt Menschen finden nicht in<br />
rascher Zeit zu einer außergewöhnlichen<br />
Lösung.<br />
Und welchen Preis sind wir, ist die zivilisierte<br />
Menschheit bereit zu zahlen, um all das<br />
zu sichern, was wir zum Leben brauchen? Die<br />
Energieressourcen dieser Welt, vor allem Öl<br />
und Gas, befinden sich mehrheitlich in den<br />
Ländern mit überkommenen Herrschaftsund<br />
Gerechtigkeitsstrukturen, in Ländern, in<br />
denen Armut und Reichtum sich krass voneinander<br />
abheben, die über die Hautfarbe<br />
und die Rassenzugehörigkeit moderne Sklaven<br />
einerseits und über alles erhabene<br />
Herrschaften andererseits schafft.<br />
Wir werden uns konfrontieren lassen müssen<br />
mit solch unangenehmen Fragen in unserem<br />
Fortschrittsdenken, das auch hier an<br />
seine Grenzen stößt. Tschernobyl als Ereignis<br />
auch unbeherrschbarer Technik mit fast apokalyptischen<br />
Ausmaßen und Plätze des Himmlischen<br />
Friedens an allen Ecken dieser Welt<br />
als Synonyme für den Preis ungebremstes<br />
Wachstums des Wohlstandes und des Fortschritts<br />
wegen bleiben Wegmarken dieser<br />
Welt.<br />
2. Irritationen<br />
Welche Dünnhäutigkeiten sich bei uns<br />
Menschen trotz unseres ungebremsten Fortschrittswahns<br />
entwickelt haben, zeigt sich<br />
markant, wenn Astronomen und andere wissenschaftlicher<br />
Forscher Near-Misses von<br />
Sternen und anderen Planeten mit unserer<br />
Erde ankündigen, oder wenn Berichte mögliche<br />
bevorstehende Kometeneinschläge voraussagen.<br />
Besorgnis über das Ende stellt sich<br />
ein. Und in einer Art Untergangshumor<br />
ergehen sich Menschen freizügig in Untergangspartys.<br />
Menschen suchen nach Orten<br />
des Lebens, bauen kleine Biotope der<br />
Hoffnung als Gegengewicht gegen all das<br />
Bedrohliche, Giftige, Tödliche.<br />
Das sind gute und verständliche Schritte,<br />
die Menschen in ihrer Verzweiflung machen,<br />
um den drohenden Untergang noch ein wenig<br />
hinauszuschieben oder gar abzuwenden.<br />
Wie groß war nicht die Hoffnung und<br />
Erleichterung, als man nach der Explosion<br />
des Kernreaktors mutige Männer und Frauen<br />
und eine wirksame Technik gefunden zu<br />
haben schien, um durch dicke Betonmauern<br />
das Moloch der offenen Kernstrahlung in die<br />
Umgebung und in die weite Welt zu besiegen<br />
und zu beherrschen. Es kann weitergehen.<br />
Wir haben gesiegt! Wie groß aber die<br />
Ernüchterung, dass das atomare Feuer dennoch<br />
weiter frisst und sich wieder einen Weg<br />
nach außen suchen wird, wenn nicht noch<br />
dickere Mauern errichtet werden! Und so<br />
wird sich dieser Wettlauf fortsetzen. Die kleinen<br />
Biotope können auch zu einer Selbsttäuschung<br />
geraten, inmitten des Chaos Inseln<br />
der Ruhe schaffen zu können.<br />
3. Annäherung<br />
Jesus spricht sehr deutlich und markant<br />
vom Ende dieser Welt. Seine Worte könnten<br />
Angst machen. Er lässt keinen Zweifel daran,<br />
dass noch irgendetwas nach dem Ende dieser<br />
Welt beim Alten bleiben könnte. Alles<br />
Gewohnte fällt in sich zusammen. Da mögen<br />
wir Menschen uns in den Jahrtausenden noch<br />
so angestrengt haben, uns diese Welt nach<br />
und nach zu erobern und unterwürfig zu<br />
machen, damit wir sie bewohnen können.<br />
Alles Gewohnte wird in sich zusammenfallen.<br />
Aus? Vorbei?<br />
Genießen wir deswegen alle Lust und alles<br />
Vergnügen, das wir hier und heute erreichen<br />
können, auf wessen Kosten auch immer!<br />
Aber Gott lässt nicht zu, dass alles vorbei<br />
ist. Er sendet seine Engel aus, um die einzusammeln,<br />
die ihn, Jesus, als den Sohn Gottes<br />
und den Menschensohn erkannt haben. Am<br />
Ende der Zeiten wird offenbar werden, dass<br />
Jesus, der von den Mächtigen der damaligen<br />
Religion Geschmähte, Gottes Sohn, ja Gott<br />
selber ist.<br />
Das konnten die Mächtigen nicht begreifen,<br />
dass Gott nicht von vornherein auf ihrer<br />
Seite steht, sondern als begnadeter Prediger<br />
in einer Schärfe und Radikalität von Gott<br />
spricht, von seinem Reich der Gerechtigkeit<br />
und des Friedens, das hier unter den Menschen<br />
angebrochen ist und nicht erst irgendwann<br />
beginnen wird. Die Mächtigen im<br />
Tempel jedoch beharrten auf ihren Posi-
tionen, dass Gott, den sie im Tempel wähnten<br />
und zu dem sie nur kontrolliert Zugang<br />
gewährten, so groß sei, dass er es gar nicht<br />
nötig habe, ganz und gar Mensch zu werden<br />
oder gar mit den Menschen durch ihr Leben<br />
unterwegs zu sein. Unverständlich und gefährlich<br />
war dieser Mann Gottes für sie, der<br />
als Gottes Sohn ankündigte, dass selbst der<br />
Tempel in Jerusalem keinen Bestand haben<br />
werde, wenn Gott als Messias zurückkehre,<br />
um endgültig das Reich Gottes zu vollenden.<br />
Sie aber glaubten, dass der Messias mit einem<br />
„Paukenschlag“ mächtig und majestätisch<br />
daherkomme und unter großen Donnerhall<br />
mit einem Schlag das Reich Gottes aufbaue.<br />
Das haben sie nicht verstanden, diese Männer<br />
und Frauen, die sich die religiöse Macht<br />
zugeschrieben haben, aber blind geworden<br />
sind, den Sohn Gottes und Gott selber zu<br />
begreifen. Dieses Reich Gottes entfaltet sich<br />
unter den Menschen, es wächst unter den<br />
Menschen, wie ein Kind wächst. Da gibt es<br />
Gesetze, die nicht von uns Menschen gemacht<br />
sind. Wer das erkennt, wie gerade die<br />
Armen, wie die Entrechteten, wie die Ausgestoßenen,<br />
wie die Kranken, wie die Kinder<br />
auf die Botschaft vom Reiche Gottes, die<br />
Jesus verkündet, hören, wird zum exponierten<br />
Mitarbeiter und zur Mitarbeiterin am<br />
Aufbau dieses Reiches, das letztlich durch<br />
Gott allein, durch seine Gnade wächst und<br />
auf höchste menschliche Anstrengungen<br />
baut.<br />
Gewiss, Gott hat uns Menschen Fähigkeiten<br />
und Fertigkeiten geschenkt, zu denen<br />
er uns einlädt, sie tief und mit Liebe für die<br />
Menschen und für die Lebenswelt der Menschen<br />
und der Kreatur und für vom Herzen<br />
her und mit ganzer Akribie zu entfalten.<br />
Jedoch müssen wir nicht jeden Erfolg dabei<br />
erzielen; denn das Reich Gottes ist nicht<br />
einem ungebremsten Wirtschaftswachstum<br />
unterworfen oder einer gierigen und ausreichenden<br />
Sicherung der Energiequellen für<br />
diejenigen, die eine globale Herrschaft anstreben<br />
und sichern wollen; das Wachsen des<br />
Reiches Gottes bedarf nicht des vermeintlichen<br />
Schutzes durch strategische Raketen-<br />
Abwehrsysteme und andere Waffen. Dieses<br />
Reich Gottes wächst von einer anderen Seite<br />
in unsere Welt hinein, auf die wir Menschen,<br />
mögen wir uns auch noch so anstrengen wollen,<br />
keinen Einfluss haben. Wir Menschen<br />
müssen für das Reich Gottes keinen materiel-<br />
len Reichtum einsetzen und stehen nicht<br />
unter einem Erfolgszwang, alles und jenes<br />
sichern und leisten zu müssen. Wir können<br />
nicht einmal unser Leben sichern und brauchen<br />
es auch nicht. Aber wir sind eingeladen,<br />
uns einzusetzen für das, was Zukunft hat,<br />
nämlich Frieden und Gerechtigkeit, so wie<br />
die Botschaft Gottes sie immer wieder<br />
umschreibt, oder, wie es in der Würzburger<br />
Synode heißt: „das Reich Gottes ist nicht<br />
indifferent gegenüber den Welthandelspreisen“.<br />
4. Verstärkung<br />
„Mag sein, dass der Jüngste Tag morgen<br />
anbricht, dann wollen wir gerne die Arbeit<br />
für eine bessere Zukunft aus der Hand legen,<br />
vorher aber nicht.“ So formulierte es Dietrich<br />
Bonhoeffer im Angesicht seines bevorstehenden<br />
gewaltsamen Todes 1945.<br />
Wir wissen nicht, wann die bisherigen so<br />
vielen Orte des Todes und der Ungerechtigkeit<br />
in der Welt, die von Menschen in<br />
ihrem Herrschafts- und Anspruchswahn<br />
errichtet worden sind, sich so ausbreiten, dass<br />
uns die Luft und der Raum zum Atmen und<br />
Leben genommen wird. Wir wissen nicht,<br />
wann und ob die Szenarien von Pandemien<br />
und Verkettungen von Gewalt und Herrschaft<br />
sich zum Unheil der Menschen durchsetzen<br />
werden. Wenn wir nur darauf warten<br />
und darauf stieren würden, wir würden die<br />
Möglichkeiten nicht nutzen, mit Ruhe, in<br />
Besonnenheit und Klugheit und im Gottvertrauen<br />
Hand anzulegen für eine bessere<br />
Zukunft, die den Weg weist zum Reich<br />
Gottes und zu dessen Wachsen unter den<br />
Bedingungen unserer Zeit und Welt.<br />
Ferdinand Kerstiens, Pfarrer und Geistlicher<br />
Beistand in der Friedensbewegung Pax<br />
Christi, nennt in diesem Zusammenhang<br />
zwei Qualitäten, in denen wir uns üben und<br />
beweisen können, da uns am Geschick der<br />
Welt und des Reiches Gottes liegen: die<br />
wachsame Geduld und die gelassene Leidenschaft.<br />
Wie wäre es, wenn wir uns diese<br />
Qualitäten zu Eigen machen könnten?<br />
Josef Kolbeck, Gau-Algesheim<br />
15.<strong>11</strong>.09<br />
153
154<br />
22.<strong>11</strong>.09<br />
Christkönigssonntag / letzter Sonntag im Kirchenjahr<br />
ev. Reihe I: Mt 25, 1-13 kath. 1. L.: Dan 7, 2a.13b-14 kath. 2. L.: Offb 1, 5b-8 kath. Evang.: Joh 18, 33b-37<br />
Mt 25, 1-13<br />
Die Art, wie wir leben und<br />
mit Energie umgehen, trägt<br />
dazu bei, dass die<br />
Lebenslichter ganzer<br />
Gattungen auf der Erde<br />
auf immer verlöschen.<br />
Der Verfasser betrachtet die Predigtperikope der ev. Reihe I. Stichworte<br />
zur Nachhaltigkeit: Interpretation der verlöschenden Lampen als<br />
verlöschendes Lebenslicht, kluger und vorausschauender Umgang mit<br />
Ressourcen, Auslöschen von Arten durch den törichten Umgang mit der<br />
Schöpfung (Natur- und Pflanzenwelt), sowie unter Punkt 3 kurz die<br />
Bibelstelle zur kath. 1. Lesung<br />
Mt 25, 1-13<br />
Menschen nehmen am Gottesdienst teil,<br />
die die Endlichkeit irdischen Lebens in den<br />
letzten Monaten schmerzlich erfahren haben.<br />
So wie die Lampen der fünf törichten Jungfrauen<br />
verlöschen, mussten Angehörige das<br />
Verlöschen eines Lebens erleben. Die Frage<br />
stellt sich daher, ob Tod und Abschied nur im<br />
individuellen subjektiven Horizont zu thematisieren<br />
und auszulegen sind oder darüber<br />
hinaus auch davon gesprochen werden kann,<br />
wie der Tod auf diesem Planeten insgesamt<br />
zurzeit umgeht. Das Bild der brennenden<br />
bzw. verlöschenden Lampen kann in der<br />
Predigt auf vielfache Weise entfaltet werden.<br />
Einige Assoziationen und Anregungen dazu:<br />
1. Welche Lebenslichter sind in der letzten<br />
Zeit in meinem Umkreis verloschen? Was<br />
hat die Person, um die ich trauere, in diese<br />
Welt gebracht und ausgestrahlt? Welche<br />
Spuren hat sie in meinem Leben und in der<br />
Welt im Allgemeinen hinterlassen? Spuren<br />
des Lichts – oder eher dunkle Schatten?<br />
2. Den törichten Jungfrauen geht unterwegs<br />
das Öl aus. Ein für unsere Zeit sehr<br />
sinnfälliges Bild: Öl, das aufgebraucht ist<br />
und versiegt. Der biblische Text unterscheidet<br />
deutlich zwischen den fünf törichten und<br />
den fünf klugen Jungfrauen. Die Auslegung<br />
von Eduard Schweizer in seinem Kommentar<br />
zum Matthäus-Evangelium vor mehr als 30 Jahren<br />
liest sich wie eine aktuelle Schilderung<br />
einer Welt, die den Höhepunkt der verfügbaren<br />
Ölvorräte überschritten hat. „Die Klugen<br />
sind die, die die Augen offen haben für das,<br />
was kommt, und nicht einfach in den Tag<br />
hineinleben. Sie ... denken nicht nur an die<br />
unmittelbare Gegenwart.“ Die Klugen wissen,<br />
dass „die Ölvorräte nicht für alle reichen“<br />
(305). Ins Allgemeine gewendet: Wie<br />
gehen wir mit der Begrenztheit der<br />
<strong>nachhaltig</strong> <strong>predigen</strong><br />
Ressourcen und mit der Endlichkeit des<br />
Lebens um? Ich sehe einen Zusammenhang<br />
zwischen der mangelnden Einsicht, dass das<br />
Ende von Öl und Kohle absehbar ist und der<br />
Tendenz, den Tod verdrängen zu wollen. Was<br />
heißt heute intelligent Vorsorge zu treffen –<br />
im Hinblick auf begrenzte Ressourcen als<br />
auch im Hinblick auf begrenzte Lebenszeit?<br />
Inzwischen ist schon die Rede davon, dass<br />
warmes Wasser und eine beheizte Wohnung<br />
für manch einen in Deutschland nicht mehr<br />
bezahlbar sein wird. Schon die Verknappung<br />
des Öls wird dramatische Folgen haben und<br />
das Versiegen der Ölquellen erst recht – falls<br />
wir nicht intelligent vorsorgen, rechtzeitig<br />
und ganz massiv in regenerative Energien<br />
investieren. Ansonsten werden wir schon<br />
bald eine Reihe von Kältetoten zu beklagen<br />
haben.<br />
3. Das Verlöschen der Lampen ist auch ein<br />
Sinnbild für Leben, das für immer ausgelöscht<br />
wird. Am Totensonntag könnte der<br />
Blick über den individuellen Tod hinaus auch<br />
auf das geweitet werden, was in der Tier- und<br />
Pflanzenwelt z. Zt. geschieht. Die Art, wie<br />
wir leben und mit Energie umgehen, trägt<br />
dazu bei, dass die Lebenslichter ganzer<br />
Gattungen auf der Erde auf immer verlöschen.<br />
Nach Aussage von Wissenschaftlern<br />
übersteigt die aktuelle Rate des Artensterbens<br />
die natürliche Aussterberate um das<br />
100- bis 1000-fache. „Wachet“, heißt es am<br />
Ende des biblischen Textes, gebt acht, und<br />
handelt klug und umsichtig.<br />
In dem in der katholischen Kirche an diesem<br />
Sonntag vorgesehenen Lesetext heißt es<br />
in Offenbarung 1 in Vers 6: Jesus Christus<br />
hat „uns zu Königen und Priestern gemacht“.<br />
So wie ein König für sein Land zu sorgen hat,<br />
so haben wir Verantwortung für die Erde zu<br />
übernehmen. Gerade an einem Tag wie Totensonntag<br />
müssen wir uns unserer<br />
Verantwortung für das Leben bewusst wer-
den. Wir dürfen nicht zulassen, dass immer<br />
mehr Lebensarten auf immer von diesem<br />
Planeten verschwinden. In den vergangenen<br />
25 Jahren ist nach Angaben der Umweltorganisation<br />
WWF die biologische Vielfalt<br />
um 25 Prozent zurückgegangen. Im Bild des<br />
biblischen Textes sind das 2,5 von insgesamt<br />
zehn Fackeln, die durch die Menschheit in<br />
einer Generation zum Verlöschen gebracht<br />
wurden. Vogelarten, die auf immer verstummen,<br />
werden mit ihrem Gesang keinen<br />
Trauernden mehr wieder Vertrauen in das<br />
Leben schöpfen lassen, ausgestorbene Pflanzenarten<br />
können späteren Generationen z. B.<br />
nicht mehr als Heilmittel dienen.<br />
4. Das Motiv der zehn Jungfrauen findet sich<br />
vielfach in der Kunst. Das Brautportal der ev.<br />
Marienkirche in Osnabrück z. B. zeigt auf der<br />
linken Seite fünf Jungfrauen mit brennenden<br />
Ölgefäßen, auf der rechten Seite sind fünf<br />
Jungfrauen zu sehen, deren Ölgefäße ausgebrannt<br />
und zum Boden gekehrt sind und<br />
denen die Enttäuschung ins Gesicht<br />
geschrieben steht. Das Motiv am Eingangsportal<br />
einer Kirche ist tiefsinnig: Welche<br />
Türen öffnen sich mir im Leben, wo stehe ich<br />
vor verschlossenen Türen, bzw. welche haben<br />
sich mir durch Abschied und Tod für immer<br />
geschlossen? Die fünf törichten Jungfrauen<br />
haben sich selber den Zutritt verbaut bzw.<br />
durch ihre Lebensweise evt. auch anderen die<br />
Tür verschlossen. Wir sollten überlegen:<br />
Schließen wir durch die Art, wie wir heute<br />
mit der Erde umgehen, schon heute für viele<br />
Menschen auf der Südhalbkugel die Tür zum<br />
Leben und die Tür zur Zukunft für kommende<br />
Generationen auf diesem Planeten insgesamt?<br />
Die fünf Jungfrauen vor der verschlossenen<br />
Tür sollten uns eine Mahnung sein: Es<br />
gibt ein „zu spät“ – auch beim Klimawandel!<br />
5. Von den zehn Lampen brennt laut biblischer<br />
Erzählung schließlich nur noch jede<br />
zweite, fünf verlöschen unterwegs. Wir können<br />
dies auch auf den Glauben beziehen. Bei<br />
manch einem ist das Licht der Hoffnung und<br />
des Glaubens, das innere Licht schon lange<br />
erloschen. Der Betreffende existiert zwar<br />
noch, aber ohne Lebensperspektive, ohne<br />
Hoffnung. Vielleicht ist das auch einer der<br />
Gründe für die Art, wie mit diesem Planeten<br />
zurzeit umgegangen wird. Zeitgleich mit<br />
dem Glauben schwindet auch die Arten-<br />
vielfalt. Das eine hängt m. E. mit dem anderen<br />
zusammen, ja das erstere bedingt das<br />
andere. Das stimmt nachdenklich. Es mangelt<br />
am Respekt und der Achtung für das<br />
Leben, und vor allem fehlt es oft am Glauben<br />
an eine Begegnung mit dem Bräutigam, der<br />
uns als Auferstandener erwartet. Vielleicht<br />
wird er eines Tages mit uns gemeinsam die<br />
Spur betrachten, die wir auf diesem Planeten<br />
hinterlassen haben. Was werden wir dann<br />
wahrnehmen: Spuren des Lichts – oder eine<br />
Schneise der Verwüstung?<br />
6. Die Metapher des Bräutigams ist in der<br />
Mystik Sinnbild für die enge, ja die intime<br />
Verbindung der menschlichen Seele mit Gott<br />
und für die Freude, die daraus erwächst. Man<br />
kann an einem Tag wie dem Ewigkeitssonntag<br />
zu entfalten suchen, wie die<br />
Erfahrung der Nähe Gottes Menschen Kraft<br />
gibt und sie befähigt, mit der Endlichkeit<br />
des Lebens, ja selbst mit dem Tod besser fertig<br />
zu werden. Der Glaube an eine Begegnung<br />
mit dem Bräutigam, der gemäß<br />
Johannes 1, <strong>11</strong> Eigentümer der Welt ist, wird<br />
uns auch in die Lage versetzen, mit der Erde<br />
angemessener umzugehen. Dreh- und Angelpunkt<br />
ist dabei m. E. ein erneuertes Verständnis<br />
unseres Glaubens. Strahlt das Licht<br />
des Glaubens in uns auf, dann werden auch<br />
die Lebenslichter vieler Arten auf der Erde<br />
weiter leuchten. Daran werden schließlich<br />
auch jene, die uns vorausgegangen und im<br />
Himmel mit dem Bräutigam vereint sind,<br />
ihre helle Freude haben: an einer Erde, die<br />
nicht abgefackelt wird, sondern gesegneter<br />
Lebensraum für zahllose Geschöpfe ist –<br />
Vorzimmer der Ewigkeit. Darum: Wachet,<br />
dass die Fackel des Glaubens nicht verlöscht.<br />
Literatur:<br />
Eduard Schweizer: Das Evangelium nach Matthäus,<br />
in der Reihe Das Neue Testamant, Göttingen 1976,<br />
14. Auflage, Seite 304 f.<br />
Andreas Krone, Waldems-Esch<br />
22.<strong>11</strong>.09<br />
Was werden wir dann<br />
wahrnehmen: Spuren des<br />
Lichts – oder eine Schneise<br />
der Verwüstung?<br />
155