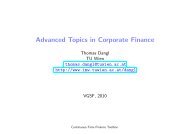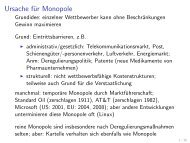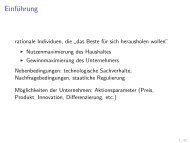Organisation und Personal - IMW
Organisation und Personal - IMW
Organisation und Personal - IMW
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
TermineDatum Zeit Einheit Thema05.10.2010 ab 14:00 1 Vorbesprechung12.10.2010 14:00 – 15:30 2 Gegenstand <strong>und</strong> Aufgabe, Existenz von <strong>Organisation</strong>en09.11.2010 14:00 – 15:30 3 Transaktionskostentheorie16.11.2010 14:00 – 15:30*15:30 – 17:0007.12.2010 14:00 – 15:30*15:30 – 17:004567Netzwerke & Effizienzbewertung<strong>Organisation</strong>sgestaltungAufgabenverteilung <strong>und</strong> <strong>Personal</strong>bedarf<strong>Personal</strong>beschaffung21.12.2010 14:00 – 15:30* 8Koordination, Delegation15:30 – 17:00 9 Koordinationsmechanismeni11.01.2011 14:00 – 15:30*15:30 – 17:001011Motivation <strong>und</strong> FührungAgency, Entlohnung18.01.2011 14:00 – 15:30 12 Ablauforganisation <strong>und</strong> Planung25.01.2011 14:00 – 15:30 13 Klausurvorbreitung, Fragestunge (optionalOrt: Thresianumgasse, HS 1* Kurze Pause zwischen den Einheiten bei Doppeleinheiten© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Kursgliederung<strong>Organisation</strong> <strong>und</strong> <strong>Personal</strong>: Gegenstand <strong>und</strong> Aufgabe1.1 <strong>Organisation</strong> <strong>und</strong> <strong>Personal</strong> als funktionale Teilbereiche der Betriebswirtschaftslehre1.2 <strong>Organisation</strong>stheorie <strong>und</strong> <strong>Organisation</strong>sbegriffe1.3 <strong>Personal</strong>management1.4 Methodische Gr<strong>und</strong>lagenGr<strong>und</strong>lagen der <strong>Organisation</strong>stheorie21E 2.1 Entstehung t von <strong>Organisation</strong>en2.1.1 Arbeitsteilung2.1.2 Transaktionskosten2.1.3 Unternehmensnetzwerke – eine Mischform zwischen Markt <strong>und</strong> Hierarchie2.2 Effizienzkriterien für <strong>Organisation</strong>en2.2.1 Der Zielerreichungsansatz2.2.2 Der Ressourcen-Ansatz2.2.32 Der Stakeholder-Ansatz2.2.4 Prozessorientierte Effizienzbegriffe2.2.5 Der Competing Values-Ansatz2.3 Organisatorische Gestaltungsvariablen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
KursgliederungAufgabenverteilung3.1 <strong>Organisation</strong>sstrukturen3.1.1 1 Gr<strong>und</strong>lagen3.1.2 Gliederungsprinzipien <strong>und</strong> <strong>Organisation</strong>sstrukturen3.2 <strong>Personal</strong>wirtschafta t3.2.1 <strong>Personal</strong>bedarf3.2.2 <strong>Personal</strong>auswahlSteuerung dezentraler Strukturen4.1 Koordination4.1.1 Weisungsrechte4.1.2 Koordinationsmechanismen4.2 Motivation4.2.1 Gr<strong>und</strong>lagen4.2.2 Motivationstheorien4.2.3 Anreizsysteme4.2.4 Variable vs. fixe Entlohnung4.2.5 Entlohnungsformen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
KursgliederungProzessorganisation5.1 Konzepte <strong>und</strong> Methoden prozessorientierter t <strong>Organisation</strong>sgestaltungt 5.1.1 Leitgedanken prozessorientierter <strong>Organisation</strong>sgestaltung5.1.2 Methoden prozessorientierter <strong>Organisation</strong>sgestaltungg g5.2 Unternehmensplanung als Prozess der Steuerungsebene5.2.1 Begriff <strong>und</strong> Ziele der Unternehmensplanung5.2.2 Aufbau der Unternehmensplanung5.2.3 Interdependenzen <strong>und</strong> Koordination von Teilplänen5.2.4 Phasenschema der Planung© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
LeistungskontrolleVorlesungsprüfung50 Multiple-Choice Fragen4 Antwortmöglichkeiten (Anzahl richtiger Antworten angegeben)1 Punkt je vollkommen richtig beantworteter FrageDatum Zeit Ort02.12.2010 14:00 – 16:00 Audimax, Getreidemarkt31.01.2011 13:00 – 15:00 Audimax, Getreidemarkt02.03.2011 14:00 – 16:00 Audimax, GetreidemarktAnmeldung via TISS© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
UnterlagenPrüfungsstoff:Skriptum Köszegi/Vetschera:<strong>Organisation</strong> <strong>und</strong> <strong>Personal</strong>im Sekretariat des Bereichs Arbeitswissenschaft<strong>und</strong> <strong>Organisation</strong> erhältlich (€ 7,-)Folien zur VorlesungDownload unter http://www.imw.tuwien.ac.at/aw> Staff > Michael FilzmoserVertiefende Literatur:Picot, A./Dietl, H./Franck, E. (2008): <strong>Organisation</strong>:Eine ökonomische Perspektive, Schäffer-PoeschlWolff Birgitta/Lazear Edward (2001):Einführung in die <strong>Personal</strong>ökonomik. Schäffer-Peoschl© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
<strong>Organisation</strong> <strong>und</strong> <strong>Personal</strong>Gegenstand <strong>und</strong> Aufgabe1.1 <strong>Organisation</strong> <strong>und</strong> <strong>Personal</strong> als funktionaleTeilbereiche der Betriebswirtschaftslehre1.2 <strong>Organisation</strong>stheorie <strong>und</strong> <strong>Organisation</strong>sbegriffe1.3 <strong>Personal</strong>management14 1.4 Methodische Gr<strong>und</strong>lagen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
<strong>Organisation</strong> <strong>und</strong> <strong>Personal</strong> als funktionale BWLAndere Funktionalbereiche<strong>Organisation</strong> <strong>und</strong> <strong>Personal</strong>Unternehmen e e as alsEinheitRealisation vonEntscheidungenunproblematischUmwelt rationalUnternehmen besteht ausmehreren PersonenMitarbeiter haben eigeneInteressenBeschränkte Rationalität© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
<strong>Organisation</strong> <strong>und</strong> <strong>Personal</strong><strong>Organisation</strong>iAbstrakte Stellen<strong>Personal</strong>Konkrete Personen☺© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
<strong>Personal</strong>managementAufgaben des <strong>Personal</strong>managments<strong>Personal</strong>beschaffung<strong>Personal</strong>einsatz<strong>Personal</strong>entwicklung<strong>Personal</strong>freisetzung© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
<strong>Organisation</strong>sbegriffe<strong>Organisation</strong> ist ein ...Soziales System, in dem mehrere Personen zurVerwirklichung gemeinsamer (<strong>und</strong> individueller)id Ziele zusammenwirken institutioneller <strong>Organisation</strong>sbegriffSystem von Regeln zur Steuerung des Verhaltensder <strong>Organisation</strong>smitgliederit funktionaler <strong>Organisation</strong>sbegriff© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
<strong>Organisation</strong>stheorieEmpirische <strong>Organisation</strong>sforschungUntersuchung des empirischen Phänomens"<strong>Organisation</strong>"Entscheidungshilfe für PraxisHandlungsempfehlungen für "optimale"organisatorische Regelungen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Gr<strong>und</strong>lagen der <strong>Organisation</strong>stheorie2.1 Entstehung von <strong>Organisation</strong>en2.1.1 Arbeitsteilung2.1.2 Transaktionskosten2.1.3 Unternehmensnetzwerke– eine Mischform zwischen Markt <strong>und</strong> Hierarchie2.2 Effizienzkriterien für <strong>Organisation</strong>en221DerZielerreichungsansatz2.2.1 2.2.2 Der Ressourcen-Ansatz223DerStakeholder 2.2.3 Stakeholder-Ansatz2.2.4 Prozessorientierte Effizienzbegriffe225DerCompetingValuesAnsatz2.2.5 Values-Ansatz2.3 Organisatorische Gestaltungsvariablen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
ArbeitsteilungVertikale Arbeitsteilung:Trennung zwischen ausführenden <strong>und</strong>koordinierenden TätigkeitenHorizontale tl Arbeitsteilung:AbittilZerlegung ausführenderTätigkeiten© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
ArbeitsteilungVorteileNachteileSpezialisierung,LerneffekteKoordinationwenigerUmrüstvorgängeeinseitige iti BelastungNutzung technischerhProduktionsmittelMonotonie© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Koordinationsformen in <strong>Organisation</strong>engleich ungleich ungleich Informationgleich gleich ungleich KalküleSelbstabstimmung:Gruppenmitglieder legen ihreAktionspläne individuell festmöglich,nichteffizientInfo-austauschn(n-1)nichtmöglichGruppenabstimmung:möglich, Info- möglich,Aktionspläne werden gemeinsam nicht austausch Qualif.für alle verbindlich festgelegt effizient < SA Gruppe?Hierarchie eac eInstanz legt Aktionspläne für alleMitglieder festmöglich,effizientInfoaustausch(n-1)effizientmöglich,Qualif.Instanz ?eher eff.© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Arbeitsteilige LeistungserstellungKoordination durchInstitutionenZentrale EntscheidungWeisungHierarchieDezentraleEntscheidungindividuelleidZielegemeinsamePreiseMarktZiele Vertrauen Netzwerk© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Gr<strong>und</strong>lagen – Neoklassisches ModellVollkommener Markt:– Anonymität der Akteure: Homogenität der Produkte– keine Marktmacht: viele Anbieter & viele Nachfrager– vollkommene Information über Anbieter & Produkte– freier MarktzugangPreis als Steuerungsmechanismus (Information)Gleichgewicht (<strong>und</strong> Pareto-Effizienz)Akteure– Wertmaximierungsprinzip– Rationalität© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Marktversagen (Coase, 1937)Marktmacht & keine homogenen ProdukteIntransparenz: fehlende Information über ProdukteFehlende Märkte: Unsicherheit, externe EffekteTransaktionskosten &ineffiziente Allokation von RessourcenAlternative Formen der <strong>Organisation</strong>:Firma, Netzwerk, Markt, Staat© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Gr<strong>und</strong>lagen TransaktionskostentheorieTransaktion als Bezugseinheit (mikroökonomische Analyse)Verhaltensannahmen h (‚Organizational Man‘)– Beschränkte Rationalität– Kalkulierender Opportunismus– RisikoneutralitätFirma als Governance-Struktur (nicht alsProduktionsfunktion)Interdisziplinäre Perspektive (Vertragsformen <strong>und</strong>Konfliktlösungsmechanismen)Institutionen = sanktionierbare Erwartungen, die sich auf dieVerhaltensweisen eines oder mehrerer Individuen beziehen(Picot et al. 2008, S 10)© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Anteil der Transaktionskosten an d. Wertschöpfung© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
TransaktionskostenTransaktion = Austausch von Leistung<strong>und</strong> GegenleistungTransaktionskosten:Kosten, die bei der Abwicklung einer Transaktion entstehent Allgemein: Kosten für die Koordination wirtschaftlicherhAktivitäten© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Ablauf einer TransaktionPlanungsphase Anregung Transaktionskosten:VollzugsphaseSucheAuswahlVertrags-abschlussVorvertragliche Phase:• Kosten der Suche• Kosten der AnbahnungAbschlußphase:• Kosten der VereinbarungDurchführung,Kontrolle,DurchsetzungAnpassungNachvertragliche Phase:• Kosten der Abwicklung• Kosten der Kontrolle• Kosten der DurchsetzungMichaelis, 1985• Kosten der Anpassung© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
KerntheseDie Höhe der Produktions- <strong>und</strong>Transaktionskosten, die für eine Transaktionanfallen, variieren systematisch mit1. Institutionellen Regelungen (z.B.<strong>Organisation</strong>sform)2. Eigenschaften der Leistung <strong>und</strong> derUmwelt© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 200627
Bestimmungsgrößen von TransaktionskostenOpportunismus &Beschränkte RationalitätEigenschaftender AkteureEigenschaftender Leistung<strong>und</strong> UmweltSpezifitätUnsicherheit & KomplexitätInstitutionelleRegelungenz.B. <strong>Organisation</strong>sformHöhe derTransaktions-kosten© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Organizational Failure Framework (Williamson)TransaktionsatmosphäreTransaktionshäufigkeitVerfügbarkeit Kapital/Know HowbeschränkteRationalitätUnsicherheitKomplexitätUmwelt-faktorenVerhaltensannahmenInformationsverkeilungOpportunismusSpezifitätPicot et al., 1996© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Institutionelle Regelungen: VertragsformenKlassischer (vollständiger) Vertrag (Markt)– Präzise Bestimmung des Gegenstandes <strong>und</strong> der Konditionen, Autonomieder Partner daher ist Identität irrelevant– Konflikte werden über den Rechtsweg gelöstNeoklassischer (unvollständiger) Vertrag (Hybride)– Identität der Partner relevant durch bilaterale Abhängigkeit– Anpassungs- <strong>und</strong> Sicherungsklauseln– Institutionalisierte privatrechtliche Konfliktlösungsmechanismen(Schiedsgerichtsbarkeit)Relationaler (forbearance) Vertrag (Hierarchie)– Langfristige Vertragsbeziehungen <strong>und</strong> bilaterale Abhängigkeit– Einbindung über Sozialbeziehungen (explizite <strong>und</strong> implizite Vertr.)– Konflikte werden intern/durch Vertragspartner gelöst (Macht, Anweisung)© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 200630
Spezifität (Asset Specifity)Spezifität = Widmung der Ressource„Je größer die Wertdifferenz zwischen der beabsichtigten Verwendung <strong>und</strong> derzweitbesten Verwendung der jeweiligen Ressource ist, desto höher ist dieSpezifität der Transaktion.“ Picot et al., S 59Standort (Site Specifity)Ressource steht nur an einem bestimmten Ort zur VerfügungPhysisch (Physical Asset Specifity)Ressource kann nur für einen spezifischen Zweck eingesetzt werdenHumankapital (Human Assest Specifity)Fähigkeiten, die nur für einen bestimmten Zweck eingesetzt werden könnenDedicated AssetInvestition in nichtspezifische Anlage, dieaber nur für geplante Transaktionerfolgt <strong>und</strong> bei deren Wegfall Überkapazität entstehenZeitlich (Time related Asset Specifity)Ressource kann nur kurzfristig genutzt t werden Williamson 1989© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Charakteristika der TransaktionTransaktionsspezifische Investitionen (asset specificity)– Senken über die Realisierung von Spezialisierungsvorteilenanfallende Produktionskosten– Erhöhen Abhängigkeit zwischen Partnern (Opportunitätskosten)Unsicherheit (uncertainty)– Parametrische Unsicherheit (situative Bedingungen)g – Verhaltensunsicherheit (opportunistisches Verhalten)Häufigkeit der Transaktion (frequency)– Skalen- <strong>und</strong> Synergieeffekte senken Produktions- <strong>und</strong>Transaktionskosten© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Kostenwirkungen von TransaktionscharakteristikaSpezifischeInvestitionenUnsicherheitHäufigkeitProduktionskosten- ~ -Transaktionskosten+ + -© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Markt vs. HierarchieVergleich: z.B. Leistung mit hoher Spezifität / häufige TransaktionenKosten Markt HierarchieSuche hoch geringAnbahnungVereinbarungAbwicklungKontrolleDurchsetzunghocheher hocheher geringeher geringhochgeringeher geringghochhochgeringAnpassung hoch gering© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Markt vs. HierarchieVergleich: z.B. Leistung mit geringer Spezifität / häufige TransaktionenKosten Markt HierarchieSuche eher gering geringAnbahnungVereinbarungAbwicklungKontrolleDurchsetzunggeringeher geringggeringeher geringgeringgeringeher geringghocheher hochgeringAnpassung gering gering© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Kosten von Markt <strong>und</strong> HierarchieKosten von Suche, Verein-barung <strong>und</strong> dAnpassung(Transaktionskosten i.e.S)Kosten von Abwicklung <strong>und</strong>Kontrolle (Koordination <strong>und</strong>Motivation)(<strong>Organisation</strong>skosten)<strong>Organisation</strong>sgrad© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Transaktionskosten <strong>und</strong> SpezifitätKostenKoordination überden MarktHierarchischehKoordination© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006SpezifitätPicot et al., 1996
Informationstechnologie <strong>und</strong> TransaktionskostenStandardsFlexible FSGlobale NetzeSpezifitätKomplexitätStandardsDatenbankenAuswertungenTransaktionskostenInformationsübermittlungInformationsverarbeitungDirekte Reduktion© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Arbeitsteilige LeistungserstellungKoordination durchInstitutionenZentrale EntscheidungWeisungHierarchieDezentraleEntscheidungindividuelleidZielegemeinsamePreiseMarktZiele Vertrauen Netzwerk© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Unternehmensnetzwerke„ein Unternehmungsnetzwerk stellt eine auf dieRealisierung von Wettbewerbsvorteilen zielende<strong>Organisation</strong>sform ökonomischer Aktivitäten dar, diesich durch komplex-reziproke, eher kooperativedenn kompetitive <strong>und</strong> relativ stabile Beziehungenzwischen rechtlich selbständigen, wirtschaftlichjedoch zumeist abhängigen Unternehmungenauszeichnet. “Sydow, 1995© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Netzwerke: EigenschaftenGemeinsame Ziele (Shared goals)Gemeinsames Wissen (Shared expertise)Gemeinsame Aufgabe (Shared work)Gemeinsame Entscheidungen(Shared decision making)Gemeinsame Prioritäten(Shared timing and issue prioritization)Gemeinsame Verantwortlichkeit <strong>und</strong> Vertrauen (Sharedresponsibility, accountability and trust)Gemeinsamer Erfolg(Shared recognition and reward)© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006Rockart/Short, 1991
DefinitionVERTRAUENVertrauens-handlungVertrauenserwartungVertrauen ist ...... die freiwillige Erbringung einerriskanten Vorleistung unter Verzichtauf explizite Sicherungs- <strong>und</strong>Kontrollmaßnahmen gegenopportunistisches Verhalten ...... in der Erwartung,dass der Vertrauensnehmermotiviert ist, trotz Fehlen solcherSchutzmaßnahmen, freiwillig aufopportunistisches Verhalten zuverzichten.© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Transaktionskosten in NetzwerkenMarktHierarchieSuche ↓ Motivation ?Anbahnung ↓Vereinbarung ↓Abwicklung ≈Kontrolle ↓Durchsetzung ↓Anpassung ≈Kontrolle ↓Koordination ↓© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Klassifikation von NetzwerkentetrischgenheitasymmAusg gewogmmetrisc ch asymKlassische HierarchieinternesNetzwerkStabiles (strategisches)Netzwerkdynamisches Netzwerk- Regionales Netzw.- Virtuelles Untern.ein UnternehmenmehrereRechtsform© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Horizontale/vertikale NetzwerkeVertikalesNetzwerkEndprodukteWertschöpfungsketteZwischenprodukteHorizontalesNetzwerkRohstoffe© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
IntegrationsgradEigenentwicklung <strong>und</strong> EigenerstellungKapitalbeteiligung an Lieferanten/AbnehmernLieferantenansiedlungEntwicklungskooperationLangzeitvereinbarungen für spezifische TeileJahresverträge (Lieferrahmenverträge)Spontaner Einkauf am MarktabnehmendervertikalerIntegrationsgrad© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006Picot 2008
Formen von NetzwerkenInternes Netzwerk:Netzwerkartige <strong>Organisation</strong> innerhalb einesUnternehmens, Koordinationsstelle (Broker) verbindetweitgehend autonome TeilbereicheStabiles Netzwerk:Führendes Unternehmen bindet andere Unternehmen(v.a. Zulieferer) eng an sichDynamisches Netzwerk:Flexible Kooperation mehrerer selbständigerUnternehmenMertens/Faißt, ß, 1996© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Internes NetzwerkEntwicklungFertigungBrokerVorprodukteVertriebMertens/Faißt, 1996© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Stabiles NetzwerkZuliefererZuliefererLeaderZuliefererZuliefererMertens/Faißt, 1996© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Dynamisches NetzwerkEntwicklungFertigungBrokerVorprodukteVertriebMertens/Faißt, 1996© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Interorganisationale UnternehmensverfassungTechnical and Computer Graphics (24 australische Firmen), 200 MASelbständige Netzwerkfirmen, die durch bilaterale Verträge koordiniertwerdenGegenseitige Bevorzugung der Firmen beim Abschluss von VerträgenAusschluss von Konkurrenz zwischen den NetzwerkfirmenerkfirmenGegenseitige NichtausbeutungFlexibilität <strong>und</strong> Wahrung der Geschäftsautonomie t der GruppenfirmenDemokratische Verfassung des NetzwerkesNichtbeachtung der Regeln führt zum AusschlussEintritt neuer Firmen ist erwünschtAustritt ist jederzeit möglichBeziehungen einzelner Netzwerkfirmen zu externen Dritten möglich© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006aus Picot 2008
Virtuelles UnternehmenNetzwerk rechtlich selbständiger UnternehmenErscheint gegenüber K<strong>und</strong>en wie ein einzigesUnternehmenKonzentration der Mitglieder auf Kern-kompetenzendynamische Konfigurationevtl. zeitliche BegrenzungUnterstützung tüt durch Informationstechnologiet i© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Weitere Beispiele für UnternehmenskooperationenLizenzierungJoint VentureKonsortiumStrategische AllianzKapitalbeteiligungengGenossenschaftenFranchise-<strong>Organisation</strong>enKeiretsu© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Beispiel Keiretsu© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Weitere Beispiele: www.fas.at© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Arbeitsteilige LeistungserstellungKoordination durchInstitutionenZentrale EntscheidungWeisungHierarchieDezentraleEntscheidungindividuelleidZielegemeinsamePreiseMarktZiele Vertrauen Netzwerk© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Was ist eine gute <strong>Organisation</strong>sform?Effizienzkriterien© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
WirtschaftlichkeitsprinzipEffizienz =Output(Produkte oder Leistungen)Input(Produktionsfaktoren)© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Effizienz von <strong>Organisation</strong>enInputs Transformationsprozess OutputsRessourcenansatz Prozessansatz ZielerreichungsansatzEffizienz einer <strong>Organisation</strong>wird an ihrer Fähigkeitgemessen, die benötigten t Inputszu erhaltenEffizienz einer <strong>Organisation</strong>wird daran gemessen, wie gutder TransformationsprozesserfolgtEffizienz einer <strong>Organisation</strong>wird idan ihren Outputs t gemessen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
RessourcenansatzBewertungsgröße:Wie gut ist <strong>Organisation</strong> in der Lage, die zurLeistungserstellung erforderlichen Ressourcen zubeschaffen?Vorteile:✔ Einfache Messung durch BeobachtungNachteile:✘ Keine Aussage über Nutzung der Ressourcen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Effizienz von <strong>Organisation</strong>enInputs Transformationsprozess OutputsRessourcenansatz Prozessansatz ZielerreichungsansatzEffizienz einer <strong>Organisation</strong>wird an ihrer Fähigkeitgemessen, die benötigten t Inputszu erhaltenEffizienz einer <strong>Organisation</strong>wird daran gemessen, wie gutder TransformationsprozesserfolgtEffizienz einer <strong>Organisation</strong>wird idan ihren Outputs t gemessen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Ziele: Beispiel Salzburger Flughafen 2007Qualitative Ziele– Standortsicherungt – Erfüllung der K<strong>und</strong>enwünsche– Mitarbeiterzufriedenheit– Langfristige Partnerschaften– Gesellschaftliche Reputation– Moderne, leistungsfähige Infrastruktur– Erfüllung der volkswirtschaftlichen AufgabenQuantitative Ziele– Moderates Wachstum– Wirtschaftliche h Ziele:– 8% Eigenkapital-Rentabilität– 8% EBIT-Margin– Beibehaltung einer ges<strong>und</strong>en Finanzstruktur© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006 web-access 31.03.2009
Ziele: Beispiel HPK<strong>und</strong>enloyalitätWir verfolgen das Ziel, unseren K<strong>und</strong>en die qualitativ hochwertigsten <strong>und</strong> wertvollsten Produkte, Services <strong>und</strong> Lösungen bereit zu stellen, umdadurch ihren Respekt <strong>und</strong> ihre Loyalität zu erlangen <strong>und</strong> zu bewahren.GewinnWir verfolgen das Ziel, ausreichend Gewinn zu erwirtschaften, um das weitere Wachstum unseres Unternehmens zu finanzieren, unserenAktionären angemessene Renditen zu sichern <strong>und</strong> um Ressourcen bereitzustellen, die wir zum Erreichen der anderen Unternehmenszielebenötigen.MarktführerschaftWir wollen das Wachstum unseres Unternehmens sichern, indem wir Märkte, auf denen wir bereits vertreten sind, mit sinnvollen <strong>und</strong> innovativenProdukten, Services <strong>und</strong> Lösungen bedienen. Außerdem wollen wir in neue Bereiche vorstoßen, die auf unsere Technologien <strong>und</strong> Kompetenzenaufbauen <strong>und</strong> die Interessen unserer K<strong>und</strong>en berücksichtigen.WachstumWir sehen in den Veränderungen des Marktes eine Chance für mehr Wachstum, um unsere Gewinne <strong>und</strong> Fähigkeiten in den Dienst derEntwicklung <strong>und</strong> Bereitstellung innovativer Produkte, Services <strong>und</strong> Lösungen zu stellen, die den neu entstehenden Ansprüchen unserer K<strong>und</strong>engerecht werden.MitarbeiterInnenWir wollen MitarbeiterInnen von HP am Erfolg des Unternehmens beteiligen, der durch sie erst möglich wird. Wir bieten unseren MitarbeiterInnenleistungsorientierte Beschäftigungsmöglichkeiten <strong>und</strong> schaffen mit ihnen eine sichere <strong>und</strong> kreative Arbeitsumgebung, in der sowohl dieVielseitigkeit als auch die Individualität jedes Einzelnen geschätzt wird. Außerdem möchten wir dazu beitragen, dass unsere MitarbeiterInnenZufriedenheit <strong>und</strong> Erfüllung bei ihrer Arbeit finden.FührungsqualitätenWir wollen auf jeder Hierarchiestufe Führungskräfte fördern, die Verantwortung übernehmen für das Erreichen unserer Unternehmensziele <strong>und</strong>unsere Gr<strong>und</strong>werte personifizieren.Gesellschaftliche VerantwortungErfolg im Geschäftsbereich durch gesellschaftliches Engagement. Eine gute Einbindung in die Gesellschaft ist gut für das Unternehmen. Wirkommen unseren Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft nach, indem wir uns an jedem unserer Standorte in der Welt als wirtschaftliche,geistige <strong>und</strong> soziale Institution etablieren.© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006web-access 31.03.2009
ZielerreichungBewertungsgröße:Erreichung der <strong>Organisation</strong>szieleVorteile:✔ZielkongruenzNachteile:✘Messung✘Zielkonflikte© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Zielbildung in <strong>Organisation</strong>enInteressensgruppen formulierenZiele für die<strong>Organisation</strong>KerngruppeautorisiertZiele der<strong>Organisation</strong>FormalzieleKonkretisierung imPlanungsprozessSachziele© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Interessensgruppen (Stakeholder)Gruppe Ziele ee SanktionsmöglichkeitenteEigentümer Gewinn, Entzug des EigenkapitalsExistenzsicherung Wechsel des ManagementsAbi Arbeitnehmer Einkommen ik Streik, Motivation, i KündigungSicherheit, ArbeitsplatzgestaltungGläubiger Zinsen, Sicherheit Fälligstellung/Nichtverlängerungvon Krediten, KonkurseröffnungK<strong>und</strong>en Preis,Qualität nicht kaufen, negative InformationenService, Termine rechtliche Schritte KonditionenLieferanten Absatz, Lieferstopp, EigentumsvorbehalteZahlungKonditionenStaat Umwelt rechtliche SanktionenBeschäftigungEntzug von FörderungenNachbarn Umwelt Boykotte, Aktionen, rechtliche Schritte© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
EffektivitätsdimensionenBetrachtungsebeneIntern/mikro Extern/makroHuman RelationsOffenes SystemenbilitätnschafteFlexibureigentStruktuSt tabilitätZiele: Entwicklung derMitgliederMittel:Zusammenhalt,EinstellungenInterne ProzesseZiele: Stabilität, KontrolleMittel:Informationssysteme,KommunikationZiele: Wachstum, Erwerb vonRessourcenMittel:FlexibilitätRational-zielorientiertZiele: Produktivität, EffizienzMittel:Planung, ZieleQuinn/Rohrbaugh, h 1983© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Effizienz von <strong>Organisation</strong>enInputs Transformationsprozess OutputsRessourcenansatz Prozessansatz ZielerreichungsansatzEffizienz einer <strong>Organisation</strong>wird an ihrer Fähigkeitgemessen, die benötigten t Inputszu erhaltenEffizienz einer <strong>Organisation</strong>wird daran gemessen, wie gutder TransformationsprozesserfolgtEffizienz einer <strong>Organisation</strong>wird idan ihren Outputs t gemessen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Prozessbezogene EffizienzkriterienKoordination (Frese)– KoordinationseffizienzMotivation (Frese)– MotivationseffizienzAnforderungskompatibilität Stelle-Mitarbeiter (Laux)– Kalkülkompatibilität– Informationskompatibilität© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
KoordinationseffizienzKoordinationseffizienzVermeidung vonAutonomiekosten bwz.Verbesserung derEntscheitungsqualitätVermeidung vonAbstimmungskosten bzw.Vermeidung von Entscheidungs<strong>und</strong>KommunikationskostenVerbesserung derInformationsbasisVerbesserung derMethodenbasisVermeidung vonVermeidung von(Know-how) beider Informations-verarbeitungKosten desEinsatzes vonRessourcenKosten desEinsatzes vonZeitFrese, 1993, S 296© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
KoordinationseffizienzZerlegung g vonEntscheidungenSegmentierungStrukturierungWelcheWelcheIn welchem Maße erfolgt eineInterdependenzen Potentiale werdenhierarchische Aufspaltung vonentstehen? getrennt? Entscheidungen?ProzeßeffizienzRessourcen-effizienzMarkteffizienzDelegationseffizienznach Frese, 1993, S 299© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
KoordinationseffizienzAutonomiekosten verursachendeEinflussfaktorenEffizienzkriterienMarktinterdependenzenRessourceninterdependenzeninterne LeistungsverflechtungenRessourcenpotentialMarkteffizienzProzeßeffizienzRessourceneffizienzMarktpotentialDelegationseffizienzhierarchische Aufspaltung© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
MotivationAnpassung an Ziele desIndividuumsZiele desIndividuumGemein-sameZielvorstellungenZiele der<strong>Organisation</strong>Anpassung an Ziele der<strong>Organisation</strong>© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
MotivationseffizienzMotivationseffizienz:iVermeidung von Verlusten aufgr<strong>und</strong> abweichender Ziele der MitgliederAutonomieeffektPositionierungseffektEntbürokratisierungseffektti i ktGruppierungseffekt© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006 nach Frese, 1993
AnforderungskompatibilitätEigenschaften desAufgabenträgers :Eigenschaften derAufgabe: Ressourcen Qualifikation Strukturiertheit Variabilität Umfang Komplexität© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 200676
QualifikationKalkülkompatibilität"… ist das Ausmaß der Übereinstimmung zwischen der Fähigkeit(bzw. den Möglichkeiten) eines Entscheidungsträgers,gInformationen (mit Hilfe von Entscheidungskalkülen) zuverarbeiten, <strong>und</strong> der Bedeutung, dem Umfang <strong>und</strong> derKomplexität der ihm übertragenen Entscheidungsprobleme."(Laux/Liermann, 1993)© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 200677
QualifikationInformationskompatibilität"… ist das Ausmaß der Übereinstimmung zwischen demInformationsstand eines Entscheidungsträgers (überHandlungsalternativen lt ti <strong>und</strong> deren Konsequenzen) bzw.dessen Fähigkeit (<strong>und</strong> Möglichkeiten), Informationeneinzuholen <strong>und</strong> zu speichern, <strong>und</strong> demjenigenKenntnisstand, der im Rahmen des jeweiligenAufgabengebietes für das Treffen "guter" Entscheidungenerforderlich ist."(Laux/Liermann, 1993)© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 200678
Übersicht EffizienzkonzepteMotivationseffizienz(Gestaltung von Feinstruktur):• Autonomieeffekt• Positionierungseffekt• Bürokratisierung• GruppierungseffektKoordinationseffizienz(Gestaltung von Grobstruktur):• Markteffizienz• Prozesseffizienz• Ressourceneffizienz• DelegationseffizienzKompatibilität(Fit Stelle & Inhaber):• Anreizkompatibilität (WOLLEN)• Anforderungskompatibilität (KÖNNEN)Zielansatz(Fit Struktur & Ziele):• Zielerreichungsansatz• Stakeholder-Ansatz• Competing Values© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Organisatorische GestaltungsvariablenGestaltungsvariablenAufbauorganisationAblauforganisationRegelt:Wer ist wofürzuständig?Wer darf wemAnweisungen erteilen?Regelt:Was hat in welcherReihenfolge wie <strong>und</strong> wozu erfolgen?© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Aufgabenverteilung3.1 <strong>Organisation</strong>sstrukturen3.1.1 Gr<strong>und</strong>lagen3.1.2 Gliederungsprinzipien <strong>und</strong> <strong>Organisation</strong>sstrukturen32 3.2 <strong>Personal</strong>wirtschaft3.2.1 <strong>Personal</strong>bedarf3.2.2 <strong>Personal</strong>auswahl© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
<strong>Organisation</strong>sgestaltungGr<strong>und</strong>konzeptArbeitsteilungKoordinationsbedarfGestaltungsaufgabe• Wie weit sollen Aufgaben zerlegtwerden? (Gr. d. Differenzierung)• Nach welchen Kriterien?(Struktur)• Wie werden Entscheidungengetroffen? (Delegation)• Wie werden Entscheidungenverschiedener Personenkoordiniert? (Koordination)Hierarchie • Wie kann rollenkonformesVerhalten der <strong>Organisation</strong>smitgliedererreicht werden?(Motivation)© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Beispiel: Hämmerle Kaffee© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 200683
Beispiel: Basler Versicherung© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006Stand April 201084
Beispiel:© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 200685
Beispiel: Reinhold & Mahla AG© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Beispiel: Bayer (108.000 MA)© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006Stand April 201087
Beispiel: Götz-Schmidtverlag (DE)© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006Stand April 201088
Beispiel: Pfadfinder Lagerorganisation© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 200689
DualproblemOrganisatorischeDifferenzierungOrganisatorischeIntegration© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
AufgabenverteilungGesamtaufgabeAufgabenanalyseTeilaufgabenAufgabensyntheseStellenAbteilung© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Aufgabenanalyse BeispielBereitstellen vonFahrzeugen fürden MarktForschen <strong>und</strong>entwicklenBeschaffen Fertigen Absetzen VerwaltenVorfertigen Hauptfertigen MontierenSchleifen Schweißen Fräsen Bohren Schrauben© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006 Schreyögg 2008
Beispiel Aufgabenstrukturblatt© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006 Zingel 2002
Fragen der Aufgabenverteilung‣KlassifikationNach welchen Merkmalen können Aufgabenunterschieden werden?‣Grad der Differenzierung (Spezialisierung)Wie weit sollen Aufgaben zerlegt werden?‣KriterienAuf welche Art sollen Aufgaben zerlegt werden?© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Klassifikation von AufgabenStrukturiertheit(Bekanntheit von Inputs, Outputs <strong>und</strong> Lösungsweg)Variabilität(Konstante Inputs, Outputs, TransformationsprozesseHäufigkeitÄhnlichkeithk itzwischen mehreren Aufgaben (Synthese)© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Strukturiertheit <strong>und</strong> VariabilitätniedrigStrukturiertheithochVariab bilitäthoch h nied drigwenig strukturiertstabilBsp.: Kunsthandwerkwenig strukturiertvariabelBsp.: Forschunghoch strukturiertstabilBsp.: Massenproduktionhoch strukturiertvariabelBsp.: Bauunternehmen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Aufgaben-synthese© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Einflussgrößen Grad der DifferenzierungVerringerteQualifikations-anforderungenKurzeEinarbeitungszeitLerneffekteDifferenzierung(Spezialisierung)Monotonie DemotivationeinseitigeBelastungKoordinationsaufwandGrößeVariabilität© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
IT & Re-Integration von FunktionenFragmentierter ProzessLieferantEntwicklung Konstruktion Einkauf Fertigung Versand Verkauf ServiceK<strong>und</strong>eIntegrierter ProzessProduktentwicklungProduktbereitstellungK<strong>und</strong>enbetreuungRockart/Short, t 1991© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Integration - BeispielTraditionelle Struktur (Financial Management)Unterstützung1336455Fachkräfte 9243-AnalyseStrategiet Integrierte Struktur (Financial Management)Handelallg.VerwaltungUnterstützungFachkräfte912 Fachleute, 3 EDV-SystemeHandel83Portfolio-managemt.PortfolioaufbauStrategieentwicklungK<strong>und</strong>enverwaltungVenkatraman, 1991© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Kriterien der Aufgabenanalyse <strong>und</strong> -syntheseVerrichtungenObjekte– Produkte– K<strong>und</strong>engruppen– RegionenArbeitsmittel (Maschinen)Rang (Entscheidung & Ausführung)Prozessphase (Planung, Realisierung & Kontrolle)© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Darstellung: OrganigrammUnterstellung(Hierarchische Beziehung)InstanzStabstelleKoordinierende/beratende FunktionFayol’scheBrückeAusführendeStellenAbteilung© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
AufgabenverteilungNach FunktionenNach Objekten(Produkte)Funktionale Funktions- Produkt-Divisionale<strong>Organisation</strong> management management <strong>Organisation</strong>© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Funktionale <strong>Organisation</strong>sstrukturUnternehmens-leitungBeschaffung Produktion VertriebForschung& EntwicklungSchnittstellen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Beispiel: Hämmerle Kaffee© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006105
Divisionale <strong>Organisation</strong>sstrukturUnternehmensleitungProduktgruppe 1 Produktgruppe 2 Produktgruppe 3B P V B P V B P VRessourcen?© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Beispiel: Bayer AG (Konzern-Holding); 2008Group Management Board:Chairman; Strategy & HumanRessources; Finance; Innovation,Technology & EnvironmentBayerHealthCareBayer CropScienceBayerBayerBayerMaterial Business TechnologyScience Services ServicesCurrentaITHumanRessources© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
FunktionsmanagementUnternehmensleitungZentralesControllingZentraleF & EEuropa USA Asien© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
ProduktmanagementUnternehmensleitungProdukt-ManagementZentraleF & EBeschaffung Produktion Vertrieb© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Formen internationaler UnternehmenstätigkeitGlobale Unternehmung:Einheitliche Produkte weltweit angebotenZiel: Effizienz durch economies of scaleMultinationale Unternehmung:Spezifische Produkte für regionale TeilmärkteZiel: optimale Anpassung an nationale MärkteInternationale Unternehmung:Regionale Anpassung zentral entwickelter TechnologieZiel: Synergie in Forschung & EntwicklungTransnationale Unternehmung:Ziel: Verbindung aller EigenschaftenBartlett/Goshal, l 1987© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Globale UnternehmungUnternehmensleitungF&EProduktionRegion 1 Region 2 Region 3Vertrieb Vertrieb Vertrieb© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Multinationale UnternehmungUnternehmensleitungRegion 1 Region 3F&E Prod. Vertrieb F&E Prod. VertriebRegion 2F&E Prod. Vertrieb© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Internationale UnternehmungUnternehmensleitungF&ERegion 1 Region 2 Region 3Prod. Vertrieb Prod. Vertrieb Prod. Vertrieb© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Konzept transnationaler UnternehmungEffizienz Anpassung TransferGlobaleMultinationaleInternationaleUnternehmung Unternehmung UnternehmungTransnationaleUnternehmung© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
<strong>Organisation</strong>sformenWelche dieser alternativen <strong>Organisation</strong>sformen istbesser?Abhängig von der Strategie des Unternehmens:Chandler: „Structure follows Strategy“Beurteilung: Vergleich der Effizienzkriterien– Koordinationseffizienz– Motivationseffizienzi i© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Vergleich Effizienzkriterien (1)Effizienz- funktionale <strong>Organisation</strong> divisionale <strong>Organisation</strong>KriterienProdukte, K<strong>und</strong>engruppen,RegionenProzess-• Ressourceninter- • Berücksichtigung voneffizienzdependenzenLeistungsverflechtungenRessourceneffizienzMarkteffizienzDelegationseffizienz• Leistungsverflechtungen• Ressourcen-Pooling• Spezialisierungsvorteile• Göß Größendegressionsvorteileil• Berücksichtigung vonMarktinterdependenzen• Bündelung von Nachfrage• geringere Autonomiekosten• Abstimmungskosten (vertikalerInformationsaust.)• Überlastung der oberenEbenendurch autonome Bereiche☺ • Red<strong>und</strong>anz• Zentralbereiche könnenRessourceneffizienz i erhöhen☺ bei Produkt-Divisionen(homogene Produkte):• SubstitutionskonkurrenzVerzicht auf Synergieeffektebei regionalen Divisionen:• Nutzung von Synergien <strong>und</strong>Berücksichtigung vonInterdependenzen• fehlende Problemumsicht –höhere Autonomiekosten• geringeregAbstimmungskosten☺☺© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Vergleich Effizienzkriterien (2)Effizienz-KriterienMotivationseffizienzfunktionale <strong>Organisation</strong>• wenig Autonomie• Gefahr der Bürokratisierung<strong>und</strong> Kontrolle• Hoher GradananDifferenzierung(Spezialisierung) <strong>und</strong>Monotonie• NiedrigePositionierungseffekte (wenigdirektes Feedback durch denK<strong>und</strong>en)divisionale <strong>Organisation</strong>Produkte, KG, Regionen• Autonomie(Entscheidungsdelegation andie Bereiche)• Entbürokratisierungseffektebei autonomen Teilbereichen• PositivePositionierungseffekte• Gruppierungseffekte durchbreites Anforderungsprofil☺© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
MatrixorganisationleonnktionaganisatioFuOrgtFunktionsbezogeneSichtweiseeinfache Unterstellungmehrfache hf hUnterstellungProduktbezogeneSichtweiseiFun nktionsagemenmanaMat trixisationorganiProdu uktmentmanagealetionDivisionarganisatDOreinfache UnterstellungFord/Randolph, d 1992© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
MatrixorganisationULF u n k t i o n e nO b j e k t eStellen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Beispiel: Götz-Schmidtverlag (DE)© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006Stand April 2010120
ProjektorganisationFunktionale Bereicherojekte Pr© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
MatrixorganisationVorteileNachteileBessere InformationFlexiblerer RessourceneinsatzHöhere ProblemlösungsfähigkeitReicheres ArbeitsumfeldEntwicklung von TeamfähigkeitZusätzliche StrukturenUnklare Verantwortlichkeittli itKoordinationsaufwandKompromisseAutoritätsverlustVerunsicherungFord/Randolph, d 1992© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Aufgabenverteilung <strong>und</strong> <strong>Personal</strong>managementAufgabenverteilungStellenAnforderungenAnforderungenAnforderungenQualifikationen<strong>Personal</strong>management Personen QualifikationenQualifikationen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
<strong>Personal</strong>beschaffung <strong>und</strong> Einsatzplanung<strong>Organisation</strong>sstruktur(Stellen)gplanunPe ersonalb bedarfsPerso onalbest tand<strong>Personal</strong>einsatzplanung© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
<strong>Personal</strong>bedarfQuantitativ:wie viele PersonenQualitativ:welche QualifikationenZeitlich:wann?Örtlich:in welchen Bereichen, Abteilungen...?© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
<strong>Personal</strong>bedarf quantitativLeistungsprogrammStrukturEffizienzIstbestandabsehbareVeränderungen<strong>Personal</strong>einsatzbedarf+ Reservebedarf= Bruttobedarf+/- fortgeschriebenerBestand© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006© Univ.Prof. Dr.= Nettobedarf<strong>Personal</strong>beschaffung<strong>Personal</strong>enwicklungOutplacementt<strong>Personal</strong> <strong>und</strong>Führung 12<strong>Personal</strong> <strong>und</strong> Führung
BruttobedarfgeplantesLeistungsprogrammMethoden:Summarische Methoden:erfahrungsbasiertAnalytische Methoden:Aufgaben <strong>und</strong> Zeitstudien;Prozessanalyse, ZeitbedarfBerechnungsmodell Tätigkeit, geplanter OutputStatistische Methoden: multiple,nicht-lineareRegressionsmodelle,Trendschätzungen<strong>Personal</strong>bedarf© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006© Univ.Prof. Dr. <strong>Personal</strong> <strong>und</strong> 12
Summarische Methoden– Schlüsselzahlen/Kennzahlenz.B. Verhältnis ProfessorInnen zu StudentInnen– Leitungsspannez.B. Ideale Leitungsspanne = 6– BenchmarkingVergleich mit anderen Unternehmen der gleichen Branche– Expertenbefragung (einfach oder nach Delphi)Befragung von z.B. Betriebs- oder AbteilungsleiterInnen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006© Univ.Prof. Dr. <strong>Personal</strong> <strong>und</strong> 12
Analytische MethodeGr<strong>und</strong>strukturPBm⋅t=PB: <strong>Personal</strong>bedarfm: Anzahl Leistungseinheiten =Tdurchschn. Anfall d. Aufgabe (geplanter Output)t: Zeitbedarf/LeistungseinheitT: Arbeitszeit pro PersonMehrere Leistungsarten (Aufgabenkategorien) m in∑PB: <strong>Personal</strong>bedarf( mi⋅ ti)m i : Anzahl Leistungseinheiten der Kategorie i= 1 t i : Zeitbedarf/Leistungseinheit der Kategorie iT: Arbeitszeit pro PersonPBi=T© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006© Univ.Prof. Dr. <strong>Personal</strong> <strong>und</strong> 12
RegressionsmodellePers sonalbe edarfP =i x iEinflussgröße(n)© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Vor- <strong>und</strong> Nachteile der MethodeSummarischeAnalytischeRegressions-VerfahrenVerfahrenmodelle• exakt• allgemeine• empirischerErfahrungs- <strong>und</strong> • zeit- <strong>und</strong> kostenaufwendigZusammenhangRichtwerte• einfach• vergangenheits-orientiert• nebenWirtschaftlichkeitauch andere Ziele• Koeffizienten ausproduktionstechn.Wissen (Prozesse)• deterministisch• ausschließlich aufWirtschaftlichkeitausgerichtet• Koeffizientenstatistischgeschätzt• Unsicherheitberücksichtigt• erforderthistorische Daten© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006© Univ.Prof. Dr. <strong>Personal</strong> <strong>und</strong> 13
Brauche ich die Besten/die Richtigen?Deutschland-Geschäftsführer von Mercuri Urval Albert Nussbaum gab den Geschäftsführern statt guterTipps Stoff zum Nachdenken mit: … "Brauche ich die Besten oder brauche ich die Richtigen? Stehenvielleicht formale Anforderungen zu sehr im Vordergr<strong>und</strong>? Liegt der Erfolg nicht in der Passung? Istwirklich das Maximum gefragt, oder geht es um das Optimum?" Oft, so Nußbaum, würden dieFachvorgesetzten falsch denken <strong>und</strong> nach dem "Maximum" verlangen. Das erzeuge Extreme imUnternehmen. … Also was tun, kam die Frage. "Nach normalen Sterblichen suchen <strong>und</strong> wissen, das LichtSchatten erzeugt", so die Antwort. Schnelle seien tendenziell fehleranfällig, Extravertierte könntentendenziell nicht so gut zuhören, erinnert Nußbaum daran, dass W<strong>und</strong>erwuzzis mehr Mystifikation dennRealität sind. Die Gretchenfrage nach den Kernkompetenzen der Zukunft beantwortete er so: "Wenn dieWelt morgen nicht mehr so ist wie heute, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir Leute haben, diemitgehen können". Also: Abschied von statischen Modellen. Konkret im Kanon der Zukunftskompetenzenunter anderem: Belastbarkeit, Sprachen, kulturelle Fähigkeiten, Intelligenz <strong>und</strong> Offenheit,Lernfähigkeit <strong>und</strong> -wille, IT-Kompetenzen.Psychologische EntscheidungskriterienHarten Stoff lieferte Nußbaum, als er an die Psychologie erinnerte <strong>und</strong> Untersuchungen der Mercuri-Urval-K<strong>und</strong>en auf vier Kontinenten präsentierte: Tatsächlich würden sich Bewerber aufgr<strong>und</strong> sympathischerVorgesetzter, interessanter Aufgaben <strong>und</strong> wirtschaftlicher Stärke des Unternehmens entscheiden.Arbeitgeber aufgr<strong>und</strong> von Sympathie, passender Ausbildung <strong>und</strong> Leistungsfähigkeit. Nußbaum: "Dawerden dann Anforderungsprofile geändert, Präferenzlisten auf den Kopf gestellt." Man neige eben dazu,sich zu klonen. "Mini me"-Syndrom nennen diesen menschlichen Faktor andere Berater. Ob diesermenschliche Faktor letztlich auch darüber entscheidet, wer geht?(Karin Bauer, DER STANDARD, Printausgabe, 2./3.5.2009)2009)© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006© Univ.Prof. Dr. <strong>Personal</strong> <strong>und</strong> 13
Fragestellungen qualitativer <strong>Personal</strong>bedarfQualifikationsniveauSind besser ausgebildete Mitarbeiter besser für den Job?Sind besser ausgebildete Mitarbeiter die zusätzlichen Kosten wert?Wie sieht der Trade-off zwischen Qualität <strong>und</strong> Quantität aus?Wie qualifiziert ist “hoch qualifiziert”?QualifikationsprofileWelches Qualifikationsniveau kommt für einen bestimmten Arbeitsplatzin Frage?Wie sollen die notwendigen Fähigkeiten definiert werden?Geht es um die formale Ausbildung oder gibt es sinnvolle andereKriterien?© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
ProduktivitätEffizienz=====OutputInputOutput/ZeitInput/ZeitProduktivitätLohnsatz© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Beispiel ProduktivitätTyp A: Hohe ProduktivitätUmsatz: 100.000 €/MonatLohnkosten: 9 €/St<strong>und</strong>eTyp B: Geringe ProduktivitätUmsatz: 70.000 €/MonatLohnkosten: 6 €/St<strong>und</strong>eLohnkosten/Monat:9 * 8 * 20 = 1.440Mitarbeiter für 700.000 Umsatz:700.000000 / 100.000 000 = 7Lohnkosten gesamt:7 * 1.440 = 10.080Lohnkosten/Monat:6 * 8 * 20 = 960Mitarbeiter für 700.000 Umsatz:700.000000 / 70.000 000 = 10Lohnkosten gesamt:10 * 960 = 9.600100.000000 70.000000= 11.111 < 11.666 =96© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
AnforderungsprofileGenfer SchemaREFA SchemaBeispieleKönnenVerantwortungBelastungKenntnisseGeschicklichkeitVerantwortunggeistige Belastungphysische BelastungAusbildung, ErfahrungHandfertigkeit, etc.Für eigene Arbeit, Arbeitanderer, für Sicherheit, etc.Aufmerksamkeit, Denktätigkeitdynamisch, statisch, einseitigStaub, Lärm, Hitze, Schmutz,Umgebungseinflüsseg Umgebungseinflüsseg Nässe, Dämpfe, Unfallgefahr, etc.Scholz, 2000© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
<strong>Personal</strong>beschaffung – Auszug aus einem GesprächsprotokollMaier: Ich finde, wir sollten einfach mit einem hohen Gehalt werben. Dann bewerben sich vielequalifizierte Leute, <strong>und</strong> wir suchen uns die besten davon aus.Huber: Nette Idee, aber sie kostet viel. Ich finde wir sollten lieber niedrige Einstiegsgehälter bieten<strong>und</strong> denen, die im Job gute Ergebnisse bringen, später mehr zahlen.Bauer: Klingt beides gut. Wie wäre es, wenn wir einfach ein bestimmtes Qualifikationsprofil inunserer Stellenanzeige fordern <strong>und</strong> dann zahlen, was nötig ist, um die Leute zubekommen?Huber: Auch nicht schlecht, aber der Vorteil meines Ansatzes besteht darin, dass wir nur denenmehr zahlen, die wirklich was leisten – nicht denen, die wir dann eh wieder entlassen.Maier: Aber wer wird für so ein niedriges Einstiegsgehalt arbeiten? Nur so Pfeifen, die sonst nichtsfinden. Wenn wir Top-Leute wollen, müssen wir von Anfang an gescheit zahlen.Bauer: Vielleicht, i aber wenn wir Super-Gehälter anbieten, wird sich die halbe Welt bei unsbewerben. Damit verstopfen wir unser <strong>Personal</strong>büro. Außerdem: woher sollen wir wissen,wen aus so einer Riesenmenge von Bewerbern wir am besten gebrauchen können?Huber: Wie wäre es, wenn wir überhaupt einen Stücklohn zahlen? Die, die nicht viel für uns bringenverdienen dann überhaupt wenig ….© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006Aus: Wolf/Lazear (2001)
<strong>Personal</strong>beschaffungWo können wir geeignete Mitarbeiter finden?Wie kann ein Unternehmen unerwünschte Bewerbungenaussondern <strong>und</strong> gleichzeitig Interviewkosten begrenzen?Wie kann man ungeeignete Leute von einer Bewerbung abhalten?Wie können wir herausfinden, ob Bewerber geeignet sind?Sollte ein hohes oder niedriges Einstiegsgehalt geboten werden?Sollte es eine Probezeit geben? Wenn ja, wie hoch soll der Lohnwährend dieser Zeit sein? Wie hoch sollte die Gehaltssteigerunganschließend sein?Sollten wir leistungsabhängige Löhne (Stücklohn) oder Zeitlöhneanbieten?© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Beispiel: Studie IG Metall (2006)45 großen Firmen verschiedener Branchen, darunterElektro-, IT-, Telekommunikations- <strong>und</strong> MaschinenbauEinstiegsgehälter nach Studienrichtung:– Ingenieure, Informatiker <strong>und</strong> Naturwissenschaftler zwischen38.383 <strong>und</strong> 46.340 Euro.– Betriebs- <strong>und</strong> Volkswirte zwischen 35.321 <strong>und</strong> 45.223 Euro.© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006139
Einstiegsgehälter MaschinenbauLaut einer Gehaltsstudie des VDI (Verein Deutscher Ingenieure) 2006verdienen Ingenieure im Maschinenbau im Schnitt 51.100 EuroIngenieur-Sachbearbeiter: 42.900 EuroProjektingenieur: 46.400 EuroProjektmanager: 56.200 EuroGruppenleiter: 59.700 EuroAbteilungsleiter 64.000 EuroBereichsleiter: 75.400 EuroHochschulabsolventen steigen laut VDI mit 37.600 Euro ein.Spannbreite der erhobenen Gehälter liegt zwischen 34.000 <strong>und</strong>41.600 Euro© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Ingeneurkarriere.de (2005)© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006141
Einstiegsgehälter (Spiegel online 2006)© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Beispiel: Jahresgehälter I&K BrancheJahresgehälter nach dem Studium mit Berufserfahrungmit FührungsverantwortungMarketing 58.753 65.284 96.682682Beratung 57.247 69.109 98.640Software-Entwicklung 45.183 55.208 80.640Vertrieb 39.771 53.053 130.619Projekt-Management 53.429 85.853Variabler Gehaltsbestandteil Gesamt Fix VariabelVertriebsbeauftragter 83.833 56.423 33%Marketing-Spezialist 65.284 54.745 16%Projekt-Manager 53.429 48.903 8%Projekt-Manager, Leitung 85.853853 68.989 20% Studie aus 2006:Junior-Berater 42.881 40.297 6% 26.000 MA in 52Beratung, Leiter 98.640 79.393 20% Unternehmen(Quelle:Software-Entwicklung, Einsteiger 45.183 43.445 4%Süddeutsche.de,Software-Entwicklung, Leiter 100.752 79.441 21%Mai 2009)© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006143
Externer vs. interner ArbeitsmarktExterner ArbeitsmarktInterner ArbeitsmarktNeue IdeenGeringes Risiko Fachkenntnisse gut Schnelles Verfahrenspezifizierbar Kenntnisse interner AbläufeInformationen über Konkurrenz Motivation Image GeringeKostenAuswahlmöglichkeitenli hk it Fluktuationsgefahr Fehlende FachkenntnisseUnsicherheitRivalitäten Fehlende Betriebskenntnisse "Beförderungsautomatik"nach Scholz, 2000, S.394© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Wie findet man geeignete Arbeitskräfte?Asymmetrische Information:Arbeitnehmer (Bewerber)Arbeitgeber (Unternehmen)●●Kenntnisse <strong>und</strong>FähigkeitenBereitschaft, dieseeinzusetzen●●Anforderungen derStellelangfristige Entwicklungdes Unternehmens© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Asymmetrische InformationInformationsbeschaffung– Auswahlverfahren– ProbezeitSelf Selection© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
<strong>Personal</strong>beschaffung: AblaufSucheVorauswahlEndauswahlEinstellung© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
<strong>Personal</strong>sucheStellenanzeigenArbeitsamtVermittlerdirekte AnwerbungInternetScholz, 2000© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
<strong>Personal</strong>suchedirektKontaktindirektBew werberaktivpass siv●●●AnwerbungStellenanzeigenInternet●●●●Head HunterArbeitsamtVermittlerAbit Arbeitsamtt© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Vorauswahl - ScreeningFormale VoraussetzungenBewerbungsunterlagen– Bewerbungsschreiben– Lebenslauf– ZeugnisseAusbildungFragebögenFrühere Tätigkeiten© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Endauswahl - Einstellungsinterview• Freies Interview vs. (teil-)strukturiertes Interview• Verschiedene Fragemethoden (Zirkuläre Fragen,Methode der kritischen Ereignisse, etc.)• Verschiedene Arteneinzeln Jury GruppenInterviewerBewerberIn© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006© Univ.Prof. Dr. <strong>Personal</strong> <strong>und</strong> 15
Interview: Probleme• Primacy-Effekt• Halo-Effekt• Projektion (= “Mini me”-Effekt)• Stereotypen• Realnormierte Messung• Kontrast-Effekt Sehr niedrige Prognosevalidität (Stehle 1980): 0,0000 – 025 0,25© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
EinstellungstestsPersönlichkeitstests– Subjektiv, objektiv, projektiv Prognosevalidität (Stehle 1980): 0,20 - 0,40Fähigkeitstests– Leistung– Konzentration & Aufmerksamkeit– Intelligenz Prognosevalidität (Stehle 1980): 0,10 - 0,30© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006© Univ.Prof. Dr. <strong>Personal</strong> <strong>und</strong> 15
Assessment CenterMehrere BewerberMehrere BeobachterVorgegebener Ablauf mitmehreren Aufgabenstellungen:– Fallstudien– "In-Basket"– Gruppendiskussionen– Interviews– Präsentationen Relativ hohe Prognosevalidität (Stehle 1980): 0,40 – 0,70© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Dimension X Assessment Methode MatrixDimensionZwischenmenschlichesVerhaltenLeistungsverhaltenIntellektuelleFähigkeitenMotivationsfähigkeitEntscheidungsverhaltenÜberzeugungsfähigkeitLeistungsmotivationWerte/ /InteressennAuswahl vonmind. 2 qualitative Methoden jeDimensionPsych.TestsSensibilitätDurchsetzungTeamfähigkeitAusdauerZielsetzungenEnergiBelastebarkeitAnalysefähigkeitKreativität<strong>Organisation</strong>Intelligenztests x xLeistungstests x x x x xPersönlichkeitstests x x x x x x x x x xGruppendiskussion x x x x x x x x x xPräsentationen x x x xRollenübungen x x x x x x x x x x xVideo‐Simulationen x x x xFallstudien x x x x x x x x x x xWirtschafts‐/Planspiele x x x x x x x x x x x x xAC‐SimulationPostkörbex x x x x x x© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006Adaptiert von Weinert, 2004
<strong>Personal</strong>auswahlZiel =- gewünschte MA anzuziehen- nicht gewünschte MA so effizient wie möglich auszusortierenUmgang mit Problem der asymmetrischen Information:Informationsbeschaffung– Auswahlverfahren– ProbezeitSelf Selection© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Wirtschaftlichkeit von EinstellungstestsOhne Einstellungstestp Wahrscheinlichkeit MA qualifiziertp q qg q1 p qv ug qGewinn, wenn MA qualifiziertMit Einstellungstestt t v uVerlust, wenn MA unqualifiziertg qcc Kosten des TestsTest vorteilhaft wenn ...g q c >p q g q 1 p q v u➢ Wahrscheinlichkeit unqualifizierthochc
Probezeit BeispielMr. Right: 120.000/Jahr Gewinn mit SicherheitMrs. Risk: 300.000000 oder -100.000; 000; p=0 0.5Vergleich: mit/ohne Probezeit, Vergleich 1 u. 3. JahreOhne ProbezeitMit Probezeit:900.000 900.000t=3 geeignett=3geeignett=2t=2t=1300.000t=1© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006- 100.000000ungeeignetg- 300.000ungeeignet-100.000
Self SelectionAdverse Selection… tritt auf, wenn durch bestimmte Verfahrensweisensystematisch die falsche Art von Mitarbeiternangezogen, die gewünschte Zielgruppe aber nichterreicht wird.© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Self Selection: StücklohnVorteil für Qualifizierteo qwzo qProduktivität qualifizierto uProduktivität unqualifiziertz Alternativlohnsatz (Zeitlohn)Alternative ti Beschäftigungw Sü StücklohnAngebot StücklohnNachteil für Unqualifiziertezo wzuw zo qo uAlternative BeschäftigungAngebot tStücklohnProblem: Monitoring-Kosten!© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Self Selection: ProbezeitVorteil für Qualifiziertew 1T 1 w 2T w qAlternative Besch.Nachteil für UnqualifizierteNach ProbezeitProbezeitw 1T 1 1 p w 2p w T ww qw uw 1w 2TpAlternativlohnsatz qualifiziertAlternativlohnsatz unqualifiziertLohn ProbezeitLohn danachBeschäftigungsdauerEntdeckungswahrscheinlichkeitAlternative Beschäftigungw 1T 1 1 p w 2p w uT w u Entlassung nach ProbezeitWeiterbeschäftigungProbezeitT w qT 1 w 2w 1T T 1 p w uT 1 1 p w 2© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Self Selection: ProbezeitT w qT 1 w 2w 1T T 1 p w uT 1 1 p w 2w 1T w qqualifiziertT T 1 p w umögliche Kombinationenunqualifiziert© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006w 2
Self Selection: Probezeit, sichere EntdeckungT w qT 1 w 2w 1T T 1 p w uT 1 1 p w 2w 1p 1:T w qT 1 w 2w 1w uT w qmögliche Kombinationenw u© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006w 2
Self Selection: Probezeit, keine EntdeckungT w qT 1 w 2w 1T T 1 p w uT 1 1 p w 20 T T 1 T T 1w 1p 0:T w qT 1 w 2w 1T w uT 1 w 2T w qT w u© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006w 2
ZusammenfassungZiel der <strong>Personal</strong>auswahl ist gewünschte MA anzuziehen <strong>und</strong> die Zahlder nicht gewünschte MA so effizient wie möglich auszusortierenMethoden– Screening von Qualifikationsnachweisen: dann effizient wennReferenz für qualifizierte leicht zu erwerben ist <strong>und</strong> für andere nicht.– Leistungsabhängige Verträge (Self Selection)– Probezeit mit niedrigerem Gehalt: dann effizient wenn wenigqualifizierte kaum Chancen haben, während der Probezeitunentdeckt zu bleibenUnternehmen mit Probezeit <strong>und</strong> leistungsabhängiger Entlohnungziehen leistungsstärkere MA an, müssen aber höhere Löhne zahlen.© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Steuerung dezentraler Stukturen4.1 Koordination4.1.1 Weisungsrechte4.1.2 Koordinationsmechanismen4.2 Motivation4.2.1 Gr<strong>und</strong>lagen4.2.2 2 Motivationstheorien4.2.3 Anreizsysteme4.2.4 Variable vs. fixe Entlohnung4.2.5 Entlohnungsformen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
KoordinationArbeitsteilungHorizontal:Zerlegung vonausführenden AufgabenAufgabenverteilungVertikal:Trennung vonEntscheidung <strong>und</strong>AusführungVerteilung vonEntscheidungsrechtenZuordnung derEntscheidungsaufgabenVerteilung vonWi WeisungsrechtenEinfluss auf Entscheidungs-<strong>und</strong>ausführende Aufgaben andererStellen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
KoordinationVerteilung vonEntscheidungsrechtenhid hVerteilung vonWeisungsrechten?? ?EntscheidungAusführung© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Verteilung von WeisungsrechtenEinliniensystemStab-Linien-SystemMehrliniensystem© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
14 Prinzipien von Henri Fayol (1916)(1) Arbeitsteilung(8) Zentralisationti(2) Formale Autorität(9) Hierarchie(3) Disziplin(4) Einheit etder Kontrolleto (10) Ordnung(11) Soziale Gerechtigkeit(Unity of Control)(12) Loyalität der Mitarbeiter(5) Einheit der Auftragserteilung(13) Initiative(Unity of Command)(14) Gemeinschaft(6) Unterordnung(sprit de corps)(7) Faire Entlohnung© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Einliniensystem: Henry FayolKlare BefugnisseLanger InstanzenzugHohe Belastung der InstanzenFayol'scheBrücke© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Stab-Linien-SystemAufgabe: BeratungVerantwortlichkeittli itKeine eigenen Weisungsrechtegegenüber LinienstellenStab-Linien-Konflikt© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Scientific Management von Frederick Taylor (1911)Basierend auf analytischen Zeit-Bewegungsstudien:ArbeitsteilungTrennung von Hand- <strong>und</strong> Kopfarbeit (craft & clericalwork)Spezialisierung (Arbeitsteilung in) der Führung(Funktionsmeistersystem)Verschiebung von Kontrolle <strong>und</strong> Entscheidungsrechtenauf das Management (dis-empowerment of workers)Stücklöhne als Anreizsysteme <strong>und</strong> Bestrafungssysteme(zur Vermeidung von soldiering & shirking)Auswahlverfahren h für Mitarbeiter (Testverfahren)Konflikt-Management für Arbeitskonflikte© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Mehrliniensystem: F. TaylorNutzung der Fachkompetenz(Evtl.) Entlastung der InstanzenKürzere DienstwegeKonflikteUnklare Verantwortlichkeit© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Leitungsspanne <strong>und</strong> Gliederungstiefeiefe erungstiGliedeLeitungsspanne© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Kennzahlen HierarchieL av= 2,35G min = 3G av=474,7I/S = 14/20L max= 4G max= 6 L min = 2L min = ? G min = ?L max = ? G max = ?L av = ? G av = ?Stellenrelation: Instanzen / Stellen = ?© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Bestimmungsgrößen der LeitungsspanneVorteile großerLeitungsspannenWenigerInstanzenkurzerDienstwegLeitungsspanneVorteile kleinerLeitungsspannenEntlastung derInstanzenMotivationEmpirische ErgebnisseHomogenitätFormalisierung© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Verteilung von EntscheidungsrechtenDelegationsproblem:Welchen Hierarchieebenen sollen welche Entscheidungsrechtezugeordnet werden?Koordinationsproblem:Wie können die einzelnen Entscheidungen aufeinanderabgestimmt werden?Anreiz-/Kontrollproblem:Wie kann zielkonformes Verhalten der <strong>Organisation</strong>smitgliedersichergestellt werden?© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
DelegationsproblemEntscheidung durchInstanz• begrenzte Kapazität• begrenztes WissenDelegation anEntscheidungsträger• Unsicherheit über Qualität• Unsicherheit über Ziele© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
DelegationsgradDelegation ist um so ausgeprägter, je… mehr Entscheidungen auf "unteren" Ebenen getroffenwerden (können)… wichtiger die auf unteren Ebenen getroffenenEntscheidungen sind… mehr andere Stellen von den auf unteren Ebenengetroffenen Entscheidungen berührt werden… weniger Abstimmung mit übergeordneten Stellengefordert wird© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006Kieser/Kubicek, 1992
Messung der DelegationDelegationsmessungdirektindirektobjektiv:tatsächlicheKompetenzensubjektiv:empf<strong>und</strong>eneKompetenzen- Leitungsspanne- Ghl Gehalt- ...© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Einflussgrößen DelegationGröße(+)FormaleKoordinationUmwelt-dynamikDiversifikation(+)(+)(+)Delegation© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Informationstechnik <strong>und</strong> DelegationZentralisierungspotenzial:– Höhere Problemlösungskapazität der Instanz– Besserer Zugriff auf DetailinformationenDezentralisierungspotenzial:– Verfügbarkeit von Methoden <strong>und</strong> Expertenwissen– Bessere Kontrollmöglichkeiten– Aufgabenintegrationg– Entlastung unterer Ebenen von Routinetätigkeiten (Kaskadeneffekt)Funktionsverlust des mittleren ManagementsOrganisatorische Gestaltungsspielräume© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
ArbeitsteilungVertikale Arbeitsteilung:Trennung zwischen ausführenden <strong>und</strong>koordinierenden TätigkeitenHorizontale tl Arbeitsteilung:AbittilZerlegung ausführenderTätigkeiten© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Verteilung von EntscheidungsrechtenDelegationsproblem:Welchen Hierarchieebenen sollen welche Entscheidungsrechtezugeordnet werden?Koordinationsproblem:Wie können die einzelnen Entscheidungen aufeinanderabgestimmt werden?Anreiz-/Kontrollproblem:Wie kann zielkonformes Verhalten der <strong>Organisation</strong>smitgliedersichergestellt werden?© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Horizontale KoordinationRestriktionenverb<strong>und</strong>:Aktionen eines Bereiches schränken Handlungsmöglichkeiten desanderen Bereiches einErfolgsverb<strong>und</strong>:Aktionen eines Bereiches beeinflussen Erfolg desanderen BereichesRisikoverb<strong>und</strong>:Beeinflussung des Gesamtrisikos durch gleiche / gegenläufigeEntwicklungen in den Bereichen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Risikoverb<strong>und</strong>© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
KoordinationRestriktionenverb<strong>und</strong>:Aktionen eines Bereiches schränken Handlungsmöglichkeiten desanderen Bereiches einErfolgsverb<strong>und</strong>:Aktionen eines Bereiches beeinflussen Ef Erfolg desanderen BereichesRisikoverb<strong>und</strong>:Beeinflussung des Gesamtrisikos durch gleiche / gegenläufigeEntwicklungen in den BereichenBewertungsverb<strong>und</strong>:Bewertung von Aktionen in einem Bereich hängt von Aktionen desanderen Bereiches ab© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Bewertungsverb<strong>und</strong>KostenUmweltqualität© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
KoordinationsmechanismenKoordinationsmechanismen sollen sicher stellen, dass inVerb<strong>und</strong>situationen trotz bestehender Interdependenzenoptimale Entscheidungen im Sinne des Unternehmensgetroffen werden.ZentralistischeKoordinationsmechanismeni iZentrale entscheidet über Zuteilung<strong>und</strong> Verwendung e von Ressourcen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006DezentraleKoordinationsmechanismenBereich entscheidet überVerwendung, z.T. auch Menge vonRessourcen
KoordinationsmechanismenVerwenndungEntscheidungs-Ressourcenmenge (Zuteilung)rechte zentral dezentralDirekte Weisungzentral ProgrammePläneAlternativplanung Verrechnungs-dezentral Budgets preise(Lenkpreise)© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Beispiel AlternativplanungBereich ABereich BProjekt Kapital- Gewinn Rendite Projekt Kapital- Gewinn Renditebedarf % bedarf %A1 10 3 30 B1 5 2 40A2 5 1,25 25 B2 5 1 20A3 5 0,5 10 B3 5 0,75 15A4 5 0,25 5 B4 5 0,5 1003 0,3X1X20,3Y1Budget: 20 Mio;Alternativzinssatz: 10 %0,20,1X3X40,20,1Y2Y3Y45 10 15 20 5 10 15 20© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Beispiel Alternativplanung & BudgetAus der Sicht der Instanz (bei 10 % Alternativ-Rendite):Projekte Investierte Gewinn aus Rest Gesamt-Mittel Projekten gewinnY1 5 2 15 3,5Y2 10 3 10 4Y3 15 3,75 5 4,25Y4 20 4,25 0 4,25X1 10 3 10 4X1 + Y1 15 3+2 5 5,5X1 + Y2 20 3+3 0 6X2 + Y1 20 4,25+2 0 6,25X3 20 4,75 0 4,75© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Koordination durch LenkpreiseDie Zentrale verrechnet den einzelnen Bereichen fürdie zugeteilten Investitionsmittel einen bestimmtenZinssatz vErwirtschafteter Ertrag über v verbleibt in denBereichenRealisation nur solcher Projekte, deren Ertrag über vliegtFestlegung des Lenkpreises v?© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Beispiel VerrechnungspreiseBereich ABereich BProjekt Kapital- Gewinn Rendite Projekt Kapital- Gewinn Renditebedarf % bedarf %A1 10 3 30 B1 5 2 40A2 5 1,25 25 B2 5 1 20A3 5 0,5 10 B3 5 0,75 15A4 5 0,25 5 B4 5 0,5 10Festlegung des Verrechnungspreises v?Bereich ABereich BVerrechnungs- Projekte Ef Erfolg Projekte Ef Erfolg Gesamt- Gesamtpreisinvest erfolg≤ 0,2 A1, A2 4,25 B1, B2 3 25 unzulässig0,20 0,25 A1 3 B1 2 15 5 (+0,5)© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Beispiel Verrechnungspreise (1)ZwischenproduktAbteilung 1 Abteilung 2Verrechnungspreis vKosten k k 2+vErlöse v pproduziert wenn k ≤ v v ≤ p - k 2v ≤ dProduktion für Gesamtunternehmen vorteilhaft:k+k k 2 ≤ pk ≤ dVerrechnungspreis: k ≤ v ≤ d© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Beispiel Verrechnungspreise (2)k L < d L < k H < d HLLHLLHHH© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Beispiel Verrechnungspreise: Perfekte InformationErfolgErwart.Zustand p biP bei Prod. Prod. Ef ErfolgLL Ф LLd L –k L > 0 ja Ф LL(d L -k L )HL Ф HLd L –k H < 0 nein 0LH Ф LH d H – k L >0 ja Ф LH (d H - k L )HH Ф HHd H –k H > 0 ja Ф HH(d H -k H )E= Ф LL (d L - k L ) + Ф LH (d H - k L ) + Ф HH (d H – k H )© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Verrechnungspreise: Unvollständige Informationk Ld Lk Hd HVerrechnungspreis LL LH HL HH Erwartungswert t Erfolgv < k Ln/j n/j n/j n/j 0k L≤ v ≤ d Lj/j j/j n/j n/j Ф LL(d L-k L) + Ф LH(d H-k L)d L
Einflussgrößen Koordinationsmechanismen(-)Pers.Weisungen(+)Größe(+)(+)Selbst-abstimmungProgramme(+)(+)(+)UmweltdynamikPläne(+)Internatio-nalisierung© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
MotivationBereitschaft zugeteilte Aufgaben durchzuführen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Arten von AnreizenIntrinsische Anreize:liegen in der Aufgabenerfüllung selbst begründetEti Extrinsische i Anreize:Bedürfnisse außerhalb des Aufgabenbereiches© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Intrinsische AnreizeAufgabe➢Abgeschlossenheit➢Vielfalt➢RückkopplungAutonomie➢Entscheidungen➢KontrolleMotivationFührung© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
MotivationstheorienInhaltstheorienFaktoren, die Einfluss auf dieMotivation habenStatischProzesstheorienBeschreiben Entwicklung vonMotivationDynamisch●●●Bedürfnispyramide(Maslow)ERG-Theorie(Alderfer)Faktorentheorie(Herzberg)●●●Anreiz-Beitragstheorie(Simon)Gerechtigkeitstheorie(Adams)Erwartungstheorie(Vroom)© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Bedürfnispyramide (Maslow)SelbstverwirklichungWachstumBedürfnisnach AnerkennungAnspruchsniveauAnspruchsniveauSoziale BedürfnisseSicherheitsbedürfnissePhysiologische BedürfnisseDefizit© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
ERG-Theorie (Alderfer)(G) Wachstum(Growth)(R) Beziehung(Relatedness)(E) Existenzsicherung(Existence)➢ Empirisch besserabgesichert➢ Keine Hierarchie➢ Komplexe Beziehungenzwischen Ebenen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Faktorentheorie (Herzberg)Hygienefaktoren Mangel hat negativeAuswirkungen auf MotivationMotivatoren Können Motivation steigern➢ Arbeitsbedingungeng➢ Bezahlung➢ Kontrolle➢ Anerkennung➢ Aufstiegsmöglichkeiten➢ Selbstverwirklichung© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Gerechtigkeitstheorie (Adams)Eigene SituationOutputInputUnternehmenVergleichspersonOutputInputVergleichO eO v unfairI eO eI eO eI vO vI vO vunfairVergleichsperson besserfairunfairI e I v Vergleichsperson schlechterKorrektur:➢Input p verändern➢Bewertung verändern➢Vergleichsperson wechseln➢"Aussteigen"© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Erwartungstheorie VroomHandlung(H)ErwartungErgebnis1. Ebene (E1)InstrumentalitätErgebnis2. Ebene (E2)Mittel für ................................... Ziel=Mittel für ………………………….… ZielValenzmodell: Valenz (E1) = Instrumentalität (E1-E2) E2) * Valenz (E2)Kraftmodell: Anstrengung (H) = Erwartung (H-E1) * Valenz (E1)Anstrengung (H) = Erwartung (H-E1) * Instrumentalität (E1-E2) * Valenz (E2)© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Kontrolle & VerantwortungKontrolle & Entscheidung (Ressourcen):niedrighochVerantwortung (erfolgsabhängige Entlohnung):niedrighochEntrepreneurship© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Beispiel SAFELITE Glass600 Filialen USA: montieren Fahrzeugglas(Windschutzscheiben, etc.)1994 Einführung Leistungsorientierte Entlohnung mitBasisst<strong>und</strong>ensatzProduktivitätssteigerung ität t i von 36 Prozent; 2/3 davon aufbereits vorhandene Mitarbeiter zurückzuführen(Anreizfunktion & Selbstselektion)Durchschnittliches Entgelt stieg um 9 %Messkosten?Qualität?Gewinn?© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006 Lazear, 1996
Extrinsische Motivation - EntlohnungssystemeWelche Entlohnungsformen gibt es?Welche Anreizwirkung haben bestimmteEntlohnungsformen?Welche Probleme können auftreten?Wie kann ich die richtige Entlohnung für meineMitarbeiter festlegen?Welche Entgeltkomponenten gibt es jenseits von Geld?© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
EntgeltdifferenzierungArbeitsanforderungenGr<strong>und</strong>lage: gedachte Normalleistung;Anwendung von verschiedenerArbeitsbewertungsverfahren.„Gleicher Lohnfür gleicheArbeit“ArbeitsleistungGr<strong>und</strong>lage: Gr<strong>und</strong>satz derLeistungsgerechtigkeit;Akkord- & Stücklohn, Prämien„Gleicher Lohnfür gleicheLeistung“EntgeltdifferenzierungUnternehmenserfolgMonetäre <strong>und</strong> nicht-monetäre Erfolgsgrößen;Bezugsgrößen: g Ertrag, Gewinn,Unternehmenswert, Strategie, etc.„Gleicher Lohnfür gleichenErfolg“QualifikationGr<strong>und</strong>lage: Erfolg des Unternehmensberuht auf Entwicklung & Nutzung desHumankapitals; Qualifikationslohn„Gleicher Lohnfür gleicheQualifikation“Sozialer <strong>und</strong>beruflicher StatusGr<strong>und</strong>lage:Unternehmenszugehörigkeit,hierarchische Position oder Status:Senioritätsentlohnung„Gleicher Lohnfür gleicheLoyalität “© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Agency-Theorie Gr<strong>und</strong>modellPrincipal(Instanz)Belohnung c(g)Erfolg g(a)AgentAktivität aUnsicherheit© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Agency - TheorieRationales (optimierendes) Verhalten von ökonomischenAkteuren (Prinzipal <strong>und</strong> Agent)Agent: Arbeitsleid -Trade Off zwischen Kompensation<strong>und</strong> dEinsatzPrinzipal: antizipiert Verhalten des Agenten in Gestaltungdes KompensationssystemsPartizipationsbedingung: Berücksichtigung des KontextesInformationsannahmen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Indifferenzkurven & OptimierungBelohnung cbesserErtrag(Belohnung)schlechter© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006Arbeitseinsatz a
Variable <strong>und</strong> fixe BelohnungBelohnung cBelohnungvariabelBelohnungmit fixemGr<strong>und</strong>anteil© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006Arbeitseinsatz a
Nettoerfolg für PrinzipalErtrag g(a)Belohnungc(g(a))g(a)Nettoerfolgc(g(a))© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006Aktivität a
Agency-Modellag(a)c(g)u(c,a)Aktivitätsniveau des AgentenGewinnfunktionKompensationsfunktionNutzenfunktion des AgentenOptimierungsproblem:Zielfunktion des Principali max g(a*) – c(g(a*))( Nebenbedingungen:Agent maximiert seinen NutzenPartizipationsbedingungu(a*, c(g(a*))) = max u (a, c(g(a)))u(a*,c(g(a*))) ≥ u min© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Variable EntlohnungsformenNach Input oder nach Output?Geeignete Basisvariable?1. Messbar2. Dem betreffenden Akteur hinreichend i h eindeutigzuordenbar3. Nicht zu stark von externen Einflüssen abhängig4. Kann durch den betreffenden Akteur hinreichend starkbeeinflusst werden© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
LohnformenFixVariabelVoraussetzung: Messbarkeit, Zuordnung, Beeinflussbarkeit von LeistungZeitlohnBezahlung nachArbeitszeit(Input)Stück-/AkkordlohnBezahlung nachOutputUnterstellt Zusammenhang zwischenLeistungsgrad <strong>und</strong> erzieltem Mengenergebnispro ZeiteinheitZeitakkord = Vorgabezeiten: Unterschreitungführt zu Entgeltleistung●●●●GleitzeitSchichtarbeitHeimarbeitTelearbeit● rein / mitMindestlohn● Zeit- /GeldakkordGeldakkord = Geldbetrag für best.Arbeitsleistung multipliziert mitZahl der Leistungen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
St<strong>und</strong>enlohn Zeit vs. AkkordlohnSt<strong>und</strong>e enlohn14,51413,51312,51211,51110,51095 9,598,5875 7,576,565,554,55 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Stk/hZeitlohnAkkord© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Stückkosten Zeit- vs. Akkordlohn1,61,51,41,3kostenStück1,21,11 ZeitlohnAkkord0,908 0,80,706 0,60,55 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Stk/hRisiko von Leistungsschwankungenwird beim Akkord auf Mitarbeiter abgewälzt!© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Akkordlohn mit Mindestlohn19,51918,51817,51716,51615,551514,51413,51312,51211,51110,5109,55 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Stk/hSt<strong>und</strong>ensatzStückkosten*10© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
LohnformenFixZeitlohnBezahlung nachArbeitszeit(Input)●●●●GleitzeitSchichtarbeitHeimarbeitTelearbeitVariabelStück-/ Prämien Team- Mitarbeiter-Akkordlohnentlohnung beteilgungenVoraussetzung: Messbarkeit, Zuordnung, Beeinflussbarkeit von LeistungBezahlung nachOutput●rein / mitMindestlohn● Zeit- /GeldakkordGrupenakkordGruppenprämienBezahlung nachZit Zeit, zusätzliche ätlihPrämie (Geld,Sachbezug oderSonderurlaub) fürbes. ErgebnissePrämien z.B. für●Menge● Qualität● Umsatz●K<strong>und</strong>enzufriedenheit● Termine● ….Bezogen aufGruppe vomMitarbeitern●●(Direkte)Beteiligung amUnternehmenserfolg● Gewinn●Optionen● Aktien● ...© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Shirking/Freeriding© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Arten von Agency-ProblemenInformationsbarriereEigenschaften(HiddenCharacteristics)AgentInformationen(HiddenInformation)PrinzipalHandlungen(Hidden Action)beeinflusst© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006Vetschera, 2010
StrukturInformation vorVertragsabschlussInformation vorEntscheidungInformation nachEntscheidungVertrag Agent entscheidet ErgebnisHiddenCharacteristicsHiddenInformationHoldup(ex post sichtbar)Hidden action(nie sichtbar)Adverse Seec SelectionMoral Hazard© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Interdependente Leistungen: Groves-SchemaBereich ABereich BProjekt Kapital- Gewinn Rendite Projekt Kapital- Gewinn Renditebedarf % bedarf %A1 10 3 30 B1 5 2 40A2 5 1,25 25 B2 5 1 20A3 5 0,5 10 B3 5 0,75 15A4 5 025 0,25 5 B4 5 05 0,5 10Problem: Asymmetrische Information - Anreizgestaltung?Belohnung nachBereichserfolgBelohnung nachGesamterfolgAnreiz zur Aneignungvon RessourcenFree-RiderProblemGroves-Schema:Belohnungsgr<strong>und</strong>lage = eigener Isterfolg + Sollerfolge der anderen Bereiche© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006Kollusionsproblem!!
Erfolgsabhängige EntgeltdifferenzierungEmpirische Bef<strong>und</strong>e:– zeigen kaum Auswirkungen von erfolgsabhängigerEntgeltdifferenzierung auf Markterfolg (Winter 2000, Murphy1999)Gründe– Multiple Tasking (Komplexität d. relevanten Erfolgsfaktoren)– Crowding – Out Phänomen (Frey/Osterloh 2000)– Hohe Anreize auch unsicheren Umwelten (widerspricht eigentlichPrincipal Agent Theorie, siehe Prendergast 2000/2004)© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Gründe für fixe EntlohnungGesetzliche/tarifvertragliche RestriktionenRisikoverteilungMessprobleme <strong>und</strong> -kostenEffizienzlöhneBeförderungsoptionen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Nicht-monetäre Anreize & Cafeteria System• Sachleistungen, Konsumvorteile• Nutzungsgewährungen• Beratungs-, Bank- <strong>und</strong> Versicherungsleistungen• ZusatzleistungenIndividualisierung vonEntlohnungJede(r) MitarbeiterIn hat dieMöglichkeit, innerhalb einesvorgegebenen Budgets zwischenverschiedenen Entgeltbestandteilenauszuwählen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006© Univ.Prof. Dr. <strong>Personal</strong> <strong>und</strong> 23
SenioritätsentlohnungEntlohnung steigt mit Alter/Betriebszugehörigkeit i it stark anZunahme des Humankapitalsverbessertes MatchingMacht der InsiderAnreiz (Pfand gegen Shirking)© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Relative Entlohnung (Turnier)Re elative Reihunng der MitarbeeiterFix vorgegebene Prämien fürRänge➢➢➢➢LeistungsturniereBeförderungsturniereAnreizwirkung durch DifferenzHöhe: Partizipation© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Relative EntlohnungVorteileNachteile✔Geringere Messkosten✔Sicherung gegen exogeneRisiken✔Wettkampfcharaktererhöht Motivation✔bei Teams anwendbar✗Kollusionsgefahr✗Leistungsreduktion beiheterogenen Teilnehmern✗Beeinflussung✗Konkurrenzdenken,Sabotage© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
ZusammenfassungGr<strong>und</strong>anforderung an Entgeltsysteme:Nachvollziehbarkeit & TransparenzDie Ef Erfolgsgrößen, an die Entlohnungselemente l t gekoppelt sindmüssen unzweifelhaft feststellbar sein <strong>und</strong> bestimmtenIndividuen oder Teams zugeordnet werden können.Die Art der Berechnung muss auf Basis dieser Kenngrößenregelgeb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> nachvollziehbar sein.Wolff, Lazear 2001© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Gr<strong>und</strong>legende Problematik LohnsystemeEntgeltspreizung (Schere zwischen Führungskräfte-Entlohnung <strong>und</strong> Mitarbeiter-Entlohung): Fehlen einesfunktionierenden MarktmechanismusEntgeltspreizung Männer/FrauenVolkswirtschaftliche Lohnquote (Verteilung derWertschöpfung zwischen ArbeitnehmerInnen <strong>und</strong>Arbeitgeber)© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Prozessorganisation5.1 Konzepte <strong>und</strong> Methoden prozessorientierter<strong>Organisation</strong>sgestaltung5.1.1 Leitgedanken prozessorientierter <strong>Organisation</strong>sgestaltung5.1.2 Methoden prozessorientierter <strong>Organisation</strong>sgestaltung5.2 Unternehmensplanung als Prozess der Steuerungsebene521Begriff<strong>und</strong>ZielederUnternehmensplanung5.2.1 der 5.2.2 Aufbau der Unternehmensplanung523Interdependenzen 5.2.3 <strong>und</strong> Koordination von Teilplänen5.2.4 Phasenschema der Planung© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Bearbeitung einer K<strong>und</strong>enanfrageULBeschaffung Produktion Finanzen Vertrieb?© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
GeschäftsprozessBündel von Aktivitäten, für das ein oder mehrereunterschiedliche Inputs benötigt werden <strong>und</strong> das für denK<strong>und</strong>en ein Ergebnis von Wert erzeugtHammer/Champy, 1995© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Wertkettenmodell von PorterUnters stützende eTätigk keitenUnternehmens-Infrastruktur<strong>Personal</strong>TechnologieBereitstellung von RessourcenPrimäreTätig gkeitenLogistikBeschaffung Produktion LogistikVertriebMarketingServiceUnternehmensgrenze© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Kernprozesse3 elementare Kernprozesse nach Kaplan/MurdockProduktentwicklungAuftragsakquisition <strong>und</strong> -abwicklungLogistikHammer/Champy:max. 10 übergeordnete Prozessejeweils max. 6 UnterprozessePraktische Projekte:IBM: 140 Geschäftsprozesse© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Business Process RengineeringBPR ist ..."f<strong>und</strong>amentales Überdenken <strong>und</strong> radikales Redesign von Unternehmen oderwesentlichen Unternehmensprozessen.DasResultat sind Verbesserungen umGrößenordnungen in entscheidenden, heute wichtigen <strong>und</strong> messbarenLeistungsgrößen in den Bereichen Kosten, Qualität, Service <strong>und</strong> Zeit"Hammer/Champy 1995• F<strong>und</strong>amental• Radikal• Prozessorientiert• Verbesserung um Größenordnungen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Ziele von BPRKostenzieleQualitätszieleK<strong>und</strong>enorientierungFlexibilität© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
BPR-Vorgehensmodell von HammerMobilization● Create business process map●●●●Appoint process ownersFormulate strategyDetermine priorizationAssign team membersDiagnosis●●●●Bo<strong>und</strong> & scope processUnderstand customer needsIdentify weaknessesSet targets for new designHes ss/Brecht,1995© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
DiagnoseKontextanalyse:t – Abgrenzung des Prozesses– Austausch von Leistungen mit anderen ProzessenLeistungsanalyse:Welche Leistung soll der Prozess erbringen?– Sind alle Leistungen erforderlich?– Fehlen Leistungen?– Qualität?Prozessanalyse: (Aktivitäten)aus welchen Schritten besteht der Prozess?– Elemente (Schritte)– Beziehungen (zeitlich, sachlogisch)– Aufgabenträger© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Beispiel AUA: KontextanalyseReservierungAUAFlugreservierungBeschwerdenFlugi information nK<strong>und</strong>eAnfragen nBeschwe erdenFAIDCustomerRlti RelationDankschreibenChefsekretariattWocheninfoCrewProzess K<strong>und</strong>enserviceOperationControlFlight SafetyCrewcontrolCISWochenberichtGro<strong>und</strong>OperationsEinkaufCateringMarketingDuty FreeDo & CoLogistikFlightManager© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Beispiel AUA: Leistungsanalyse - QualitätsprofilAbteilung TechnikLeistungsbestandteil Bedeutung vorhandenInformation hochfehltLeistungsmerkmale Bedeutung erfüllt nicht erfülltAktualitäthochVollständigkeit mittelIdentifizierbarkeit hochStandardisierbarkeithochIstSoll© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Beispiel AUA: Prozessanalyse - AblaufkarteAblaufkarte Flight OperationslotPiSe ekretariatNr Ablaufstufen Verricht1 Holen d. PVR O I T S 12 Lesen dr. Sekretariat O I T S 23 Prüft Relevanz für Flottenchef O I T S 3Flo ottenchef4 Ablage bis Flottenchef kommt O I T S 45 Lesen dr. Flottenchef O I T S 56 Prüft Relevanz für Abteilung O I T S 67 Kopien erstellen O I T S 7Ha auspostspatchDitionsTe echnikGr ro<strong>und</strong> OperatSa afety8 Verteilung OI TS 89 Bearbeitung dr. Abteilung O I T S 9 9 9 910 Feedback erstellen O I T S 10 10 10 1011 Zurücksenden O I T S 1112 Ablage bis Flottenchef kommt O I T S 1213 PüftEl Prüft Erledigung O I T S 1314 Sekretariat legt PVR ab O I T S 14O (Operation) = BearbeitungsschrittI (Inspection) = KontrollvorgangT (Transport) = TransportvorgangS (Stopover) = Verzögerung© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Beispiel AUA: Redesign <strong>und</strong> StandardisierbarkeitStandardprozess <strong>und</strong> Sonderprozess:Standardisierbarkeitdi i ithoch mittel niedrigKomplexität des Inhaltesniedrig mittel hochHäufigkeit des Auftretenshoch mittel niedrigDringlichkeit der Informationniedrig mittel hochStandardisierbarkeitdi i ihoch mittel niedrigKomplexität des Inhaltesniedrig mittel hochHäufigkeit des Auftretenshoch mittel niedrigDringlichkeit der Informationniedrig mittel hoch© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
BPR-Vorgehensmodell von HammerMobilization● Create business process map●●●●Appoint process ownersFormulate strategyDetermine priorizationAssign team membersCh hange ManagementDiagnosisRedesign●●●●●●●●●Bo<strong>und</strong> & scope processUnderstand customer needsIdentify weaknessesSet targets for new designCreate design conceptDevelop detailed designRedesign entire systemBuild prototypeTest, learn and iterateTransition●●●●●●Formulate transition strategyImplement pilotRealize initial benefitImplement succeeding releasesDevelop infrastructureRoll out and institutionalize1995Hes ss/Brecht,© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Eigenschaften neuer ProzesseIntegration von AufgabenMitarbeiter treffen Entscheidungen ("Empowerment")Natürliche Reihenfolge der ProzessschritteMehrere ProzessvariantenArbeit wird dort erledigt, wo es am sinnvollsten istWeniger Überwachung- <strong>und</strong> KontrollbedarfMinimum an AbstimmungCasemanagerMischung aus Zentralisierung <strong>und</strong> Dezentralisierung© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006Hammer/Champy, 1995
Parallelisierung von ProzessschrittenProzess vor ReengineeringProzess nach Reengineering© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
BPR <strong>und</strong> InformationstechnologieGemeinsame Neugestaltung g von Prozessen <strong>und</strong>Informationssystemen➔ Triage-Konzept• Automatisierte Bearbeitung einfacher Fälle• Unterstützung der Case-Worker in mittleren Fällen• Kommunikation mit Experten für schwierige FälleSteuerung der neuen ProzesseParallelisierung von Abläufen durch DatenbankenInformationstechnische Unterstützung des BPR-Projektesselbst• Dokumentation• Analyse© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Prozessführung... permanente Überwachung <strong>und</strong> Weiterentwicklung der Effektivität<strong>und</strong> Effizienz sowohl einzelner Prozesse als auch der Gesamtheitaller Prozesse der UnternehmungPlant, gestaltet <strong>und</strong> beobachtet Prozess,bestimmt Führungsgrößen,g setzt Ziele,vergleicht Soll <strong>und</strong> Ist,leitet daraus Verbesserungsmaßnahmen ab <strong>und</strong>überwacht deren UmsetzungNach: Österle, 1995© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Prozess als StrukturkriteriumFunktionFunktionaleSpezialisierungFunktionale Spezialisierung mitprozessorientierten StabsstellenProzessteam ausfunktionalen SpezialistenFunktions-/Prozess-MatrixorganisationCase-Management mitfunktionsorientierten StäbenCase-Management alsprozessorientierte Spezialisierung© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006Prozess Picot/Franck, 1995
Konsequenzen für AufbauorganisationMehrliniensystem (Matrix)Gleichzeitige Zentralisierung (durch EDV) <strong>und</strong>Dezentralisierung (durch Empowerment)Geringerer Überwachungs- <strong>und</strong> Kontrollbedarf(vertikale Koordination)Weniger Schnittstellen t (geringerer horizontalerKoordinationsbedarf)Integration von Aufgaben (geringere Spezialisierung)Höherqualifizierung von Mitarbeitern© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
BPR: ProblematikEinseitige Orientierung an ProzesseffizienzUnternehmensgrenzen nicht analysiert<strong>Organisation</strong>sstruktur unklarTop-Down-OrientierungEinmaliger VorgangVerlust an SpezialwissenCase Worker: soziale VereinsamungTheuvsen, 1996Picot/Franck, 1995© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
BPR vs. KaizenKaizenVerbesserungbestehenderProzesseBPRRadikaleNeugestaltungvon ProzessenDauerndEinmaligBottom-UpTop-Downbereichs-übergreifendlokall© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
ProzessentwicklungRevolutionAnalyseEntwurfImplementierungImplementierungEntwurfEvolutionBetriebAnalyseÖsterle, 1995© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
BPR-Vorgehensmodell von HammerMobilization● Create business process map●●●●Appoint process ownersFormulate strategyDetermine priorizationAssign team membersCh hange ManagementDiagnosisRedesign●●●●●●●●●Bo<strong>und</strong> & scope processUnderstand customer needsIdentify weaknessesSet targets for new designCreate design conceptDevelop detailed designRedesign entire systemBuild prototypeTest, learn and iterateTransition●●●●●●Formulate transition strategyImplement pilotRealize initial benefitImplement succeeding releasesDevelop infrastructureRoll out and institutionalize1995Hes ss/Brecht,© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Intensität der VeränderungEvolutionäre Veränderung beschränkt auf einzelneDimensionen beschränkt auf einzelne Ebenen Wandel des Inhalts Kontinuität, gleiche Richtung inkremental logisch <strong>und</strong> rational ohne Paradigmenwechsel(Weltbild ändert sich nicht)Revolutionäre Veränderung mehrdimensional umfaßt alle Ebenen Wandel im Kontext Diskontinuität, neue Richtung revolutionär vermeintlich irrational, andereRationalität mit Paradigmenwechsel(Veränderung des Weltbildes)© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006MPH 262
10 Gründe für Widerstand gegen VeränderungGesichtsverlust Veränderung bedeutet, dass man vorher etwas falsch gemacht hatNot-invented here Syndrom Wir können es am BestenKontrollverlust Verlust von Macht <strong>und</strong> EinflussUnsicherheit man weiß nicht, was auf einen zukommt, Verlust von SicherheitSurprise, surprise automatische Verteidigung gegen ÜberrumpelungDifference Effekt Widerspruch zu bestehenden Normen <strong>und</strong> WertesystemÜberforderung kann ich das alles überhaupt schaffen?Überlastung zu viele neue Aufgaben zu bestehenden zu bewältigenSchlechte Erfahrungen mit früheren VeränderungenEchte Bedrohung Veränderung führt zu „echten“ Verlierern© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006MPH 263
Lewin-ExperimentKriegsjahre USA; LebensmittelknappheitErweiterung des Speiseplans um InnereienFeldexperiment mit amerikanischen i Hausfrauen– Vortragsgruppen– Diskussionsgruppen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Maßnahmen zur Überwindung von Widerstand1. Bewusstsein für Veränderungsnotwendigkeit schaffen:umfassende Information <strong>und</strong> Hintergründe für den anstehenden Wandel2. Aktive Teilnahme am Veränderungsgeschehen:Einbeziehung von <strong>und</strong> Kooperation mit Betroffenen („Betroffene zu Beteiligtenmachen“);Motivation <strong>und</strong> Entscheidung3. Teams als wichtigstes Wandelmedium:Wandel in Gruppen wird als weniger bedrohlich erlebt <strong>und</strong> Veränderungenwerden im Durchschnitt schneller vollzogen4. Rücksichtnahme auf Zyklus von Wandelprozessen:Auftauen alter Gewohnheiten sowie Beruhigungsphasen zum Stabilisierenberücksichtigen.© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006MPH 265
Modell nach LewinEffizienz-niveauwiderstrebendeKräfteidealeEntwicklungtreibende KräfterealeEntwicklungZeitPhase 1:AuftauenPhase 2:BewegenPhase 3:Einfrieren© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006MPH 266
Phasenverlauf erfolgreicher Wandelprozesse1. Druck <strong>und</strong> AufrüttlungKrisensignale (von innen <strong>und</strong> außen)2. Intervention <strong>und</strong> NeuorientierungDefreezing: Einführung von Change-Agents: Außenperspektive!3. Diagnose <strong>und</strong> ErklärungMoving in Teams: wichtig keine Tabus!4. Neue Lösungen <strong>und</strong> SelbstverpflichtungenUmgang mit Widerstand5. Experimentieren <strong>und</strong> ErgebnissucheWichtig: Commitment von oben6. Verstärkung <strong>und</strong> AkzeptanzRefreezing: positive Resultate <strong>und</strong> kontinuierliche Information© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006MPH 267
PlanungPlanung ist. . . gedankliche Vorstrukturierung späterer HandlungenMag, 1990. . . vorausschauende, d.h. gedankliche Festlegung gder Unternehmung für dieZukunftKuhn, 1990. . . vorausschauendes, systematisches Durchdenken <strong>und</strong> Formulieren vonZielen, Handlungsalternativen <strong>und</strong> Verhaltensweisen, deren optimale Auswahlsowie die Festlegung von Anweisungen zur rationellen Realisierung derausgewählten AlternativeZangemeister, 1970© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Betriebswirtschaftlicher PlanungsbegrifffunktionalinstitutionalPlanung als ProzessPlanungssystem:der Vorbereitung➢ Planungssubjektevon Handlungen➢ Planungsobjekte➢➢PlanungshandlungenPlanungsinstrumente© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Planung vs. ImprovisationPlanungImprovisation●Nimmt zukünftigeSachverhalte vorweg●Reaktion auf eingetreteneEntwicklungen●Hoher Zeitbedarf●Hohe Geschwindigkeit● Höhere Kosten ● Geringere Kosten● ● "Optimales" Ergebnis Suboptimales Ergebnis© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
PlanungszweckeMag, 1990Welge, 1985Handhabung der KomplexitätStrukturierungsfunktionOptimierungsfunktionSicherungsfunktionKreativitätsfunktionFlexibilitätsfunktionVerbesserung derInformationsversorgungInduzierung zieladäquatenVerhaltensVorgabe von LeistungsgrößenAbstimmung vonEinzelmaßnahmenSicherung desUnternehmensbestandes© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Hierarchischer Aufbau der PlanungGr<strong>und</strong>-satzplanungStrategische t PlanungTaktische PlanungF/E Log Prod. Absatz Pers. FinanzOperative PlanungF/E Logistik Produktion Absatz <strong>Personal</strong> Finanzen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
InterdependenzenStrategischTaktischHorizontaleInterdependenzenOperativVertikaleInterdependenzen© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Vertikale Koordinationretrograd progressiv Gegenstrom+ Zielkonvergenz + Motivation + beide Vorteile- Datenproblem - Koordination - Aufwand© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
ZeitstrukturReihunglangfristigStaffelunglangfristigSchachtelungkurz-fristigkurzfristigmittelfristigkurz-fristigmittel-fristigmittel-fristiglangfristigMag, 1990© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Rollende Planunglangfristiger Plankurzfristigkurz-fristiglangfristiger Plankurz-fristiglangfristiger Plankurzfristiglangfristiger Plan© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006
Flexible Planunga3ErgebnisEntscheidungssymbol;Entscheidungsknotene1a4ausgehende Strategie:= ein‐ Linien oder stellen mehrstufigeHandlungsalternativen Handlungsanweisung dar;a1a5(=Zeilen der Ergebnismatrix)e2a6a7a8Ereignissymbol;Zufallsknotenausgehende Linien stellen Ereignisse bzw.Szenario:=Zustände dar;Kombination verschiedenerEreignisse bzw. Zuständea2e3a9a10(= Spalten der Ergebnismatrix)i e4a11a12© R. Vetschera, 2004, S.T. Köszegi, 2006Zeit