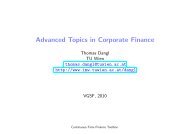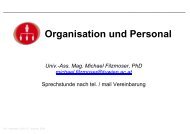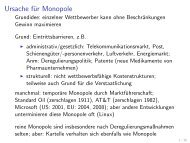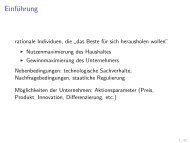Was bedeutet Info-/Internet-Zeitalter? - IMW
Was bedeutet Info-/Internet-Zeitalter? - IMW
Was bedeutet Info-/Internet-Zeitalter? - IMW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Erkennen<br />
von<br />
Zukunftsmustern<br />
Hauptproblem des Managements<br />
von heute:<br />
Umgehen mit der Ungewissheit,<br />
der Unvorhersagbarkeit.<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
1
D1353 M1TT31LUNG Z31GT D1R, ZU W3LCH3N GRO554RT1G3N<br />
L315TUNG3N UN53R G3H1RN F43H1G 15T!<br />
4M 4NF4NG W4R 35 51CH3R NOCH 5CHW3R,<br />
D45 ZU L353N, 483R M1TTL3W31L3 K4NN5T DU D45<br />
W4HR5CH31NL1ICH 5CHON G4NZ GUT L353N, OHN3 D455 35<br />
D1CH W1RKL1CH 4N5TR3NGT.<br />
D45 L315T3T D31N G3H1RN M1T 531N3R 3NORM3N<br />
L3RNF43HIGKEIT.<br />
8331NDRUCK3ND, OD3R?<br />
DU D4RF5T D45 G3RN3 KOP13R3N,<br />
W3NN DU 4UCH 4ND3R3 D4M1T 83G315T3RN W1LL5T.<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
2
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
3
Szenariodenken<br />
Es ist verfehlt, auch nur den Versuch zu machen, aus der<br />
Geschichte zu extrapolieren - etwa, in dem wir aus den<br />
gegenwärtigen Tendenzen schließen, was morgen geschehen<br />
wird. Dass die Geschichte ein Strom ist, dessen Weiterfluß<br />
wenigstens teilweise voraussehbar sein soll, ist ein Versuch,<br />
aus einem Bild, einer Metapher, eine Theorie zu machen. Wir<br />
können aus der Gegenwart lernen, was zu erreichen möglich<br />
ist.<br />
NIC National Intelligence Council/ USA<br />
Karl R. Popper<br />
(Alles Leben ist Problemlöser, 1994)<br />
Global Scenarios to 2025<br />
• Scenario planning has become an increasingly important strategic planning<br />
tool as more corporations, organizations, and government agencies begin to<br />
use scenarios. This publication presents a set of three interdisciplinary, global<br />
scenarios to 2025 that provide different pictures of possible futures.<br />
What are scenarios?<br />
• Scenarios are plausible alternative views about how the future may develop.<br />
They differ from forecasting in that they do not attempt to predict the future<br />
based on linear extrapolations of the past. Scenarios do not seek to project the<br />
future. Instead, they focus on the identification of discontinuities and how<br />
these could potentially develop as a set over time. Scenario analysis allows us<br />
to anticipate future developments, and to evaluate strategies for responding to<br />
these events or conditions through an exploration of alternative futures.<br />
(Director of NIC: Koordination aller Geheimdienst-<strong>Info</strong>s für Präsidenten<br />
NIC eingeführt nach 9-11-Anschlag)<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
4
S I N N M Ä R K T E<br />
•Regionalität: Die Sinnmärkte des Nahen, Guten und Vertrauten<br />
•Tourismus: Die Sinnmärkte des Unterwegsseins und der Selbstveränderung<br />
•Spiritualität: Die Sinnmärkte des Transzendenten und Religiösen<br />
•Bildung: Wising Up – die Sinnmärkte des Schönen, Guten, Wahren<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
•Körper und Genuss: Die Sinnmärkte des Selbermachens und des Selbstmanagements<br />
•Ethik-Konsum: Die Sinnmärkte der Nachhaltigkeit<br />
•Sozial-Kapitalimus: Die Sinnmärkte der guten Taten und des Gemeinsinns<br />
•Medien: Die Sinnmärkte der Nachrichten und <strong>Info</strong>rmationen, Bewusstseinsindustrie 2.0<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
5
Shopping 2020:<br />
Neue Consumer-Markets<br />
Szenario 1: Spaces of Identity<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Für den bewussten Konsumenten ist Shopping ein selbstverständlicher Bestandteil seiner Lebenswelt.<br />
Billige Tricks ziehen bei ihm nicht. Das, was er sucht, ist Authentizität. Der bewusste Konsument begibt<br />
sich dazu an Orte, an denen er ein Wohlgefühl hat und mit denen er sich identifiziert. Dazu zählt auch die<br />
Wiederaneignung des urbanen Raums.<br />
Szenario 2: Neo-Noblesse<br />
Der Luxus-Shopper der Zukunft ist kein demonstrativer Konsument, denn Luxus wird immer mehr in<br />
Erfahrungen und Lebensstilen gesucht, weniger in teuren Produkten. Die Neo-Dandys sind die<br />
Romantiker des modernen Konsums. Sie sehnen sich nach einem Aufbruch aus der Normalität, nach<br />
Wiederverzauberung und Erotisierung des Konsums.<br />
Szenario 3: Stand-up Consumer<br />
Mobiler Lifestyle in einer 24/7-Gesellschaft. Der prototypische Stand-up Consumer ist der global<br />
agierende Business-Nomade. Er sucht nach der Vereinfachung seines Alltags und intelligenter<br />
Unterstützungsdienstleistung, die ihn durch eine stressige Welt navigiert. Konsum findet hauptsächlich<br />
dort statt, wo uns Infrastrukturen und Kommunikationswege entlang führen.<br />
Szenario 4: Social-Shopping<br />
Die Zukunft des E-Commerce liegt im konsumentengetriebenen Dialog-Handel. In den „handelsfreien<br />
Handelszonen“ werden sich künftig Millionen von Menschen tummeln, die aktive Rollen (Verkäufer,<br />
Produkttester, Ratgeber etc.) einnehmen. Sie sind medienkompetent, kritisch, kreativ, selbstdarstellerisch<br />
und community-affin.<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
6
Volkswirtschaftliche Szenarien aus Herbst 2010<br />
ING-Szenarien Eurokrise 2012<br />
(Zweck: Vermögensalternativen für Kunden !)<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
• Szenario 1 „Durchwursteln“ Prop2012: 60%/Prop2014:10%<br />
– Basisszenario, politische Mindestmaßnahmen weiterhin, Grie behält €,<br />
Grie-Anleihen -60%, andere Länder nicht betroffen, detto Banken<br />
• Szenario 2 Governance-Lösung Prop2012: 10%<br />
– Bankenwunsch: Begrenzte Umschuldung in Grie (-30%), weitergehende<br />
politische und fiskalische Integration durch Politik, Emission von<br />
Eurobonds bei stärkerer Lenkung (Transferunion), Euro-Rettungsschirm<br />
als „lender of last resort“, juristische Insolvenzregelung für Länder<br />
• Szenario 3 „Knappes Überleben“ Prop2012: 25%/Prop2014:30%<br />
– Grie raus aus €: Massenarbeitslosigkeit, Depression, Bankenrun, Anleihen<br />
– 70%,auch Irl+Port -40%, Span+Ital -20% haircut, europ.System-Banken<br />
von Staaten zu retten<br />
• Szenario 4 Euro-Crash Prop2012: 5%/Prop2014:10%<br />
– Worst-case-Szenario: mehrere Länder bankrott, EU zerbricht, Euro-Mark-<br />
Zone (D,A,Nl,Lux,Finn) neu, Grie -80%, Irl+Port -60%, Ital+Span -40%,<br />
F+Bel -20%<br />
Quelle: Presse 6.10.2011<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
7
EUROPÄISCHE KOMMISSION<br />
GRUPPE FÜR PROSPEKTIVE ANALYSEN<br />
Szenarien Europa 2010<br />
FÜNF BILDER DER ZUKUNFT EUROPAS<br />
GILLES BERTRAND (KOORD.)<br />
ANNA MICHALSKI<br />
LUCIO R. PENCH<br />
ARBEITSPAPIER, JULI 1999<br />
© EUROPÄISCHE KOMMISSION, GRUPPE FÜR PROSPEKTIVE ANALYSEN, 1999<br />
NACHDRUCK MIT QUELLENANGABEN GESTATTET<br />
Peter Kutis<br />
BCG, 9/2011<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
8
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Stand: Daten Bilanz 2008<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
9
Retropolation als Pfad der strategischen Neuausrichtung<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
10
SZENARIO-DENKEN<br />
IST<br />
SPIELEN MIT DEN<br />
WAHRSCHEINLICHKEITEN.<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
11
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
12
Moderne <strong>Info</strong>rmationssysteme<br />
• Unterschied zwischen operativen (also Buchhaltung, Kostenrechnung,<br />
Controlling) und strategischen <strong>Info</strong>rmations- bzw Kommunikationssystemen,<br />
aber beide im Zusammenspiel für Überleben nötig (vgl beim<br />
Menschen elektrochemische und hormonelle <strong>Info</strong>rmationsverarbeitung)<br />
• Lineare <strong>Info</strong>rmationsverarbeitung vs. Rückkoppelungsschleifen zur<br />
Reaktion auf dynamische Veränderungen<br />
• Verdichtung nach oben: Entscheidungsinfos statt Datenfrust, um oben<br />
mehr frei schwingen zu können für strategischen Fokus (wenige<br />
Kennzahlen, erst bei Bedarf/Abweichung auch Vertiefung zulassen)<br />
• Unterscheidung DRINGEND und WICHTIG<br />
• Suche nach <strong>Info</strong>rmationsattraktoren und Einbau im strategischen <strong>Info</strong>-<br />
Netzwerk zur Verbreiterung der <strong>Info</strong>.quellen (<strong>Info</strong>rmation darf niemals<br />
hierarchisch organisiert sein mit Wissensmonopol an der Spitze)<br />
• <strong>Info</strong>rmationen „erspielen“, indem unbewußtes und bewußtes Wissen<br />
sowie Intuition gezielt in Teams zu <strong>Info</strong>rmationen gekoppelt werden (zB<br />
Forschungsplan eines Mitbewerbers, Kundenbedürfnisse, Risikospiel, Verhalten der<br />
Mitbewerber auf bestimmte Strategie, etc)<br />
• Strategischer Radar zur Beobachtung der Marktführer und<br />
Hauptkunden<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Realität statt Spekulation:<br />
Forschung an neuen Prognosemodellen<br />
• Forschungsprojekt von Prof. Doyne Farmer, Santa Fe Institute/USA (komplexe<br />
Systeme, gründete erfolgreichen Hedgefonds, den er an UBS verkaufte),<br />
finanziert von George Soros´ INET (Institute of New Economic Thinking):<br />
• Agent-based Model mit Realitätsdaten realer Menschen als bottom-up-<br />
Ansatz ohne jegliche modellvereinfachende Annahme (wie bisher in<br />
makroökonomischen Prognosemodellen üblich und nötig: „Diese heutigen<br />
Modelle sind nicht mal gut genug um zu versagen!“)<br />
• Großer Datenkranz echter Menschen aus unterschiedlichsten Segmenten,<br />
daraus „Second Life-Model“, aus dem handfeste Prognosen über zukünftige<br />
Entwicklungen hochgerechnet werden sollen (im ersten Schritt zur<br />
Modellentwicklung für Immobilienmarkt)<br />
• Wirklichkeit ersetzt somit bisher übliche Spekulationen und grobe<br />
Vereinfachungen<br />
• Ergebnisse sind damit der Wirklichkeit viel (selbst-)ähnlicher<br />
• Gesamtprojektziel: Agent-based Model der Gesamtwirtschaft für exaktere<br />
makroökonomische Vorhersagen im Sinne von Szenario-Einschätzungen von<br />
erwarteten oder möglichen zukünftigen Entwicklungen als realistischeres<br />
Prognosetool<br />
Quelle: Profil, 17. Okt. 2011<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
13
Strategischer und operativer Beitrag zum Unternehmenserfolg<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
14
Attraktor in einer Organisation:<br />
<strong>Info</strong>rmeller Führer (wie erkennbar ? Durch Befragungen)<br />
Aufgabe, bewußt u/o unbewußt: <strong>Info</strong>rmationskumulationsfeld<br />
(vgl. Lorenz-Attraktor bzw „Schmetterlingseffekt“)<br />
Erkennen und richtiges Einsetzen als „Mitspieler“<br />
neben offiziellen Führern der Hierarchie<br />
(verstärkt als Soliton Veränderungen)<br />
Peter Kutis<br />
Zum Unterschied zur klassischen Hierarchie mit deren offiziellen Führern<br />
mit zusätzlicher Gefahr gemäß 1. Peter – Prinzip:<br />
„Jeder wird solange befördert, bis er/sie den<br />
level of incompetence erreicht hat !“<br />
Zusatzgefahr: …und oft bleibt er dort oder wird sogar noch<br />
weiter nach oben „gelobt“, wodurch Problem lediglich auf<br />
anderen Bereich verschoben wird.<br />
(Beispiel: tüchtiger Verkäufer, mäßiger Verkaufsleiter,<br />
katastrophaler Vertriebsgeschäftsführer)<br />
Spiel ist eine Befreiung aus den Zwängen der<br />
Gegenwart.<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
15
FINITE SPIELE:<br />
Aus der überprüften Vergangenheit und Gegenwart in die<br />
Zukunft schließen (zB Werbekonzept überprüfen)<br />
INFINITE SPIELE:<br />
Aus der Zukunft die Gegenwart und Vergangenheit<br />
verändern (zB Auswirkung eines bestimmten Szenarios auf eigene<br />
Unternehmensstrategie)<br />
SCHACHPIEL<br />
mit<br />
vorhersagbaren Regeln,<br />
Zügen und bekannten Mitspielern<br />
STABILITÄT<br />
STRATEGIE<br />
OFFENES SPIEL<br />
mit<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
unvorhersagbaren Regeln,<br />
und Abläufen mit unbekannten Mitspielern<br />
INSTABILITÄT<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
16
Beispiel: Daimler Vorstandsspiel-Klausur zur SMART-Entscheidung<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
17
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
18
STRATEGISCHES MANAGEMENT ALS RATIONALE METHODE<br />
* Portfolio, IST-SOLL-Vergleiche, Prognosetechnik, Konzepte<br />
und Vorstandsvorlagen (die vielleicht „diagonal“ gelesen<br />
werden), <strong>Info</strong>rmationsverarbeitung als Problemdiskussion.<br />
AUTOPOIETISCHES MANAGEMENT ALS INTUITIVE METHODE<br />
* Herbeiführung außergewöhnlicher Bewusstseinszustände<br />
(Zeitlosigkeit, verändertes Bedeutungserlebnis), Spaß,<br />
Spiel, Kommunikation als Lösungsdiskussion.<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
19
„MEME“ als Quasi-Gene der Erinnerung<br />
ZIEL: eigene Intuition<br />
kennenlernen<br />
METHODIK:<br />
Für ein bevorstehendes<br />
Treffen die Situation<br />
"in Gedanken"durchspielen<br />
ZIEL: Gefühle aus<br />
dem "Bauch"<br />
METHODIK:<br />
Entspannungsübung<br />
"Geistesblitze"<br />
ZIEL: eigene Intuition<br />
in Gang setzen<br />
METHODIK:<br />
Entspannung, Kopf frei<br />
* schweben --> Wüste<br />
* Berg, alter weiser Mann<br />
* Gespräch<br />
Rollenspiel<br />
ja<br />
Ideen bekommen<br />
ja<br />
Innere Stimme<br />
ja<br />
nein<br />
nein<br />
nein<br />
ZIEL: Gedanken eines anderen<br />
(anwesenden) erfassen<br />
METHODIK:<br />
* ich kann es<br />
* ich bewerte nicht<br />
* ich bin nicht destruktiv<br />
* ich lese (höre) zwischen<br />
Gedanken lesen<br />
den Zeilen<br />
* "Verheimlicht er/sie mir was?"<br />
INTUITIONSÜBUNGEN<br />
(Quelle: Richard M. Contino, Intuitive Intelligenz 1997, Wien)<br />
"Phantasie ist wichtiger als Wissen. Denn das Wissen ist begrenzt, doch die<br />
Phantasie umfaßt die ganze Welt, ist der Impuls für den Fortschritt und der<br />
Anfang der Evolution." Albert Einstein<br />
ja<br />
ja<br />
ja<br />
ja<br />
ja<br />
Intuitive<br />
Brücke<br />
nein<br />
Blockaden<br />
Ahnungen<br />
Mentale<br />
Störungen<br />
nein<br />
Stil<br />
Hilfsmittel für eigene Intuition<br />
* Schüssel mit <strong>Was</strong>ser<br />
* Gegenstand, der zur Person Bezug hat<br />
"Ich möchte wissen, was NN gerade macht."<br />
Blockaden durch fremde Umgebung<br />
Blockaden durch fremde Gedanken<br />
* Umgebung wechseln<br />
* Person meiden<br />
* "<strong>Was</strong> für ein herrlicher Tag!"<br />
Zulassen nichtkörperlicherGefühle<br />
- "Kopf frei."<br />
* negative Gedanken (Falter u. Lichtquelle) aufschreiben<br />
(5 Min/d) jeweils zu anderer Tageszeit<br />
* Entspannungsübung und bei jedem negativen<br />
Gedanken laut STOP sagen<br />
* negative Äußerungen im Team sich nicht<br />
aufschaukelnlassen<br />
eigenen intuitiven Stil suchen<br />
* sehen (visueller Typ)<br />
* wissen (analytischer Typ)<br />
* hören (auditiver Typ)<br />
* fühlen (kinästhetischerTyp)<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
20
Verhalte Dich entsprechend den Gesetzen<br />
deines inneren Selbst,<br />
Vertraue der Richtigkeit deiner Intuition.<br />
Auf diese Weise wirst Du Erfolg haben.<br />
(I Ching)<br />
STRESS REDUZIERT DAS IMMUNPOTENZIAL<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
(SOWOHL DES MANAGERS ALS AUCH DES UNTERNEHMENS)<br />
UND SOMIT<br />
DIE LEBENSERWARTUNG.<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
21
3. Organisation und ihre Strukturen<br />
im dynamischen Veränderungsprozess<br />
ORGANISATION + + + STRUKTUR<br />
Als Organisation eines System<br />
werden dessen konstitutiven Beziehungen<br />
verstanden. Veränderungen<br />
in der Unternehmensorganisation sind<br />
somit Identitätsänderungen.<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Als Struktur eines Systems werden<br />
dessen tatsächlichen Beziehungen<br />
verstanden. Veränderungen in der<br />
Unternehmensstruktur sind somit<br />
Umfeldanpassungen.<br />
IDENTITÄT + + +<br />
TURBULENZ<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
22
Das Nicht-Tun hat keine Kenntnisse,<br />
es hat keine Fähigkeiten, doch es gibt<br />
nichts, was es nicht wüsste<br />
und es gibt nichts, was es nicht könnte<br />
Lie-Zi<br />
Es ist die Aufgabe des Generals, zu schweigen und damit für<br />
Geheimhaltung zu sorgen; standhaft und gerecht, um damit die<br />
Ordnung aufrechtzuerhalten. Er muss fähig sein, seine Offiziere und<br />
Männer mit falschen Berichten und Täuschungen zu verwirren, um<br />
sie völlig unwissend zu halten.<br />
Sunzi (ca. 500 v. Chr.), Die Kunst des Krieges<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
23
HIERARCHIE + + + HETERARCHIE<br />
leitet sich aus dem Griechischen<br />
hiero (heilig) und arche<br />
(Ordnung/Herrschaft) ab und<br />
<strong>bedeutet</strong> somit System der Unterund<br />
Überordnung in der<br />
Unternehmensstruktur<br />
Peter Kutis<br />
leitet sich aus dem Griechischen<br />
hetero (ungleich/verschieden) und<br />
arche (Ordnung/Herrschaft) ab und<br />
<strong>bedeutet</strong> somit verschiedenartige<br />
und flexible Ordnung in der<br />
Unternehmensstruktur<br />
OLIGARCHIE POLYKRATIE<br />
BÜROKRATIE<br />
+ + +<br />
+ + +<br />
Lenken: Planen, Organisieren, Kontrollieren Führen: Vision, Selbstorganisation, Motivation<br />
Neue Arbeitswelt<br />
Matthias Horx, Trendforscher, November 2011:<br />
SELBSTORGANISATION<br />
• Arbeitswelt im Strukturwandel:<br />
von der Industriewelt in die kreative Ökonomie<br />
• Basis der „alten“ Arbeitssicherheit war ein strenges Regime von Zeit,<br />
Verfügbarkeit und Verbindlichkeit nach dem Deal „Sicherheit gegen<br />
Abhängigkeit“<br />
• Moderne Menschen wollen innere und äußere Flexibilität und damit neue<br />
Arbeitsmodelle im Sinne von Zeit, Inhalt, Selbstverwirklichung, Entlohnung<br />
etc<br />
• Zwang zu Kreativität, Innovation und Kommunikation als neue<br />
Herausforderungen:<br />
Geld verdient man im tertiären und neuen quartären Sektor nicht mehr mit<br />
reproduzierten Produkten, sondern mit Innovation und Selbstveränderung<br />
• In der neuen Arbeitswelt wird der „organization man“ als Mann in den<br />
traditionellen Kommandohierarchien obselet, was die Arbeitskultur und die<br />
Managementstile nachhaltig ändern wird<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
24
Pathologische Hierarchie-Pyramiden<br />
Wenn sich die erste Person,<br />
die sich am Telefon meldet,<br />
deinen Anruf nicht beantworten kann,<br />
dann ist es eine Bürokratie.<br />
Peter Kutis<br />
Lyndon B. Johnson, US-Präsident<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Durchbrechen der Hierarchie-Pyramide<br />
durch<br />
heterarchische Netzwerk-Strukturen<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
25
Structure follows Strategy<br />
Historische Entwicklung der Strategie- und Organisationsansätze<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
26
Basiselemente und deren Auswirkungen bei den tradierten Organisationsbaustilen<br />
Adaption der Organisationsform<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
27
Organisation zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung<br />
Reorganisationsbedarf bei sich wandelnden Märkten<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
28
Fraktale Unternehmensorganisation<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
29
Konzept des virtuellen Unternehmens<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
30
Mittel zur strategischen Unternehmenskontrolle<br />
• Bildung harter/stabiler Aktionärskerne<br />
• Satzungsmäßige Verankerung einer spezifischen Aktie mit Sonderrechten,<br />
„golden share“, in EU nur mehr in einigen Bereichen wie Rüstung erlaubt, aber<br />
wegen russischer und chinesischer Aufkaufpläne gerade neu belebt<br />
• Stimmrechtslose Aktien (vgl Magna)<br />
• Höchststimmrechte bzw Mehrfachstimmrechte (in EU im Auslaufen; Vgl VW-<br />
Urteil für relativen Mehrheitseigentümer Porsche, gegen Land Niedersachsen)<br />
• Maximierung des Streubesitzes<br />
• Meldepflichten ab bestimmter Beteiligungshöhe bzw Gesamtoffert ab 25 %<br />
• Privatisierungskommissionen<br />
• Privatisierungsgesetze (Rahmen oder Fall bezogen)<br />
• Wettbewerbsbehörden auch zur Zustimmung von Verkäufen in strategischen<br />
Bereichen (dzt EU-Diskussion)<br />
• Rückkaufsrechte für eigene Aktien (oft Vorratsbeschluss)<br />
• Verkaufsbedingungen vorab festgelegt mit poison pills und golden parachutes<br />
Kooperationen, Allianzen, Synergien<br />
• Motto: Gesamterfolg ist mehr als Summe der Teilerfolge<br />
• Schnelligkeit/Schlagkraft gemeinsam erhöhen vor simpler Größe<br />
• Formen<br />
– Strategische Allianzen<br />
• Abgabe von Randbereichen oder outsourcing von Hilfsfunktionen bei<br />
gleichzeitiger Einbindung in gemeinsames Systemnetzwerk<br />
• 50:50 Allianzen gleich starker Partner mit neuen<br />
Konsensfindungsmethoden<br />
• Allianzen auf Zeit bzw für bestimmtes Ziel (zB Entwicklung)<br />
– Fusionen<br />
– Regionale Allianzen<br />
– Lizenzpartnerschaften<br />
– Wertschöpfungspartnerschaften horizontal und vertikal im Unterschied von<br />
sub-contracting<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
31
Die Plan- und Berichtshierarchie<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Lebensfähige Strukturen durch Parallelorganisation<br />
Orden<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
32
Fallbeispiele<br />
Beispiel für eine offene, heterarchisch organisierte Struktur:<br />
Online-Enzyklopädie WIKIPEDIA:<br />
Freies Wissen, wo jeder frei mitarbeiten kann mittels open-source-Software,<br />
dzt. in 250 Sprachen,<br />
250 Mio Besucher pro Monat = weltweit eine der meistgenutzten Webseiten<br />
2001 von Jimmy Wales/USA gegründet<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
33
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Der in Sydney ansässige Unternehmensverband Technical and Computing Graphics (TCG) besteht<br />
in Form eines Netzwerkes aus etwa 14 kleinen Unternehmen, die unterschiedliche Computerdienstleistungen<br />
anbieten und zusammen als eines der innovativsten australischen Unternehmen im Bereich<br />
tragbarer Datenstationen, Computergrafik, Barcode-Systeme,, elektronischer Datenaustausch, elektronische<br />
Identifizierungssysteme und ähnliche Anwendungen im Bereich der <strong>Info</strong>rmations- und Kommunikationstechnik<br />
betrachtet werden kann. Das TCG-Netzwerk operiert wie ein vielgliedrig organisiertes,<br />
pluralistisches System, das die kreative Vielfalt der beteiligten Partnerunternehmen für die Neuproduktentwicklung<br />
in einer Struktur zusammenführt, die sowohl Kooperation als auch Wettbewerb fördert.<br />
Entscheidend dabei ist eine der Heterarchie folgende Idee der Rollendifferenzierung, wobei die Definition<br />
von Zuständigkeiten im Führungssystem situationsbezogen unter den Partnern ausgehandelt wird.<br />
So übernimmt beispielsweise jenes Partnerunternehmen im TCG-Netzwerk die Führungsrolle im<br />
Produktentwicklungsprozess, welches eine neue Geschäftschance im Markt identifiziert hat.<br />
Der Projektleiter hat die Aufgabe, Entwicklungspartner zu finden, den Markt nach potentiellen Kunden<br />
zu untersuchen und andere TCG-Unternehmen in den Entwicklungsprozess zu involvieren. Darüber<br />
hinaus kann er als temporärer Netzknoten bezeichnet werden, durch den <strong>Info</strong>rmationen und Ressourcen<br />
ins Netzwerk hinein und heraus fließen. Damit bilden sich im TCG-Netzwerk unterschiedliche,<br />
fluktuierende Hierarchien mit überlappender Mitgliedschaft aus. Während einem Unternehmen bei der<br />
Entwicklung eines Neuproduktes die Rolle der Projektleitung zugewiesen wird, kann es in einem<br />
anderen Projekt die Rolle des Implementierenden oder Co-Entwicklers übernehmen.<br />
In diesem Sinne gelingt es dem TCG-Netzwerk, eine flexible Spezialisierung von Personen, Gruppen<br />
und Unternehmen zu schaffen, mit denen wiederum bestimmte Rollenerwartungen korrespondieren.<br />
Gleichzeitig verfügt TCG über wenige gemeinsame Regeln und kein hierarchisches Management,<br />
wodurch die Organisation die Fähigkeit erlangt, sich kontinuierlich hinsichtlich eines veränderten<br />
Bedarfes zu reformieren. Die charakteristischen Merkmale des Unternehmensnetzwerkes sind im<br />
Kasten auf der nächsten Seite zusammengefasst.<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
34
Charakteristische Merkmale des Unternehmensnetzwerkes<br />
am Beispiel TCG<br />
* Wechselseitige Unabhängigkeit<br />
Das TCG-Netzwerk besteht aus unabhängigen Unternehmen,<br />
zwischen denen bilaterale Vertragsbeziehungen<br />
bestehen.<br />
Grundsätzlich ist das Netzwerk für neue Unternehmen<br />
offen, sofern sie sich den gemeinsamen Regeln für ein<br />
kooperatives Zusammenarbeiten unterwerfen. Innerhalb<br />
des Netzwerkes gibt es keine hierarchische<br />
Führungsstruktur.<br />
* Partner bevorzugt<br />
Partnerunternehmen wird bei ähnlichem Leistungsprofil<br />
prinzipiell der Vorzug vor Externen gegeben.<br />
* Begrenzter Wettbewerb<br />
Der Wettbewerb unter den Partnern ist begrenzt, um<br />
vertrauensvolle Beziehungen aufbauen zu können.<br />
* Keine kurzsichtige Ausbeutung<br />
Partnerunternehmen versuchen nicht, kurzfristige Gewinne<br />
auf Kosten ihrer Kooperationspartner zu erwirtschaften,<br />
* Flexibilität und Geschäftsautonomie<br />
Die Flexibilität des Netzwerkes resultiert aus der Fähigkeit<br />
der Partnerunternehmen, auf identifizierte<br />
Geschäftschancen schnell zu reagieren. Sofern nicht<br />
gegen gemeinsame Abmachungen und Regeln verstoßen<br />
wird, ist ein Zustimmung der anderen Netzwerkpartner<br />
nicht erforderlich.<br />
* Netzwerkdemokratie<br />
Das Netzwerk verfügt weder über ein zentrales<br />
Entscheidungsgremium noch über eine formale<br />
Führungsstruktur.<br />
Peter Kutis<br />
* Ausschluss<br />
Partner, die sich opportunistisch verhalten, und gegen<br />
gemeinsame Regeln verstoßen, können aus dem<br />
Netzwerk durch Abbruch der Geschäftsbeziehungen<br />
ausgeschlossen werden.<br />
* Subcontracting<br />
Das Netzwerk beinhaltet keine Unternehmen, die ausschließlich<br />
als Subcontractor eingebunden werden.<br />
Vielmehr besteht die Erwartung, dass jedes Unternehmen<br />
auch neue Geschäfte für das Gesamtnetzwerk akquiriert.<br />
* Eintritt<br />
Das Netzwerk ist offen für neue Partnerschaften.<br />
Potentielle Partner können keine finanzielle Unterstützung<br />
vom Netzwerk erwarten, sondern müssen extern Kapital<br />
akquirieren.<br />
* Austritt<br />
Prinzipiell kann jedes Unternehmen das Netzwerk verlassen.<br />
Da es jedoch keine veräußerbaren Geschäftsanteile<br />
gibt, muss ein Austritt fallweise verhandelt werden.<br />
Quelle: Miles/Snow (1995), S. 9 (adaptiert)<br />
Struktur eines fraktalen Softwareunternehmens mit 155<br />
Mitarbeitern, 36 Kompetenzteams, 9 Kompetenzcentern und<br />
3 Geschäftsbereichen<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
35
Team-Definition:<br />
Ein Team ist eine kleine Gruppe von Personen,<br />
deren Fähigkeiten einander ergänzen und die sich<br />
für eine gemeinsame Sache, gemeinsame<br />
Leistungsziele und einen gemeinsamen Arbeitseinsatz<br />
engagieren und gegenseitig zur Verantwortung<br />
ziehen. (Mc Kinsey)<br />
SEMCO – Management (1)<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
• Flat circular organization: 12 Ebenen auf 4 reduziert: counsellors-partners-coordinatorsassociates,<br />
gleichzeitig miteinander verwoben<br />
• No Org-charts: nur wenn für Erklärung von Prozessen nötig, aber sobald wie möglich wieder<br />
zu vernichten<br />
• Flexitime: freie Arbeitszeiteinteilung mit Kollegen (auch shopfloor-level !), keine<br />
Zeiterfassungskontrolle<br />
• Manufacturing cells statt assembly lines für mehr Verantwortung und Autonomie; eigene<br />
Vorgaben, Produktivitätsziele und Vorschläge möglich<br />
• Self-set pay: Mitentscheid bei Gehalt auf fast allen Ebenen<br />
• Salary surveys: Mitarbeiter sollen Gehälter am Markt aktiv vergleichen und an Unternehmen<br />
berichten<br />
• Profit-sharing: Basis-Prozentsatz am Unternehmensgesamtgewinn zur Verteilung verhandelt<br />
(ca. 25 %), dann eigenständige Verteilung in den Abteilungen, Firmen, etc.<br />
• Transparency: alle Unternehmensinfos werden veröffentlicht, plus Kurse für Verstehen (z.B.<br />
Bilanzlesen für Arbeiter)<br />
• Risk salary: freiwilliges Programm: in schlechten Zeiten -25 %, in guten +125%<br />
• Keine Statussymbole, keine Reisevorschriften (Kategorie etc): Korrektiv Kollegen<br />
• Headline one page memos only<br />
• No Vacation accumulation: jeder muss Urlaub im Jahr verbrauchen wegen Erholung/Abstand<br />
• Hepatitis leave: sabbatical für mehrere Wochen oder Monate alle 2 Jahre möglich<br />
• Lost in space: junge Mitarbeiter dürfen 12 Monate in 12 verschiedenen Abteilungen ohne Chef<br />
und bestimmter Aufgabe Erfahrung sammeln<br />
Quelle: Ricardo Semler. Maverick (Einzelgänger). UK 1993, www.semco.locaweb.com.br/en<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
36
SEMCO – Management (2)<br />
Peter Kutis<br />
• Factory committee: zwingend in jeder business unit einzusetzen plus Einbindung Gewerkschaft<br />
sowie regelmäßiger institutionalierter Dialog mit Management, alle Themen genereller<br />
Bedeutung<br />
• Management by walking-around: keine Mauern, nur Pflanzen als Barrieren<br />
• Reverse evaluation: vor Aufnahme/Beförderung muss es Interviews und Bewertung von<br />
Kollegen und zukünftigen Mitarbeitern geben<br />
• Regelmäßige Bewertung auch der Vorgesetzten durch anonyme multiple-choice-Fragebögen<br />
von Mitarbeitern<br />
• Down-bossing auch im Verhalten, keinerlei Diskrimierung<br />
• Mitarbeiter werden als mündige Bürger in allen Belangen angesehen: keine Zwangsprogramme<br />
(z.B. Sport, etc.), nur Unterstützung, wenn selbst gewünscht<br />
• Gegen Entfremdung: jede business unit maximal 150 Mitarbeiter<br />
• Elimination of support-staff (Sekretär(in),Assistant(in),Rezeptionist, etc.): jeder selbst<br />
typing,copying,coffeeing,guest fetching, etc.<br />
• Working at home forciert<br />
• Satellite programme: Hilfe und Vernetzung bei Selbständig-Machen<br />
• Family silverware: bei 70 % Eignung wird eigener Mitarbeiter bei Jobbesetzung bevorzugt<br />
• Clean-outs: 2 Mal jährlich ein Nachmittag shut-down in allen Abteilungen für Auskehren jedes<br />
Arbeitsplatzes (Dokumente, Papiere bis zu alten Maschinen)<br />
Quelle: Ricardo Semler. Maverick. UK 1993<br />
SEMCO Principles and Values<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
1 – To be a dependable and reliable company;<br />
2 – Value honesty and transparency over and above all temporary interests;<br />
3 – Seek a balance between short-term and long-term profit;<br />
4 – Offer products and services at fair prices which are recognized by customers as the<br />
best on the market;<br />
5 – Provide the customer with differentiated services, placing our responsibility before profits;<br />
6 – Encourage creativity, giving support to the bold;<br />
7 – Encourage everyone's participation and question decisions that are imposed from the top down;<br />
8 – Maintain an informal and pleasant environment, with a professional attitude and free of<br />
preconceptions;<br />
9 – Maintain safe working conditions and control industrial processes to protect our personnel and the<br />
environment;<br />
10 – Have the humility to recognize our errors and understanding that we can always improve.<br />
Corporate Democracy and Participative Management<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
37
The last Lecture: Really Achieving your Childhood Dreams, 18.9 2007<br />
Randy Pausch, Professor für Computerwissenschaften,<br />
Carnegie Mellon University/ Pittsburgh/USA, 1960 – 25.7.2008, Pankreaskrebs<br />
Kein Vortrag über Leidensweg und das Sterben, sondern über das Leben:<br />
Projektsemester „Erfinde Deine eigene virtuelle Realität“ als Spiel im Projektteam<br />
ETC: Entertainment Technology Center mit eigenem Master-decree<br />
Träume träumen und zu realisieren versuchen<br />
Spaß haben bei allem („Es macht Spaß, das Unmögliche zu versuchen.“)<br />
Be prepared: Luck is where preparation meets opportunity !<br />
Loyalität ist keine Einbahnstrasse<br />
Wie helfen Dir Menschen (Erkenntnis: Alleine geht´s nicht):<br />
immer Wahrheit sagen<br />
ehrlich entschuldigen<br />
Fokus auf andere, nicht nur auf sich selbst<br />
<strong>Internet</strong>: w_.cmu.edu/uls/journeys/randy-pausch/index<br />
Randy Pausch: Last Lecture. Die Lehren meines Lebens. Bertelsmann 2008<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
38
SELBSTORGANISATION<br />
SELBSTLERNFUNKTIONEN<br />
(Recht auf Irrtum)<br />
SELBSTERHALTUNGSFUNKTIONEN<br />
(Recht auf Wachstum)<br />
SELBSTSTEUERUNGSFUNKTIONEN<br />
(Recht auf Entscheidung)<br />
OFFENE STRUKTUR<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
39
Wird die Wissensgesellschaft chaotisch sein?<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
<strong>Was</strong> <strong>bedeutet</strong> <strong>Info</strong>-/<strong>Internet</strong>-<strong>Zeitalter</strong>?<br />
• Wandel/Dynamik:<br />
– 15 % der Chinesen sprechen Engl. = #1 englischsprachiges Land in 3 J<br />
– 2010: 540.000 englische Worte = 5* mehr als zur Shakespeare-Zeit<br />
– Indien als brain trust: 25% Inder mit über-DS IQ > US-<br />
Gesamtbevölkerung (ca. 300 Mio)<br />
• Arbeitswelt,Sozialumfeld:<br />
– 10 gefragteste Jobs 2010 gab es 2000 noch nicht<br />
– 1 von 4 Unselbständigen < 1 Jahr bei gleichem Arbeitgeber<br />
1 von 2 < 5 J.<br />
– Schätzung US-Arbeitsmin.: heutige Schüler werden mit 38 J bereits DS<br />
10-14 Jobs gemacht haben<br />
– 2009: 1 von 8 US-Eheschließung erfolgt nach online-Bekanntschaft<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
40
Peter Kutis<br />
<strong>Was</strong> <strong>bedeutet</strong> <strong>Info</strong>-/<strong>Internet</strong>-<strong>Zeitalter</strong>?<br />
• <strong>Info</strong>.volumen der NY-Times aus 1 Woche > Mensch über gesamte<br />
Lebenszeit im 18.Jhd.<br />
• Erreichen von 50 Mio. Menschen Marktdurchdringung:<br />
– Radio 38 J.<br />
– TV 13 J.<br />
– <strong>Internet</strong> 4 J.<br />
– iPod 3 J.<br />
– Facebook 2 J.<br />
• Exponentielle Zeit: 2009 31 Bill.Google-Suchen/Monat, 2006: 2,7 Bill<br />
• Schnelllebigkeit: 1.kommerzielle Textmessage: 12/1999,<br />
2010: pro Tag > Weltbevölkerung (ca. 1,35 Mrd)<br />
• Technische <strong>Info</strong>rmation: Verdoppelung alle 2 Jahre<br />
– Technikstudent mit 4 Jahres-Studium: Hälfte, was im 1.Jahr gelernt<br />
wurde, ist im 3.Studiumsjahr bereits veraltet !<br />
Quelle: Presse, 6.10.2011<br />
D,Nl: je 12 unter Top 200<br />
Ö: 1 !<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
41
Peter Kutis<br />
<strong>Was</strong> <strong>bedeutet</strong> <strong>Info</strong>-/<strong>Internet</strong>-<strong>Zeitalter</strong>?<br />
• 2010: 4 Exabytes (4,0*10^19) an unique <strong>Info</strong>rmationen generiert ><br />
5000 Jahre zuvor<br />
• NTT/Japan: neues einzelnes Glasfaserkabel mit 14 Trill.Bits/sec =<br />
2660 CD´s oder 210 Mio Telefongespräche<br />
• <strong>Info</strong>-Leitungsmöglichkeit: Verdreifachung alle 6 Monate (Schätzung,<br />
dass dies zumindest 20 Jahre weiter anhält)<br />
• Zukunft ?: 2013 Supercomputer mit mehr<br />
Rechenoperationsmöglichkeiten als das sehr komplexe menschliche<br />
Gehirn<br />
• 2050: 1000 $-Computer leistet quantitativ mehr Rechenleistung als<br />
Gehirne der gesamten Menschheit<br />
Begriffe der Wissensgesellschaft<br />
Komplexität Art und Anzahl der Relationen zwischen Elementen eines Systems<br />
(Überschuss an Optionen)<br />
Managementziel: Komplexität reduzieren, mit Komplexität<br />
umgehen können<br />
Kompliziertheit Grad der Unterschiedlichkeit der Elemente eines Systems<br />
Managementziel: Unterschiedlichkeit zu erkennen und<br />
daraus Schlussfolgerungen zu ziehen<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Kompetenz Ein Unternehmen ist ein System von unternehmensspezifischen<br />
Kompetenzen. Je spezifischer diese Kompetenzen ausgeprägt sind und<br />
je besser sie der Marktnachfrage entsprechen, desto wettbewerbsfähiger<br />
ist das Unternehmen<br />
Managementziel: positive Wissensbilanz erzielen, die dann wertvoll ist,<br />
wenn Unvorhergesehenes bewältigt werden kann<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
42
Peter Kutis<br />
negative Wissensbilanz: ausschließlich Bedürfnisse der Kunden erfüllen<br />
positive Wissensbilanz: gegenwärtige und künftige Bedürfnisse der<br />
Kunden erraten zu wollen<br />
Elastizität Fähigkeit zu Visionen (forecast, foresight), zu Strategieevolution,<br />
Organisationsinnovationen<br />
Managementziel: Anpassungsfähigkeit fördern (d.h. Redundanz* zu<br />
tolerieren, Parallelentwicklungen zulassen,<br />
Heterarchien akzeptieren)<br />
* Redundanz .... die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers fällt mit zunehmender Redundanz<br />
(wie überflüssiger <strong>Info</strong>rmation) exponenziell (Eigenschaften eines Teams)<br />
Suche nach Veränderung in der Zukunft organisieren<br />
(besser in Teams als in einer Zukunftsabteilung)<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
43
Peter F. Drucker: Erkenntnisse<br />
Peter Kutis<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
Ein Artikel Druckers in der US-Zeitschrift „Forbes ASAP“ (29. 8. 94) ist dem Thema „<strong>Info</strong>literacy“ gewidmet. Die Grundaussage<br />
ist eigentlich nur, dass der Chef auf keinen Fall die Festlegung des <strong>Info</strong>rmationsbedarfs des Unternehmens einem <strong>Info</strong>rmatiker<br />
oder <strong>Info</strong>rmationsmanager überlassen darf. Unternehmen werden heute um <strong>Info</strong>rmationen herum strukturiert. Und das ist<br />
Chefsache. In diesem Artikel sind auch für den amerikanischen Management-Professor ganz typische Erkenntnisse enthalten:<br />
- „Vor vielen, vielen Jahren prägte ich den Begriff „Profitcenter“. Heute schäme ich mich dafür, denn innerhalb eines<br />
Unternehmens kann es keine Profitcenter geben. Das sind alles nur Kostencenter. Der Gewinn kommt nur von<br />
außen. Wenn ein Kunde einen Wiederholungsauftrag gibt - und sein Scheck platzt nicht - hat man ein Profitcenter.<br />
Alles davor sind Kosten.“<br />
- „Wenn wir von Weltwirtschaft sprechen, kann ich nur hoffen, dass niemand glaubt, dass man wirklich global<br />
agieren kann. Man kann es nicht. Die <strong>Info</strong>rmationen reichen nicht …. Das Unternehmen der Zukunft wird auf das<br />
konzentrieren, worüber es <strong>Info</strong>rmationen besitzt.“<br />
- „Für die meisten Chefs ist die wichtigste <strong>Info</strong>rmation nicht die über ihre Kunden, sondern die über die Nichtkunden.<br />
Dort spielen sich die Veränderungen ab.“<br />
Als Beispiel führt Drucker die amerikanischen Kaufhäuser an. Niemand wusste mehr über seine Kundschaft als sie. Mit diesem<br />
Wissen konnten sie die Kunden und 28 Prozent Marktanteil bis zu den 80er Jahren halten. Nur: Sie wussten nichts über die<br />
Nichtkunden und ihre 72 Prozent Marktanteil. Und diese Nichtkunden begannen im Kaufe der 80er Jahre, das Kaufverhalten in<br />
den USA zu bestimmen. „Die Kaufhäuser wussten mehr und mehr über weniger und weniger.“<br />
Trendletter 10/94<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
44
Peter Kutis<br />
Der Übergang aus der Industrie- in die Wissensgesellschaft<br />
Industriegesellschaft Wissensgesellschaft<br />
Eine Ware war um so wertvoller,<br />
je weniger davon im Umlauf war.<br />
Je höher der Preis der Ware,<br />
desto mehr kann man verdienen.<br />
Handelsbarrieren und Zollschranken regeln<br />
den Warenstrom und die Verkäufer brauchten<br />
Visa, Arbeitsbewilligungen und<br />
Geldtransaktionen.<br />
Je mehr Netzwerkteilnehmer es gibt, desto<br />
wertvoller ist die Teilnahme (z.B. Faxgeräte).<br />
Herschenken kann im Netzwerk zur Gewinnmaximierung<br />
führen (z.B. Netscape oder<br />
Sun haben die ersten Millionen Kopien<br />
verschenkt).<br />
Ein Software-Hersteller benötigt weder ein<br />
Visum noch eine Arbeitsbewilligung, noch zahlt<br />
er Zoll, um weltweit sein Geld zu verdienen.<br />
Strategische Kernkompetenzen in der Wissensgesellschaft<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
Peter Kutis<br />
1. Überlegene Beherrschung des Wertschöpfungsprozesses<br />
2. Eingespielte Mitarbeiter (Team)<br />
3. Bekanntheit der Marke<br />
4. Zugang zu den Kunden<br />
Quelle: Turnheim<br />
Folien TU Vorlesung, 15.11.2011<br />
45