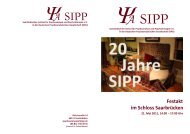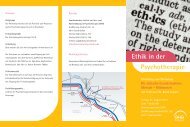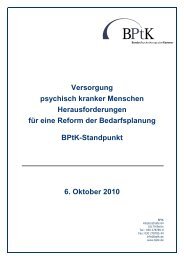Psychotherapie und Erziehungsberatung
Psychotherapie und Erziehungsberatung
Psychotherapie und Erziehungsberatung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Klaus Menne<br />
<strong>Psychotherapie</strong> <strong>und</strong> <strong>Erziehungsberatung</strong><br />
Das Verhältnis von <strong>Erziehungsberatung</strong> zur <strong>Psychotherapie</strong> ist ein inniges. Es ist so eng, dass<br />
<strong>Erziehungsberatung</strong> ohne <strong>Psychotherapie</strong> kaum zu denken ist. Deshalb war es selbstverständlich,<br />
dass viele Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter in den örtlichen Beratungsstellen die Approbation als<br />
Psychologische Psychotherapeuten bzw. Kinder- <strong>und</strong> Jugendlichenpsychotherapeuten beantragt <strong>und</strong><br />
erhalten haben. Ist also nicht davon auszugehen, dass der Psychologische Psychotherapeut quasi<br />
natürlicherweise das multidisziplinäre Team der <strong>Erziehungsberatung</strong> verstärkt <strong>und</strong> dass entsprechend<br />
die Ausübung von <strong>Psychotherapie</strong> jedenfalls einen Teil der Arbeit in der <strong>Erziehungsberatung</strong><br />
ausmacht? - Innige Verhältnisse können auch einen Dissens einschließen oder geradezu<br />
hervorbringen. Und so ist auch die Relation von <strong>Psychotherapie</strong> <strong>und</strong> <strong>Erziehungsberatung</strong> kontrovers<br />
erörtert worden. Ich werde deshalb versuchen, Abstand zu gewinnen <strong>und</strong> mich dem Thema über<br />
einen historischen Rückblick nähern. Danach werde ich <strong>Psychotherapie</strong> <strong>und</strong> <strong>Erziehungsberatung</strong> zu<br />
einander in Beziehung setzen, um schließlich <strong>Erziehungsberatung</strong> als eine Leistung eigener Art<br />
auszuweisen.<br />
Zur Geschichte<br />
Es liegt nun beinahe h<strong>und</strong>ert Jahre zurück, dass in Deutschland die erste Einrichtung gegründet<br />
worden ist, die die Bezeichnung „<strong>Erziehungsberatung</strong>“ in ihrem Namen geführt hat. Fürstenheim hat<br />
im Jahr 1906 die „Medico-pädagogische Poliklinik für Kinderforschung, <strong>Erziehungsberatung</strong> <strong>und</strong><br />
ärztliche Behandlung“ gegründet. Weitere Einrichtungen mit unterschiedlichen Bezeichnungen kamen<br />
zunächst nur zögernd hinzu. Ein Durchbruch erfolgte Anfang der 20er Jahre des letzten Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
als in den Bezirken Wiens 23 „<strong>Erziehungsberatung</strong>sstelen“ geschafen wurden. Seitdem hat sich der<br />
Terminus <strong>Erziehungsberatung</strong> durchgesetzt – auch wenn der eine oder andere mit dieser<br />
Formulierung eine Schwierigkeit hat.<br />
Die Entwicklung der <strong>Erziehungsberatung</strong> reicht damit in jene Zeit zurück, in der auch die Anfänge der<br />
<strong>Psychotherapie</strong> zu finden sind. Freuds Traumdeutung erschien im ersten Jahr des neuen<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts. Und es ist kein Zufall, dass es der Psychoanalytiker August Aichhorn war, der in Wien<br />
die Gründung von <strong>Erziehungsberatung</strong>sstellen aktiv betrieben hat. Hatte doch auch Freud eine Vision<br />
entwickelt, nach der künftig „Anstalten oder Ordinationsinstitute erichtet werden, an denen<br />
psychoanalytisch gebildete Ärzte angestellt sind, um die Männer, die sich sonst dem Trunk ergeben<br />
würden, die Frauen, die unter der Last der Entsagungen zusammenzubrechen drohen, die Kinder,<br />
denen nur die Wahl zwischen Verwilderung <strong>und</strong> Neurose bevorsteht, durch Analyse widerstands- <strong>und</strong><br />
leistungsfähig zu erhalten. Diese Behandlungen werden“ –so seine Vision – „unentgeltliche sein. Es<br />
mag lange dauern, bis der Staat diese Pflichten als dringende empfindet“ (Freud 1919, S. 193). In der<br />
Tat, es hat gedauert, aber seit 1990 ist für die Unterstützung der Entwicklung von Kindern ein<br />
Rechtsanspruch auf eine therapeutisch kompetente <strong>Erziehungsberatung</strong> Wirklichkeit.<br />
Schon jene Anfänge haben <strong>Erziehungsberatung</strong> in den Kontext eingebettet, in dem sie auch heute<br />
erörtert werden müssen: nämlich in den sozialpädagogisch geprägten Zusammenhang mit der<br />
Fürsorgeerziehung, oder wie wir heute sagen: der Fremdunterbringung. <strong>Erziehungsberatung</strong>, das hieß<br />
für August Aichorn mit „kriminelen <strong>und</strong> dissozialen Jugendlichen“ zu arbeiten, mit „schwer erziehbaren<br />
<strong>und</strong> neurotischen Kindern“ (1951, S. 9) –mit der Klientel der Jugendhilfe eben.<br />
Es hat noch eine Zeit gedauert, bis <strong>Erziehungsberatung</strong>sstellen als ein flächendeckendes<br />
Unterstützungsangebot für Familien in Deutschland etabliert worden sind. Ab 1970 ist in kurzer Zeit
die Mehrzahl der heute bestehenden Einrichtungen geschaffen worden. Und erneut ging die<br />
Etablierung der <strong>Erziehungsberatung</strong> mit der Entwicklung in der <strong>Psychotherapie</strong> einher: Hatte anfangs<br />
die Psychoanalyse Pate gestanden, waren es nun die neuen therapeutischen Richtungen<br />
�� die Verhaltensstherapie<br />
�� die Gesprächstherapie<br />
�� die Gestalttherapie,<br />
die als Zusatzqualifikationen erworben werden konnten <strong>und</strong> es den Beratungsstellen ermöglichten,<br />
stärker als zuvor mit den Kindern <strong>und</strong> ihren Familien an deren Problemen zu arbeiten.<br />
Es ist diese Zeit, in der sich die fachliche Identität der <strong>Erziehungsberatung</strong> zu festigen beginnt wie sie<br />
in den „Gr<strong>und</strong>sätzen“ der Jugendminister für die Förderung von <strong>Erziehungsberatung</strong>sstelen (1973)<br />
ihren Ausdruck gef<strong>und</strong>en hat. Es ist eine Zeit der Professionalisierung der <strong>Erziehungsberatung</strong> <strong>und</strong><br />
zwar in Orientierung am medizinischen Modell psychotherapeutischer Praxis. Die Professionalisierung<br />
betrifft das methodische Handwerkszeug zum einen, die möglichen Settings der Intervention zum<br />
anderen <strong>und</strong> die Pflicht zum Schutz des Privatgeheimnisses der Ratsuchenden zum dritten. Nicht<br />
zuletzt eine strikte Handhabung der Schweigepflicht hat <strong>Erziehungsberatung</strong> in einen Gegensatz<br />
gebracht zur damaligen Jugendhilfe, der sie doch zugehört. Aber eine Jugendhilfe, die am Paradigma<br />
der Kontrolle ausgerichtet ist <strong>und</strong> deren Hilfe im Eingriff in die Familie besteht, hat kein alternatives<br />
Modell der Professionalisierung geboten.<br />
Es war also folgerichtig, dass die Fachkräfte der Erziehungs- <strong>und</strong> Familienberatung, die als<br />
Psychologen in der großen Mehrzahl über - zum Teil auch mehrere -psychotherapeutische<br />
Zusatzqualifikationen verfügen <strong>und</strong> sich in ihrer Praxis als Psychotherapeuten verstehen, die<br />
Anerkennung in dem Beruf erlangen wollten, den bereits auszuüben sie ja überzeugt sind. Ihre<br />
Approbation sollte eine erworbene Kompetenz bestätigen.<br />
<strong>Psychotherapie</strong><br />
Aber genau dieser Akt, die staatliche Anerkennung der Befähigung, <strong>Psychotherapie</strong> ausüben zu<br />
können, führt zu den Fragen, die heute erörtert werden müssen. Wird <strong>Erziehungsberatung</strong> zu einer<br />
heilk<strong>und</strong>lichen Leistung, weil ein approbierter Psychotherapeut sie ausübt? Oder setzt eine Diagnose<br />
in der <strong>Erziehungsberatung</strong> die Approbation des Diagnostizierenden voraus? Müssen gar Aufgaben<br />
abgegrenzt <strong>und</strong> unterschiedlichen Gr<strong>und</strong>berufen zugeordnet werden?<br />
Solche Fragen gehen von einer stillschweigenden Annahme aus: dass nämlich <strong>Psychotherapie</strong><br />
begrifflich hinreichend klar bestimmt sei, dass <strong>Psychotherapie</strong> paraphrasiert werde müsse als<br />
heilk<strong>und</strong>liche Behandlung einer seelischen Krankheit <strong>und</strong> folglich dort, wo <strong>Psychotherapie</strong> sich findet,<br />
auch immer Heilk<strong>und</strong>e ihren Ort habe. Oder anders gesprochen, dass nur derjenige, der über eine<br />
Approbation verfügt, psychotherapeutische Interventionstechniken verwenden dürfe. <strong>Psychotherapie</strong><br />
in dieser Weise als eine gefestigte Entität zu aufzufassen greift jedoch zu kurz. Das Wissen, auf dem<br />
die heilende Intervention basiert, ist allgemeiner als die therapeutische Technik. In einer kleinen Arbeit<br />
über „Psychische Behandlung“ hat schon Freud festgehalten: „Man könnte also meinen, dass darunter<br />
verstanden wird: Behandlung der krankhaften Erscheinungen des Seelenlebens. Dies ist aber nicht<br />
die Bedeutung dieses Wortes. Psychische Behandlung will vielmehr besagen: Behandlung von der<br />
Seele aus. Behandlung - seelischer oder körperlicher Störungen - mit Mitteln, welche zunächst <strong>und</strong><br />
unmittelbar auf das Seelische des Menschen einwirken. - Ein solches Mitel ist vor alem das Wort .”<br />
(Freud 1905, S. 289).<br />
Nun können zwar verschiedene Formen der sprachlichen Kommunikation als spezifisch für eine<br />
therapeutische Interaktion ausgezeichnet werden: sei es das Spiegeln einer Gefühlslage, die<br />
Konfrontation mit einem Sachverhalt oder die Deutung eines unbewussten Sinnes, der einem Zuhörer<br />
sich aufnötigt, dem Sprecher aber unzugänglich bleibt. Aber diese sprachlichen Mittel werden dadurch
nicht zu gleichsam “patentierbaren“ Techniken, die - in einer Alltagssituation angewandt - das<br />
Gespräch zu einem therapeutischen Kontakt mutieren ließen. Im Gegenteil: Wie die seelischen<br />
Konflikte selbst sich in Sprache ausdrücken können, so knüpft auch <strong>Psychotherapie</strong> an den in der<br />
Sprache inhärenten Möglichkeiten an. Sie gründet in der allgemeinen Sprachkompetenz natürlicher<br />
Sprecher. Daher können Elemente von <strong>Psychotherapie</strong> auch in anderen Formen methodisch<br />
disziplinierter Kommunikation wieder gef<strong>und</strong>en werden.<br />
Das gilt z.B. für Supervision. Sie knüpft an das methodische Repertoire der jeweiligen therapeutischen<br />
Schule an <strong>und</strong> verwendet deren Erkenntnismittel ohne dass deshalb Supervision als <strong>Psychotherapie</strong>,<br />
gar als heilk<strong>und</strong>liche Behandlung, aufgefasst werden dürfte. Sie fördert vielmehr die Erkenntnis- <strong>und</strong><br />
Interventionsfähigkeit des Therapeuten.<br />
Auch Mediation als Verfahren der Vermittlung zwischen zwei strittigen Parteien verwendet<br />
Gesprächstechniken, die der <strong>Psychotherapie</strong> entnommen sind. Doch blendet Mediation gerade die<br />
seelische Dimension eines Konfliktes aus <strong>und</strong> versucht –orientiert an den Interessen beider Seiten -<br />
einen Ausgleich in der Sache zu erreichen.<br />
Beratung schließlich ist ein unübersichtliches Feld. Es reicht von informatorischen Beratungen (wie<br />
Verbraucherberatung <strong>und</strong> Ernährungsberatung), die Sachverhalte für die eigene Entscheidung des<br />
Beratenen aufbereiten, über aktivierende Unterstützung etwa bei Beratungen im Kontext von<br />
Arbeitslosigkeit bis hin zu Beratungsfeldern, die den Beratenen selbst <strong>und</strong> die Beziehungen, in denen<br />
er lebt, thematisieren. Die Eheberatung ist mit ihrem klaren Setting noch am ehesten der<br />
therapeutischen Situation nachgebildet; in sie gehen auch Erfahrungen psychotherapeutischer Praxis<br />
ein ohne dass sie deshalb selbst schon <strong>Psychotherapie</strong> wäre. Der Deutsche Arbeitskreis für Jugend-,<br />
Ehe- <strong>und</strong> Familienberatung (DAKJEF) –der Zusammenschluss der Verbände der Institutionellen<br />
Beratung - formuliert deshalb: „Im Schutz einer durch Vertrauen <strong>und</strong> ganzheitliche Wahrnehmung<br />
geprägten Beziehung kann der bzw. die Ratsuchende neue gedankliche, emotionale <strong>und</strong><br />
Sinnzusammenhänge erkennen <strong>und</strong> neue Verhaltensmöglichkeiten entwickeln <strong>und</strong> erproben“ (1993, S<br />
6f.). Und <strong>Erziehungsberatung</strong> ist von der B<strong>und</strong>eskonferenz für <strong>Erziehungsberatung</strong> gerade in<br />
Abgrenzung zu inhaltsbezogenen Beratungsaufgaben als eine personenbezogene Beratung<br />
charakterisiert worden, als eine Beratung, die den Klienten die Möglichkeit gibt, „die eigenen Gefühle<br />
<strong>und</strong> Reaktionsweisen zu verstehen <strong>und</strong> sie im Zusammenhang ihrer familialen <strong>und</strong> sozialen<br />
Beziehungen zu sehen“ (bke 1993, S. 269). Die vom Wissenschaftlichen Beirat des<br />
Familienministeriums in seinem Gutachten zu „Familie <strong>und</strong> Beratung“ (1993) von einer Beratung<br />
abgegrenzten therapeutischen Fähigkeiten machen gerade den Kern einer personenbezogenen<br />
Beratung aus. Diese gründet auf psychotherapeutischer Kompetenz.<br />
<strong>Psychotherapie</strong> <strong>und</strong> <strong>Erziehungsberatung</strong> sind beide dadurch gekennzeichnet, dass sie die Beziehung<br />
zwischen Beraterin <strong>und</strong> Mutter oder Vater des Kindes einerseits bzw. zwischen Therapeut <strong>und</strong> Patient<br />
andererseits als das Medium der Veränderung darstellen. Wobei die Beraterin die eigenen<br />
Empfindungen <strong>und</strong> Gefühlslagen, die sich in Reaktion auf die andere Person einstellen, zum<br />
Verständnis der Situation benutzt.<br />
Komplexe Problemsituation<br />
Wenn es aber nicht die Methoden des Vorgehens sind, die <strong>Erziehungsberatung</strong> eindeutig von<br />
<strong>Psychotherapie</strong> abgrenzen lassen, dann muss man versuchen, einen Anhaltspunkt in den Problemen<br />
zu finden, mit denen <strong>Erziehungsberatung</strong> sich zu befassen hat. Die Problemsituationen, mit denen<br />
Kinder, Jugendliche <strong>und</strong> ihre Familien Erziehungs- <strong>und</strong> Familienberatung in Anspruch nehmen, sind in<br />
der Regel komplex angelegt. Sie betreffen z.B. innere Zustände von Kindern (ihre Ängstlichkeit oder<br />
Traurigkeit), ihr Verhalten in sozialen Kontexten (sei dies eine Tendenz, sich in Gruppen zu isolieren<br />
oder etwa aggressives Handeln anderen Kindern gegenüber) aber auch Körperfunktionen. (Einnässen
<strong>und</strong> Einkoten sind seit jeher Themen der <strong>Erziehungsberatung</strong>). Die Anlässe, aus denen heraus<br />
Unterstützung gesucht wird, sind vielfach miteinander kombiniert. Und das am Kind oder Jugendlichen<br />
identifizierbare „Problem“, für das um Abhilfe nachgefragt wird, ist darüber hinaus eingebetet in die<br />
konkrete Situation der Familie mit ihrer eigenen Geschichte von Glück <strong>und</strong> Leid, Konflikt <strong>und</strong><br />
Versöhnung. Das Problem des Kindes, eine Leistungsschwäche oder Konzentrationstörung, besteht<br />
aber oft auch in einem sozialen Kontext, in diesen Beispielen meist in der Schule. Oder das Problem<br />
ist unter dem Eindruck einer veränderten Situation der Familie entstanden, z.B. durch die Folgen der<br />
Arbeitslosigkeit eines Elternteils. Die Probleme eines Kindes bzw. die Probleme, die andere –nämlich<br />
Erwachsene –mit einem Kind haben, sind eng verwoben mit der Welt, in der das Kind lebt, mit seiner<br />
sozialen Lebenswelt.<br />
Eine andere Möglichkeit, den Unterschied von Therapie <strong>und</strong> Beratung zu markieren, könnte in der<br />
Diagnose dieser in der <strong>Erziehungsberatung</strong> vorgestellten Probleme liegen. Sind sie im Rahmen des<br />
ICD 10 –Schlüssels erfassbar, so könnten sie zu einer psychischen Störung mit Krankheitswert<br />
zusammengefasst werden, die einer Behandlung durch heilk<strong>und</strong>liche <strong>Psychotherapie</strong> zuzuführen<br />
wäre. Damit wäre schon die Aufgabe approbierter Psychotherapeuten in der <strong>Erziehungsberatung</strong><br />
gewonnen. Und alle jene Anlässe, die nicht in dieser Weise klassifiziert werden können, wären einer<br />
dann nicht-heilk<strong>und</strong>lichen Form der Unterstützung zuzuführen.<br />
Allein, so sehr wir intendieren müssen, die Probleme der Familie ohne unsere eigenen persönlichen<br />
Bewertungen neutral, möglichst wissenschaftlich objektiv, zu erfassen, so sehr wissen wir doch auch,<br />
dass die Objektivität einer Diagnose nicht umstandslos zu haben ist. Borg-Laufs hat dies auf den<br />
Punkt gebracht „Ob eine Störung ‚Krankheitswert’ besitzt, ist nicht abhängig von der Art <strong>und</strong> kaum von<br />
der Schwere eines Problems. Es ist eine Frage der (Re-)Konstruktion eines Phänomens durch einen<br />
Beobachter“ (Borg-Laufs 2001, S. 175). Dies hat uns die Kritik des Konstruktivismus ins Bewusstsein<br />
gehoben.<br />
Es sind also die Unterschiede im diagnostischen Vorgehen festzuhalten. Für eine heilk<strong>und</strong>liche<br />
Behandlung im Rahmen der Richtlinien-<strong>Psychotherapie</strong> ist es erforderlich, eine ätiologisch orientierte<br />
Diagnostik zu betreiben, die die als krankhaft erscheinenden Phänomene aus der unbewussten<br />
Psychodynamik des Patienten (im Falle psychoanalytischer Verfahren) bzw. (im Falle einer<br />
Verhaltenstherapie) im Rahmen einer Verhaltensanalyse aus den ursächlichen <strong>und</strong> die Krankheit<br />
aufrechterhaltenden Bedingungen des Krankheitsgeschehens erklärt. Die diagnostische Erfassung<br />
des Krankheitszustandes in seiner Komplexität ist notwendige Voraussetzung auch dann, wenn<br />
therapeutisch nur ein Teilziel erreicht werden soll (<strong>Psychotherapie</strong>-Richtlinien, A 6).<br />
<strong>Erziehungsberatung</strong> prüft demgegenüber z.B.,<br />
�� ob ein auffälliges Verhalten, die scheinbare Störung des Kindes, ihm selbst zuzuordnen ist<br />
oder vielmehr aus einer Krise seines Umfeldes heraus zu verstehen ist,<br />
�� welche Situation in der Familie bestanden hat oder noch besteht,<br />
�� <strong>und</strong> ob, bezogen auf die Kontexte, in denen das als problematisch aufgefasste Verhalten<br />
auftritt, die vermeintliche Störung möglicherweise gerade als Ausdruck von Ges<strong>und</strong>heit<br />
verstanden werden muss (bke 1988, S. 20).<br />
Jeweils anders ist die Ebene der Intervention zu bestimmen: beim Kind selbst, in seiner Familie bzw.<br />
im sozialen Kontext. ‚Diagnose’, nämlich der Versuch, ein angemessenes Problemverständnis zu<br />
gewinnen, muss in der <strong>Erziehungsberatung</strong> –wenn sie ihren Auftrag, die den individuellen Problemen<br />
zugr<strong>und</strong>e liegenden Faktoren zu erfassen (§ 28 Satz 1 SGB VIII), - erfüllen will, multiperspektivisch<br />
angelegt sein. Auch die Diagnose krankheitswertiger seelischer Störungen bietet mithin kein<br />
geeignetes Abgrenzungskriterium zwischen <strong>Psychotherapie</strong> <strong>und</strong> <strong>Erziehungsberatung</strong>. Der
psychotherapeutische Blick kann nur ein Element in der erziehungsberaterischen Problemdefinition<br />
darstellen.<br />
<strong>Erziehungsberatung</strong> als eine Leistung sui generis<br />
Auch wenn an den Anlässen, Problemen <strong>und</strong> Konflikten, die Familien in der <strong>Erziehungsberatung</strong><br />
vorstellen, aus der Perspektive <strong>und</strong> mit den kategorialen Instrumenten der Heilk<strong>und</strong>e<br />
krankheitswertige Störungen gesehen werden können, so lassen sich diese gleichermaßen in den<br />
anderen Kontext der Förderung der Erziehung <strong>und</strong> der Unterstützung der Entwicklungsprozesse von<br />
Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen einordnen. Es wird dann an den Problemen der erzieherische Bedarf<br />
erkannt, den eine Familie bei ihrem Kind hat. Bevor ich mich aber den Rechtsgr<strong>und</strong>lagen zuwende,<br />
die hier begrifflich schon aufscheinen, möchte ich auf einige Besonderheiten der <strong>Erziehungsberatung</strong><br />
hinweisen, die aus meiner Sicht ihrer Status als einer Sozialleistung sui generis begründen.<br />
Erziehungs- <strong>und</strong> Familienberatung ist –obwohl der Ausgangspunkt der Leistung immer ein Kind (oder<br />
Jugendlicher) ist –eine Hilfe für Erwachsene, denen ja auch der Rechtsanspruch auf die Leistung zu<br />
geordnet ist. Zwar werden in der B<strong>und</strong>esstatistik der Jugendhilfe als Empfänger der<br />
<strong>Erziehungsberatung</strong> die jungen Menschen, Minderjährige <strong>und</strong> junge Volljährige, statistisch in ihren<br />
Merkmalen erfasst. Doch erfolgt die Beratung in der Regel nicht mit den minderjährigen Kindern <strong>und</strong><br />
Jugendlichen selbst, sondern um des jungen Menschen willen mit einem oder beiden<br />
Personensorgeberechtigten, also mit den Müttern <strong>und</strong> Vätern. Dies prägt den Charakter der Leistung.<br />
<strong>Erziehungsberatung</strong> erfolgt typischerweise als Gespräch der Beraterin mit der Mutter des Kindes.<br />
Diese berichtet vom Verhalten des Kindes, von ihren Versuchen, das Kind zu beeinflussen <strong>und</strong> sie<br />
erhofft sich Ratschläge, was sie anders machen kann. Das heißt die Mutter trägt eine Fallkonstellation<br />
aus ihrer eigenen Praxis als Erziehende vor <strong>und</strong> beschreibt die Grenzen, an die sie in ihrem<br />
Verständnis des Kindes gelangt ist. Nachdem das Lösungspotential in der Beziehung zwischen ihr<br />
selbst <strong>und</strong> dem Kind an eine Schranke geraten ist, trägt sie die Problemlage einem außen stehenden<br />
Dritten vor. Er vermag aufgr<strong>und</strong> dieser Position des Dritten die Verstrickungen einer dyadischen<br />
Beziehung zu erkennen. Eltern –auch wenn sie beide gemeinsam Beratung in Anspruch nehmen –<br />
treten strukturell gesehen nicht als Patienten ihrem Therapeuten gegenüber, sondern suchen in der<br />
<strong>Erziehungsberatung</strong> eine Supervision. So wie Supervision den Fachkräften, die sie in Anspruch<br />
nehmen, wieder eine innere Distanz zum Geschehen ermöglicht <strong>und</strong> ihnen damit erlaubt,<br />
Veränderungsimpulse in der eigenen Praxis mit Ratsuchenden zu setzen, so gewinnen Eltern in der<br />
<strong>Erziehungsberatung</strong> emotionale Distanz zu den Problemen mit ihrem Kind <strong>und</strong> können durch ihr<br />
eigenes Handeln dem Kind wieder neue Entwicklungsimpulse geben. Nicht die <strong>Psychotherapie</strong> ist das<br />
Modell der <strong>Erziehungsberatung</strong>. <strong>Erziehungsberatung</strong> folgt vielmehr dem Paradigma der Supervision.<br />
Auf ein zweites will ich hinweisen. <strong>Erziehungsberatung</strong> wird seit etlichen Jahren zunehmend mehr für<br />
Kinder in Anspruch genommen, die nicht mehr in einer herkömmlichen Familie mit beiden Elternteilen<br />
aufwachsen. Kinder, die bei allein erziehenden Elternteilen leben, stellen inzwischen ein Drittel der<br />
Beratenen. Auch die Zahl der Kinder, die in einer Stieffamilie leben, genauer: die mit einem<br />
Stiefelternteil als Stiefkind zusammenleben, nimmt in der <strong>Erziehungsberatung</strong> zu. Beiden<br />
Konstellationen liegt bekanntlich in der Mehrzahl der Fälle die Scheidung desjenigen Paares<br />
zugr<strong>und</strong>e, welches das vorgestellte Kind gezeugt hat. Ich will an dieser Stelle auf einen Gr<strong>und</strong>satz<br />
hinweisen, der sich in der Arbeit mit Scheidungseltern herausgebildet hat: nämlich klar zu<br />
unterscheiden zwischen der Ebene, auf der die sich trennenden Eltern als Paar verb<strong>und</strong>en waren, <strong>und</strong><br />
der zweiten Ebene, auf der beide Partner auch nach einer Trennung als Eltern ihres gemeinsamen<br />
Kindes noch verb<strong>und</strong>en bleiben. Die kritische Konstellation sich trennender Eltern verdeutlicht eine<br />
Unterscheidung, die auch für die Arbeit mit zusammenlebenden Elternpaaren in der<br />
<strong>Erziehungsberatung</strong> wesentlich ist: denn diese suchen nicht als Paar die Einrichtung auf, sondern als<br />
Eltern. Und auch dann, wenn sie miteinander Probleme in der Paarbeziehung haben, thematisiert
<strong>Erziehungsberatung</strong> diese dann <strong>und</strong> solange wie die Paarprobleme die Erziehungssituation des<br />
Kindes beeinträchtigen. <strong>Erziehungsberatung</strong> unterstützt Rat Suchende insofern sie Eltern sind <strong>und</strong><br />
eine Unterstützung bei ihrer Erziehungsaufgabe benötigen. Rechtlich gesprochen: soweit sie einen<br />
erzieherischen Bedarf haben.<br />
Und ein Drittes kennzeichnet <strong>Erziehungsberatung</strong>. Wiederum schärft eine zunächst atypische<br />
Situation den Blick. Die B<strong>und</strong>eskonferenz für <strong>Erziehungsberatung</strong> bietet seit einiger Zeit in einem<br />
Kooperationsprojekt mit örtlichen Beratungsstellen <strong>Erziehungsberatung</strong> im Internet an. Die<br />
besonderen Bedingungen dieser Leistungserbringung, nämlich die Beantwortung einer Anfrage<br />
innerhalb von 48 St<strong>und</strong>en rückt die fachliche Intervention in eine große zeitliche Nähe zu der<br />
Situation, in der ein Elternteil sich am Ende seiner eigenen erzieherischen Möglichkeiten gesehen hat.<br />
<strong>Erziehungsberatung</strong> interveniert im Internet quasi in die aktuelle Problemsituation der Familie hinein.<br />
Dies aber kennzeichnet zunehmend mehr auch die ambulante Beratung in den Einrichtungen: Sie hat<br />
sich von einer Rekonstruktion der Problemgenese, die eine therapeutische Wirkung entfalten sollte,<br />
weg entwickelt - hin zu einer Lösung von aktuellen Problemen in kleinen Schritten (Kurz-Adam 1977).<br />
Der Transfer neu gewonnener Einsichten in den eigenen Alltag steht so nicht am Ende eines<br />
Beratungsprozesses –möglicherweise noch mit ungewissem Ausgang -, sondern rückt nah an die<br />
Beratungssituation selbst heran. Die Beratung strukturiert gleichsam diesen Transfer.<br />
<strong>Erziehungsberatung</strong> kann also aufgefasst werden als eine Supervision für Eltern, die in einer aktuellen<br />
Erziehungssituation Unterstützung durch einen externen Dritten für ihr eigenes erzieherisches<br />
Handeln brauchen.<br />
Rechtliche Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Damit ergibt sich zwanglos der Übergang zu den rechtlichen Gr<strong>und</strong>lagen von <strong>Erziehungsberatung</strong><br />
einerseits <strong>und</strong> heilk<strong>und</strong>licher <strong>Psychotherapie</strong> andererseits. <strong>Erziehungsberatung</strong> zählt im System der<br />
Jugendhilfe zu den Hilfen zur Erziehung. Personensorgeberechtigte haben nach § 27 SGB VIII<br />
Anspruch auf eine Hilfe zur Erziehung, wenn bei ihrem Kind eine Erziehung, die dem Wohl des Kindes<br />
oder des Jugendlichen entspricht, nicht mehr gewährleistet ist. Dabei muss die Begrifflichkeit genau<br />
beachtet werden: Anspruchsvoraussetzung ist hier nicht, dass das Wohl des Kindes nicht<br />
gewährleistet ist (dann kämen wir in die Nähe des § 1666 BGB –Kindeswohlgefährdung); es ist die<br />
Erziehung, die beeinträchtigt ist. Dabei wird weder beim Kind oder Jugendlichen ein Defizit verortet,<br />
noch ein Verschulden der Eltern vorausgesetzt. Es reicht aus, dass eine Situation gegeben ist, in der<br />
eine Erziehung, die dem Wohl des jungen Menschen entsprechen würde, nicht realisiert werden kann,<br />
in der - paraphrasiert - ein erzieherischer Bedarf (§ 27 Abs. 2 SGB VIII) vorliegt. Jugendhilfe nimmt<br />
damit nicht einen einzelnen Menschen, das Kind oder einen Elternteil, in den Blick, sondern stellt hier<br />
vornherein auf die Interaktion zwischen Kindern <strong>und</strong> Eltern ab. Reinhard Wiesner hat in seinem<br />
kürzlich vorgelegten Gutachten zur „<strong>Psychotherapie</strong> im Kinder- <strong>und</strong> Jugendhilferecht“ noch einmal<br />
hervorgehoben: „Leistungen der Kinder- <strong>und</strong> Jugendhilfe sind daher an die Eltern in Bezug auf ihre<br />
Kinder adressiert. Die Hilfestellung ... knüpft an der Erziehungs- <strong>und</strong> Lebensgemeinschaft von Eltern<br />
<strong>und</strong> Kind, am ‚System’ Familie an“ (S. 6).<br />
Für eine heilk<strong>und</strong>liche <strong>Psychotherapie</strong> ist dagegen im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung<br />
(SGB V) das Vorliegen einer Krankheit die anspruchsbegründende Voraussetzung. Der Anspruch des<br />
Versicherten umfasst:<br />
�� das Erkennen der Krankheit<br />
�� die Heilung der Krankheit<br />
�� die Verhütung einer Verschlimmerung der Krankheit <strong>und</strong><br />
�� die Linderung der Krankheitsbeschwerden (§ 27 Abs. 1 SGB V).
Die Hilfe ist dabei erkennbar individualisiert <strong>und</strong> die psychotherapeutische Leistung klar definiert. Eine<br />
heilk<strong>und</strong>liche <strong>Psychotherapie</strong> setzt nach den <strong>Psychotherapie</strong>-Richtlinien voraus, dass<br />
�� die seelische Krankheit mit wissenschaftlich begründeten Methoden untersucht <strong>und</strong><br />
�� definitorisch in eine Krankheitslehre eingeordnet wird,<br />
�� methodisch definierte Interventionen angewendet werden <strong>und</strong><br />
�� ein Behandlungserfolg erwartet werden kann.<br />
Dabei wird das Wesen krankhafter Störungen – korrekt – dadurch definiert, dass sie „sie der<br />
wilentlichen Steuerung durch den Patienten nicht mehr oder nur zum Teil zugänglich sind“ (Richtlinien<br />
A 2).<br />
Das Sozialrecht rekonstruiert hier einen Sachverhalt, der am Handeln der Menschen selbst abgelesen<br />
werden kann: ein Kranker vollzieht einen Übergang von seinen sonst eingenommenen sozialen Rollen<br />
(als Lehrer, Ehemann oder Vereinsmitglied) in die Rolle eines Kranken, der nun nicht mehr mit den<br />
gleichen Ansprüchen auf Handlungskompetenz auftreten kann, sondern einzelne Bereiche seines<br />
Lebens oder Funktionen seines Körpers nicht mehr durch sich selbst bestimmt sieht. Anders dagegen<br />
Eltern: sie treten ihre Elternrolle typischerweise nicht der Jugendhilfe ab (wenn gleich im Grenzfall<br />
auch ein Entzug des Sorgerechts gegeben sein kann), sondern sie nehmen –insbesondere bei der<br />
<strong>Erziehungsberatung</strong> –die Unterstützung der Jugendhilfe in Anspruch, weil sie sich selbst als Eltern<br />
weiter in der Pflicht sehen <strong>und</strong> ihrer Erziehungsaufgabe gerecht werden wollen. Und sie verstehen<br />
daher, wenn sie eine Beratungsstelle aufsuchen, weder sich selbst noch ihr Kind als krank.<br />
Abgrenzungen<br />
Wenn auch die unterschiedlichen Ansatzpunkte von Jugendhilfe <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitswesen deutlich zu<br />
sein scheinen. In der Praxis können sich angesichts komplexer Problemlagen dennoch<br />
Abgrenzungserfordernisse ergeben. Die Probleme von Kindern sind immer eingebettet in die<br />
Beziehungen, die sie zu ihren Eltern haben. Auch eine heilk<strong>und</strong>liche Kindertherapie wird deshalb<br />
begleitend immer auch mit den Eltern des Kindes arbeiten. Auch die Gesetzliche Krankenversicherung<br />
trägt dieser Einbettung von Problemen der Kinder in die familiale Interaktionsstruktur Rechnung <strong>und</strong><br />
finanziert auch eine begleitende Elternarbeit mit. Dabei soll sich der Aufwand im Verhältnis von 1 zu 4<br />
auf Eltern <strong>und</strong> behandeltes Kind verteilen (<strong>Psychotherapie</strong>-Vereinbarung Teil C § 11 Abs. 9).<br />
Wie also kann unterschieden werden zwischen einer Behandlungsbedürftigkeit wegen einer<br />
seelischen Erkrankung des Kindes oder Jugendlichen <strong>und</strong> einem durch <strong>Psychotherapie</strong> zu deckenden<br />
erzieherischen Bedarf? Wenn die seelischen Probleme eines Kindes aus den Beziehungen heraus<br />
verstanden werden müssen, die das Kind zu seinen Eltern hat, <strong>und</strong> Heilk<strong>und</strong>e zum einen den<br />
Einzelnen, Jugendhilfe zum anderen dagegen die Interaktion von Eltern <strong>und</strong> Kind zum Bezugpunkt<br />
nimmt, dann muss die Unterschiedslinie sich genau in diesem Verhältnis ergeben:<br />
�� Wenn Probleme eines Kindes, die als seelische Krankheit verstanden werden können, im<br />
Rahmen einer wenig belasteten, man könnte sagen: ‚normalen’ Eltern-Kind-Beziehung<br />
auftreten, wenn also die Störung sich als innerer Konflikt vom Sozialisationprozess des Kindes<br />
abgelöst hat, dann ist die Gesetzliche Krankenversicherung zuständig <strong>und</strong> eine heilk<strong>und</strong>liche<br />
<strong>Psychotherapie</strong> angezeigt.<br />
�� Treten die Probleme dagegen in einer belasteten Interaktionsbeziehung zwischen Kind <strong>und</strong><br />
Eltern auf, die eine normale, am Wohl des Kindes orientierte Erziehung nicht mehr zulässt,<br />
dann ist Jugendhilfe zuständig. Und die therapeutischen Kompetenzen der<br />
<strong>Erziehungsberatung</strong> sind gefragt. Die Auffälligkeit des Kindes wird dann interpretiert als<br />
Ergebnis – oder Begleitsymptom – eines fehlgelaufenen Entwicklungs- <strong>und</strong><br />
Erziehungsprozesses. Die dabei zugr<strong>und</strong>e liegenden Wirkfaktoren sind in der Regel noch<br />
aktuell <strong>und</strong> beeinflussbar (Lasse 2002, S. 115).<br />
Wenn also die Probleme des Kindes vorrangig Krankheitswert haben <strong>und</strong> ein erzieherischer Bedarf in<br />
den Hintergr<strong>und</strong> tritt, ist Heilk<strong>und</strong>e zuständig; wenn aber der erzieherische Bedarf im Vordergr<strong>und</strong>
steht, setzt die Jugendhilfe mit ihren Unterstützungsmaßnahmen an –auch wenn den Phänomenen,<br />
die ein Kind zeigt, Krankheitswert zugeschrieben werden könnte.<br />
<strong>Erziehungsberatung</strong>sstellen müssen also klären, ob die Eltern, die zu ihnen kommen einen<br />
erzieherischen Bedarf haben, der sich aus der interaktiven Situation dieser Familie ergibt. Aber ihr<br />
Auftrag ist auch auf diese Klärung begrenzt; er schließt die Diagnose einer seelischen Erkrankung<br />
nicht ein (bke 2005, S. 5). Von der Einrichtung muss nur verlangt werden, dass sie die Grenzen ihrer<br />
eigenen Zuständigkeit erkennt. In diesem Fall wird die Beratungsstelle den Eltern den Hinweis geben,<br />
wo ggf. in anderen Diensten der Jugendhilfe, in der Eheberatung, in der Schuldnerberatung oder eben<br />
auch bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten eine angemessene Hilfe geleistet werden<br />
könnte. Die Feststellung, ob die Voraussetzung für eine Leistungserbringung vorliegen, trifft der<br />
übernehmende Dienst.<br />
Eine letzte notwendige Abgrenzung betrifft den gesetzlich geregelten Nachrang der Jugendhilfe. § 10<br />
Abs. 1 SGB VIII legt fest, dass Leistungen anderer Gesetzbücher auch dann zu gewähren sind, wenn<br />
in der Jugendhilfe eine ähnliche Leistung gewährt werden könnte. Praktisch bedeutet dies, dass bei<br />
psychotherapeutischen Behandlungen zunächst die Gesetzliche Krankenversicherung zur Leistung<br />
verpflichtet ist. <strong>Erziehungsberatung</strong>sstellen, die –wie gerade skizziert –bei einem Kind vorrangig<br />
seelische Störungen von Krankheitswert vermuten, werden daher die Rat suchenden Eltern an das<br />
Ges<strong>und</strong>heitswesen weiter zu verweisen haben. Was aber geschieht, wenn dort eine Behandlung –<br />
trotz diagnostizierter seelischer Erkrankung –nicht möglich ist, etwa weil die Versorgungssituation in<br />
der Region zu schlecht ist? Muss <strong>Erziehungsberatung</strong> dann die heilk<strong>und</strong>liche <strong>Psychotherapie</strong><br />
dennoch leisten? Manchen Orts wird Jugendhilfe in solcher Weise als „Ausfalbürge“ verstanden.<br />
Dabei wird übersehen, dass Jugendhilfe nur dann zur Leistung verpflichtet <strong>und</strong> auch berechtigt ist,<br />
wenn nach ihren eigenen Vorsetzungen ein Leistungsanspruch besteht. Das heißt, es ist zu prüfen, ob<br />
im jeweiligen Fall ein erzieherischer Bedarf vorliegt. Nur wenn dies der Fall ist, kann Jugendhilfe<br />
eintreten. Und sie wird auf diesen Bedarf hin, ihre jugendhilflichen Unterstützungsmöglichkeiten<br />
aktivieren, nicht aber eine Leistung des Ges<strong>und</strong>heitswesens erbringen (bke 2005, S. 4; Wiesner<br />
2000, § 10 Rn 21, 23; Münder u.a. 2003, § 10 Rn 2).<br />
<strong>Psychotherapie</strong> in der <strong>Erziehungsberatung</strong><br />
<strong>Erziehungsberatung</strong> steht in einer engen methodischen Verwandtschaft zu psychotherapeutischen<br />
Leistungen. Wie diese nutzt sie die Beziehung zwischen Rat suchenden Eltern <strong>und</strong> beratender<br />
Fachkraft als Medium der Veränderung. Gleichwohl ist weniger <strong>Psychotherapie</strong> das Modell für eine<br />
Praxis, die Eltern darin unterstützt, ihre erzieherischen Kompetenzen zu stärken; vielmehr bildet<br />
Supervision das Paradigma für eine Kommunikation, in der der andere als prinzipiell kompetent für<br />
seine Aufgabe gelten muss.<br />
In Situationen aber, in denen Eltern etwa aufgr<strong>und</strong> eigener psychischer Probleme nicht in der Lage<br />
sind, für ihr Kind eine seinem Wohl entsprechende Erziehung zu gewährleisten, werden auch in der<br />
<strong>Erziehungsberatung</strong> psychotherapeutische Interventionen in einem engeren Sinne notwendig (bke<br />
2005). Das kann z.B. Eltern betreffen, die eigene Mangelerlebnisse an ihrem Kind stellvertretend<br />
kompensieren, oder eine traumatisierte Mutter, die ihren Sohn so mächtig erlebt, wie einen früheren<br />
Misshandler. Bevor mit ihnen ein förderliches Verhalten dem eigenen Kind gegenüber aufgebaut<br />
werden kann, muss das „innere Kind“ eines solchen Elternteils selbst therapeutische Zuwendung<br />
erfahren. Die Eltern müssen dann zunächst lernen, ihre eigene Problematik von der ihres realen<br />
Kindes zu unterscheiden. Dabei richten sich die Interventionen nicht auf eine „Heilung“ einer Störung,<br />
sondern sie zielen auf die Wiederherstellung der elterlichen Erziehungskompetenz.<br />
Ebenso kommen psychotherapeutische Interventionen bei Kindern oder Jugendlichen in Betracht,<br />
wenn ihre Problemlagen sich so verfestigt haben, dass eine Beratung von Eltern <strong>und</strong> sozialem Umfeld
allein nicht ausreicht, oder wenn akute Problemlagen sich so zuspitzen, dass das Kind selbst eine<br />
direkte Hilfestellung braucht. Die therapeutische Arbeit mit dem Kind wird dann in der Regel mit einer<br />
intensiven Elternarbeit verb<strong>und</strong>en sein. Dabei zielen die Interventionen auf beiden Ebenen, beim Kind<br />
<strong>und</strong> beim Erziehenden, wiederum darauf, die Interaktion zwischen beiden so zu verbessern, dass die<br />
Eltern ihre erzieherische Verantwortung allein übernehmen können.<br />
Es ist also nicht die Methode, die den Unterschied zwischen <strong>Erziehungsberatung</strong> <strong>und</strong> <strong>Psychotherapie</strong><br />
konstituiert; ebenso wenig eine mit Objektivitätserwartungen überfrachtete Diagnose. Es ist das Ziel,<br />
auf das unter Verwendung des methodischen Instrumentariums der <strong>Psychotherapie</strong> in der<br />
<strong>Erziehungsberatung</strong> hingearbeitet wird, das die Differenz zu heilk<strong>und</strong>licher Therapie markiert: nämlich<br />
–wie Ulrich Lasse formuliert (2002, S. 118) - „die Ausrichtung auf eine gelingende Erziehung“,.<br />
Dies bestätigt auch die Rechtssprechung des B<strong>und</strong>essozialgerichts, das im Jahr 2003 festgestellt hat:<br />
„Für die Abgrenzung zwischen medizinischen <strong>und</strong> nicht medizinischen Maßnahmen <strong>und</strong> damit für die<br />
Zuständigkeit der Krankenversicherung kommt es in erster Linie auf die Zielsetzung der Maßnahme<br />
an (BSG 2003, Nr. 15 u. 16). Und diese Orientierung am Zweck der Leistung liegt ebenso den<br />
<strong>Psychotherapie</strong>-Richtlinien zugr<strong>und</strong>e, wenn sie abgrenzen: „<strong>Psychotherapie</strong>ist keine Leistung der<br />
gesetzlichen Krankenkassen ... wenn sie nicht der Heilung oder Besserung einer Krankheit bzw. der<br />
medizinischen Rehabilitation dient. Dies gilt ebenso für . <strong>Erziehungsberatung</strong>“ (<strong>Psychotherapie</strong>-<br />
Richtlinie A 1 auch D 2.3). Entscheidend ist - so hebt Wiesner in seinem Rechtsgutachten hervor: „das<br />
mit der Therapie verb<strong>und</strong>ene Ziel“ (2005, S. 46).<br />
Eben weil <strong>Erziehungsberatung</strong> sich an der Herstellung der Erziehungsfähigkeit von Eltern orientiert,<br />
hat sie ihre Interventionen aus der engen Anlehnung an die psychotherapeutischen Schulen, bei<br />
denen therapeutische Kompetenzen erworben worden sind, zunehmend gelöst. Für<br />
<strong>Erziehungsberatung</strong> ist nicht entscheidend, nach der jeweiligen Therapiemethode definierte<br />
Interventionen (<strong>Psychotherapie</strong>-Richtlinie A 4) anzuwenden –wie dies für heilk<strong>und</strong>liche Behandlungen<br />
gefordert wird, sondern sie hat jeweils jene methodischen Werkzeuge auszuwählen, die am<br />
erfolgreichsten eine dann dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung ermöglichen (Lasse 2002;<br />
bke 2005, S. 8). Maria Kurz-Adam hat denn auch in einer empirischen Untersuchung der Praxis von<br />
<strong>Erziehungsberatung</strong> Mitte der 90er-Jahre festgehalten: „Die ehemals eindeutig definierte Fachlichkeit<br />
ist im Prozess der Ausbildungen <strong>und</strong> Erfahrungen ambivalent geworden. Diese Ambivalenz ist das<br />
Ergebnis einer langen Reflexionsphase über die professionelle Arbeit, durch die sie<br />
hindurchgegangen ist. Daher ist der oder die postmoderne Berater/Beraterin durch keine Schule zu<br />
kennzeichnen. ... Vielmehr hat er (bzw.) sie Distanz zu diesen Schulen <strong>und</strong> Richtungen gewonnen,<br />
ohne das gewonnene Wissen <strong>und</strong> die gewonnenen Erfahrungen ... auszublenden. Der postmoderne<br />
Beratertypus ist ... Ausdruck einer reflexiven Modernisierung der Professionalität im Sinne der<br />
Revision der Prinzipien moderner Fachlichkeit“ (Kurz-Adam 1997, S. 212).<br />
Damit kehrt eine durch die psychotherapeutische Professionalisierung hindurchgegangene<br />
<strong>Erziehungsberatung</strong> wieder zu ihren Ursprüngen zurück. Schon August Aichhorn wusste: „Wenn wir<br />
die zu uns gebrachten verwahrlosten Kinder <strong>und</strong> Jugendlichen sprechen lassen <strong>und</strong> mit ihnen reden,<br />
so ist das keine psychoanalytische Behandlung. Wir ziehen aus ihren Mitteilungen <strong>und</strong> sonstigen<br />
Äusserungen Schlüsse, denen wir dann unseren Erziehungsvorgang anpassen“ (Aichhorn 1951, S.<br />
28). Auch heute ist <strong>Erziehungsberatung</strong> wieder herausgefordert, ihre fachliche Kompetenz in die<br />
Arbeit mit Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen einzubringen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen,<br />
deren Eltern nach einer Arbeitslosigkeit keine neue berufliche Perspektive sehen, als Migranten in<br />
unserer Gesellschaft leben oder deren Eltern nach einer Trennung oder Scheidung keine dem Wohl<br />
ihres Kindes entsprechende Erziehung mehr gewährleisten können. <strong>Erziehungsberatung</strong> muss<br />
zunehmend jenen Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen eine Unterstützung bieten, deren Perspektive ansonsten<br />
eine Fremdunterbringung außerhalb ihrer Familie wäre. Die Unterscheidung zwischen heilk<strong>und</strong>licher
<strong>Psychotherapie</strong> dort <strong>und</strong> nicht-heilk<strong>und</strong>licher <strong>Psychotherapie</strong> hier erscheint dann müßig: Geleistet wird<br />
<strong>Erziehungsberatung</strong>.<br />
Literatur<br />
Aichhorn, August (1951): Verwahrloste Jugend. Stuttgart, Wien. 1977<br />
Borg-Laufs, Michael (2001): <strong>Psychotherapie</strong> in Beratungsstellen. In: Psychotherapeutenjournal,<br />
3/2003, S. 173 –178.<br />
B<strong>und</strong>eskonferenz für <strong>Erziehungsberatung</strong> (bke) (1988): Seelische Ges<strong>und</strong>heit von Kindern <strong>und</strong><br />
Jugendlichen als Auftrag institutioneller Erziehungs- <strong>und</strong> Familienberatung. In: bke (2000):<br />
Gr<strong>und</strong>lagen der Beratung. Fürth, S. 18 –23.<br />
B<strong>und</strong>eskonferenz für <strong>Erziehungsberatung</strong> (bke) (1993): Stelungnahme zum Gutachten „Familie <strong>und</strong><br />
Beratung“. In: bke (2000): Gr<strong>und</strong>lagen der Beratung. Fürth, S. 267 –277.<br />
B<strong>und</strong>eskonferenz für <strong>Erziehungsberatung</strong> (bke) (2005): <strong>Erziehungsberatung</strong> <strong>und</strong> <strong>Psychotherapie</strong>. In:<br />
Informationen für <strong>Erziehungsberatung</strong>sstellen, Heft 2/2005, S. 3 –8.<br />
B<strong>und</strong>esozialgericht (2003): Urteil des 1. Senats vom 3. September 2003, Az: B 1 KR 34/01 R.<br />
Deutscher Arbeitskreis für Jugend-, Ehe- <strong>und</strong> Familienberatung (DAKJEF) (1993): Institutionelle<br />
Beratung im Bereich der Erziehungs, Ehe- Familien- <strong>und</strong> Lebensberatung, Partnerschafts- <strong>und</strong><br />
Sexualberatung. In: Deutscher Arbeitskreis für Jugend-, Ehe- <strong>und</strong> Familienberatung (Hg) (2001):<br />
Gr<strong>und</strong>satztexte des Deutschen Arbeitskreises für Jugend-, Ehe- <strong>und</strong> Familienberatung. Frankfurt am<br />
Main, S. 6 –12.<br />
Figdor, Helmuth (1991): Kinder aus geschiedenen Ehen –Zwischen Trauma <strong>und</strong> Hoffnung. Mainz.<br />
Freud, Sigm<strong>und</strong> (1905): Psychische Behandlung, in: Freud, Sigm<strong>und</strong>: Gesammelte Werke, Band V,<br />
London, S. 289 –315.<br />
Freud, Sigm<strong>und</strong> (1919): Wege der psychoanalytischen Therapie. In: Freud, Sigm<strong>und</strong>: Gesammelte<br />
Werke, Band XII, London, S. 181 –194.<br />
Gr<strong>und</strong>sätze (1973): Gr<strong>und</strong>sätze für die einheitliche Gestaltung der Richtlinien der Länder für die<br />
Förderung von <strong>Erziehungsberatung</strong>sstellen. In: bke (2000): Gr<strong>und</strong>lagen der Beratung. Fürth, S. 309 –<br />
318.<br />
Kurz-Adam, Maria (1997): Professionalität <strong>und</strong> Alltag in der <strong>Erziehungsberatung</strong>, Opladen.<br />
Lasse, Ulrich (2002): <strong>Psychotherapie</strong> in der <strong>Erziehungsberatung</strong> als Leistung der Jugendhilfe. In:<br />
H<strong>und</strong>salz, Andreas; Menne, Klaus (Hg.) (2004): Jahrbuch für <strong>Erziehungsberatung</strong>, Band 5, Weinheim<br />
<strong>und</strong> München, S. 109 –121.<br />
Münder, Johannes u.a. (2003): Frankfurter Kommentar zum SGB VIII: Kinder- <strong>und</strong> Jugenhilfe.<br />
Weinheim, Berlin, Basel.
<strong>Psychotherapie</strong>-Richtlinien (1998): <strong>Psychotherapie</strong>-Richtlinien des B<strong>und</strong>esauschusses der Ärzte <strong>und</strong><br />
Krankenkassen über die Durchführung der <strong>Psychotherapie</strong> (11.12.1998). In: Jerouschek, Günter<br />
(2004): PsychThG. Psychotherapeutengesetz.Kommentar. München, S. 208 –220.<br />
Wiesner, Reinhard (2000): SGB VIII –Kinder- <strong>und</strong> Jugendhilfe. München.<br />
Wiesner, Reinhard (2005): <strong>Psychotherapie</strong> im Kinder- <strong>und</strong> Jugendhilferecht.