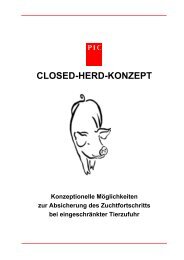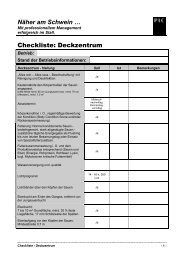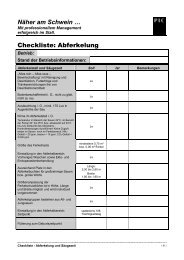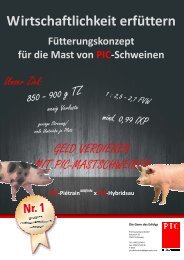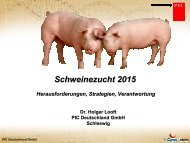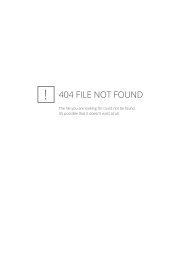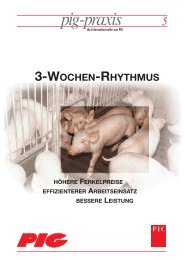PIC-Zeit - Die Zeitung für erfolgreiche Schweineproduzenten
PIC-Zeit - Die Zeitung für erfolgreiche Schweineproduzenten
PIC-Zeit - Die Zeitung für erfolgreiche Schweineproduzenten
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>PIC</strong> ZEIT<br />
DEZEmbEr ZEITUNG FÜr ErFOLGrEICHE SCHWEINEPrODUZENTEN 2010<br />
Biotechnologie<br />
Genomische Selektion –<br />
von der Utopie zur Realität<br />
Seite 4<br />
Sehr geehrte<br />
Leserinnen und Leser,<br />
„<strong>Die</strong> einzige Konstante ist die Veränderung“! <strong>Die</strong>se Aussage hat in unserer<br />
Industrie - in der heutigen, jetzigen <strong>Zeit</strong> eine neue bedeutung bekommen<br />
und eine Dynamik erhalten, die bisher kaum vorstellbar war.<br />
<strong>Die</strong> Klassifizierung nach<br />
FOm wird ersetzt<br />
durch AutoFOm,<br />
„Animal Welfare“ speziell im<br />
Hinblick auf die Kastration und<br />
(zu vermeidende) Verluste werden<br />
intensiv in der Öffentlichkeit<br />
diskutiert, erheblich gestiegene<br />
Futtermittelkosten, sowie<br />
sich verändernde politische<br />
Kräfte beeinflussen ebenfalls<br />
signifikant die Produktion und<br />
die Ertragslage der betriebe.<br />
<strong>Die</strong> Anforderungen an die betriebsleiter<br />
steigen, Entscheidungen<br />
müssen schnell getroffen<br />
werden unter berücksichtigung<br />
möglichst aller wirtschaftlich bedeutenden<br />
Faktoren. man redet<br />
hier oft über „Häuser“, will heißen,<br />
die Summen, die hier beeinflusst<br />
werden, addieren sich schnell zu<br />
beträgen, die ausreichen um ganze<br />
Einfamilienhäuser zu bauen -<br />
und das sowohl in der Ferkelproduktion<br />
als auch in der Aufzucht<br />
und mast.<br />
Führt man sich zum beispiel vor<br />
Augen, dass 1 % Ferkelverluste<br />
den Grenzertrag je Sau und Jahr<br />
mit 10 € beeinflussen, dass 0,1<br />
Wurf mehr je Sau und Jahr eine<br />
Erhöhung des Grenznutzens je<br />
Sau und Jahr um 45 € bedeutet,<br />
dass 1 dt weniger Futter je Sau<br />
und Jahr rund 24 € wert ist, das<br />
50 g höhere tägliche Zunahmen<br />
die mastdauer um eine Woche<br />
verkürzen, dass die Verbesserung<br />
der Futterverwertung um 0,1 2 €<br />
Grenznutzen pro mastschwein<br />
ausmachen, so bewegt sich ein<br />
betrieb mit 500 Sauen auf das<br />
einzelne merkmal bezogen locker<br />
im bereich eines Kleinwagens<br />
und in der Summe sind wir beim<br />
Einfamilienhaus.<br />
Zum beispiel summieren sich<br />
allein die Senkung der Ferkelverluste<br />
um 5 %, die Erhöhung der<br />
Wurffolge um 0,2 und ein geringerer<br />
Futterverbrauch von 1 dt je<br />
Sau und Jahr, die Steigerung der<br />
masttagszunahmen um 50 g und<br />
die Verbesserung der Futterverwertung<br />
um 0,1 auf rund 150.000 €<br />
<strong>für</strong> einen betrieb mit 500 Sauen<br />
und 4.500 mastplätzen.<br />
Gar nicht zu reden von Arbeitszeit,<br />
Ammensauen, Sauenausfällen<br />
und vielen Parametern mehr,<br />
die die Gesamtwirtschaftlichkeit<br />
beeinflussen…<br />
Neben der sorgfältigen Auswahl<br />
der weiblichen Genetik ist auch<br />
der Einsatz hochwertiger Endstufeneber<br />
von extremer bedeutung<br />
<strong>für</strong> die Gesamtwirtschaftlichkeit,<br />
z. b. entspricht die Differenz von<br />
einer Standardabweichung im<br />
Zuchtwert „magerfleischanteil“<br />
eines <strong>PIC</strong>-Piétrain-Ebers einem<br />
wirtschaftlichen Vorteil von mehr<br />
als 4 € je Spermaprotion.<br />
Letztendlich ist es die Gesamtwirtschaftlichkeit,<br />
die entscheidend<br />
<strong>für</strong> die „Entwicklung des<br />
Girokontos“ ist oder mit anderen<br />
Worten, die Kontrolle über Einnahmen<br />
und Ausgaben in punkto<br />
Produktion.<br />
<strong>Die</strong> <strong>PIC</strong> ist aufgrund ihrer konsequenten<br />
Zuchtarbeit mit der<br />
größten genetischen basis weltweit<br />
und dem Einsatz modernster<br />
Technologien in der Datenerfassung<br />
sowie dem professionellen<br />
Einsatz der Genomischen Selektion<br />
hervorragend aufgestellt.<br />
Dadurch können wir unseren<br />
Kunden und Partnern die effizientesten<br />
Produkte zur Erreichung<br />
aller ihrer wirtschaftlichen Herausforderungen<br />
zur Verfügung<br />
stellen und zudem gesichert und<br />
zeitnah auf veränderte marktbedingungen<br />
reagieren.<br />
bereits heute sind wir aufgrund<br />
der uns vorliegenden Ergebnisse<br />
aus unseren Nukleusbetrieben,<br />
sicher, dass wir durch den Einsatz<br />
der modernsten Züchtungstechnologien<br />
einen wirtschaftlichen<br />
Vorteil von 18 € pro mastschwein<br />
bis zum Jahr 2015 erreichen werden.<br />
<strong>Die</strong> Ergebnisse aus der Praxis<br />
bestätigen diese Zahlen.<br />
Des Weiteren investieren wir in-<br />
<strong>PIC</strong> Deutschland GmbH ∙ Ratsteich 31 ∙ 24837 Schleswig ∙ Telefon 04621/543-0<br />
Leistungsfähige Endstufeneber<br />
Produktion unter Einsatz modernster<br />
Zuchtverfahren<br />
tensiv in qualifiziertes Personal<br />
und die Weiterbildung unserer<br />
mitarbeiter, um adäquat mit professioneller<br />
und kompetenter beratung<br />
das genetische Potential<br />
unserer Genetik zur vollen Entfaltung<br />
kommen zu lassen und<br />
so den finanziellen Erfolg unserer<br />
Kunden und Partner zu sichern.<br />
<strong>Die</strong> Weihnachtszeit wird im allgemeinen<br />
definiert als eine ruhige<br />
- oder zumindest ruhigere - und<br />
besinnliche <strong>Zeit</strong>, die man intensiv<br />
mit der Familie und auch mit<br />
Freunden verbringen sollte - und<br />
neben der „normalen“ Hektik<br />
auch hoffentlich dazu kommt.<br />
Vielleicht finden Sie auch noch<br />
fünf (besinnliche) minuten, in<br />
denen Sie sich intensiv mit dem<br />
Taschenrechner beschäftigen<br />
können … und am Ende zu dem<br />
resultat kommen, künftig noch<br />
„einige Häuser bauen“ oder auch<br />
mehr angenehme <strong>Zeit</strong> mit Familie<br />
und Freunden verbringen zu<br />
wollen.<br />
Seite 5<br />
<strong>Die</strong> Neue Camborough®<br />
Ges<strong>PIC</strong>kt mit den erfolgreichsten Genen.<br />
In diesem Sinne bedanke ich mich<br />
im Namen der <strong>PIC</strong> Deutschland<br />
und aller mitarbeiter bei Ihnen<br />
<strong>für</strong> die vertrauensvolle Zusammenarbeit<br />
und wünsche Ihnen<br />
und Ihrer Familie ein frohes und<br />
besinnliches Weihnachtsfest und<br />
ein gutes und <strong>erfolgreiche</strong>s Neues<br />
Jahr. Wir freuen uns auch 2011<br />
auf eine <strong>erfolgreiche</strong> und fruchtbare<br />
Zusammenarbeit mit Ihnen.<br />
Ihr Hinrich Leerhoff<br />
Geschäftsführer<br />
<strong>PIC</strong> Deutschland GmbH<br />
Betriebsreportagen<br />
Jordans vom Niederrhein Seite 3<br />
Klindworth aus Niedersachsen Seite 9<br />
Wenn etwa alle sechs bis acht Jahre ein neues verbessertes Sauenprodukt in den Markt eingeführt werden soll, muss frühzeitig mit der Umstellung im Nukleus-<br />
und Vermehrungsbereich begonnen werden, damit in 2011 ein neues Produkt in entsprechendem Volumen am Markt angeboten werden kann.<br />
<strong>Die</strong> Umstellung der Herden hat daher schon im März 2009 begonnen und läuft derzeit auf Hochtouren.<br />
Innovation hat einen<br />
Namen:<br />
<strong>Die</strong> Neue Camborough ®<br />
<strong>Die</strong> <strong>PIC</strong> hat sich entschlossen, <strong>für</strong> den deutschen markt zukünftig<br />
vorrangig die Camborough ® (Large White L03 x Landrasse L02 )<br />
zu produzieren. Über 20 Jahre genetische Innovation im <strong>PIC</strong>-<br />
Zuchtprogramm mit immer rasanterer Entwicklung gerade in den<br />
letzten zehn Jahren machen dieses Sauenprodukt möglich und eröffnen<br />
eine neue Ära. Alle Entwicklungen finden sich wieder in<br />
der Neuen Camborough ® Hybridsau.<br />
Seit nahezu 40 Jahren ist<br />
die Camborough wichtiger<br />
bestandteil der<br />
<strong>PIC</strong>-Produktpalette. <strong>Die</strong> Neue<br />
Camborough ® hat allerdings<br />
mit der Camborough der 80er<br />
Jahre außer der Linienkombination<br />
Large White x Landrasse<br />
nicht mehr viel gemein. In<br />
der Neuen Camborough ® ist<br />
das motto „Ges<strong>PIC</strong>kt mit den<br />
erfolgreichsten Genen!“ erlebbare<br />
realität, denn sie vereint<br />
alle züchterischen meilensteine<br />
der <strong>PIC</strong>-Zucht (siehe Tabelle<br />
auf Seite 2).<br />
Große Zuchttierpopulation <strong>für</strong><br />
größtmöglichen Zuchtfortschritt<br />
<strong>Die</strong> Entscheidung <strong>für</strong> die Camborough<br />
ist unter anderem deshalb<br />
getroffen worden, weil mit<br />
aktuell 96.000 aktiven Large<br />
White L03 -Sauen und 15.000 aktiven<br />
Landrasse L02 -Sauen diese<br />
beiden Ausgangslinien der<br />
Camborough im Wesentlichen<br />
das <strong>PIC</strong>-mutterlinien-Zuchtprogramm<br />
bestimmen und<br />
somit den schnellstmöglichen<br />
Zuchtfortschritt gewährleisten.<br />
<strong>Die</strong> wenigsten dieser Sauen<br />
stehen allerdings heute auf Nukleusbetrieben.<br />
Tiere mit realen<br />
Daten aus kommerziellen Praxis-Kundenbetrieben<br />
machen<br />
immer mehr den Erfolg des<br />
Zuchtprogramms aus.<br />
Das Kreuzungszucht-Programm<br />
erhöht die Anzahl der Tiere mit<br />
Datensätzen <strong>für</strong> die Zuchtwertschätzung<br />
enorm. Aktuell sind<br />
in der Datenbank rund 154.000<br />
Kreuzungstiere aus Praxisbetrieben<br />
mit einem Vater aus dem<br />
Nukleus enthalten. Etwa 18.400<br />
<strong>PIC</strong>-Hybridsauen in Ferkelerzeugerbetrieben<br />
liefern kontinuierlich<br />
Daten zur Verbesserung<br />
der Lebensleistung. Somit<br />
konnte auch in den klassischen<br />
Linien LandrasseL02 und Large<br />
WhiteL03 der Zuchtfortschritt in<br />
den robustheitsmerkmalen wie<br />
Fundament, Sauenverluste und<br />
Langlebigkeit deutlich erhöht<br />
werden.<br />
Duroc-mutterlinien mit Vorteilen<br />
in diesen merkmalen<br />
sind also nicht länger zwingend<br />
erforderlich. biologische<br />
Gegenspieler, wie z. b.<br />
hohe Tageszunahmen und<br />
schlechte Fundamente, werden<br />
in zunehmendem maße genetisch<br />
neutralisiert, da die merkmalskomplexe<br />
über moderne<br />
bLUP-Zuchtwertschätzverfahren<br />
in Kombination mit genetischen<br />
DNA-markern wesentlich<br />
besser erfasst werden und in<br />
der Zuchtwertschätzung heute<br />
simultan berücksichtigt werden<br />
können.<br />
<strong>Die</strong> Erhöhung der Genauigkeit<br />
in der Zuchtwertschätzung erlaubt<br />
es uns daher, signifikante<br />
Fortschritte in der Fruchtbarkeit<br />
und robustheit gleichzeitig mit<br />
Verbesserungen z. b. in den traditionell<br />
„einfachen“ merkmalen<br />
Zuwachs und Fleischanteil<br />
zu erzielen.<br />
Weiter auf Seite 2
SEITE 2 <strong>PIC</strong>-ZEIT DEZEmbEr<br />
Weiter von Seite 1: Innovation hat einen Namen: <strong>Die</strong> neue Camborough ®<br />
Ein Innovationsende ist nicht<br />
absehbar<br />
An einem weiteren neuen<br />
merkmal, „Futteraufnahme der<br />
Sau während der Laktation“,<br />
Meilensteine der <strong>PIC</strong>-Zucht<br />
Zum inzwischen fünften<br />
mal in Folge steht<br />
Familie Spieker aus Lienen<br />
mit ihren rund 600 Vermehrungssauen<br />
an der Spitze<br />
der <strong>PIC</strong>-Vermehrer.<br />
mit vor sieben Jahren „nur“ 23<br />
abgesetzten Ferkeln pro Sau<br />
und Jahr – einer Zahl, die auch<br />
damals schon deutlich über<br />
dem deutschen Durchschnitt<br />
lag – und heute 30 Ferkeln,<br />
verzeichnet der betrieb Spieker<br />
eine jährliche Steigerung von<br />
sage und schreibe einem Ferkel<br />
pro Jahr.<br />
Eine ansprechende Wurfgröße<br />
von 12,6 lebend geborenen Fer-<br />
die die Ferkelüberlebensrate<br />
beeinflusst, wird schon intensiv<br />
gearbeitet. Der metabolismus,<br />
der hinter der milchproduktion<br />
steckt, ist ein sehr wichtiges<br />
1991 Erste züchterische Revolution<br />
<strong>PIC</strong> führt die bLUP-Zuchtwertschätzung ein und implementiert<br />
dieses Verfahren ein Jahr später auch <strong>für</strong> das<br />
merkmal Wurfgröße.<br />
1994 Das <strong>Zeit</strong>alter der Molekularbiologie beginnt<br />
Der erste genetische marker <strong>für</strong> Wurfgröße, LS1, wird in<br />
der Large White Linie genutzt.<br />
1998 <strong>PIC</strong> führt alle mutterlinien weltweit in einer einheitlichen<br />
globalen Zuchtwertschätzung zusammen.<br />
2000 <strong>Die</strong> Reinzuchtliniendatenbasis der Linien Large White<br />
und Landrasse wird um Tiere in Vermehrungsherden und<br />
Kundenbetrieben auf heute etwa 120.000 Sauen erweitert.<br />
2002 Ein neues Software-Anpaarungsprogramm – <strong>PIC</strong>Mate -<br />
wird speziell <strong>für</strong> <strong>PIC</strong> entwickelt und führt durch effiziente<br />
balancierung von Inzucht und genetischem Niveau zu erheblichen<br />
Zuchtfortschritten.<br />
2003 <strong>PIC</strong> führt nach über 10 Jahren Vorlauf die marker-<br />
gestützte Selektion ein.<br />
2005 Das Kreuzungszuchtprogramm aus dem Vaterlinienbereich<br />
wird nun auch <strong>für</strong> die Weiterentwicklung der Mutterlinien<br />
genutzt.<br />
Immer mehr Praxis-Daten von kommerziellen <strong>PIC</strong>-Hybridsauen<br />
fließen gezielt in die Zuchtwertschätzung ein.<br />
2009 <strong>PIC</strong> erweitert mit Aufbau des neuen Nukleusbetriebes<br />
Apex die Leistungsprüfung nochmals um 20 %.<br />
2010 Zweite züchterische Revolution<br />
<strong>PIC</strong> führt die Genomische Selektion ein und erhöht den<br />
Zuchtfortschritt z. b. bei gering erblichen merkmalen wie<br />
Wurfgröße und Ferkelüberlebensrate um mehr als das<br />
Doppelte – siehe auch beitrag „Genomische Selektion“<br />
links (siehe auch Artikel „Genomische Selektion...“ auf S. 4)<br />
keln, Ferkelverluste unter 10 %,<br />
eine Umrauschquote unter 6 %<br />
und eine Abferkelrate über 90 %<br />
machen diese Leistungen möglich.<br />
Im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr<br />
bestand die Sauenherde<br />
zum überwiegenden Teil<br />
aus Großelternsauen zur Produktion<br />
von Camborough 25<br />
Jungsauen. Inzwischen ist die<br />
Umstellung auf eine Large<br />
White L03 Herde zur Produktion<br />
von Camborough-Jungsauen in<br />
vollem Gange.<br />
Wer meint, dass mit einer<br />
reinzuchtherde dann die „Ära<br />
Spieker“ in der Führungsriege<br />
der <strong>PIC</strong>-Vermehrung dem-<br />
Element in Sauen-Genotypen,<br />
die sehr große Würfe realisieren.<br />
Futteraufnahme, aber natürlich<br />
auch Wasseraufnahme während<br />
der Laktation und der Anteil<br />
von Körpergewebe, den die Sau<br />
während der Laktation mobilisiert,<br />
sind entscheidende merkmale.<br />
<strong>Die</strong>se merkmale können<br />
einfach gemessen werden, aber<br />
es stecken eine menge Arbeit<br />
und damit auch Kosten dahinter,<br />
daher werden sie von den meisten<br />
Zuchtorganisationen bis<br />
heute nicht ermittelt. <strong>PIC</strong> hat<br />
die Erfassung dieser wichtigen<br />
merkmale unlängst im neuen<br />
Nukleus APEX gestartet und<br />
noch in diesem Wirtschaftsjahr<br />
werden sie über Zuchtwerte<br />
Eingang in die Zuchtzielsetzung<br />
der mutterlinien finden.<br />
Ein ausgewogenes Zuchtprogramm<br />
ausgerichtet auf Gesamtwirtschaftlichkeit,<br />
basierend auf<br />
genauen reinzuchtdaten zusammen<br />
mit einer Fülle von kommerziellen<br />
Daten in Verbindung<br />
mit Genomischer Selektion<br />
macht weitere Leistungsreserven<br />
vor allem bei „schwierigen“<br />
merkmalen durchaus mobilisierbar.<br />
<strong>Die</strong> Neue Camborough ® ist<br />
eine Kreuzungssau bestehend<br />
aus den Fruchtbarkeitslinien<br />
Landrasse L02 und Large White<br />
L03 und besticht durch:<br />
Hohe Fruchtbarkeit<br />
Hervorragende Aufzuchtleistung<br />
Gleichmäßige Würfe<br />
nächst vorbei ist, wird sich sicher<br />
täuschen, denn auch mit<br />
reinzuchtsauen sind höchste<br />
Leistungen zu realisieren, wie<br />
der zweite – nicht zweitplatzierte<br />
– Vermehrer des Jahres,<br />
Familie Ulrich und Anette<br />
Peschel aus Lonne, eindrucksvoll<br />
unter beweis stellt. In Lonne<br />
wird schon lange mit einer<br />
reinen Large White L03 Herde<br />
zur Produktion von Camborough-Jungsauen<br />
gearbeitet.<br />
mit sorgfältig ausgewähltem<br />
Tiermaterial und einem konsequenten,<br />
professionellen ma-<br />
nagement konnte betriebsleiter<br />
Siegfried Kamping die<br />
Leistung von 25,1 abgesetzten<br />
Ferkeln im Wirtschaftsjahr<br />
2005/06 auf nunmehr 30 abgesetzte<br />
Ferkel pro Sau und Jahr<br />
zu steigern.<br />
<strong>Die</strong> lebend geborenen Ferkel<br />
je Wurf sind nahe der 13, und<br />
Hohe Geburtsgewichte<br />
Sehr gute milchleistung<br />
Gutes rauscheverhalten<br />
Einfaches Handling<br />
Effizienter Futterverbrauch<br />
Hohe Nutzungsdauer<br />
robuste Schlachtschweine<br />
mit marktkonformem magerfleischanteil,<br />
hohen Zunahmen,<br />
guter Futterverwertung<br />
und niedrigen Verlusten<br />
<strong>Die</strong> Neue Camborough ® :<br />
Aktuelle Leistungsdaten<br />
rund 89.000 Sauen in Deutschland<br />
und Österreich lieferten<br />
im abgelaufenen Wirtschaftsjahr<br />
Daten in den Internetsauenplaner<br />
<strong>PIC</strong>Traq.<br />
Wirtschaftliche Fruchtbarkeit<br />
Was in Camborough ® -Sauen<br />
von <strong>PIC</strong> steckt, beweisen die<br />
Ergebnisse der Top-betriebe:<br />
Umrauschquote unter 7,5 %<br />
Abferkelrate über 85 %<br />
rund 13 lebend geborene<br />
Ferkel je Wurf<br />
Totgeburtenrate unter 6 %<br />
Ferkelverluste um die 10 %<br />
rund 2,5 Würfe je Sau/Jahr<br />
über 28 abgesetzte Ferkel je<br />
Sau/Jahr<br />
geringe Sauenverluste von<br />
ca. 5 % und<br />
robuste <strong>PIC</strong>-Sauen, die im<br />
Schnitt mehr als 5 Würfe<br />
produzieren<br />
Gerade auf diesem Top-Niveau<br />
ist es besonders wichtig, dass<br />
alle Parameter, die zur Wirtschaftlichkeit<br />
der Ferkelproduktion<br />
beitragen, in einem<br />
optimalen bereich liegen. Gute<br />
Erstmals ZWEI Vermehrer des Jahres – beide<br />
mit 30,0 abgesetzten Ferkeln je Sau und Jahr<br />
<strong>Die</strong> <strong>PIC</strong>-Vermehrer lieferten sich im vergangenen Wirtschaftsjahr<br />
ein spannendes Kopf-an-Kopf-rennen mit ungewohntem<br />
Ausgang! Wir gratulieren gleich zwei Vermehrern, Familie Carsten<br />
Spieker und Familie Ulrich Peschel, zu einer hervorragenden Leistung<br />
von 30,0 abgesetzten Ferkeln.<br />
v. links: Dr. Kerstin Reiners, <strong>PIC</strong>-Produktionsleitung, Gisela Spieker mit Hannah,<br />
Carsten Spieker, Hinrich Leerhoff, Geschäftsführer <strong>PIC</strong> Deutschland GmbH<br />
vorne: Theresa Spieker mit der Plakette „Vermehrer des Jahres 2009/10“<br />
auch in Lonne liegen die Ferkelverluste<br />
unter 10 %. Lediglich<br />
eine Umrauschquote von<br />
10,3 % und eine Abferkelrate<br />
von knapp 87 % „verhindern“<br />
eine etwas höhere Wurffolge<br />
<strong>für</strong> einen Sprung schon jetzt<br />
über die 30-Ferkel-marke.<br />
mit Herrn Kamping hat Familie<br />
Peschel seit über 24 Jahren<br />
– also seit beginn der Zusammenarbeit<br />
mit <strong>PIC</strong> – einen<br />
kompetenten, selbständig arbeitenden<br />
mitarbeiter, auf den<br />
sie sich verlassen können, so<br />
dass sich Ulrich Peschel auf seine<br />
beratungstätigkeit im <strong>PIC</strong>-<br />
Zuchtsauen-Vertrieb konzentrieren<br />
kann.<br />
Auf den weiteren Plätzen der<br />
diesjährigen Hitliste liegt an<br />
zweiter Stelle die Schweinezucht<br />
Wulfsode mit einem<br />
sehr jungen bestand (rund 900<br />
von links: Patrick, Anette, Ulrich und Sebastian Peschel, Hinrich Leerhoff (<strong>PIC</strong>),<br />
Siegfried Kamping<br />
bzw. sehr gute biologische<br />
Leistungen müssen auch mit<br />
überdurchschnittlichen ökonomischen<br />
Ergebnissen einher<br />
gehen. Nach wie vor heißt das<br />
oberste Zuchtziel der <strong>PIC</strong> stete<br />
<strong>PIC</strong>Traq - Wirtschaftsjahr 2009/10<br />
Betriebe mit Camborough ®<br />
Top 50 Top 25 Top 10<br />
Mittelwerte<br />
% % %<br />
Sauen/Betrieb 881 1177 1895<br />
Umrauscher, % 5,4 5,7 5,5<br />
Abferkelrate, % 88,7 88,7 90,2<br />
lebend geborene Ferkel/Wurf 12,9 13,0 13,1<br />
tot geborene Ferkel/Wurf 0,8 0,7 0,6<br />
% tot geborene Ferkel/Wurf 5,6 5,2 4,7<br />
abgesetzte Ferkel/Wurf 11,6 11,7 11,8<br />
Ferkelverluste, % 10,5 10,0 10,2<br />
Würfe/Sau u. Jahr 2,45 2,45 2,48<br />
abgesetzte Ferkel/Sau u. Jahr 28,4 29,1 29,3<br />
% TKV-Sauen, % 5,3 4,9 4,8<br />
Ø Wurfnr. bei Abgang 4,9 5,2 5,3<br />
Kurzmeldung:<br />
Das kann doch eine <strong>PIC</strong>-Sau nicht<br />
erschüttern!<br />
22.08.2010, Niederösterreich,<br />
Mödling.<br />
Sonntagfrüh ereig nete sich auf der<br />
Wiener Süd auto bahn A2 kurz<br />
vor der Ausfahrt Wiener Neudorf<br />
ein Verkehrsunfall „mit <strong>PIC</strong>-beteiligung“.<br />
Auf dem Weg vom<br />
österreichischen <strong>PIC</strong>-Vermehrer<br />
der Porco-Gruppe zu ihrer neuen<br />
Wirkungsstät te verunglückten 14<br />
<strong>PIC</strong>-Jung sau en.<br />
Der Pkw mit dem An hänger war<br />
auf der A2 in Fahrt richtung Graz<br />
unterwegs, als plötzlich der Anhänger<br />
ausbrach und beim Pannenstreifen<br />
auf die Leitschiene geschleudert<br />
wurde. Zum Stillstand<br />
kam der Anhänger schließlich<br />
schräg auf der Leitschiene, alle<br />
Schweine blieben unverletzt.<br />
Um den Tieren unnötigen Stress<br />
zu ersparen, wurde, in rücksprache<br />
mit dem Lenker, der Anhänger<br />
samt den Jungschweinen von<br />
der Leitschiene gehoben. <strong>Die</strong>s<br />
wurde mit Hebebändern über<br />
den Ladekran des schweren rüstfahrzeuges<br />
durchgeführt. <strong>Die</strong><br />
Feuerwehr mödling brachte den<br />
Anhänger in ihre Zentrale, wo<br />
die jungen Schweine mit frischem<br />
Wasser versorgt wurden und sich<br />
von dem Schreck erholen konnten.<br />
mit einem Ersatzfahrzeug konnte<br />
schließlich die Fahrt wieder<br />
fortgesetzt werden. Der Empfänger<br />
war informiert, nahm die<br />
Schweine mit „leichter“ Verspätung,<br />
aber wohlbehalten, in Empfang.<br />
Auf spätere Nachfrage vermeldete<br />
er auch keine Spätfolgen. Ein<br />
praktischer beweis <strong>für</strong> die robustheit<br />
und Stressstabilität von<br />
<strong>PIC</strong>-Sauen!<br />
Sauen, Produktionsbeginn im<br />
Herbst 2008), aber schon 28,1<br />
abgesetzten Ferkeln. Dritter ist<br />
der betrieb Scheffer mit 27,4<br />
abgesetzten Ferkeln je Sau und<br />
Jahr.<br />
Sicher werden sich die <strong>PIC</strong>-<br />
Vermehrer auch in den nächsten<br />
Jahren einen gesunden<br />
„Wettstreit“ liefern und an<br />
Verbesserung der Gesamtwirtschaftlichkeit<br />
durch Kostenreduktion<br />
in Ferkelerzeugung<br />
und mast.<br />
HLO<br />
Quelle: regionews.at (ergänzt)<br />
weiteren Produktionsfeinheiten<br />
feilen, um so da<strong>für</strong> zu sorgen,<br />
dass sie auch weiterhin den<br />
gesunden Zuchtfortschritt in<br />
„optimaler Verpackung“ an die<br />
<strong>PIC</strong>-Kunden weitergeben. Wir<br />
dürfen uns auf die weiteren<br />
Entwicklungen freuen.<br />
KR/BB
DEZEmbEr <strong>PIC</strong>-ZEIT SEITE 3<br />
Erfolgreiche Ferkelproduktion in geschichtsträchtiger<br />
Umgebung<br />
Xanten am Niederrhein ist uns allen noch aus dem Geschichtsunterricht<br />
bekannt. Oder wer hat noch nichts von Varus und seiner<br />
Schlacht gegen Armin, den Cherusker, gehört?<br />
<strong>Die</strong> Kenner der Schweineszene wissen aber auch, dass am Niederrhein<br />
mit Erfolg Ferkel produziert und Schweine gemästet werden.<br />
Einen diesen <strong>erfolgreiche</strong>n Ferkelproduzenten haben wir besucht.<br />
Kontinuierlich gewachsen<br />
„Ein paar Sauen gab<br />
es hier immer auf dem Hof,“<br />
bestätigen Hubert und Arne<br />
Jordans, die seit Anfang der<br />
90er Jahre <strong>PIC</strong>-Ferkel produzieren.<br />
Nachdem Ende der 70er<br />
Jahre die 40 milchkühe abgeschafft<br />
wurden, waren es zunächst<br />
ca. 80 Sauen. Anfang der<br />
90er kamen weitere 50 hinzu.<br />
Inzwischen sind es - nachdem<br />
der bisherige Stall 2005 einmal<br />
„gespiegelt“ wurde - rund 250<br />
produzierende <strong>PIC</strong>-Sauen. Zu<br />
dem Familienbetrieb gehören<br />
darüber hinaus noch 70 ha<br />
Ackerland.<br />
Viele Kleinigkeiten machen in<br />
der Summe den Erfolg aus<br />
Im Abferkelstall entdecken<br />
wir in einigen buchten kleine<br />
Schalen, in denen die Ferkel<br />
zusätzliche Ersatzmilch<br />
angeboten bekommen. beim<br />
gemeinsamen Stallrundgang<br />
erklärt uns Arne Jordans den<br />
Grund dieser maßnahme, wo<br />
doch landauf landab immer<br />
wieder über den zusätzliche<br />
Arbeitsaufwand und die Kosten<br />
diskutiert wird. „Wir wollen<br />
möglichst ohne Ammensauen<br />
auskommen, die treiben nur<br />
die Produktionstage hoch, reißen<br />
die Gruppen auseinander,<br />
werden „ausgelaugt“ und bringen<br />
im Folgewurf wohlmöglich<br />
schlechtere Leistungen,“ zählt<br />
er die Nachteile auf und fügt<br />
schmunzelnd hinzu: „Und diese<br />
technischen Ammen, an die die<br />
abgesammelten Ferkel gesetzt<br />
werden, mag ich nicht. Außerdem<br />
brauchen die auch ihren<br />
Platz. Allerhöchstens muss mal<br />
eine Schlachtsau noch einen<br />
Wurf groß ziehen.“ Es ist keine<br />
Standardmaßnahme, denn vornehmlich<br />
nach Augenmaß wird<br />
Mmmmhhh: Modifiziertes Milchtassensystem<br />
in den ersten fünf Tagen nach<br />
der Geburt eine milchtasse mit<br />
Hilfe eines Kabelbinders an<br />
den rosten befestigt und darin<br />
die milch angeboten. Eigentlich<br />
gehört ein Leitungssystem<br />
dazu, aber das haben Jordans<br />
bewusst nicht installiert, um<br />
flexibler zu bleiben. Jetzt muss<br />
zwar mit der Gießkanne ausgeschenkt<br />
werden, aber das sind<br />
täglich ca. 30 minuten, die sowieso<br />
zu Tierbeobachtung etc.<br />
aufgewendet werden müssen.<br />
Nach 14 Tagen bekommen die<br />
Ferkel in denselben Schalen zusätzlich<br />
Prestarter in die milch<br />
gemischt. Eine sinnvolle Lösung,<br />
um den Ferkeln den Start<br />
im Flatdeck zu erleichtern.<br />
So gewöhnen sich die Tiere<br />
langsam an feste Nahrungsbestandteile<br />
und richten ihr Verdauungssystem<br />
auf den Abbau<br />
pflanzlicher Nährstoffe aus<br />
(Enzymtraining). Wachstumsstörungen<br />
sowie Ferkelverluste<br />
durch fütterungsbedingte Verdauungsstörungen<br />
werden damit<br />
reduziert.<br />
Hier wird am Wochenende besamt.<br />
Hauptabferkeltag ist <strong>Die</strong>nstag<br />
<strong>Die</strong>nstag – Hauptabferkeltag?<br />
Jetzt mag sich der ein oder andere<br />
Schweineprofi wundern.<br />
Drei monate, drei Wochen,<br />
drei Tage Tragezeit – dann sind<br />
die Sauen ja am Wochenende<br />
belegt worden. richtig, bei<br />
Jordans ist montag Absetztag.<br />
Auch so ein Detail, das sich die<br />
beiden gut überlegt haben. Sicherlich<br />
wird im Deckzentrum<br />
die basis <strong>für</strong> den Erfolg gelegt,<br />
der falsche belegezeitpunkt<br />
lässt sich schwerlich korrigieren.<br />
Aber dennoch sehen die<br />
beiden diese Arbeit im Vergleich<br />
zu den im Abferkelstall<br />
anfallenden sehr vielfältigeren<br />
Aufgaben eher als routine<br />
und besser <strong>für</strong> das Wochenende<br />
geeignet. Dann lieber<br />
morgens und abends jeweils<br />
eine halbe Stunde besamen, zu<br />
viert – die beiden Jordans und<br />
zwei Stimuliereber – geht das<br />
zügig vonstatten. „Außerdem<br />
bekommen wir so immer ohne<br />
Probleme unsere Wunscheber,<br />
die wir bei der GFS abonniert<br />
haben, natürlich <strong>PIC</strong>-Piétrain<br />
NN,“ ergänzt Herr Jordans.<br />
Und als weiterer positiver Faktor<br />
kommt noch hinzu, dass<br />
so der mitarbeiter, den sich<br />
Jordans mit einem milchviehbetrieb<br />
in der Nähe „teilen“,<br />
gerade an den Abferkel- und<br />
Absetztagen ideal eingesetzt<br />
werden kann.<br />
Genügend Futter <strong>für</strong> die Sau,<br />
dann klappt‘s auch mit der<br />
Milchleistung<br />
Das Futter wird auf dem be-<br />
„Breifütterung“ im Abferkelstall: Fer-kelmilch plus Prestarter<br />
trieb selbst gemischt. Eigenes<br />
Getreide plus Sojaschrot, Sojaöl<br />
und bierhefe. Am Abferkel-<br />
und am ersten Säugetag sind es<br />
jeweils noch zwei mahlzeiten<br />
das NT-Futter, ab dem dritten<br />
Säugetag wird dann auf Laktationsfutter<br />
umgestellt. mit der<br />
Umstellung auf Laktationsfutter<br />
gibt‘s dann auch dreimal was<br />
zu fressen, so dass eine ausreichende<br />
Futteraufnahme sichergestellt<br />
ist. Auch im Sommer<br />
gibt‘s dann keine Einbrüche<br />
und die Sauen verlassen mit<br />
einer ansprechenden Kondition<br />
den Abferkelstall. „So kommen<br />
sie auch gut wieder in die rausche.“<br />
Fit nach der Säugezeit, dann<br />
klappt‘s auch mit dem nächsten<br />
Wurf<br />
Dass die Sauen nach der Säugezeit<br />
fit zur nächsten belegung<br />
kommen, bestätigt die<br />
Umrauschquote von unter 9 %.<br />
bis zum 40. Trächtigkeitstag<br />
wird aufkonditioniert. „Da geht<br />
aber noch was, bei den Jungsauen<br />
müssen wir noch besser<br />
werden. Daran arbeiten wir<br />
zurzeit,“ lautet Arne Jordans<br />
Kommentar zu den doch sehr<br />
guten Ergebnissen im letzten<br />
Wirtschaftsjahr. In den zwei<br />
Deckzentren mit insgesamt 60<br />
Plätzen sind die Sauen in Kastenständen<br />
mit Freilauf, die<br />
Jungsauen jeweils in Sechsergruppen<br />
untergebracht.<br />
<strong>Die</strong> älteste Sau im Stall hat bislang in<br />
zwölf Würfen 139 Ferkel geboren, 129<br />
davon lebend und 124 abgesetzt. In<br />
ihrem jetzigen Wurf kommen noch mal<br />
11 hinzu.<br />
Auch die Jungsauen sind vom<br />
Niederrhein<br />
Alle zwei monate kommen<br />
zwölf Jungsauen aus dem <strong>PIC</strong>-<br />
Aufzuchtbetrieb Dohrenbusch<br />
in Tönisvorst. <strong>Die</strong> „jungen Damen“<br />
dürfen sich dann erstmal<br />
sechs Wochen an alles auf dem<br />
neuen betrieb gewöhnen und<br />
werden in das Impfprogramm<br />
eingebunden und bekommen<br />
ihre Parvo-, rotlauf- und<br />
PrrS-Impfungen. Zwischendurch<br />
geht‘s einen Tag ins<br />
Deckzentrum, aber „nur gucken,<br />
nicht anfassen …“.<br />
Eingliederungsstall<br />
1300 Ferkelaufzuchtplätze<br />
– eigentlich schon wieder zu<br />
wenig, das altbekannte „Luxusproblem“<br />
…<br />
Nach drei Wochen Säugezeit<br />
ziehen die Ferkel um. Entweder<br />
ins erst vor gut vier<br />
Jahren neu gebaute Flatdeck<br />
mit 800 Plätzen oder in eines<br />
der Abteile in einem Altgebäude.<br />
Hier bleiben sie bis<br />
zu ihrem Verkaufsgewicht<br />
von im Durchschnitt 28 kg<br />
und verlassen somit knapp 11<br />
Wochen nach ihrer Geburt den<br />
Hof in Xanten.<br />
Positive Rückmeldungen aus<br />
der Mast<br />
In der mast hinterlassen<br />
Jordans <strong>PIC</strong>-Ferkel dann auch<br />
einen guten Eindruck: nur 1,5 %<br />
Verluste, rund 800 g masttagszunahmen<br />
und ca. 0,99 Indexpunkte<br />
je kg Schlachtgewicht<br />
machen jeden mäster zufrieden.<br />
Zukunft noch nicht entschieden!<br />
<strong>Die</strong> nächsten Weichenstellungen<br />
<strong>für</strong> die zukünftige Ausrichtung<br />
des betriebes sind<br />
noch nicht zu Ende diskutiert.<br />
Hubert und Arne Jordans können<br />
sich sowohl vorstellen, auf<br />
500 Sauen aufzustocken oder<br />
mit 250 weiterzumachen, dann<br />
aber die Ferkel selbst zu mästen.<br />
Weiteres Wachstum ist aber auf<br />
jeden Fall angesagt.<br />
„Natürlich wollen wir viele<br />
Ferkel …“<br />
<strong>Die</strong>se Aussage hören wir landauf<br />
landab. Und die Entwicklung<br />
in der Ferkelerzeugung<br />
gerade in den letzten Jahren<br />
spiegelt diese Forderung deut-<br />
Ferkelaufzucht<br />
Der Betrieb Jordans im Wirtschaftsjahr 2009/10<br />
Produktionsrhythmus 2 Wochen<br />
produktive Sauen 250<br />
Umrauschquote, % 8,8<br />
Abferkelrate, % 88,7<br />
gesamt geb. Ferkel/Wurf 13,9<br />
tot geborene Ferkel, % 6,5<br />
lebend geborene Ferkel/Wurf 13,0<br />
Säugezeit, Tage 21<br />
Absetzgewicht, kg 6,5<br />
Zwischenwurfzeit, Tage 144<br />
remontierungsrate, % 33,6<br />
abgesetzte Ferkel/Sau u. Jahr 29,13<br />
Quelle: Sauenplaner KW Supersau<br />
Profis fachsimpeln …, von links Mitarbeiter Tobias Terlinden, Arne Jordans und<br />
<strong>PIC</strong>-Berater Johann Hindriks<br />
lich wieder. Von enormen<br />
Leistungssteigerungen gerade<br />
im merkmal Wurfgröße wird<br />
berichtet. Auch bei Jordans<br />
können wir dies sehen. In den<br />
12 Ferkel an der Sau …<br />
letzten Jahren kamen jedes Jahr<br />
1,5 bis 2 abgesetzte Ferkel je<br />
Sau und Jahr hinzu, so dass in<br />
der letzten Wirtschaftsjahresauswertung<br />
über 29 abgesetzte<br />
Ferkel zu buche stehen.<br />
Der Arbeitskreis rheinland,<br />
in dem Jordans mitglied sind,<br />
ist einer der <strong>erfolgreiche</strong>n<br />
Deutschlands. Im Schnitt<br />
setzten die 147 betriebe 24,69<br />
Ferkel je Sau im vergangenen<br />
Jahr ab, die besten 25 % brachten<br />
es auf 27,66 Ferkel und der<br />
betrieb Jordans rangierte in den<br />
Top 5 %!<br />
„Aber,“ betont der 28-jährige<br />
Arne Jordans, „ich will die<br />
vielen Ferkel mit einem überschaubaren<br />
Arbeitsaufwand<br />
realisieren können. Und das<br />
klappt!“ <strong>Die</strong> aktuellen Ergebnisse<br />
weisen den Weg. In den<br />
ersten Wochen des neuen Wirtschaftsjahres<br />
waren es immer<br />
12 abgesetzte Ferkel je Wurf,<br />
so dass Jordans sehr überzeugt<br />
verlauten lässt „Nächstes Jahr<br />
steht auf der Wirtschaftsjahresauswertung<br />
eine 3 vorne bei<br />
den abgesetzten Ferkeln! Das<br />
kriegen wir ohne mehraufwand<br />
hin. Dazu nehmen wir<br />
auch den Leistungsschub mit,<br />
den die Neue Camborough uns<br />
jetzt noch bringt.“<br />
BB
SEITE 4 <strong>PIC</strong>-ZEIT DEZEmbEr<br />
Genomische Selektion beim Schwein<br />
- von der Utopie zur Realität<br />
Genauigkeit der Zuchtwertschätzung<br />
bestimmt den Zuchtfortschritt<br />
Züchter streben danach, den<br />
Zuchtfortschritt laufend zu<br />
verbessern. Dabei können sie<br />
verschiedene Faktoren beeinflussen,<br />
denn der jährliche<br />
Zuchtfortschritt einer Population<br />
(∆G Jahr ) wird durch vier<br />
Größen bestimmt:<br />
durch die Genauigkeit der<br />
Selektion (r ), also der<br />
Sel<br />
Korrelation zwischen dem<br />
wahren Zuchtwert und<br />
dem geschätzten Zuchtwert,<br />
d. h. je genauer der geschätzte<br />
Zuchtwert den<br />
wahren Zuchtwert vorhersagt,<br />
umso größer ist der<br />
Zuchtfortschritt,<br />
durch die genetische Standardabweichung<br />
(σ ), d. g<br />
h. je größer die Variation<br />
zwischen den Tieren, umso<br />
größer ist der Zuchtfortschritt,<br />
durch die Selektionsintensität<br />
(i) und<br />
durch das Generationsintervall<br />
(t), also das durchschnittliche<br />
Alter der<br />
Eltern, wenn ihre Nachkommen<br />
geboren werden.<br />
D. h. je kürzer das Generationsintervall,<br />
umso höher<br />
der Zuchtfortschritt.<br />
Umfangreiche Eigenleistungs-<br />
und Nachkommenprüfung =<br />
hoher Zuchtfortschritt?<br />
mehr Geschwister- und Nachkommendaten<br />
erhöhen die Genauigkeit,<br />
verlängern aber das<br />
Generationsintervall. Entscheidend<br />
ist die richtige balance<br />
zwischen Genauigkeit und<br />
zeitlicher Verzögerung.<br />
Auf den ersten blick erscheint<br />
es einfach, den Zuchtfortschritt<br />
zu erhöhen, denn mit vielen<br />
Leistungsdaten von Verwandten<br />
und Nachkommen erhöht<br />
sich die Genauigkeit der Selektion.<br />
Allerdings wird dadurch<br />
gleichzeitig das Generationsintervall<br />
deutlich verlängert und<br />
somit der gewonnene Vorteil<br />
wieder aufgezehrt. Das heißt<br />
also, dass zu einem frühen <strong>Zeit</strong>punkt<br />
genaue Informationen<br />
über den genetischen Wert<br />
eines Tieres vorliegen müssen.<br />
Genau an dieser Stelle setzt die<br />
genomische Selektion an.<br />
Der Fortschritt in der Biotechnologie<br />
macht‘s möglich<br />
Verständlich ist, warum sich<br />
derzeit gerade die rinderzüchter<br />
intensiv mit der genomischen<br />
Selektion beschäftigen,<br />
da aufgrund des langen<br />
Generationsintervalls und dem<br />
Test- und Wartebullensystem<br />
viel <strong>Zeit</strong> vergeht, bis ein erster<br />
sicherer Zuchtwert <strong>für</strong> einen<br />
bullen geschätzt werden kann.<br />
Aber nicht nur die Verkürzung<br />
des Generationsintervalls spielt<br />
eine entscheidende rolle bei der<br />
Entscheidung <strong>für</strong> die Nutzung<br />
von Genom-Informationen. Auch<br />
in der Schweinezucht leistet die<br />
marker-gestützte/genomische Se-<br />
Fragen und Antworten<br />
zur „Genomischen Selektion“<br />
Was ist ein Marker?<br />
Als marker bezeichnet man<br />
in der molekularbiologie eindeutig<br />
identifizierbare, kurze<br />
DNA-Abschnitte, deren Ort<br />
im Genom bekannt ist. Solche<br />
markergene sind im Genom<br />
vorhanden.<br />
Was ist ein SNP?<br />
Es gibt verschiedene Arten von<br />
markern, u. a. so genannte SNPs<br />
(sprich snips). <strong>Die</strong>se werden bei<br />
der markeranalyse untersucht.<br />
SNP steht <strong>für</strong> den englischen<br />
begriff Single Nucleotid Polymorphism,Einzelnukleotid-Polymorphismus.<br />
<strong>Die</strong>s sind Variationen<br />
von einzelnen basenpaaren<br />
in einem DNA-Strang. Einige<br />
dieser Veränderungen sind mit<br />
der unterschiedlichen Ausprägung<br />
von merkmalen verknüpft.<br />
Polymorphismen treten relativ<br />
häufig auf und haben eine hohe<br />
Variabilität. <strong>Die</strong>sen Umstand<br />
macht man sich bei der Genmarker-Analyse<br />
zunutze.<br />
In welchem Umfang werden Marker<br />
bzw. Genom-Informationen<br />
in der Schweinezucht genutzt?<br />
Als Startpunkt der Nutzung von<br />
marker- oder Genom-Informationen<br />
in der Schweinezucht<br />
kann die Entdeckung des „Halothan-Gens“<br />
gesehen werden,<br />
denn wissenschaftlich gesehen<br />
ist diese Gen-mutation, die die<br />
Stressanfälligkeit beim Schwein<br />
beeinflusst, nichts anderes als ein<br />
„Gen-marker“. Somit ist die Selektion<br />
gegen Stressanfälligkeit<br />
lektion einen wichtigen beitrag.<br />
Niedrig erbliche merkmale wie<br />
Fruchtbarkeit, Vitalität oder<br />
Krankheitsresistenz, erst am geschlachteten<br />
Tier oder nach Abschluss<br />
des Produktionsabschnitts<br />
messbare merkmale wie muskelfleischanteil,<br />
rückenspeck,<br />
Fleischqualität, Tageszunahmen,<br />
Futterverwertung sind nur einige<br />
hier zu nennende merkmale.<br />
Gerade auch die Vielzahl der wirtschaftlich<br />
relevanten merkmale in<br />
der Schweine- im Vergleich zur<br />
rinderzucht, macht es notwendig,<br />
alle möglichkeiten zu ihrer weiteren<br />
Verbesserung auszuschöpfen.<br />
In den vergangenen Jahren<br />
wurde das Schweine-Genom<br />
immer weiter erforscht und<br />
mehr und mehr Gene bzw.<br />
marker und mit ihnen verbundene<br />
Eigenschaften wurden<br />
entdeckt.<br />
Voraussichtlich Ende 2010<br />
wird das Schweinegenom vollständig<br />
entschlüsselt sein. Zu<br />
beginn der marker-gestützten<br />
Selektion (marker Assisted<br />
Selection - mAS) wurde der<br />
jeweilige markerstatus <strong>für</strong> das<br />
Einzeltier ausgewiesen, bsp.<br />
Halothan-Status NN, NP oder<br />
PP, und die Effekte als so genannte<br />
fixe Effekte in die statistischen<br />
modelle der Zuchtwertschätzung<br />
einbezogen.<br />
die erste praktische Anwendung<br />
eines Gen-markers. Schon seit<br />
rund 20 Jahren ist bei <strong>PIC</strong> die<br />
Nutzung genetischer marker in<br />
der Selektion und Zuchtwertschätzung<br />
ein integraler bestandteil<br />
des Zuchtprogramms.<br />
<strong>Die</strong> Technologie bietet die Möglichkeit<br />
zur umfassenden Genomanalyse.<br />
Jede Zuchtorganisation<br />
und jedes Zuchtunternehmen<br />
kann diese Technologie nutzen.<br />
Welchen Vorteil bringt dann die<br />
genomische Selektion noch?<br />
<strong>Die</strong> Technologie in Form z. b.<br />
des Untersuchungschips, mit<br />
dem 60.000 SNPs eines Tieres<br />
gleichzeitig untersucht werden<br />
können, kann jeder nutzen. So<br />
ein Chip kostet ca. 150 US$ pro<br />
Schwein. Das Entscheidende<br />
jedoch ist, dass nicht jede Zuchtorganisation<br />
oder jedes Zuchtunternehmen<br />
die notwendigen<br />
mittel und möglichkeiten hat,<br />
die aus dem Genomscan gewonnenen<br />
Informationen in das<br />
Zuchtfortschritt<br />
€/Schlachtschwein<br />
(wirtschaftlicher Wert des Zuchtfortschritts)<br />
50 €<br />
45 €<br />
40 €<br />
35 €<br />
30 €<br />
25 €<br />
20 €<br />
15 €<br />
10 €<br />
5 €<br />
0 €<br />
0,30 €/Jahr<br />
„Klassische Selektion“<br />
Eigenleistungs- und<br />
Nachkommenprüfung<br />
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015<br />
Frühzeitige Nutzung sichert<br />
den Zuchtvorsprung<br />
Chip zur gleichzeitigen Analyse von<br />
60.000 Genorten eines Tieres<br />
Foto: Illumina<br />
Schon seit rund 20 Jahren ist<br />
bei <strong>PIC</strong> die Nutzung genetischer<br />
marker in der Selektion<br />
und Zuchtwertschätzung<br />
ein integraler bestandteil des<br />
Zuchtprogramms.<br />
War es Anfang der 90er Jahre<br />
noch ziemlich zeit- und kostenintensiv,<br />
an einzelnen Tieren<br />
einzelne marker zu identifizieren,<br />
so ist es heute möglich,<br />
mit so genannten SNP-Chips<br />
60.000 Genorte eines Tieres in<br />
einem Lauf auf eine Vielzahl<br />
von markern zu untersuchen.<br />
Auch die rechenmodelle und<br />
rechnerkapazitäten wurden<br />
laufend verbessert, so dass<br />
heutzutage Zuchtwerte täglich<br />
aktualisiert werden können.<br />
Heute bezieht <strong>PIC</strong> die Informationen<br />
von über 4,2 millionen<br />
Schweinen in die tägliche<br />
Zuchtwertschätzung ein. So<br />
wurden z. b. 2009 wöchentlich<br />
mehr als 411.000 Einzeltier-<br />
Indizes aktualisiert.<br />
0,60 €/Jahr<br />
BLUP-<br />
Zuchtwertschätzung<br />
Vorteile der marker-gestützten<br />
Selektion<br />
Verbesserung der Genauigkeit<br />
der Selektion und damit<br />
Erhöhung des Zuchtfortschritts<br />
Vorverlegung der Selektionsentscheidung<br />
und damit<br />
Erhöhung des Zuchtfortschritts<br />
je <strong>Zeit</strong>einheit<br />
möglichkeit zur Produktdifferenzierung<br />
(z. b.<br />
Futteraufnahme, Krankheitsresistenz,Fleischqualität,<br />
rückverfolgbarkeit)<br />
Ohne Leistungsinformationen<br />
sind genomische Informationen<br />
nicht viel wert<br />
Um sicher herauszufinden, welche<br />
Effekte bestimmte Genorte<br />
haben, benötigt man umfassende<br />
Leistungsinformationen. <strong>Die</strong>se<br />
tierindividuellen Leistungsinformationen<br />
müssen mit denen aus<br />
der Genom-Untersuchung <strong>für</strong><br />
jedes Tier verknüpft werden.<br />
Erst dann erhalten die Genom-<br />
Informationen einen Wert, der<br />
<strong>für</strong> die Zuchtwertschätzung von<br />
bedeutung ist.<br />
regelmäßige Aktualisierung<br />
sowohl der phänotypischen als<br />
auch der genotypischen Daten<br />
ist auch weiterhin unumgänglich,<br />
um auch in Zukunft weitere Verbesserungen<br />
in der Schätzgenauigkeit<br />
zu erzielen.<br />
Deshalb hat <strong>PIC</strong> in den vergangenen<br />
Jahren erheblich investiert<br />
und die Leistungsprü-<br />
2,50 €/Jahr<br />
„Genomische Selektion“<br />
1,00 €/Jahr<br />
„marker-gestützte<br />
Selektion“<br />
2000: durch fortschrittliche Technologien „nur“ 4,00 €/Schlachtschwein mehr Zuchtfortschritt als mit klassischer Selektion<br />
2015: durch fortschrittliche Technologien 18,00 €/Schlachtschwein mehr Zuchtfortschritt als mit klassischer Selektion<br />
Zuchtprogramm einzubinden.<br />
Denn die gefundenen Unterschiede<br />
an bestimmten Genorten<br />
müssen zur Validierung mit<br />
sicheren phänotypischen Daten<br />
verknüpft werden, um den Genunterschieden<br />
auch merkmals-<br />
bzw. Leistungsunterschiede zuordnen<br />
zu können.<br />
Da<strong>für</strong> reicht nicht nur eine<br />
Handvoll Tiere. <strong>PIC</strong> überprüft<br />
jeden marker an 3.000<br />
bis 4.000 Schweinen, bevor sie<br />
den markereffekt in die Zuchtwertschätzung<br />
einbindet. Auch<br />
im weiteren Verlauf müssen die<br />
markerergebnisse immer wieder<br />
an Leistungsdaten überprüft<br />
werden. <strong>Die</strong>s erfordert sowohl<br />
finanzielle als auch personelle<br />
mittel, die den wenigsten Zuchtunternehmen<br />
oder gar Zuchtorganisationen<br />
zur Verfügung<br />
stehen.<br />
<strong>PIC</strong> sagt, sie sei weltweit führend<br />
in der Anwendung von<br />
Biotechnologie in der Tierzucht.<br />
Was machen denn die anderen?<br />
Erst kürzlich hat die redaktion<br />
der Fachzeitschrift SUS<br />
die in Deutschland vertretenen<br />
Zuchtorganisationen und –unternehmen<br />
zum Thema „Genomische<br />
Selektion“ befragt (SUS<br />
2/2010). Unabhängig voneinander<br />
bestätigten alle die Vorteile<br />
der Genom-Analyse gera-<br />
fungen im Nukleus um 20 %<br />
erhöht sowie u. a. 360.000 US$<br />
<strong>für</strong> ein Hochleistungs-Computer-Cluster<br />
ausgegeben, um die<br />
exponentiell zunehmende Datenmenge<br />
zu bewältigen. Auch<br />
das Kreuzungszucht-Programm<br />
wurde weiter ausgebaut und<br />
liefert umfangreiche Leistungsinformationen<br />
aus der kommerziellen<br />
Produktionsstufe <strong>für</strong> die<br />
Verbesserung der reinzuchtlinien.<br />
<strong>PIC</strong> hat heute, wie kein<br />
anderes Zuchtunternehmen, eine<br />
Datenbank mit rund 12,5 millionen<br />
Datensätzen über phänotypische<br />
Leistungsinformationen,<br />
darunter über eine million Sauen<br />
mit vollständig erfasster Abstammung<br />
sowie über 1,5 millionen<br />
eingelagerte DNA-Proben, die<br />
in den vergangenen zehn Jahren<br />
gesammelt wurden. Und täglich<br />
kommen neue Daten hinzu!<br />
<strong>PIC</strong><br />
erhöht die Selektionsgenauigkeit<br />
und damit den Zuchtfortschritt<br />
durch genomische<br />
Selektion, umfangreiche<br />
Leistungsprüfungen und<br />
modernste Schätzmodelle<br />
um über 60 % (Fruchtbarkeitsmerkmale),<br />
hat als einziges Schweinezuchtunternehmen<br />
die notwendigen<br />
Voraussetzungen<br />
und möglichkeiten, um die<br />
genomische Selektion <strong>für</strong><br />
ihre Kunden gewinnbringend<br />
anzuwenden.<br />
HLO/BB<br />
de bei komplexen merkmalen<br />
wie Vitalität oder Gesundheit.<br />
<strong>Die</strong> Vertreter von bHZP, Topigs<br />
und DanZucht zeigten<br />
sich allerdings skeptisch bezüglich<br />
der zukünftigen bedeutung<br />
insbesondere aufgrund der hohen<br />
Typisierungs- und notwendigen<br />
laufenden Kalibrierungskosten.
DEZEmbEr <strong>PIC</strong>-ZEIT SEITE 5<br />
Scan # untersuchte Merkmale Dauer der Untersuchung Anzahl SNP‘s Kosten/Genotyp Anzahl untersuchter Genotypen<br />
HDG 1 alle routinemäßig verfügbaren Produktionsmerkmale 4 Jahre 1.000 $0,10 6,5 mio.<br />
HDG 2 Verluste/mortalität 2 Jahre 2.000 $0,05 10,6 mio.<br />
HDG 3 Erbdefekte 6 monate 7.000 $0,02 22,6 mio.<br />
HDG 4 Wurfgröße 3 monate 60.000 $0,02 125 mio.<br />
HDG 5 genomweit 60.000<br />
HDG = High Density Genotyping (Hochgeschwindigkeits-Typisierung von Genotypen)<br />
DanZucht hat erst im vergangenen<br />
Jahr eine Stichprobe<br />
von weniger als 1.000 Landrasse-Ebern<br />
typisieren lassen bzw.<br />
lässt derzeit rund 2.000 Duroc-<br />
Eber analysieren. Dabei wird<br />
hauptsächlich Wert auf Informationen<br />
bzgl. Futterverwertung<br />
und Schlachtkörperwert<br />
gelegt. Hier sei allerdings angemerkt,<br />
dass dies merkmale<br />
sind, die aufgrund ihrer guten<br />
Erblichkeit nicht vorrangig <strong>für</strong><br />
die Weiterentwicklung mittels<br />
genomischer Selektion prädestiniert<br />
sind …<br />
Topigs baut seit geraumer <strong>Zeit</strong><br />
eine Probensammlung (Haar,<br />
blut, Gewebe, Sperma) auf und<br />
nutzt diese <strong>für</strong> DNA-Tests auf<br />
Stressresistenz (mHS-Gen)<br />
und Fleischqualität (rN-Gen).<br />
<strong>Die</strong> Technik des Genomscans<br />
wird bislang nur zur rückverfolgung<br />
genutzt. Eine routinemäßige<br />
Einbindung – wie bei<br />
der <strong>PIC</strong> realität – ist bislang<br />
nicht geplant. Geforscht werden<br />
soll im bereich der markeridentifizierung<br />
<strong>für</strong> Ebergeruch,<br />
Erbfehler oder auch<br />
bemuskelung.<br />
Das bHZP sieht gerade aufgrund<br />
der hohen Kosten lediglich<br />
möglichkeiten der Vorselektion<br />
von Prüfkandidaten<br />
<strong>für</strong> die Geschwisterprüfung auf<br />
Station.<br />
Wir können davon ausgehen,<br />
dass die Forschungs- und Entwicklungsarbeit<br />
in diesen Unternehmen<br />
bei Weitem nicht<br />
den Umfang und die Erfolge<br />
angenommen hat – und annehmen<br />
wird – wie es bei <strong>PIC</strong> der<br />
Fall ist.<br />
Wird bei der Genomanalyse bzw.<br />
der anschließenden genomischen<br />
Selektion irgendetwas an den<br />
Genen verändert?<br />
Ein klares Nein! <strong>Die</strong> markeranalyse<br />
liefert „nur“ die Informationen<br />
<strong>für</strong> die Selektionsentscheidung.<br />
Der Weg der<br />
Vererbung der gewünschten<br />
Eigenschaften ist und bleibt<br />
derselbe wie eh und je.<br />
Welche Marker nutzt die <strong>PIC</strong><br />
derzeit in ihrem Zuchtprogramm?<br />
Verschiedene HDG-Projekte<br />
beschäftigen sich mit verschiedenen<br />
merkmalsgruppen (siehe<br />
Tabelle oben). <strong>Die</strong> Projekte 1<br />
und 2 zielten darauf ab, marker<br />
<strong>für</strong> Produktions- und robustheitsmerkmale<br />
zu finden,<br />
HDG3 beschäftigte sich mit<br />
der Analyse von Erbdefekten<br />
und im HDG4-Projekt wurden<br />
marker <strong>für</strong> die Wurfgröße<br />
gesucht. Das fünfte Projekt ist<br />
der beginn der genomischen<br />
Selektion im Frühjahr 2010.<br />
Das aktuelle resultat der <strong>PIC</strong>-<br />
Genomforschung sind weit<br />
über 200 identifizierte marker,<br />
die seit 2003 real in die Zuchtwertschätzung<br />
der reinzuchtlinien<br />
eingebunden werden, um<br />
mit Hilfe von bLUP-Zuchtwerten<br />
Verlustraten, Produk-<br />
tions- und reproduktionsmerk-<br />
male, Auftreten von Defekten<br />
sowie Fleischqualität zu verbessern.<br />
Weitere rund 250 marker<br />
befinden sich im Prüfverfahren.<br />
Hier muss noch die endgültige<br />
Freigabe abgewartet werden,<br />
bevor sie kommerziell eingesetzt<br />
werden können. Einige<br />
der marker beeinflussen zudem<br />
gleich mehrere merkmale,<br />
sodass die Gesamtsumme der<br />
genutzten marker sogar noch<br />
größer als 200 ist.<br />
Signifikante marker, die im<br />
Verlauf des HDG-Projektes<br />
entdeckt werden, werden auf<br />
ihre kommerzielle bedeutung<br />
hin geprüft. Daraufhin erfolgt<br />
eine weitere routinemäßige<br />
Untersuchung ihrer Wirkweise<br />
bei ihrer Einbindung in die<br />
Weiterentwicklung der reinzuchtlinien.<br />
Darüber hinaus<br />
werden die marker auch überprüft,<br />
um unerwartete negative<br />
Effekte auf andere merkmale<br />
ausschließen zu können. Nach<br />
<strong>erfolgreiche</strong>r Testphase werden<br />
die marker routinemäßig in<br />
den reinzuchtlinien genotypisiert<br />
und ihre Effekte in die<br />
bLUP-Zuchtwertschätzung<br />
integriert.<br />
‚Genomische Selektion‘ ist also<br />
sehr kostenintensiv. Was verspricht<br />
sich die <strong>PIC</strong> denn nun<br />
letztendlich von der Nutzung?<br />
<strong>Die</strong> Antwort auf diese Frage<br />
liefert die Aussage des „Chef-<br />
Genetikers“ der <strong>PIC</strong>, Dave<br />
mcLaren:<br />
„Warum machen wir das alles?<br />
<strong>PIC</strong>‘s Vision ist es, ‚das weltbeste<br />
Schwein‘ zu entwickeln.<br />
<strong>Die</strong>se Aussage soll nicht arrogant<br />
klingen, aber verdeutlicht<br />
unsere Strategie. Wir haben<br />
Produktion von leistungsfähigen Endstufenebern<br />
unter Einsatz modernster Zuchtverfahren<br />
In den vergangenen 30 bis 40 Jahren hat sich die bedeutung der<br />
Endstufeneber in der globalen Produktionskette von Schlachtschweinen<br />
enorm verschoben. Im Vergleich zu den guten Natursprungebern,<br />
die vor ca. 30 Jahren gerade mal ca. 350 – 550<br />
Schlachtschweine pro Jahr produziert bzw. genetisch beeinflusst<br />
haben, sind die heutigen Kb-Eber mit ca. 4.400 bis 6.500 produzierten<br />
Schlachtschweinen pro Jahr wahre Schwergewichte in der<br />
Verbreitung ihrer Gene. Auch wenn eine alte Weisheit besagt, dass<br />
50 % der Gene eines Schlachtschweines vom Endstufeneber abhängig<br />
sind, ist doch deutlich erkennbar, dass sich der Einfluss der<br />
Endstufeneber in den letzten drei Jahrzehnten um mehr als das 12<br />
bis 15-fache steigerte. Zu erwartende neue reproduktionstechnologien<br />
werden diesen Einfluss noch weiter steigern. Somit werden<br />
der wirtschaftliche Einfluss des einzelnen besamungsebers und damit<br />
auch die Verantwortung der Zuchtunternehmen im Hinblick<br />
auf die Zucht von gesamtwirtschaftlichen Endproduktebern zukünftig<br />
weiter an bedeutung gewinnen. <strong>Die</strong>se Aufgabe stellt große<br />
Herausforderungen an alle marktteilnehmer.<br />
Um sowohl den lokalen<br />
als auch den globalen<br />
aktuellen und zukünftigen<br />
marktanforderungen<br />
gerecht zu werden - ein gutes<br />
beispiel hierzu ist die aktuelle<br />
maskenänderung, die Diskussion<br />
über Ebermast, zukünftige<br />
Erfordernisse in Sachen Tierhaltungsverordnung,Steigerung<br />
des Schlachtgewichtes etc.<br />
Grafik 1: <strong>PIC</strong>-Eberlinien<br />
- wird eine gewisse Anzahl von<br />
Eberlinien benötigt. <strong>PIC</strong> bearbeitet<br />
aktuell züchterisch sechs<br />
Eberlinien (L14, L15, L18,<br />
L27, L62 und die L65-Familie).<br />
Des Weiteren werden zwei<br />
kundenspezifische Eberlinien<br />
züchterisch weiter entwickelt.<br />
<strong>Die</strong>se enorme Eberlinienanzahl,<br />
maßgeschneiderte Indizes<br />
auf Länder- und Kundenebene,<br />
sowie mehr als 15 Endstufeneberprodukte,<br />
machen es<br />
<strong>PIC</strong> möglich, marktführende<br />
Endprodukteber in den jeweiligen<br />
marktsegmenten unter<br />
dem Aspekt der Gesamtwirtschaflichkeit<br />
zu liefern. Grafik<br />
1 stellt die vier wichtigsten<br />
<strong>PIC</strong>-Eberlinien bzw. die sieben<br />
wichtigsten Endstufeneberprodukte<br />
der <strong>PIC</strong> dar.<br />
bei den Endstufenebern machen<br />
die sieben weltweit meist<br />
verkauften Endstufeneberlinien<br />
ca. 70 % des gesamten<br />
Verkaufsvolumens der <strong>PIC</strong><br />
aus. <strong>Die</strong> unterschiedlichen nationalen,<br />
regionalen oder auch<br />
lokalen marktanforderungen<br />
bedingen regional deutlich unterschiedliche<br />
Nachfrage nach<br />
den differenzierten <strong>PIC</strong>-Eberlinien.<br />
Um den verschiedenen Ansprüchen<br />
gerecht zu werden,<br />
unterhält die <strong>PIC</strong> ein globales<br />
Produktionsnetz von mehr als<br />
50 Ebervermehrungsbetrieben<br />
mit einer durchschnittlichen<br />
betriebsgröße von über 360<br />
Sauen pro betrieb. <strong>Die</strong> betriebsgröße<br />
ist von nicht unerheblicher<br />
bedeutung, da sie<br />
einen entscheidenden Einfluss<br />
auf die Verfügbarkeit der jeweiligen<br />
Eberprodukte hat.<br />
Anders ausgedrückt: mehr<br />
und mehr wird eine verringerte<br />
remontierungsfrequenz der<br />
besamungsstationen registriert,<br />
um das Gesundheitsrisiko und<br />
damit das wirtschaftliche risiko<br />
durch die Zufuhr von Tieren<br />
zu minimieren. Hinzu kommt<br />
die weiter steigende Effizienz<br />
in der Ausnutzung der besamungseber.<br />
<strong>Die</strong>se Entwicklungen<br />
bedingen, dass größere<br />
Lieferpartien von gleichbleibender<br />
genetischer Qualität erwartet<br />
bzw. vorausgesetzt werden.<br />
Um eine Lieferflexibilität im<br />
globalen Produktionsnetz<br />
zu erzielen, den steigenden<br />
marktansprüchen gerecht zu<br />
werden, und somit das risiko<br />
<strong>für</strong> unsere Kunden zu minimieren,<br />
hat die <strong>PIC</strong> seit jeher<br />
<strong>für</strong> den Aufbau des Eberpro-<br />
intern nachweisen können, dass<br />
durch die Einbeziehung von<br />
genomischen Informationen,<br />
die Genauigkeit von Teilzuchtwerten<br />
insbesondere <strong>für</strong> niedrig<br />
erbliche merkmale deutlich gesteigert<br />
werden kann. <strong>PIC</strong> profitiert<br />
dabei von seinen quantitativen<br />
Genetikern, die sowohl<br />
in der Schweine- als auch rinderzucht<br />
mit dem Genomscan<br />
arbeiten. Wir wissen darüber<br />
hinaus, dass mit der Einführung<br />
dieser Technologien in unser<br />
Zuchtprogramm unsere Kunden<br />
einen deutlichen mehrwert<br />
erzielen konnten. Genauso wie<br />
die elektronische Erfassung der<br />
Futteraufnahme, die Einbeziehung<br />
von Kreuzungstierinformationen<br />
sowie die index- und<br />
inzuchtoptimierte Paarungsplanung<br />
zu Standardwerkzeugen<br />
in unserem Programm<br />
geworden sind, wird die genomische<br />
Selektion nach unserer<br />
Einschätzung zukünftig <strong>für</strong><br />
die führenden weltweit tätigen<br />
Schweinezuchtunternehmen<br />
wesentliche Teile der Kosten-<br />
Merkmal DNA-Marker<br />
Lebenstagszunahmen 45<br />
Futteraufnahme 40<br />
rückenspeckdicke 56<br />
rückenmuskeldicke 54<br />
pH24 54<br />
minolta L* 16<br />
Saugferkelverluste (merkmal der Ferkel) 11<br />
Flatdeckverluste 12<br />
mastverluste 14<br />
Erbdefekte 4<br />
Fundamentnote 44<br />
Fleischmarmorierung 21<br />
Gesamt geborene Ferkel 19<br />
Tot geborene Ferkel 14<br />
Ferkelüberlebensrate (merkmal der Sau) 17<br />
Wurfabsetzgewicht 10<br />
Sauensterblichkeit 3<br />
Ödemkrankheit 1<br />
duktionsnetzwerkes den allerhöchsten<br />
Gesundheitsstatus<br />
angestrebt, erzielt und durch<br />
kontinuierliche Investitionen<br />
erhalten oder falls möglich sogar<br />
noch verbessert. Von den<br />
ca. 20.000 Urgroßeltern- und<br />
Großelternsauen in der welt-<br />
struktur im Zuchttiergeschäft<br />
bestimmen.<br />
Heute nutzen wir den „Illumina<br />
PorcineSNP60 beadChip“<br />
als unser „Arbeitspferd“ bei<br />
der Hochgeschwindigkeits-<br />
Genotypisierung. In der rinder-/milchvieh-Zucht<br />
werden<br />
in Kürze Plattformen <strong>für</strong> die<br />
zeitgleiche Genotypisierung<br />
von 800.000 SNPs zur Verfügung<br />
stehen. Technisch machbar<br />
ist es, auch einen Chip zur<br />
Genotypisierung von 800.000<br />
Schweine-SNPs herzustellen,<br />
wenn die Nachfrage an Hersteller<br />
wie Illumina gestellt<br />
wird. Wir sind eindeutig an<br />
einem Wendepunkt in der Anwendung<br />
von genomischen Instrumenten<br />
beim Schwein.<br />
<strong>Die</strong> <strong>PIC</strong> glaubt an den Wert<br />
dieser Technologie und wird sie<br />
weiter entwickeln, um auch in<br />
Zukunft Vorreiter in der Anwendung<br />
genomischer Technologien<br />
zu sein. In zwanzig Jahren<br />
wird der erneute rückblick<br />
wieder interessant sein. Dann<br />
werden wir sehen, ob wir die<br />
Entwicklungen richtig vorhergesehen<br />
haben. In der Humanmedizin<br />
bedeutet „High Density“<br />
heute die Verarbeitung<br />
von 1 bis 1,5 millionen SNPs.<br />
Wer weiß, vielleicht bedeutet<br />
High Density Genotyping im<br />
Jahr 2030 die Genotypisierung<br />
des kompletten Genoms und<br />
Werkzeuge wie unser Porcine-<br />
SNP60 beadChip werden dann<br />
als „normal“ angesehen ...“<br />
HLO/BB<br />
Grafik 2: Anzahl der jährlich eigenleistungsgetesteten<br />
<strong>PIC</strong>-Endstufeneber<br />
Grafik 3: Anzahl jährlich verfügbarer Datensätze bzgl. Futteraufnahme<br />
weitenEndstufeneberproduktion sind mehr als 95 % PrrSnegativ,<br />
über 75 % EP-negativ,<br />
100 % rA-negativ etc.<br />
Weiter auf Seite 6
SEITE 6 <strong>PIC</strong>-ZEIT DEZEmbEr<br />
Weiter von Seite 5: Produktion von leistungsfähigen Endstufenebern unter Einsatz modernster Zuchtverfahren<br />
Grafik 4: Steigerung der Genauigkeit der Zuchtwerte durch Daten<br />
aus dem Kreuzungsprogramm der Vaterlinien (in Prozent)*<br />
*Mittelwert der erreichten Genauigkeitssteigerung in den Zuchtwerten der vier wichtigsten <strong>PIC</strong>-Eberlinien<br />
Auf der basis eines hohen Gesundheitsstatus,<br />
einer breitgefächerten<br />
Anzahl an Eberlinien<br />
sowie der konsequenten Umsetzung<br />
eines hochmodernen<br />
Zuchtprogrammes und dementsprechend<br />
notwendigen<br />
Investitionen entstehen in der<br />
<strong>PIC</strong>-Ebervermehrung wettbewerbsfähige<br />
Endstufeneber.<br />
Alle Produktionsbetriebe von<br />
<strong>PIC</strong>-Eberprodukten sind an<br />
die globale <strong>PIC</strong>-Datenbank<br />
<strong>PIC</strong>Traq angeschlossen.<br />
<strong>Die</strong>se Datenbank enthält alle<br />
Eigenleistungsdaten der getesteten<br />
Endstufeneber sowie die<br />
ihrer Voll-, Halbgeschwister<br />
und weiterer Verwandten.<br />
In den letzten zehn Jahren hat<br />
<strong>PIC</strong> die Leistungsdaten von<br />
rund 740.000 Endstufenebern<br />
erfasst - siehe Grafik 2.<br />
<strong>Die</strong>se Prüfergebnisse beinhalten<br />
unter anderem merkmale<br />
wie tägliche Zunahme,<br />
rückenspeckdicke, intramuskuläres<br />
Fett, Kotelettfläche,<br />
Fundamentbewertung, bemuskelung,<br />
Futteraufnahme etc.<br />
<strong>Die</strong> globale Steigerung der Futtermittelpreise<br />
in den letzten<br />
drei Jahren sowie ein auch in<br />
Zukunft zu erwartendes hohes<br />
Niveau der Futterkosten, lassen<br />
die Wichtigkeit der Datenerfassung<br />
von merkmalen wie<br />
Futteraufnahme in ein besonderes<br />
Licht rücken.<br />
In der <strong>PIC</strong>-Eberproduktion<br />
sind aktuell 200 automatische<br />
Futterstationen im Einsatz. An<br />
diesen Futterstationen wird die<br />
Futteraufnahme der Eber während<br />
der 12-wöchigen Testphase<br />
tierindividuell registriert.<br />
Grafik 3 stellt die erfassten<br />
Datensätze zur Futteraufnahme<br />
der eigenleistungsgetesteten<br />
Endstufeneber dar.<br />
Als “Nebenprodukt” der Futteraufnahmenerfassung<br />
fallen<br />
zusätzliche Informationen zum<br />
Fressverhalten, zur Fressdauer<br />
etc. an. <strong>Die</strong>se wertvollen Daten<br />
werden täglich in der weltweiten<br />
mastberatung der <strong>PIC</strong> genutzt.<br />
Um einen genaueren und effektiveren<br />
Zuchtfortschritt der<br />
Endstufeneber in den Kundenbetrieben<br />
zu erzielen, erfolgt<br />
eine Nachkommenprüfung der<br />
Nukleuseber in kommerziellen<br />
Produktionsbetrieben.<br />
<strong>PIC</strong> konnte mit diesem Kreuzungszuchtprogramminsbesondere<br />
in merkmalen mit<br />
niedriger Vererbung wie z. b.<br />
robustheit (Verluste), Defekte,<br />
aber auch in merkmalen mit einer<br />
mittleren/hohen Vererbung<br />
wie z. b. Fleischqualität enorme<br />
Steigerungen in der Genauigkeit<br />
der Zuchtwerte erzielen -<br />
siehe Grafik 4.<br />
Grafik 5: Anzahl genutzter Genmarker in der Selektion und Zuchtwertschätzung<br />
von <strong>PIC</strong>-Endstufenebern<br />
Ein weiterer wichtiger baustein<br />
im globalen Zuchtprogramm<br />
der Vaterlinien und somit der<br />
Produktion von Endstufenebern<br />
war und ist die frühzeitige<br />
Nutzung der markergestützten<br />
Selektion. Schon seit<br />
20 Jahren ist die Nutzung dieser<br />
Technologie in der Selektion<br />
und Zuchtwertschätzung ein<br />
integraler bestandteil des <strong>PIC</strong>-<br />
Zuchtprogramms. mit dem<br />
Voranschreiten der Computertechnologie<br />
sowie der enormen<br />
Erweiterung der Chips zur<br />
Untersuchung der sogenannten<br />
SNPs (engl. Single Nucleotid<br />
Polymorphism, Einzelnukleotid-Polymorphismus)<br />
können<br />
heute 60.000 Genorte eines<br />
Zuchttieres auf eine hohe Anzahl<br />
von markern untersucht<br />
werden. Gleichzeitig wurde die<br />
Anzahl der Genotypen um ein<br />
Vielfaches erhöht.<br />
Der Anzahl zur Selektion und<br />
Zuchtwertschätzung von Endstufenebern<br />
genutzter Genmarker<br />
hat sich in den letzten<br />
fünf Jahren fast verdreifacht -<br />
siehe Grafik 5. <strong>Die</strong>se Zahl wird<br />
sich zukünftig durch die Nutzung<br />
der SNP-Chips mit einer<br />
Kapazität von 60.000 noch bedeutend<br />
erhöhen.<br />
<strong>PIC</strong>-interne Auswertungen<br />
haben nachgewiesen, dass die<br />
genomische Selektion eine<br />
Tabelle 1: Mast und Schlachtleistungsdaten verschiedener <strong>PIC</strong>-Endstufenebern aus den Testbetrieben in Deutschland.<br />
jährliche Steigerung des Zuchtfortschritts<br />
von mindestens 20 %<br />
ermöglicht. Trotz aller verfügbaren<br />
modernen Technologien,<br />
ist ein weiterer wichtiger<br />
baustein in der Produktion der<br />
Endstufeneber der bereich der<br />
Produktvalidierung, also die<br />
kontinuierliche Produktüberprüfung.<br />
mit einem globalen<br />
Netzwerk von Testbetrieben<br />
(ca. 14 betriebe weltweit, davon<br />
fünf in Deutschland – siehe<br />
Grafik 6), werden sowohl die<br />
aktuellen Endstufeneberprodukte<br />
als auch neue Eberprodukte<br />
laufend getestet.<br />
<strong>Die</strong> Testbetriebe sind auf dem<br />
gesamten Globus verteilt, um<br />
die verschiedenen <strong>PIC</strong>-Endstufeneber<br />
unter einem breiten<br />
Spektrum von unterschiedlichen<br />
Umwelteinflüssen (Gesundheitsstatus,<br />
Aufstallung,<br />
Gruppengröße, Schlachtendgewichte,<br />
Fütterungssystem,<br />
Platzangebot/mastschwein<br />
etc.) prüfen zu können. <strong>Die</strong><br />
gesammelten Daten von mehr<br />
als 61.000 Schlachtschweinen<br />
pro Jahr aus den Testbetrieben<br />
beeinflussen den Zuchtwert des<br />
einzelnen Endstufenebers sowie<br />
all seiner Verwandten rund<br />
um den Erdball.<br />
<strong>Die</strong> in Tabelle 1 dargestellten<br />
Ergebnisse differenzierter <strong>PIC</strong>-<br />
Eberprodukte zeigen die Vor-<br />
Grafik 6: Weltweite Standorte der Testbetriebe <strong>für</strong> <strong>PIC</strong>-Endstufeneberprodukte<br />
sowie Bestandseber der Vaterlinien aus den Genetischen<br />
Nukleusbetrieben<br />
teile der einzelnen <strong>PIC</strong>-Eberprodukte<br />
deutlich. <strong>Die</strong> Vorzüge<br />
der <strong>PIC</strong>-Eberprodukte bestätigte<br />
im Frühjahr 2010 auch<br />
das Institut <strong>für</strong> Sicherheit und<br />
Qualität bei Fleisch in Kulmbach<br />
in seiner Auswertung zur<br />
neuen muskelfleisch-Schätzformel<br />
- siehe Grafik 7.<br />
<strong>Die</strong> jahrelangen Investitionen<br />
in einen hohen Gesundheitsstatus<br />
im weltweiten Ebervermehrungssystem,<br />
ein weltweit<br />
führendes Forschungs- und<br />
Entwicklungsteam mit exzellentem<br />
Zuchtprogramm - mit<br />
einer breiten Palette an Eberlinien,<br />
das zeitnah zukunfts-<br />
weisende Technologien wie die<br />
Genomische Selektion in die<br />
Endstufeneberprodukte einbinden<br />
kann, ein effizientes<br />
Ebertestsystem <strong>für</strong> ein kontinuierliches<br />
Produktmonitoring<br />
sowie starke lokale und globale<br />
Teams führen zu der Produktion<br />
von wettbewerbsfähigen<br />
Endstufeneberprodukten, die<br />
darauf ausgerichtet sind, die<br />
Gesamtwirtschaftlichkeit der<br />
Ferkelerzeuger, mastbetriebe,<br />
Schlachtunternehmen und der<br />
nachgelagerten Verarbeitungsstufe<br />
nachhaltig zu verbessern.<br />
Grafik 7: Aktuelle Schätzung des Muskelfleischanteils anhand einer<br />
<strong>für</strong> den deutschen Markt phänotypisch repräsentativen Stichprobe<br />
von Schlachtschweinen 1<br />
1 Pi * Nord = <strong>PIC</strong>-Genetik<br />
<strong>PIC</strong> L359 <strong>PIC</strong> L380 <strong>PIC</strong> L410 <strong>PIC</strong> L408 <strong>PIC</strong> L426<br />
Hampshire<br />
x<br />
synthetische<br />
weiße Linie<br />
roter Duroc<br />
x<br />
synthetische<br />
weiße Linie<br />
<strong>PIC</strong>-Piétrain<br />
x<br />
synthetische<br />
weiße Linie<br />
<strong>PIC</strong>-Piétrain<br />
NN<br />
<strong>PIC</strong>-Piétrain<br />
NP/PP<br />
Anzahl Schlachtschweine, n 250 565 263 1230 1231<br />
Tägl. Zunahme (28 - 118 kg), g 974 942 923 927 926<br />
Nettotageszunahmen, g 561 551 545 545 545<br />
Alter bei Schlachtung, Tage 165 168 170 170 170<br />
mFA, % AutoFOm 56,50 55,95 57,80 57,36 57,75<br />
Speckmaß AutoFOm, mm 16,78 17,20 16,13 16,80 16,61<br />
Fleischmaß AutoFOm, mm 60,28 59,73 63,13 63,81 64,50<br />
bauch-mFA, % 50,01 49,25 51,72 51,17 51,49<br />
Schinken schier, kg 16,90 16,80 17,36 17,34 17,44<br />
Lachs, kg 6,62 6,56 6,86 6,84 6,92<br />
Schulter, kg 7,95 7,93 7,99 7,93 7,94<br />
bauch, kg<br />
Schlachtgewicht: 92,5 kg<br />
14,77 14,74 14,58 14,66 14,63<br />
Der Autor<br />
Jürgen E. Kramer<br />
Genus Global Porcine | Production manager | 100 bluegrass Commons blvd. - Suite 2200 | Hendersonville, TN, USA<br />
E-mail: Jurgen.kramer@pic.com<br />
Jürgen Kramer begann seine <strong>PIC</strong>-Karriere vor über 23 Jahren bei der <strong>PIC</strong> in Deutschland auf dem damaligen Nukleusbetrieb Ortberg als Verantwortlicher <strong>für</strong> die Ebereigenleistungsprüfung<br />
sowie die interne besamungsstation.<br />
In vergangenen 23 Jahren arbeitete er zudem <strong>für</strong> <strong>PIC</strong> unter anderem in den USA, mexiko und Großbritannien, verlor dabei aber nie den Kontakt nach Deutschland.<br />
Seit vier Jahren ist Jürgen Kramer ‚Global Porcine Production manager‘ <strong>für</strong> <strong>PIC</strong>‘s mutterkonzern Genus plc. Damit ist er weltweit u. a. verantwortlich <strong>für</strong> die Produktion<br />
in den <strong>PIC</strong>-eigenen und Vertrags-betrieben, die Umsetzung des Zuchtprogramms, den Zuchttierexport sowie die fortlaufende Überwachung und Anpassung der <strong>PIC</strong>-<br />
Produktionsstrukturen an aktuelle markterfordernisse.<br />
Seit über elf Jahren lebt er mit seiner Familie in den USA.<br />
JEK
DEZEmbEr <strong>PIC</strong>-ZEIT SEITE 7<br />
Ferkelverluste reduzieren, nicht produzieren:<br />
Nicht allein der Mäster profitiert von der Wahl<br />
des richtigen Endstufenebers<br />
Nach landläufiger meinung ist die Sau <strong>für</strong> den Erfolg in der Ferkelerzeugung<br />
und der Endstufeneber <strong>für</strong> die Ergebnisse in der<br />
mast verantwortlich. mitnichten! <strong>Die</strong> von ihrem Vater ererbten<br />
Eigenschaften entwickeln mastschweine nicht erst mit beginn<br />
bzw. im Verlauf der mast, sondern sie machen sich von Geburt an<br />
bemerkbar.<br />
Auch in den Endstufenebern<br />
der <strong>PIC</strong><br />
spiegelt sich die <strong>PIC</strong>-<br />
Zuchtphilosphie deutlich wieder.<br />
Oberstes Ziel war und ist<br />
die Gesamtwirtschaftlichkeit<br />
- von der Ferkelerzeugung über<br />
die mast bis zum Schlachthof,<br />
also die komplette Kette<br />
der Schweineproduktion. Das<br />
heißt, dass auch bei der Weiterentwicklung<br />
der <strong>PIC</strong>-Eberlinien<br />
nicht allein Wert auf die<br />
masteigenschaften wie Tageszunahmen<br />
und Futteraufnahme<br />
und -verwertung und die<br />
Qualität der Schlachtkörper -<br />
insbesondere mager-<br />
fleischanteil und Ausprägung<br />
der wertvollen Teilstücke - gelegt<br />
wird, sondern auch merkmale<br />
wie robustheit, Vitalität,<br />
Ausgeglichenheit/Uniformität<br />
oder auch Anomalien eine<br />
wichtige rolle spielen.<br />
Der Eber hat einen deutlichen<br />
Einfluss auf die<br />
Ferkelvitalität.<br />
Der mäster verlangt gleichmäßige,<br />
fleischreiche, wüchsige<br />
und robuste Ferkel <strong>für</strong><br />
eine unkomplizierte mast und<br />
optimale resultate am<br />
Schlachthaken.<br />
Der Sauenhalter will<br />
möglichst<br />
viele dieser Qualitätsferkel mit<br />
möglichst geringem Arbeitsaufwand<br />
produzieren.<br />
Ein „sicheres“ - sprich fleischreiches<br />
- mastschwein kann<br />
mit den seit langen Jahren bewährten<br />
Piétrain-Ebern erfolgreich<br />
produziert werden. Aber<br />
warum soll der Ferkelerzeuger<br />
bei der Wahl des Endstufenebers<br />
nur ein Auge auf die mast-<br />
und Schlachteigenschaften haben,<br />
wenn er gleichzeitig auch<br />
direkt den Erfolg in seinem betrieb<br />
beeinflussen kann? In der<br />
Praxis beweisen <strong>PIC</strong>-Piétrain-<br />
Eber, dass mit ihnen die Ferkelerzeugung<br />
UND die mast<br />
<strong>erfolgreiche</strong>r wird.<br />
In Vergleichen erzielten <strong>PIC</strong>-<br />
Kunden deutlich geringere Ferkelverluste<br />
durch den Einsatz<br />
von <strong>PIC</strong>-Piétrain 408/426 als im<br />
parallelen Vergleich zu anderen<br />
Piétrain.<br />
Tabelle 1 zeigt einige beispiele<br />
aus ostdeutschen betrieben.<br />
Im Schnitt verringerten sich die<br />
Ferkelverluste um mehr als 5%-<br />
Punkte. bares Geld <strong>für</strong> jeden<br />
Ferkelerzeuger, denn 5 % Fer-<br />
kelverluste entsprechen ca. 50 €<br />
Grenznutzen je Sau und Jahr.<br />
Oder anders ausgedrückt: Jede<br />
Portion <strong>PIC</strong>-Piétrain-Sperma<br />
bedeutet einen wirtschaftlichen<br />
mehrwert von über 8 €, bei<br />
Einsatz von sechs Portionen<br />
Sperma je Sau und Jahr.<br />
Alle betriebe haben die Art der<br />
Ferkelverluste detailliert analysiert<br />
und sind zu dem Schluss<br />
gekommen, dass bei Ferkeln<br />
mit <strong>PIC</strong>-Piétrain-Vater im<br />
Vergleich zu den Nachkommen<br />
von anderen Piétrain-Ebern<br />
weniger Erdrückungsverluste,<br />
weniger Verluste durch lebensschwache<br />
Ferkel und weniger<br />
Verluste durch Spreizer auftreten.<br />
mit ihrem Vitalitätsvorsprung<br />
punkten Ferkel aus<br />
Anpaarungen mit <strong>PIC</strong>-Piétrain<br />
gerade in den wichtigen ersten<br />
Lebenstagen. Zahlreiche Untersuchungen<br />
haben nachgewiesen,<br />
dass mindestens 85 %<br />
der Gesamtferkelverluste in<br />
den ersten drei Tagen nach der<br />
Geburt auftreten. Vitalere und<br />
damit agilere Ferkel können<br />
sich die Kolostrumaufnahme<br />
zügiger sichern und haben auch<br />
bei der Festlegung der rangordnung<br />
am Gesäuge ein entsprechendesDurchsetzungsvermögen.<br />
Ein optimaler Start<br />
ist dadurch gegeben. Und die<br />
Vorteile eines guten Starts machen<br />
sich bekanntlich bis in die<br />
mast hin bemerkbar. So profitiert<br />
der mäster als Kunde des<br />
Ferkelerzeugers zusätzlich.<br />
Wichtig ist, das Gesamtergebnis<br />
nicht aus den Augen zu<br />
verlieren und sich als Ferkelerzeuger<br />
nicht durch pauschale<br />
Forderungen nach einem<br />
Wechsel des Endstufenebers<br />
seitens der Abnehmer verunsichern<br />
zu lassen. Praktische<br />
beispiele belegen nämlich auch<br />
den misserfolg solcher maßnahmen.<br />
So stiegen z. b. in<br />
einem betrieb mit 1.300 Sauen<br />
nach Umstellung von <strong>PIC</strong>-Piétrain<br />
auf andere Piétrain-Eber<br />
die Ferkelverluste um 5,5 %. In<br />
einem anderen betrieb sank die<br />
Zahl der abgesetzten Ferkel je<br />
Wurf um 0,5 Ferkel bei gleich<br />
gebliebener Anzahl der lebend<br />
geborenen Ferkel. Als Konsequenz<br />
stellte dieser betrieb die<br />
Anpaarungen nach sechs Abferkelgruppen<br />
wieder auf <strong>PIC</strong>-<br />
Piétrain um.<br />
Unterm Strich ist der <strong>PIC</strong>-Piétrain-Eber<br />
ein praktisches beispiel<br />
<strong>für</strong> erlebbare Umsetzung<br />
der <strong>PIC</strong>-Zuchtphilosophie auf<br />
Gesamtwirtschaftlichkeit, sowohl<br />
<strong>für</strong> den Ferkelerzeuger als<br />
auch <strong>für</strong> den mäster aber auch<br />
geschlossene Systeme. So ist<br />
der <strong>PIC</strong>-Piétrain in vielen ostdeutschen<br />
Großbetrieben seit<br />
Jahren präsent und nicht mehr<br />
wegzudenken.<br />
VN/BB<br />
Betrieb A B C D E<br />
bestandsgröße 1600 700 630 400 1900<br />
Ferkelverluste bei Anpaarung<br />
mit Piétrain-Ebern<br />
18,1 % 17,4 % 12,5 % 11,7 % 18,4 %<br />
Ferkelverluste bei Anpaarung<br />
mit <strong>PIC</strong>-Piétrain 408/426 11,3% 12,2 % 7,4 % 8,7 % 13,2 %<br />
Differenz - 6,8 % - 5,2 % - 5,1 % - 3,0 % - 5,2 %<br />
<strong>PIC</strong>-Schlachtschweine - Fit <strong>für</strong> neue Herausforderungen!<br />
Jüngste maskenänderungen und eng damit verbundene neu gelebte<br />
AutoFOm-Dominanz in der Schlachtbranche, in 2011 auf<br />
uns zukommende neue Klassifizierungsformeln und zu guter Letzt<br />
vehement binnen kurzer Frist geforderter Kastrationsverzicht –<br />
<strong>Die</strong> Schweinehalter kommen in den letzten monaten kaum noch<br />
zur ruhe und die Umstellungszeiten sind nicht immer angemessen.<br />
Auch ein Zuchtunternehmen muß sich der Frage stellen, ob<br />
seine mastschweine in diesem markt <strong>für</strong> die kommenden Herausforderungen<br />
gerüstet sind oder ob es Handlungsbedarf gibt.<br />
Prof. branscheid vom<br />
max-rubner-Institut<br />
in Kulmbach hat die<br />
Schätzformeln <strong>für</strong> die Klassifizierung<br />
von Schweineschlachtkörpern<br />
angepasst und bereits<br />
Anfang mai anläßlich der<br />
Kulmbacher Woche 2010 die<br />
Katze aus dem Sack gelassen.<br />
Ziel seines Zerlegeversuches<br />
war es, möglichst repräsentativ<br />
die wesentlichen am deutschen<br />
Schlachtschweinemarkt vertretenen<br />
Genotypen abzubilden.<br />
<strong>Die</strong> im Versuch vertretenen<br />
<strong>PIC</strong>-Schlachtschweine erreichten<br />
dabei mit 60,6 % mFA<br />
mit Abstand den höchsten<br />
wahren mFA-Anteil: „Dass<br />
die norddeutsche Herkunft (=<br />
<strong>PIC</strong>) Spitzenreiter beim muskelfleischanteil<br />
würde, welche<br />
die süddeutschen ‚Schinkenbomber‘<br />
um 0,8 Prozentpunkte<br />
überflügelte, überraschte alle<br />
marktkenner.“ (Zitat Landwirtschaftliches<br />
Wochenblatt<br />
Westfalen-Lippe, mai 2010).<br />
Als Ergebnis kam heraus, dass<br />
die derzeitigen Formeln <strong>für</strong> den<br />
mFA generell nicht mehr zeitgemäß<br />
sind. bei fetten Tieren<br />
wird der mFA deutlich überschätzt,<br />
bei mageren Tieren<br />
stark unterschätzt.<br />
<strong>Die</strong> jüngste maskenänderung<br />
im Herbst 2010 in richtung<br />
Fleisch gepaart mit einem verstärkten<br />
AutoFOm-boom ist<br />
nicht zuletzt eine reaktion auf<br />
die zu Tage getretene eklatante<br />
Überschätzung fleischärmerer<br />
Herkünfte. <strong>Die</strong> neue Formel<br />
kommt dem <strong>PIC</strong>-Schlachtschwein<br />
entgegen.<br />
Auch die bislang unterschätzen<br />
Teilstückgewichte werden<br />
zukünftig gerechter bewertet.<br />
Insgesamt wird der Fleischanteil<br />
nach ersten berechnungen<br />
aufgrund der neuen Formel um<br />
ca. 0,5 bis 0,6 % steigen. Unter-<br />
und Überschätzungen lassen<br />
sich auch in Zukunft offensichtlich<br />
nicht vermeiden, aber<br />
mit der höchstwahrscheinlich<br />
ab Sommer 2011 gültigen und<br />
verbindlich einzusetzenden<br />
Formel wird die mFA-Ermitt-<br />
Tabelle 1: Verringerung der Ferkelverluste mit <strong>PIC</strong>-Piétrain<br />
lung genauer. Gespannt darf<br />
man nun auf die Aktivitäten<br />
der Schlachtunternehmen sein,<br />
die sich voraussichtlich bereits<br />
ab märz 2011 im Hinblick auf<br />
die neue Formel positionieren<br />
werden.<br />
Parallel dazu rückt ein Verzicht<br />
auf Ferkelkastration zügig näher,<br />
der hauptsächlich durch<br />
Forderungen des Tierschutzbundes<br />
und marketingversprechen<br />
der Systemgastronomie<br />
und des Lebensmitteleinzelhandels<br />
forciert wird. Innerhalb<br />
der letzten beiden Jahre<br />
hat es in zahlreichen Projekten<br />
zu diesem Thema konkrete<br />
Fortschritte gegeben. Auf dem<br />
Expertenworkshop „Verzicht<br />
auf Ferkelkastration - Stand<br />
und Perspektiven“ im November<br />
2010 in berlin wurde von<br />
Experten dabei die Jungebermast,<br />
auch wenn sie noch viele<br />
Fragen aufwirft, als generelle<br />
und nachhaltige Lösung favorisiert.<br />
Nur übergangsweise<br />
wird die betäubung zur Kastration<br />
über Inhalationsverfahren<br />
mit Isofluran akzeptiert.<br />
Gleichermaßen akzeptiert wie<br />
die Ebermast, ist die Immuno-<br />
kastration, zumindest von Seiten<br />
des Tierschutzes. <strong>Die</strong>se<br />
Impfung steht und fällt aber<br />
mit der Akzeptanz beim Verbraucher,<br />
da sich die Gefahr<br />
einer Assoziation mit Hormonen<br />
nicht ohne weiteres von<br />
der Hand weisen lässt. <strong>Die</strong> Genetik<br />
kann mittel- bzw. langfristig<br />
Unterstützung bei der<br />
Vermeidung von Geruchsabweichungen<br />
leisten. bereits aus<br />
<strong>PIC</strong>-eigenen Untersuchungen<br />
im Jahre 2006 zu <strong>PIC</strong>-reinzuchtlinien<br />
- eine in Expertenkreisen<br />
immer wieder gern<br />
verwandte Studie - geht hervor,<br />
dass es deutliche rasse- bzw.<br />
linienbedingte Unterschiede<br />
im Androstenon- und Skatol-<br />
Gehalt gibt. <strong>Die</strong>se könnten<br />
entweder über entsprechende<br />
Linienkombinationen oder als<br />
vielversprechende Ausgangsbasis<br />
<strong>für</strong> Zuchtprogramme zur<br />
reduktion von Ebergeruch u.a.<br />
auch mit Hilfe von markertechnologie<br />
genutzt werden.<br />
<strong>Die</strong> <strong>PIC</strong> ist im Produktentwicklungsbereich<br />
aktuell mit<br />
derartigen Linienkombinationen<br />
in einige Ebermast-Projekte<br />
in Deutschland involviert.<br />
Nicht vergessen werden darf in<br />
diesem Zusammenhang, dass<br />
ein Schlachtschwein die Hälfte<br />
seiner Gene von seiner mutter<br />
bekommt. Im <strong>PIC</strong>-Zuchtprogramm<br />
wird auch bei den<br />
mutterlinien seit Jahrzehnten<br />
großer Wert auf mast- und<br />
Schlachtkörpereigenschaften<br />
gelegt. Es wäre sicher fatal,<br />
bei unzureichendem Potential<br />
der Hybridsau allein über den<br />
Endstufeneber notwendige<br />
Korrekturen in der Ausrichtung<br />
der mast- und Schlachtleistungseignung<br />
zu steuern.<br />
Nicht selten ist dies mit negativen<br />
Ausschlägen in anderen<br />
merkmalen wie z.b. Verluste,<br />
Futterverwertung, Zunahme<br />
etc. verbunden. Eine weitere<br />
Erhöhung der Schlachtgewichte,<br />
um bei unzureichendem<br />
mFA dennoch die notwendigen<br />
Teilstückgewichte zu erreichen,<br />
geht aufgrund erhöhter<br />
Produktionskosten in den seltensten<br />
Fällen positiv aus. Also<br />
gilt es, neben dem Eber auch<br />
die Sau im Auge zu behalten.<br />
Flexibilität ist Trumpf: Aus<br />
<strong>PIC</strong>-Sicht lässt sich derzeit<br />
entspannt und relativ gelassen<br />
nach vorn schauen. <strong>PIC</strong>-Genetik<br />
ist gut gerüstet <strong>für</strong> die Zukunft.<br />
<strong>Die</strong> aktuellen Schlachtschweine<br />
entsprechen den<br />
Anforderungen des marktes.<br />
Der sich abzeichnenden Ebermast<br />
kann bei bedarf nach weiter<br />
reduziertem Ebergeruch mit<br />
entsprechenden Linienkombinationen<br />
begegnet werden. In<br />
den mutterlinien spielt neben<br />
der Fruchtbarkeit seit jeher die<br />
mast- und Schlachtleistung<br />
eine zentrale rolle.<br />
Neben dem aktuellen Haupt-<br />
Endstufeneberprodukt, dem<br />
<strong>PIC</strong>-Pietrain 408/426 , stehen zudem<br />
mehrere alternative <strong>PIC</strong>-<br />
Endstufeneber aus dem globalen<br />
Zuchtprogramm bereit, die<br />
alle in den vergangenen drei<br />
Jahren unter deutschen bedingungen<br />
auf Herz und Nieren<br />
getestet wurden und die z. b.<br />
in einem gar nicht so weit entferntem<br />
Szenario mit hohen<br />
Futterpreisen schnell an bedeutung<br />
gewinnen könnten.<br />
HLO
SEITE 8 <strong>PIC</strong>-ZEIT DEZEmbEr<br />
<strong>PIC</strong> auf der EUrOTIEr 2010<br />
Zahlreiche Besucher aus Nah und Fern, aus der Region, aus Deutschland, aus Europa und von Übersee informierten sich über<br />
die <strong>PIC</strong>, diskutierten, fachsimpelten und tauschten sich aus - viele positive Eindrücke und Erlebnisse <strong>für</strong> alle Seiten. Und auf der<br />
erstmals veranstalteten <strong>PIC</strong>-Standparty am Donnerstagabend hatten rund 250 Gäste viel Spaß!
DEZEmbEr <strong>PIC</strong>-ZEIT SEITE 9<br />
Nebenher – aber voll dabei!<br />
Landwirtschaft im Nebenerwerb – wie stellt man sich das vor?<br />
Kommen einem da sechzig Kopf rindvieh, davon 20 milchkühe,<br />
die im Sommer auf der Weide gemolken werden, 53 ha Acker-<br />
bzw. Grünland und 120 Sauen zur mastferkelproduktion in den<br />
Sinn?<br />
Unterhält man sich mit Hans-Wilhelm Klindworth in Kalbe bei<br />
Sittensen, stellt er einem seinen landwirtschaftlichen betrieb so als<br />
Nebenerwerbsbetrieb vor. Denn er arbeitet „eigentlich“ fünf Tage<br />
in der Woche <strong>für</strong> ca. vier bis fünf Stunden bei einer räucherei im<br />
Lager und Versand. „Ja klar,“ gibt er lachend zu, „ohne ‚die rentner‘,<br />
wie Vater Wilhelm und mutter Ursula gleichzeitig respekt- und<br />
liebevoll genannt werden, ginge das sicherlich nicht ganz so gut.“<br />
120 Sauen, damit beschäftigen sich andere den ganzen Tag, fragen<br />
wir erstaunt bei unserem besuch. Das müssen wir uns anschauen!<br />
Von den 60er Jahren bis<br />
mitte der 90er Jahre<br />
waren es immer rund<br />
35 Sauen, ehe dann ein großer<br />
Schritt gewagt wurde und der<br />
bestand mehr als verdoppelt<br />
wurde auf 80 Sauen. Ob dies<br />
ursächlich damit zusammenhing,<br />
dass seit 1995 <strong>PIC</strong>-Sauen<br />
im Klindworth‘schen Stall stehen,<br />
sei mal außer Acht gelassen.<br />
Aber es lassen sich schon<br />
abstrusere Zusammenhänge<br />
konstruieren, entwickelte sich<br />
doch die Leistung der Sauenherde<br />
seitdem deutlich und<br />
kontinuierlich nach oben. mit<br />
der letzten baumaßnahme<br />
2004 wurde Platz <strong>für</strong> weitere<br />
40 Sauen geschaffen und so die<br />
heutige bestandsgröße von 120<br />
Sauen erreicht. Das soll auch<br />
erstmal so bleiben, mehr Erweiterung<br />
ist in der dörflichen<br />
Lage schlecht möglich. Der<br />
letzte bauabschnitt umfasste<br />
deshalb auch schon einen biofilter.<br />
100 % Natursprung ...<br />
Wir wandern langsam durch<br />
den Stall: Gestartet sind wir<br />
bei den tragenden Sauen. <strong>Die</strong>se<br />
laufen in der Gruppe an einer<br />
Abruffütterung mit 50 Plätzen<br />
<strong>für</strong> die Sauen ab dem zweiten<br />
Wurf. <strong>Die</strong> Jungsauen bilden<br />
eine Extragruppe. Wir sehen<br />
also, auch in zwei Jahren mit<br />
endgültigem Inkrafttreten der<br />
Schweinehaltungsverordnung<br />
in Sachen Gruppenhaltung<br />
wird es bei Klindworths keine<br />
Probleme geben.<br />
Nebenan finden wir das Deck-<br />
Im Deckzentrum…<br />
…versehen zwei <strong>PIC</strong>-Piétrain-Eber<br />
ihren <strong>Die</strong>nst.<br />
1. bis 5. Lebenstag<br />
ab 8. Lebenstag<br />
zentrum <strong>für</strong> 16 Sauen. besamungsutensilien<br />
suchen wir<br />
vergeblich, denn hier läuft noch<br />
alles auf „ganz natürlichem<br />
Wege“.<br />
Zwei <strong>PIC</strong>-Piétrain 408 (NN) verrichten<br />
hier ihren <strong>Die</strong>nst, ein<br />
Dritter steht derzeit noch in der<br />
Quarantäne. Auch wenn Herr<br />
Klindworth senior den besamungsschein<br />
hat, so ist diese<br />
Lösung die praktikabelste <strong>für</strong><br />
alle beteiligten. Sicherlich bedeutet<br />
dieses kontinuierliche<br />
System auch, dass hin und wieder<br />
mal belegte Sauen etwas<br />
später an die Abruffütterung<br />
umgestallt werden, oder dass<br />
die Ferkel etwas länger säugen<br />
dürfen. Es muss halt der Platz<br />
im jeweils nächsten Produktionsabschnitt<br />
frei sein. Aber<br />
bislang nimmt der Viehhändler<br />
die Ferkel auch in den bisweilen<br />
unterschiedlichen Partiegrößen<br />
gerne ab. <strong>Die</strong> Trächtigkeitskontrolle<br />
übernimmt der betreuende<br />
Tierarzt, der alle zwei Wochen<br />
den betrieb besucht.<br />
Viele Ferkel an jeder Sau!<br />
Nun zu den säugenden Sauen.<br />
Vier Abteile mit insgesamt 28<br />
Abferkelplätzen reihen sich aneinander.<br />
Natürlich zählen auch<br />
wir und kommen jeweils auf elf<br />
bis dreizehn Ferkel an der Sau.<br />
bei etwas über dreizehn lebend<br />
geborenen Ferkeln ein schönes<br />
Indiz <strong>für</strong> die sehr gute Aufzuchtleistung<br />
der Sauen durch<br />
eine hohe milchleistung. Insbesondere<br />
die Jungsauen zeigen<br />
mit 12,4 abgesetzten Ferkeln<br />
hervorragende Aufzuchtleistungen,<br />
was sicherlich auch daran<br />
liegt, dass sie konsequent 13<br />
Ferkel ans Gesäuge bekommen.<br />
Gefüttert wird zweimal täglich<br />
von Hand mit einem Laktationsschrot<br />
mit 13 mJ mE. Das<br />
macht Herr Klindworth jeden<br />
morgen und Abend selber. So<br />
Fütterung der Ferkel<br />
hat er stets einen guten Überblick<br />
über den Konditionszustand<br />
seiner Sauen. Gefüttert<br />
wird im Abferkelstall eine Eigenmischung<br />
aus 70 % eigener<br />
Gerste plus 30 % zugekauftes<br />
Ergänzungsfutter.<br />
<strong>Die</strong> <strong>für</strong> die gute milchproduktion<br />
unerlässliche ausreichende<br />
Wasserversorgung stellt der<br />
Aqua-Level in jedem Sauentrog<br />
sicher. <strong>Die</strong> Ferkelnester haben<br />
alle eine Fußbodenheizung.<br />
Während ‚rentner‘ Wilhelm<br />
sich um die Sauen kümmert,<br />
übernimmt Ursula Klindworth<br />
die Ferkelversorgung.<br />
In sechs Wochen Flatdeck<br />
auf 31 Kilo<br />
Nach – in der regel – vier<br />
Wochen Säugezeit ziehen die<br />
Absetzferkel um in ein Abteil<br />
mit vier buchten, Längstrog<br />
und Putentränken. Putentränken?<br />
„Über die Putentränken<br />
nehmen die frisch abgesetzten<br />
Ferkel viel besser und mehr<br />
Wasser auf, auch wenn wir in<br />
jeder bucht zwei Nippeltränken<br />
in unterschiedlicher Höhe<br />
haben. Das macht die Umstellung<br />
leichter und seitdem haben<br />
wir keine Probleme mehr<br />
mit Ödemen,“ erklärt uns Herr<br />
Klindworth.<br />
Von hier werden die Ferkel<br />
dann nach zwei Wochen<br />
weiter aufgeteilt auf die eigentliche<br />
Ferkelaufzucht. <strong>Die</strong><br />
Ferkelaufzucht umfasst 400<br />
Plätze in fünf Abteilen. <strong>Die</strong><br />
genaue buchführung von H.-<br />
W. Klindworth belegt: Im<br />
vergangenen Wirtschaftsjahr<br />
wird eine Schale mit Wasser zusätzlich zur Tränke in die<br />
bucht gestellt<br />
erhalten die Ferkel eine Handvoll Prestarter (14,6 mJ mE)<br />
ins Ferkelnest<br />
ab 15. Lebenstag wird der Prestarter in einer Futterschale angeboten<br />
bis 3 Tage nach dem Absetzen wird der Prestarter weiter gefüttert<br />
ab dem 4. Tag nach dem Absetzen<br />
2. und 3. Absetzwoche Ferkelstarter (13,8 mJ mE)<br />
ab der 4. Absetzwoche<br />
Alle 14 Tage kommt der Tierarzt zur<br />
Trächtigkeitskontrolle.<br />
<strong>Die</strong> letzten beiden Bauabschnitte lassen<br />
sich auf diesem Bild erkennen.<br />
wird über 3 Tage Verschneiden auf einen Ferkelstarter mit<br />
13,8 mJ mE umgestellt<br />
wird über 3 Tage Verschneiden auf einen Starter mit 13,4<br />
mJ mE umgestellt<br />
holte der Viehhändler die Ferkel<br />
nach durchschnittlich sechs<br />
Wochen Aufzucht mit rund 31<br />
kg ab. Was bei Absetzgewichten<br />
von 8,5 bis 9 kg Tageszunahmen<br />
im Flatdeck von über<br />
500 g bedeutet. Auch wenn<br />
die Vermarktung über einen<br />
Viehhändler erfolgt, so sind<br />
es doch immer dieselben zwei<br />
mäster, die Klindworths Ferkel<br />
einstallen. Für beide sind die<br />
unterschiedlichen Partiegrößen<br />
nahezu ideal, da sie jeweils<br />
mehrere mastställe mit unterschiedlichen<br />
Abteilgrößen<br />
betreiben, die gut zu den Lieferungen<br />
aus Kalbe passen.<br />
Dokumentation – über ein<br />
Vierteljahrhundert zurück<br />
Apropos buchhaltung, auch<br />
der Sauenplaner funktioniert<br />
nach dem Prinzip „Einfach und<br />
zweckmäßig“. Im Gang zu den<br />
einzelnen Abferkelabteilen finden<br />
wir die aktuelle Dokumentation<br />
an der Wand. Aber nicht<br />
als Stallbüro mit einem PC,<br />
sondern akkurat geführte Listen<br />
geben die erforderlichen Informationen.<br />
Eine etwas andere<br />
Form von „Windows Vista“,<br />
bei dem man mehrere „Fenster“<br />
auf einmal im blick hat. Ein an<br />
Scharnieren aufgehängtes brett<br />
dient als „Tastatur“. Später im<br />
Haus bekommen wir sogar das<br />
backup präsentiert. <strong>Die</strong> Aufzeichnungen<br />
reichen zurück<br />
bis ins Jahr 1982! Damals waren<br />
es insgesamt 78 Würfe mit<br />
10,36 gesamt geborenen Ferkel<br />
und 8,27 abgesetzten Ferkel<br />
pro Wurf. Über die Jahre sind<br />
noch einige weitere Parameter<br />
in der regelmäßigen Erfassung<br />
Absetzen bis ca.<br />
15. Tag nach dem belegen<br />
ca. 15. bis ca. 35. TT<br />
35. bis 50. TT<br />
50. bis 80. TT<br />
80. bis 95. TT<br />
hinzugekommen, so dass z. b.<br />
seit 1998 Erst- und Nachbelegungen<br />
getrennt erfasst werden<br />
und auch der durchschnittliche<br />
Sauenbestand pro monat zu<br />
Papier gebracht ist. Und mit<br />
den historischen Daten lässt<br />
sich auch eine rekordsau in<br />
Sachen Lebensleistung dokumentieren.<br />
<strong>Die</strong> Sau 2140<br />
wurde am 25.10.1996 geboren,<br />
am 08.04.1997 am Ende der<br />
Aufzucht im <strong>PIC</strong>-Aufzuchtbetrieb<br />
müller mit 90 kg, 165<br />
Lebenstagen und 12 Strichen<br />
<strong>für</strong> zuchttauglich befunden<br />
und am 28.04.1997 nach Kalbe<br />
ausgeliefert. Ihren ersten Wurf<br />
brachte sie am 1. Dezember<br />
1997 zur Welt. Im Laufe von 24<br />
Würfen hat Sau 2140 306 Ferkel<br />
(20 davon tot) zur Welt gebracht,<br />
wovon sie 219 absetzte.<br />
Im stolzen Alter von fast 11<br />
Jahren schied sie im September<br />
2007 aus der Produktion aus.<br />
<strong>Die</strong> 27 Ferkel sind fix<br />
Der rundgang und unser Gespräch<br />
mit Herrn Klindworth<br />
haben uns überzeugt. Auch<br />
mit 120 Sauen - und einigen<br />
milchkühen und einigen<br />
Hektar Acker- und Grünland<br />
- lässt sich erfolgreich im Nebenerwerb<br />
wirtschaften. Vorraussetzung<br />
ist natürlich, dass<br />
sich die guten Leistungen ohne<br />
immensen Arbeitsaufwand<br />
erzielen lassen. Ausgeklügelte<br />
Ammensysteme finden wir<br />
im Stall Klindworth nicht.<br />
Von nächtlicher Ferkelwache<br />
ist keine rede. <strong>Die</strong> remontierung<br />
ist mit rund 35 % nicht<br />
hoch, vielleicht wäre hier sogar<br />
noch die eine oder andere reserve<br />
aufzudecken. Es lässt sich<br />
zwar nicht auf die letzte minute<br />
bestimmen, aber über den<br />
Daumen kalkuliert, beschäftigt<br />
die Sauenherde eine halbe bis<br />
eine dreiviertel Arbeitskraft.<br />
Dass darunter die Leistung<br />
überhaupt nicht leiden muss,<br />
zeigt die beeindruckende Entwicklung<br />
bei Klindworths. In<br />
den letzten fünf Jahren ist die<br />
Leistung ohne mehraufwand<br />
um 4,5 abgesetzte Ferkel je Sau<br />
und Jahr gestiegen. Nach einem<br />
kleinen „Durchhänger“ im Jahr<br />
2009 sind jetzt die 27 abgesetzten<br />
Ferkel die richtschnur.<br />
BB<br />
Fütterung der Sauen kg Futter/Tier u. Tag MJ ME/Tier u. Tag<br />
95. TT bis Umstallen i. d. Abferkelung<br />
(ca. 110. bis 112. TT)<br />
ab Einstallen in Abferkelung<br />
bis 114. TT<br />
115. TT<br />
116. TT<br />
1. Säugetag<br />
2. u. 3. Säugetag<br />
ab 4. bis 7. Säugetag<br />
ab 2. Säugewoche<br />
TT = Trächtigkeitstag<br />
Sau 2140 hatte eine beachtliche Lebensleistung: Geboren 1996 brachte sie über<br />
300 Ferkel in 24 Würfen zur Welt.<br />
LAK-Futter<br />
(13 mJ mE)<br />
NT-Futter<br />
(12,2 mJ mE)<br />
NT-Futter<br />
(12,2 mJ mE)<br />
NT-Futter<br />
(12,2 mJ mE)<br />
NT-Futter<br />
(12,2 mJ mE)<br />
NT-Futter<br />
(12,2 mJ mE)<br />
LAK-Futter<br />
(13 mJ mE)<br />
LAK-Futter<br />
(13 mJ mE)<br />
LAK-Futter<br />
(13 mJ mE)<br />
LAK-Futter<br />
(13 mJ mE)<br />
LAK-Futter<br />
(13 mJ mE)<br />
LAK-Futter<br />
(13 mJ mE)<br />
LAK-Futter<br />
(13 mJ mE)<br />
ca. 3 39<br />
3 36,6<br />
3 → 2,6 36 → 32<br />
2,6 32<br />
2,6 → 3,2 32 → 39<br />
3,2 39<br />
3 39<br />
2 26<br />
1,5 19,5<br />
1,5 19,5<br />
2 26<br />
2 → 5 26 → 65<br />
5,5<br />
individuell<br />
bis max. 6,5 kg/Tag<br />
71,5<br />
individuell bis<br />
max. 84,5 mJ mE/Tag
SEITE 10 <strong>PIC</strong>-ZEIT DEZEmbEr<br />
Internationale Gäste<br />
bei <strong>PIC</strong> in Deutschland<br />
Den internationalen Charakter der Fachmesse Eurotier in Hannover<br />
bekommt auch die <strong>PIC</strong> in Deutschland alle zwei Jahre verstärkt<br />
zu spüren, denn viele internationale Gäste nutzen die Gelegenheit<br />
der reise nach Deutschland, um sich vor Ort über die praktische<br />
Schweineproduktion zu informieren. <strong>Die</strong> <strong>PIC</strong> Deutschland als Teil<br />
eines Weltkonzerns bekam so im Vorfeld verschiedene Anfragen<br />
von diversen Kontinenten. So begleiteten mitarbeiter u. a. Gruppen<br />
aus Neuseeland, Irland und russland. Eine reisegruppe aus<br />
Japan führte es in diesem Jahr nach brandenburg.<br />
Asien zu Gast in Brandenburg<br />
こんにちわ。- konnichiwa -<br />
Good morning – Hallo und<br />
Guten Tag – hieß es am 22.<br />
November in Altlüdersdorf und<br />
Wulkow als eine besuchergruppe<br />
der Iwatani Camborough Co.<br />
Ltd. (ICC) mit insgesamt 14<br />
Personen dort Station machte.<br />
ICC ist der exklusive Franchise-<br />
Nehmer von <strong>PIC</strong> in Japan.<br />
<strong>Die</strong> Gruppe hatte in berlin einen<br />
reisebus gechartert und reiste<br />
morgens in Altlüdersdorf an.<br />
Dort hatte sich der betriebsleiter<br />
des <strong>PIC</strong>-Closed-Herd-Kundenbetriebs,<br />
bernd Wunderlich, bereit<br />
erklärt, den besuch aus Fernost<br />
durch die Anlage zu führen.<br />
Um den zeitlichen Aufwand <strong>für</strong><br />
die Einhaltung der Hygiene-<br />
maßnahmen (Einduschen, Umziehen)<br />
zur Absicherung des<br />
High-Health-betriebes Altlüdersdorf<br />
in überschaubarem<br />
rahmen zu halten, teilte sich die<br />
Gruppe in Altlüdersdorf.<br />
Sieben Teilnehmer fuhren weiter<br />
nach Wulkow bei Altruppin<br />
zum Piétrain-Zuchtbetrieb<br />
der <strong>PIC</strong>. Dort erläuterte <strong>Die</strong>ter<br />
Tramnitzke, verantwortlich <strong>für</strong><br />
die Produktion der Endstufeneber<br />
bei der <strong>PIC</strong> in Deutschland,<br />
alles rund um die Eber-Produkt-<br />
„Damokles-Schwert“ AutoFOM?<br />
Wie reagieren ostdeutsche <strong>Schweineproduzenten</strong><br />
auf neue Anforderungen in der Vermarktung?<br />
Auch im Osten ist die Umstellung der Abrechnungsmasken einiger<br />
nordwestdeutscher Schlachtunternehmen deutlich zu vermerken.<br />
Wenngleich in den großen Schlachthöfen noch keine Änderungen<br />
stattgefunden haben, so sind doch die Signale deutlich. Sicher geht<br />
es momentan noch darum, die Schlachtkapazitäten auszulasten.<br />
Jedoch, wie lange nehmen die Schlachtunternehmen die Verluste -<br />
oder anderes gesagt die entgangenen Gewinne - hin?<br />
<strong>Die</strong> Zusagen und Kommentare<br />
von heute<br />
können morgen längst<br />
vergessen sein. Garantien gibt<br />
es keine. Was bleibt ist der<br />
Wunsch nach fleischreichen,<br />
schweren Schweinen, die möglichst<br />
wenig kosten sollen.<br />
Zudem haben die neuen<br />
Schätzformeln schon gezeigt,<br />
dass ein großer Teil der aus<br />
dem europäischen Ausland<br />
kommenden Schweinegene-<br />
tiken von der Schlachtung<br />
überschätzt wurden. Und wer<br />
gibt schon gerne mehr Geld aus<br />
als nötig?<br />
Viele große ostdeutsche Ferkelerzeuger<br />
bedienen mäster<br />
in den alten bundesländern, die<br />
die maskenumstellung bereits<br />
getroffen hat. Da ist ein sofortiges<br />
reagieren nahezu unabdingbar.<br />
Aber auch die betriebe, die<br />
ihre Ferkel vor Ort vermarkten<br />
bzw. auch selbst mästen, gehen<br />
bereits jetzt auf die zu erwartenden<br />
Veränderungen ein.<br />
Zwar ist momentan von den<br />
hiesigen Schlachtunternehmen<br />
zu hören, dass sich an der aktuellen<br />
Abrechnung vorerst nichts<br />
ändern wird, was allerdings vielerorts<br />
nur als die ruhe vor dem<br />
Sturm betrachtet wird.<br />
besser jetzt umstellen, als später<br />
Geld verlieren. Und das sind<br />
schnell mal 6 bis 8 € je mastschwein.<br />
Geld, das gerade unter<br />
der jetzigen Situation am<br />
markt und den hohen Futterkosten<br />
dringend benötigt wird.<br />
Allerdings gilt es, den Taschenrechner<br />
sorgfältig zu bedienen.<br />
mit den Daten des vom Westfälisch-LippischenLandwirtschaftsverband,<br />
dem Deutschen<br />
20 Jahre <strong>erfolgreiche</strong> Zusammenarbeit<br />
mit PORKY Gröden<br />
Schon 20 Jahre arbeitet das<br />
Unternehmen „POr-<br />
KY Schweinezucht und<br />
mast GmbH“ in Gröden mit<br />
der <strong>PIC</strong> Deutschland GmbH<br />
zusammen.<br />
<strong>Die</strong> ersten Kontakte kamen im<br />
rahmen eines betriebsbesuches<br />
hinsichtlich einer kostenorientierten<br />
Ferkelproduktion 1990<br />
zustande. POrKY Gröden, damals<br />
noch eine Genossenschaft,<br />
war eines der ersten Unternehmen<br />
nach der Wende, wo <strong>PIC</strong><br />
Deutschland Hilfestellung in<br />
der Ausrichtung des Unternehmens<br />
auf eine marktwirtschaftliche<br />
Produktion von Ferkeln<br />
gab. Über die Weiterbildung<br />
des betriebsleiters Frank blättermann,<br />
Produktions- und<br />
Veterinärberatung bis hin zur<br />
belieferung von Jungsauen aus<br />
dem <strong>PIC</strong>-Genetikprogramm<br />
v.l.: Hinrich Leerhoff, <strong>PIC</strong>-Geschäftsführer, Jürgen Pfennig, Geschäfstführer PORKY,<br />
Heinrich Schulz, <strong>PIC</strong>-Produktionsberater und Michael Strauß, <strong>PIC</strong>-Regionalleiter Ost<br />
entwickelte sich eine <strong>erfolgreiche</strong><br />
und kontinuierliche Zusammenarbeit<br />
– immer vor dem<br />
Hintergrund einer gesamtwirtschaftlichen<br />
Ausrichtung des<br />
Unternehmens. Auf der diesjährigen<br />
Eurotier in Hannover<br />
fand sich während der erstmals<br />
durchgeführten Standparty<br />
ein würdiger rahmen, um die<br />
Urkunde und einen Präsentkorb<br />
an den Geschäftsführer<br />
Jürgen Pfennig und sein Team<br />
zu überreichen. Wir freuen uns<br />
auf eine weitere gegenseitig befruchtende<br />
Zusammenarbeit in<br />
den nächsten Jahren.<br />
MST<br />
3 7 9 8 2 6 4 1 5<br />
2 5 4 7 9 1 6 8 3<br />
6 1 8 5 4 3 2 7 9<br />
5 4 1 3 7 9 8 2 6<br />
7 9 6 2 5 8 1 3 4<br />
8 2 3 6 1 4 9 5 7<br />
9 6 7 1 8 5 3 4 2<br />
1 3 2 4 6 7 5 9 8<br />
4 8 5 9 3 2 7 6 1<br />
palette der <strong>PIC</strong> und stellte diese<br />
anhand verschiedener Eberkollektionen<br />
im Schauraum – hinter<br />
der Glasscheibe – den interessierten<br />
besuchern vor. Zuvor<br />
gab er ihnen einen Überblick<br />
über den Zuchtbetrieb, die eingesetzte<br />
Genetik, das <strong>PIC</strong>-Testsystem<br />
u. v. m.<br />
Nach ca. zwei Stunden wurden<br />
beide Gruppen ausgetauscht, so<br />
dass alle 14 Personen die möglichkeit<br />
hatten, beide betriebe zu<br />
besichtigen. Da alle mitglieder<br />
der Delegation „vom Fach“ waren<br />
– vom Farmmitarbeiter bis<br />
zum Fütterungsexperten – ergab<br />
sich ein reger Austausch zwischen<br />
den besuchern und den<br />
Vertretern der betriebe bzw. der<br />
<strong>PIC</strong> über Fragen wie die Zusammensetzung<br />
des Futters und<br />
dessen Zuteilung, Futteraufnahme,<br />
Temperaturbedingungen<br />
im Stall, Alter und Gewicht<br />
der Sauen in den einzelnen be-<br />
bauernverband und der ZmP<br />
entwickelten bundesweiten<br />
Schlachtabrechnungsvergleichs<br />
wurden mögliche finanzielle<br />
Folgen ausgewertet.<br />
Der Erlösunterschied zwischen<br />
FOm- und AutoFOm<br />
fiel recht gering aus. Jedoch<br />
wird davon ausgegangen, dass<br />
sich mäster aufgrund des gemästeten<br />
Tiermaterials oder<br />
auch weniger Aufwand <strong>für</strong> die<br />
Sortierung bewusst <strong>für</strong> die Vermarktung<br />
nach FOm entschieden<br />
haben. Und gerade hier<br />
wird es besonders wichtig, bei<br />
einer Vermarktung nach AutoFOm<br />
die passenden bauch-<br />
und Schinkengewichte zu erreichen.<br />
Nur hilft es wenig oder ist sogar<br />
der Wirtschaftlichkeit abträglich,<br />
nur den Erlös im Auge<br />
zu behalten. Höhere Schlachtgewichte<br />
bedeuten höheren<br />
Futterverbrauch. Teures Futter,<br />
das gerade zum Ende mast zunehmend<br />
schlechter verwertet<br />
reichen des Closed-Herd-betriebes,<br />
Eberverhalten etc. besonders<br />
beeindruckt waren die<br />
japanischen Kollegen von den<br />
über 28,0 abgesetzten Ferkeln je<br />
Sau und Jahr in Altlüdersdorf.<br />
Letzte, während des rundganges<br />
offen gebliebene Fragen konnten<br />
bei einem gemeinsamen Imbiss<br />
in den räumen des betriebes<br />
wird, und so die rentabilität<br />
negativ beeinflusst. Auch eine<br />
Aufwertung der Futtermischung<br />
in punkto Eiweiß und Lysin,<br />
um die bauchfleischanteile<br />
zu verbessern, verteuert die<br />
ration und verschlechtert die<br />
rentabilität.<br />
<strong>Die</strong> Aktivitäten auf Seiten<br />
der Schlachtunternehmen haben<br />
auch da<strong>für</strong> gesorgt, dass<br />
die Trendwende in der Endstufengenetik<br />
eingeläutet ist.<br />
Wenn in der letzten <strong>Zeit</strong> ein<br />
zunehmender Einsatz von<br />
Duroc-Ebern aus Dänemark,<br />
teilweise gepaart mit der dort<br />
beheimateten Sauengenetik,<br />
zu bemerken war, so gibt der<br />
ökonomische Zwang nunmehr<br />
wieder fleischreicheren Genetiken<br />
der Vorrang. Da viele<br />
große <strong>Schweineproduzenten</strong><br />
im Osten eher reserven in<br />
management, Fütterung und<br />
Gesundheit suchen, hielt sich<br />
hier sowieso die Schar derer,<br />
die dem „Trend“ folgten, eher<br />
Impressum: <strong>PIC</strong> Deutschland GmbH ∙ Ratsteich 31 ∙ 24837 Schleswig ∙ Telefon 04621 543-0 ∙ www.picdeutschland.de<br />
Verantwortlich <strong>für</strong> den Inhalt: Hinrich Leerhoff, Chefredakteurin: Barbara Berger – Gestaltung: Stamp Media / Produktion: Schmidt & Klaunig im Medienhaus Kiel<br />
Altlüdersdorf geklärt werden.<br />
Fazit des besuches war, dass viele<br />
Dinge in Japan ähnlich gehandhabt<br />
werden, es allerdings Unterschiede<br />
beim Gewicht und<br />
Lebensalter im Flatdeck sowie<br />
den Stallbedingungen gibt. Außerdem<br />
wird dort mehr Personal<br />
zur betreuung der Sauen eingesetzt.<br />
GLO<br />
gering. meist blieb es bei mehr<br />
oder weniger <strong>erfolgreiche</strong>n Versuchen.<br />
Was ausblieb, war der<br />
große boom. Denn vor dem<br />
ökonomischen Erfolg kommt<br />
das rechnen.<br />
Was aber bleibt, ist die Idee von<br />
mehr Wachstum und stabileren<br />
Ferkeln.<br />
Hier gilt als besondere Herausforderung,<br />
einen Piétrain-Eber<br />
am markt zu haben, der zum<br />
einen die geforderte Fleischfülle<br />
sichert, zum anderen aber<br />
die gewünschten Effekte wie<br />
Wachstumsvorteile, Homogenität<br />
in den Würfen und Stabilität<br />
der Ferkel vererbt.<br />
Dass dies möglich ist, zeigen<br />
die Daten und der Erfolg<br />
von Kunden, die den<br />
<strong>PIC</strong>-Piétrain 408/426 einsetzen.<br />
Da kann auch im Osten die<br />
maskenumstellung kommen.<br />
FB<br />
... und zum Schluss ein bisschen<br />
rätseln und rechnen ...<br />
5 9 2 6<br />
4 8<br />
1 8<br />
2 5 7<br />
7 9 5 3 4<br />
5 4 2<br />
4 3<br />
2 1<br />
Wer nicht weiter kommt:<br />
<strong>Die</strong> Auflösung finden Sie links!<br />
7 8 6 4<br />
die Sudoku-Ecke