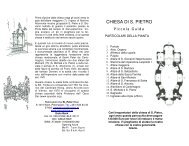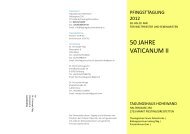Cantores Suaves ab 1.10.12. Choeur du Soleil
Cantores Suaves ab 1.10.12. Choeur du Soleil
Cantores Suaves ab 1.10.12. Choeur du Soleil
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Liebe Messbesucher!<br />
Die heutige musikalische Begleitung des Gottesdienstes bietet selten Gehörtes aus dem<br />
russischen Kulturkreis.<br />
Werke der heute aufgeführten Komponisten kennt man aus dem Konzertsaal, der Oper oder<br />
vom Ballett her; weniger bekannt ist <strong>ab</strong>er - und damit überraschend - das kirchenmusikalisches<br />
Œvre dieser Komponisten. Vieles basiert auf genuin russischen bzw. slawischen Volksmelodien,<br />
<strong>ab</strong>er auch auf Harmonien der nichtslawischen Minoritäten des alten Russlands und traditionell<br />
Kirchentonalem (zB. Liturgie des Hl. Johannes Chrysostomos). Die Chrysostomos-Liturgie ist<br />
die gebräuchlichste Messform im byzantinischen Ritus. Viele russischen Komponisten - so<br />
Rachmaninoff (1910) und Tschaikowsky (1880) - h<strong>ab</strong>en in ihren Kompositionen die Chöre dieser<br />
Liturgie vertont.<br />
Mili Alexejewitsch Balakirew (1837-1910); russischer Komponist, Pianist und Dirigent. Als<br />
Mathematik- und Klavierstudent lernte er 1855 in St. Petersburg Michael Glinka kennen und ließ<br />
sich von dessen Idee begeistern, eine nationale russische Musik zu kreieren; dies als Gegensatz<br />
zur westlichen, vor allem italienischen Musik. Es entstand das von dieser Vision beseelte<br />
„Mächtige Häuflein“ - auch „Gruppe der Fünf“ genannt - (Balakirew, Alexander Borodin, César<br />
Cui, Modest Mussorgski und Nikolai Rimski-Korsakow), dessen Mentor und Lehrer Balakirew<br />
wurde. Vom Petersburger Musikleben frustriert war er in den Jahren 1873 bis 1876 als<br />
Eisenbahnbeamter tätig; erst danach wandte er sich wieder der Musik zu und wurde ua. Dirigent<br />
der Hofsängerkapelle. 1881 erhielt er den Auftrag, die russisch-orthodoxe Liturgie musikalisch<br />
mit neuer Harmonie zu versehen. Seine Einkünfte aus der Hofsängerkapelle ermöglichten ihm<br />
ein weitgehend sorgenfreies kompositorisches Schaffen.<br />
Das „Mächtige Häuflein“ grenzte sich mit seinen musikalischen Intentionen von anderen<br />
russischen Komponisten dieser Zeit <strong>ab</strong>, die sich vorwiegend an westeuropäischen Vorbildern<br />
orientiert h<strong>ab</strong>en; zu deren bekanntesten Vertretern sind P.I.Tschaikowsky und<br />
S.W.Rachmaninoff zu zählen.<br />
Sergej Wassiljewitsch Rachmaninoff (1873-1943) erhielt seine musikalische Ausbil<strong>du</strong>ng am St.<br />
Petersburger und Moskauer Konservatorium. Zunächst vorwiegend als Konzert-Pianist tätig,<br />
förderte seine Ehefrau seine kompositorischen Ambitionen. Zwei Jahre hin<strong>du</strong>rch wirkte er<br />
überdies als erfolgreicher Dirigent am Moskauer Bolschoi-Theater. Eine Gruppe um den<br />
Komponisten Alexander Skrj<strong>ab</strong>in propagierte neue kompositorische Wege, weg von der<br />
Tonalität. Rachmaninoff konnte dem nichts <strong>ab</strong>gewinnen; so wurde er <strong>ab</strong> 1910 seines tonalen<br />
Kompositionsstils wegen zunehmend kritisiert und von Anhängern der „Schönberg“-Schule<br />
spöttisch als „letzter Romantiker“ bezeichnet.<br />
Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs waren Rachmaninoffs Tourneen <strong>du</strong>rch Europa schlagartig<br />
beendet; er konnte nur noch in Russland konzertieren.<br />
Schließlich bewogen ihn <strong>ab</strong>er die politischen Veränderungen des Jahres 1917 seine Heimat zu<br />
verlassen. Der in den USA begehrteste und bestbezahlte Klaviervirtuose seiner Zeit konnte sich<br />
dort jedoch nicht akklimatisieren; er sehnte sich zurück nach Europa. 1930 erwarb Rachmaninoff<br />
eine Villa am Vierwaldstättersee; hier fand er auch wieder zum Komponieren. Doch mit<br />
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs musste er die Schweiz verlassen und zurück in die USA gehen.<br />
Er starb in Beverly Hills, Kalifornien.<br />
Die heute zu hörenden Werke - Kyrie und Tibie paiom - stammen aus Rachmaninoffs „Liturgie<br />
des Hl. Johannes Chrysostomos" sowie das Ave Maria aus der „Vesper".<br />
Michail Michailowitsch Ippolitow-Iwanow (1859–1935). Russischer Komponist,<br />
Musikpädagoge und Dirigent. Begann als Chorkn<strong>ab</strong>e an der Isaak-Kathedrale in St. Petersburg,<br />
später Kompositionsschüler von N.Rimski-Korsakow am St. Petersburger Konservatorium. Ab<br />
1884 Dirigent des Kaiserlichen Theaters in Tiflis (Georgien); <strong>ab</strong> 1893 Professor am Moskauer<br />
Konservatorium, schließlich dessen Direktor (bis 1924). Seit 1925 Dirigent des Bolschoi-Theaters<br />
und ebenso der Russischen Choral-Gesellschaft. Politisch konnte er sich ein gewisses Maß an<br />
Un<strong>ab</strong>hängigkeit bewahren. 1922 erhielt er für seine Verdienste den Titel „Volkskünstler der<br />
UdSSR“ und den „Orden des Roten Banners der Arbeit“.<br />
Seine besonders an P.I.Tschaikowsky und N.Rimski-Korsakow orientierten Kompositionen<br />
verarbeiten häufig russische, <strong>ab</strong>er auch georgische und armenische Volksmelodien. Der heute<br />
gesungene Psalm „Bless the Lord" („Lobe den Herrn") ist ebenfalls Teil der Liturgie des Hl.<br />
Johannes Chrysostomos.