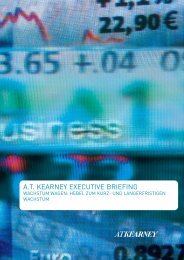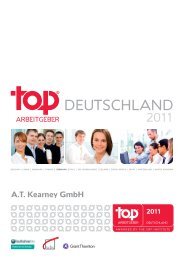Aus dem Unbundling ergibt sich substantieller Anpassungsbedarf ...
Aus dem Unbundling ergibt sich substantieller Anpassungsbedarf ...
Aus dem Unbundling ergibt sich substantieller Anpassungsbedarf ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
M. Cord / B. Hannes / B. Hartmann / J. Kellerhoff / D. Weber-Rey<br />
schaft gegeben, da der Bau konkurrierender<br />
Parallelleitungen fast nie wirtschaftlich<br />
ist. Ein Betreiber von Strom-<br />
und Gasnetzen hat somit typischerweise<br />
ein natürliches Monopol inne.<br />
In den <strong>dem</strong> Netzberieb benachbarten<br />
Geschäftsbereichen von Versorgungsunternehmen,<br />
insbesondere den Bereichen<br />
Erzeugung und Vertrieb, ist<br />
Wettbewerb hingegen möglich und von<br />
den Beschleunigungsrichtlinien auch<br />
ausdrücklich gewünscht. Die Beibehaltung<br />
der natürlichen Monopolaktivitäten<br />
Übertragung (transmission), Verteilung<br />
(distribution) und Netzbetrieb<br />
(system operation) in <strong>dem</strong>selben<br />
vertikal integrierten Unternehmen<br />
bietet jedoch – der ökonomischen<br />
Theorie nach – diesen Unternehmen<br />
einen Anreiz, ihre Monopolstellung<br />
gegen Wettbewerber und zum Vorteil<br />
konzernverbundener Unternehmen einzusetzen.<br />
Ein Netzmonopolist ist nämlich<br />
in der Lage, den funktionierenden<br />
Wettbewerb zum Nachteil fremder<br />
Netznutzer auf verschiedene Art und<br />
Weise zu stören, beispielsweise durch<br />
diskriminierende Zugangsbedingungen,<br />
prohibitiv hohe oder diskriminierend<br />
eingesetzte Netznutzungsentgelte sowie<br />
durch strategisch eingesetzte Investitionen<br />
in das bestehende Netz. <strong>Aus</strong> der<br />
Perspektive der Beschleunigungsrichtlinien<br />
stellen <strong>Unbundling</strong>-Maßnahmen<br />
ein flankierendes Mittel zur Erreichung<br />
der Richtlinienziele dar, funktionsfähigen<br />
Wettbewerb auf den Energiemärkten<br />
<strong>sich</strong>erzustellen und Diskriminierung<br />
durch vertikal integrierte Monopolunternehmen<br />
in Bezug auf<br />
wettbewerblich gestaltete wirtschaftliche<br />
Aktivitäten zu verhindern. Die<br />
Vorgaben der Beschleunigungsrichtlinien<br />
verfolgen daher die Ziele,<br />
� das natürliche Monopol „Netz“ von<br />
anderen, nicht den Bedingungen des<br />
natürlichen Monopols unterliegenden<br />
und daher wettbewerbsorientierten<br />
Unternehmensbereichen zu entflechten,<br />
� dadurch die Transparenz des Netzbereichs<br />
zu erhöhen und<br />
� – mittelbar – eine wirksame Auf<strong>sich</strong>t<br />
über Netzmonopole zu erreichen.<br />
<strong>Unbundling</strong>-Formen<br />
Mit Blick auf die Regelungsintensität<br />
lassen <strong>sich</strong> - in absteigender Reihenfolge<br />
- fünf Typen des <strong>Unbundling</strong> unterscheiden.<br />
Dieser Abschnitt skizziert<br />
zunächst die Steuerungswirkung, die<br />
den verschiedenen Typen des <strong>Unbundling</strong><br />
jeweils beigemessen wird, bevor er<br />
beschreibt, welchen Inhalt dieser Typus<br />
des <strong>Unbundling</strong> in den Richtlinien gefunden<br />
hat.<br />
Eigentumsrechtliches <strong>Unbundling</strong><br />
Die schärfste – und nach An<strong>sich</strong>t von<br />
Marktbeobachtern effektivste – <strong>Unbundling</strong>-Form<br />
ist die vollständige<br />
Trennung der Wettbewerbs- von den<br />
Monopolbereichen in der Form, dass<br />
das Eigentum an einem Versorgungsnetz<br />
in eine eigenständige Rechtspersönlichkeit<br />
überführt und jegliche Form<br />
der gesellschaftsrechtlichen Bindung zu<br />
den anderen Bereichen – also auch eine<br />
Führung als verbundenes Unternehmen<br />
– unterbunden wird. Diese Form des<br />
<strong>Unbundling</strong> wird als eigentumsrechtliches<br />
(ownership) <strong>Unbundling</strong> bezeichnet.<br />
Im Gegensatz zu allen anderen<br />
<strong>Unbundling</strong>-Formen wird <strong>dem</strong> Ownership-<strong>Unbundling</strong><br />
zugetraut, sämtliche<br />
Anreize und technischen Möglichkeiten<br />
zu diskriminieren<strong>dem</strong> Verhalten vollständig<br />
zu beseitigen. Obwohl gegen<br />
diese Form des <strong>Unbundling</strong> verschiedentlich<br />
vorgebracht worden ist, sie<br />
behindere Entscheidungen bezüglich<br />
Investitionen in das Versorgungsnetz<br />
und sei verfassungsrechtlich bedenklich,<br />
haben <strong>sich</strong>, z.B. in Großbritannien,<br />
Schweden, Norwegen und Finnland,<br />
keine signifikanten Probleme jedenfalls<br />
in der praktischen Durchführung im<br />
Zusammenhang mit dieser Form des<br />
<strong>Unbundling</strong> ergeben.<br />
Die Beschleunigungsrichtlinien schließen<br />
eine Verpflichtung zum Ownership-<br />
<strong>Unbundling</strong> ausdrücklich aus.<br />
Gesellschaftsrechtliches (legal)<br />
<strong>Unbundling</strong><br />
Weniger einschneidend ist die gesellschaftsrechtliche<br />
Trennung der Aktivitäten<br />
in voneinander unabhängige Organisationseinheiten<br />
mit eigenständiger<br />
Rechtspersönlichkeit. Diese Form wird<br />
als gesellschaftsrechtliches (legal) <strong>Unbundling</strong><br />
bezeichnet. Bei dieser Variante<br />
liegen der Betrieb und sämtliche unternehmerischen<br />
und Investitionsentscheidungen<br />
über das Netz bei einer<br />
Geschäftsleitung, die von <strong>dem</strong> Eigentümer<br />
der Erzeugungs- und Vertriebsaktivitäten<br />
unabhängig ist. Bisherige Erfahrungen<br />
mit Netzbetriebsgesellschaften,<br />
die selbst nicht Eigentümer der betriebenen<br />
Anlagen waren, haben gezeigt,<br />
dass diese Art des <strong>Unbundling</strong> bei fehlen<strong>dem</strong><br />
Einfluss der Geschäftsleitung<br />
des entflochtenen Unternehmens nur<br />
eine abgeschwächte <strong>Unbundling</strong>-<br />
Wirkung haben kann.<br />
Nach den Beschleunigungsrichtlinien<br />
müssen Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreiber<br />
zwingend bis zum<br />
1. Juli 2004 "zumindest in Rechtsform,<br />
Organisation und Entscheidungsgewalt"<br />
von <strong>dem</strong> integrierten EVU unabhängig<br />
sein. Die Richtlinien lassen es<br />
für Verteilernetzbetreiber zu, das gesellschaftsrechtliche<br />
– nicht hingegen das<br />
organisatorische und informationelle –<br />
<strong>Unbundling</strong> bis zum 1. Juli 2007 zurückzustellen;<br />
hieraus <strong>ergibt</strong> <strong>sich</strong>, dass<br />
auch Verteilernetzbetreiber bereits zum<br />
1. Juli 2004 Verpflichtungen zur Umsetzung<br />
der <strong>Unbundling</strong>-Vorgaben auf<br />
Unternehmenebene unterliegen. Die<br />
Mitgliedstaaten sind jedoch berechtigt,<br />
bei Verteilernetzbetreibern diejenigen<br />
vertikal integrierten Unternehmen, die<br />
weniger als 100.000 Kunden beliefern,<br />
von der Pflicht zum gesellschaftsrechtlichen<br />
<strong>Unbundling</strong> auszunehmen (sogenannte<br />
de-minimis-Klausel). Grund dieser<br />
<strong>Aus</strong>nahmeregelung ist, dass die<br />
Umsetzung des <strong>Unbundling</strong> einen relativ<br />
hohen Restrukturierungsaufwand<br />
erfordern würde, der ange<strong>sich</strong>ts des bei<br />
mittleren und kleinen EVU vergleichsweise<br />
geringen Diskriminierungspotentials<br />
nicht gerechtfertigt wäre. Stellte<br />
252 ZfE – Zeitschrift für Energiewirtschaft 27 (2003) 4