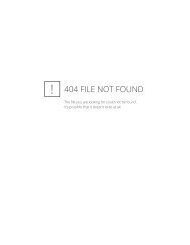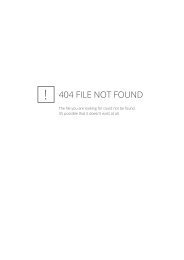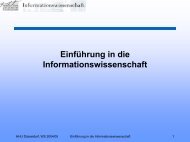Über den Tellerrand geschaut - Fachhochschule Potsdam
Über den Tellerrand geschaut - Fachhochschule Potsdam
Über den Tellerrand geschaut - Fachhochschule Potsdam
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Prof. Dr. Hartwig Walberg (<strong>Potsdam</strong>)<br />
<strong>Über</strong> <strong>den</strong> <strong>Tellerrand</strong> <strong>geschaut</strong>: Neue Strategien der Archivarsausbildung<br />
Die Berufs- und Hochschulausbildung von ArchivarInnen ist europaweit auf dem<br />
Prüfstand und gegenwärtig enormen Veränderungen unterworfen. So enthält z.B.<br />
das Gutachten des Wissenschaftsrates der Bundesrepublik für die Entwicklung der<br />
<strong>Fachhochschule</strong>n in Deutschland aus dem Jahre 2002 auch für die<br />
Archivarsausbildung wichtige Hinweise. 1 Die Schlagworte hierfür heißen:<br />
Modularisierung der Lehre, Internationalisierung/Europäisierung der Ausbildung und<br />
der Abschlüsse, inhaltlich neue Ausrichtungen und Synergieeffekte mit benachbarten<br />
und ergänzen<strong>den</strong> Disziplinen, Wettbewerb und Evaluation der<br />
Ausbildungseinrichtungen.<br />
Im folgen<strong>den</strong> möchte ich kurz darstellen:<br />
1. Gegenwärtige Ausbildungssituation in Deutschland<br />
2. Allgemeine Perspektiven<br />
3. Empfehlungen des Wissenschaftsrates der Bundesrepublik Deutschland von<br />
2002<br />
4. Modularisierung und Interdisziplinarität<br />
5. Europäisierung/Internationalisierung<br />
6. Evaluation<br />
1. Gegenwärtige Ausbildungssituation in Deutschland<br />
Die ausbildungsmäßige Zusammensetzung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in<br />
<strong>den</strong> deutschen Archiven ist trotz langjähriger Vorherrschaft verwaltungsinterner<br />
Ausbildungen in Ost- und Westdeutschland nicht einheitlich, sondern äußerst<br />
vielgestaltig! Norbert Reimann hat unterstützt von Katharina Tiemann versucht, in<br />
einer Folie seines Vortrages auf dem Deutschen Archivtag in Nürnberg 2000 dies<br />
bezogen auf <strong>den</strong> Kreis der Mitglieder des VDA darzustellen. In seinem Referat stellte<br />
er zunächst die fünf klassischen Gruppen verschie<strong>den</strong> ausgebildeter Archivare fest: 2<br />
"1. Archivare mit wissenschaftlicher Ausbildung für <strong>den</strong> höheren Archivdienst<br />
("Archivassessor", Abschluss der Archivschulen Marburg und München sowie<br />
Humboldt-Universität und Vorläufer)<br />
2. Archivare mit Fachausbildung für <strong>den</strong> gehobenen Archivdienst ("Diplomarchivare",<br />
Fachhochschulausbildung Marburg, München, FH <strong>Potsdam</strong> sowie Fachschule Franz<br />
Mehring in <strong>Potsdam</strong> zu DDR-Zeit)<br />
1<br />
http://www.wissenschaftsrat.de/texte/5102-02.pdf (Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Entwicklung<br />
der <strong>Fachhochschule</strong>n, 238 Seiten)<br />
2<br />
Für meinen Vortrag durfte ich auf das Vortragsmanuskript und die Folien zurückgreifen. Inzwischen<br />
liegt gedruckt vor: Norbert Reimann, Der Verein deutscher Archivare nach zehn Jahren deutscher<br />
Einheit. Wandel und Perspektive, in: Die Archive am Beginn des 3. Jahrtausends. Referate des 71.<br />
Deutschen Archivtags 2000 in Nürnberg, Siegburg 2002, S. 307-329.<br />
1
3. Archivare mit Fachausbildung mittlerer Dienst (Archivschule München und<br />
Archivassistentenausbildung in der DDR)<br />
4. Archivare mit Hochschulausbildung ohne Archivfachausbildung<br />
5. sonstige Ausbildung bzw. keine verwertbaren Angaben." 3<br />
Ich zitiere nun das Auszählungsergebnis: "Von <strong>den</strong> 2.062 persönlichen VdA-<br />
Mitgliedern verfügt fast exakt ein Drittel (32,7%) über eine wissenschaftliche<br />
Archivfachausbildung (Gruppe 1). Der Anteil mit der entsprechen<strong>den</strong><br />
Fachhochschulausbildung für <strong>den</strong> gehobenen Dienst (Gruppe 2) liegt mit 25,2%<br />
schon erkennbar niedriger. <strong>Über</strong> eine Ausbildung für <strong>den</strong> mittleren Dienst (Gruppe 3)<br />
verfügen lediglich 2,7%, Sehr hoch ist dagegen der Anteil der Mitglieder mit Hochschulausbildung,<br />
aber ohne Archivfachqualifikation (Gruppe 4). Er beläuft er sich auf<br />
knapp 30%. 180 Mitglieder (oder 8,7%) haben eine andere Ausbildung oder keine<br />
Angaben hierzu gemacht (Gruppe 5)." 4<br />
Nun bezieht sich dieses Bild ausschließlich auf die 2.062 VDA-Mitglieder. Das Bild<br />
würde noch deutlicher <strong>den</strong> Ausbildungsbedarf jenseits der verwaltungsinternen<br />
Archivarsausbildung zeigen, wenn eine Darstellung auf der Grundlage aller Archiv-<br />
Mitarbeiter möglich wäre. Aber auch unter <strong>den</strong> VDA-Mitgliedern ist schon deutlich,<br />
dass annähernd 40% von ihnen keine archivarischen Ausbildungen, teilweise aber<br />
andere durchlaufen haben. Die verwaltungsinterne archivarische Fachausbildung hat<br />
in <strong>den</strong> vergangenen Jahrzehnten – und das ist positiv zu vermerken – formal und<br />
auch inhaltlich zur Professionalisierung des Berufsbildes beigetragen, da sie für<br />
spezielle Archivbereiche, vor allem <strong>den</strong> staatlichen Archivdienst, das ausschließliche<br />
Ausbildungsmonopol besaß. Die verwaltungsinterne Ausbildung erreichte aber nicht<br />
alle Archivbereiche. Betroffen davon waren und sind vor allem die Kommunal-,<br />
Wirtschafts- und Medienarchive und die so genannten Wissenschaftlichen Archive<br />
(Fachgruppe 8). Dort haben sich in der Vergangenheit schon ersatzweise<br />
Ausbildungs- und Weiterbildungsstränge ausgebildet. Teilweise sind ganze<br />
Archivbereiche mit ihren Ausbildungen abgewandert wie die Medienarchive und die<br />
medizinischen Archive zur Dokumentation. (<strong>Fachhochschule</strong> Hamburg,<br />
<strong>Fachhochschule</strong> Ulm etc.)<br />
Und noch eine bedeutende Korrektur ist in Zukunft notwendig: die Ausbildung zum<br />
Diplomarchivar/Diplomarchivarin (FH) wird (wie an der <strong>Fachhochschule</strong> <strong>Potsdam</strong><br />
bereits heute) keine Ausbildung des oder zum gehobenen Archivdienst (!), sondern<br />
eine wissenschaftliche Hochschulausbildung sein. Dies ist insofern ein Unterschied<br />
zum gehobenen Dienst und zu der verwaltungsinternen Ausbildung, als<br />
Fachhochschul-Absolventen etwa im Ingenieursbereich und z.B. auch die <strong>Potsdam</strong>er<br />
FH-Absolventen des Archivstudienganges nicht zwingend <strong>den</strong> BAT-Einstieg bei BAT<br />
Vb, sondern durchaus höher bei BAT IVa oder außerhalb des öffentlichen Dienstes<br />
machen. D.h. dass FH-Absolventen genau zwischen der dem gehobenen und dem<br />
höheren Dienst entsprechen<strong>den</strong> Bezahlung nach BAT einsteigen sollten. Inzwischen<br />
gibt es sogar eine Reihe von Absolventen, die vor oder nach ihrem FH-Diplom einen<br />
anderen Hochschul-Abschluss an einer FH oder Universität absolvieren, teilweise mit<br />
Magisterabschluss oder Promotion und somit die Doppelqualifikation erwerben, die in<br />
Deutschland so viele Jahre lang die postgraduale Ausbildung des Höheren<br />
3 Ebd., S. 314f.<br />
4 Ebd., S. 315.<br />
2
Archivdienstes gekennzeichnet hat. Diese Archivare haben durchaus einen Anspruch<br />
auf Vergütung nach BAT II oder III, entsprechend dem höheren Dienst. Doch tun sich<br />
die einstellen<strong>den</strong> staatlichen Archive schwer, solche hochqualifizierten Bewerber<br />
gleichzustellen mit <strong>den</strong> Marburger Absolventen der Höheren-Dienst-Kurse, da einige<br />
Bundesländer, so auch NRW zu <strong>den</strong> Hauptträgern der auf Staatsvertrag beruhen<strong>den</strong><br />
Archivschule Marburg zählen. Wo das Laufbahnrecht eine weniger dominante Rolle<br />
spielt, so z. B. in <strong>den</strong> Kommunalarchiven, ist es eher möglich leistungsgerecht<br />
eingestuft zu wer<strong>den</strong>. Dass das Laufbahnrecht einer leistungsgerechten Vergütung<br />
seit Jahren im Wege steht, darüber ist im VDA-Arbeitskreis "DiplomarchivarInnen<br />
FH" (vormals: "AK gehobener Archivdienst") und in dem von ihm auf <strong>den</strong> Deutschen<br />
Archivtagen jährlich stattfin<strong>den</strong><strong>den</strong> Forum mehrfach berichtet wor<strong>den</strong>. Ich möchte<br />
insbesondere die Initiativen zur BAT-Problematik hervorheben, die von dem Kollegen<br />
Paul vom AsD der FES (Bonn) hierzu in der Vergangenheit vorgetragen wur<strong>den</strong>. 5<br />
2. Allgemeine Perspektiven<br />
Auf dem Deutschen Archivtag in Münster 1998 hatte mein <strong>Potsdam</strong>er Kollege Volker<br />
Schockenhoff bezüglich der allgemeinen Perspektiven der Archivarsausbildung die<br />
folgen<strong>den</strong> Forderungen aufgestellt: 6<br />
- Modularisierung der Lehrinhalte und damit Ermöglichung einer Auswahl und<br />
Zusammenstellung durch die Studieren<strong>den</strong> im Rahmen curricularer Vorgaben und<br />
nach individueller Vorbildung und angestrebtem Berufsziel; Modularisierung des<br />
Studienangebots plus Fernstudium gestattet u. a. einen früheren Berufseinstieg<br />
für die grundständig Studieren<strong>den</strong>, wenn sie vor Studierende ein attraktives<br />
Angebot erhalten, ohne die Gefahr eines Studienabbruchs und individuelle Aus-<br />
und Weiterbildung der berufstätigen Archivare<br />
- Anrechenbarkeit und <strong>Über</strong>tragbarkeit von Leistungen im europäischen<br />
Hochschulsystem (ECTS)<br />
- Einführung internationaler Abschlüsse (Bachelor, Master : BA, MA)<br />
- bilinguale Lehranteile, insb. Englisch als Unterrichtssprache, Auslandssemester<br />
für unsere deutschen Stu<strong>den</strong>ten, im Austausch dazu Anwerbung ausländischer<br />
Stu<strong>den</strong>ten<br />
- Weiterbildungsangebote für ein lebenslanges Lernen, nicht als bloße<br />
Zertifizierung sondern als berufsqualifizierendes Angebot<br />
- Und das möglichst auch in Form eines Fernstudiums unter Einsatz neuer<br />
Medien. 7<br />
Seine Forderungen zielten vor allem darauf ab:<br />
- Mehr Praxisbezug des Studiums für alle Archivbereiche – nicht nur die staatlichen<br />
zu gewährleisten,<br />
- Durchlässigkeit der Ausbildung vom "gehobenen" zum "höheren Dienst"<br />
herzustellen,<br />
- die Möglichkeit lebenslangen Lernens anzubieten,<br />
5 Hans-Holger Paul, Eingruppierung von DiplomarchivarInnen nach dem BAT, in: Die Archive am<br />
Beginn des 3. Jahrtausends. Referate des 71. Deutschen Archivtags 2000 in Nürnberg, Siegburg<br />
2002, S. 361-369.<br />
6 Volker Schockenhoff, "In die Freiheit entlassen!“ Perspektiven der deutschen Archivarsausbildung im<br />
zusammenwachsen<strong>den</strong> Europa, in: Archive im zusammenwachsen<strong>den</strong> Europa. Referate des 69.<br />
Deutschen Archivtags 1998 in Münster, Siegburg 2000, S. 311-323.<br />
7 Ebd., S. 317.<br />
3
- Internationalität durch Austausch von Studieren<strong>den</strong>, Lehren<strong>den</strong>, Lehrinhalten und<br />
-metho<strong>den</strong> zu ermöglichen<br />
- Die Ausbildung von Archivaren vorrangig an Hochschulen des allgemeinen<br />
Hochschulsystems zu bin<strong>den</strong> und damit die verwaltungsinterne Ausbildung zum<br />
Auslaufmodell zu machen. 8<br />
"Stattdessen wird von einigen der höchsten Repräsentanten des bundesdeutschen<br />
Archivwesens die laufbahnrechtliche Anerkennung der <strong>Potsdam</strong>er Ausbildung durch<br />
das Land Niedersachen als gefährliches "Einfallstor in alle Bundesländer"<br />
gebrandmarkt. Die Entwicklung und Gleichstellung einer Ausbildungsalternative für<br />
externe Fachhochschulabsolventen sei die Auflösung der verwaltungsinternen<br />
Ausbildungsmonopols im gehobenen Archivdienst. Es gefährde langfristig die<br />
Rentabilität der verwaltungsinternen Ausbildung in Marburg.<br />
Was diesen Herren offensichtlich entgangen ist, ist die Tatsache, dass dieses<br />
Einfallstor längst existiert – <strong>den</strong>n es ist nicht nur das kleine Land Niedersachsen ein<br />
Einfallstor – es ist das gesamte Europa der EU. Staatsangehörige aus anderen EU-<br />
Mitgliedsstaaten, die eine Hochschulausbildung mit einem Bachelor- oder<br />
Masterabschluss absolviert haben und Zugang zu einem reglementierten Beruf in<br />
Deutschland anstreben, - und das ist der staatliche Archivdienst – können sich<br />
zwecks Anerkennung ihres Diploms auf die Hochschuldiplomrichtlinie 89/48 EWG<br />
berufen. Die zentrale Vorschrift der Hochschuldiplomrichtlinie besteht darin, dass ein<br />
Mitgliedsstaat dem Bürger <strong>den</strong> Zugang zu einem reglementierten Beruf nicht wegen<br />
mangelnder Qualifikation verweigern darf, wenn dieser statt des vorgeschriebenen<br />
inländischen Diploms das entsprechende Diplom eines anderen EG-Staates als<br />
Nachweis seiner beruflichen Qualifikation besitzt. Die Richtlinie ist in Deutschland<br />
bereits für eine Reihe von Berufen umgesetzt – z. B. für die Lehrereinstellung in<br />
verschie<strong>den</strong>en Bundesländern.<br />
Das wird auch für die staatliche Archivausbildung erfolgen müssen. Denn das<br />
staatliche Ausbildungsmonopol als alleinige Zugangsvoraussetzung für <strong>den</strong><br />
Archivdienst ist m. E. – zumindest soweit es sich auf andere EU-Bürger bezieht –<br />
rechtswidrig." 9<br />
3. Empfehlungen des Wissenschaftsrates der Bundesrepublik Deutschland von<br />
2002<br />
In <strong>den</strong> Empfehlungen des Wissenschaftsrates der Bundesrepublik Deutschland zur<br />
Entwicklung der <strong>Fachhochschule</strong>n vom 18.01.2002 sind viele Forderungen von 1998<br />
festgeschrieben wor<strong>den</strong>: 10<br />
- Seit Gründung der <strong>Fachhochschule</strong>n im Jahre 1968 durch Beschluss der Konferenz<br />
der Ministerpräsi<strong>den</strong>ten der Bundesländer hat die Bedeutung der FHs im<br />
Hochschulsystem der Bundesrepublik ständig zugenommen. In einigen aber weitaus<br />
nicht in allen Bundesländern hat die Anzahl der FH-Studienplätze inzwischen 35 %<br />
der Gesamtzahl der Hochschulstudienplätze erreicht.<br />
8<br />
Ebd., S. 318.<br />
9<br />
Ebd., S. 318-319.<br />
10<br />
http://www.wissenschaftsrat.de/texte/5102-02.pdf (Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Entwicklung<br />
der <strong>Fachhochschule</strong>n, 238 Seiten)<br />
4
- Die Trennung des deutschen Hochschulsystems in Universitäten und<br />
<strong>Fachhochschule</strong>n wird zunehmend aufgeweicht. Sind die "alten" Diplomstudiengänge<br />
der FHs durch <strong>den</strong> Zusatz Diplom (FH) gekennzeichnet, so ist durch die Einführung<br />
von Bachelor- und Masterstudiengängen an Universitäten und <strong>Fachhochschule</strong>n eine<br />
neue Situation erreicht. Nach § 19 HRG gibt es für diese Abschlüsse keine<br />
Differenzierung mehr nach Hochschultyp.<br />
- Kooperationen zwischen Universitäten und <strong>Fachhochschule</strong>n hinsichtlich<br />
gemeinsamer Einrichtungen, gemeinsamer Studiengänge wer<strong>den</strong> nachhaltig<br />
gefordert und unterstützt<br />
- Internationalisierung der FH-Studiengänge im Blick auch auf die künftig notwendige<br />
Anwerbung ausländischer Studierender, da wegen der Alterstruktur die Anzahl der<br />
inländischen Studieren<strong>den</strong> schon ab 2008 deutlich zurückgehen werde<br />
- <strong>Über</strong>nahme von ehemals an verwaltungsinternen Ausbildungseinrichtungen<br />
angesiedelten Studiengängen (Stichwort Archivschule Marburg) in vorhan<strong>den</strong>e<br />
allgemeine Hochschulen – eine Empfehlung, der seit 1996 viele Bundesländer<br />
gefolgt sind, mit dem Ergebnis, dass sich die Studieren<strong>den</strong>zahlen an<br />
verwaltungsinternen Ausbildungseinrichtungen im Zeitraum von 1996 bis heute<br />
halbiert haben. Ich zitiere die Empfehlungen des Wissenschaftsrates:<br />
"Ein weiteres Feld der Erweiterung des Fächerspektrums sieht der Wissenschaftsrat<br />
in Studiengängen, die bislang an verwaltungsinternen <strong>Fachhochschule</strong>n angesiedelt<br />
sind. Der Wissenschaftsrat hat im Jahr 1996 Empfehlungen zur Weiterentwicklung<br />
der verwaltungsinternen <strong>Fachhochschule</strong>n gegeben und dabei besonderen Wert auf<br />
die <strong>Über</strong>führung der Ausbildungsangebote in das allgemeine Hochschulsystem unter<br />
nachhaltiger Anhebung der Qualitätsniveaus gelegt. Er begrüßt deshalb<br />
nachdrücklich, dass dieser Weg bereits in mehreren Bundesländern erfolgreich<br />
beschritten wird und dass in einigen weiteren Bundesländern eine ähnliche Reform<br />
ins Auge gefasst ist. Auch die von <strong>den</strong> verwaltungsinternen <strong>Fachhochschule</strong>n selbst<br />
zur Verbesserung der Ausbildungsqualität in Angriff genommenen Reformen – etwa<br />
die Einführung einer Diplomarbeit – sind nach Einschätzung des Wissenschaftsrates<br />
positiv zu bewerten. Gleichwohl ist vor dem Hintergrund der 10 Thesen zur<br />
Hochschulpolitik und der Empfehlungen zu <strong>den</strong> verwaltungsinternen<br />
<strong>Fachhochschule</strong>n aus dem Jahr 1996 das Gesamtbild der Entwicklung<br />
enttäuschend. Obgleich in Struktur und Qualitätsniveau der verwaltungsinternen<br />
<strong>Fachhochschule</strong>n große Unterschiede feststellbar sind, verfügen diese Hochschulen<br />
als nachgeordnete Behör<strong>den</strong> oft weder über eine hochschulangemessene<br />
Rechtsform noch über eine fachhochschulspezifische Personalstruktur. Trotz eines<br />
hohen Praxisanteils am Studium ist die Verzahnung des theoretischen Studiums mit<br />
der Praxis gering, das Fächerspektrum ist schmal, größtenteils handelt es sich um<br />
monofachliche Spezialhochschulen, die für <strong>den</strong> spezifischen Bedarf begrenzter<br />
Berufsbereiche des öffentlichen Dienstes ausbil<strong>den</strong>. Zugleich hat der Rückzug der<br />
öffentlichen Verwaltung aus einer Reihe von nicht hoheitlichen Aufgaben zu einem<br />
be<strong>den</strong>klichen Schrumpfungsprozess geführt. Eine Beschäftigungsgarantie für<br />
Absolventen der verwaltungsinternen <strong>Fachhochschule</strong>n ist ohnehin seit längerem<br />
nicht mehr gegeben. Vor diesem Hintergrund nimmt die Attraktivität der<br />
verwaltungsinternen <strong>Fachhochschule</strong>n als Ausbildungsstätten weiter ab, zusätzlich<br />
5
zur einseitigen fachlichen Struktur hat die Größe der einzelnen Einheiten bereits<br />
unterkritische Werte erreicht." 11<br />
- Einführung gestufter Studienabschlüsse durch die Einführung von dreijährigen<br />
bachelor-Studiengängen B.A. und darauf aufsetzen<strong>den</strong> Masterstudiengängen M.A.<br />
(plus 1 Jahr=vierjährig)<br />
- Das neue Hochschulrecht hat die schon seit längerem mögliche Promotion von<br />
besonders qualifizierten FH-Absolventen in Kooperation zwischen FH und Uni nun<br />
ergänzt um die ohne jedes weitere Promotionsstudium mögliche Promotion im<br />
direkten Anschluss an <strong>den</strong> M.A.. Das bedeutet 4 Jahre FH und direkt daran<br />
anschließend Promotion. Strukturierte Promotionsprogramme der kooperieren<strong>den</strong><br />
Hochschulen sollen <strong>den</strong> Anteil promovierter FH-Absolventen steigern.<br />
- Duale Studienangebote zur Integration von Lernort Hochschule und Praxis wer<strong>den</strong><br />
als besonders geeignete Lernform der FHs angesehen.<br />
- "Der Wissenschaftsrat hält ein verstärktes Engagement der <strong>Fachhochschule</strong>n in der<br />
wissenschaftlichen Weiterbildung für unverzichtbar. Eine bedeutende Rolle wer<strong>den</strong><br />
hier künftig Teilzeit-, berufsbegleitende und Fernstudienangebote in strukturierter<br />
Form spielen, die auf die spezifischen Bedürfnisse Berufstätiger zugeschnitten sind.<br />
Der Wissenschaftsrat spricht sich auch dafür aus, im Rahmen der wissenschaftlichen<br />
Weiterbildung verkürzte Bachelorstudiengänge unter Anrechnung kreditierter<br />
Berufsphasen durch die Hochschule einzurichten."<br />
Soweit der Wissenschaftsrat in seinem Papier vom Januar 2002. Wie sind diese<br />
Positionen seitdem umgesetzt wor<strong>den</strong>? Was ist neu hinzugekommen?<br />
4. Modularisierung und Interdisziplinarität<br />
In der Berufspraxis wer<strong>den</strong> bereits heute unter dem Einfluss sich ständig ändernder<br />
Rahmenbedingungen neue flexible Profile der Absolventen gefordert. Das bedeutet,<br />
dass Archivare in <strong>den</strong> verschie<strong>den</strong>sten Archivsparten einerseits Kernkompetenzen,<br />
andererseits aber spezialisiertes Wissen für ihr jeweiliges Tätigkeitsfeld z.B. im<br />
Staatsarchiv, im Wirtschaftsarchiv oder im Medienarchiv erwerben müssen. Zu <strong>den</strong><br />
Kernkompetenzen zählen vor allem: Informationstechnologische und<br />
betriebswirtschaftliche Kenntnisse, Managementfähigkeiten, Kommunikation und<br />
Präsentation etc., die für die Anwendung in der Archivwelt übersetzt wer<strong>den</strong> müssen.<br />
Die neuen Ausbildungsmodule zu <strong>den</strong> Kernkompetenzen wie auch die darauf<br />
aufsetzen<strong>den</strong> Module mit archivarischem Spezialwissen wer<strong>den</strong> vielfach<br />
interdisziplinär organisiert sein.<br />
Synergie mit Nachbardisziplinen:<br />
Was können Archivare von und mit Informatikern, Designern, Sozialpädagogen,<br />
Kulturarbeitern und Medienwissenschaftlern lernen? Die Modularisierung von<br />
Hochschulstudiengängen führt zu mehr Kooperationen benachbarter Studiengänge.<br />
Für die neuen Aufgabenstellungen der Archive z.B. in <strong>den</strong> Bereichen "digitales Erbe"<br />
und "Vernetzung der Archive durch verteilten Datenbankzugriff" wer<strong>den</strong> diese<br />
11 Ebd., S. 99f.<br />
6
Kooperationen insbesondere mit Informatikern dringend gebraucht.<br />
(Datenbanktechnologie und Webtechnologie) Für die proaktive Tätigkeit der Archive<br />
z.B. im Bereich der Nutzung und Wissensvermittlung wer<strong>den</strong> die Kenntnisse und<br />
gemeinsame Projekte der Kulturarbeiter, Sozialpädagogen, Medienwissenschaftler<br />
und Designer nützlich sein. (Ausstellungen, Stadtteilarbeit, Nutzerforschung und -<br />
betreuung)<br />
5. Europäisierung/Internationalisierung<br />
Europäisierung:<br />
Europäische und andere internationale Auslandspraktika, Auslandssemester (über<br />
Sokrates/Leonardo-Programm der EU) und gemeinsame europäische<br />
Modulentwicklung (z. B. E-Term für elektronische Archivierung) führen zu einem<br />
vertieften gegenseitigen Verständnis der Archivare und der unterschiedlichen<br />
Grundbedingungen und Arbeitsmetho<strong>den</strong> in <strong>den</strong> Mitgliedsländern. Durch<br />
gegenseitige Anerkennung im Rahmen des europaweit eingeführten Punktesystems<br />
ECTS (European Credit Point System) wer<strong>den</strong> auch im Archivbereich "europäische"<br />
Lehreinheiten entstehen, die in der Ausbildung gegenseitig verrechenbar sind.<br />
Neue Abschlüsse: Bachelor, Master und Promotion für Archivare (B.A. und M.A.)<br />
Die Formen der Ausbildung und die Abschlüsse sind unter dem Druck des Bologna-<br />
Prozesses, der die Einführung von Bachelor und Masterabschlüssen bis 2007<br />
vorsieht, gravieren<strong>den</strong> Veränderungen unterworfen. Hier sind europaweit neue auch<br />
international anerkannte Abschlüsse angestrebt. Die technischen Studiengänge sind<br />
hier wegweisend auch für die Gestaltung neuer Abschlüsse für Archivare in der<br />
Stufung: Bachelor (B.A.: 3 Jahre), Diplom (B.A. plus 1 Jahr), Master (B.A. plus zwei<br />
Jahre), Promotion auch von FH-Absolventen in Kooperation mit Universitäten nach<br />
neuem Hochschulrecht.<br />
Durch weitergehende Beschlüsse der EU-Bildungsminister sollen die B.A. - M.A.-<br />
Abschlüsse bereits bis 2005 auch in der Bundesrepublik verwirklicht sein. 12<br />
Definition: Was sind "Leistungspunkte", "Credit Points", "ECTS-Punkte"?<br />
"Leistungspunkte", "Credit Points" und "ECTS-Punkte" sind synonym. Sie<br />
beschreiben <strong>den</strong> angenommenen Arbeitsaufwand von Studieren<strong>den</strong>. Dabei<br />
entspricht ein Leistungspunkt 30 Arbeitsstun<strong>den</strong>. Das Bachelor-Studium ist so<br />
angelegt, dass Studierende bei einem Arbeitsvolumen von 40 Stun<strong>den</strong> pro Woche<br />
und 45 Arbeitswochen im Jahr das Studium in der Regelstudienzeit abschließen<br />
können.<br />
Die bislang üblichen Berechnungen für <strong>den</strong> Zeitaufwand im Studium basierten auf<br />
der Anwesenheitszeit in Lehrveranstaltungen. Diese Größe sagt aber über die<br />
Arbeitsbelastungen wenig aus: Die Vor- und Nachbereitung von<br />
Lehrveranstaltungen, der Zeitaufwand für Leistungsnachweise und die Vorbereitung<br />
auf Prüfungen gingen in diese Rechnungen nicht ein. Für eine Lehrveranstaltung von<br />
2 Stun<strong>den</strong> pro Woche bei einer Vor- und Nachbereitungszeit von 30 Minuten wurde<br />
12 nach dem Willen der Konferenz der EU-Bildungsminister in Berlin im September 2003<br />
7
die gleiche Zeit angerechnet wie für eine Lehrveranstaltung von 2 Stun<strong>den</strong> pro<br />
Woche bei einer Vor- und Nachbereitungszeit von 5 Stun<strong>den</strong>. Leistungspunkte<br />
beziehen <strong>den</strong> Arbeitsaufwand ein.<br />
B.A.-M.A. - Promotion<br />
"Im Sommersemester 2003 wur<strong>den</strong> an deutschen Hochschulen 749 Bachelorund<br />
803 Master-Studiengänge angeboten. Die gestufte Studiengangstruktur<br />
ermöglicht es <strong>den</strong> Studieren<strong>den</strong>, bereits nach drei bis vier Jahren mit einem ersten<br />
berufsqualifizieren<strong>den</strong> Abschluss, dem "Bachelor", die Hochschule zu verlassen. Die<br />
Studieren<strong>den</strong> können im Anschluss daran in einem ein- bis zweijährigen<br />
Masterstudiengang das erste Studium vertiefen, interdisziplinär erweitern oder sich<br />
spezialisieren. Die starke Zunahme der gestuften Studiengänge ist Beleg für die<br />
Bemühungen der deutschen Hochschulen um eine grundlegende Studienreform und<br />
vor allem eine stärkere Internationalisierung.<br />
Die in einer Reihe deutscher Zeitungen Ende Januar 2003 kolportierte Behauptung,<br />
deutsche Bachelor-Abschlüsse wür<strong>den</strong> in Großbritannien generell nicht anerkannt,<br />
wurde und wird von der Hochschulrektorenkonferenz mit Nachdruck zurückgewiesen.<br />
Denn sie ist schlichtweg falsch. Das ergaben HRK-Recherchen. Aus einer<br />
gemeinsamen Erklärung der vier maßgeblichen britischen Organisationen vom 29.<br />
Januar 2003 geht hervor, dass sich Inhaber von Bachelor-Abschlüssen deutscher<br />
Hochschulen wie von Hochschulen aller Teilnahmeländer des Bologna-Prozesses<br />
um die Zulassung zu Masterprogrammen an britischen Hochschulen bewerben<br />
können." 13<br />
Definition: Was bedeuten Bachelor, Master, PhD?<br />
Bachelor: Bakkalaureus, in <strong>den</strong> anglo-amerikanischen Ländern unterster<br />
akademischer Grad. Je nach Fachrichtung erhält der Titel einen unterschiedlichen<br />
Zusatz: B.A. für <strong>den</strong> Bachelor of Arts, B.Sc. für <strong>den</strong> Bachelor of Science. Ein<br />
Bachelor-Studium ist an der Universität Bielefeld i.d.R. auf eine Regelstudienzeit von<br />
drei Jahren ausgelegt und ist im Gegensatz zum Vordiplom oder zur<br />
Zwischenprüfung in herkömmlichen Studiengängen ein eigenständiger<br />
berufsqualifizierender Abschluss.<br />
Master: Mittlerer akademischer Grad zwischen Bachelor und Doctor, entspricht dem<br />
Magister, dem Diplom oder dem ersten Staatsexamen im Lehramt. Das Master-<br />
Studium, das auf dem Bachelor oder einem äquivalenten Abschluß aufbaut, ist auf<br />
eine Studiendauer von ein oder zwei Jahren ausgelegt, je nach Abschluss.<br />
Ph.D.: Anglo-amerikanischer Doktortitel. Steht für: Doctor of Philosophy in the Arts<br />
and Sciences.<br />
Beispiel:<br />
Verbundvorhaben Bachelor-/Master-Strukturen in der Lehramtsausbildung<br />
Die Niedersächsischen Universitäten haben sich zu einem Verbundvorhaben<br />
zusammengeschlossen mit dem Ziel, in der Lehramtsausbildung Bachelor-/Master-<br />
Strukturen zu entwickeln und zu erproben. Grundlage dafür sind die "Empfehlungen<br />
13 http://www.hrk.de/161.htm (letzter Zugriff: 25.10.2003)<br />
8
zur Weiterentwicklung der Lehrerbildung" der Wissenschaftlichen Kommission<br />
Niedersachsen sowie der Beschluss der Kultusministerkonferenz vom März 2002,<br />
aber auch die Empfehlungen des Wissenschaftsrates vom November 2001. Das<br />
Verbundvorhaben wird vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur und vom<br />
Kultusministerium begleitet. Die Federführung liegt bei der Universität Hannover. 14<br />
An <strong>den</strong> beteiligten Universitäten des Verbundvorhabens (Braunschweig, Göttingen,<br />
Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Ol<strong>den</strong>burg, Osnabrück und Vechta) soll der<br />
Lehrbetrieb, nach Bachelor-/Master-Strukturen zum Wintersemester 2003/2004<br />
aufgenommen wer<strong>den</strong> können.<br />
Als weiteres Mitglied ist die Universität Bremen dem Verbundvorhaben beigetreten.<br />
Die Prüfungsordnungen sollen voraussichtlich im Sommer 2003 vorliegen. 15<br />
40 europäische Staaten wollen bis 2005 ihre Studienabschlüsse angleichen. Dann<br />
soll man die Universitäten überall mit Bachelor- und Masterabschlüsse verlassen<br />
können.<br />
"Die Bildungsminister von 40 europäischen Staaten haben sich geeinigt, bis 2005<br />
einheitliche Studienabschlüsse zu schaffen. Das sei einer der «radikalsten<br />
Beschlüsse» in der europäischen Hochschulpolitik, erklärte Bundesbildungsministerin<br />
Edelgard Bulmahn (SPD) in Berlin.<br />
Bis 2005 soll in allen Ländern ein zweistufiges System für Bachelor- und<br />
Masterabschlüsse (BA und MA) eingeführt wer<strong>den</strong>. Für Deutschland bedeute dies,<br />
dass das neue Hochschulrahmengesetz in allen Ländern bis 2005 umgesetzt wer<strong>den</strong><br />
müsse, sagte Bulmahn. Die Hochschulen müssten dann BA- und MA-Studiengänge<br />
als Regelstudiengänge anbieten. Auch die gegenseitige Anerkennung von<br />
Hochschulabschlüssen solle verbessert wer<strong>den</strong>, heißt es im Abschluss-Kommuniqué<br />
der Konferenz.<br />
Bulmahn lobte die Ergebnisse der Konferenz, betonte aber, dass das System noch<br />
weiter entwickelt wer<strong>den</strong> müsse. Der Bachelor-Abschluss müsse so gestaltet<br />
wer<strong>den</strong>, dass sich die Nachfrage für BA-Absolventen auf dem Arbeitsmarkt erhöhe.<br />
Die schleswig-holsteinische Kultusministerin Ute Erdsiek-Rave (SPD) forderte, dass<br />
Deutschland bei <strong>den</strong> Reformen mehr Tempo machen müsse. Großen Ländern mit<br />
langer akademischer Tradition fielen solche Neuerungen schwerer als kleineren.<br />
Durch die Konferenz in Berlin sei aber neuer Schwung in die Debatte gekommen.<br />
«Hochschulen müssen Fesseln abgenommen wer<strong>den</strong>»<br />
Die bildungspolitische Sprecherin der Union, Katherina Reiche, warnte die<br />
Bundesregierung davor, bei der Umstrukturierung ausschließlich auf staatliche<br />
Regelungen zu setzen. Wichtig sei, dass sich diese Umstrukturierung von unten<br />
entwickele. «Die Hochschulen müssen in <strong>den</strong> Prozess eingebun<strong>den</strong> wer<strong>den</strong>», sagte<br />
Reiche. «Die angelegten Fesseln müssen <strong>den</strong> Hochschulen wieder abgenommen<br />
wer<strong>den</strong>», forderte sie.<br />
Außerdem müsse das Hochschulrahmengesetz verschlankt wer<strong>den</strong>, damit die<br />
Hochschulen international konkurrenzfähiger wür<strong>den</strong>. Die Hochschulen bräuchten<br />
14<br />
http://www.uni-hannover.de/bama-lehr/ (letzter Zugriff: 25.10.2003)<br />
15<br />
http://www.uni-hannover.de/bama-lehr/download/Faecher%20Verbund%20150903.pdf (letzter<br />
Zugriff: 25.10.2003)<br />
9
jetzt verstärkt Planungssicherheit, sagte Reiche. Deshalb seien die beabsichtigten<br />
Kürzungen beim Hochschulbau um über 12 Prozent das falsche Signal.<br />
Die Beratungen über eine gemeinsame europäische Bildungspolitik begannen vor<br />
vier Jahren im italienischen Bologna zwischen 29 Staaten. Die nächste Konferenz<br />
soll in zwei Jahren in Norwegen stattfin<strong>den</strong>. 16<br />
6. Evaluation<br />
Sowohl die Hochschulausbildungen als auch die Weiterbildungsträger durchlaufen z.<br />
Zt größer angelegte Evaluationen zur Qualitätsverbesserung. Erste Ergebnisse<br />
hierzu liegen vor.<br />
So wurde beispielsweise die <strong>Fachhochschule</strong> <strong>Potsdam</strong> und auch mein Fachbereich<br />
im vergangenen Jahr extern durch die Zentrale Evaluations- und<br />
Akkreditierungsagentur Hannover nach einem standardisierten Verfahren evaluiert:<br />
Selbstreport des Fachbereichs, externe Bestellung der Gutachter und Besuch des<br />
Fachbereichs, externer Bericht, Stellungnahme des FB zum Bericht,<br />
Maßnahmenkatalog, Beschluss der Hochschulleitung über Mittel- und<br />
Stellenzuwachs. Die Arbeit hat sich gelohnt: ein Stellenzuwachs im Bereich der<br />
Lehren<strong>den</strong> ist beschlossen und wird 2004 und 2005 schrittweise realisiert.<br />
Fazit:<br />
Die wissenschaftliche Ausbildung von Archivarinnen und Archivaren in Europa findet<br />
bereits heute überwiegend an <strong>den</strong> allgemeinen Hochschulen statt. Künftig wer<strong>den</strong> an<br />
<strong>den</strong> allgemeinen Hochschulen EU-weit die oben angezeigten Veränderungen<br />
eintreten, die sich bereits seit langem angekündigt haben. Nur so wer<strong>den</strong> in der<br />
Zukunft in <strong>den</strong> 40 Staaten der EU die gewünschte Anhebung der Absolventenzahlen,<br />
die Vergleichbarkeit der Studienabschlüsse, Internationalisierung, Studieren<strong>den</strong>- und<br />
Lehren<strong>den</strong>mobilität und allgemein anerkannte Ausbildungsziele und -abschlüsse zu<br />
erreichen sein.<br />
16 http://www.netzeitung.de/deutschland/255246.html<br />
10