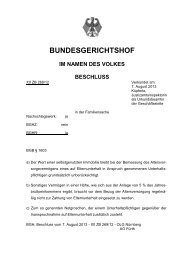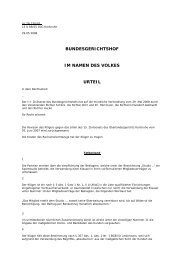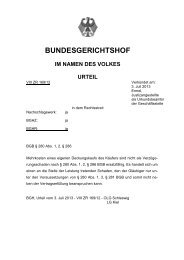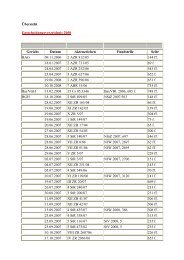AUFSÄTZE - Ja-Aktuell
AUFSÄTZE - Ja-Aktuell
AUFSÄTZE - Ja-Aktuell
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
AUFSATZ<br />
AUFSATZ ZIVILRECHT · GRUNDSTÜCKSSCHENKUNG AN MINDERJÄHRIGE<br />
gänzungspfleger (§§ 1909, 1915 BGB). 8 Vertretung ist zwingend<br />
notwendig, soweit das minderjährige Kind das siebte<br />
Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Bis zu diesem Zeitpunkt<br />
ist es geschäftsunfähig (§ 104 Nr. 1 BGB) und kann anders<br />
als durch Vertreter überhaupt noch nicht rechtsgeschäftlich<br />
tätig werden.<br />
Anders stellt sich die Lage jedoch bei Minderjährigen dar,<br />
die das siebte Lebensjahr bereits vollendet haben und deshalb<br />
beschränkt geschäftsfähig (§ 106 BGB) sind: Sie können durchaus<br />
– wenn auch nur unter bestimmten Voraussetzungen<br />
(§§ 107-113 BGB) – selbst rechtsgeschäftlich tätig werden, also<br />
Willenserklärungen abgeben und entgegennehmen. Beruht diese<br />
rechtsgeschäftliche Handlungsfähigkeit auf einer gesetzlichen<br />
Erweiterung der Geschäftsfähigkeit (§§ 112 f. BGB), so verdrängt<br />
diese die Vertretungsmacht der gesetzlichen Vertreter. 9<br />
Beruht sie dagegen darauf, dass das Geschäft dem Minderjährigen<br />
lediglich einen rechtlichen Vorteil bringt (§ 107 BGB), so<br />
besteht die Vertretungsmacht der Eltern fort. Mit anderen<br />
Worten: Ein Rechtsgeschäft, das dem Minderjährigen lediglich<br />
einen rechtlichen Vorteil bringt, kann er entweder selbst abschließen,<br />
oder seine Eltern können dies für ihn tun. 10 Dieses<br />
Nebeneinander von eigenständiger rechtsgeschäftlicher Handlungsfähigkeit<br />
des Minderjährigen einerseits, fortbestehendem<br />
Vertretungsrecht der Eltern andererseits, macht es erforderlich,<br />
bei der Lösung entsprechender Fälle stets genau darauf zu<br />
sehen, wer gehandelt hat: Die Eltern für das Kind oder das<br />
Kind selbst.<br />
Von dieser Unterscheidung hängt ab, welche Norm streitentscheidend<br />
ist: Schenken Eltern ihrem Kind ein Grundstück<br />
und treten sie hierbei zugleich als seine gesetzlichen Vertreter<br />
auf, so spielt sich der Fall im Vertretungsrecht ab. Zentrale<br />
Vorschrift ist dann nicht etwa § 107 BGB. Streitentscheidend<br />
sind die §§ 1629 II 1, 1795 II und § 181 BGB. Die intuitive<br />
gedankliche Einordnung einer solchen Konstellation ins Minderjährigenrecht<br />
ist mithin irreführend. Sollte der Minderjährige<br />
im Zuge der Schenkung dagegen selbst einmal rechtsgeschäftlich<br />
gehandelt haben, spielt sich der Fall tatsächlich<br />
ausschließlich im Minderjährigenrecht ab. Streitentscheidende<br />
Norm ist dann § 107 BGB. § 181 BGB spielt keine Rolle.<br />
Vor dem Hintergrund dieser Differenzierung erweist sich die<br />
in der Ausbildungsliteratur immer wieder zu lesende Behauptung<br />
als falsch, die Zustimmung des § 107 BGB scheitere am<br />
Vertretungsverbot des § 181 BGB. 11 Wenn Eltern in ein Geschäft<br />
einwilligen, dass der Minderjährige selbst abgeschlossen<br />
hat, dann vertreten sie ihn nicht. 12 Deshalb kann eine rein<br />
vertretungsrechtliche Vorschrift wie § 181 BGB schon aus systematischen<br />
Gründen keine Rolle spielen. 13<br />
Eine andere Frage ist es, ob vertretungsrechtliche Vorschriften<br />
wie § 1795 BGB oder auch § 1643 BGB auf die Situation<br />
der §§ 107 f. BGB wegen der Vergleichbarkeit der Gefährdungslage<br />
analog angewendet werden können. Wer die angebotenen<br />
Falllösungen durchmustert, wird eine Auseinandersetzung<br />
mit diesem (schwierigen) Problem indessen vergeblich suchen.<br />
Für § 1643 I BGB, wo es um das Erfordernis familiengerichtlicher<br />
Genehmigung geht, wird diese Frage von der h.M. bejaht.<br />
14 Dass die Vertretungsverbote des § 1795 BGB auf die<br />
Einwilligung nach § 107 f. BGB analog angewendet werden<br />
müssten, wird demgegenüber nur von Wagenitz 15 und Wolf 16<br />
vertreten. Zu Unrecht, denn die Situation, in der die maßgebliche<br />
Willensentschließung vom Minderjährigen selbst stammt<br />
und die Eltern gewissermaßen nur eine Billigung aussprechen,<br />
ist mit derjenigen nicht vergleichbar, in der die maßgebliche<br />
und vor allem: einzige Willensentschließung vom gesetzlichen<br />
Vertreter selbst stammt. Letztere Situation ist, wie nicht zuletzt<br />
562<br />
8-9/2009<br />
die Wertung des § 1629a BGB zeigt, für den Minderjährigen<br />
ungleich gefährlicher als die der §§ 107 f. BGB: § 1629a BGB<br />
ist nicht anwendbar, wenn sich der Minderjährige durch den<br />
Abschluss von Rechtsgeschäften überschuldet, die er selbst mit<br />
Einwilligung seiner Eltern abgeschlossen hat.<br />
Diese soeben beschriebene Unterscheidung ist gesondert sowohl<br />
für das Verpflichtungs- als auch für das Erfüllungsgeschäft<br />
vorzunehmen. Sie führt oft zu unterschiedlichen Ergebnissen:<br />
Während im Zuge des Verpflichtungsgeschäftes – der Schenkung<br />
– häufig der Minderjährige selbst gehandelt haben wird,<br />
dürfte das beim Erfüllungsgeschäft – der Auflassung – kaum<br />
je der Fall sein. 17 Ungeachtet ihrer Häufigkeit ist diese Kombination<br />
von Vertretungs- und Minderjährigenrecht freilich nicht<br />
zwingend. Denkbar ist auch, dass sich der Fall insgesamt nur<br />
entweder im Vertretungsrecht oder im Minderjährigenrecht abspielt.<br />
Für den Entwurf einer Prüfungsaufgabe ist diese etwas<br />
eintönige Konstellation freilich wenig attraktiv. 18<br />
II. Der Begriff des »lediglich rechtlichen Vorteils«<br />
Unbeschadet der soeben dargestellten Differenzierung hängt die<br />
Lösung entsprechender Fälle in der Sache stets von ein und<br />
derselben Frage ab: Derjenigen nämlich, ob die abgeschlossenen<br />
Rechtsgeschäfte und das Rechtsgeschäft insgesamt dem Minderjährigen<br />
lediglich einen rechtlichen Vorteil bringen oder nicht.<br />
Ist § 107 BGB streitentscheidende Norm, folgt dies bereits aus<br />
dem Wortlaut dieser Vorschrift. Bei einer Lösung über § 181<br />
BGB kann man entsprechende Erwägungen zwar nicht an den<br />
Wortlaut der Vorschrift heften, anstellen muss man sie gleichwohl.<br />
Von ihrem Ergebnis hängt nämlich ab, ob das Vertretungsverbot<br />
des § 181 BGB teleologisch zu reduzieren ist (oder<br />
nicht) und damit, ob das jeweils geprüfte Geschäft im Ergebnis<br />
wirksam ist (oder nicht). Die zentrale Bedeutung des lediglich<br />
rechtlichen Vorteils und der Umfang der hierzu ergangenen<br />
Rechtsprechung rechtfertigen es, ihm einen eigenen Abschnitt<br />
zu widmen. Aus Gründen besserer Verständlichkeit ist er der<br />
Darstellung der Rechtslage allerdings nach- und nicht vorangestellt.<br />
8 MüKo-BGB/Schmitt 5. Aufl. 2006, § 107 Rn. 8.<br />
9 Palandt/Heinrichs (Fn. 1) § 112 Rn. 1; Soergel/Hefermehl BGB, 13. Aufl. 2002, § 113<br />
Rn. 1; Medicus Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2002 Rn. 583; D. Schwab Familienrecht,<br />
16. Aufl. 2008, Rn. 560; von Tuhr Der Allgemeine Teil des Deutschen Bürgerlichen<br />
Rechts, Bd. II/1 1914, § 59 zu Anm. 144; Larenz /Wolf Allgemeiner Teil des<br />
Bürgerlichen Rechts, 9. Aufl. 2004, § 25 Rn. 70.<br />
10 Palandt/Heinrichs (Fn. 1) § 107 Rn. 1; Planck/Flad BGB, 4. Aufl. 1913, § 107,<br />
Anm. II. 4.; Staudinger/Dilcher BGB, Neubearbeitung 2004, § 107 Rn. 1; auch ein<br />
rechtlich nachteiliges Geschäft kann der Minderjährige entweder selbst abschließen<br />
(dann benötigt er die Einwilligung seiner Eltern, § 108 BGB) oder sich durch seine<br />
Eltern vertreten lassen.<br />
11 S. bei Emmerich JuS 2005, 457 (458); Fezer BGB Allgemeiner Teil, 6. Aufl. 2003,<br />
Fall 13 = S. 125 (133); Marburger Klausurenkurs BGB Allgemeiner Teil, 8. Aufl.<br />
2004, Rn. 60 ff.; Ultsch Jura 1998, 524 (526); richtig dagegen Olzen/Wank Zivilrechtliche<br />
Klausurenlehre mit Fallrepetitorium, 1994, Fall 4 = S. 145 (148 ff.).<br />
12 Anders offenbar Marburger (Fn. 11) Rn. 61, wonach die Eltern die Zustimmung<br />
gegenüber sich selbst (?) vornehmen.<br />
13 S. nur Palandt/Heinrichs (Fn. 1) § 107 Rn. 1.<br />
14 OLG Düsseldorf NJW-RR 1995, 755 (757); Palandt/Heinrichs (Fn. 1) § 107 Rn. 10;<br />
<strong>Ja</strong>uernig/ders. BGB, 12. Aufl. 2007, § 107 Rn. 8; MüKo-BGB/Huber 5. Aufl. 2008,<br />
§ 1643 Rn. 11 m. w. Nachw.; Staudinger/Knothe (Fn. 10) § 107 Rn. 43 unter Verweis<br />
auf Mot IV 1136 = Mugdan IV 602; Schulze/Dörner/Ebert BGB, 5. Aufl. 2007,<br />
§ 107 Rn. 12; Bamberger/Roth/Wendtlandt BGB, Band 2, 2. Aufl. 2007, § 107<br />
Rn. 3.<br />
15 MüKo-BGB/ders. 5. Aufl. 2008, § 1795 Rn. 10 unter Hinweis auf KG KGJ 1945,<br />
237. Auf diese Fundstelle bezieht sich Marburger (Fn. 11) Rn. 60. A.A. zu Recht<br />
Palandt/Heinrichs (Fn. 1) § 107 Rn. 1. Vorsichtiger MüKo-BGB/Schmitt § 107 Rn. 4<br />
(»ergänzende Regelungen«) und Rn. 26.<br />
16 Larenz /Wolf (Fn. 9) § 25 Rn. 33 a.E. So offenbar auch BayObLG LG NJW 2004,<br />
2264, s. bei Emmerich JuS 2005, 457.<br />
17 Sehr instruktiv daher Olzen/Wank (Fn. 11) S. 145 ff.<br />
18 S. nochmals den in Fn. 17 Genannten.